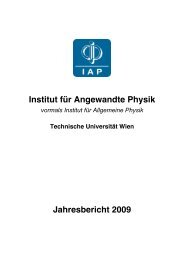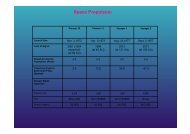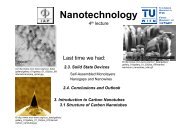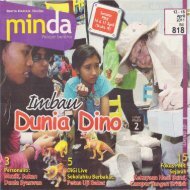DIPLOMARBEIT - IAP/TU Wien
DIPLOMARBEIT - IAP/TU Wien
DIPLOMARBEIT - IAP/TU Wien
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
II. 4. Die Satzklammer<br />
Die bedeutendste Erscheinungsform in der deutschen Syntax stellt die so<br />
genannte Satzklammer dar. Darunter wird die Zerlegung des zusammengesetzten<br />
Verbalkomplexes im deutschen (auch niederländischen) Satz verstanden. „Die<br />
Freiheiten bei der Anordnung von Prädikat und Satzgliedern sind aber nicht<br />
grenzenlos. Die unterschiedlichen Formen der deutschen Sätze lassen sich<br />
vielmehr auf ein gemeinsames Grundmuster zurückführen. Es ist geprägt von der<br />
so genannten Satzklammer.“ 20<br />
Die langjährigen Untersuchungen haben ergeben, dass die Linguisten die<br />
Satzklammer nicht konstruiert hatten, sondern dass sie eine syntaktische<br />
Erscheinung kodifizierten, die zu ihrer Zeit in der gesprochenen Sprache schon<br />
längst üblich war. 21 Ronnenberger-Sibold charakterisiert die Satzklammer<br />
folgendermaßen:<br />
Das klammernde Verfahren besteht darin, dass bestimmte<br />
Bestandteile eines Satzes so von zwei Grenzsignalen<br />
umschlossen werden, dass der Hörer aus dem Auftreten des<br />
ersten Signals mit sehr großer Wahrscheinlichkeit schließen kann,<br />
dass der betreffende Bestandteil erst dann beendet sein wird,<br />
wenn das passende zweite Signal in der Sprechkette erscheint.<br />
Diese Erscheinung dient also dazu, den Hörer bei der<br />
syntaktischen Dekodierung zu unterstützen. 22<br />
In der Fachliteratur sind für die Satzklammer außerdem noch Bezeichnungen wie<br />
prädikativer Rahmen, Satzrahmen, verbale Klammer, Rahmenkonstruktion etc.<br />
vorzufinden.<br />
In der deutschen Sprache werden drei Klammertypen unterschieden und zwar die<br />
Verbal-, Subjunktional- und die Nominalklammer, wobei die Verbal- und<br />
Subjunktionalklammer zusammengefasst werden und in der Fachliteratur unter<br />
20 DUDENREDAKTION (2005), S.874.<br />
21 Vgl. Ebert (1986), S.115.<br />
22 Ronnenberger-Sibold (1994), S.115.<br />
31