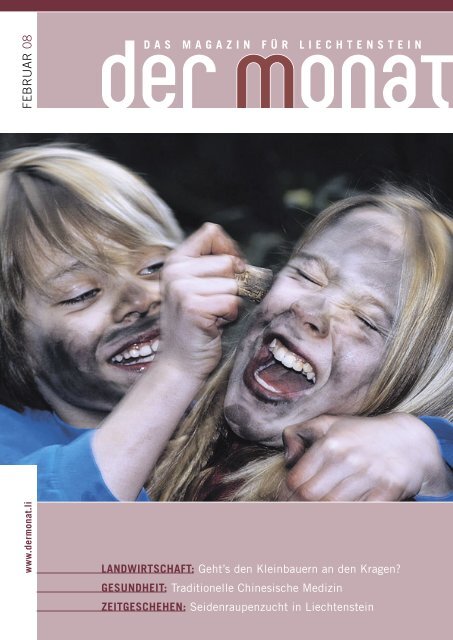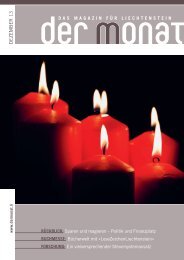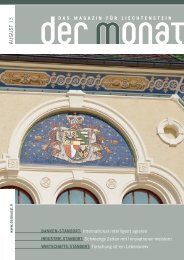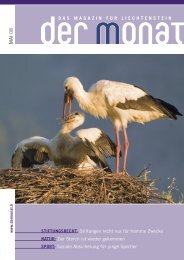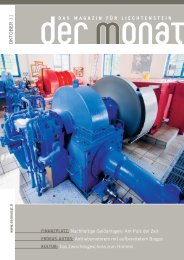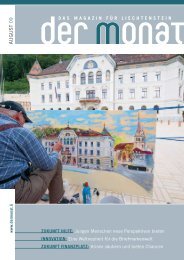FEBRUAR 08 - Der Monat
FEBRUAR 08 - Der Monat
FEBRUAR 08 - Der Monat
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>FEBRUAR</strong> <strong>08</strong><br />
www.dermonat.li<br />
LANDWIRTSCHAFT: Geht’s den Kleinbauern an den Kragen?<br />
GESUNDHEIT: Traditionelle Chinesische Medizin<br />
ZEITGESCHEHEN: Seidenraupenzucht in Liechtenstein
READY WHEN YOU ARE<br />
DER NEUE FREELANDER 2<br />
Stilvoll. Sportlich. Dynamisch. Mit unverkennbarem Design, höchstem Fahrkomfort und einer Sicherheitsausstattung, die neue<br />
Massstäbe setzt.<br />
Entdecken Sie jetzt den neuen Freelander 2 von Land Rover mit den folgenden verfügbaren Premium-Ausstattungselementen:<br />
• Terrain Response TM System mit 4 Fahrprogrammen für jede Fahrunterlage<br />
• Hill Descent Control (HDC), elektronisch gesteuerte Bergabfahrkontrolle<br />
• 9 Airbags inkl. Knieairbag für den Fahrer<br />
• Bi-Xenon Scheinwerfer mit adaptivem Kurvenlicht<br />
• Premium-Soundsystem mit 14 Lautsprechern und Dolby Pro Logic II 7.1 Surround Sound<br />
• 2.2-Liter-Td4-Turbodiesel (Commonrail), serienmässig mit Partikelfilter, 152 PS/400 Nm, 6-Gang-Schalt- oder<br />
Automatikgetriebe mit CommandShift TM<br />
• 3.2-Liter-Reihensechszylinder-Benzinmotor, 233 PS/317 Nm, 6-Stufenautomatik mit CommandShift TM<br />
• Preis ab CHF 47’700.– (Td4 mit Schaltgetriebe)<br />
Sind Sie bereit für eine Probefahrt? Wir freuen uns auf Ihren Besuch.<br />
Schaan<br />
www.garagemaxbeck.li<br />
www.landrover.ch GO BEYOND<br />
«Das Weiterbildungsprogramm der Ospelt Haustechnik<br />
bildet den Grundstein für Qualität und unser erfolgreiches<br />
Arbeiten.»<br />
Fiorenzo Vallone<br />
Ospelt Haustechnik AG<br />
Wuhrstrasse 7, FL-9490 Vaduz, Telefon +423 237 <strong>08</strong> <strong>08</strong><br />
Telefon 237 50 50<br />
Gewinner des suissetec<br />
Bildungspreises
INHALT | EDITORIAL<br />
Es geht um die Natur<br />
und ihre Ressourcen<br />
Etliche Nebenerwerbsbauern werden ihre Stalltüre<br />
für immer zuschlagen. Ist das der Sinn der Sache?<br />
PANORAMA 4<br />
LANDWIRTSCHAFT<br />
Geht’s den Kleinbauern an den Kragen? 6<br />
MEDIZIN<br />
Wie geht das? Traditionelle Chinesische<br />
Medizin 10<br />
INTEGRATION<br />
Konventionen sprengen auf hohem Niveau 12<br />
KOPF DES MONATS<br />
Astrid Meier – Fasten ist mehr als hungern 14<br />
UMWELT<br />
Verantwortung für die Arbeitswege<br />
übernehmen 16<br />
BRAUCHTUM<br />
Ruassla am Schmutzigen Donnerstag 18<br />
WIRTSCHAFT<br />
From Good to Great – Das Beispiel Google 20<br />
KULTUR<br />
Die Energie vom Föhn sollte man<br />
nutzen können 22<br />
ZEITGESCHEHEN<br />
Vor 150 Jahren<br />
Seidenraupenzucht in Liechtenstein 24<br />
JUGEND<br />
Bist du ein Checker? Jugendliche<br />
pflegen ihre eigene Sprache 25<br />
MARKT 26<br />
KUNSTDENKMÄLER<br />
Schmuckstück für Fotografen<br />
Die Kapelle St. Mamertus in Triesen 27<br />
RÄTSEL-SPASS 28<br />
AUTO<br />
Er könnte, wenn man wollte<br />
<strong>Der</strong> neue Freelander 2 setzt neue Massstäbe 29<br />
SCHLUSSPUNKT 30<br />
Grosse Umwälzungen hat die Landwirtschaft hinter<br />
sich, neue Herausforderungen stehen bevor. Die<br />
Vernehmlassung für das neue Landwirtschaftsgesetz<br />
ist abgeschlossen, wahrscheinlich<br />
noch in diesem Jahr<br />
wird sich der Landtag mit dem<br />
neuen Landwirtschaftsgesetz befassen.<br />
Professioneller soll die Landwirtschaft nach<br />
diesem Vorschlag werden. Die Kleinbauern, die oft<br />
an steilen Hängen arbeiten, fürchten um ihre Exis -<br />
tenz. Etliche Nebenerwerbsbauern<br />
werden ihre Stalltüre für immer<br />
zuschlagen. Ist das der Sinn<br />
der Sache? Wäre es nicht besser,<br />
wenn möglichst viele zur Erhaltung<br />
unserer Landschaft beitragen<br />
würden? Um die Nutzung<br />
der Natur und ihrer Kräfte geht<br />
es auch bei der Energie. Hans<br />
Frommelt, der viele Jahre als<br />
Energiefachmann bei den LKW<br />
Günther Meier<br />
arbeitete, setzt auf Windenergie<br />
Redaktion «<strong>Der</strong> <strong>Monat</strong>»<br />
als erneuerbare Energiequelle der<br />
Zukunft. Die Kraft des Föhns sollte man in Strom<br />
umsetzen können, ist oft zu hören. Wer weiss, möglicherweise<br />
gehört der Föhn in einigen Jahren nicht<br />
mehr zu den «Nöten» Liechtensteins, sondern zu<br />
den gern begrüssten Energiespendern.<br />
IMPRESSUM: 3. Jahrgang, Nr. 26, Februar 20<strong>08</strong><br />
HERAUSGEBER: Alpenland Verlag AG, Feld kircher Strasse 13, FL-9494 Schaan,<br />
Tel. +423 239 50 30, Fax +423 239 50 31, office@alpenlandverlag.li<br />
REDAKTION: Günther Meier, Tel. +423 380 09 30, Fax +423 380 09 31, redaktion@dermonat.li<br />
ANZEIGEN: Tel. +423 239 50 23, Fax +423 239 50 51, annoncen@dermonat.li<br />
GESTALTUNG: Barbara Schmed, Gutenberg AG<br />
SATZ UND DRUCK: Gutenberg AG, FL-9494 Schaan<br />
AUFLAGE: 18 000 Exemplare, monatlich<br />
ONLINE: «<strong>Der</strong> <strong>Monat</strong>» im Internet: www.dermonat.li<br />
TITELBILD: Ruassla am Schmotziga Donnschtig (Photo Malu)<br />
Feldkircherstrasse 13 | 9494 Schaan<br />
Tel. +423 239 50 50<br />
Im Zentrum · FL-9494 Schaan<br />
Telefon +423 232 07 70<br />
Fax +423 232 15 79<br />
service@foto-kaufmann.li<br />
www.foto-kaufmann.li<br />
<strong>FEBRUAR</strong> 20<strong>08</strong><br />
Anstalt<br />
3
4<br />
5<br />
PANORAMA<br />
Soll man die Kirchen<br />
dem Erzbistum schenken?<br />
Zehn Jahre nach Errichtung des Erzbistums<br />
Vaduz wird immer noch von Trennung oder von<br />
Entflechtung von Staat und Kirche geredet. Wie das<br />
in der Theorie gemacht werden könnte, weiss man.<br />
Doch schon in der praktischen Umsetzung wirft die<br />
Entflechtung von Staat und Kirche die Frage auf,<br />
wem künftig die Kirchen in unserem<br />
Liechtenstein gehören sollen:<br />
Den Gemeinden oder dem<br />
Erzbistum? Für viele eine heikle<br />
Frage, die nicht so einfach zu beantworten<br />
ist. Nicht so für Fürst<br />
Hans-Adam II. Im Neujahrsinterview<br />
mit Radio Liechtenstein<br />
sagte der Fürst: «Die Frage ist<br />
einfach, was die Gemeinden sonst<br />
mit den Kirchen machen. Wenn die Gemeinden<br />
die Kirchen für irgendwelche kulturellen Zwe cke<br />
verwenden wollen, wie Theateraufführungen oder<br />
Konzerte, dann ist es halt ein Konzerthaus. Aber da<br />
verstehe ich natürlich, dass zumindest die katholische<br />
Kirche dies dann nicht gerne unbedingt für<br />
ihre Zwecke benützt, sondern sich mit Hilfe ihrer<br />
Gemeinde lieber etwas sucht, wie dies heute bei uns<br />
die Mohammedaner oder andere machen müssen.»<br />
Foto: Günther Meier<br />
Die Zahlen des Jahres 20<strong>08</strong><br />
Die Landwirtschaft könnte ohne staatliche Beiträge – siehe Titel -<br />
thema in dieser Ausgabe – nicht überleben. Die Unterstützungs -<br />
beiträge für die Landwirtschaft belaufen sich für das Jahr 20<strong>08</strong> auf<br />
knapp 15 Millionen Franken.<br />
■ 6,0 Millionen Franken gehen an die Bauern zur Verbesserung<br />
des Einkommens<br />
■ 5,3 Millionen Franken machen die Abgeltungen für ökologische<br />
Leistungen aus<br />
■ 1,6 Millionen Franken erfordert die Berg- und Alplandwirtschaft<br />
■ 1,5 Millionen Franken werden zur Preis- und Absatzsicherung<br />
entrichtet<br />
Das Investitionsbudget 20<strong>08</strong> enthält ferner knapp 1,8 Millionen<br />
Franken für die Förderung des landwirtschaftlichen Bauwesens, für<br />
Meliorationen und Drainagen sowie für Darlehen an Junglandwirte.<br />
Foto: IPG Gutenberg Est.<br />
Müssen die Schneekanonen<br />
höher hinauf?<br />
Wenn die Klimaerwärmung anhält, kommen<br />
schwere Zeiten auf Wintersportgebiete unterhalb<br />
von 1500 m ü. M. zu. Diese Skigebiete haben in den<br />
letzten Jahren in die Aufrüstung mit Schneekanonen<br />
inves tiert. Nach einer Expertenstudie, bei der CIPRA<br />
erhältlich, ist die natürliche Schneesicherheit heute<br />
schon nicht mehr überall bei den Talstationen der<br />
Skilifte gegeben, die auf etwa 1200 m Meereshöhe<br />
liegen. Steigt die Durchschnittstemperatur der Erde<br />
weiter an, so werden in 20 bis 30 Jahren die Skige -<br />
biete in den mittleren Lagen, bei etwa 1500 m Höhe,<br />
in Schwierigkeiten kommen.<br />
Den Unterländern<br />
ist nicht alles Wurscht!<br />
Die Gampriner und Schellenberger machen es<br />
vor. Ihnen ist nicht alles «Wurscht», vor allem nicht,<br />
dass bei Vereinsanlässen immer nur Wurst auf den<br />
Tisch kommt. Die Gesundheitskommissionen der<br />
beiden Gemeinden haben eine neue Broschüre herausgegeben,<br />
die unter dem Titel «Alles Wurscht?»<br />
zum Nachdenken über gesunde und bekömmliche<br />
Nahrung anregen soll. Künftig wird es also in Gamprin<br />
und Schellenberg gesunde Alternativen zu<br />
Wurst und Brot geben, wenn Musik- oder Gesangverein,<br />
Feuerwehr oder Sportverein zu Veranstaltungen<br />
einladen. Den anderen Gemeinden wird es<br />
wohl kaum «Wurscht» sein, dass sich Gamprin und<br />
Schellenberg zu kulinarischen Hochburgen emporschwingen.<br />
Deshalb ist damit zu rechnen, dass in<br />
absehbarer Zukunft auch in anderen Gemeinden<br />
etwas Abwechslung in die Vereinstöpfe kommt. <strong>Der</strong><br />
kulinarische Wettbewerb ist entfacht.<br />
<strong>FEBRUAR</strong> 20<strong>08</strong>
Kriminalpsychologe<br />
im Einsatz für eine Bank<br />
<strong>Der</strong> österreichische Kriminalpsychologe Thomas Müller sei im<br />
Einsatz für die LGT Bank Schweiz, berichtete die Sonntags-Zeitung.<br />
Den Beizug des österreichischen Psychopathenjägers habe die Bank<br />
mit den bekannt gewordenen Amokläufen in den letzten Jahren<br />
begründet. Wie die Sonntags-Zeitung weiter berichtete, müssen sich<br />
alle Angestellten mit dem Kriminalpsychologen treffen, die mit<br />
sensib len Daten zu tun hätten. <strong>Der</strong> Sprecher der LGT Bank in Liechtenstein<br />
gab Entwarnung: Die Gespräche würden losgelöst von den<br />
Personalbewertungsprozessen geführt.<br />
ThyssenKrupp Presta<br />
baut TecCenter in Eschen<br />
Meldungen von Auslagerungen in Billiglohnländer machen in<br />
unserer Region beinahe wöchentlich die Runde. Den umgekehrten<br />
Weg beschreitet die ThyssenKrupp Presta, die derzeit in Eschen ein so<br />
genanntes TecCenter baut. In das neue Technologie-Center, das im<br />
Herbst 20<strong>08</strong> bezugsbereit sein soll, werden rund 6 Millionen Franken<br />
investiert. Zu den Aufgaben des TecCenters gehören die Entwicklung<br />
gebauter Nockenwellen und der Bau von Prototypen für Ventiltriebskomponenten<br />
für die Autoindustrie. Die Presta Camshafts Gruppe<br />
gehört zu den Weltmarktführern bei gebauten Nockenwellen, die<br />
praktisch alle Auto-Hersteller rund um den Globus bedient.<br />
Gemeinde Triesen plant<br />
ein Fest der Kulturen<br />
Integration von Ausländern gehört zu den<br />
aktuellsten Themen in Liechtenstein. Das Thema<br />
Integration steht auch im Mittelpunkt einer Veranstaltung<br />
der Gemeinde Triesen. Ein «Fest der Kulturen»<br />
soll am Samstag, 27. September 20<strong>08</strong> über die<br />
Bühne gehen. Ort des multikulturellen Geschehens<br />
wird das Spoerry-Fabrikareal<br />
sein, mit der Arena im Innenhof<br />
und dem Kulturzentrum«Gasometer».<br />
Ziel der Veranstaltung ist<br />
es laut Vorsteher Günter Mahl,<br />
Begegnungen von Menschen unterschiedlicher<br />
Herkunft zu fördern<br />
und die Besucher die Vielfalt<br />
des kulturellen Austauschs als<br />
Bereicherung erfahren zu lassen.<br />
Foto: IPG Gutenberg Est.<br />
Foto: Günther Meier<br />
1 Million Ziegelsteine für<br />
das Landtagsgebäude<br />
Das neue Landtagsgebäude in Vaduz findet<br />
Beachtung, erregt Aufmerksamkeit und ist zuweilen<br />
auch Gegenstand emotionaler Äusserungen.<br />
War es zuerst das markante Dach-Bauwerk<br />
des «Hohen Hauses», das die Gemüter beschäftigte,<br />
so sind es derzeit die Ziegelsteine, die<br />
den dominierenden Baustoff für das Gebäude,<br />
die Hangbebauung und für den «Peter-Kaiser-<br />
Platz» bilden. «Sein prägnanter Körper markiert<br />
in schlicht gehaltenem Selbstbewusstsein»,<br />
offenbarte der Münchner Architekt Hansjörg<br />
Göritz die Philosophie des Zelt-Dachs, das am<br />
15. Februar 20<strong>08</strong> eröffnet wird, «die Bedeutung<br />
des bürgerlichen Plenums als Landesparlament<br />
eines prosperierenden Berglandes und eines<br />
Fürstentums in zeitloser Elementarform.» Diese<br />
elementare Zeitlosigkeit offenbart sich auch bei<br />
den Ziegeln, die in Massen zum Einsatz gekommen<br />
sind.<br />
Für das Landtagszelt, die anderen Gebäude<br />
und den Platz sind rund 1 Mio. Ziegelsteine vermauert<br />
worden, ungefähr 30 Stück für jeden Ein -<br />
wohner. Das kann sich nur ein Kleinstaat wie<br />
Liechtenstein leisten. Doch damit nicht genug,<br />
die Ziegelsteine wurden von der Ziegelei speziell<br />
angefertigt, weil in der gewünschten Farbe kein<br />
Standardprodukt im Sortiment aufzutreiben war.<br />
Inzwischen scheint auch die Ziegelfabrik etwas<br />
Gefallen am farbigen Stein gefunden zu haben,<br />
denn künftig wird der «Landtags-Stein» als eigenständige<br />
Linie im Angebot aufscheinen. Zum<br />
Glück für Liechtenstein – wenn einmal einer<br />
unter den hunderttausenden Ziegeln in Brüche<br />
gehen sollte, kann er im Katalog bestellt werden.
6<br />
7<br />
Von Günther Meier<br />
LANDWIRTSCHAFT<br />
Geht’s den Kleinbauern<br />
an den Kragen?<br />
«Für die Agrarpolitik ist die Steigerung der Wett -<br />
bewerbsfähigkeit sowie die Sicherstellung von vergleichbaren<br />
Rahmenbedingungen mit der Schweiz<br />
ein zentrales Anliegen.» So steht es im Vernehmlassungsbericht<br />
der Regierung zu<br />
Landwirtschaftsbetriebe einem neuen Landwirtschafts -<br />
gesetz, das wahrscheinlich noch<br />
müssen in Zukunft pro-<br />
dieses Jahr dem Landtag zur<br />
fessionell und wirtschaftlich Beschlussfassung zugeleitet wird.<br />
<strong>Der</strong> Staat soll sich weiter aus der<br />
geführt werden, um staatliche<br />
aktiven Marktinterventionspoli-<br />
Zuschüsse zu erhalten tik zurückziehen, lautet die Botschaft,<br />
und sich auf die Bereitstellung<br />
von guten Rahmenbedingungen für eine<br />
nachhaltige Landwirtschaft beschränken. <strong>Der</strong><br />
Schlüssel einer erfolgreichen Agrarpolitik liege<br />
darin, gibt sich die Regierung überzeugt, eine<br />
Balance zu finden zwischen einer effizienten<br />
Agrarproduktion und der Bereitstellung von Pflege-<br />
und Umweltleistungen im öffentlichen Inter -<br />
esse. Schon im Landwirtschaftlichen Leitbild 2004<br />
war fest gelegt worden, dass der<br />
Staat in Zukunft eine «unternehmeri-sche<br />
und marktkonforme<br />
Landwirtschaft» fördere. Die<br />
daraus abgeleitete Botschaft, die<br />
mit dem neuen Landwirtschafts -<br />
gesetz umgesetzt werden soll,<br />
lautet: Landwirtschaftsbetriebe<br />
müssen professionell und wirtschaftlich<br />
geführt werden. Zugleich<br />
sind die Bauern angehalten,<br />
ihre Produktion nach den<br />
Bedürfnissen des Marktes auszurichten<br />
und wenn möglich die<br />
spezielle Nachfrage nach tierge-<br />
Liechtensteins Landwirtschaft soll zur Steigerung der Wett -<br />
bewerbsfähigkeit noch professioneller werden. Für das neue<br />
Landwirtschaftsgesetz ist die Vernehmlassung abgelaufen. Die<br />
Kleinbauern fürchten um ihre Existenz.<br />
rechten, ökologischen und regionalen<br />
Produkten zu decken. Die<br />
Rede ist auch von einer gut strukturierten,<br />
existenzfähigen Landwirtschaft,<br />
die es zu unterstützen<br />
gelte, sowie von einer «dyna -<br />
mischen Entwicklung von unternehmerischen<br />
Betrieben», wo -<br />
runter man sich sehr viel<br />
vorstellen kann, wenn man der<br />
Fantasie freien Lauf lässt.<br />
Die kleinen Nebenerwerbs -<br />
betriebe im Visier<br />
Ein Blick in die Schweiz, die in Sachen Wettbewerbsfähigkeit<br />
und Sicherstellung von Rahmen -<br />
bedingungen das entscheidende Vorbild ist, verdeutlicht<br />
was damit gemeint sein könnte. Die<br />
schweizerische Landwirtschaft sei noch geprägt von<br />
unrentablen und ineffizienten Strukturen: Zu viele<br />
und zu kleine Betriebe, zu kleine Ställe und zu
viele Traktoren! <strong>Der</strong> liechtensteinische Vernehmlassungsbericht<br />
wird nicht so deutlich, sondern<br />
deutet einen sich abzeichnenden und notwendigen<br />
Strukturwandel an, was nichts anderes heisst als<br />
eine Reduktion der bäuerlichen Betriebe.<br />
Klein- und Nebenerwerbsbauern<br />
wehren sich<br />
Im Visier hat die neue Landwirtschaftspolitik<br />
die Nebenerwerbsbetriebe, die wohl<br />
vom Segen staatlicher Landwirtschaftsförderung<br />
profitieren, aber nicht zu den erwünschten, effizient<br />
organisierten und marktwirtschaftlich orientierten<br />
Unternehmen zählen. Wie viele Betriebe unter<br />
die Kategorie Nebenerwerb fallen, steht im Vernehmlassungsbericht<br />
nicht drin, aber Landwirtschaftsminister<br />
Hugo Quaderer führte im November-Landtag<br />
aus, dass «ein beachtlicher Teil<br />
der Landwirtschaftsbetriebe von Bewirtschaftern<br />
geführt wird, die einer vollen Erwerbstätigkeit<br />
ausserhalb der Landwirtschaft nachgehen.» Aufschluss<br />
über den tatsächlichen Bestand könnte die<br />
Interpellation der Freien Liste zur Problematik<br />
«Landwirtschaft und Naturschutz» geben, die in<br />
Die Landwirtschaft steht im<br />
Wettbewerb, soll aber auch<br />
Natur- und Landschaftsschutz -<br />
aufgaben wahrnehmen.<br />
der letzten Landtagssitzung 2007<br />
eingereicht wurde und unter<br />
anderem nachfragt, wie viele<br />
Landwirtschaftsbetriebe staatliche<br />
Beiträge über das Abgeltungsgesetz<br />
erhalten. Wie der<br />
Stand der finanziellen Dinge in<br />
der Landwirtschaft ist, erläuterte<br />
ein Bericht der Regierung im<br />
Jahre 2006 zur Agrarpolitik, der<br />
von der FBP-Fraktion angefordert<br />
worden war: «Viele Landwirte<br />
wirtschafteten gut und erzielten hohe bis<br />
sehr hohe Arbeitsverdienste. Hingegen gibt es auch<br />
Betriebe, die ohne staatliche Beiträge nicht mehr<br />
existieren könnten. So erzielten die 30 Betriebe mit<br />
dem schlechtesten Resultat einen Arbeitsverdienst<br />
von durchschnittlich nur 5000 Fr. pro Jahr, haben<br />
aber Direktzahlungen in der Höhe von 57 000 Fr.<br />
erhalten.» Diesen Bezügerkreis hat der Entwurf für<br />
ein neues Landwirtschaftsgesetz im Visier. Einerseits<br />
soll der Bezügerkreis klar definiert werden,<br />
anderseits will man die Eintrittslimiten für die Förderung<br />
durch den Staat erhöhen. Bisher mussten<br />
900 Arbeitskraftstunden nachgewiesen werden, um<br />
in den Genuss staatlicher Zahlungen zu gelangen.<br />
<strong>Der</strong> Vernehmlassungsbericht geht von einer Erhöhung<br />
auf 1500 Arbeitskraftstunden aus, was Landwirtschaftsminister<br />
Hugo Quaderer nur als eine Art<br />
Versuchsballon wertete: Die Einführung einer Mindestlimite<br />
von 1500 Arbeitskraftstunden sei noch<br />
keineswegs fixiert, sondern mit dieser Zahl sei «einzig<br />
die nötige Diskussion lanciert» worden. Unterhalb<br />
der Limite von 1500 Arbeitskraftstunden liegen<br />
derzeit 16 landwirtschaftliche Betriebe, womit<br />
verständlich ist, dass sich die Klein- oder Neben -<br />
Fotos: Marco Nescher<br />
<strong>FEBRUAR</strong> 20<strong>08</strong>
8<br />
LANDWIRTSCHAFT<br />
erwerbsbauern gegen die Vorlage wehren. Es kursieren<br />
Schreiben von besorgten Kleinbauern, die<br />
ihrer Enttäuschung freien Lauf lassen. Da wird die<br />
herrschende «Agro-Diktatur» angeprangert, die<br />
keine Rücksicht auf die kleinen Betriebe nehme. Es<br />
wird prophezeit, dass eine Reihe von Betrieben eingehen<br />
werde – und viele ungelöste Fragen würden<br />
Unsicherheit und Misstrauen nach sich ziehen.<br />
Wo bleibt die typisch «liechtensteinische»<br />
Lösung?<br />
Die Regierungsvorlage rechnet damit, dass in den<br />
nächsten Jahren noch manche Stalltüre für immer<br />
zugeschlagen wird. Wie ein roter Faden zieht sich<br />
der Begriff «Strukturwandel» durch den Regierungsbericht,<br />
immer wieder ist auch die Rede von<br />
«notwendigen Betriebsentwicklungen», was nichts<br />
anderes bedeutet, als dass kleine Bauernbetriebe<br />
keinen Platz mehr haben: «Das Landwirtschaftsgesetz<br />
strebt eine moderate Beschleunigung des<br />
Strukturwandels an, ohne dass ein harter Verdrängungskampf<br />
der kleineren Betriebe eintritt.»<br />
Obwohl als Ziel genannt wird, den Strukturwandel<br />
so einzuleiten, dass kleinstrukturierte Bauernbetriebe<br />
auch in Zukunft existieren können,<br />
sucht man nach der sonst immer präsenten «typisch<br />
liechtensteinischen» Lösung. Die staatlichen<br />
<strong>FEBRUAR</strong> 20<strong>08</strong><br />
Ziel der Agrarpolitik<br />
«Ziel der Agrarpolitik und dieses<br />
Gesetzes ist es, unter Berücksichtigung auf eine<br />
gute landwirtschaftliche Praxis eine wirtschaft lich<br />
gesunde, leistungsfähige, bäuerliche Landwirtschaft<br />
in einem funktionsfähigen ländlichen<br />
Raum zu schaffen, wobei die Landwirtschaft für<br />
eine nachhaltige Nahrungsmittelproduktion verantwortlich<br />
ist und zur Krisenvorsorge beiträgt.»<br />
(Aus dem Zweckartikel des neuen Landwirtschaftsgesetzes)<br />
Mittel sollen dort eingesetzt werden, lautet die<br />
Botschaft des neuen Landwirtschaftsgesetzes, «wo<br />
eine möglichst hohe Wirkungseffizienz erzielt werden<br />
kann.» Im Landwirtschaftlichen Leitbild 2004<br />
gehörte noch die «Pflege und Erhaltung der Kulturlandschaft»<br />
zu den obersten Zielen, die nun<br />
anderen Zielen untergeordnet werden: Hoher<br />
Markterlös, hohe Wertschöpfung, kostengüns tige<br />
Marktleistungen, hohe Wirkungseffizienz – alles<br />
Begriffe, die überall dort Verwendung finden, wo es<br />
um Gewinnmaximierung geht. Bei unserer Landwirtschaft,<br />
das sollte nicht vergessen werden, geht<br />
es aber auch um die Erhaltung der Natur. |
PUBLIREPORTAGE<br />
Centrum Bank<br />
Ihr Partner in Vermögensfragen<br />
<strong>Der</strong> Name der Bank spiegelt die Philosophie wider: Im Cent -<br />
rum stehen unsere Kunden. Die Centrum Bank, gegründet 1993,<br />
führt als moderne Privatbank eine Tradition weiter. Diese begann<br />
1925, als Ludwig Marxer in Vaduz mit einer Rechtsanwaltskanzlei<br />
den Grundstein legte. Bis heute ist die Marxer Familienstiftung<br />
Mehrheitsbesitzerin der Centrum Bank.<br />
Als Partnerin Vermögensfragen bündeln wir Spezialwissen in einer<br />
Hand. Unsere Privatbank ist Teil eines Kompetenzzentrums: Dazu<br />
gehören Marxer & Partner als die grösste Rechtsanwaltskanzlei<br />
Liechtensteins, die Confida Treuhand- und Revisions-AG, in der<br />
Unternehmens- und Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Immo -<br />
bilienfachleute bereit stehen. Mit internationalem Wissen und<br />
Können. Jedes der drei Unternehmen kann zusätzlich auf ein internationales<br />
Netzwerk zurückgreifen. Damit sind wir wie geschaffen<br />
für die Verwaltung von Vermögen reicher Familien im Sinne eines<br />
Family Office.<br />
Das Vertrauen von Mensch zu Mensch ist im Private Banking durch<br />
nichts zu ersetzen. Privatkunden und wohlhabende Familien hatten<br />
noch nie so viele Möglichkeiten für Ihr Vermögen. Das Interesse am<br />
Kunden als Mensch, Transparenz bei Produkten und Kosten, Unabhängigkeit<br />
bei der Wahl der für jeden Kunden ganz individuell passenden<br />
Anlagestrategie, das macht den Unterschied. Vermögensverwaltung<br />
und Anlageberatung für anspruchsvolle private und<br />
institutionelle Anleger sowie Intermediäre – national wie international<br />
– zählen zum Kerngeschäft der Privatbank im Herzen von Vaduz.<br />
Vermögen über Generationen zu entwickeln, sorgsam zu sichern<br />
und grenzüberschreitend in den verschiedensten Ländern weiter -<br />
zuentwickeln ist eine unserer Stärken. Eine zweite sind die tiefen<br />
Wurzeln im Finanzplatz Liechtenstein.<br />
Ihr Stefan Laternser<br />
Dieter Musielak, Chief Investment<br />
Officer, Stefan Laternser, CEO,<br />
Matthias Trösch, Leiter Operations &<br />
Services<br />
Centrum Bank AG<br />
Kirchstrasse 3<br />
Postfach 1168<br />
FL-9490 Vaduz
10<br />
11<br />
Von Marco Ospelt<br />
MEDIZIN<br />
Wie geht das? Traditionelle<br />
Chinesische Medizin<br />
Im Jahr 2006 habe ich meine<br />
Grundversorger-Praxis aufgegeben, meinen Praxisstandort<br />
an die Dröschistrasse 9 in Triesen verlegt<br />
und arbeite seit September jenen Jahres ausschliesslich<br />
nach den Methoden der Traditionellen Chinesischen<br />
Medizin. In der Praxis arbeite ich mit guten<br />
technischen, kommunikativen Hilfsmitteln, aber<br />
allein. Das heisst, ich bediene selbst das Telefon und<br />
vergebe Termine. Nach der Behandlung räume ich<br />
auch selber auf und bereite das Zimmer für den<br />
nächsten Patienten vor.<br />
Warum chinesische Medizin?<br />
Wenn sich ein Patient anmeldet,<br />
reserviere ich für die erste Behandlung eine Stunde.<br />
Die Befragung des Patienten nach seinen Beschwerden<br />
und Lebensumständen, die Erhebung der<br />
Befunde durch Betrachtung, in typischer Weise<br />
zum Beispiel der Zunge, die durch Farbe und<br />
Form ihres Körpers und ihres Belags, und durch<br />
Betastung der Pulse, welche durch ihre Qualität<br />
Rückschlüsse auf energetische Veränderungen im<br />
Körper erlauben, ergibt sich die «chinesische»<br />
Dia g nose. Diese schafft Klarheit darüber, welche<br />
energetischen Entgleisungen vorliegen und welche<br />
Akupunkturpunkte das Gleichgewicht wieder herstellen.<br />
Die Zahl der Nadeln schwankt zwischen<br />
zwei bis maximal 12. Das Stechen der Nadeln<br />
schmerzt eigentlich nicht; wohl aber entsteht ein<br />
so genanntes «Da-Qi-Gefühl». Das ist ein ziehendes<br />
Gefühl am Akupunkturpunkt, welches dadurch<br />
hervorgerufen wird, dass die Leitbahn (der Meri -<br />
dian) durch die Nadel energetisch stimuliert wird.<br />
Die Nadeln liegen dann während etwa 30 bis 40<br />
Minuten, sodass der Patient für diese erste Behandlung<br />
mit 1 bis 2 Stunden rechnen muss. Die nächs -<br />
Die europäische Schulmedizin und die Traditionelle Chinesische Medizin haben<br />
grosse Unterscheidungsmerkmale. Marco Ospelt hat als praktizierender Arzt<br />
nach europäischem Muster und als Anwender der Traditionellen Chinesischen<br />
Medizin den Einblick in beide Gebiete.<br />
ten Behandlungen dauern dann jeweils eine Stunde.<br />
Im Anschluss an diese Behandlung überlege<br />
ich mir aufgrund der erhobenen Befunde und der<br />
Wirkung der Akupunktur, welche pflanzlichen<br />
Substanzen den Heilungsprozess<br />
unterstützen und die Konstitu - Die chinesischen Ärzte ver-<br />
tion des Patienten stärken könnstehen<br />
den Menschen als<br />
ten. Diese Substanzen werden als<br />
Tee aufgelöst oder auch in Tablet- ein energetisches Gefüge,<br />
tenform gepresst eingenommen.<br />
Unsere moderne, naturwissen-<br />
eingebettet in die universale<br />
schaftlich begründete Medizin Rhythmik von Yin und Yang<br />
ist eine somatische, d.h. auf den<br />
Körper bezogene Wissenschaft. Die Gegenstände,<br />
mit denen sie es zu tun hat und in die sie den Menschen<br />
einteilt, sind etwas Gegenständliches, Stoff -<br />
liches, Materielles. Die gedanklichen Voraussetzungen<br />
dazu schuf Isaac Newton im 17. Jahrhundert<br />
mit seinem überzeugenden, umfassenden, mechanistischen<br />
Weltbild. Daraus entwickelte sich ein<br />
sehr funktionstüchtiges, mechanisches Modell des<br />
Körpers. Kranksein ist mit morphologischen, messbaren<br />
Veränderungen verknüpft und wird als<br />
Fehlfunktion von physikalisch-chemischen und<br />
bio logischen Mechanismen angesehen, die korrigiert<br />
werden müssen. Diese Medizin eignet sich vor<br />
allem für Krankheiten, die sich als körperliche<br />
Veränderungen manifestieren, für fortgeschrittene,<br />
ernste, oft lebensgefährliche Krankheiten.<br />
Häufig sind aber Krankheiten<br />
und Beschwerden nicht mit messbaren Strukturveränderungen<br />
verbunden. Oder der Grund einer Fehlfunktion<br />
ist nicht immer so gut bekannt, dass eine<br />
rationale Behandlung möglich wäre. Lassen sie mich<br />
das dokumentieren am Beispiel eines Gesprächs<br />
zwischen einem Grundversorger (Dr. Kissling, Her-
Die «chinesische» Diagnose<br />
schafft Klarheit darüber, welche<br />
energetischen Entgleisungen<br />
vorliegen und welche Akupunkturpunkte<br />
das Gleichgewicht<br />
wieder herstellen.<br />
ausgeber des Schweizerischen<br />
Fachblatts für Allgemeinmedi -<br />
ziner und Grundversorger) und<br />
einem Vertreter des Regionalen<br />
Ärztlichen Dienstes RAD der Invalidenversicherung<br />
des Kantons<br />
Zürich. Dr. Kissling fragt: «Bei<br />
diesen Menschen, die den Anforderungen<br />
der modernen Berufswelt<br />
nicht mehr genügen, können<br />
wir Hausärzte meistens keine<br />
spezifisch messbare und mit Zahlen dokumentierbaren<br />
Befunde zu den Fragen auf dem IV-Bericht<br />
beschreiben. Vielmehr liegt der Invalidität eine Vielzahl<br />
von ineinander übergreifenden persönlichen<br />
und kontextuellen Gründen zugrunde. Wie siehst<br />
Du dieses Problem als RAD-Arzt?» Und der Befragte<br />
antwortet: «Etwas überspitzt gesagt sind deshalb<br />
diese Krankheiten, die sich nicht durch klare Befunde<br />
dokumentieren lassen, keine Krankheiten.»<br />
Was steckt dahinter?<br />
Die pathogenetische Herangehensweise<br />
der Schulmedizin (die sich ausschliesslich<br />
mit der Entstehung und Behandlung von<br />
Krankheiten beschäftigt) gleicht im Bild der von<br />
Antonovsky begründeten Salutogenese dem Versuch,<br />
Menschen mit hohem Aufwand aus einem<br />
reissenden Fluss zu retten, ohne sich Gedanken da -<br />
rüber zu machen, wie sie da hineingeraten sind und<br />
warum sie nicht besser schwimmen können. Die<br />
Salutogenese hingegen (die eher danach fragt, wie<br />
es Menschen gelingt, trotz aller Hindernisse relativ<br />
gesund zu bleiben) sieht den Fluss als den Strom des<br />
Lebens: Niemand geht sicher am Ufer entlang. Die<br />
Frage ist vielmehr: Wie wird man, wo immer man<br />
Foto: Marco Nescher<br />
sich in dem Fluss befindet, ein guter Schwimmer?<br />
Dieser Frage kommt die Traditionelle Chinesische<br />
Medizin sehr nahe. Denn sie ist eine funktionale<br />
Wissenschaft. Das bedeutet, dass bei ihr lebendige<br />
Abläufe, Lebensfunktionen, aktuelles biologisches<br />
oder psychisches Geschehen im Mittelpunkt der<br />
Aufmerksamkeit stehen. Die chinesischen Ärzte<br />
verstehen den Menschen als ein energetisches<br />
Gefüge, eingebettet in die universale Rhythmik von<br />
Yin und Yang. Gesundheit bedeutet das harmonische<br />
Fliessen des energetischen Potentials, welches<br />
die Chinesen Qi (zu übersetzen etwa als «Lebensenergie»)<br />
nennen. Deshalb kann eine Behandlung<br />
nach den Prinzipien der traditionellen chinesischen<br />
Medizin sehr gut ergänzend zur Schulmedizin und<br />
in vielen Fällen auch alleine eingesetzt werden.<br />
Denn beide Medizin-Systeme haben ihre spezifischen<br />
Vorzüge und Grenzen. |<br />
Zur Person<br />
Dr. Marco Ospelt hatte bis 2006 eine medizinische<br />
Grundversorger-Praxis in Triesen. Seither arbeitet er ausschliesslich<br />
nach den Methoden der Traditionellen Chinesischen Medizin.<br />
<strong>FEBRUAR</strong> 20<strong>08</strong>
12<br />
13<br />
Von Günther Meier<br />
INTEGRATION<br />
Konventionen sprengen<br />
auf hohem Niveau<br />
Als ein Gast in unverwechselbarem Dialekt eine<br />
«Lady» bestellte, zuckte Sandra Lorber zusammen.<br />
«Wenn der Kerl eine Dame sucht», schoss es der<br />
Kellnerin durch den Kopf, «dann sollte er sich<br />
anderswo melden.» Inzwischen weiss sie, dass die<br />
Bestellung des Mannes einem kleinen Bier im Offenausschank<br />
galt. Auch über andere Besonderheiten<br />
der liechtensteinischen Gastronomie kennt sie<br />
sich bestens aus. Die Absolvierung des Wirtefachkurses<br />
und die mit Erfolg bestandene Wirteprüfung<br />
lassen daran keine Zweifel. Situa-<br />
Die Deutschen Sandra Lorber tionen wie in Vaduz erlebte Sandra<br />
Lorber am ersten Arbeitstag<br />
und Stephan Forsil bringen auch an anderen Orten, denn<br />
internationales Flair in die nach ihrer Ausbildung in der<br />
deutschen Gastronomie zog es sie<br />
Gastro-Szene Liechtensteins nach Portugal, in die Schweiz<br />
und nach Österreich. Geprägt<br />
durch die Gastro-Grundkenntnisse in Deutschland,<br />
die in anderen Ländern erweitert wurden, bringt sie<br />
internationales Flair in die Gastro-Szene. Liechtensteins<br />
Gastronomie ist durch ihre Zuwanderung um<br />
einen Farbtupfer strahlender geworden.<br />
Die deutsche Gastronomie wirft im Ausland keine hohen Wel-<br />
len. Bei Sandra Lorber und Stephan Forsil im Vaduzer «Luce»<br />
verbinden sich Fachkenntnisse mit herzlicher Gastlichkeit. Ein<br />
sympathischer Integrationsgewinn für unser Land.<br />
Mit deutscher Gründlichkeit<br />
neue Elemente ausloten<br />
<strong>Der</strong> Geschäftsführerin im «Luce» steht Küchenchef<br />
Stephan Forsil zur Seite, auch er ein erfreulicher<br />
«Wandergewinn» für Liechtenstein und seine Gas -<br />
tronomie. Die teilweise unkonventionellen Kreationen,<br />
die der Jungkoch auf die Teller zaubert,<br />
zeichnete der Gastro-Führer Gault-Millau im vergangenen<br />
Jahr mit 13 Punkten aus. Die kulinarischen<br />
Tester befanden, dass Stephan Forsil mit<br />
seiner kreativen und mediterranen Kochkunst<br />
Konventionen sprengen wolle. Er selbst, der nach<br />
seiner Kochlehre in Deutschland<br />
an verschiedenen bekannten Orten<br />
bei hoch dekorierten Köchen<br />
das Handwerk verfeinerte, gibt<br />
sich bescheidener: Zwar ist für<br />
ihn diese Auszeichnung eine Verpflichtung,<br />
auf diesem speziellen<br />
Weg weiterzugehen, aber an ers -<br />
ter Stelle steht für ihn die Zufriedenheit der Gäste,<br />
die Gefallen finden an den mutigen Kreationen,<br />
welche die traditionelle Küche mit neuen Elementen<br />
erweitert. Während Stephan Forsil kreativ, aber<br />
mit deutscher Gründlichkeit die Möglichkeiten der<br />
internationalen, mediteran angehauchten Küche<br />
auslotet, geht Sandra Lorber im Service mit zurückhaltender<br />
Herzlichkeit auf die kulinarischen Wünsche<br />
der Gäste ein – jeder in seinem Bereich mit<br />
meisterlichem Können.<br />
Arbeitsplatz in Liechtenstein,<br />
Wohnsitz in der Schweiz<br />
Sandra Lorber und Stephan Forsil begegneten einander<br />
im Vaduzer Restaurant «Residence». Wie sie<br />
dorthin gelangten, gehört zu den Launen des persönlichen<br />
Schicksals. Gleichzeitig illustriert ihr<br />
beruflicher Werdegang in Liechtenstein die besondere<br />
Ausprägung der liechtensteinischen Ausländerund<br />
Integrationspolitik. Auf der Suche nach einem<br />
inte ressanten Arbeitsplatz in einem renommierten<br />
Hotel nahm die Hotelfachfrau Sandra Lorber eine<br />
Stelle im Vaduzer «Sonnenhof» an. Das strenge Ausländergesetz<br />
stellte die Kurzaufenthalterin schon<br />
nach einem Jahr wieder über die Grenze. Die<br />
Schweiz mit bilateralen EU-Verträgen und einem<br />
Mangel an gelernten Fachkräften in der Gastro no -<br />
mie nahm sie mit offenen Armen auf. Liechtenstein
und damit verbundene persönliche Gründe zogen<br />
sie nach Ablauf der gesetzlichen Frist wieder nach<br />
Vaduz, diesmal ins «Residence». Aber Liechtenstein<br />
ist für Sandra Lorber nur Arbeitsort, den Wohnsitz<br />
musste sie in der benachbarten Schweiz nehmen.<br />
Stephan Forsil, den ein Berufskollege in unser Land<br />
lockte, hatte mehr Glück. Schon bei seiner ersten Bewerbung<br />
im Rahmen der EWR-Auslosung erhielt er<br />
die Aufenthaltsbewilligung, nachdem er vorher den<br />
Wohnsitz ebenfalls in die Schweiz verlegen musste.<br />
Gastronomie auf hohem Niveau<br />
Die typisch deutsche Gastronomie<br />
haben Sandra Lorber und Stephan Forsil nicht<br />
nach Liechtenstein gebracht. Aber die positiven<br />
Eigenschaften, die den Deutschen nachgesagt werden,<br />
dringen trotz ihres internationalen Erfahrungsschatzes<br />
in ihre Gastronomie-Vorstellungen<br />
ein. Kompetenz in der Küche und im Service ist<br />
für sie ein Muss. «Mir ist sofort das sehr hohe Ni-<br />
Bauchgefühle<br />
Integration hat auch etwas mit Gefühl zu tun. Mit<br />
Bauchgefühl. Wir wollen das Thema Integration von Ausländern von<br />
der Gefühlsseite her betrachten. Diesmal mit den beiden Deutschen<br />
Sandra Lorber und Stephan Forsil in unserer Serie.<br />
Ein gutes Gespann – Sandra<br />
Lorber mit zurückhaltender<br />
Herzlichkeit, Stephan Forsil<br />
mit mutigen Kreationen.<br />
veau der Gastronomie in Liechtenstein<br />
aufgefallen», erinnert<br />
sich Sandra Lorber an die ersten<br />
Erfahrungen. Entsprechend anspruchsvoll<br />
sind auch die Gäste,<br />
die regelmässig in Liechtenstein<br />
oder in der weiteren Umgebung<br />
eine Gastronomie auf hohem<br />
Niveau geniessen. Die Gäste haben Vergleiche und<br />
erwarten Service wie Küche nach diesen Ansprüchen.<br />
Im «Luce» sollen die Gäste auf ihre Rechnung<br />
kommen, lautet die ungeschriebene Hausregel.<br />
Stephan Forsil kocht aus Leidenschaft, versucht tatsächlich<br />
immer wieder Konventionen zu sprengen,<br />
was den gehobenen Ansprüchen der Gäste entgegenkommt.<br />
Hohe Kochkunst mit frischen Produkten,<br />
und das zu vernünftigen Preisen!<br />
Foto: Günther Meier<br />
Integration vorerst noch eine<br />
Einbahnstrasse<br />
Von der deutschen Mentalität der Sorgfalt, der<br />
Arbeitsmoral und der Flexibilität können die Liechtensteinerinnen<br />
und Liechtensteiner im «Luce» profitieren.<br />
Die offizielle Integration in Liechtenstein<br />
ist aber vorerst noch eine Einbahnstrasse. Liechtenstein<br />
schätzt die beiden Deutschen als Arbeitskräfte<br />
und jetzt auch als Unternehmer. Eine Wohnsitznahme<br />
aber bleibt verwehrt, ausser das Glück ist auch<br />
Sandra Lorber so hold bei der EWR-Auslosung wie<br />
Stephan Forsil. Neben diesen behördlichen Restriktionen<br />
aber gibt es die persönliche Integration, die<br />
beiden geglückt ist. Sie fühlen sich als Gastgeber in<br />
Liechtenstein wohl, wundern sich inzwischen nicht<br />
mehr darüber, dass die meisten Leute einfach «Du»<br />
sagen und schätzen es, wenn die Gäste nicht nur<br />
über Essen und Trinken reden wollen. |<br />
<strong>FEBRUAR</strong> 20<strong>08</strong>
14<br />
KOPF DES MONATS<br />
Astrid Meier –<br />
Fasten ist mehr als hungern<br />
Die Fastenzeit nach der stürmischen Fasnacht<br />
ist für viele willkommener Anlass zum kurzfristigen<br />
Umdenken. Die einen schwören dem Alkohol für<br />
einige Wochen ab, andere versuchen mit Fasten<br />
oder Diät auch noch die von<br />
den Festtagen übrig gebliebenen<br />
Speckröllchen zu beseitigen.<br />
Be weggründe gibt es viele. Auch<br />
die Möglichkeiten, in unserem<br />
Schlaraffenland den einen oder anderen Verzicht<br />
zu üben, scheinen fast endlos zu sein. Wer nicht nur<br />
sein Gewissen beruhigen will, sondern die Weichen<br />
seiner Ernährung in Richtung Gesundheit stellen<br />
möchte, sollte sich von Fachleuten<br />
beraten lassen. Dass ein gesunder<br />
Geist nur in einem gesunden<br />
Körper wirken kann und<br />
nur ein gesunder Körper einen<br />
gesunden Geist walten lässt, ist<br />
in unseren Breitengraden zum<br />
Allgemeingut geworden. Aber,<br />
so weiss die diplomierte Ernäh-<br />
Astrid Meier-Guldimann rungsberaterin Astrid Meier-<br />
Dipl. Ernährungsberaterin SHS Guldimann aus Erfahrung, das<br />
Wissen über gesunde Ernährung<br />
ist nicht sehr weit verbreitet. Allerdings ist es heute<br />
nicht einfach, aus dem riesigen Nahrungsmittel -<br />
angebot, das teilweise mit grossem Aufwand beworben<br />
wird, die richtige Auswahl zu treffen. Zudem<br />
haben sich die Essensgewohnheiten in unserer<br />
Gesellschaft stark verändert, was dem einzelnen<br />
Körper nicht immer zum Vorteil gereicht.<br />
Leistungsfähigkeit mit bewusster<br />
Ernährung<br />
«Wir leben nicht, um zu essen, sondern wir<br />
essen, um zu leben», zitiert Astrid Meier den Philosophen<br />
Sokrates. Eine nicht den Bedürfnissen des<br />
Körpers angepasste Ernährung kann längerfristig<br />
zu Reaktionen des Organismus und letztlich zu<br />
Krankheiten führen. «Mit einer bewussten Ernährung<br />
hingegen kann man die körperliche und geis -<br />
tige Leistungsfähigkeit massgeblich beeinflussen,<br />
<strong>FEBRUAR</strong> 20<strong>08</strong><br />
Foto: Günther Meier<br />
Gesunde Ernährung heisst nicht Verzicht, sondern<br />
umfasst eine vernünftige und ausgewogene Ernährung<br />
sich bis ins hohe Alter vital halten und so das Leben<br />
gesund und aktiv geniessen», ist die Ernährungsberaterin<br />
überzeugt. Mit einer kurzfristigen Fastenkur<br />
ist es freilich nicht getan, auch die in unübersehbarer<br />
Anzahl angebotenen Diäten halten in der Regel<br />
nicht, was sie versprechen. Wer also nicht nur kurzfristig<br />
schnell an Gewicht verlieren will, sondern<br />
seinen Körper mit ausgewogener Ernährung gesund<br />
und leistungsfähig erhalten möchte, vertraut<br />
sich der Ernährungsberatung an.<br />
Körperliches Wohlbefinden und seelisches<br />
Gleichgewicht<br />
Astrid Meier, die über ihren Beruf als Drogis -<br />
tin und ihre Tätigkeit im Reformhaus zur Ernährungsberatung<br />
kam, bietet individuelle Ernährungsanalysen<br />
an, die auf die persönliche Situation<br />
abgestimmt ist: Leistungssportler brauchen eine<br />
andere Ernährung als Büroangestellte, Kinder müssen<br />
anders ernährt werden als ältere Menschen,<br />
was für Untergewichtige richtig ist, kann für Über -<br />
gewichtige zu einem Problem werden. Die Ernährungsberaterin<br />
legt deshalb nach ihrer Analyse<br />
einen Plan fest, der auf Wünsche und Bedürfnisse<br />
der Ratsuchenden eingeht, in erster Linie aber eine<br />
gesunde Ernährung zum Inhalt hat. Macht also Fas -<br />
ten während der Fastenzeit keinen Sinn? «Fasten<br />
kann durchaus Sinn machen», ist Astrid Meier<br />
überzeugt, «es muss aber nicht unbedingt körper -<br />
liches Fasten allein sein, der Geist und die Seele<br />
brauchen ebenfalls Pflege.» Damit schliesst sich<br />
der Kreis, wonach Gesundheit Körper und Geist<br />
umfasst – und richtige Ernährung nicht nur auf das<br />
körperliche Wohlbefinden zielt. |
Frauen-Businesstag 20<strong>08</strong><br />
PUBLIREPORTAGE<br />
Businesstag am 25. Februar<br />
Doris Leuthard als Hauptreferentin<br />
Am 25. Februar 20<strong>08</strong> feiert der «Businesstag» Premiere.<br />
Die Schweizer Bundesrätin Doris Leuthard ist Hauptreferentin<br />
dieser neuen Wirtschaftstagung für Frauen.<br />
Das neue Wirtschaftsforum für Frauen im Rheintal orientiert<br />
sich an den spezifischen Bedürfnissen von Frauen im Wirtschafts -<br />
leben. Das Programm soll von der Studentin, über die Managerin<br />
und Unternehmerin bis hin zur wirtschaftsinteressierten Frau interessante<br />
Gespräche und spannende Kontakte bieten, sagen die Veranstalter<br />
Skunk AG und Boja 19.<br />
Informationen zur Tagung sind im Internet unter www.businesstag.li<br />
erhältlich.<br />
Hochkarätige Referentinnen<br />
Hauptreferentin des Wirtschaftsforums ist Doris Leuthard,<br />
Chefin des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements. Von 1999<br />
bis 2006 war die Rechtsanwältin Nationalrätin, von 2004 bis 2006<br />
Parteipräsidentin der CVP. Doris Leuthard ist seit dem 1. August<br />
2006 Mitglied des Schweizer Bundesrats, und eine Frau, die das<br />
Schweizer Wirtschaftsleben prägt. Ihr Thema am Businesstag lautet<br />
«Zauberquoten statt Quotenzauber – Die Frauen auf dem Weg in<br />
die Chefetagen» und wird mit Spannung erwartet.<br />
Ebenfalls einen Auftritt am Businesstag am 25. Februar in<br />
Vaduz hat die Zukunftsforscherin Susanne Westphal, die für das<br />
Horx-Institut den «Megatrend Frau» untersucht hat und zum<br />
Vortragstitel «Die Zukunft ist weiblich – warum Megatrends vor<br />
allem Frauen neue Chancen eröffnen» spricht.<br />
Auch die aus den Medien bekannte Schweizer Politologin<br />
Regula Stämpfli, welche vor wenigen Tagen ihr neuestes Buch «Die<br />
Macht des richtigen Friseurs» veröffentlicht hat und die Liechten -<br />
steinerin Aurelia Frick, die für eine internationale Headhunting-<br />
Firma in Zürich tätig ist, haben ihre Teilnahme zugesagt. Professo rin<br />
Silvia Simon stellt zudem ihre Untersuchung über die Rahmen -<br />
bedingungen für Frauen auf dem liechtensteinischen Arbeitsmarkt<br />
vor.<br />
Bundesrätin Doris Leuthard ist<br />
Hauptreferentin am Frauen-Businesstag<br />
20<strong>08</strong>.<br />
Regierungsrätin Rita Kieber-Beck<br />
eröffnet das erste Wirtschaftsforum<br />
für Frauen.<br />
Tickets<br />
Unter www.businesstag.li sind<br />
Tickets und detaillierte Informationen<br />
erhältlich. Das Wirtschaftsforum<br />
findet am 25. Februar um<br />
16 Uhr im Vaduzer Saal statt.
16<br />
17<br />
Von Georg Sele<br />
UMWELT<br />
Verantwortung für die<br />
Arbeitswege wahrnehmen<br />
Die Inficon AG in Balzers (ehemals<br />
Balzers Instruments) mit etwa 225 Mitarbeitern<br />
entwickelt und produziert hochwertige Messgeräte<br />
für Vakuumanwendungen<br />
und Gase sowie weitere Vakuum-<br />
Die Basis von erfolgreichem komponenten. Sie ist ein Teil der<br />
Mobilitätsmanagement<br />
Inficon Holding, einem börsenkotierten<br />
Unternehmen mit 850<br />
sind Anreize für den Fuss- Mitarbeitenden in 12 Ländern<br />
und 2006 einem Jahresumsatz<br />
und Radverkehr<br />
von 212 Millionen US-Dollar.<br />
Für ihr betriebliches Mobilitätsmanagement<br />
wurde die Inficon AG mehrfach ausgezeichnet,<br />
zuletzt 2006 mit einem Binding Preis.<br />
<strong>Der</strong> Weg zur Arbeit in Liechtenstein wird von etwa 75% der Berufstätigen<br />
mit motorisiertem Individualverkehr (vor allem allein im Auto) zurückgelegt.<br />
Bei der Inficon AG in Balzers sind es nur etwa 50%. Warum diese Sonder -<br />
stellung?<br />
Wie es dazu kam<br />
Die Inficon AG ist seit 1994 nach<br />
ISO 9001 und seit 1998 auch nach ISO 14001 zertifiziert.<br />
Obwohl nach Norm nicht verlangt, wurden<br />
aus Gründen der Ehrlichkeit und Verantwortung<br />
die Arbeitswege bei der Analyse mit berücksichtigt.<br />
Es zeigte sich bei einem Anteil des motorisierten<br />
Individualverkehrs (MIV) von etwa 65%, dass die<br />
Arbeitswege etwa 50% des gesamten Energieverbrauchs<br />
verursachen. Die Reduktion dieses Energieverbrauchs<br />
wurde als eines der Umweltziele<br />
definiert und festgelegt, dass längerfristig nur 40%<br />
der Mitarbeitenden per MIV zur Arbeit kommen<br />
sollen. So wurde von einer Arbeitsgruppe ein kluges<br />
betriebliches Mobilitätsmanagement entwickelt<br />
und – getragen von der Geschäftsleitung – realisiert<br />
sowie weiterentwickelt. Dies alles, ohne die Mitarbeiterzufriedenheit<br />
zu gefährden. <strong>Der</strong> Zwischen -<br />
erfolg kann sich sehen lassen. Gemäss Umfrage liegt<br />
der MIV-Anteil heute bei 46%. Die Zählungen über<br />
die letzten zwei Jahre ergeben im Jahresdurchschnitt:<br />
13% Fuss-/Radverkehr (10% Radverkehr,<br />
3% Fussverkehr), 37% kollektiver Verkehr (30%<br />
ÖV, 7% Fahrgemeinschaft), 50% motorisierter<br />
Individualverkehr (44% Auto, 6% Motorrad). Pa -<br />
rallel zum Aufbau der Belegschaft gegen 300 Mitarbeitende<br />
muss der MIV-Anteil auf die geplanten<br />
40% reduziert werden; dann reichen die Parkplätze.<br />
Neue Mitarbeiter wählen zwischen einer<br />
Club-Mitgliedschaft oder einem Parkplatz; etwa die<br />
Hälfte wird Top- oder Plus-Mitglied im Inficon<br />
Mobilitäts-Club.<br />
Erfolgsfaktoren<br />
Die Basis von erfolgreichem betrieblichem<br />
Mobilitätsmanagement sind Anreize<br />
für den Fuss- und Radverkehr, Fahrgemeinschaften<br />
und die Benützung des öffentlichen Verkehrs bei<br />
gleichzeitig einschränkenden Massnahmen für den<br />
motorisierten Individualverkehr (speziell Parkplatzbewirtschaftung).<br />
Wichtige Elemente sind:<br />
Inficon Mobilitäts-Club: Mitarbeitende verpflichten<br />
sich als Top-Mitglieder höchstens 12 Mal pro
Jahr allein im Auto zur Arbeit zu kommen, Plus-<br />
Mitglieder 52 Mal, Basic-Mitglieder 96 Mal. Dafür<br />
erhalten sie am Ende des Jahres einen Mobilitätsbeitrag<br />
ausbezahlt: Top 500, Plus 380, Basic 100<br />
Franken. Für den Nahbereich gilt eine Reduktion<br />
von 100 Franken. Finanzielle Anreize sind für den<br />
Erfolg von betrieblichem Mobilitätsmanagement<br />
wichtig. Sie sind dann hoch genug, wenn der Unterschied<br />
von «Selten-MIV» zu «Immer-MIV» im<br />
Bereich von 1000 Franken liegt. Ein Beispiel: Ein<br />
Top-Mitglied erhält 500 Franken; ein Parkplatz bei<br />
«ohne Auto zumutbar» kostet 720 Franken; der<br />
Unterschied beträgt 1250 Franken pro Jahr. Clubmitglieder<br />
können kostenlos Mitglied von Mobi lity<br />
CarSharing Schweiz werden und an Arbeitstagen<br />
(z.B. zum Einkaufen, für Arztbesuch) kostenlos ein<br />
Mobility-Auto verwenden; eines steht beim Eingang<br />
der Inficon. Radverkehr: Als fortschrittlicher<br />
Zur Person<br />
Dr. Georg Sele war bis zu seiner Pensionierung<br />
Mitglied der Geschäftsleitung der Inficon AG. Heute ist er nur noch<br />
verantwortlich für das betriebliche Mobilitätsmanagement.<br />
Fotos: Inficon<br />
Als fortschrittlicher Arbeitgeber<br />
stellt Inficon eingangsnahe, überdachte<br />
Radabstellanlagen bereit;<br />
zudem Umkleideräume mit<br />
Schränken, Duschen, Duschtüchern,<br />
Haarföhn.<br />
Arbeitgeber stellt Inficon eingangsnahe,<br />
überdachte Radabstellanlagen<br />
bereit; zudem Umkleideräume<br />
mit Schränken,<br />
Duschen, Duschtüchern, Haarföhn.<br />
Dies ist nicht nur für Rad<br />
Fahrende mit mehr als drei Kilometer<br />
Arbeitsweg unabdingbar,<br />
sondern dient auch den Mittagsjoggern.<br />
Nur Gewinner<br />
<strong>Der</strong> Arbeitgeber hat kleinere<br />
Kos ten, da er weniger Parkplätze zur Verfügung<br />
stellen muss. Zudem legt ein guter Teil der Belegschaft<br />
die Arbeitswege stressfrei und auf gesundheitsfördernde<br />
Art zurück. Viele Arbeitnehmer<br />
haben dank kos tengünstiger Arbeitswege erheblich<br />
mehr Geld zur Verfügung. Zudem fühlen sie sich<br />
fitter und gesünder. Die Emissionen aus dem motorisierten<br />
Verkehr sinken – Mensch, Umwelt, Klima<br />
werden weniger belastet. Ebenso sinken Landverbrauch<br />
und Kosten für Verkehrsinfrastrukturen.<br />
Wünsche an die Behörden<br />
Etwa 70% der Inficon-Mitarbeitenden<br />
wohnen in der Schweiz. Die Weiterentwicklung<br />
wird gefördert durch den Ausbau der Eisenbahn<br />
Sargans-St. Gallen mit Pendler-Regionalverkehr<br />
zwischen Buchs-Sargans. Zudem 30-Minuten-<br />
Takt der Busse Buchs-Sargans zu den Hauptverkehrszeiten<br />
am Morgen, Mittag und Abend. Und<br />
schlanke LBA-Verbindungen von Trübbach nach<br />
Balzers. Als wesentliches Element des Radwegnetzes<br />
fehlt eine Fuss-/Radwegbrücke über den Rhein im<br />
Bereich Weite-Halös (zwischen Triesen-Balzers). |<br />
<strong>FEBRUAR</strong> 20<strong>08</strong>
BRAUCHTUM<br />
18 Ruassla am Schmotziga Donnschtig<br />
Am Fasnachtsbeginn werden die Gesichter schwarz<br />
Früher verwendete man Speck- Fröhlich-derb geht es oft am<br />
schwarten oder alte Korkzapfen, Schmutzigen Donnerstag zu. An<br />
um das Gesicht der anderen diesem Donnerstag vor dem Fas-<br />
fasnächtlich zu dekorieren. nachtssonntag steuert die Fasnacht<br />
auf ihren Höhepunkt zu.<br />
Ein alter Brauch will es, dass an diesem Tag die Leute<br />
besonders ausgelassen sind und einander die Gesichter<br />
einfärben oder schwärzen. Das Brauchtum ist<br />
nicht mehr an allen Orten gleich, aber ursprünglich<br />
wurde zuerst der Schmutzige Donnerstag gefeiert,<br />
auf den der Russige Freitag folgte. Heute werden die<br />
beiden Tage oft vermischt, was bedeutet, dass viele<br />
schon am Donnerstag mit dem «Ruassla» beginnen.<br />
<strong>Der</strong> Schmutzige Donnerstag oder «dr Schmotzig<br />
Donnschtig» hat seinen Namen vom früheren<br />
Brauch, an diesem Tag vor der Fastenzeit nochmals<br />
Fleisch essen zu dürfen. «Schmotz» heisst im Dialekt<br />
Fett oder Schmalz. Die Sache mit dem Fleisch war<br />
früher nicht so einfach wie heute, wo Kühlschränke<br />
und Tiefkühler, Metzgereien und Supermärkte<br />
tagtäglich zur Verfügung stehen. <strong>Der</strong> Freitag war<br />
früher ein Fasttag, an dem kein<br />
Fleisch gegessen werden durfte.<br />
Am Samstag und Sonntag konnte<br />
nicht geschlachtet werden, weil<br />
am einen Tag das Judentum und<br />
am anderen Tag das Christentum<br />
derartige Arbeiten verbot.<br />
<strong>FEBRUAR</strong> 20<strong>08</strong><br />
Digiprint AG – Die Print-Agentur<br />
St.Luzi-Strasse 18, FL-9492 Eschen<br />
Tel. +423 373 73 50<br />
digiprint@digiprint.li, www.digiprint.li<br />
Schlachten am Montag und<br />
Dienstag vor dem Aschermittwoch<br />
machte keinen Sinn mehr,<br />
weil dann die fleischlose Fastenzeit<br />
begann. Also nahm man<br />
den Donnerstag vor dem Fasten,<br />
um noch einmal ausgiebig<br />
«Schmotz» zu essen, natürlich bei<br />
fröhlicher bis ausgelassener Stimmung.<br />
Erhalten geblieben ist der<br />
Brauch, dass am «Schmotziga<br />
Donnschtig» die Fasnacht so richtig<br />
beginnt und sich die Kinder<br />
die Gesichter einfärben oder<br />
schwärzen. An vielen Orten wird<br />
nur am Donnerstag «gruasslet», an anderen Orten<br />
nur am «Ruassiga Fritig», wieder an anderen Orten<br />
an beiden Tagen. Die «Ruassler» verwendeten früher<br />
Speckschwarten oder Tücher, die mit dem Russ von<br />
Pfannenböden oder aus dem Holzherd geschwärzt<br />
waren. Weil sowohl die Speckschwarten als auch<br />
die russgeschwärzten Pfannenböden verschwanden,<br />
verlegten sich die «Ruassler» auf Korkzapfen, die mit<br />
dem Feuerzeug kurz angebrannt werden. <strong>Der</strong> Russ<br />
des Korks eignet sich gut für einen schwarzen Tupfer<br />
auf der Nase oder eine Zeichnung auf der Wange<br />
oder Stirn.<br />
Unter Schulkindern herrschte früher der Wettbewerb,<br />
dass jener als Meister seines Fachs galt, der<br />
möglichst viele «ruassla» konnte, selbst aber weitgehend<br />
unversehrt von Russspuren blieb. Weil das in<br />
der Praxis meistens nur von den Stärkeren verwirklicht<br />
werden konnte, waren vor allem die Mädchen<br />
die Opfer. Listige junge Frauenzimmer machten aus<br />
dieser Not eine Tugend und schwärzten sich selbst<br />
ein. Damit blieben sie in der Regel vom gröberen<br />
«Ruassla» verschont, weil nur<br />
Bleichgesichter als Opfer ausserkoren<br />
wurden – und zudem hat-<br />
Foto: Photo Malu<br />
ten sie das Gesicht nicht einfach<br />
verschmiert, sondern konnten<br />
vor dem Spiegel selbst ein paar<br />
kecke Schwarztupfer auftragen. |
FR. 440.–<br />
EXKL. 7.6% MWST<br />
… UND DIESER LOGENPLATZ<br />
GEHÖRT IHNEN!<br />
Reservationen unter Telefon 239 50 23<br />
E-Mail: annoncen@dermonat.li<br />
Verkauf • Vermietung • Verwaltungen<br />
Immobilien AG · 9494 Schaan<br />
Telefon +423 /233 22 00 · www.wp-immobilien.li<br />
Nach …<br />
Konzert<br />
Laufend stark reduzierte<br />
Einzelstücke!<br />
Wissen, worauf es bei<br />
Licht<br />
ankommt...<br />
Leuchten-Atelier Frey<br />
Giuf 95<br />
9475 Sevelen<br />
Telefon <strong>08</strong>1 750 14 05<br />
Mobile 078 670 56 54<br />
Unser Pizzaiolo José hat<br />
25 Pizzas zur Auswahl<br />
täglich von Mo-Sa bis 23.00 Uhr<br />
Sie können auch Ihre Wunschpizza bei uns<br />
bestellen und abholen.<br />
Tel. 00423 / 233 20 20<br />
Öffnungszeiten:<br />
Mo–Fr 11.30–14.00 Uhr<br />
Mo–Sa ab 18.00 Uhr<br />
… ab ins Luce.<br />
Fussball Snowboarden<br />
Schwimmen<br />
schwefelstrasse 14<br />
tel. 00423 / 233 20 20<br />
fax 00423 / 233 20 85<br />
Turnen<br />
Versammlung Judo Volleyball Jassen<br />
Kino Unihockey Reiten
20<br />
21<br />
Von Stefan Güldenberg<br />
WIRTSCHAFT<br />
From Good to Great<br />
Das Beispiel Google<br />
<strong>Der</strong> Reichtum unserer westlichen<br />
Gesellschaft basiert historisch betrachtet zu einem<br />
Gutteil auf unserer Fähigkeit zum effizienten Management<br />
der manuellen Arbeit und der damit verbundenen<br />
Produktivitätssteigerung. Unser grösstes<br />
Problem heute ist, dass viele Manager dieselben,<br />
in der Vergangenheit erfolgreichen Managementprinzipien<br />
nach wie vor konsequent praktizieren,<br />
unsere Arbeitsplätze sich aber<br />
in der Zwischenzeit fundamental<br />
Bei Google gibt’s keine<br />
gewandelt haben. Sie haben<br />
Anwesenheitskontrolle. Was mehrheitlich nichts mehr mit<br />
manueller Arbeit im klassischen<br />
allein zählt ist, dass die<br />
Sinne zu tun. Es handelt sich viel-<br />
gemeinsam vereinbarten mehr um geistige Arbeit, um<br />
Wissensarbeitsplätze, die ganz<br />
Ziele erreicht werden<br />
neue Anforderungen und Herausforderungen<br />
an Führungskräfte<br />
stellen. Dies führt dazu, dass viele dieser<br />
hochqualifizierten Wissensarbeiter heute frustriert<br />
und demotiviert sind. Experten schätzen, dass im<br />
Schnitt mehr als 80% des Personals von Unternehmen<br />
nur noch Dienst nach Vorschrift machen.<br />
Viele befinden sich in einem Zustand der inneren<br />
Kündigung.<br />
Nicht so beim attraktivsten Arbeitgeber<br />
der Welt, dem amerikanischen Internetunternehmen<br />
Google. Dieses bekommt geschätzte<br />
1300 Bewerbungen pro Tag zugesendet, und das<br />
ohne eine konkrete Stellenausschreibung. In Zeiten<br />
eines härter werdenden Wettbewerbs um qualifizierte<br />
Arbeitskräfte, oft auch als «War for Talents»<br />
bezeichnet, ein unschätzbarer Wettbewerbsvorteil.<br />
Waren es früher namhafte Industrieunternehmen<br />
oder Unternehmensberatungen, so kann sich heute<br />
Google die besten und motiviertesten Arbeitskräfte<br />
Unser grösstes Problem ist, dass viele Manager in der Vergangenheit erfolg -<br />
reiche Managementprinzipien nach wie vor praktizieren, unsere Arbeitsplätze<br />
sich aber in der Zwischenzeit fundamental gewandelt haben. Google macht es<br />
vor, wie es geht.<br />
als erstes aussuchen, die anderen Unternehmen<br />
müssen sich hinten anstellen. Was macht Google<br />
besser als andere? Dies durfte ich kürzlich bei einem<br />
Besuch des Züricher Büros selbst erleben. Dabei<br />
sind mir drei Managementprinzipien besonders<br />
eindrücklich in Erinnerung geblieben:<br />
1. Wissensarbeiter haben bei Google einen hohen<br />
Stellenwert, sie sind wichtiger als alles andere!<br />
Google hat verstanden, dass Wissensarbeiter gefordert<br />
und gefördert werden wollen. Sie sind anders<br />
motiviert als der klassische Industriearbeiter unserer<br />
Vätergeneration und sie müssen auch dementsprechend<br />
anders geführt werden. Wissensarbeiter<br />
brauchen Freiraum, viel Freiraum. Sie wollen sich<br />
nicht mehr einer klassischen Unternehmenshie -<br />
r archie unterordnen. Bei Google kann jeder selbst<br />
bestimmen, wann er zur Arbeit kommt und wann<br />
er wieder geht. Wissensarbeiter wissen selbst am<br />
besten, wann und wie sie produktiv arbeiten können,<br />
sei es in der Früh, am Nachmittag oder eben in<br />
der Nacht. Es gibt keine Notwendigkeit einer Anwesenheitskontrolle.<br />
Was allein zählt ist, dass die gemeinsam<br />
vereinbarten Ziele erreicht werden. Dabei<br />
wird zwischen inhaltlichen und fachlichen Zielen<br />
unterschieden. Was für die Arbeitzeit gilt, gilt auch<br />
für den Arbeitsplatz. Bei Google können die Mitarbeiter<br />
diesen selbst gestalten. Und wenn sie glauben,<br />
ein Pool-Billiard oder ein Swimming Pool<br />
trägt zur Steigerung der Arbeitsproduktivität bei,<br />
gibt es keinen Grund, diesen Wunsch abzulehnen.<br />
2. Ablenkung ist der grösste Feind der Produktivität,<br />
die Fokussierung der Aufmerksamkeit die<br />
grösste Herausforderung moderner Unternehmens<br />
führung!
Wissensarbeiter sind anders<br />
motiviert als der klassische<br />
Industriearbeiter und müssen<br />
auch dementsprechend<br />
anders geführt werden.<br />
Wieviel Mitarbeiter wissen eigentlich<br />
heute genau, was das Unternehmen,<br />
bei dem sie arbeiten,<br />
von ihnen erwartet? «Google does<br />
search» – kürzer und präziser<br />
kann man den Zweck der eigenen<br />
Existenz wohl nicht ausdrücken.<br />
Nach Ansicht von Google ist es<br />
das Beste, sich auf eine Sache zu<br />
konzentrieren und diese wirklich, wirklich gut zu<br />
machen. Zu diesem Zweck leistet man sich seit<br />
kurzem auch einen sogenannten «Chief Internet<br />
Evangelist» und dieser ist niemand geringerer als<br />
der Vater des Internets: Vint Cerf. Was es heisst,<br />
Wissensarbeiter für eine Sache zu motivieren, kann<br />
sich jeder selbst in seinen Videobotschaften am<br />
Internet ansehen.<br />
3. Zeit ist der grösste ökonomische Engpass in<br />
unserer heutigen Zeit, nicht Geld!<br />
«Schnell ist besser als langsam»: Ein weiterer Leitspruch<br />
in der Google-Welt, der ganz an den Vater<br />
der Produktivitätsbewegung Frederick W. Taylor<br />
und sein Konzept des wissenschaftlichen Managements<br />
erinnert. Allerdings geht es heute nicht<br />
mehr um die möglichst effiziente Aufteilung der<br />
Arbeit, sondern um produktive Wissensteilung und<br />
gemeinsame Wissensentwicklung, nicht um hohe<br />
Stückzahlen, sondern um die beste Lösung. Unternehmen,<br />
die heute in der Lage sind, schneller zu<br />
lernen als ihre Konkurrenz, werden die wahren<br />
Gewinner in einer globalisierten Welt sein, nicht<br />
die, die durch ihre schiere Grösse glauben, sich dadurch<br />
für immer unentbehrlich gemacht zu haben.<br />
Schlag nach bei den Dinosauriern. Diesen hat ihre<br />
Grösse auch herzlich wenig geholfen: Sie sind aus-<br />
Fotos: IPG Gutenberg Est.<br />
gestorben, weil sie sich nicht schnell genug an das<br />
sich verändernde Umfeld anpassen konnten. Bei<br />
Google heisst Zeitmanagement, tue alles, damit sich<br />
die Mitarbeiter im Hause wohl fühlen und nehme<br />
ihnen die zeitlichen Belastungen des Alltags soweit<br />
wie möglich ab. Und schliesslich kostet es nicht die<br />
Welt, tatsächlich für ein «Free Lunch» zu sorgen,<br />
dass nach Überzeugung meines Gesprächspartners<br />
nicht nur das beste, sondern auch das gesündeste in<br />
ganz Zürich ist. Es gäbe noch viele weitere bemerkenswerte<br />
Punkte zu berichten, z.B. das stimulierende<br />
Arbeitsklima und die Tatsache, dass kaum<br />
einer den Wechsel von seinem früheren Arbeitgeber<br />
(übrigens überdurchschnittlich häufig namhafte<br />
Unternehmen und Elite-Universitäten) zu Google<br />
bereut hat. Was Google überzeugend zeigt, ist die<br />
Konsequenz, mit der man die Idee einer lernenden<br />
Organisation in der Praxis umgesetzt hat. Und so<br />
heisst der letzte Grundsatz der Google-Philosophie<br />
auch ganz einfach: «Great just isn’t good enough.»|<br />
Zur Person<br />
Prof. Dr. Stefan Güldenberg ist Inhaber des Lehrstuhls<br />
für Internationales Management am Institut für Entrepreneurship<br />
der Hochschule Liechtenstein.<br />
<strong>FEBRUAR</strong> 20<strong>08</strong>
22<br />
23<br />
Von Hans Frommelt<br />
KULTUR<br />
«Die Energie vom Föhn<br />
sollte man nutzen können»<br />
«Die Energie vom Föhn sollte<br />
man nutzen können». Dieses Argument wird bei<br />
Diskussionen über die Stromversorgungsproblematik<br />
immer wieder erwähnt. <strong>Der</strong> Föhn ist zu<br />
turbulent, zu bockig. Die Wind-<br />
Stromproduktion aus erneuergeschwindigkeit sei zu hoch,<br />
man müsse bei so hohen Windbaren<br />
Energien wäre auch geschwindigkeiten die Maschi-<br />
aus finanzieller Sicht ein nen abstellen. Windräder machen<br />
einen Saulärm, ist ein<br />
Gewinn für unsere Region<br />
weiteres negatives Argument gegen<br />
die Windenergienutzung. Ein<br />
Haupt- problem bei der Windenergienutzung in<br />
den Alpen sei auch die Vereisung der Rotorblätter.<br />
Solche Negativkritiken und weitere hört man seit<br />
Jahrzehnten. Andererseits hört und liesst man ständig,<br />
dass die Windenergienutzung unerschöpflich,<br />
sauber, wirtschaftlich und zukunftsorientiert ist.<br />
Die Windenergie schafft Arbeits-<br />
Windräder arbeiten heute ohne plätze bei Planung, Herstellung,<br />
grossen Lärm. Moderne Anlagen Errichtung und Betrieb. Die<br />
sind kaum mehr hörbar. Windenergie verringert die Stromim-<br />
portabhängigkeit. Windenergie<br />
kann Atomkraftwerke<br />
ersetzen. Bei einer richtigen<br />
Standortwahl kann eine einzelne,<br />
grössere Windkraftanlagen leicht<br />
den Strombedarf von 1000 Haushalten<br />
decken. Die Windenergie -<br />
nutzung ist extrem nachhaltig<br />
und produziert 40- bis 80mal<br />
mehr Energie, als für die Herstellung,<br />
Transport, Montage und<br />
einen Rückbau benötigt wird.<br />
Eine Kennzahl, die keine andere<br />
Stromproduktionsanlage bieten<br />
Foto: IPG Gutenberg Est.<br />
Wind haben wir genug, vor allem wenn der Föhn bläst. Aber einfangen lässt<br />
sich der Wind nur mit speziellen Anlagen, die heute noch mit Skepsis auf -<br />
genommen werden. Die Zukunft liegt jedoch bei erneuerbaren Energien.<br />
kann. Windenergieanlagen sind zudem sehr umweltfreundlich,<br />
emittieren keine klimabelastenden<br />
Schadstoffe wie CO2, produzieren praktisch keine<br />
Abfälle und Sondermüll wie andere Stromproduktionsanlagen.<br />
Somit erstaunt es nicht, dass auf<br />
dem Meer und entlang von Meeresküsten, aber<br />
auch auf flachen Landflächen tausende von Windenergienutzungsanlagen<br />
aufgestellt wurden und<br />
noch werden. Die Vorteile der Windenergienutzung<br />
sind längstens erkannt. Moderne, zeitgemäss konzipierte<br />
Windenergieanlagen erzeugen kaum noch<br />
eine Geräuschbelastung.<br />
Windenergieanlagen gehören<br />
bald zum Landschaftsbild<br />
Windenergieanlagen verändern<br />
das Landschaftsbild. Für Erholungsuchende kann<br />
das schlanke und recht dominante Bauwerk das<br />
Naturerlebnis vielleicht etwas einschränken. Allerdings<br />
kann dieses Thema relativiert werden. An die<br />
Hochspannungsmasten entlang des Rheins hat sich<br />
die Bevölkerung längstens gewöhnt, an welchen<br />
auch Antennen für die Mobilkommunikation<br />
montiert sind. Da stellt sich die Frage, ob sich<br />
die Bevölkerung auch an die Windenergienutzung<br />
gewöhnen wird. Für viele gehören Windenergie -<br />
anlagen bereits zu einem Erscheinungsbild, das zu<br />
einer bewohnten Landschaft gehört, so wie die<br />
Strassen, Autobahnen, Brücken, Häuser, Kühltürme<br />
von Atom- und Kohlekraftwerken, Kamine<br />
von Verbrennungsanlagen, Hochspannungsleitungen,<br />
Industrie- und Gewerbebauten oder Stauseedämme<br />
aus Beton.<br />
Bis vor kurzem galt die Region<br />
Süddeutschland als windarm und folglich wurde<br />
kaum über die Windenergienutzung diskutiert.
Typische Föhnstimmung<br />
über dem Rheintal.<br />
Die neuen Erkenntnisse über die<br />
Windenergienutzung abseits von<br />
Meeresküsten zeigen neue Fakten.<br />
In rund 100 Meter Höhe lässt<br />
sich mit den ständig besseren<br />
Rotoren der Windkraftanlagen<br />
ein Vielfaches an Energie einfangen<br />
als noch vor wenigen Jahren mit kleineren<br />
Anlagen. Interessant in dieser Beziehung ist die<br />
Windenergienutzungsstudie des Eidgenössischen<br />
Bundesamtes für Energie. Modelliert wurden die<br />
mittleren jährlichen Windgeschwindigkeiten 70<br />
Meter über Grund. Über die Grate unserer Berge<br />
weht im Jahresdurchschnitt sehr viel Wind. Liechtenstein<br />
könnte weitgehend mit elektrischer Energie<br />
versorgt werden und zudem ohne CO2-Belastung.<br />
Geräusche sind künftig kaum<br />
mehr wahrnehmbar<br />
Liechtenstein hat sich die ver -<br />
gangenen 80 Jahre sehr stark verändert. Bei der<br />
vermehrten Windenergienutzung geht es auch um<br />
die Frage: Wie wird sich Liechtenstein in den<br />
nächsten 80 Jahren verändern? Die fossilen Energien<br />
neigen sich dem Ende zu. Bis in 80 Jahren<br />
werden womöglich Treibstoffe aus Pflanzen, die<br />
auf unseren Feldern wachsen, unsere Fahrzeuge, ob<br />
öffentliche Verkehrsmittel oder Warentransporter,<br />
bewegen. Viele neue Ideen werden aufgegriffen<br />
um das CO2 und andere klimaschädigende Stoffe<br />
zu reduzieren. Bis in 80 Jahren wird die Solarener -<br />
giegewinnung auf allen Dächern Liechtensteins<br />
vielleicht das Normalste sein. So wie man sich an<br />
die Hochspannungsmasten gewöhnt hat, wird man<br />
sich an die Windräder gewöhnen. Ein Geräusch<br />
Foto: Marco Nescher<br />
wird kaum noch wahrnehmbar sein. Was sich im<br />
Grossen auf europäischer Ebene abspielen wird,<br />
lässt sich auch auf kleinräumige Verhältnisse übertragen.<br />
Die Zukunft der dezentralen<br />
Stromversorgung<br />
Die derzeitigen Klimaschutzdiskussionen<br />
haben eine neue Politik bei der Stromversorgung,<br />
von der zentralen zur dezentralen<br />
Stromversorgung, eingeläutet. Oder anders ausgedrückt,<br />
die Stromproduktion aus fossilen, aber<br />
auch atomaren Brennstoffen wird durch Produk -<br />
tionsanlagen ersetzt, die erneuerbare Energien nutzen.<br />
Diese neue Dynamik im Zusammenhang mit<br />
dem Klimaschutz hat eine nicht unwesentliche<br />
wirtschaftliche Komponente. Eine Stromproduk -<br />
tion ausschliesslich aus erneuerbaren Energien<br />
wäre auch aus finanzieller Sicht ein Gewinn für<br />
unsere Region. Es geht da um Pachtzahlungen für<br />
die Nutzung der Standorte, höhere Wassernutzungszinsen<br />
bei Wasserkraftwerken, Folgeaufträge<br />
für Ingenieurbüros, Industrie- und Handwerks -<br />
betriebe, aber auch um steuerliche Abgaben an die<br />
Gemeinden. Zweifellos muss bei einer vermehrten<br />
Windenergienutzung auch der Landschaftsschutz<br />
miteinbezogen werden. Doch sollte man ein Ja oder<br />
Nein zur Windenergienutzung nicht ausschliesslich<br />
auf diese Thematik fokussieren. |<br />
<strong>FEBRUAR</strong> 20<strong>08</strong>
ZEITGESCHEHEN<br />
24 Vor 150 Jahren<br />
Seidenraupenzucht in Liechtenstein<br />
Im 19. Jahrhundert wurden ver- Nach dem Sparkassen-Skandal<br />
schiedene Versuche mit Seiden- 1928, als es Liechtenstein wirtraupenzucht<br />
in Liechtenstein schaftlich schlecht ging, erhielt<br />
unternommen, aber ohne Erfolg. die Regierung zahlreiche Vorschläge,<br />
wie die Leute zu einfachen<br />
und guten Verdienstmöglichkeiten kommen<br />
könnten. Einer der Vorschläge betraf die Seidenraupenzucht,<br />
weil Seide ein gefragtes Produkt sei, wie<br />
damals auch in den Zeitungen ausgeführt wurde:<br />
«Wenn man bedenkt, dass Deutschland jährlich<br />
für über 360 Millionen Mark und die Schweiz für<br />
über 100 Millionen Franken Rohseide einführen, so<br />
kann man sich ein Bild davon machen, welche Zukunft<br />
die Seidenraupenzucht hat.»<br />
Die Idee einer Seidenraupenzucht wurde<br />
nicht aufgenommen. Wahrscheinlich weil es früher<br />
schon Versuche mit der Zucht von Seidenraupen<br />
gab, die aber alle scheiterten. Die Seide kommt aus<br />
China. Schon im 3. Jahrtausend vor Christus haben<br />
die Chinesen die Seidenfäden der Seidenraupe<br />
benützt, um feine Stoffe herzustellen. Die Chinesen<br />
waren sich offenbar bewusst, welch wertvollen<br />
Rohstoff sie mit der Seide hatten.<br />
Deshalb war es bei Todesstrafe<br />
verboten, Raupen oder Eier ausser<br />
Landes zu bringen. Erst zwei<br />
Mönchen gelang es 555 Jahre<br />
nach Christi Geburt, ein paar Eier<br />
an den kaiserlichen Hof nach<br />
<strong>FEBRUAR</strong> 20<strong>08</strong><br />
keramik werkstatt schaedler<br />
www.schaedler-keramik.com<br />
Konstantinopel zu schmuggeln.<br />
Von dort breitete sich die Seidenraupenzucht<br />
über ganz Europa<br />
aus. <strong>Der</strong> Schaaner Frächter<br />
Andreas Hilti versuchte es 1858,<br />
also vor 150 Jahren. Seine Pferde-<br />
Frächterei war unter grossen<br />
wirtschaftlichen Druck gekommen,<br />
nachdem im Rheintal eine<br />
Eisenbahnlinie gebaut worden<br />
war. Als initiativer Unternehmer<br />
setzte Andreas Hilti auf die<br />
Seidenraupenzucht als neue Erwerbsquelle,<br />
doch konnte er<br />
trotz grosser Hartnäckigkeit keine Erfolge verbuchen.<br />
Verschiedene andere Leute, die einen neuen<br />
Erwerbszweig suchten, müssen damals versucht<br />
haben, Seidenraupen zu züchten. Darauf weisen die<br />
Maulbeerbäume hin, die noch Jahrzehnte später in<br />
unserer Landschaft zu sehen waren, so in Vaduz und<br />
Schaan, in Mauren, Balzers und beim Dorfeingang<br />
von Triesenberg. Die «Saatschule» in Schaan versuchte<br />
mit Erfolg das Heranziehen von Maulbeerbäumen,<br />
die dann im Windschutzgürtel am Scheidgraben<br />
Oberland-Unterland gepflanzt wurden.<br />
Für die Nahrungsmittel der Seidenraupen war<br />
also gesorgt, doch die Raupen als anspruchsvolle<br />
Tierchen rückten die Seidenfäden nur bei entsprechender<br />
Pflege heraus: Mehrmals rund um die Uhr<br />
mussten die Raupen mit frischen Blättern des<br />
Maulbeerbaumes gefüttert werden. Zudem brauchten<br />
die Seidenspinner Wärme, die damals in den<br />
Häusern nur in den Wohnzimmern vorhanden war.<br />
Alle diese Faktoren führten dazu, dass die Züchter<br />
nach kurzer Zeit ihr Vorhaben wieder aufgaben. Als<br />
1928 der Vorschlag für den Aufbau einer Seiden -<br />
raupenzucht unterbreitet wurde,<br />
hätte man gleich mit der Aufzucht<br />
der Seidenraupen beginnen<br />
können. Damals gab es noch<br />
zahlreiche Maulbeerbäume in<br />
unserem Land, von denen sich<br />
die Seidenraupen ernähren. |<br />
Foto: Marco Nescher
JUGEND<br />
Bist du ein Checker? Jugendliche<br />
pflegen ihre eigene Sprache<br />
Wenn das Korallenriff zum Kopfgärtner rennt, um<br />
sich aufzupimpen, ist es ein Vollpfosten. Alles gecheckt?<br />
Also wenn ein Pickelgesicht zum Coiffeur<br />
geht, um sich zu verschönern, ist es ein Vollidiot. Die<br />
Jugend hat ihre eigene Sprache, die aus allerlei Entlehnungen<br />
zusammengesetzt ist, aus dem unmittelbaren<br />
Umfeld, aus dem Englischen, zunehmend<br />
auch aus den Sprachen von Einwanderern. Kein<br />
Wunder, dass das Krampfadergeschwader, also die<br />
älteren Leute, nichts mehr verstehen. Die Jugendsprache<br />
ist auch dynamisch, was gewitzten Verlegern<br />
gar nicht ungelegen kommt, denn so können sie<br />
jährlich ein neues Lexikon der Jugendsprache herausgeben.<br />
Verschiedene Lexika-Verlage wie Langenscheidt<br />
oder Pons geben solche Büchlein heraus –<br />
und wollen auf dem neuesten Stand sein. So fordert<br />
Langenscheidt die Jugendlichen zur Suche nach<br />
unbekannten Wörtern auf, die von Jugendlichen<br />
verwendet werden: «Fällt dir noch ein besonders<br />
angesagtes Wort ein, das du in diesem Buch nicht gefunden<br />
hast?» Dann sofort einschicken, zusammen<br />
mit einem Beispielsatz – es winkt als Preis ein iPod<br />
nano. Die Sprache der Jugend ist aber nicht nur<br />
kurzlebig, sondern auch regional geprägt. Deutsche<br />
Jugendliche entlehnen ihren Sprachschatz zunehmend<br />
aus dem Türkischen oder Arabischen, in der<br />
Schweiz zeigt der Trend mehr in Richtung Dialekt.<br />
Abgrenzung, Selbstdefinition<br />
Warum die Jugend ihre eigene<br />
Sprache formt und immer wieder neu definiert, versuchten<br />
Sprachforscher zu ergründen. Die Hauptmotivation<br />
scheint der Drang nach Abgrenzung und<br />
die Suche nach Selbstdefinition zu sein. Die Jugendsprache<br />
wird meistens nur unter Gleichaltrigen verwendet.<br />
Mit den modernen Kommunikationsmitteln<br />
können Jugendliche ihre Sprache rascher als<br />
früher verbreiten. Über SMS und Chat-Rooms findet<br />
ein schneller Austausch statt, der keine geografischen<br />
Grenzen kennt. Dass Sprachforscher, Lehrer<br />
und Eltern fast verzweifeln, wenn sie die Jugendsprache<br />
hören, liegt auf der Hand. Aber nicht nur die<br />
Sprachverluderung dröhnt vielen in den Ohren.<br />
Foto: IPG Gutenberg Est.<br />
Das Kopfschütteln hat noch einen Wenn Jugendliche reden, versteht<br />
anderen Grund: Man versteht die das «Krampfadergeschwader»<br />
Jungen einfach nicht mehr. «Nur<br />
oft nur noch Bahnhof.<br />
ein bisschen rumpimmeln, sei<br />
kein Karottenrambo». Da macht man grosse Augen,<br />
wenn man das hört. Aber Entwarnung: Als Karottenrambo<br />
wird ein Schwächling bezeichnet, rumpimmeln<br />
bedeutet faulenzen. Als Softwürfel wird<br />
eine sensible Person benannt, die Disco heisst Fummelbunker.<br />
Ein Einlauf ist nichts anderes als Ärger,<br />
ein kleiner Hund ein Teppichporsche. Alles klar?<br />
Nein, alles clisso! Am farbigsten scheint die Jugendsprache<br />
in den Städten Deutschlands zu sein. So<br />
wird vieles übernommen oder – wie die Jugendlichen<br />
sagen – sozialistisch umgelagert, was auch stehlen<br />
bedeutet. Nicht alle Wörter, die in den Jugendsprache-Lexikas<br />
aufscheinen, befinden sich im<br />
Umlauf. Viele verschwinden nach kurzer Zeit, andere<br />
halten sich länger, einige haben es sogar in die<br />
Umgangssprache geschafft, wie etwa «steck es dir an<br />
den Hut». Über die Auswirkungen der Jugendsprache<br />
auf unsere Kultur sind sich nicht alle einig. Während<br />
die einen über die Sprachverluderung schimpfen,<br />
machen andere darauf aufmerksam, dass in die<br />
deutsche Sprache immer schon Fremdes eingeflossen<br />
sei – aus dem Lateinischen, Französischen und<br />
Englischen. Also Entwarnung: Wer die Jugend nicht<br />
versteht, ist noch lange kein Vollpfosten. |<br />
<strong>FEBRUAR</strong> 20<strong>08</strong><br />
25
26<br />
MARKT<br />
Frech und bunt<br />
in den Sommer<br />
Farben, Farben, Farben – das<br />
ist das Thema des Modesommers<br />
<strong>08</strong> bei Jones. Frech, bunt ist auch<br />
die Frühjahrsmode, die am 14.<br />
März an einer frech-bunten Modeschau<br />
in der Hofkellerei präsentiert<br />
wird. Hochwertige, aber tragbare<br />
Mode zu erschwinglichen Preisen<br />
– mal City, mal Casual, mal Party.<br />
Jones Store<br />
Beatrice Frei-Kaiser<br />
Städtle 36, Vaduz<br />
Edle Schmuckstücke<br />
nach Massanfertigung<br />
Wer möchte edle Schmuckstücke,<br />
die nach dem eigenen<br />
Geschmack angefertigt werden? In<br />
Gold, Silber oder anderen edlen<br />
Materialien? Trauringe nach den<br />
Ideen des Brautpaares? Jutta Hämmerle<br />
fertigt den Schmuck nach<br />
den individuellen Wünschen an.<br />
Auch Änderungen an Schmuckstücken<br />
werden gerne gemacht.<br />
Goldschmied-Atelier<br />
Hämmerli<br />
Herrengasse 30, Vaduz<br />
<strong>FEBRUAR</strong> 20<strong>08</strong><br />
Sonnige Geschenke<br />
aus der Sonnenblume<br />
Das Atelier Sonnenblume im<br />
Heilpädagogischen Zentrum in<br />
Schaan stellt Deko- und Gebrauchsgegenstände<br />
her, die im<br />
eigenen Laden verkauft werden.<br />
Das Angebot richtet sich nach den<br />
Jahreszeiten. Verwendet werden<br />
Materialien wie Holz, Papier, Ton,<br />
Textilien und Peddigrohr. Wer ein<br />
Geschenk aus einem sonnigen Angebot<br />
sucht, der liegt hier richtig,<br />
denn alle Gegenstände sind mit<br />
viel Geduld, Ausdauer und Liebe<br />
hergestellt. Da gibt es Holzspiel -<br />
sachen, Kindermöbel, Kleiderbügel,<br />
Körbe, Schalen und Figuren<br />
aus Ton, Bilder und Glückwunschkarten.<br />
Auch Strassenschilder, die<br />
beispielsweise «Achtung Kinder»<br />
anzeigen, werden aus Holz gefertigt.<br />
Wer ganz spezielle Wünsche<br />
hat, kann Gebrauchs- und Deko-<br />
Gegenstände auch nach seinen<br />
Wünschen anfertigen lassen.<br />
Atelier Sonnenblume<br />
Heilpädagogisches Zentrum<br />
Bildgasse 1, Schaan<br />
www.<br />
Unentbehrlich<br />
für Manager<br />
Wer in der Geschäftswelt Erfolge<br />
verbuchen will, braucht auch unterwegs<br />
Zugang zu Daten, E-Mails<br />
und Internet. Mit dem HSDPA<br />
geht es so schnell wie im Büro. Das<br />
HTC S710 ist das kompakteste<br />
Smartphone mit Schiebetastatur,<br />
das die neue Windows Mobile®<br />
6.0 Standard-Plattform nutzt.<br />
Telecom Liechtenstein<br />
Telecom Shop<br />
Austrasse 77, Vaduz<br />
Roberts Radio<br />
Revival Collection<br />
Roberts Radios, vor 75 Jahren<br />
erstmals gebaut, sind schon<br />
Legende. Bei Elrowa kann die<br />
Revival Collection bestaunt und<br />
natürlich gekauft werden. Ob poppig-farbig,<br />
in Leder oder in einer<br />
exklusiven Crystal-Edition mit Swarovski-Steinchen<br />
– kein Wunsch<br />
bleibt mehr offen für das besondere<br />
Radio-Vergnügen.<br />
Elrowa Radio TV Anstalt<br />
Anton Felder<br />
Gapetschstr. 50, Schaan
KUNSTDENKMÄLER<br />
Schmuckstück für Fotografen<br />
Kapelle St. Mamertus<br />
Wer erstmals auf dem Aussichtspunkt<br />
bei der Kapelle St. Mamertus<br />
steht, weiss nicht, ob er die<br />
herrliche Aussicht ins Rheintal<br />
geniessen oder die wunderschöne<br />
Kapelle bewundern soll. Auf<br />
Briefmarken wurde das schmu -<br />
cke Bauwerk verewigt, viele<br />
Künstler haben ihre Pinsel vor<br />
dem Schmuckstück geschwungen,<br />
unzählige Fotografen bannten<br />
schon das fotogene Kirchlein<br />
auf ihre Filme. Die Kapelle<br />
St. Mamerten, wie die Triesner<br />
sagen, gilt als der älteste Kirchenbau<br />
in Triesen. Ob das kleine<br />
Kirchlein auf dem Geländeplateau<br />
in der Nähe der Strasse hinauf nach Triesenberg<br />
tatsächlich die erste Triesner Pfarrkirche war, konnte<br />
noch nicht ganz geklärt werden. Die Kapelle mit<br />
dem markanten Turm hütet ihr kleines Geheimnis<br />
und lässt die Forscher weiter spekulieren.<br />
Ausgegrabene Grundrisse erlaubten<br />
den Archäologen die Festlegung, dass ein erstes<br />
Bauwerk im 9./10. Jahrhundert erstellt worden ist,<br />
das aber noch keinen Turm besass. In schriftlichen<br />
Quellen stiessen die Historiker auf einen Eintrag im<br />
Sulzisch-Hohenemsischen Urbar aus dem Jahre<br />
1415, der als erster urkundlicher Beweis für die<br />
Kapelle St. Mamertus gilt. Nach diesem Zeitpunkt<br />
scheint die Kapelle immer wieder in Schriftstücken<br />
auf: So wurde 1639 auf den schlechten baulichen<br />
Zustand des Kirchleins und die Einsturzgefahr des<br />
Turmes aufmerksam gemacht und 1721 die For -<br />
derung nach einer Instandstellung erhoben. Eine<br />
etwas frühere Anordnung, die Kapelle abzubrechen,<br />
Das Buch zum Thema<br />
Die Kunstdenkmäler des Fürs -<br />
ten tums Liechtenstein. Cornelia Hermann:<br />
Das Oberland. Gesellschaft für Schweizerische<br />
Kunst geschichte. 2007<br />
Foto: Marco Nescher<br />
ist zum Glück nicht ausgeführt Die Kapelle St. Mamertus in<br />
worden. Den Erhalt des Bauwerks Triesen gehört zu den schönsten<br />
sicherte wohl das Gutachten des kleinen Kirchen in Liechtenstein.<br />
Fürstlichen Oberingenieurs Gabriel<br />
Heiner im Jahre 1912, denn in der Folge kam es<br />
zu mehreren Renovationen, letztmals 2004/2005.<br />
Das kleine Geländeplateau, auf dem die Kapelle<br />
St. Mamertus thront, gehört zu den geschichtsträchtigen<br />
Orten unseres Landes. Mauerreste, Gräber,<br />
aber auch Pfeilspitzen, Eisenmesser, Hufeisenfragmente<br />
und Steigbügel lassen auf eine frühe Besiedlung<br />
schliessen. Ihre wechselvolle Geschichte hat die<br />
Kapelle aber bisher noch nicht preisgegeben, und<br />
auch die ausgegrabenen Überreste in ihrer Nähe<br />
gaben bislang keine abschliessende Auskunft. An<br />
den Wänden der Kapelle sind einige Malereien erhalten<br />
geblieben, die Szenen aus dem Leben Christi<br />
zeigen. Frühere Vermutungen, die Wandmalereien<br />
könnten im 15. Jahrhundert entstanden sein, konnten<br />
bei Restaurationsarbeiten 2006 etwas korrigiert<br />
werden, als man bei einem Gemälde auf die Jahrzahl<br />
1395 stiess. Das sich in der Kapelle befindliche Vesperbild<br />
mit Maria und dem toten Jesus, das auf die<br />
zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts datiert wurde, ist<br />
eine Kopie. Das Original ist gut geschützt im Liechtensteinischen<br />
Landesmuseum ausgestellt. |<br />
<strong>FEBRUAR</strong> 20<strong>08</strong><br />
27
28<br />
RÄTSEL-SPASS<br />
NEUES RÄTSEL: Wo befindet sich dieses Fenster<br />
in Liechtenstein?<br />
� Schloss Vaduz<br />
� Schloss Gutenberg, Balzers<br />
� Rathaus Vaduz<br />
Senden Sie die richtige Lösung mit dem Betreff «Fenster-Rätsel<br />
Februar <strong>08</strong>» an folgende Mail-Adresse und gewinnen Sie<br />
tolle Preise: wettbewerb@dermonat.li oder benutzen Sie eine<br />
Post karte und senden diese an Alpenland Verlag AG, Postfach,<br />
9494 Schaan.<br />
Einsendeschluss ist der 22. Februar <strong>08</strong>. Gewinner werden<br />
im Internet unter www.dermonat.li veröffentlicht!<br />
<strong>FEBRUAR</strong> 20<strong>08</strong><br />
Auflösung Sudoku Januar <strong>08</strong><br />
3 5 2 9 1 7 6 4 8<br />
4 6 9 8 3 5 2 7 1<br />
7 8 1 2 4 6 9 3 5<br />
8 2 4 5 7 9 1 6 3<br />
9 7 6<br />
1 2 3 5 8 4<br />
5 1 3 4 6 8 7 9 2<br />
1 9 7 3 5 4 8 2 6<br />
6 4 5 7 8 2 3 1 9<br />
2 3 8 6 9 1 4 5 7<br />
5 7 6 3 2 9 8 4 1<br />
4 8 9 1 6 7 5 3 2<br />
3 1 2 4 5 8 9 6 7<br />
1 3 4 9 8 5 2 7 6<br />
2 9 7 6 3 4 1 5 8<br />
6 5 8 2 7 1 3 9 4<br />
7 6 3 5 1 2 4 8 9<br />
8 4 1 7 9 3 6 2 5<br />
9 2 5 8 4 6 7 1 3<br />
Gewinnen Sie einen Gutschein<br />
im Wert von CHF 100.–
Er könnte, wenn man wollte<br />
<strong>Der</strong> neue Freelander 2 setzt neue Massstäbe<br />
Ausserordentliche Leistung<br />
auf der Strasse kombiniert sich<br />
mühelos mit der klasseführenden<br />
Geländetauglichkeit eines<br />
echten Land Rovers. So lautet die<br />
Werbung für den Freelander 2,<br />
der laut Werk neue Massstäbe in<br />
der kompakten 4x4-Premiumklasse<br />
setzt. Land Rover hatte<br />
über Jahre die Nase vorn, wenn es<br />
um geländetaugliche Fahrzeuge<br />
ging, die auch auf der normalen<br />
Strasse eine gute Figur machten.<br />
Doch die Konkurrenz schlief<br />
nicht. Toyota, Nissan, Hyundai,<br />
Mercedes oder BMW – alle schnitten sich ein Stück<br />
vom SUV-Kuchen ab. Jetzt hält Land Rover mit<br />
dem Freelander 2, der sich äusserlich nur dezent<br />
vom Vorgänger unterscheidet, aktiv dagegen. Das<br />
Beste am neuen Freelander sei seine Geländegängigkeit,<br />
die in der SUV-Mittelklasse tatsächlich<br />
Neues biete, schwärmen Autotester. Obwohl man<br />
weiss, dass die wenigsten Käufer wirklich im Gelände<br />
kurven. Wichtig ist das Gefühl, man könnte,<br />
wenn man wollte! Wer im Freelander 2 sitzt, muss<br />
sich nicht überrascht vorkommen, wenn einmal ein<br />
Schuh hoch Schnee auf der Strasse liegt oder der<br />
Weg ins Gebirge keine Ähnlichkeit mehr mit einer<br />
neu geteerten Autobahn hat. Dafür sorgen schon<br />
die kurzen Überhänge und der Rampenwinkel von<br />
34 Grad. ESP, Schlupfregelung und Kraftverteilung<br />
werden den verschiedenen Bodenbelägen angepasst,<br />
so dass sich der Freelander souverän über<br />
Steigungen und Hindernisse bewegt.<br />
Auch auf der Strasse macht der Freelander 2<br />
eine gute Figur. Ein kraftvoller Sound begleitet die<br />
317 Nm maximales Drehmo-<br />
ment, die beim 6-Zylinder mit<br />
3,2 Liter Hubraum für 233 PS<br />
sorgen. Dem bulligen Motor<br />
mangelt es nicht an Leistungsund<br />
Drehfreude, so dass das<br />
Fahrzeug den Spurt von Null auf<br />
Den Preis für dieses Inserat<br />
erfahren Sie unter<br />
Telefon 239 50 23<br />
AUTO<br />
100 in knapp 9 Sekunden schafft. Auf Wunsch ist der Freelander 2<br />
Gelobt werden die agilen Hand- auch mit einem Licht zu haben,<br />
lingeigenschaften auf der Strasse das um die Kurven gucken kann.<br />
und im Gelände. Über eine der<br />
vier verschiedenen Einstellungen optimiert das einzigartige<br />
Terrain-Response-System das Fahrverhalten<br />
und den Komfort. Die Traktion durch die elektronischen<br />
Systeme und Traktionshilfen werden<br />
ebenfalls damit maximiert. Bergabfahrkontrolle<br />
und Bremskraft-Entriegelungssteuerung sorgen<br />
automatisch für die richtige Bremskraft, um die Geschwindigkeit<br />
auf Gefällestrecken zu kontrollieren.<br />
Auf den Schutz der Insassen legte Land Rover<br />
besonderen Wert, denn man weiss ja nie, ob nicht<br />
jemand mit dem eleganten Wagen ins Gelände oder<br />
sonst an die Grenzen geht. Ein elektronischer<br />
Bremsassistent weist bei einer Notbremsung den<br />
Bremszylinder an, den Hydraulikdruck zu erhöhen,<br />
was den Bremsweg verringert. Die dynamische Stabilitätskontrolle<br />
hilft dem Fahrer, unter rutschigen<br />
Bedingungen die Kontrolle zu behalten, denn dieses<br />
System greift ein, wenn das<br />
Fahrzeug auf Lenkbewegungen<br />
nicht korrekt reagiert. Sicher<br />
können sich Fahrer und Fahr gäs -<br />
te zudem fühlen, weil sie wissen,<br />
dass nicht weniger als 7 Airbag-<br />
Module eingebaut wurden. |<br />
<strong>FEBRUAR</strong> 20<strong>08</strong><br />
Foto: Werkbild Landrover<br />
29
30<br />
SCHLUSSPUNKT<br />
Noldi Matt<br />
Leichtere Kredite für KMU<br />
<strong>Der</strong> Businessplan-Wettbewerb der Hochschule<br />
Liechtenstein ist angelaufen. Eine ausgezeichnete Idee, denn damit<br />
wird ein Funke angefacht für die Förderung des Unternehmertums in<br />
unserem Land und in der angrenzenden Region. Dem Sieger winken<br />
hohe Investitionsgelder des Landes<br />
und einer Investorengruppe, Banken kommt eine Verantwortung zu, die sich auch<br />
die eine gute Startchance für ein<br />
neues Unternehmen bilden.Doch über die Bereitstellung von Risikokapital erstreckt<br />
nicht jeder innovative Unternehmer<br />
steht zuoberst auf dem Businessplan-Treppchen, was in der Regel<br />
bedeutet, dass eine Start-up-Finanzierung mit fremden Mitteln notwendig<br />
wird. Keine einfache Sache, denn die Banken verlangen nach<br />
Sicherheiten, die nicht jeder Jungunternehmer<br />
vorweisen kann. «Wir finanzieren Start-ups in der<br />
Regel nicht, da sie ja noch keinen Leistungsausweis<br />
vorlegen können und damit ein hohes Finanzierungsrisiko<br />
darstellen», sagte kürzlich ein Banker.<br />
Ich wählte bewusst den Ausspruch eines schweizerischen<br />
Bankers, aus zwei Gründen: Erstens sind kleinere<br />
Unterschiede bei der Kreditgewährung durch<br />
die Banken vorhanden, so dass nicht alle über einen<br />
Leisten geschlagen werden können und zweitens<br />
kann damit ausgedrückt werden, dass die Situation<br />
Noldi Matt<br />
in unserem Land gar nicht so unähnlich wie in der<br />
Präsident der Wirtschafts- Schweiz ist. Was nützt der schönste Businessplan,<br />
kammer Liechtenstein<br />
wenn nachher die Finanzierung der unternehmerischen<br />
Idee scheitert? Wenn wir weiterhin eine erfolgreiche<br />
Volkswirtschaft sein wollen, dann brauchen wir neue Unternehmer,<br />
die ein gewisses Risiko auf sich nehmen. Wenn aber niemand<br />
bereit ist, dieses Risiko mitzutragen?<br />
Es gibt nicht nur den Finanzplatz Liechtenstein, sondern<br />
auch den Werkplatz, der sehr diversifiziert ist und ebenfalls zum<br />
«Wirtschaftswunder Liechtenstein» beigetragen hat. In diesem Umfeld<br />
kommt den Banken eine volkswirtschaftliche Verantwortung zu, die<br />
sich auch über ein gewisses Mass an Bereitstellung von Risikokapital erstreckt.<br />
Die liechtensteinischen Banken machten im Jahre 2006 gesamthaft<br />
Reingewinne von über 600 Mio. Franken. Wenn nur ein halbes<br />
Prozent in einen Risikofonds gelegt würde, der zur Finanzierung von<br />
Jungunternehmen verwendet wird, dann wäre schon einiges getan. Dabei<br />
meine ich nicht, dass Geschenke gemacht werden sollten, sondern<br />
dass normale Kredite vergeben werden. Vor allem für jene Jungunternehmer,<br />
die kein Grundstück als Sicherheit anbieten können, aber dennoch<br />
eine zündende, zukunftsgerichtete Geschäftsidee haben. |<br />
<strong>FEBRUAR</strong> 20<strong>08</strong><br />
Foto: Wirtschaftskammer Liechtenstein
VON DER IDEE BIS ZUR UMSETZUNG<br />
Als Medienunternehmen führen wir Botschaften zum Erfolg.<br />
Kompetent. Persönlich. Flexibel. Preis- und qualitätsbewusst.<br />
Gutenberg AG<br />
Feldkircher Strasse 13<br />
FL-9494 Schaan<br />
Tel. +423 239 50 50<br />
office@gutenberg.li<br />
www.gutenberg.li<br />
Gutenberg printing performance<br />
Innovative Partner – hochwertige Verlagsobjekte:<br />
www.digiprint.li<br />
www.alpenlandverlag.li<br />
www.buchzentrum.li<br />
www.dermonat.li
��������������<br />
����������������<br />
����������<br />
��������������������������������������