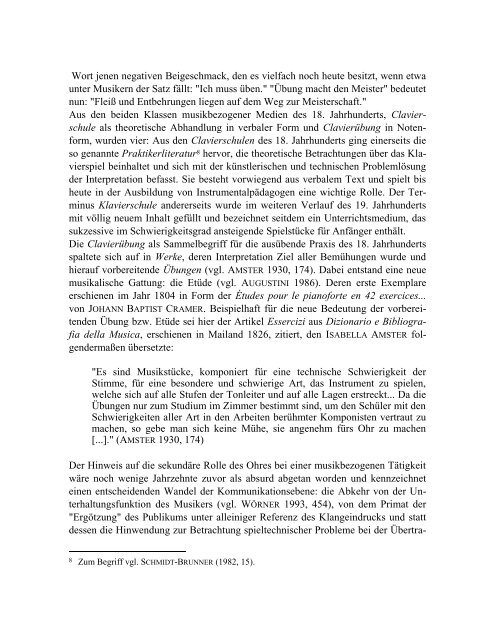1. Einleitung - Heiner Klug
1. Einleitung - Heiner Klug
1. Einleitung - Heiner Klug
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Wort jenen negativen Beigeschmack, den es vielfach noch heute besitzt, wenn etwa<br />
unter Musikern der Satz fällt: "Ich muss üben." "Übung macht den Meister" bedeutet<br />
nun: "Fleiß und Entbehrungen liegen auf dem Weg zur Meisterschaft."<br />
Aus den beiden Klassen musikbezogener Medien des 18. Jahrhunderts, Clavierschule<br />
als theoretische Abhandlung in verbaler Form und Clavierübung in Notenform,<br />
wurden vier: Aus den Clavierschulen des 18. Jahrhunderts ging einerseits die<br />
so genannte Praktikerliteratur 8 hervor, die theoretische Betrachtungen über das Klavierspiel<br />
beinhaltet und sich mit der künstlerischen und technischen Problemlösung<br />
der Interpretation befasst. Sie besteht vorwiegend aus verbalem Text und spielt bis<br />
heute in der Ausbildung von Instrumentalpädagogen eine wichtige Rolle. Der Terminus<br />
Klavierschule andererseits wurde im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts<br />
mit völlig neuem Inhalt gefüllt und bezeichnet seitdem ein Unterrichtsmedium, das<br />
sukzessive im Schwierigkeitsgrad ansteigende Spielstücke für Anfänger enthält.<br />
Die Clavierübung als Sammelbegriff für die ausübende Praxis des 18. Jahrhunderts<br />
spaltete sich auf in Werke, deren Interpretation Ziel aller Bemühungen wurde und<br />
hierauf vorbereitende Übungen (vgl. AMSTER 1930, 174). Dabei entstand eine neue<br />
musikalische Gattung: die Etüde (vgl. AUGUSTINI 1986). Deren erste Exemplare<br />
erschienen im Jahr 1804 in Form der Études pour le pianoforte en 42 exercices...<br />
von JOHANN BAPTIST CRAMER. Beispielhaft für die neue Bedeutung der vorbereitenden<br />
Übung bzw. Etüde sei hier der Artikel Essercizi aus Dizionario e Bibliografia<br />
della Musica, erschienen in Mailand 1826, zitiert, den ISABELLA AMSTER folgendermaßen<br />
übersetzte:<br />
"Es sind Musikstücke, komponiert für eine technische Schwierigkeit der<br />
Stimme, für eine besondere und schwierige Art, das Instrument zu spielen,<br />
welche sich auf alle Stufen der Tonleiter und auf alle Lagen erstreckt... Da die<br />
Übungen nur zum Studium im Zimmer bestimmt sind, um den Schüler mit den<br />
Schwierigkeiten aller Art in den Arbeiten berühmter Komponisten vertraut zu<br />
machen, so gebe man sich keine Mühe, sie angenehm fürs Ohr zu machen<br />
[...]." (AMSTER 1930, 174)<br />
Der Hinweis auf die sekundäre Rolle des Ohres bei einer musikbezogenen Tätigkeit<br />
wäre noch wenige Jahrzehnte zuvor als absurd abgetan worden und kennzeichnet<br />
einen entscheidenden Wandel der Kommunikationsebene: die Abkehr von der Unterhaltungsfunktion<br />
des Musikers (vgl. WÖRNER 1993, 454), von dem Primat der<br />
"Ergötzung" des Publikums unter alleiniger Referenz des Klangeindrucks und statt<br />
dessen die Hinwendung zur Betrachtung spieltechnischer Probleme bei der Übertra-<br />
8 Zum Begriff vgl. SCHMIDT-BRUNNER (1982, 15).<br />
43