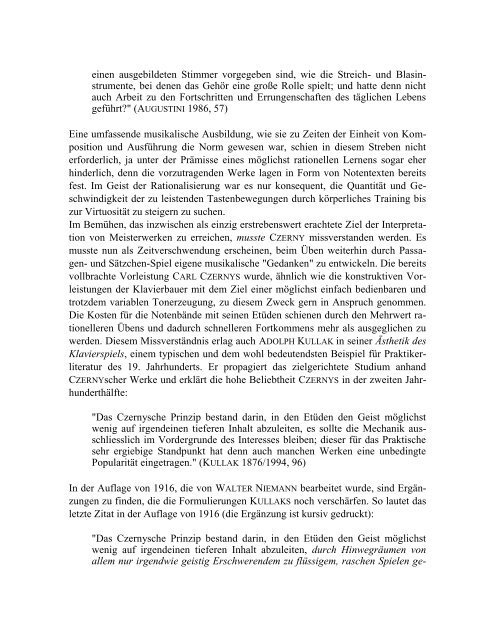1. Einleitung - Heiner Klug
1. Einleitung - Heiner Klug
1. Einleitung - Heiner Klug
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
einen ausgebildeten Stimmer vorgegeben sind, wie die Streich- und Blasinstrumente,<br />
bei denen das Gehör eine große Rolle spielt; und hatte denn nicht<br />
auch Arbeit zu den Fortschritten und Errungenschaften des täglichen Lebens<br />
geführt?" (AUGUSTINI 1986, 57)<br />
Eine umfassende musikalische Ausbildung, wie sie zu Zeiten der Einheit von Komposition<br />
und Ausführung die Norm gewesen war, schien in diesem Streben nicht<br />
erforderlich, ja unter der Prämisse eines möglichst rationellen Lernens sogar eher<br />
hinderlich, denn die vorzutragenden Werke lagen in Form von Notentexten bereits<br />
fest. Im Geist der Rationalisierung war es nur konsequent, die Quantität und Geschwindigkeit<br />
der zu leistenden Tastenbewegungen durch körperliches Training bis<br />
zur Virtuosität zu steigern zu suchen.<br />
Im Bemühen, das inzwischen als einzig erstrebenswert erachtete Ziel der Interpretation<br />
von Meisterwerken zu erreichen, musste CZERNY missverstanden werden. Es<br />
musste nun als Zeitverschwendung erscheinen, beim Üben weiterhin durch Passagen-<br />
und Sätzchen-Spiel eigene musikalische "Gedanken" zu entwickeln. Die bereits<br />
vollbrachte Vorleistung CARL CZERNYS wurde, ähnlich wie die konstruktiven Vorleistungen<br />
der Klavierbauer mit dem Ziel einer möglichst einfach bedienbaren und<br />
trotzdem variablen Tonerzeugung, zu diesem Zweck gern in Anspruch genommen.<br />
Die Kosten für die Notenbände mit seinen Etüden schienen durch den Mehrwert rationelleren<br />
Übens und dadurch schnelleren Fortkommens mehr als ausgeglichen zu<br />
werden. Diesem Missverständnis erlag auch ADOLPH KULLAK in seiner Ästhetik des<br />
Klavierspiels, einem typischen und dem wohl bedeutendsten Beispiel für Praktikerliteratur<br />
des 19. Jahrhunderts. Er propagiert das zielgerichtete Studium anhand<br />
CZERNYscher Werke und erklärt die hohe Beliebtheit CZERNYS in der zweiten Jahrhunderthälfte:<br />
"Das Czernysche Prinzip bestand darin, in den Etüden den Geist möglichst<br />
wenig auf irgendeinen tieferen Inhalt abzuleiten, es sollte die Mechanik ausschliesslich<br />
im Vordergrunde des Interesses bleiben; dieser für das Praktische<br />
sehr ergiebige Standpunkt hat denn auch manchen Werken eine unbedingte<br />
Popularität eingetragen." (KULLAK 1876/1994, 96)<br />
In der Auflage von 1916, die von WALTER NIEMANN bearbeitet wurde, sind Ergänzungen<br />
zu finden, die die Formulierungen KULLAKS noch verschärfen. So lautet das<br />
letzte Zitat in der Auflage von 1916 (die Ergänzung ist kursiv gedruckt):<br />
"Das Czernysche Prinzip bestand darin, in den Etüden den Geist möglichst<br />
wenig auf irgendeinen tieferen Inhalt abzuleiten, durch Hinwegräumen von<br />
allem nur irgendwie geistig Erschwerendem zu flüssigem, raschen Spielen ge-<br />
49