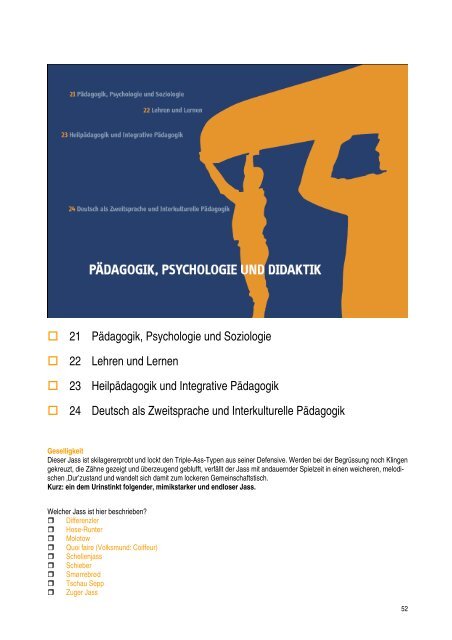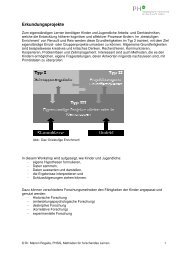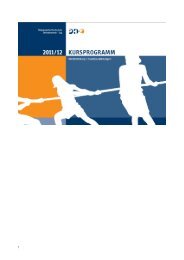20 Pädagogik Psychologie Didaktik - PHZ Zug
20 Pädagogik Psychologie Didaktik - PHZ Zug
20 Pädagogik Psychologie Didaktik - PHZ Zug
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
� 21 <strong>Pädagogik</strong>, <strong>Psychologie</strong> und Soziologie<br />
� 22 Lehren und Lernen<br />
� 23 Heilpädagogik und Integrative <strong>Pädagogik</strong><br />
� 24 Deutsch als Zweitsprache und Interkulturelle <strong>Pädagogik</strong><br />
Geselligkeit<br />
Dieser Jass ist skilagererprobt und lockt den Triple-Ass-Typen aus seiner Defensive. Werden bei der Begrüssung noch Klingen<br />
gekreuzt, die Zähne gezeigt und überzeugend geblufft, verfällt der Jass mit andauernder Spielzeit in einen weicheren, melodischen<br />
‚Dur’zustand und wandelt sich damit zum lockeren Gemeinschaftstisch.<br />
Kurz: ein dem Urinstinkt folgender, mimikstarker und endloser Jass.<br />
Welcher Jass ist hier beschrieben?<br />
� Differenzler<br />
� Hose-Runter<br />
� Molotow<br />
� Quoi faire (Volksmund: Coiffeur)<br />
� Schellenjass<br />
� Schieber<br />
� Smørrebrød<br />
� Tschau Sepp<br />
� <strong>Zug</strong>er Jass<br />
52
53<br />
21 PÄDAGOGIK, PSYCHOLOGIE UND SOZIOLOGIE<br />
<strong>Pädagogik</strong>, <strong>Psychologie</strong> und Soziologie<br />
21.01 AUF DEN SPUREN VON J. H. PESTALOZZI - IN DER SCHWEIZ UND IN CHINA<br />
Stufenübergreifend<br />
Die Wirkungsgeschichte Pestalozzis ist ein spannendes Feld, das sich weit über die<br />
Schweiz hinaus erstreckt. Pestalozzis Gedankengut bietet reichlich Ansatzpunkte, um sich<br />
auf grundlegende pädagogische Werte zu besinnen. Durch die gemeinsame<br />
Auseinandersetzung mit diesem weltbekannten Schweizer Pädagogen ermöglicht das<br />
Symposium einen Austausch zwischen Kulturen zu einer grundlegenden Thematik: der<br />
Bildung.<br />
Ziele<br />
� Auseinandersetzung mit Leben und Werk Pestalozzis<br />
� Suche nach Spuren Pestalozzis in China und in der Schweiz<br />
� Vergleich der Pestalozzi-Rezeption in China und in der Schweiz<br />
� Aufspüren historischer Wirkungsstätten Pestalozzis in der Schweiz<br />
Inhalte<br />
� Pestalozzi-Rezeption in China und der Schweiz (10.4.<strong>20</strong>12)<br />
� Pestalozzis Bildungsverständnis und die heutige Schule (11.4.<strong>20</strong>12)<br />
� Auf den Spuren Pestalozzis - Besuch von Schweizer Schulen (12.4.<strong>20</strong>12)<br />
� Auf den Spuren Pestalozzis - Besuch von Wirkungsstätten (13.4.<strong>20</strong>12)<br />
Arbeitsweise<br />
� Ateliers, Workshops, Referate (10. & 11.4.<strong>20</strong>12)<br />
� Schulbesuche (12.4.<strong>20</strong>12)<br />
� Exkursionen zu Wirkungsstätten Pestalozzis (13.4.<strong>20</strong>12)<br />
Roger Dettling, Meierskappel - Dozent <strong>PHZ</strong><br />
Guido Estermann, Kriens - Religionspädagoge, Dozent <strong>PHZ</strong><br />
21.02 MONTESSORI PÄDAGOGIK – AKTUELLER DENN JE<br />
Kindergarten, Unterstufe<br />
Ziele, Inhalte<br />
� Einblick in die Montessoripädagogik<br />
� Transfer in den eigenen Schulraum<br />
� Einblick in das Montessori Kinderhaus<br />
� sensible Phasen nach Maria Montessori<br />
� didaktische Hilfsmittel für den Umgang mit Heterogenität<br />
� Aufbau des Sprachbereichs sowie des Mathematikbereichs nach Maria Montessori<br />
� Material für den Unterricht herstellen<br />
Sabrina Balzano, Luzern - Kindergartenlehrperson, Montessoripädagogin<br />
Regula Mathis-Berther, Sursee - Schul. Heilpädagogin, Montessoripädagogin<br />
DI-MI 09.00-17.00<br />
DO-FR 08.00-18.00<br />
10.04./ 11.04./ 12.04./ 13.04.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
33 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern, externer Besuch von<br />
Schulen und Wirkungsstätten<br />
Pestalozzis<br />
Bemerkungen<br />
Materialkosten: 10.04./11.04.<strong>20</strong>12:<br />
je CHF 15.00 für Skript;<br />
12.04./13.04.<strong>20</strong>12: Ca. CHF<br />
100.00 Reisekosten mit Halbtax,<br />
ca. CHF 100.00 Verpflegung und<br />
Übernachtung<br />
3 MI-Nachmittage 14.00-17.00<br />
07.03./ 14.03./ 21.03.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
9 Std.<br />
Kursort<br />
Sursee, LU
<strong>Pädagogik</strong>, <strong>Psychologie</strong> und Soziologie<br />
21.03 ERLEBNISPÄDAGOGISCHES ARBEITEN MIT SCHULKLASSEN<br />
Stufenübergreifend<br />
Ziele<br />
Die Lehrpersonen kennen Möglichkeiten, in der Natur an Klassen- und individuellen Zielen<br />
zu arbeiten.<br />
Inhalte<br />
� Kooperatives Arbeiten, z.B. gemeinsames Kochen, Feuer machen<br />
� Naturräume als Lernräume gestalten und einsetzen<br />
� Arbeit an der Sozial- und Selbstkompetenz (Teambildung)<br />
� Bewusstmachen der eigenen Ressourcen<br />
Arbeitsweise: Der Kurs findet ausschliesslich im Freien statt.<br />
Transfer: Verknüpfen der positiven Naturerlebnisse mit dem Schulalltag.<br />
Claudia Arnold, Ennetbürgen – Lehrerin, dipl. Erlebnispädagogin HF<br />
Sybille Hänggi, Engelberg – Lehrerin, Erlebnispädagogin<br />
2 Samstage 09.00-17.00<br />
03.09.<strong>20</strong>11/ 14.01.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
7 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton Obwalden<br />
21.04 INDIVIDUELLES UND TEILAUTONOMES LERNEN IN DER GRUNDACHER<br />
SCHULE<br />
Kindergarten, Primarstufe, Schulsozialarbeitende<br />
In unserer kleinen Schule mit Basis- und Primarstufe setzen wir vor allem auf<br />
individualisierendes, altersgemischtes und teilautonomes Lernen. So können alle Kinder<br />
erfolgreich lernen. Dieses System fördert und fordert die Selbständigkeit und Kreativität der<br />
Kinder. Es unterstützt ressourcenorientierte Selbst- und Fremdbeurteilung. Jedem Kind<br />
gerecht zu werden ist eines der wichtigsten Ziele unserer Schule.<br />
Inhalte<br />
Wir stellen unseren Schulalltag vor und erläutern die Bedingungen, die für die Umsetzung<br />
unserer Idee erfüllt sein müssen. Wir geben konkrete organisatorische Tipps, die das<br />
Arbeiten in der heterogenen Gruppe erleichtern. Wir stellen auch gutes Lernmaterial und<br />
selbsterklärende Lehrmittel vor, die sich für den individualisierenden und altersgemischten<br />
Unterricht eignen. Es bleibt auch Zeit für individuelle Fragen und Anliegen der<br />
Kursteilnehmenden.<br />
Karin Anderhalden Steiner, Sarnen - Kindergartenlehrperson, Schulleiterin<br />
Victor Steiner, Alpnach Dorf – Schulleitung<br />
1 Samstag 08.30-16.30<br />
29.10.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
7 Std.<br />
Kursort<br />
Sarnen, OW<br />
54
55<br />
<strong>Pädagogik</strong>, <strong>Psychologie</strong> und Soziologie<br />
21.05 KRITISCHE AUSEINANDERSETZUNG MIT ERZIEHUNGSSTRATEGIEN<br />
Kindergarten, Unterstufe, Mittelstufe 1, SHP<br />
Ziele<br />
� Bewusste Auseinandersetzung mit verschiedenen Erziehungsstrategien zur Zeit<br />
gängiger Erziehungs-Kursangebote für Eltern: Triple P, STEP, Stark durch Erziehung,<br />
Stark durch Beziehung und Freiheit in Grenzen sowie mit ergänzenden<br />
Alltagsstrategien<br />
� Diskussion über Vor- und Nachteile einzelner Strategien<br />
� Transfer von der Theorie in die Praxis<br />
Inhalte<br />
Zu Erziehungsfragen gibt es für Eltern vielfältige Angebote in Form von Kursen, Literatur,<br />
Internet, und Fernsehsendungen. Diese Informationsflut stärkt nicht nur, sondern löst<br />
oftmals auch Verunsicherung aus. Pädagogisch tätige Fachpersonen werden durch die<br />
enge Zusammenarbeit mit Eltern aufgerufen, sich mit unterschiedlichen Erziehungsausrichtungen<br />
auseinander zu setzen, um fachlich fundierte Diskussionen und konstruktive<br />
Auseinandersetzungen mit Eltern führen zu können.<br />
Es werden unterschiedliche Erziehungsansätze kritisch beleuchtet, verglichen, diskutiert<br />
und in Bezug gesetzt, auch zu konkreten Beispielen aus der Praxis.<br />
Dagmar Böhler-Kreitlow, Meggen - Heilpädagogin, Audiopädagogin<br />
1 Samstag 09.00-16.00<br />
26.11.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
6 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong><br />
21.06 WIE KINDER SICH UND DIE WELT SEHEN. ENTWICKLUNGSSCHRITTE DER<br />
JÜNGSTEN<br />
Kindergarten, Unterstufe, Mitarbeitende für Tagesstruktur, Schulsozialarbeitende<br />
Der Kurs gibt eine Übersicht über die für den Unterricht relevanten Aspekte der kognitiven<br />
und motivationalen Entwicklung. Im Zentrum steht das Wissen und Erleben der Kinder<br />
zwischen vier und acht Jahren:<br />
� Welche kognitiven Fähigkeiten (Wahrnehmung, Denken, Gedächtnis) können in<br />
welchem Alter vorausgesetzt werden?<br />
� Wie generieren und organisieren Kinder Wissen über die physikalische und soziale<br />
Umwelt?<br />
� Worin wurzelt das kindliche Verständnis von Kausalität und Intentionalität?<br />
� Wie vollzieht sich die motivationale Entwicklung der Kinder zwischen Sicherheit und<br />
Autonomie?<br />
� Wie entwickelt sich beispielsweise die Leistungsmotivation?<br />
� Wann erreichen Kinder die Fähigkeit, Bedürfnisse aufzuschieben?<br />
Trix Cacchione, Ebikon - Psychologin<br />
3 DO-Abende 18.00-21.00<br />
26.04./ 03.05./ 10.05.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
9 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern
<strong>Pädagogik</strong>, <strong>Psychologie</strong> und Soziologie<br />
21.07A PUBERTIERENDE BESSER VERSTEHEN<br />
Mittelstufe 2<br />
Pubertierende leben in einer "Zwischenwelt" zwischen Kindheit und Erwachsensein. Sie<br />
sollen sich ablösen und selbstständig werden, gleichzeitig müssen sie sich anpassen und<br />
verschiedensten Anforderungen genügen. Ihr Gehirn wird in dieser Zeit nach<br />
neurologischen Erkenntnissen massiv umgebaut und funktioniert nur teilweise so, wie man<br />
es von ihnen erwartet. Ihr Realitätsbezug kommt ihnen phasenweise abhanden. Deshalb<br />
sind sie suchtgefährdet und verhalten sich oft parasuizidal.<br />
Ziele, Inhalte<br />
� Den Teilnehmenden wird das nötige Fachwissen vermittelt, damit sie die Bedürfnisse<br />
Pubertierender verstehen und auf ihr Verhalten (im Klassenzimmer) adäquat reagieren<br />
bzw. Eltern beraten können.<br />
� Diskussionen zu entwicklungsbedingten Gefahren und zur Notwendigkeit, Grenzen zu<br />
setzen werden angeregt.<br />
� Themen wie Peer-Groups, Lernschwierigkeiten und Verhaltensprobleme sowie deren<br />
Bewältigung werden angesprochen.<br />
� Die Bedürfnisse der Erwachsenen (Selbstwahrnehmung/Abgrenzung) werden ebenfalls<br />
thematisiert.<br />
Walter Wolf, Rüti - Schulleiter, Psychologe, Paar- und Familientherapeut<br />
21.07B PUBERTIERENDE BESSER VERSTEHEN<br />
Sekundarstufe 1<br />
Pubertierende leben in einer "Zwischenwelt" zwischen Kindheit und Erwachsensein. Sie<br />
sollen sich ablösen und selbstständig werden, gleichzeitig müssen sie sich anpassen und<br />
verschiedensten Anforderungen genügen. Ihr Gehirn wird in dieser Zeit nach<br />
neurologischen Erkenntnissen massiv umgebaut und funktioniert nur teilweise so, wie man<br />
es von ihnen erwartet. Ihr Realitätsbezug kommt ihnen phasenweise abhanden. Deshalb<br />
sind sie suchtgefährdet und verhalten sich oft parasuizidal.<br />
Ziele, Inhalte<br />
� Den Teilnehmenden wird das nötige Fachwissen vermittelt, damit sie die Bedürfnisse<br />
Pubertierender verstehen und auf ihr Verhalten (im Klassenzimmer) adäquat reagieren<br />
bzw. Eltern beraten können.<br />
� Diskussionen zu entwicklungsbedingten Gefahren und zur Notwendigkeit, Grenzen zu<br />
setzen werden angeregt.<br />
� Themen wie Peer-Groups, Lernschwierigkeiten und Verhaltensprobleme sowie deren<br />
Bewältigung werden angesprochen.<br />
� Die Bedürfnisse der Erwachsenen (Selbstwahrnehmung/Abgrenzung) werden ebenfalls<br />
thematisiert.<br />
Walter Wolf, Rüti - Schulleiter, Psychologe, Paar- und Familientherapeut<br />
3 MI-Nachmittage 14.00-17.00<br />
07.09./ 14.09./ 21.09.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
9 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong><br />
3 MI-Nachmittage 14.00-17.00<br />
16.11./ 23.11./ 30.11.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
9 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong><br />
56
57<br />
21.08A GESCHWISTER UND IHRE BEDEUTUNG<br />
Primarstufe<br />
Geschwisterbeziehungen werden bis heute – auch von Fachleuten – in ihrer Bedeutung für<br />
den Menschen immer noch unterschätzt. Der Kurs möchte dazu wichtige Erkenntnisse und<br />
Anregungen vermitteln.<br />
Ziele: Die Teilnehmenden<br />
� verfügen über zentrale Erkenntnisse der Geschwisterpsychologie.<br />
� vertiefen ihr Verständnis für die Bedeutung von Geschwisterbeziehungen.<br />
� entwickeln Anregungen und Ideen für die konkrete Umsetzung.<br />
� reflektieren die eigene Geschwisterkonstellation.<br />
Inhalte<br />
� Geschwisterkonstellationen und -positionen<br />
� Einflussfaktoren und Bedeutung<br />
� Auswirkungen in Kindergarten, Schule und Kollegium<br />
� Anregungen für die Schulpraxis<br />
Arbeitsweise<br />
Kurzreferate, Gruppenarbeiten, Filmausschnitte, Fallbeispiele<br />
Jürg Frick, Zürich - Prof. Dr., Dozent und Berater <strong>PHZ</strong>H<br />
21.08B GESCHWISTER UND IHRE BEDEUTUNG<br />
Sekundarstufe 1<br />
Geschwisterbeziehungen werden bis heute – auch von Fachleuten – in ihrer Bedeutung für<br />
den Menschen immer noch unterschätzt. Der Kurs möchte dazu wichtige Erkenntnisse und<br />
Anregungen vermitteln.<br />
Ziele: Die Teilnehmenden<br />
� verfügen über zentrale Erkenntnisse der Geschwisterpsychologie.<br />
� vertiefen ihr Verständnis für die Bedeutung von Geschwisterbeziehungen.<br />
� entwickeln Anregungen und Ideen für die konkrete Umsetzung.<br />
� reflektieren die eigene Geschwisterkonstellation.<br />
Inhalte<br />
� Geschwisterkonstellationen und -positionen<br />
� Einflussfaktoren und Bedeutung<br />
� Auswirkungen in Kindergarten, Schule und Kollegium<br />
� Anregungen für die Schulpraxis<br />
Arbeitsweise<br />
Kurzreferate, Gruppenarbeiten, Filmausschnitte, Fallbeispiele<br />
Jürg Frick, Zürich - Prof. Dr., Dozent und Berater <strong>PHZ</strong>H<br />
<strong>Pädagogik</strong>, <strong>Psychologie</strong> und Soziologie<br />
1 Samstag 08.30-16.30<br />
19.11.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
6.5 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong><br />
Bemerkungen<br />
Literaturhinweis: Frick, J.; Ich mag<br />
dich – du nervst mich!<br />
Geschwister und ihre Bedeutung<br />
für das Leben; <strong>20</strong>09, 3. Auflage;<br />
Huber, Bern<br />
1 Samstag 08.30-16.30<br />
10.12.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
6.5 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong><br />
Bemerkungen<br />
Literaturhinweis: Frick, J.: Ich mag<br />
dich – du nervst mich!<br />
Geschwister und ihre Bedeutung<br />
für das Leben. <strong>20</strong>09; 3. Auflage.<br />
Huber, Bern
<strong>Pädagogik</strong>, <strong>Psychologie</strong> und Soziologie<br />
21.09 «SCHWIERIGE KINDER» – HERAUSFORDERUNGEN IN TAGESSTRUKTUREN<br />
GEMEINSAM MEISTERN<br />
Mitarbeitende in Tagesstrukturen<br />
Die Betreuungssituation in schul- und familienergänzenden Tagesstrukturen ist komplex,<br />
fordert viel und nicht selten Widersprüchliches von den Mitarbeitern. Erwartungen und<br />
Bedürfnisse von verschiedenen Seiten treffen aufeinander und das mitten im aktuellen<br />
Tagesgeschehen. «Schwierige Kinder» und «anspruchsvolle Familiensituationen» stellen<br />
Mitarbeitende vor besondere Herausforderungen.<br />
Ziele<br />
� die Handlungskompetenz von Betreuenden in Tagesstrukturen insbesondere im<br />
Umgang mit «schwierigen Kindern» stärken<br />
� Zuständigkeiten klären<br />
� die Zusammenarbeit im Team fördern<br />
Inhalte<br />
� Vermittlung von Hintergrundwissen zu Rolle und Funktion der verschiedenen Personen<br />
im Umfeld von Bildung<br />
� Reflexion aktueller Problemstellungen und konkreter Situationen<br />
� Auseinandersetzung mit den besonderen Anforderungen von und durch «schwierige<br />
Kinder»<br />
� Zusammenarbeit im Team betrachten und eventuell verbessern<br />
Arbeitsweise<br />
Referat, Dialog, Fallbesprechung - Lösungsorientiertes Coaching<br />
Silke Ziegler, Emmendingen (D) – Coaching<br />
3 MI-Nachmittage 14.00-17.00<br />
28.09./ 26.10./ 09.11.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
9 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern<br />
58
59<br />
<strong>Pädagogik</strong>, <strong>Psychologie</strong> und Soziologie<br />
21.10 VERHALTENSAUFFÄLLIGKEITEN: AGGRESSIVES VERHALTEN IM<br />
KINDESALTER<br />
Kindergarten, Unterstufe, SHP<br />
Ziele<br />
� Ätiologie von aggressivem Verhalten kennen lernen<br />
� Entwicklungsaufgaben und entwicklungspsychologische Aspekte in die Thematik<br />
einbeziehen<br />
� Reflexion der eigenen Gefühle im Umgang mit Aggressionen<br />
� Praktische Anregungen für den Alltag erarbeiten und auswerten<br />
Inhalte<br />
Im Rahmen eines theoretischen Teils soll ein Basiswissen über aggressives Verhalten<br />
geschaffen werden. Dazu gehören: Begriffsdefinitionen, Klärung möglicher Ursachen und<br />
Hintergründe, Einbezug von Entwicklungsaufgaben, entwicklungspsychologischen<br />
Aspekten und Reaktionsmöglichkeiten. In einem praktischen Teil geht es darum, die<br />
Problematik im Berufsalltag zu reflektieren, eigene Gefühle im Prozess wahrzunehmen<br />
und realisierbare Interventionen zu erarbeiten. Die Kursteilnehmenden sind eingeladen,<br />
eigene Alltagsbeispiele einzubringen. Nach einer Erprobungsphase werden an einem 2.<br />
Kurstag die Praxiserfahrungen der umgesetzten Interventionen diskutiert.<br />
Arbeitsweise: Der Kurs beinhaltet eine Mischform von Referat/Fachinput, Workshop,<br />
Evaluation und Erfahrungsaustausch.<br />
Laila Huisman, Pfäffikon SZ - Schulpsychologin<br />
21.11 WENN KINDER GEWALT ERLEBEN<br />
Kindergarten, Primarstufe<br />
Wenn Kinder von häuslicher und/oder sexueller Gewalt betroffen sind, können<br />
Lehrpersonen oft erste Ansprechpersonen in der Not sein. Vielleicht haben Sie als Lehrerin<br />
oder Lehrer einen ersten Verdacht, oder das Kind erzählt ihnen davon. Das wird Sie<br />
möglicherweise beunruhigen oder Sie unter Druck setzen. Sie haben das Gefühl,<br />
unbedingt etwas unternehmen zu müssen. Oftmals sind aber überstürzte Schritte wenig<br />
hilfreich für das Kind. Gewalt spielt sich aber auch in der Schule unter Kindern ab. Oft<br />
erleben sie untereinander grenzverletzende, von Gewalt geprägte Situationen. Als Lehrer<br />
oder Lehrerin sind Sie auch da gefordert, hin- und nicht wegzuschauen.<br />
Ziele, Inhalte<br />
Je mehr Sie über Grenzverletzungen, häusliche und sexuelle Gewalt wissen, desto besser<br />
können Sie betroffene Kinder unterstützen. Wir erarbeiten gemeinsam Hintergrundwissen<br />
zu diesen Themen und zeigen Ihnen Wege für vernetztes Handeln auf.<br />
Franz Kälin, <strong>Zug</strong> - lic. phil., Psychologe<br />
Marie-Therese Elsener, <strong>Zug</strong> - Sozialarbeiterin<br />
1 Samstag 08.30-16.30<br />
1 MI-Nachmittag 13.30-16.30<br />
29.10.<strong>20</strong>11/ 04.04.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
9 Std.<br />
Kursort<br />
Goldau, SZ<br />
2 MI-Nachmittage 14.00-17.00 /<br />
14.00-16.30<br />
07.09./ 14.09.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
5.5 Std.<br />
Kursort<br />
<strong>Zug</strong>, eff-zett das fachzentrum<br />
Bemerkungen<br />
14.09.11 GV-LVZ ab 17.00 Uhr
<strong>Pädagogik</strong>, <strong>Psychologie</strong> und Soziologie<br />
21.12 JUGENDGEWALT: KLARE INTERVENTION UND WIRKSAME PRÄVENTION AN<br />
SCHULEN<br />
Mittelstufe 2, Sekundarstufe 1, SHP, Lehrpersonen für Integrative Förderung, Schulsozialarbeitende,<br />
Schulleitende<br />
Ziele<br />
Jugendliche mental stärken und der Entwicklung der Jugendgewalt an Schulen wirksam<br />
Einhalt gebieten.<br />
Inhalte<br />
� Wer sind die gewalttätig gewordenen Jugendlichen? (Ausmass und Entwicklung)<br />
� Wie sieht die Praxis der Jugendstrafrechtspflege und der Schule aus?<br />
(Rückfallverhinderung, Intervention, Sozialisation, Ausschluss als letzte Massnahme?)<br />
� Wie verhalte ich mich gegenüber diesen Jugendlichen? (Klare Interventionsstrategien,<br />
Prävention mit bewährten Ansätzen)<br />
� Welche Antworten haben wir als Lehrpersonen, als Gesellschaft? (Interventionsbedarf<br />
in Schule, Familie und Sozialraum)<br />
Arbeitsweise<br />
Kurzreferate, Inputreferate, Erfahrungsberichte aus Schule und strafrechtlichem<br />
Massnahmenvollzug, Präventions- und Integrationsstrategien<br />
Sonya Gassmann, Bern - Berufsschullehrerin, Sozial- und Rechtspsychologin<br />
3 MI-Nachmittage 14.00-17.30<br />
07.09./ 14.09./ 21.09.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
10.5 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern<br />
21.13 «DE HED AAGFANGE!» – STREITEN UND SICH WIEDER VERTRAGEN<br />
Kindergarten, Unterstufe, Schulsozialarbeitende<br />
Immer wieder ähnliche Streitigkeiten und dann die endlosen Diskussionen, wer<br />
angefangen hat und wer mehr schuld ist - all dies braucht viel Zeit und Nerven.<br />
Ziele, Inhalte<br />
� Wie können auch jüngere Kinder befähigt werden, Konflikte selber zu lösen?<br />
� Wie gelingt es, fixe Rollenübernahmen - «Täter», «Opfer» und «Mitläufer» - zu<br />
durchbrechen?<br />
Arbeitsweise und Transfer<br />
Neben Spiel- und Trainingsformen für die präventive Arbeit mit der Klasse werden in<br />
diesem Kurs auch Rituale und Gesprächsformen der eigenverantwortlichen Konfliktlösung<br />
vorgestellt. Anhand von<br />
Fallbeispielen der Teilnehmenden besprechen wir, wer wie reagieren kann, damit eine<br />
positive Zusammenarbeit in der Klasse unterstützt und niemand ausgegrenzt wird.<br />
Andreas Hausheer, Sempach - Dozent <strong>PHZ</strong> <strong>Zug</strong>, Schulmediator, Lehrer<br />
3 DO-Abende 18.00-21.00<br />
12.01./ 26.01./ 09.02.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
9 Std.<br />
Kursort<br />
Sempach, LU<br />
60
61<br />
<strong>Pädagogik</strong>, <strong>Psychologie</strong> und Soziologie<br />
21.14 UMGANG MIT ANGST, KRAFT UND AGGRESSION DURCH STOCKKAMPF<br />
stufenübergreifend, SHP, Lehrpersonen für Integrative Förderung<br />
Angst und Aggression können unter Anderem auch verstanden werden als Ausdruck von<br />
orientierungsloser oder fehlgesteuerter Kraft.<br />
Im Stockkampf werden diese Kräfte spielerisch erlebt und ausgelotet.<br />
In diesem Praxiskurs werden Stockkampfspiele und -übungen für den Schullaltag erlebt<br />
und reflektiert.<br />
Brigitte Hachen, Luzern - Psychomotorik-Therapeutin, Rhythmikpädagogin, Supervision und<br />
Coaching BSO<br />
4 FR-Abende 17.00-<strong>20</strong>.30<br />
27.01./ 03.02./ 02.03./ 09.03.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
14 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern<br />
21.15 ⊗ "DU SCHON WIEDER..." – ALTERNATIVE REAKTIONEN BEI<br />
UNTERRICHTSSTÖRUNGEN<br />
Stufenübergreifend<br />
Allgemein bekannte Reaktionen (Strafen, Disziplinierungsmassnahmen) von Lehrpersonen<br />
auf Unterrichtsstörungen, Konflikte oder Disziplinprobleme und das problematische<br />
Rollenverhalten von Schülerinnen und Schülern werden kritisch hinterfragt. Die<br />
Auseinandersetzung mit alternativen Reaktionen (Evozieren von kognitiven Dissonanzen)<br />
auf problematische Verhaltensweisen soll effizientere, möglichst längerdauernde<br />
Wirkungen ermöglichen.<br />
Jürg Rüedi, Zürich - Dozent FHNW<br />
1 Montag 09.00-16.45<br />
11.07.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
6 Std.<br />
Kursort<br />
Goldau, SZ<br />
Bemerkungen<br />
Weitere Informationen unter:<br />
www.disziplin.ch
<strong>Pädagogik</strong>, <strong>Psychologie</strong> und Soziologie<br />
21.16 SINN UND GRENZEN VON REGELN<br />
Stufenübergreifend<br />
Sind Regeln unabdingbar als Gegenstück zur Beliebigkeit in unserer Spassgesellschaft?<br />
Wie viele Regeln sind sinnvoll, wann ist es Überreglementierung? Diesen Fragen geht der<br />
Kurs ebenso nach wie jenen, wie Regeln implentiert werden sollen und wie ihnen<br />
Nachachtung zu verschaffen ist. Braucht es Regeln für die Schule und die Klasse? Was ist<br />
zu tun, damit sie auch akzeptiert werden? Welche Folgen treten ein bei Nichtbeachtung<br />
der Regeln?<br />
Inhalte<br />
� Einige neuropsychologische Erkenntnisse über die Art, wie unser Gehirn mit Regeln<br />
umgeht<br />
� Die Regeln der Gesellschaft und jene der Schule<br />
� Regeln aufstellen oder aushandeln?<br />
� Wie viele Regeln braucht der Mensch?<br />
� Regelübertretungen - ein notwendiger Entwicklungsschritt bei Kindern und<br />
Jugendlichen<br />
� sinnvolle Konsequenzen und sinnlose Strafen<br />
� Autorität vs. Eigenverantwortung<br />
Walter Wolf, Rüti - Schulleiter, Psychologe, Paar- und Familientherapeut<br />
2 MI-Nachmittage 14.00-17.00<br />
07.03./ 14.03.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
6 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong><br />
21.17 DIAGNOSTIK AUF DEM SCHULPSYCHOLOGISCHEN DIENST<br />
Stufenübergreifend<br />
Die Teilnehmenden lernen die gängigsten Tests kennen, die in SPD-Abklärungen<br />
verwendet werden. Die Teilnehmenden lernen auch die Grenzen der Diagnostik kennen<br />
und können somit realistische Erwartungen in die Arbeit des SPD formulieren. Gearbeitet<br />
wird in zwei Gruppen und im Plenum. Untermauert werden die theoretischen Inputs durch<br />
praktische Beispiele.<br />
Stephan Kälin, <strong>Zug</strong> - Schulpsychologe SPD <strong>Zug</strong><br />
Silvia Stauber, <strong>Zug</strong> - Schulpsychologin SPD <strong>Zug</strong><br />
1MI-Nachmittag 14.00-17.00<br />
16.11.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
3 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong><br />
62
63<br />
21.18 FÖRDERORIENTIERTE DISZIPLINARMASSNAHMEN<br />
Stufenübergreifend<br />
Der tägliche Kampf um Disziplin raubt vielen Lehrpersonen Energie, die sie anders<br />
einsetzen möchten. Mit einem praktischen Verständnis der Psyche von Kindern und<br />
Jugendlichen ist es möglich, aus dieser unheilvollen Spirale auszusteigen und konstruktive<br />
Wege zu beschreiten. Mehr Zufriedenheit bei den Lehrenden und Kooperation bei den<br />
Schülerinnen und Schülern ist das Resultat.<br />
Ziele, Inhalte<br />
� Kenntnis der grundlegenden Unterschiede in den Erwartungen von Lehrpersonen und<br />
Schülerinnen und Schülern und der Umgang damit<br />
� Beziehungsgestaltung vor dem Hintergrund eines humanistischen Menschenbildes<br />
� Lösungsorientierte Strategien und ihre Implementierung<br />
� Umgang mit Störungen und Konflikten<br />
� Einbindung von Schülerinnen und Schülern und Eltern in die Verantwortung<br />
� Konflikttraining, Mediation, No blame approach<br />
� sinnvolle Anwendung des disziplinarischen Instrumentariums der Schule<br />
Walter Wolf, Rüti - Schulleiter, Psychologe, Paar- und Familientherapeut<br />
21.19 FÖRDERDIAGNOSTIK<br />
Stufenübergreifend<br />
Ziele<br />
� Kenntnis des mehrperspektivischen Ansatzes bei der Beobachtung und Beurteilung von<br />
Kindern mit speziellen Herausforderungen<br />
� Einführung in die systematische Beobachtung und die Mittel der Frühdiagnostik<br />
� Bedeutung diagnostischer Verfahren im Rahmen von Schullaufbahnentscheiden<br />
� Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit schulpsychologischen und<br />
sonderpädagogischen Diensten und Personen<br />
Inhalte<br />
Voraussetzungen, Ressourcen und Begabungen der Lernenden sind unterschiedlich.<br />
Während eine Schülerin oder ein Schüler problemlos den schulischen Anforderungen<br />
genügt, benötigen andere Lernende Hilfe. Sie müssen speziell gefördert werden. Damit<br />
einem herausgeforderten Kind gezielt und kompetent geholfen werden kann, muss man<br />
sein Fähigkeitsprofil kennen. Leidet eine Schülerin oder ein Schüler unter einer<br />
Wahrnehmungsstörung? Liegt ein Sprachdefizit vor oder ist sie/er kognitiv<br />
herausgefordert?<br />
Die Förderdiagnostik hat zum Ziel, den Kindern die Hilfe und Unterstützung zukommen zu<br />
lassen, die sie benötigen. Im Kurs werden die Möglichkeiten der Förderdiagnostik und ihre<br />
Methoden vorgestellt. Der Kurs führt in die mehrperspektivische Beurteilung der Kinder ein<br />
(Wahrnehmung, Kognition, Motorik, Emotionen) und erwähnt Fallen und Gefahren, derer<br />
man sich als Lehrperson bewusst sein muss.<br />
Arbeitsweise<br />
Referat, Fallübungen, Besprechung ausgewählter Anliegen in Gruppen<br />
Sandra Röthlisberger, Zürich - Psychologin (Schulpsychologie), Projektleiterin IKM<br />
<strong>Pädagogik</strong>, <strong>Psychologie</strong> und Soziologie<br />
2 MI-Nachmittage 14.00-17.00<br />
18.01./ 25.01.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
6 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong><br />
1 Samstag 08.30-16.30<br />
10.09.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
6 Std.<br />
Kursort<br />
Goldau, SZ<br />
Bemerkungen<br />
Materialkosten: Fr. 6.-
<strong>Pädagogik</strong>, <strong>Psychologie</strong> und Soziologie<br />
21.<strong>20</strong> UMGANG MIT KINDERN MIT ADHS UND VERHALTENSAUFFÄLLIGKEITEN<br />
Stufenübergreifend<br />
Ziele, Inhalte<br />
� Die Teilnehmenden erhalten Kenntnisse über das Störungsbild ADHS und andere<br />
Verhaltensauffälligkeiten, insbesondere über Ursachen, Diagnostik und<br />
Entwicklungsverläufe.<br />
� Ziel ist ein Gewinn von Kompetenz im Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern,<br />
Jugendlichen und ihren Eltern im Schulalltag.<br />
� Informationen über Abklärungsstellen und therapeutische Angebote im Kanton <strong>Zug</strong><br />
werden vermittelt.<br />
Arbeitsweise: Referate und Diskussion<br />
Regula Blattmann, Baar - Dr. med. FMH, Kinder- und Jugendpsychiatrie<br />
2 DI-Abende 19.00-21.00<br />
08.11./ 22.11.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
4 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong><br />
21.21A KREATIVE INTERVENTIONEN ZU TYPISCHEN ADHS-THEMEN (GRUNDKURS)<br />
stufenübergreifend, SHP<br />
Ziele<br />
Erlernen von verschiedenen praktischen Interventionen zur Förderung von Selbstvertrauen<br />
und Leistungsfähigkeit sowie von Selbst- bzw. Fremdwahrnehmung und sozialen<br />
Kompetenzen bei Kindern mit AD(H)S<br />
Inhalte<br />
� Spezifische Schwierigkeiten bei Kindern mit ADHS<br />
� Erkenntnisse zu ADS aus der Hirnforschung<br />
� Diagnostik und therapeutische Interventionen bei ADS<br />
� Einzeltherapie und -training mit Kindern (Metaphern, Bilderbücher, etc)<br />
� Gruppenarbeit mit Kindern<br />
Arbeitsweise<br />
Interaktiver Workshop mit (Klein)gruppenübungen, Spielen, usw.<br />
Sabine Zehnder Schlapbach, Bern - Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin FMH, FA<br />
medizinische Hypnose SMSH<br />
1 Montag 09.00-17.00<br />
17.10.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
6.5 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong><br />
64
65<br />
<strong>Pädagogik</strong>, <strong>Psychologie</strong> und Soziologie<br />
21.21B KREATIVE INTERVENTIONEN ZU TYPISCHEN ADHS-THEMEN (AUFBAUKURS)<br />
stufenübergreifend, SHP<br />
Ziele<br />
Erlernen von Präventionsmaßnahmen sowie praktischen Interventionen zur Förderung von<br />
Selbstvertrauen und Leistungsfähigkeit, Selbst- bzw. Fremdwahrnehmung bei Kindern und<br />
Jugendlichen mit AD(H)S .<br />
Inhalte<br />
� Neuste Erkenntnisse zu ADS aus der Hirnforschung, Näheres zur Diagnosestellung<br />
� Einzeltherapie und -training mit Kindern (Ressourcenarbeit, Kommunikationstraining)<br />
� Gruppenarbeit mit Kindern, Jugendlichen ("Ich schaff's", Kraftbuch, Hilfen zur<br />
Selbstfindung)<br />
� Elternarbeit (Gesprächsführungstechniken)<br />
Arbeitsweise<br />
interaktiver Workshop mit (Klein)gruppenübungen, Spielen, usw.<br />
Sabine Zehnder Schlapbach, Bern - Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin FMH, FA<br />
medizinische Hypnose SMSH.<br />
1 Dienstag 09.00-17.00<br />
18.10.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
6.5 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong><br />
Bemerkungen<br />
Achtung: Basiswissen zu ADHS<br />
wird vorausgesetzt (z.B.<br />
Grundkurs besucht)<br />
21.22 "ICH SCHAFF'S" – SPIELERISCH LÖSUNGEN MIT KINDERN FINDEN<br />
stufenübergreifend, SHP, Schulsozialarbeitende<br />
'Ich schaff's' ist ein Programm mittels dessen man Kindern helfen kann, die in schwierigen<br />
Situationen stecken. Seien dies Prüfungsangst, Trennungsangst, soziale Schwierigkeiten,<br />
etc. mit Hilfe von 'Ich schaff's' kann mit dem Kind ressourcen- und lösungsorientiert<br />
gearbeitet werden.<br />
'Ich schaff's' basiert auf dem Gedanken, dass Kinder eigentlich keine Probleme haben.<br />
Probleme werden definiert als Fähigkeiten, die sie noch nicht erlernt haben.<br />
Ziele, Inhalte<br />
Die Teilnehmenden kennen nach dem Workshop das 15-Schritte-Programm 'Ich schaff's'.<br />
Neben theoretischen Inputs zum Hintergrund und der Theorie dieses Ansatzes, werden<br />
auch praktische Übungen ein grosser Bestandteil des Workshops sein. Der Zeitaufwand<br />
für die Durchführung der 15 Schritte beträgt ca. 3 Sitzungen à 30 min. Das kann je nach<br />
Alter des Kindes variieren.<br />
Stephan Kälin, <strong>Zug</strong> - Schulpsychologe SPD <strong>Zug</strong><br />
Karin Wolf, <strong>Zug</strong> – Schulpsychologin<br />
2 MI-Nachmittage 14.00-16.30 /<br />
14.00-17.00<br />
14.09./ 21.09.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
5.5 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong><br />
Bemerkungen<br />
14.09.11 GV-LVZ ab 17.00 Uhr
<strong>Pädagogik</strong>, <strong>Psychologie</strong> und Soziologie<br />
21.23 ACHTSAMKEIT IN DER SCHULE<br />
Kindergarten, Primarstufe<br />
Ziel<br />
Achtsamkeit als eine Haltung kennen zu lernen, die uns hilft, freudvoll, gesund und<br />
leistungsfähig zu bleiben und diese Haltung in der Schule zu praktizieren, ist Ziel des<br />
Kurses.<br />
Inhalte und Arbeitsweise<br />
Inhalte sind sowohl die Achtsamkeit von Lehrpersonen sich selbst und den Kindern<br />
gegenüber, als auch die Entwicklung von Achtsamkeit bei den Kindern selbst. Dies kann<br />
zu einer gelasseneren Atmosphäre beitragen und das Lernklima positiv beeinflussen.<br />
Anhand praktischer Übungen werden die Lehrpersonen in das Konzept 'Achtsamkeit' eingeführt<br />
und machen damit eigene Erfahrungen. Sie lernen Möglichkeiten für die Arbeit mit<br />
Kindern kennen, erarbeiten eigene Umsetzungshilfen für die Praxis und werden durch den<br />
Austausch in der Gruppe ermutigt, eigene Ideen im Schulalltag auszuprobieren. Raum<br />
sollen auch der Erfahungsaustausch und die Fragen der Teilnehmenden zu konkreten<br />
Beispielen haben.<br />
Claudia Suter, Bremgarten - Lehrerin f. Stressbewältigung durch Achtsamkeit (MBSR)<br />
21.24 ACHTSAMKEIT UND MENTALTRAINING IN DER SCHULE<br />
Stufenübergreifend<br />
Die eigene und fremde Motivation entdecken ist eine mentale Technik. Sie kann trainiert<br />
werden. Das Vertrauen in die eigene Wahrnehmung ist die wichtigste Voraussetzung zum<br />
Handeln. Wenn wir dies ernst nehmen, ändert sich der Unterricht.<br />
Ziele<br />
Die Aufmerksamkeit auf Denken und Fühlen trainieren und Trainingsmethoden für den<br />
Unterricht erarbeiten.<br />
Inhalte und Arbeitsweise<br />
� Mentaltraining (Meditation)<br />
� Meditation und Hirnforschung<br />
� Instrumente der REOSCH-Schule<br />
� Anwendungen für den Unterricht<br />
Jakob Widmer, Kerzers – Sekundarlehrer<br />
3 MI-Nachmittage 14.00-17.00<br />
26.10./ 02.11./ 23.11.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
9 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong><br />
1 Samstag 09.00-17.00<br />
1 SA-Vormittag 09.00-12.30<br />
24.09./ 19.11.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
10 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong><br />
66
67<br />
21.25A DIE KRAFT DER ERMUTIGUNG<br />
Kindergarten, Unterstufe, Mittelstufe 1<br />
Wie kann ich andere und mich ermutigen? Der Mensch muss von der Geburt bis zum Tod<br />
mit vielfältigen Anforderungen und Hindernissen fertig werden. Dazu braucht es u.a. Mut<br />
und Selbstbewusstsein! Im Kurs werden wir uns mit Denkanstössen und<br />
Unterstützungsmöglichkeiten zu diesem existenziellen Thema auseinandersetzen.<br />
Ziele<br />
Die Teilnehmenden haben ein Grundwissen zu einer "Ermutigungspsychologie", kennen<br />
wichtige präventive Aspekte und finden Umsetzungsmöglichkeiten für das eigene<br />
Wirkungsfeld.<br />
Inhalte<br />
� Das Konzept der Ermutigung<br />
� Ermutigung und Entmutigung<br />
� Ermutigung und Resilienz<br />
� Möglichkeiten im Schulfeld<br />
Arbeitsweise, Transfer<br />
Kurze Inputs, Gruppenarbeit, Filmausschnitt, Diskussion, Reflexion allfälliger Beispiele der<br />
Kursteilnehmenden<br />
Jürg Frick, Zürich - Prof. Dr., Dozent und Berater <strong>PHZ</strong>H<br />
21.25B DIE KRAFT DER ERMUTIGUNG<br />
Stufenübergreifend<br />
Wie kann ich andere und mich ermutigen? Der Mensch muss von der Geburt bis zum Tod<br />
mit vielfältigen Anforderungen und Hindernissen fertig werden. Dazu braucht es u.a. Mut<br />
und Selbstbewusstsein! Im Kurs werden wir uns mit Denkanstössen und<br />
Unterstützungsmöglichkeiten zu diesem existenziellen Thema auseinandersetzen.<br />
Ziele<br />
Die Teilnehmenden haben ein Grundwissen zu einer "Ermutigungspsychologie", kennen<br />
wichtige präventive Aspekte und finden Umsetzungsmöglichkeiten für das eigene<br />
Wirkungsfeld.<br />
Inhalte<br />
� Das Konzept der Ermutigung<br />
� Ermutigung und Entmutigung<br />
� Ermutigung und Resilienz<br />
� Möglichkeiten im Schulfeld<br />
Arbeitsweise, Transfer<br />
Kurze Inputs, Gruppenarbeit, Filmausschnitt, Diskussion, Reflexion allfälliger Beispiele der<br />
Kursteilnehmenden<br />
Jürg Frick, Zürich - Prof. Dr., Dozent und Berater <strong>PHZ</strong>H<br />
<strong>Pädagogik</strong>, <strong>Psychologie</strong> und Soziologie<br />
1 Samstag 08.30-16.30<br />
24.09.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
6.5 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong><br />
Bemerkungen<br />
Literaturhinweis: Frick, Jürg; Die<br />
Kraft der Ermutigung. Grundlagen<br />
und Beispiele zur Hilfe und<br />
Selbsthilfe; <strong>20</strong>07; Huber, Bern<br />
1 Samstag 08.30-16.30<br />
03.12.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
6 Std.<br />
Kursort<br />
Goldau, SZ<br />
Bemerkungen<br />
Kurskostenbeitrag: Fr. 50.-
<strong>Pädagogik</strong>, <strong>Psychologie</strong> und Soziologie<br />
21.26 UNTERRICHT BEOBACHTEN UND REFLEKTIEREN MIT VIDEO<br />
Primarstufe, Schulleitende<br />
Ziele<br />
� Wichtige Elemente von Unterrichtsqualität erkennen<br />
� Instrumente zur Unterrichtsreflexion kennen lernen<br />
� Unterrichtsprozesse gezielt reflektieren<br />
� Unterrichtsvideos analysieren<br />
Inhalte<br />
Die Reflexion von Unterricht kann helfen, Unterrichtsprozesse effektiver zu gestalten. Da<br />
im Unterrichtsalltag zumeist wenig Zeit dazu vorhanden ist, soll der Kurs produktive Wege<br />
aufzeigen, Unterricht gezielt zu reflektieren. Als Grundlage für den Kurs dienen<br />
videografierte Unterrichtslektionen.<br />
Arbeitsweise: Inputs im Plenum, Einzel- und Gruppenarbeiten<br />
Corinne Wyss, Niederlenz - Dozentin <strong>PHZ</strong>H<br />
Bitte beachten Sie auch folgende Kurse in anderen Themenbereichen:<br />
1 Samstag 09.00-16.30<br />
12.11.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
6 Std.<br />
Kursort<br />
Goldau, SZ<br />
Bemerkungen<br />
Materialkosten: Fr. 5.-<br />
00.14 Disziplin und Strafe<br />
11.12 Lachen in der Schule<br />
22.01 4 bis 8-Jährige: Kinder lernen von Kindern<br />
22.24 Wahrnehmungsförderung als Voraussetzung für gutes Lernen<br />
23.01 Aktuelles aus den Neurowissenschaften: Mit dem Körper lernen<br />
23.02 Aus der Sicht der Neurowissenschaften: Wahrnehmung - Basis des Lernens<br />
23.05 Früherkennung - eine wichtige Funktion der Sozialen Arbeit in der Schule<br />
23.21 "Ein Kind mit Autismus Spektrum Störungen (Asperger Syndrom) in der Klasse - was<br />
tun?"<br />
23.22 Bewegung "als Weg zum ADS-Kind"<br />
23.29 Systemorientierte <strong>Pädagogik</strong> - Handlungssicherheit im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten<br />
32.07 Fair – unfair: Alltag und soziale Gerechtigkeit<br />
35.07 Pubertärer Blues oder Depression?<br />
68
69<br />
22 LEHREN UND LERNEN<br />
Beurteilen und Fördern<br />
Lehren und Lernen<br />
Beurteilen und Fördern B&F: Die Beurteilung der Schülerinnen und Schüler im Kanton <strong>Zug</strong> geschieht ganzheitlich, förder- und<br />
lernzielorientiert sowie transparent. Zu den Beurteilungsverfahren gehören eine Selbstbeurteilung der Schülerin/des Schülers,<br />
Gespräche über das Lernen und differenzierte Aussagen zum Leistungsstand und der Entwicklung in den Fach-, Methoden-/Lern-,<br />
Selbst- und Sozialkompetenzen.<br />
Ausgangslage: Der Bildungsrat hat am 18. Februar <strong>20</strong>09 den Auftrag „Verankerung und Umsetzung Beurteilen und Fördern B&F<br />
an den gemeindlichen Schulen“ erlassen. Die Gemeinden haben den Auftrag, bis zum Sommer <strong>20</strong>14 die Grundlagen,<br />
Zielsetzungen und Verbindlichkeiten von Beurteilen und Fördern im Sinne eines kohärenten Beurteilungssystems über die ganze<br />
Schulzeit zu verankern, umzusetzen und weiterzuentwickeln.<br />
Diese Verankerung und Umsetzung von Beurteilen und Fördern B&F an den gemeindlichen Schulen beinhaltet ebenfalls die Ebene<br />
der Lehrpersonen. Diese sind verpflichtet, Beurteilen und Fördern B&F im Unterricht umzusetzen.<br />
Grundlagen: Als inhaltliche Grundlagen dienen die „Grundsätze Beurteilen und Fördern B&F Kanton <strong>Zug</strong>“ für Kindergarten-,<br />
Primar- und Sekundarstufe I und das Rahmenkonzept „Gute Schulen – Qualitäts-management an den gemeindlichen Schulen“.<br />
Lehrpersonen, welche neu im Kanton <strong>Zug</strong> unterrichten, bietet die WBZA einen kantonalen Einführungskurs an, welcher die<br />
kantonalen Grundlagen und eine Einführung in die verschiedenen zugerischen Instrumente zu B&F thematisiert (vgl. Kurs 00.02).<br />
Bedarfsorientierte Unterstützung: Folgende Holkursangebote unterstützen die gemeindlichen Schulen in der Umsetzung des<br />
Auftrages B&F und der Elemente 1-3 aus dem Rahmenkonzept "Gute Schulen – Qualitätsmanagement an den gemeindlichen<br />
Schulen":<br />
Anforderungssituationen (für die Planung und Durchführung eines Unterrichts nach B&F)<br />
Lern- und Förderkreislauf<br />
Orientierungsgespräche führen<br />
Lernjournal und Portfolio-Arbeit<br />
Förderorientierte Beurteilung der Methoden-/ Lern-, Selbst- und Sozialkompetenzen<br />
Formative und summative Beurteilung<br />
Beurteilen und Fördern – Weiterentwicklung der Beurteilungspraxis (Schulteams)<br />
Stufenspezifische Aspekte auf der Kindergartenstufe<br />
Das Handbuch B&F sowie die überarbeiteten Zeugnisse stehen im Schuljahr <strong>20</strong>11/12 zur Verfügung.
Lehren und Lernen<br />
22.01 4 BIS 8-JÄHRIGE: KINDER LERNEN VON KINDERN<br />
Kindergarten, Unterstufe<br />
Der Unterricht in jahrgangsgemischten Gruppen stellt neue Herausforderungen an die<br />
Lehrpersonen. Wie lässt sich diese Altersmischung zum Vorteil der Kinder nutzen? Was<br />
braucht es, damit Kinder von den Fähigkeiten und Fertigkeiten anderer profitieren können?<br />
Wie kann man eine Spiel- u. Lernumgebung schaffen, in der Kinder ganz natürlich<br />
voneinander lernen? Welchen Einfluss haben Lernumgebung und Lernklima auf den<br />
Lernerfolg? Wie lassen sich Erkenntnisse aus der Lernforschung im Alltag umsetzen?<br />
Inhalte<br />
Anhand konkreter Beispiele aus der Praxis sollen dazu Umsetzungsmöglichkeiten für die<br />
Volkschule aufgezeigt werden. Dabei kommen auch grundsätzliche Fragen übers Lernen<br />
zur Sprache.<br />
Arbeitsweise<br />
Neben Inputteilen, in denen wir über unsere Erfahrungen mit altersgemischen Gruppen an<br />
der Grundacherschule erzählen, werden wir auch Diskussionsrunden anregen und<br />
gruppenweise arbeiten. Es besteht die Möglichkeit, für den eigenen Unterricht konkrete<br />
Massnahmen zu planen oder sich in ausgewählten Bereichen zu vertiefen.<br />
Karin Anderhalden Steiner, Sarnen - Kindergartenlehrperson, Schulleiterin<br />
Victor Steiner, Alpnach Dorf – Schulleitung<br />
MO-DI 08.30-17.00<br />
16.04./ 17.04.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
14 Std.<br />
Kursort<br />
Sarnen, OW<br />
22.02 LERNPROZESSE KOMPETENZORIENTERT KOMMENTIEREN<br />
Stufenübergreifend<br />
Viele heutige Aufgabenstellungen zeichnen sich dadurch aus, dass Schülerinnen und<br />
Schüler nicht nach einer ganz bestimmten Lösung suchen sollen, sondern dass die<br />
Aufgabe in erster Linie darin besteht, einen eigenen Lösungsweg zu finden. Damit<br />
verändert sich die Rolle der Lehrperson; ihre Aufgabe ist es nicht mehr, in erster Linie<br />
Schülerprodukte einfach zu korrigieren, sondern in der Rolle eines Coach individuelle<br />
Lernprozesse freizulegen und zu verstärken. Dabei sind das Gespräch über das Lernen<br />
und die Rückmeldung zu Lernprozessen und -produkten zentral.<br />
Ziele<br />
Anforderungen an kompetenzorientiertes Kommentieren (statt defizitorientiertes<br />
Korrigieren) kennenlernen; eigene bisherige sprachliche Praxis der Rückmeldung<br />
reflektieren.<br />
Inhalte<br />
Wie gebe ich Rückmeldungen, die kompetenz- und nicht fehler-/defizitorientiert sind?<br />
Welche Aspekte sprachlicher Kommunikation sind im Zusammenhang mit derartigen<br />
Rückmeldungen relevant?<br />
Arbeitsweise<br />
1. Sitzung: Input-Referat; Fallanalysen; Planung Selbstbeobachtung<br />
2. Sitzung: Erfahrungsaustausch Selbstbeobachtung, Fallanalysen<br />
Martin Luginbühl, <strong>Zug</strong> - Dozent Deutschdidaktik, Co-Leitung ZM<br />
2 MI-Nachmittage 14.00-16.00<br />
06.06./ <strong>20</strong>.06.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
4 Std.<br />
Kursort<br />
<strong>Zug</strong>, <strong>PHZ</strong><br />
70
71<br />
22.03 SCHRITTE ZUM SELBSTGESTEUERTEN LERNEN<br />
Lehren und Lernen<br />
Kindergarten, Unterstufe, Mittelstufe 1, SHP, Lehrpersonen für Integrative Förderung, Schulleitende<br />
Selbstgesteuertes Lernen wird ausdrücklich als Entwicklungsziel für die Luzerner<br />
Volksschule benannt. In dieser Weiterbildung werden neben theoretischen Grundlagen vor<br />
allem konkrete Schritte in Richtung individualisiertes Lernen und freie Arbeitsphasen<br />
anhand der Rahmenbedingungen der Teilnehmenden erarbeitet. Sie sollten konkrete<br />
Veränderungsabsichten und -möglichkeiten sowie die Bereitschaft zu<br />
selbstverantwortlichem Lernen mitbringen.<br />
Detlev Vogel, Luzern - Erziehungsberater<br />
Silvia Vogel Wiederkehr, Sursee – Schulleiterin, Lehrerin<br />
MO 10.00-17.00<br />
DI-MI 08.30-17.00<br />
16.04./ 17.04./ 18.04.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
17 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern<br />
Bemerkungen<br />
Wünschenswert ist die<br />
gemeinsame Teilnahme mehrerer<br />
Lehrpersonen aus einer Schule.<br />
22.04 MODELL, PROZESS UND MATERIALIEN ZUR ANREGUNG UND FÖRDERUNG<br />
SELBSTSTÄNDIGEN LERNENS<br />
Mittelstufe 1, Mittelstufe 2, Sekundarstufe 1, SHP, Lehrpersonen für Integrative Förderung<br />
Ziele: Die Teilnehmenden<br />
� verstehen das Modell «Erfolgsfaktoren des Lernens».<br />
� verknüpfen das Modell mit einem systematischen Förderprozess.<br />
� können sich in der umfangreichen Sammlung der auf der Kurs-CD zur Verfügung<br />
gestellten Fördermaterialien orientieren.<br />
� können den Transfer zu ihrer Praxis machen.<br />
Inhalte<br />
� Modell «Erfolgsfaktoren des Lernens»<br />
� Basis individueller Lernerfolge: Metakognition/ selbstgesteuertes Lernen<br />
� Systematischer Förderprozess<br />
� Praxisbeispiele zur Förderung selbstständigen Lernens (Einzel-, Gruppen-,<br />
Klassenförderung)<br />
� stufen- und fächerunabhängige Fördermaterialien<br />
Arbeitsweise<br />
Inputvorträge, Gruppenarbeiten, Diskussion, Auseinandersetzung mit dem Fördermaterial<br />
auf der Kurs-CD<br />
Tanja Michel, Luzern - Primarlehrerin, Schulische Heilpädagogin<br />
Sandra Zgraggen, Greppen - Primarlehrerin<br />
2 DO-Abende 18.00-21.00<br />
10.11./ 24.11.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
6 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern<br />
Bemerkungen<br />
Materialkosten: Fr. 40.- für<br />
dasLehrmittel «Individuell zum<br />
Lernerfolg»
Lehren und Lernen<br />
22.05 LERNCOACHING<br />
Primarstufe, Sekundarstufe 1<br />
Ziele<br />
Die Teilnehmenden lernen die Kerngedanken und Grundhaltungen des Lerncoachings<br />
kennen und fangen an, sie umzusetzen. Sie können Lernprozesse gezielt beobachten,<br />
analysieren und individuelle Schritte anregen. Die Teilnehmenden erweitern ihre<br />
Kompetenz, umsichtige Lehr-Lern-Dialoge zu führen und zu reflektieren.<br />
Inhalte<br />
Das individuelle, eigenständige Lernen der Schülerinnen und Schüler rückt immer mehr ins<br />
Zentrum des Unterrichtens. Lernende arbeiten an unterschiedlichen Aufgaben,<br />
Projektunterricht hält Einzug, Lernateliers entstehen. Für Lehrpersonen bedeutet das,<br />
vermehrt Aufmerksamkeit auf das Lernen statt das Lehren zu richten: gezielt beobachten,<br />
Gespräche über das Lernen führen, lernen Lernen thematisieren und Lernende<br />
dahingehend begleiten - Lerncoaching eben.<br />
Nicole Périssent, Zürich - Dozentin <strong>PHZ</strong>H<br />
Martin Keller, Zürich - Dozent <strong>PHZ</strong>H<br />
1 MI-Nachmittag 13.30-16.30<br />
2 Samstage 09.00-16.00<br />
21.09./ 05.11.<strong>20</strong>11/ 14.01.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
15 Std.<br />
Kursort<br />
Goldau, SZ<br />
22.06 ICH-DU-WIR: KOOPERATIVE LERNFORMEN IM KINDERGARTEN<br />
Kindergarten, Unterstufe, Schulsozialarbeitende<br />
Ziele: Die Lehrpersonen<br />
� kennen die Prinzipien des kooperativen Lernens.<br />
� erfahren die Methoden an sich selber.<br />
� bekommen eine Übersicht über Methoden und deren Einsatzmöglichkeiten in der<br />
Praxis.<br />
Inhalte<br />
Das Unterrichten mit kooperativem Lernen motiviert und aktiviert die Lernenden.<br />
Gemeinsam werden die verschiedenen Formen des kooperativen Lernens erforscht und<br />
konkrete Praxisbeispiele für den Unterricht besprochen.<br />
Sibylle Raimann, <strong>Zug</strong> - Dozentin Kindergartendidaktik<br />
2 MI-Nachmittage 14.00-17.00<br />
28.09./ 16.11.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
6 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern<br />
72
73<br />
22.07 KOOPERATIVES LERNEN<br />
Mittelstufe 2, Sekundarstufe 1<br />
Das Unterrichten mit kooperativem Lernen motiviert und aktiviert die Lernenden, führt zu<br />
besseren Lernergebnissen und entlastet die Lehrperson während des Unterrichts.<br />
Ziele<br />
Die Teilnehmenden lernen die drei Schritte des kooperativen Lernens kennen: Eigenarbeit,<br />
Austausch, Präsentation.<br />
Inhalte und Arbeitsweise<br />
Da der Kurs mit den Methoden des kooperativen Lernens durchgeführt wird, erleben die<br />
Teilnehmenden hautnah, wie sich dies auf die Motivation und das Lernen auswirkt. Der<br />
Kurs ist praxisorientiert und nach dem ersten Kurstag können die Teilnehmenden das<br />
Gelernte in ihrem Unterricht umsetzen.<br />
Transfer<br />
Dieses Angebot beinhaltet Inhalte und Methoden, die für die Umsetzung 'Integrative<br />
Schulung' und 'Spezielle Förderungen' hilfreich sind.<br />
Ruedi Rüegsegger, Aarau - Dozent PH FHNW, Institut Weiterbildung und Beratung<br />
22.08 LERN- UND ARBEITSTECHNIKEN FÜR DIE SCHULE<br />
Mittelstufe 1, Mittelstufe 2, Sekundarstufe 1<br />
Im Kurs werden verschiedene Arbeits- und Lerntechniken vorgestellt, diskutiert und so<br />
vorbereitet, dass sie im Unterricht angewendet werden können. Die Lehrpersonen erhalten<br />
auf diese Weise einen Überblick über die Grundlagen des Lernens aus hirnphysiologischer<br />
und lernpsychologischer Sicht und sind anschliessend in der Lage, Lernende bei der<br />
Verbesserung ihres Lernverhaltens kompetent anzuleiten und zu beraten. Dazu gehört<br />
auch die Förderung von Kindern mit unterschiedlichen Begabungen.<br />
Ziele<br />
� Erweiterung und Festigung des persönlichen Reptertoires an Lern- und<br />
Arbeitstechniken<br />
� Zusammenhänge von Theorie und Praxis erkennen und für den Unterricht nützen<br />
� Lernende beim Lernen kompetent beraten<br />
� Austausch und Diskussion von Lehr-/Lern-Erfahrungen<br />
Inhalte<br />
Funktion des Gehirns, Vergesslichkeit, Lernhemmungen, verschiedene Lerntypentests,<br />
Wahrnehmungs- und Lernformen, Lern- und Arbeitsvoraussetzungen, Lernvertrag,<br />
Lernkartei, Lernpatience, Walkman, Mind Mapping, Clustering, Methodensammlung für<br />
Gruppenarbeiten, Prüfungen vorbereiten, aktive Bewegungspausen, Methoden zur<br />
Informationsdarstellung, Vorstellung verschiedener PC-Lernsoftware<br />
Arbeitsweise<br />
Fachvorträge, Übungen, Partnerarbeit, Gruppenarbeit, Lernwerkstatt<br />
Rinaldo Manferdini, Eschlikon - Primar- und Mittelschullehrer, Sportlehrer ETH und Mentaltrainer<br />
verschiedener Nationalmannschaften<br />
Lehren und Lernen<br />
MO-DI 08.30-17.00<br />
1 SA-Vormittag 08.30-12.00<br />
16.04./ 17.04./ 16.06.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
19.5 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton Uri<br />
2 FR-Abende 17.30-21.00<br />
2 Samstage 09.00-16.30<br />
16.09./ 17.09./ 23.09./ 24.09.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
<strong>20</strong> Std.<br />
Kursort<br />
Luzern
Lehren und Lernen<br />
22.09A UMGANG MIT LEISTUNGSHETEROGENITÄT IM OFFENEN UNTERRICHT<br />
Kindergarten, Unterstufe, Mittelstufe 1<br />
Ziele<br />
Die Lehrpersonen sollen individuell ihre Kompetenzen erweitern im Umgang mit<br />
Leistungsheterogenität.<br />
Inhalte<br />
Die Teilnehmenden lernen theoretische Grundlagen zum Thema Leistungsheterogenität<br />
kennen. In individueller Arbeit beschäftigen sie sich mit Posten zu folgenden Themen:<br />
Aufgaben öffnen, Aufgaben differenzieren, Wahlangebote schaffen, Portfolio, forschendes<br />
Lernen, Selbst- bzw. Sozialkompetenz, gemeinschaftsbildende Elemente.<br />
Die Teilnehmenden erstellen einen Plan zum Erarbeiten von konkreten, ausgewählten<br />
Strategien für den produktiven Umgang mit Leistungsheterogenität und erproben neue<br />
Möglichkeiten im eigenen Unterricht. Sie tauschen sich über Erfahrungen und<br />
Konsequenzen im Plenum aus und reflektieren die Ergebnisse für den eigenen Unterricht.<br />
Anhand von Wochenplanarbeit wird exemplarisch aufgezeigt, was Gelingensbedingungen<br />
für effizientes Lernen im individualisierten Unterricht sind.<br />
Arbeitsweise<br />
Input, Postenarbeit, Praxiserprobung, Erfahrungsaustausch im Plenum<br />
Gabriela Ryser, Kreuzlingen - Schulische Heilpädagogin<br />
1 Samstag 09.00-17.00<br />
1 SA-Vormittag 09.00-13.00<br />
24.09./ 03.12.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
10 Std.<br />
Kursort<br />
Goldau, SZ<br />
Bemerkungen<br />
Materialkosten: Fr. 5.-<br />
22.09B UMGANG MIT LEISTUNGSHETEROGENITÄT IM OFFENEN UNTERRICHT<br />
Mittelstufe 2, Sekundarstufe 1<br />
Ziele<br />
Die Lehrpersonen sollen individuell ihre Kompetenzen erweitern im Umgang mit<br />
Leistungsheterogenität.<br />
Inhalte<br />
Die Teilnehmenden lernen theoretische Grundlagen zum Thema Leistungsheterogenität<br />
kennen. In individueller Arbeit beschäftigen sie sich mit Posten zu folgenden Themen:<br />
Aufgaben öffnen, Aufgaben differenzieren, Wahlangebote schaffen, Portfolio, forschendes<br />
Lernen, Selbst- bzw. Sozialkompetenz, gemeinschaftsbildende Elemente.<br />
Die Teilnehmenden erstellen einen Plan zum Erarbeiten von konkreten, ausgewählten<br />
Strategien für den produktiven Umgang mit Leistungsheterogenität und erproben neue<br />
Möglichkeiten im eigenen Unterricht. Sie tauschen sich über Erfahrungen und<br />
Konsequenzen im Plenum aus und reflektieren die Ergebnisse für den eigenen Unterricht.<br />
Anhand von Wochenplanarbeit wird exemplarisch aufgezeigt, was Gelingensbedingungen<br />
für effizientes Lernen im individualisierten Unterricht sind.<br />
Arbeitsweise<br />
Input, Postenarbeit, Praxiserprobung, Erfahrungsaustausch im Plenum<br />
Gabriela Ryser, Kreuzlingen - Schulische Heilpädagogin<br />
1 Samstag 09.00-17.00<br />
1 SA-Vormittag 09.00-13.00<br />
17.09./ 26.11.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
10 Std.<br />
Kursort<br />
Goldau, SZ<br />
Bemerkungen<br />
Materialkosten: Fr. 5.-<br />
74
75<br />
22.10 EIN STOTTERNDES KIND IN DER KLASSE<br />
Stufenübergreifend<br />
Ziele, Inhalte<br />
Der Kurs vermittelt Grundkenntnisse über Definition, Symptomatik und<br />
Bedingungshintergründe des Stotterns. Daraus wird ersichtlich, dass Stottern mehr ist als<br />
nur das Wiederholen und Blockieren von Lauten. Stotternde Kinder wenden Strategien an,<br />
um nicht als Stotternde erkannt zu werden und zeigen daher oft ihre eigentlichen<br />
Fähigkeiten im Unterricht nicht. Im Kurs wird aufgezeigt, wie Lehrpersonen dem<br />
stotternden Kind im Schulalltag Unterstützung bieten und im Gespräch mit Kind und Eltern<br />
nach hilfreichen Verhaltensweisen suchen können.<br />
Arbeitsweise<br />
Konkrete Beispiele veranschaulichen die theoretischen Ausführungen.<br />
Luzia Füglistaller, Cham - dipl. Logopädin, Primarlehrerin, zert. Kommunikationstrainerin<br />
22.11A HOCHBEGABTE KINDER ERKENNEN UND FÖRDERN<br />
Kindergarten, Unterstufe<br />
Ziele<br />
� Kinder mit hohen Begabungen in der Klasse erkennen<br />
� Fördermassnahmen kennen<br />
� Material zur Förderung kennen lernen<br />
Inhalte<br />
� Wissenschaftliche Befunde über hochbegabte Kinder<br />
� Fördermöglichkeiten<br />
� Vernetzung und Angebote externer Institutionen und Personen<br />
� Eltern hochbegabter Kinder<br />
Arbeitsweise: Inputs, Gruppenarbeiten, Diskussion<br />
Transfer<br />
Umsetzungsmöglichkeiten für die eigene Klasse, das eigene Schulhaus<br />
Katarina Farkas, <strong>Zug</strong> - lic. phil., Dozentin <strong>PHZ</strong>, Pädagogische Psychologin<br />
Lehren und Lernen<br />
1 SA-Vormittag 09.00-12.00<br />
12.11.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
3 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong><br />
1 SA-Nachmittag 13.30-17.00<br />
1 MI-Abend 17.00-<strong>20</strong>.30<br />
29.10./ 02.11.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
7 Std.<br />
Kursort<br />
<strong>Zug</strong>, <strong>PHZ</strong>
Lehren und Lernen<br />
22.11B HOCHBEGABTE KINDER ERKENNEN UND FÖRDERN<br />
Mittelstufe 1, Mittelstufe 2<br />
Ziele<br />
� Kinder mit hohen Begabungen in der Klasse erkennen<br />
� Fördermassnahmen kennen<br />
� Material zur Förderung kennen lernen<br />
Inhalte<br />
� Wissenschaftliche Befunde über hochbegabte Kinder<br />
� Fördermöglichkeiten<br />
� Vernetzung und Angebote externer Institutionen und Personen<br />
� Eltern hochbegabter Kinder<br />
� Arbeitsweise: Inputs, Gruppenarbeiten, Diskussion<br />
Transfer<br />
Umsetzungsmöglichkeiten für die eigene Klasse, das eigene Schulhaus<br />
Katarina Farkas, <strong>Zug</strong> - lic. phil., Dozentin <strong>PHZ</strong>, Pädagogische Psychologin<br />
1 SA-Vormittag 08.30.- 12.00<br />
1 Mi-Nachmittag 13.00-16.30<br />
29.10./ 02.11.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
7 Std.<br />
Kursort<br />
<strong>Zug</strong>, <strong>PHZ</strong><br />
22.12A BEWEGENDE BUCHSTABENWELT – KLINGENDER ZAHLENZAUBER<br />
(GRUNDKURS)<br />
Kindergarten, Unterstufe, SHP, Lehrpersonen für Logopädie / Psychomotorik<br />
Kindliche Entdeckerfreude, spielerisches Miteinander, Eintauchen in Lernen mit Musik und<br />
Bewegung; all dies macht den Unterricht zu einem intensiven Erlebnis.<br />
Ziel, Inhalte<br />
Dieser Kurs richtet sich an alle Lehrpersonen, welche im Bereich „Lernen mit und durch<br />
Bewegung“ neue kind- und zeitgemässe Ansätze suchen. Ziel dieses Kurses ist es,<br />
vielseitige, fächerverbindende und spielerisch-bewegte Ideen kennen zu lernen. Dies<br />
einerseits in Verbindung mit dem Sprechen, Lesen und Schreiben sowie mit dem<br />
mathematisch logischen Verständnis, andererseits im Bereich des sozialen Lernens in der<br />
Klasse.<br />
Transfer<br />
Alle Inhalte lassen sich anschliessend eins zu eins im Kindergarten und im Schulalltag<br />
umsetzen.<br />
Catherine Huggler Feger, Knonau - dipl. Bewegungspädagogin BGB, therapeutische Masseurin<br />
Michelle Konrad, Sins - dipl. Musik- und Bewegungspädagogin, Rhythmikerin, Primarlehrerin,<br />
Dozentin <strong>PHZ</strong> <strong>Zug</strong><br />
2 SA-Vormittage 08.30-12.30<br />
05.11./ 12.11.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
8 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong><br />
76
77<br />
22.12B BEWEGENDE BUCHSTABENWELT – KLINGENDER ZAHLENZAUBER<br />
(GRUNDKURS)<br />
Lehren und Lernen<br />
Kindergarten, Unterstufe, SHP, Lehrpersonen für Integrative Förderung / Logopädie / Psychomotorik,<br />
Mitarbeitende in Tagesstrukturen<br />
Kindliche Entdeckerfreude, spielerisches Miteinander, Eintauchen in Lernen mit Musik und<br />
Bewegung, machen den Unterricht zu einem intensiven Erlebnis. Dieser Kurs richtet sich<br />
an alle Lehrpersonen, welche im Bereich «Lernen mit und durch Bewegung» neue, kindund<br />
zeitgemässe Ansätze suchen.<br />
Ziel<br />
Ziel des Kurse ist es, vielseitige, fächerverbindende und spielerisch-bewegte Ideen kennen<br />
zu lernen, wie einerseits das Sprechen, Lesen und Schreiben, das mathematisch logische<br />
Verständnis und andererseits das soziale Lernen der Klasse handelnd und durch<br />
Bewegung mit der Klasse erarbeitet werden kann.<br />
Transfer<br />
Alle Inhalte lassen sich anschliessend eins zu eins im Kindergarten und im Schulalltag<br />
umsetzen.<br />
Catherine Huggler Feger, Knonau - dipl. Bewegungspädagogin BGB, therapeutische Masseurin<br />
Michelle Konrad, Sins - dipl. Musik- und Bewegungspädagogin, Rhythmikerin, Primarlehrerin,<br />
Dozentin <strong>PHZ</strong> <strong>Zug</strong><br />
1 Samstag 08.30-16.30<br />
22.10.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
7 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern<br />
Bemerkungen<br />
Materialkosten: Fr. <strong>20</strong>.-<br />
22.13 BEWEGENDE BUCHSTABENWELT – KLINGENDER ZAHLENZAUBER<br />
(AUFBAUKURS)<br />
Kindergarten, Unterstufe, SHP, Lehrpersonen für Logopädie / Psychomotorik<br />
Dieser Kurs richtet sich an Lehrpersonen des Kindergartens und der Unterstufe, welche<br />
bereits Erfahrungen mit und durch "Musik und Bewegung“ gesammelt haben und nach<br />
diesem Prinzip unterrichten.<br />
Ziele, Inhalte<br />
Aufbauend auf den Inhalten des Grundkurses 'Bewegende Buchstabenwelt – klingender<br />
Zahlenzauber' öffnen die Kursleiterinnen eine weitere ideengefüllte Schublade aus ihrem<br />
„Bewegungsschatz“ und experimentieren mit spezifischen Bewegungskünsten und<br />
Bewegungsmaterialien. Zudem wird die Fragestellung: „Was hat Bewegung mit<br />
erfolgreichem Lernen zu tun?" vertieft.<br />
Catherine Huggler Feger, Knonau - dipl. Bewegungspädagogin BGB, therapeutische Masseurin<br />
Michelle Konrad, Sins - dipl. Musik- und Bewegungspädagogin, Rhythmikerin, Primarlehrerin,<br />
Dozentin <strong>PHZ</strong> <strong>Zug</strong><br />
1 Samstag 08.30-15.30<br />
17.03.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
6 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong>
Lehren und Lernen<br />
22.14A TANZKINDER: DREHEN-HÜPFEN, STRECKEN-RUGELN, PATSCHEN-<br />
KLATSCHEN 1-2-3<br />
Kindergarten, Unterstufe, SHP<br />
Miteinander bewegen, erfinden, improvisieren, gestalten. Kindliche Entdeckerfreude,<br />
spielerisches Miteinander, Eintauchen in Musik, Bewegung und Tanz; all dies macht den<br />
Unterricht zu einem intensiven Erlebnis.<br />
Ziele, Inhalte<br />
Dieser Kurs richtet sich an Lehrpersonen, welche mit Kindern im Kindergarten oder auf der<br />
Unterstufe arbeiten und im Bereich Bewegung und Tanz neue Ansätze suchen. Ziel dieses<br />
Kurses ist es, nicht nur Ideen für Bewegungs- und Tanzsequenzen kennen zu lernen,<br />
sondern auch Anregungen und Inputs zu bekommen, wie man mit Musik, Bewegung und<br />
Tanz die Themen des Schulalltages fächerübergreifend verbinden kann.<br />
Catherine Huggler Feger, Knonau - dipl. Bewegungspädagogin BGB, therapeutische Masseurin<br />
Michelle Konrad, Sins - dipl. Musik- und Bewegungspädagogin, Rhythmikerin, Primarlehrerin,<br />
Dozentin <strong>PHZ</strong> <strong>Zug</strong><br />
2 MI-Nachmittage 14.00-17.00<br />
29.02./ 07.03.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
6 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong><br />
22.14B TANZKINDER: DREHEN-HÜPFEN, STRECKEN-RUGELN, PATSCHEN-<br />
KLATSCHEN 1-2-3<br />
Kindergarten, Unterstufe, SHP, Lehrpersonen für Integrative Förderung / Logopädie / Psychomotorik,<br />
Mitarbeitende in Tagesstrukturen<br />
Miteinander bewegen, erfinden, improvisieren, gestalten. Kindliche Entdeckerfreude,<br />
spielerisches Miteinander, Eintauchen in Musik, Bewegung und Tanz; all dies macht den<br />
Unterricht zu einem intensiven Erlebnis.<br />
Ziele, Inhalte<br />
Dieser Kurs richtet sich an Lehrpersonen, welche mit Kindern im Kindergarten oder auf der<br />
Unterstufe arbeiten und im Bereich Bewegung und Tanz neue Ansätze suchen. Ziel dieses<br />
Kurses ist es, nicht nur Ideen für Bewegungs- und Tanzsequenzen kennen zu lernen,<br />
sondern auch Anregungen und Inputs zu bekommen, wie man mit Musik, Bewegung und<br />
Tanz die Themen des Schulalltages fächerübergreifend verbinden kann.<br />
Catherine Huggler Feger, Knonau - dipl. Bewegungspädagogin BGB, therapeutische Masseurin<br />
Michelle Konrad, Sins - dipl. Musik- und Bewegungspädagogin, Rhythmikerin, Primarlehrerin,<br />
Dozentin <strong>PHZ</strong> <strong>Zug</strong><br />
1 Dienstag 08.30-16.00<br />
17.04.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
6.5 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern<br />
Bemerkungen<br />
Materialkosten: Fr. <strong>20</strong>.-<br />
78
79<br />
22.15A "BEWEGTES LERNEN" IM UNTERRICHTSALLTAG<br />
Lehren und Lernen<br />
Mittelstufe 1, Mittelstufe 2, SHP, Lehrpersonen für Integrative Förderung / Logopädie / Legasthenie /<br />
Psychomotorik<br />
Ziele, Inhalte<br />
Dieser Kurs richtet sich an alle Lehrpersonen, welche die wichtigsten Unterrichtsprinzipien<br />
des "Bewegten Lernens" kennenlernen möchten und neue kind- und zeitgemässe Ansätze<br />
suchen, die gewinnbringend zur bewegten Rhythmisierung des Unterrichts beitragen<br />
werden. Die Kursteilnehmenden lernen, wie Schulstoff in Verbindung mit Musik und<br />
Bewegung konzentrations- und motivationsfördernd eingesetzt und die ganzheitliche<br />
Entfaltung des Leistungspotenzials der Schülerinnen und Schüler gefördert werden kann.<br />
Transfer<br />
Die Teilnehmenden lernen vielseitige Ideen kennen, welche anschliessend eins zu eins im<br />
Schulalltag umgesetzt werden können.<br />
Catherine Huggler Feger, Knonau - dipl. Bewegungspädagogin BGB, therapeutische Masseurin<br />
Michelle Konrad, Sins - dipl. Musik- und Bewegungspädagogin, Rhythmikerin, Primarlehrerin,<br />
Dozentin <strong>PHZ</strong> <strong>Zug</strong><br />
22.15B "BEWEGTES LERNEN" IM UNTERRICHTSALLTAG<br />
1 Samstag 08.30-16.30<br />
10.09.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
7 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong><br />
Mittelstufe 2, SHP, Lehrpersonen für Integrative Förderung / Logopädie / Psychomotorik, Mitarbeitende in<br />
Tagesstrukturen<br />
Ziele, Inhalte<br />
Dieser Kurs richtet sich an alle Lehrpersonen, welche die wichtigsten Unterrichtsprinzipien<br />
des "Bewegten Lernens" kennenlernen möchten und neue kind- und zeitgemässe Ansätze<br />
suchen, die gewinnbringend zur bewegten Rhythmisierung des Unterrichts beitragen<br />
werden. Die Kursteilnehmenden lernen, wie Schulstoff in Verbindung mit Musik und<br />
Bewegung konzentrations- und motivationsfördernd eingesetzt und die ganzheitliche<br />
Entfaltung des Leistungspotenzials der Schülerinnen und Schüler gefördert werden kann.<br />
Transfer<br />
Die Teilnehmenden lernen vielseitige Ideen kennen, welche anschliessend eins zu eins im<br />
Schulalltag umgesetzt werden können.<br />
Catherine Huggler Feger, Knonau - dipl. Bewegungspädagogin BGB, therapeutische Masseurin<br />
Michelle Konrad, Sins - dipl. Musik- und Bewegungspädagogin, Rhythmikerin, Primarlehrerin,<br />
Dozentin <strong>PHZ</strong> <strong>Zug</strong><br />
1 Montag 08.30-17.00<br />
16.04.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
7 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern<br />
Bemerkungen<br />
Materialkosten: Fr. <strong>20</strong>.-
Lehren und Lernen<br />
22.16A „MAUS, PASS AUF!“ - GESCHICHTENKOFFER FÜR DIE HERBSTZEIT<br />
Kindergarten, Unterstufe, SHP<br />
Rhythmisch-musikalisches Erleben und Ideensammlung zum Bilderbuch „Maus, pass auf!“<br />
(Paula Gerritsen).<br />
Ziele<br />
Der Kurs richtet sich an alle Lehrpersonen des Kindergartens und der Unterstufe, welche<br />
ihren Unterricht mit dem Bilderbuch „Maus, pass auf!“ (Paula Gerritsen) rhythmischmusikalisch-bewegt<br />
erlebbar und stimmungsvoll ganzheitlich gestalten möchten.<br />
Miteinander bewegen, erfinden, improvisieren, gestalten, singen...<br />
Inhalte<br />
In der praktischen Arbeit werden Einstiegsideen, Bewegungssequenzen, Spielformen und<br />
musikalisch-tänzerische Elemente zu einzelnen Ausschnitten des Bilderbuches mit<br />
unterschiedlichen Materialien kennen gelernt. Das Bilderbuch als Ganzes wird durch einen<br />
roten Faden 'verpackt'. Zudem werden sprachliche und mathematische Inhalte dieser<br />
Stufen fächerübergreifend durch die Geschichte erarbeitet und aufgebaut.<br />
Transfer<br />
Das Bilderbuch mit allen vielfältigen „Kofferideen“ lässt sich anschliessend eins zu eins im<br />
Kindergarten - und Unterstufenalltag umsetzen.<br />
Catherine Huggler Feger, Knonau - dipl. Bewegungspädagogin BGB, therapeutische Masseurin<br />
Michelle Konrad, Sins - dipl. Musik- und Bewegungspädagogin, Rhythmikerin, Primarlehrerin,<br />
Dozentin <strong>PHZ</strong> <strong>Zug</strong><br />
1 MI-Nachmittag 14.00-17.30<br />
07.09.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
3.5 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong><br />
80
81<br />
Lehren und Lernen<br />
22.16B „WIE WEIHNACHTELT MAN?“ - GESCHICHTENKOFFER FÜR DIE ADVENTS-<br />
UND WEIHNACHTSZEIT<br />
Kindergarten, Unterstufe, SHP<br />
Rhythmisch-musikalisches Erleben und Ideensammlung zum Bilderbuch „Wie weihnachtelt<br />
man?“ (Lorenz Pauli, Kathrin Schärer).<br />
Ziele<br />
Der Kurs richtet sich an alle Lehrpersonen des Kindergartens und der Unterstufe, welche<br />
ihren Unterricht mit dem Bilderbuch „Wie weihnachtelt man?“ (Lorenz Pauli, Kathrin<br />
Schärer) rhythmisch-musikalisch-bewegt erlebbar und stimmungsvoll ganzheitlich<br />
gestalten möchten. Miteinander bewegen, erfinden, improvisieren, gestalten, singen...<br />
Inhalte<br />
In der praktischen Arbeit werden Einstiegsideen, Bewegungssequenzen, Spielformen und<br />
musikalisch-tänzerische Elemente zu einzelnen Ausschnitten des Bilderbuches mit<br />
unterschiedlichen Materialien kennen gelernt. Das Bilderbuch als Ganzes wird durch einen<br />
roten Faden 'verpackt'. Zudem werden sprachliche und mathematische Inhalte dieser<br />
Stufen fächerübergreifend durch die Geschichte erarbeitet und aufgebaut.<br />
Transfer<br />
Das Bilderbuch mit allen vielfältigen „Kofferideen“ lässt sich anschliessend eins zu eins im<br />
Kindergarten - und Unterstufenalltag umsetzen.<br />
Catherine Huggler Feger, Knonau - dipl. Bewegungspädagogin BGB, therapeutische Masseurin<br />
Michelle Konrad, Sins - dipl. Musik- und Bewegungspädagogin, Rhythmikerin, Primarlehrerin,<br />
Dozentin <strong>PHZ</strong> <strong>Zug</strong><br />
1 MI-Nachmittag 14.00-17.30<br />
28.09.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
3.5 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong>
Lehren und Lernen<br />
22.16C „FÜNF FRECHE MÄUSE MACHEN MUSIK“ - GESCHICHTENKOFFER FÜR EIN<br />
MUSIK- UND BEWEGUNGSPROJEKT<br />
Kindergarten, Unterstufe, SHP<br />
Rhythmisch-musikalisches Erleben und Ideensammlung zu den Bilderbüchern „Fünf freche<br />
Mäuse machen Musik“ (Chisato Tashiro) und "Fünf freche Mäuse bauen ein Haus“<br />
(Chisato Tashiro). Eignet sich sehr gut für den Start ins neue Schuljahr.<br />
Ziele<br />
Der Kurs richtet sich an alle Lehrpersonen des Kindergartens und der Unterstufe, welche<br />
ihren Unterricht mit den Bilderbüchern „Fünf freche Mäuse machen Musik“ (Chisato<br />
Tashiro) und "Fünf freche Mäuse bauen ein Haus“ (Chisato Tashiro) rhythmischmusikalisch-bewegt<br />
erlebbar und stimmungsvoll ganzheitlich gestalten möchten.<br />
Miteinander bewegen, erfinden, improvisieren, gestalten, singen...<br />
Inhalte<br />
In der praktischen Arbeit werden Einstiegsideen, Bewegungssequenzen, Spielformen und<br />
musikalisch-tänzerische Elemente zu einzelnen Ausschnitten des Bilderbuches mit<br />
unterschiedlichen Materialien kennen gelernt. Das Bilderbuch als Ganzes wird durch einen<br />
roten Faden 'verpackt'. Zudem werden sprachliche und mathematische Inhalte dieser<br />
Stufen fächerübergreifend durch die Geschichte erarbeitet und aufgebaut.<br />
Transfer<br />
Das Bilderbuch mit allen vielfältigen „Kofferideen“ lässt sich anschliessend eins zu eins im<br />
Kindergarten - und Unterstufenalltag umsetzen.<br />
Catherine Huggler Feger, Knonau - dipl. Bewegungspädagogin BGB, therapeutische Masseurin<br />
Michelle Konrad, Sins - dipl. Musik- und Bewegungspädagogin, Rhythmikerin, Primarlehrerin,<br />
Dozentin <strong>PHZ</strong> <strong>Zug</strong><br />
1 MI-Nachmittag 14.00-17.30<br />
02.05.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
3.5 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong><br />
22.17 <strong>20</strong> BEWEGUNGSIDEEN FÜR EINE BESSERE KONZENTRATION<br />
Primarstufe<br />
Zum Start der Schulstunde, zur Unterbrechung, zum Abschalten, zum Innehalten - kurze,<br />
spielerische Bewegungsabläufe helfen weiter.<br />
Ziele, Inhalte<br />
� Spielerische, koordinative Bewegungsideen für mehr Konzentration<br />
� Über die Bewegung die Konzentration auf sich selber lenken, Abstand gewinnen vom<br />
Lektionsinhalt, damit man sich von Neuem auf den Schulstoff konzentrieren kann<br />
Arbeitsweise: Praxis und Theorie wechseln sich ab<br />
Transfer: Die Kursideen können im Schulzimmer umgesetzt werden<br />
Erika Gallusser, Neudorf - dipl. Bewegungspädagogin SBTG<br />
2 SA-Vormittage 08.30-12.30<br />
29.10./ 12.11.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
8 Std.<br />
Kursort<br />
<strong>Zug</strong>, <strong>PHZ</strong><br />
82
83<br />
22.18 DER ZÜNDENDE FUNKE – MOTIVATION IM SCHULZIMMER<br />
Primarstufe<br />
Der Lernerfolg in der Schule hängt eng mit der Motivation zusammen. Für viele<br />
Schülerinnen und Schüler ist für die Lernmotivation die Beziehung zur Lehrperson sehr<br />
bedeutsam. Die Beziehungsgestaltung und das Klassenklima sind für die Lernmotivation<br />
zentrale Faktoren. Die Weiterbildung setzt sich in einem umfassenden Sinn mit der Frage<br />
auseinander: Wie kann Motivation im Schulalltag geweckt und gefördert werden?<br />
Ziele<br />
� Grundlagen der Lernmotivation und deren schulische Rahmenbedingungen kennen<br />
lernen<br />
� Instrumente und Haltungen für die Förderung der Motivation kennen lernen<br />
� Ansätzen im Umgang mit demotivierten Schülerinnen und Schülern kennen lernen<br />
� Möglichkeiten für die Stärkung der Motivation in der Rolle der Lehrperson kennen<br />
lernen<br />
� Zusammenhänge zwischen Motivation und Klassenführung kennen<br />
Inhalte<br />
� Vermitteln von Wissen zum Thema Motivation und Beziehung im Unterricht<br />
� Reflexion der persönlichen Einstellungen zu Motivation<br />
� Aufzeigen von Möglichkeiten der Integration der Kursinhalte<br />
Arbeitsweise: Theoretische und praktische Inputs, Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen<br />
und Kollegen, Arbeit an Fallbeispielen, Gruppenarbeiten<br />
Gertrud Zürcher, Zürich - Fachexpertin für Gesundheitsförderung, Sozialarbeiterin FH,<br />
Supervisorin, Organisationsberaterin BSO<br />
Urs Nogler, Meilen - Lehrer, Schulleiter, TaV-Berater, Supervisor, Coach, Organisationsberater<br />
IEF BSO<br />
22.19A MOTIVIERENDE LEKTIONSEINSTIEGE<br />
Mittelstufe 2, Sekundarstufe 1<br />
Inhalte<br />
Lernende für ein Thema begeistern, deren Neugierde wecken und die ganze<br />
Aufmerksamkeit auf den Stoff lenken. Ob dies gelingt, entscheidet sich oft bereits in den<br />
ersten paar Minuten einer Lektion.<br />
Dieser Kurs präsentiert den Teilnehmenden eine Fülle von Einstiegsideen, welche sich<br />
gezielt in den Unterricht einbauen lassen (spannende Texte, Lern- und<br />
Kommunikationsspiele, witziges Bildmaterial, Quiz, usw).<br />
Ziele: Die Teilnehmenden<br />
� kennen eine Fülle von motivierenden Lektionseinstiegen für den Deutsch- und<br />
Fremdsprachenunterricht (Englisch/Französisch).<br />
� sind in der Lage, die vermittelten Ideen ihrem Unterricht anzupassen.<br />
Michael Burtscher, Wilen b. Wil - Sekundarlehrer phil. I<br />
Lehren und Lernen<br />
3 SA-Vormittage 08.30-12.00<br />
12.05./ 02.06./ 16.06.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
10.5 Std.<br />
Kursort<br />
<strong>Zug</strong>, <strong>PHZ</strong><br />
1 Samstag 09.00-16.45<br />
29.10.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
6.5 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong>
Lehren und Lernen<br />
22.19B MOTIVIERENDE LEKTIONSEINSTIEGE<br />
Mittelstufe 2, Sekundarstufe 1<br />
Inhalte<br />
Lernende für ein Thema begeistern, deren Neugierde wecken und die ganze<br />
Aufmerksamkeit auf den Stoff lenken. Ob dies gelingt, entscheidet sich oft bereits in den<br />
ersten paar Minuten einer Lektion.<br />
Dieser Kurs präsentiert den Teilnehmenden eine Fülle von Einstiegsideen, welche sich<br />
gezielt in den Unterricht einbauen lassen (spannende Texte, Lern- und<br />
Kommunikationsspiele, witziges Bildmaterial, Quiz, usw).<br />
Ziele: Die Teilnehmenden<br />
� kennen eine Fülle von motivierenden Lektionseinstiegen für den Deutsch- und<br />
Fremdsprachenunterricht (Englisch/Französisch).<br />
� sind in der Lage, die vermittelten Ideen ihrem Unterricht anzupassen.<br />
Michael Burtscher, Wilen b. Wil - Sekundarlehrer phil. I<br />
1 Samstag 09.00-17.00<br />
10.03.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
6.5 Std.<br />
Kursort<br />
Goldau, SZ<br />
22.<strong>20</strong> SCHACH – STEIGERUNG DER KONZENTRATION UND LERNEFFIZIENZ<br />
Stufenübergreifend<br />
Ziele<br />
Mit diesem Kurs wird gezeigt, wie man Schach in verschiedenen Unterrichtsfächern<br />
spannend integrieren kann und welche positiven Effekte Kinderschach auf Konzentration<br />
und Schulleistungen hat.<br />
Inhalte<br />
Warum Kinderschach? Hintergrund, persönliche Erfahrungen und wissenschaftliche<br />
Erkenntnisse: Zahlreiche internationale Studien belegen die positiven Effekte von<br />
Kinderschach. Die Kinder lernen im Schach mit den vorhandenen Ressourcen wie Raum,<br />
Zeit, Material bewusst und zielgerecht umzugehen. Ihre Konzentration und<br />
Aufmerksamkeit wird geschult und sie lernen auf spielerische Art und Weise, wie man<br />
strategisch Schritt für Schritt eine komplexe Situation bewältigt. Zudem wird der Umgang<br />
mit Sieg, Niederlage und Fairness auch bei Frustrationen ständig erprobt.<br />
Arbeitsweise und Transfer<br />
In diesem Kurs erfahren die Lehrpersonen, wie Schach spannend und vielfältig in<br />
verschiedene Fächer integriert werden kann. Dabei führt der Referent die Lehrpersonen in<br />
die Grundlagen des Schachs und deren Vermittlung mit modernen interaktiven<br />
Lehrmethoden ein.<br />
Alexander Schiendorfer, Biberist - Mentaltrainer IAP, Mitglied des SASP (anerkannt von<br />
SwissOlympic), Jugendschachtrainer SSB<br />
2 MI-Nachmittage 14.00-17.00<br />
21.03./ 30.05.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
6 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong><br />
84
85<br />
22.21 JASSEN IN DER SCHULE<br />
Primarstufe<br />
Inhalt<br />
Jassen als Teamanlass: Das WBZA-Team führt die Teilnehmenden in die im<br />
Kursprogramm <strong>20</strong>11/12 beschriebenen Jassformen ein.<br />
Arbeitsweise<br />
� Kurzer Input fürs Jassen mit deutschschweizer Jasskarten: Geschichte, Kartenkunde,<br />
Jassregeln, Zähl- und Schreibsystem<br />
� Gemeinsames Jassen<br />
� Hinweise für das Jassen mit der Klasse<br />
Bemerkung<br />
Die Jassregeln sind ausführlich auf www.jassonkel.ch beschrieben.<br />
Auflösung Kursprogramm <strong>20</strong>11/12<br />
Strategie und Spass im Team und im Unterricht<br />
� Gemeinsame Werte: Quoi faire (Volksmund: Coiffeur) (S. 9)<br />
� Gemeinsam einsam: Differenzler (S. 13)<br />
� Im Trio zweimal im Kreis: Smørrebrøed (19)<br />
� Geselligkeit:Hose-Runter (S. 25)<br />
� Generationenverbindend: Schellenjass (S. 47)<br />
� Brücken bauen: Tschau Sepp (S. 61)<br />
� Gemeinsame Interessen: <strong>Zug</strong>er Jass (S. 73)<br />
� Partner(schafft): Schieber (S. 85)<br />
� Miteinander gegeneinander: Molotow (S. 105)<br />
TEAM WBZA, <strong>Zug</strong><br />
Lehren und Lernen<br />
1MI-Nachmittag 14.00-17.00<br />
25.01.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
3 Std.<br />
Kursort<br />
<strong>Zug</strong>, <strong>PHZ</strong><br />
Bemerkungen<br />
Team WBZA
Lehren und Lernen<br />
22.22 KOGNITIVE FÖRDERUNG - VERMITTLUNG GRUNDLEGENDER<br />
LERNFÄHIGKEITEN<br />
Sekundarstufe 1<br />
Ziele<br />
Dieses Angebot richtet sich an Lehrpersonen der Oberstufe, die Prozesse des Lernens<br />
besser verstehen wollen, um Kindern und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten besser<br />
helfen zu können. Die Fortbildung führt in den theoretischen Rahmen von Feuerstein und<br />
in die praktische Arbeit mit zwei Instrumenten ein (Arbeitseinheiten von ca. <strong>20</strong> Lektionen).<br />
Inhalte und Arbeitsweise<br />
Wir werden uns Zeit nehmen für eigenes Ausprobieren, für Reflexionen, für<br />
Erfahrungsaustausch und für das Umsetzen der theoretischen Grundlagen in den<br />
Arbeitsalltag. Die Teilnehmenden erhalten ein strukturiertes Mittel, um grundlegende<br />
Lernprozesse in Jugendlichen und Erwachsenen auszulösen und einzuüben.<br />
Rolf Nyfeler, Zürich - Fachpsychologe für Psychotherapie FSP, Fachpsychologe für Kinder und<br />
Jugendliche FSP<br />
2 Samstage 09.00-17.00<br />
14.01./ 28.01.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
14 Std.<br />
Kursort<br />
<strong>Zug</strong>, <strong>PHZ</strong><br />
Bemerkungen<br />
Materialkosten: ca. Fr. <strong>20</strong>.-<br />
22.24 WAHRNEHMUNGSFÖRDERUNG ALS VORAUSSETZUNG FÜR GUTES LERNEN<br />
Kindergarten, Primarstufe, SHP<br />
Ein altersgemässer Reifestand der kindlichen Wahrnehmungsausstattung ist eine<br />
unabdingbare Voraussetzung für eine harmonische körperliche, seelische und intellektuelle<br />
Entwicklung. Die Intensität, mit welcher ein Kind einen Gegenstand ergreift und die<br />
Prägnanz, mit welcher es etwas zu betrachten und zu erhorchen, also zu beobachten<br />
vermag, sowie die Geschicklichkeit, mit der es geht, rennt und sich im Gleichgewicht hält,<br />
sind die wichtigste Voraussetzung für den Erwerb eines verlässlichen Lese- und<br />
Rechenverständnisses und einer altersgemässen Schreibleistung.<br />
Kindergartenlehrpersonen legen daher mit dem Wissen um diese Zusammenhänge und<br />
mit einer gezielten Wahrnehmungsförderung die Grundlagen für eine künftige gedeihliche<br />
Schullaufbahn der Kinder.<br />
Ziele, Inhalte<br />
Lange vor dem Eintritt in den Kindergarten formt sich die Qualität der Wahrnehmung. Die<br />
Wahrnehmungsreife ermöglicht erst einen zweckmässigen Umgang mit sich und der<br />
Umwelt. Eine intakte Wahrnehmungsleistung ist Grundvoraussetzung für altersgemässes<br />
Lernen. Auf Grund des Verhaltens lassen sich Rückschlüsse auf Wahrnehmungsdefizite<br />
ziehen. Welche Vorkehrungen lassen sich zum Abbau solcher Wahrnehmungsdefizite<br />
treffen?<br />
Transfer<br />
Die Teilnehmenden lernen Zusatzangebote zur Förderung des Wahrnehmungsrepertoires<br />
kennen. Auch Erfahrungsaustausch und Diskussion sind Bestandteile des Kurses.<br />
Richard Humm, Zürich - Schulungsberater<br />
3 DO-Abende 17.30-<strong>20</strong>.00<br />
01.09./ 08.09./ 15.09.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
7.5 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong><br />
86
87<br />
22.25 KLASSENRAT – DEMOKRATIE IM KLASSENZIMMER<br />
Sekundarstufe 1, Schulsozialarbeitende<br />
Ziele<br />
Partizipation und Selbstverantwortung der Jugendlichen sind wichtige Bildungsziele. Im<br />
Klassenrat lernen die Jugendlichen, ihre Ideen, Anliegen, Fragen und Sorgen<br />
einzubringen, ihre Vorschläge zum<br />
gemeinsamen Lernen und Zusammenleben zu verhandeln, sowie Konflikte zu lösen.<br />
Inhalte<br />
� Bedeutung von Kreisgesprächen<br />
� Feedbackformen und -regeln<br />
� Demokratie im Klassenzimmer<br />
� Führen eines Klassenrates; Ablauf und Regeln<br />
� Chancen und Grenzen<br />
� Rolle der Lehrperson<br />
Beat Zopp, Schattdorf - Lehrperson Sekundarstufe 1<br />
22.26 KLASSENRAT EFFIZIENT DURCHFÜHREN<br />
Mittelstufe 1, Mittelstufe 2<br />
Ziel<br />
Die Teilnehmenden erlernen effiziente Spielregeln für die Durchführung eines<br />
Klassenrates.<br />
Inhalte<br />
� Die zwei Ziele des Klassenrates<br />
� Die vier Runden des Klassenrates<br />
� Umgang mit Wünschen und Konflikten<br />
Arbeitsweise<br />
Kurzvorträge, Informationsteil, Gruppen- und Einzelarbeit, Plenum, Rollenspiel,<br />
Fallbeispiele<br />
Mària Kenessey-Szuhànyi, Zürich - Individualpsychologische Beraterin, Familientherapeutin,<br />
Supervisorin<br />
1 Samstag 08.30-16.30<br />
27.08.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
6.5 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern<br />
Lehren und Lernen<br />
2 MI-Nachmittage 14.00-17.00<br />
16.11./ 30.11.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
6 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong>
Lehren und Lernen<br />
22.27 REFERATEZYKLUS "SCHULENTWICKLUNG – LEHRPERSON UND<br />
UNTERRICHT"<br />
stufenübergreifend, Schulleitende<br />
Ziele<br />
Der Referatezyklus widmet sich zum einen der Lehrperson und zum anderen dem<br />
Unterricht.<br />
Im ersten Teil erfolgt auf der individuellen Ebene der Lehrerschaft die Auseinandersetzung<br />
mit der Gesunderhaltung der Lehrperson als deren Entwicklungsaufgabe: Wie steht es um<br />
die Gesundheit der Lehrpersonen? Wie bewältigen sie ihren Alltag und wie tun sie dies<br />
erfolgreich? Und welche Massnahmen können Lehrpersonen und Schulleitungen ergreifen,<br />
um die Gesunderhaltung ihrer Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen?<br />
Der zweite Teil des Zyklus’ fokussiert die Unterrichtsebene. Unter dem Motto "Lernen<br />
sichtbar machen" werden Portfolios, Lernjournale und weitere Methoden besprochen sowie<br />
probate Wege des Feedbacks gegenüber Lernenden dargestellt.<br />
Inhalte<br />
Die Repräsentanten und Repräsentantinnen der Themenbereiche führen mittels Referat in<br />
die Materie ein. In der anschliessenden Diskussion erfolgt der Austausch zu individuellen<br />
Bezügen und Situationen im beruflichen Umfeld.<br />
Annett Uhlemann, Goldau - Dozentin <strong>PHZ</strong><br />
Bitte beachten Sie auch folgende Kurse in anderen Themenbereichen:<br />
4 DO-Abende 17.30-19.00<br />
<strong>20</strong>.10./ 24.11.<strong>20</strong>11/ 22.03.<strong>20</strong>12/<br />
24.05.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
6 Std.<br />
Kursort<br />
Goldau, SZ<br />
00.02 Einführung: Beurteilen und Fördern für neue Lehrpersonen<br />
21.02 Montessori <strong>Pädagogik</strong> - aktueller denn je<br />
21.03 Erlebnispädagogisches Arbeiten mit Schulklassen<br />
21.04 Individuelles und teilautonomes Lernen in der Grundacher Schule<br />
21.14 Umgang mit Angst, Kraft und Aggression durch Stockkampf<br />
21.15 "Du schon wieder…" - Alternative Reaktionen bei Unterrichtsstörungen<br />
21.18 Förderorientierte Disziplinarmassnahmen<br />
21.23 Achtsamkeit in der Schule<br />
21.24 Achtsamkeit und Mentaltraining in der Schule<br />
35.10 Zu viel Lärm in der Schule - was tun<br />
88
WEITERBILDUNGSSCHWERPUNKT INTEGRATIVE FÖRDERUNG<br />
Eine Initiative der Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildungsstellen der Zentralschweiz LWBZ<br />
89<br />
Lehren und Lernen<br />
Integration ist an allen Schulen der Zentralschweiz kein neues, aber ein sehr bedeutsames und aktuelles Thema der Schul- und<br />
Unterrichtsentwicklung. Der Paradigmenwechsel von der Separation zur Integration ist für Lehrpersonen, Schulleitungen und Unterrichtsteams<br />
mit grossen Herausforderungen verbunden. Die Weiterbildungsstellen der Zentralschweiz unterstützen die Schulen in<br />
der Planung und Umsetzung von ihrem Integrationskonzept mit einem Weiterbildungsschwerpunkt.<br />
Der Weiterbildungsschwerpunkt „Integrative Förderung“ stellt den Schulleitungen, Lehrpersonen und schulischen Fachpersonen<br />
verschiedene Angebote bereit, die zur Entwicklung der benötigten Kompetenzen von Einzelpersonen und Unterrichtsteams beitragen.<br />
.<br />
Die Angebote basieren auf folgenden Grundsätzen:<br />
• Für die erfolgreiche Umsetzung ist die Schaffung eines gemeinsamen Verständnisses von Integration im Team zentral.<br />
• Die Umsetzung von Integrativer Förderung ist nur von Teams leistbar, in denen alle Mitglieder über je spezifische fachliche<br />
Kompetenzen verfügen und mittels konstruktiver Zusammenarbeit gemeinsam an der weiteren Unterrichtsentwicklung<br />
arbeiten.<br />
• Schulen, Unterrichtsteams und auch die beteiligten Einzelpersonen stehen in der Entwicklung an unterschiedlichen Orten.<br />
Entsprechend besuchen sie Weiterbildungsangebote, die an ihren aktuellen Fragen und Bedürfnissen anknüpfen.<br />
Angebotsübersicht<br />
A) Aufbau eines gemeinsamen integrativen Verständnisses: Weiterbildungsangebote für Schulleitungen, Lehr- und weitere<br />
schulische Fachpersonen, Unterrichtsteams<br />
B) Aufbau und Vertiefung fachlicher Kompetenzen: Weiterbildungsangebote für Lehr- und weitere schulische Fachpersonen
Lehren und Lernen<br />
A) Aufbau eines gemeinsamen integrativen Verständnisses<br />
Weiterbildungsangebote für Schulleitungen, Lehr- und weitere schulische Fachpersonen, Unterrichtsteams<br />
Um Veränderungen und Massnahmen an der Schule gut verankern zu können, muss im Team vor Ort ein gemeinsames Verständnis<br />
von Integration geschaffen werden.<br />
Die Tatsache, dass die Basis einer integrativen Schule aus der Vernetzung unterschiedlicher Fachpersonen besteht, bedingt hohe<br />
Zusammenarbeitskompetenzen. Eine effiziente und gewinnbringende Zusammenarbeit ist anspruchsvoll. Die unterschiedlichen<br />
Situationen der integrierten Kinder, die verschiedenen Bedürfnisse der Lehrpersonen und die sich verändernden Herausforderungen<br />
in den Klassen führen zu ständigen Veränderungen der Zusammenarbeitsstrukturen innerhalb einer Schule. Zusammenarbeit<br />
ist dadurch immer auch Entwicklungsarbeit.<br />
Für den Aufbau eines gemeinsamen integrativen Verständnisses bieten wir folgende Kurse an:<br />
Kurstitel Kursleitung<br />
12.07 Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team erleben Sylvia Bürkler<br />
12.08 Eine integrative Schule braucht eine integrative Zusammenarbeit Priska Brun Hauri<br />
14.09 Schulentwicklung mit dem Index für Inklusion Ivo Grossrieder, Ines Boban,<br />
Andreas Hinz<br />
23.08 Integrative Sonderschulung - Umsetzungen und Lösungen Doris Kehl, Gabriela Eisserle<br />
Studer<br />
23.09 Integrativer Unterricht auf der Sekundarstufe 1 Peter Lötscher, Marcel Huber<br />
23.10 Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und SHP im Rahmen von Integration Klaus Joller-Graf<br />
auf der Sekundarstufe 1<br />
23.11 Die lösungsorientierte Haltung in der Zusammenarbeit mit Eltern Christine Schmid-Maibach<br />
23.12 Formen der Zusammenarbeit an einer Integrativen Schule Fabienne Hubmann, Adrian<br />
Bucher<br />
23.13 Integrative Förderung und Schulsozialarbeit - eine gelingende Kooperation Uri Ziegele, Brigitte Portmann<br />
23.14 Integrative Förderung aus der Sicht der Psychomotoriktherapie Brigitte Mösch<br />
23.25 Stärken entdecken, erfassen, entwickeln Beat Schelbert<br />
24.03 Die Chancen der Vielfalt nutzen: Integration der Erstsprachen Bruno Rütsche<br />
90
B) Aufbau und Vertiefung fachlicher Kompetenzen<br />
Weiterbildungsangebote für Lehr- und weitere schulische Fachpersonen<br />
91<br />
Lehren und Lernen<br />
Die fachliche Kompetenz bildet die Grundlage für professionelles Handeln. Je komplexer die Situationen von Kindern und Jugendlichen,<br />
die in die Regelschule integriert werden, sind, desto höher sind auch die Ansprüche an die Kompetenzen der Lehr- und anderen<br />
Fachpersonen. Die folgenden Kurse unterstützen Lehrpersonen beim Aufbau ihres fachlichen Profils:<br />
Kurstitel Kursleitung<br />
21.09 «Schwierige Kinder» - Herausforderungen in Tagesstrukturen gemeinsam<br />
meistern<br />
Silke Ziegler<br />
22.09A Umgang mit Leistungsheterogenität im offenen Unterricht Gabriela Ryser<br />
22.09B Umgang mit Leistungsheterogenität im offenen Unterricht Gabriela Ryser<br />
22.11A Hochbegabte Kinder erkennen und fördern Katarina Farkas<br />
22.11B Hochbegabte Kinder erkennen und fördern Katarina Farkas<br />
23.04 Förderdiagnostik, ein eigenes Förderdiagnostisches Journal erstellen Astrid von Büren Jarchow<br />
23.15 Kulturtechniken Lesen, Schreiben, Mathematik in der Schule für Kinder Othmar Kamer, Yolanda<br />
mit geistiger Behinderung<br />
Weyermann<br />
23.21 «Ich habe ein Kind mit Autismus Spektrum Störungen (Asperger Syndrom) in<br />
meiner Klasse – was tun?»<br />
Beatrice Lucas-Stöckli<br />
24.04 Deutsch als Zweitsprache - Sprachförderung in der Sekundarstufe 1 Elke-Nicole Kappus, Bruno<br />
Rütsche<br />
43.14 Produktives Mathematiklernen mit lernschwachen Schülerinnen und Schülern<br />
- Fördern durch Fordern<br />
Petra Scherer<br />
43.16 Mathematik ohne Langeweile Priska Fischer Portmann<br />
43.18 Fördern bei mathematischen Lernschwierigkeiten Margreth Schmassmann, Lis<br />
Reusser<br />
43.<strong>20</strong> Umgang mit Vielfalt – Binnendifferenzierter Mathematikunterricht Marcel Eichler<br />
62.13 Sonderschüler im Textilen Werken Monika Reichlin-Kyburz<br />
Als Ergänzung zu diesen Angeboten bestehen im Rahmen der Tagung „Fokus Fachdidaktik“ Möglichkeiten, die individuellen<br />
Kompetenzen im Umgang mit Heterogenität fachspezifisch zu erweitern (siehe folgende Seiten).
Lehren und Lernen<br />
FOKUS FACHDIDAKTIK<br />
Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass fachdidaktische Kompetenzen für die Unterrichtsqualität von<br />
hoher Bedeutung sind. Auf diesem Hintergrund haben die beiden Weiterbildungsstellen der <strong>PHZ</strong> Luzern und der<br />
<strong>PHZ</strong> <strong>Zug</strong> das Weiterbildungsangebot ‚Fokus Fachdidaktik’ konzipiert.<br />
In Form einer Tagung für Lehrpersonen können die fachdidaktischen Kompetenzen unter einem über zwei Jahre<br />
geltenden Schwerpunkt gezielt gestärkt werden. Für die Jahre <strong>20</strong>11 und <strong>20</strong>12 liegt das Hauptaugenmerk auf<br />
dem Umgang mit Vielfalt und stützt somit den aktuellen Weiterbildungsschwerpunkt. <strong>20</strong>11 stehen die Fachdidaktiken<br />
Mathematik, M & U, Naturlehre, Geografie, Geschichte und Sprachen im Vordergrund. <strong>20</strong>12 werden<br />
fachdidaktische Impulse in den Fächern Ethik & Religionen, Lebenskunde, Hauswirtschaft, Gestalten, Musik und<br />
Sport angeboten.<br />
Neben der fachspezifischen Vertiefung in Form von zweitägigen Weiterbildungskursen stärkt der Tagungsrahmen<br />
mit Plenarveranstaltungen und informellen Austauschmöglichkeiten den fächerübergreifenden Diskurs.<br />
Ziele<br />
Die Teilnehmenden<br />
• kennen aktuelle Forschungsergebnisse zum integrativen Umgang mit Vielfalt.<br />
• sind vertraut mit didaktischen Prinzipien zum Umgang mit Vielfalt.<br />
• können einzelne didaktische Prinzipien im gewählten Fachbereich entsprechend den individuellen Lernvoraussetzungen<br />
der Schülerinnen und Schüler wirksam einsetzen.<br />
• können aus den exemplarisch erarbeiteten Unterrichtsarrangements methodisch-didaktische Konsequenzen für andere<br />
Fachbereiche ableiten.<br />
Zielpublikum<br />
Lehrpersonen der Volksschule aller Zentralschweizer Kantone, welche folgende Fächer unterrichten, respektive<br />
als SHP- oder IF-Lehrperson begleiten: Mathematik, M&U, Naturlehre, Geschichte, Geografie, Schul- und<br />
Fremdsprachen.<br />
Tagungsablauf<br />
Mittwoch,<br />
12.10. <strong>20</strong>11<br />
Donnerstag,<br />
13.10. <strong>20</strong>11<br />
Freitag,<br />
14.10. <strong>20</strong>11<br />
18.00-<strong>20</strong>.00 „Didaktische Prinzipien im Umgang mit Vielfalt“<br />
Eröffnungsreferat, Prof. Dr. Klaus Joller-Graf, ISH <strong>PHZ</strong> Luzern<br />
Anschliessend Apéro<br />
08.30-09.00 Kaffee und Gipfeli<br />
09.00-12.00 Fachdidaktik-Angebot gemäss Wahl<br />
12.00-13.30 Lunch-Buffet<br />
13.30-16.30 Fortsetzung Fachdidaktik-Angebot gemäss Wahl<br />
08.30-09.00 Kaffee und Gipfeli<br />
09.00-12.00 Fortsetzung Fachdidaktik-Angebot gemäss Wahl<br />
12.00-13.30 Lunch-Buffet<br />
13.30-15.15 Fortsetzung Kurs gemäss Wahl<br />
15.30-16.30 Fächerübergreifender Austausch<br />
92
Datum: Mittwochabend, 12. Oktober bis Freitag, 14. Oktober <strong>20</strong>11<br />
Ort: Luzern<br />
Kosten: Kostenübernahme für <strong>Zug</strong>er Lehrpersonen durch WBZA <strong>Zug</strong><br />
Anmeldung: WBZA Luzern: www.wbza.luzern.phz.ch/volksschule/fokus-fachdidaktik-<strong>20</strong>11<br />
Anmeldetermin: 31.05.<strong>20</strong>11.<br />
Nachmeldungen sind möglich, sofern noch Plätze frei sind.<br />
Verantwortung: WBZA Luzern und WBZA <strong>Zug</strong> im Auftrag der LWBZ<br />
Organisation: WBZA Luzern<br />
Fachdidaktik-Angebote<br />
In der Tagungsanmeldung kann eines der folgenden fachdidaktischen Angebote ausgewählt werden:<br />
93<br />
Lehren und Lernen<br />
Fach Stufe Kursangebot<br />
Mathematik<br />
Kindergarten,<br />
Kompetenzorientierung in mathematischer Lern- und Leistungsvielfalt<br />
Unterstufe<br />
Kurt Hess<br />
Kurs-Nr. 43.07.01<br />
Mittelstufe 1, Mittelstufe Entdecken, forschen und knobeln im Mathematikunterricht - Herausforde-<br />
2<br />
rungen für unterschiedliche Begabungsniveaus<br />
Priska Fischer Portmann<br />
Kurs-Nr. 43.09.01<br />
Sekundarstufe 1 Mathematisches Lernen kompetenzorientiert entwickeln, fördern und beurteilen<br />
Reinhard Hölzl, Walter Affolter<br />
Kurs-Nr. 43.10.01<br />
M&U<br />
Kindergarten<br />
«Was passiert, wenn?» - Kinder entdecken die Welt über Experimente für<br />
Unterstufe<br />
alle Sinne<br />
Beatrice Mathis Omlin<br />
Kurs-Nr. 31.01.01<br />
Mittelstufe 1, Mittelstufe Instrumentelle Ziele in M&U - Unterrichtsideen, praktische Umsetzung<br />
2<br />
Verena Blum<br />
Kurs-Nr. 31.03.01<br />
Naturlehre Sekundarstufe 1 Lernwirksame naturwissenschaftliche Lernaufgaben und Lernum-gebungen<br />
kennen lernen (SWiSE-Grundkurs)<br />
Markus Wilhelm, Dorothee Brovelli<br />
Kurs-Nr. 41.01.01<br />
Geschichte Sekundarstufe 1 Differenzierungsmöglichkeiten im Geschichtsunterricht: Eidgenossenschaft,<br />
politische Grundkonzepte, Geschichtswissenschaft<br />
Sabine Zieger, Karin Fuchs, Markus Furrer, Claudio Caduff<br />
Kurs-Nr. 34.01.01<br />
Geografie Sekundarstufe 1 Differenzierungsmöglichkeiten im Geografie-Unterricht: Vernetztes Denken,<br />
Geologie, Didaktische Rekonstruktion<br />
Armin Rempfler, Ute Schönauer, Marianne Landtwing, Ulrich Kattman,<br />
Sibylle Reinfried<br />
Kurs-Nr. 42.01.01
Lehren und Lernen<br />
Deutsch<br />
Französisch<br />
Englisch<br />
Kindergarten<br />
Unterstufe<br />
Mittelstufe 1, Mittelstufe<br />
2<br />
Geschichten erzählen<br />
Lisa Hellmann, Alexandra Greeff<br />
Kurs-Nr. 51.09.01<br />
Gute Gespräche - schlechte Gespräche<br />
Brigit Eriksson-Hotz, Martin Luginbühl<br />
Kurs-Nr. 51.10.01<br />
Sekundarstufe 1 Texte selbständig erarbeiten und gemeinsam vertiefen<br />
Ruth Gschwend-Hauser<br />
Mittelstufe 2<br />
Kurs-Nr. 51.11.01<br />
Tâches communicatives en rapport avec la méthode envol<br />
Hans-Peter Hodel<br />
Kurs-Nr. 52.01.01<br />
Sekundarstufe 1 «L'hétérogénéité et des solutions concrètes»<br />
Rebekka Spinner<br />
Mittelstufe 1, Mittelstufe<br />
2<br />
Kurs-Nr. 52.02.01<br />
Open tasks with Young World - ways of dealing with heterogenity<br />
Anna Maria Häfliger<br />
Kurs-Nr. 53.01.01<br />
Sekundarstufe 1 Task-based and content-based teaching with “Inspiration”<br />
Katharina Fischer-von Weissenfluh<br />
Kurs-Nr. 53.02.01<br />
94
95<br />
23 HEILPÄDAGOGIK UND INTEGRATIVE PÄDAGOGIK<br />
Heilpädagogik und Integrative <strong>Pädagogik</strong><br />
23.01 AKTUELLES AUS DEN NEUROWISSENSCHAFTEN: MIT DEM KÖRPER<br />
LERNEN<br />
SHP, Lehrpersonen für Integrative Förderung / Psychomotorik, Schulsozialarbeitende<br />
Ziele<br />
Die Neurowissenschaften weisen immer wieder auf die grundlegende Bedeutung des<br />
Zusammenspiels von Bewegung, Emotion und kognitiver Entwicklung hin. Lernen mit Hilfe<br />
der Bewegung kann daher ein wichtiger Bestandteil des heilpädagogischen Unterrichts<br />
sein.<br />
Der Kurs informiert einerseits über aktuelles Fachwissen aus den Neurowissenschaften<br />
und vermittelt aber auch deren konkrete bewegungsbezogene Umsetzung für den<br />
heilpädagogischen Schulalltag.<br />
Inhalte<br />
� Meilensteine der Bewegungs- und Spielentwicklung<br />
� Aktuelle neurowissenschaftliche Aussagen zum Thema Bewegung und Lernen<br />
� Konkrete Beispiele und Übungen zur Umsetzung auf die heilpädagogische und<br />
therapeutische Arbeit<br />
Arbeitsweise<br />
Referate, Eigenerfahrung, Videobeispiele, Fallbeispiele, Gruppenarbeiten<br />
Kristin Egloff Lehner, Zürich - Psychomotorik-Therapeutin, Dozentin HfH Zürich<br />
2 Samstage 09.15-16.45<br />
29.10./ 12.11.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
12 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern<br />
23.02 AUS DER SICHT DER NEUROWISSENSCHAFTEN: WAHRNEHMUNG – BASIS<br />
DES LERNENS<br />
SHP, Lehrpersonen für Integrative Förderung / Psychomotorik, Schulsozialarbeitende<br />
Ziele<br />
Die Neurowissenschaften beschreiben seit längerem die grundlegende Bedeutung der<br />
Wahrnehmung. Unsere Sinne bilden das Tor zur Kommunikation, unseren Kontakt zur<br />
Welt.<br />
Ziel des Kurses ist das Vertiefen und Ergänzen unseres Fachwissens und die Erweiterung<br />
des wahrnehmungsbezogenen Interventionsrepertoires für unsern Berufsalltag. Neben<br />
aktuellen Erkenntnissen der Medizin und der Neurowissenschaften vermittelt der Kurs die<br />
praktische wahrnehmungsbezogene Umsetzung für den therapeutischen Alltag.<br />
Inhalte<br />
� Grundlagenwissen zu den verschiedenen Sinnesmodalitäten<br />
� Aktuelle neurowissenschaftliche Aussagen zum Thema Wahrnehmung und perzeptive<br />
Verarbeitung<br />
� Konkrete Videobeispiele aus dem Berufsalltag<br />
� viele praktische Übungen zur Umsetzung auf die psychomotorisch therapeutische<br />
Arbeit<br />
2 Samstage 09.15-16.45<br />
03.03./ 17.03.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
12 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern<br />
Bemerkungen<br />
Materialkosten: Fr. <strong>20</strong>.-
Heilpädagogik und Integrative <strong>Pädagogik</strong><br />
Arbeitsweise<br />
Referate, Eigenerfahrung, Videobeispiele, Fallbeispiele, Gruppenarbeiten<br />
Kristin Egloff Lehner, Zürich - Psychomotorik-Therapeutin , Dozentin HfH Zürich<br />
23.03 AUSEINANDERSETZUNG MIT HEILPÄDAGOGISCHEM BASISWISSEN<br />
Stufenübergreifend<br />
Ziele<br />
Auseinandersetzung mit den Facetten der integrativen Sonderschulung und<br />
heilpädagogischem Grundwissen<br />
Inhalte<br />
Durch die Etablierung der integrativen Sonderschulung setzen sich immer mehr Personen<br />
des Bildungswesens mit Behinderten und deren Förderung auseinander. Ein wichtiger<br />
Bestandteil dieses Kurses ist die Auseinandersetzung mit der heilpädagogischen<br />
Grundhaltung, durch welche wir alle Lernenden einer Klasse optimal unterstützen können.<br />
Es werden Inputs zu verschiedenen Behinderungsformen wie Down-Syndrom, Autismus,<br />
geistiger Behinderung, Mehrfachbehinderung, wie auch zu Therapieansätzen vermittelt.<br />
Arbeitsweise<br />
Theoretische Inputs, Diskussionen, Filme, Reflexion, Gruppenarbeiten<br />
Charlotte Schulthess, Ebikon - Sonderpädagogin, Erwachsenenbildnerin<br />
4 MO-Abende 18.00-21.00<br />
19.09./ 26.09./ 17.10./ 24.10.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
12 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern<br />
Bemerkungen<br />
Materialkosten: Fr. <strong>20</strong>.-<br />
23.04 FÖRDERDIAGNOSTIK – EIN EIGENES FÖRDERDIAGNOSTISCHES JOURNAL<br />
ERSTELLEN<br />
stufenübergreifend, SHP, Lehrpersonen für Integrative Förderung<br />
Ziele<br />
Schritte des förderdiagnostischen Prozesses erarbeiten, Erstellen eines eigenen<br />
förderdiagnostischen Journals<br />
Inhalte<br />
Die Kursteilnehmenden bringen ein eigenes Beispiel aus ihrer Praxis zur Bearbeitung mit.<br />
Anhand dieses Beispiels werden die vier Schritte des förderdiagnostischen Journals<br />
durchgespielt. Es wird ein Förderdiagnostisches Journal erstellt.<br />
Arbeitsweise: Kurzreferate und Workshop<br />
Astrid von Büren Jarchow, Stans - Dozentin<br />
3 MI-Nachmittage 13.15-16.45<br />
26.10./ 02.11./ 09.11.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
10.5 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern<br />
96
97<br />
Heilpädagogik und Integrative <strong>Pädagogik</strong><br />
23.05 FRÜHERKENNUNG – EINE WICHTIGE FUNKTION DER SOZIALEN ARBEIT IN<br />
DER SCHULE<br />
Primarstufe, Sekundarstufe 1, SHP, Lehrpersonen für Integrative Förderung, Schulsozialarbeitende,<br />
Schulleitungen<br />
Ziele, Inhalte<br />
Nebst der Prävention und der behandelnden Intervention ist die Früherkennung eine der<br />
drei zentralen Funktionen der Sozialen Arbeit in der Schule. Um Früherkennung als<br />
Systematisierung von sozialen Beobachtungen, ressourcen- und lösungsorientiertem<br />
Austausch über Schülerinnen und Schüler und denkbaren Frühinterventionen in einem<br />
Schulhaus wirksam einzuführen, müssen sich die beteiligten Fachpersonen der Schule<br />
und der Sozialen Arbeit mit möglichen Kommunikationsgefässen sowie einer sinnvollen<br />
personellen Zuständigkeit auseinandersetzen.<br />
Arbeitsweise<br />
Nach einer theoretischen Verortung setzen sich die Teilnehmenden im Kurs interaktiv mit<br />
Beobachtungs und Austauschfragen sowie mit einer konkreten schulhausrelevanten<br />
Einführung der Früherkennung auseinander.<br />
Kurt Gschwind, Luzern - Dozent & Projektleiter Zentrum für Lehre und Bildung<br />
Uri Ziegele, Liebefeld - Dozent & Projektleiter Zentrum für Lehre und Bildung<br />
3 MO-Abende 18.00-21.00<br />
14.11./ 21.11./ 28.11.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
9 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern<br />
23.06 DIAGNOSTIK FÜR SCHULISCHE HEILPÄDAGOGINNEN: NEUE TESTS UND<br />
TRENDS<br />
SHP, Lehrpersonen für Integrative Förderung<br />
Ziele, Inhalte<br />
In diesem Kurs werden eine Reihe kürzlich auf dem Markt erschienene psychologische<br />
Tests und Lernstandserfassungen für die Primar- und Oberstufe vorgestellt. Die<br />
Teilnehmenden werden dabei in deren Anwendung und Handhabung eingeführt und sind<br />
am Ende in der Lage, die Ergebnisse zu interpretieren und daraus Schlussfolgerungen für<br />
die Praxis zu ziehen.<br />
Arbeitsweise<br />
Theoretische Hintergründe werden durch die Referenten kurz beleuchtet. Konkrete<br />
Fallbeispiele werden in Gruppen diskutiert und gedeutet.<br />
Niklaus Oberholzer, Stans - Schulpsychologe Kanton Nidwalden<br />
3 MO-Abende 18.00-<strong>20</strong>.00<br />
05.09./ 12.09./ 19.09.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
6 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern
Heilpädagogik und Integrative <strong>Pädagogik</strong><br />
23.07 FÖRDERDIAGNOSTIK NACH ICF UND SCHULISCHES STANDORTGESPRÄCH<br />
Primarstufe, Sekundarstufe 1, SHP, Lehrpersonen für Integrative Förderung<br />
Ziel<br />
Die Kursteilnehmenden lernen die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit,<br />
Behinderung und Gesundheit (ICF) kennen.<br />
Inhalte<br />
Das schulische Standortgespräch, welches vor dem Hintergrund der ICF entstand, wird in<br />
dem Kurs eingeführt und mit Praxisbeispielen vertieft. Der webbasierte Förderplaner WFP<br />
und die individuelle Schülerdokumentation (ISD) werden als Instrumente der<br />
Förderplanung und Unterrichtsentwicklung aufgezeigt.<br />
Roman Brügger, Kriens - Primarlehrer, SHP<br />
Gabriela Eisserle Studer, Luzern - Dozentin <strong>PHZ</strong><br />
2 MI-Nachmittage 13.30-17.00<br />
11.01./ 25.01.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
6 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern<br />
23.08 INTEGRATIVE SONDERSCHULUNG – UMSETZUNGEN UND LÖSUNGEN<br />
Kindergarten, Primarstufe, SHP, Lehrpersonen für Integrative Förderung, Schulleitende<br />
Seit einigen Jahren werden Kinder und Jugendliche mit Behinderung zunehmend in<br />
Regelklassen wohnortnah unterrichtet. Eine schulische Heilpädagogin unterstützt das Kind<br />
im Unterricht, begleitet die Regelklassenlehrperson und wirkt in der Elternarbeit mit. In der<br />
Umsetzung ergeben sich aus der Komplexität der Aufgabe einige offene Fragen. In diesem<br />
Kurs werden Lösungen und Antworten dargestellt.<br />
Ziele: Die Teilnehmenden<br />
� erhalten Einblick in die theoretischen Grundlagen der «Schule für alle».<br />
� verstehen Denk- und Handlungsmodelle der integrativen (Sonder-) Schulung.<br />
� erhalten Einblick in die integrative Sonderschulung im Körperbehindertenbereich und im<br />
Geistigbehindertenbereich auf der Primarstufe.<br />
� erfahren Gelingensbedingungen und Zuständigkeiten für eine integrative<br />
Sonderschulung. Sie werden somit handlungsfähig, um gemeinsam mit der SHP<br />
Konzepte zu entwickeln, die den Bedürfnissen und den Ressourcen gerecht werden.<br />
Gabriela Eisserle Studer, Luzern - Dozentin <strong>PHZ</strong><br />
Doris Kehl, Wohlen – Sonderpädagogin<br />
1 Samstag 08.30-16.30<br />
17.09.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
6 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern<br />
98
99<br />
23.09 INTEGRATIVER UNTERRICHT AUF DER SEKUNDARSTUFE 1<br />
Sekundarstufe 1, SHP, Lehrpersonen für Integrative Förderung<br />
Ziele, Inhalte<br />
� Mit welchen Lernarrangements können wir auf die unterschiedlichen Lernbedürfnisse<br />
der Schülerinnen und Schüler eingehen?<br />
� Wie fördern wir eigenständiges und verstehensorientiertes Lernen der Jugendlichen<br />
wirksam?<br />
� Wie gelingt es mit angemessenem Aufwand eine Klasse zu führen und die einzelnen<br />
Jugendlichen individuell zu begleiten?<br />
� Wie können wir unser Rollenrepertoire als Lehrpersonen für diese Herausforderungen<br />
erweitern?<br />
� Wie entwickeln wir die Zusammenarbeit im Team, um die vorhandenen Ressourcen<br />
optimal zu nutzen?<br />
Arbeitsweise<br />
� Theoretische Inputs (Konstruktivistisches Lernverständnis, Lerncoaching)<br />
� Einblick in die Praxis einer integrierten Sekundarschule (Lernarrangements,<br />
Arbeitsinstrumente, Zusammenarbeit)<br />
� Einbezug von Fragen und Anliegen der Teilnehmenden<br />
� Erarbeiten eines auf den eigenen Arbeitsplatz abgestimmten Umsetzungsprojektes<br />
� Reflexionen, Erfahrungsaustausch<br />
Marcel Huber, Rain - Sekundarlehrer<br />
Peter Lötscher, Rothenburg - Sekundarlehrer<br />
Heilpädagogik und Integrative <strong>Pädagogik</strong><br />
5 MO-Abende 18.00-21.00<br />
29.08./ 19.09./ 21.11.<strong>20</strong>11/<br />
05.03.<strong>20</strong>12/ 14.05.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
15 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern<br />
23.10 ZUSAMMENARBEIT LEHRPERSONEN UND SHP IM RAHMEN VON<br />
INTEGRATION AUF DER SEKUNDARSTUFE 1<br />
Sekundarstufe 1, SHP, Lehrpersonen für Integrative Förderung, Schulsozialarbeitende<br />
Ziele: Die Teilnehmenden<br />
� verfügen über Kriterien, um Zusammenarbeitssituationen zu analysieren und können<br />
die eigene Situation auf dieser Basis reflektieren.<br />
� erkennen die Bedeutung und die Auswirkungen von Persönlichkeitsaspekten für die<br />
Zusammenarbeit.<br />
� können (auch sich verändernde) Konstellationen im Team analysieren.<br />
� kennen Möglichkeiten, Konflikte im Team konstruktiv zu nutzen.<br />
� können fachgerecht eine Auftragsklärung durchführen.<br />
Inhalte<br />
� Ebenen der Zusammenarbeit<br />
� Persönlichkeit und Zusammenarbeit<br />
� Phasen der Teamentwicklung<br />
� Konflikte frühzeitig erkennen und bearbeiten<br />
� Pflichten, Erwartungen und Aufgaben<br />
� Rollen klären<br />
2 MI-Nachmittage 13.30-17.00<br />
31.08./ 07.09.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
7 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern
Heilpädagogik und Integrative <strong>Pädagogik</strong><br />
Arbeitsweise<br />
Im Kurs werden Inputs zu verschiedenen Aspekten der Zusammenarbeit angeboten, die<br />
zuerst in der Gruppe vertieft werden. Anschliessend wird die Möglichkeit geboten, die<br />
entsprechenden Sachverhalte in die eigene Praxis zu übertragen.<br />
Klaus Joller-Graf, Sarnen - Dr. phil., Dozent <strong>PHZ</strong>, Projektleiter ISH<br />
23.11 DIE LÖSUNGSORIENTIERTE HALTUNG IN DER ZUSAMMENARBEIT MIT<br />
ELTERN<br />
Lehrpersonen der Logopädie / Psychomotorik, Schulsozialarbeitende<br />
Ziele<br />
� Einführung Grundhaltung und Modell der lösungsorientierten Beratung<br />
� Kennen lernen einzelner Elemente und Möglichkeiten zur Umsetzung in der<br />
Zusammenarbeit mit Eltern<br />
� Erweitern der eigenen lösungsorientierten Kompetenzen<br />
Inhalte<br />
Die lösungsorientierte Haltung in der Zusammenarbeit mit Eltern, bzw. die<br />
lösungsorientierte Beratung (LOB) von Eltern ist heute in aller Munde. Fast für jede<br />
beratend tätige Fachperson sind Lösungsorientierung oder Lösungsfokussierung ein Muss<br />
in ihrer Arbeit. Was ist damit aber eigentlich gemeint? Meistens sind ja die Probleme der<br />
Kinder der Grund dafür, dass Sie in der Logopädie oder Psychomotorik mit Eltern<br />
zusammen arbeiten.<br />
Christine Schmid-Maibach, Oberwil - Supervisorin/Coach BSO<br />
2 MI-Nachmittage 13.30-17.00<br />
11.01./ 01.02.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
7 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong><br />
23.12 FORMEN DER ZUSAMMENARBEIT AN EINER INTEGRATIVEN SCHULE<br />
Kindergarten, Primarstufe, SHP, Lehrpersonen für Integrative Förderung<br />
Ziele<br />
Grundlagen und Praxis der Zusammenarbeit zwischen IF-Lehrperson und<br />
Klassenlehrperson an einer integrativen Schule kennen lernen.<br />
Inhalte<br />
Theoretische Grundlagen, Rollen- und Arbeitsteilungen, Organisationsformen,<br />
Voraussetzungen, Herausforderungen, Chancen und Risiken der Zusammenarbeit werden<br />
erläutert und diskutiert. Mögliche Rollen- und Arbeitsteilungen und Organisationsformen<br />
einer Zusammenarbeit werden vorgestellt und so die Verbindung zur Schulpraxis<br />
hergestellt.<br />
Adrian Bucher, Luzern - Primarlehrer<br />
Fabienne Hubmann, Luzern - Lehrerin für Integrative Förderung<br />
4 DO-Abende 18.00-21.00<br />
22.09./ 29.09./ 27.10./ 03.11.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
12 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern<br />
100
101<br />
Heilpädagogik und Integrative <strong>Pädagogik</strong><br />
23.13 INTEGRATIVE FÖRDERUNG UND SCHULSOZIALARBEIT – EINE GELINGENDE<br />
KOOPERATION<br />
Primarstufe, SHP, Lehrpersonen für Integrative Förderung, Schulsozialarbeitende<br />
Ausgehend von den Aufgabenbereichen der Integrativen Förderung und Schulsozialarbeit<br />
klären die Teilnehmenden ihre unterschiedlichen Rollen im System Schule, befassen sich<br />
mit Schnittstellen sowie möglichen Kooperationsformen und setzen sich mit Chancen und<br />
Perspektiven auseinander. Dabei werden Prävention, Früherkennung und behandelnde<br />
Intervention mit berufsspezifischen Arbeitsmethoden reflektiert und durch konkrete<br />
Beispiele vertieft.<br />
Brigitte Portmann, Luzern - Dozentin, Schulische Heilpädagogin<br />
Uri Ziegele, Liebefeld - Dozent & Projektleiter Zentrum für Lehre und Bildung<br />
1 SA-Vormittag 09.00-13.00<br />
1 MI-Nachmittag 13.30-17.30<br />
10.12./ 14.12.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
8 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern<br />
23.14 INTEGRATIVE FÖRDERUNG AUS DER SICHT DER PSYCHOMOTORIK-<br />
THERAPIE<br />
Lehrpersonen für Psychomotorik<br />
Ziele<br />
Wir gewinnen mehr Sicherheit für das interdisziplinäre Zusammenwirken und lernen<br />
gleichsam unterstützende Konzepte für neue Anforderungen und Herausforderungen<br />
kennen. Der individuelle<br />
Förderprozess des Kindes sowie die sorgfältig prozessorientierte Elternbegleitung stehen<br />
dabei im Mittelpunkt.<br />
Inhalte<br />
� Stille: Umgang mit dem Atem und dem körperlichen Grundrhythmus<br />
� Entwicklung des körperlichen Haltes und der räumlichen Wahrnehmungsfähigkeit<br />
� Regulationsstörungen<br />
� Wahrnehmung der Tiefensensibilität und Förderung der Kraftsteuerung<br />
� Bewegungsentwicklung im Zusammenhang mit der Sprachentwicklung und der<br />
Sprachförderung<br />
� Auditive Wahrnehmungsförderung und Gleichgewichtsschulung<br />
� Klang, Stimme, Modulation in der sprachlichen Anleitung<br />
Arbeitsweise<br />
� Diagnostische Beobachtungen mit Kindern in der Praxis<br />
� Praxisreflexion und Evaluation aus systemorientierter Sicht<br />
� Prozessorientierte Selbsterfahrung (Grundlage: Funktionelle Entspannung nach<br />
Marianne Fuchs)<br />
Brigitte Mösch, Uster - Heilpädagogin, Körpertherapeutin<br />
4 Samstage 08.30-16.30<br />
2 MI-Nachmittage 13.30-17.00<br />
17.09./ 24.09./ 14.12.<strong>20</strong>11/<br />
25.01.<strong>20</strong>12/ 10.03./ 09.06.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
35 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern
Heilpädagogik und Integrative <strong>Pädagogik</strong><br />
23.15 KULTURTECHNIKEN LESEN, SCHREIBEN, MATHEMATIK FÜR KINDER MIT<br />
GEISTIGER BEHINDERUNG<br />
SHP, Lehrpersonen für Integrative Förderung<br />
Ziele<br />
Der Kurs richtet sich in erster Linie an Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger in dieses<br />
Berufsfeld. Sie lernen die aktuellen didaktischen Konzepte und Lehrmittel aus diesem<br />
Bereich kennen, illustriert mit vielen Beispielen aus der Praxis. Lehrkräfte mit<br />
Berufserfahrung können vorhandene Kenntnisse ertiefen und neue Ideen für die Praxis<br />
entwickeln.<br />
Inhalte<br />
Erster Tag: Theoretische Fundierung in Kurzreferaten und mit Fachtexten; Präsentation<br />
von Beispielen aus der Praxis; Entwicklung von Ideen und Konzepten für die eigene<br />
Praxis.<br />
Zweiter Tag: Erfahrungsaustausch, Vertiefung, Anregung zu neuen Praxisprojekten<br />
Othmar Kamer, Büren - Dozent<br />
Yolanda Weyermann, Reiden - Kindergartenlehrperson, dipl. schulische Heilpädagogin<br />
1 Samstag 08.30-16.00<br />
1 MI-Nachmittag 14.00-17.30<br />
10.09./ 26.10.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
10 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern<br />
23.16 DER LAUTBILDUNGSANSATZ – WAS UNS DAS SPRECHEN ÜBER LESEN,<br />
SCHREIBEN UND RECHTSCHREIBEN LEHRT<br />
SHP, Lehrpersonen für Logopädie<br />
Ziele<br />
Teilnehmende lernen mit dem Lautbildungsansatz Schülerinnen und Schüler mit<br />
Schwierigkeiten beim Erwerb des Lesens, Schreibens und Rechtschreibens eine<br />
innovative, aussprachegebundene Stütze und einen alternativen Lernstil anzubieten. Sie<br />
erfahren wie eigene Lehr- und Arbeitsmittel sinnvoll ergänzt werden und nicht erneuert<br />
werden müssen.<br />
Inhalte<br />
Für die Unterstufe werden Themen wie Laut-Buchstaben Beziehungen, Wortanalyse und<br />
der Lese-/Schreiberwerb aufgegriffen. Für die Mittelstufe thematisieren wir den Erwerb der<br />
Orthographie mit Hinweisen zu Trennregeln und Doppelungen, die über das Übliche<br />
hinaus gehen.<br />
Arbeitsweise<br />
Wir arbeiten mit Vorträgen, Film- und Tonbeispielen, Arbeitsblättern und Spielen.<br />
Marina Russ, Fällanden - SLP/Logopädin<br />
1 Samstag 09.00-16.00<br />
1 SA-Vormittag 09.00-12.00<br />
03.09./ 21.01.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
9 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern<br />
Bemerkungen<br />
Materialkosten: Fr. 55.-<br />
102
103<br />
Heilpädagogik und Integrative <strong>Pädagogik</strong><br />
23.17 DAS AUDITIVE SYSTEM UND DIE MUSIK- UND SPRACHWAHRNEHMUNG<br />
Kindergarten, Primarstufe, SHP, Lehrpersonen für Integrative Förderung<br />
Ziele<br />
Das auditive System, die Sprach- und Musikverarbeitung kennen lernen und vertiefen<br />
Inhalte<br />
Das Hörsystem ist eines der wichtigsten Systeme zur menschlichen Kommunikation. Lässt<br />
sich das System schulen? Das alte und anatomisch hoch komplexe System fasziniert nicht<br />
nur Musiker, sondern auch Hirnforscher. In diesem Kurs werden die Psychophysik, die<br />
Anatomie und die Grundlagen der auditiven Verarbeitung vorgestellt. Weiter werden die<br />
Gemeinsamkeiten der Musik- und Sprachverabeitung herausgearbeitet und in praktischen<br />
Übungen veranschaulicht.<br />
Arbeitsweise: Referate und kurze praktische Anwendungen<br />
Thomas Jarchow-von Büren, Stans - Dozent<br />
Astrid von Büren Jarchow, Stans - Dozentin<br />
2 MI-Nachmittage 13.15-16.45<br />
14.09./ 21.09.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
7 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern<br />
23.18 DIAGNOSTIK UND THERAPIE KINDLICHER AUSSPRACHESTÖRUNGEN<br />
Lehrpersonen für Logopädie<br />
Die Einteilung kindlicher Aussprachestörungen unklarer Genese ist in der deutschen<br />
Literatur von grossen Unstimmigkeiten geprägt, die sich in einer schier endlosen,<br />
inkongruenten, teilweise undefinierten Terminologie äussert. Im Wesentlichen werden alle<br />
Einteilungsmodelle parallel verwendet, wobei keine Form direkte Rückschlüsse über zugrunde<br />
liegende Störungen oder notwendige Behandlungsansätze zulässt. Studien haben<br />
erwiesen, dass eine psycholinguistische Betrachtung von kindlichen Sprechstörungen<br />
diesen Mangel aufhebt und es hat sich weiterhin gezeigt, dass das Klassifikationsmodell<br />
nach Dodd (1995) in allen bisher untersuchten Sprachen sinnvoll anwendbar ist. Dieses<br />
Modell ist durch zahlreiche Forschungsarbeiten bezüglich der zugrunde liegenden<br />
Störungen der einzelnen Untergruppen bestätigt worden und hat den großen Vorteil, dass<br />
Therapieforschung störungsspezifische Therapiemethodik identifizieren konnte.<br />
Ziele<br />
� Vermittlung notwendiger Grundlagen zur Anwendung des Modells<br />
� Diagnostik der kindlichen Aussprachestörung<br />
� Erklärung der daraus folgenden therapeutischen Konsequenzen<br />
� Vorstellung störungsspezifischer Therapieansätze mit dem Schwerpunkt auf dem<br />
Ansatz P.O.P.T. (Psycholinguistisch orientierte phonologische Therapie, Fox, <strong>20</strong>07).<br />
Inhalte<br />
Unter Verwendung von Fallbeispielen werden diagnostisches und therapeutisches<br />
Vorgehen den Teilnehmenden näher gebracht und mittels Videobeispielen verdeutlicht. Im<br />
Voraus wird ein Prä-Skript an die Teilnehmenden als Vorbereitung für das Seminar<br />
gemailt.<br />
Kerstin Schauss-Golecki, Molfsee (D) - Logopädin, B.A., Lehrlogopädin (dbl)<br />
1 FR-Nachmittag 13.00-<strong>20</strong>.00<br />
1 Samstag 09.00-17.00<br />
21.10./ 22.10.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
13.5 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong>
Heilpädagogik und Integrative <strong>Pädagogik</strong><br />
23.19 THERAPIEINDIKATION BEI JUGENDLICHEN MIT SPRACHSTÖRUNGEN<br />
Lehrpersonen für Logopädie<br />
Ziel<br />
Wann ist bei Kindern und Jugendlichen (ab 10 Jahren) Logopädische Therapie (noch)<br />
sinnvoll? Der Kurs bietet Logopädinnen, die Schülerinnen und Schüler der Mittel- und<br />
Oberstufe betreuen, Unterstützung im Umgang mit dieser Fragestellung. Es geht um<br />
Entscheidungen ob, wie lange und mit welchen Zielsetzungen Logopädie angebracht ist.<br />
Inhalte<br />
Ein speziell zu dieser Fragestellung erarbeitetes Raster mit Therapieindikatoren wird<br />
vorgestellt. Es erleichtert die Entscheidungsfindung hinsichtlich Therapiebedarf und<br />
Therapieschwerpunkten und macht diese auch für Eltern und beteiligte Fachpersonen<br />
transparent.<br />
Arbeitsweise<br />
Die Anwendung des PC-gestützten Indikatorenrasters wird demonstriert,<br />
Einsatzmöglichkeiten werden aufgezeigt und an eigenen Beispielen z.T. in Gruppen<br />
diskutiert.<br />
Tonja Seglias, Zürich - Logopädin, lic. phil.<br />
23.<strong>20</strong> MORPHEMMETHODE – EIN SICHERER WEG ZUR<br />
RECHTSCHREIBKOMPETENZ<br />
SHP, Lehrpersonen für Logopädie<br />
Die Morphemmethode bildet in allen neuen Sprachbüchern die Basis zum Erwerb der<br />
Rechtschreibkompetenz, denn sie ermöglicht den Lernenden einen kognitiven <strong>Zug</strong>riff auf<br />
unsere weitgehend klar definierte Schrift. Dieser <strong>Zug</strong>riff hilft vor allem Kindern mit<br />
Rechtschreibproblemen, in die vermeintliche Willkür der Schrift Ordnung zu bringen.<br />
Mithilfe des Lehrgangs "Grundbausteine der Rechtschreibung" wird gezeigt, wie nach dem<br />
Erwerb der Phonem-Gaphem-Korrespondenzen (phonologische Bewusstheit) das Wissen<br />
über die deutsche Rechtschreibung systematisch vermittelt werden kann (orthografische<br />
Bewusstheit).<br />
Ziele<br />
� den Morphemansatz (Struktur der deutschen Sprache) kennen<br />
� die wichtigsten Reglen innerhalb der Struktur kennen (Metasprache)<br />
� Möglichkeiten zur Erarbeitung und Festigung des Grundwortschatzes kennen<br />
� Arbeits- und lerntechnischen Methoden, die Transfer ermöglichen reflektieren<br />
(Metakognition)<br />
� ein auf die Morphemmethode abgestützes Fehleranalyseschema (Diagnostik,<br />
Förderplanung, Lernprozessbegleitung) kennen<br />
� Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den "Grundbausteinen" und den<br />
"Sprachstarken" herausarbeiten<br />
Arbeitsweise: Vortrag, Übungen, Diskussion<br />
Katharina Leemann Ambroz, Seegräben - Sonderpädagogin, Psychotherapeutin FSP<br />
2 MI-Nachmittage 14.00-17.30<br />
18.01./ 29.02.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
7 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong><br />
1 FR-Abend 18.00-21.00<br />
1 Samstag 08.30-16.30<br />
09.03./ 10.03.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
9.5 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong><br />
104
105<br />
Heilpädagogik und Integrative <strong>Pädagogik</strong><br />
23.21 "EIN KIND MIT AUTISMUS SPEKTRUM STÖRUNGEN (ASPERGER SYNDROM)<br />
IN DER KLASSE – WAS TUN?"<br />
Primarstufe, Sekundarstufe 1, SHP, Lehrpersonen für Integrative Förderung<br />
Ziele, Inhalte<br />
Der Kurs richtet sich an Lehrpersonen aller Stufen, inkl. IF, SHP von Regel- und<br />
Sonderschulen und Schulleitungen, die Kinder mit Autismus Spektrum Störungen und<br />
Aspergersyndrom in ihren Klassen und Schulen haben.<br />
Neben der Vermittlung von Grundwissen zum Thema Autismus werden praxisbezogene<br />
Lösungsansätze zur Unterrichtsvorbereitung und Anpassung der Lernziele vorgestellt, die<br />
auf die individuellen Situationen<br />
und Lernstile angewendet werden können. Zusätzlich werden auch Modelle zur<br />
Verhaltensunterstützung sowie autismusspezifische Strategien behandelt. Wichtige<br />
Faktoren für eine erfolgreiche Integration und in der Praxis häufig gebrauchte Strategien<br />
und Hilfsmittel (z.B. social scripts, Comics Gespräche) werden vorgestellt und besprochen,<br />
ebenso ein<br />
ganzheitlicher Schulansatz zum Thema Integration.<br />
Arbeitsweise und Transfer<br />
Der Kurs bietet den Teilnehmenden eine Kombination von Vortrag mit Videobeispielen und<br />
Gruppenarbeit. Die Lehrpersonen haben auch Gelegenheit, eigene Fallbeispiele zu<br />
besprechen.<br />
Beatrice Lucas-Stöckli, Luzern - Schulberaterin f. Autismusfragen, Tanztherapeutin, Supervisorin,<br />
Coach<br />
23.22 BEWEGUNG "ALS WEG ZUM ADS-KIND"<br />
1 MO 08.30-17.00<br />
1 DI-Vormittag 08.30-12.00<br />
13.02./ 14.02.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
10.5 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern<br />
Kindergarten, Primarstufe, SHP, Lehrpersonen für Integrative Förderung, Mitarbeitende in<br />
Tagesstrukturen<br />
ADS-Kinder, Kinder mit Entwicklungsverzögerung und starken Auffälligkeiten im Verhalten<br />
sind für den geregelten Schulalltag oft eine Belastung, manchmal gar ein Risiko.<br />
Der Kurs vermittelt fachliches Wissen und bewegungsorientierte Interventionen mit dem<br />
Ziel, das Interesse und die Motivation in der Arbeit mit diesen Kindern zu stärken. Konkrete<br />
Inputs und Situationen aus der Schule, im Klassenverband oder in der Einzelsituation<br />
werden analysiert und verschiedene Lösungswege betrachtet.<br />
Theresia Buchmann-Brander, Luzern - Fachlehrerin, Psychomotoriktherapeutin<br />
Irène Kissling, Nürensdorf - Psychomotoriktherapeutin, Dozentin<br />
1 Samstag 09.30-16.30<br />
19.11.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
6 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern
Heilpädagogik und Integrative <strong>Pädagogik</strong><br />
23.23 GRAFOMOTORIK AUF DER BASISSTUFE UNTERSTÜTZEN UND FÖRDERN<br />
Kindergarten, Unterstufe, SHP<br />
Ziele<br />
� Die Teilnehmenden lernen theoretischen Hintergrund zu Zeichnungsentwicklung und<br />
Grafomotorik verstehen.<br />
� Im Kurs erfahrene praktische Inputs sollen im Praxisalltag mit 1 bis 12 Kindern<br />
gemeinsam durchgeführt werden können.<br />
Inhalte<br />
Das Buch "Grafomotorik auf der Basisstufe", welches im März <strong>20</strong>10 erschienen ist, dient<br />
uns als Grundlage. Es enthält neun Lektionen und eine Werkstatt, die nach den<br />
Grundgedanken der Grafomotoriktherapie von mir erstellt wurden. Eine Rahmengeschichte<br />
kann zur Motivation eingesetzt werden. Mir ist jedoch wichtig, dass die Kurtsteilnehmenden<br />
erkennen, dass sie nicht an eine bestimmte Geschichte gebunden sind und die Förderung<br />
in der Grafomotorik auf verschiedenste Art und Weise in den Unterricht einfliessen kann.<br />
Arbeitsweise<br />
Im Plenum, Paararbeit und Einzelarbeit. 1/4 Theorie, 3/4 Praxis (Grob- Fein- Grafomotorik,<br />
Wahrnehmung)<br />
Transfer: Zur Schule, zum Berufsalltag findet ständig statt<br />
Christina Liner, Zürich - dipl. Psychomotoriktherapeutin EDK, Fachberaterin<br />
2 SA-Vormittage 09.00-13.00<br />
24.09./ 01.10.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
8 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong><br />
23.24 MIT DEM KIND FÜRS KIND ÜBUNGSMATERIAL HERSTELLEN<br />
Lehrpersonen für Logopädie<br />
Zahlreiche kommerzielle Therapiematerialien unterstützen uns bei unserer täglichen Arbeit<br />
mit dem Kind. Damit Sprache verknüpft wird mit dem individuellen Umfeld, lassen sich<br />
zusammen mit dem Kind Spiele, Übungsblätter, Merkzettel usw. in Anlehnung an<br />
Bekanntes, herstellen. Auch Neuschöpfungen können entstehen. Im Kurs werden<br />
Beispiele vorgestellt, ausprobiert und weiterführende Ideen gesammelt, hergestellt, u.a.<br />
Renata Iten-Stöckli, <strong>Zug</strong> - Logopädin<br />
Bemerkungen<br />
Bei einem zweiteiligen<br />
Kursangebot besteht die<br />
Möglichkeit, dass die<br />
Teilnehmenden die neuen Inputs<br />
ausprobieren können und Fragen<br />
im zweiten Kursteil besprechen<br />
können.<br />
2 DO-Abende 18:00-21:00<br />
10.11./ 24.11.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
6 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong><br />
106
23.25 STÄRKEN ENTDECKEN, ERFASSEN, ENTWICKELN<br />
107<br />
Sekundarstufe 1, SHP, Lehrpersonen für Integrative Förderung<br />
Der Schlüssel zur Stärkenorientierung liegt darin, die Interessen der Schülerinnen und<br />
Schüler zu wecken, zu erfassen und weiterzuentwickeln. Ein Instrument dazu bildet das<br />
Talentportfolio, wo auch die Stilvorlieben (im Denken, Ausdruck, Lernen, Unterricht) erfasst<br />
werden. Projektartiges Arbeiten (einzeln oder in Gruppen), der Klassenrat und das<br />
Leseatelier stellen weitere Möglichkeiten dar, Unterricht stärkenorientiert zu entwickeln.<br />
Die vorgestellten Instrumente und Methoden werden im Rahmen eines Förderprojektes an<br />
der Oberstufe eingesetzt und weiterentwickelt.<br />
Ziele, Inhalte<br />
Die Teilnehmenden stellen Bestehendes in den Kontext der Stärkenorientierung und<br />
lernen neue Möglichkeiten kennen, auf die Interessen und Fähgikeiten der Schülerinnen<br />
und Schüler einzugehen.<br />
Beat Schelbert, Schindellegi - Sekundarlehrer<br />
23.26 INDIVIDUELLE LERNZIELE UND BEURTEILUNG<br />
SHP, Lehrpersonen für Integrative Förderung<br />
Differenzierter Unterricht an Schulen mit Integrativer Förderung fordert durchdachte<br />
Anpassungen im Bereich Beurteilen. Gerade bei Kindern mit individuellen Lernzielen<br />
herrscht zum Teil grosse Unsicherheit, wie Tests durchgeführt werden sollen und ob man<br />
Anpassungen machen darf. Der Kurs zeigt Gestaltungsmöglichkeiten im anspruchsvollen<br />
Spannungsfeld zwischen Förder- und Selektionsauftrag. Fragen werden anhand<br />
theoretischer Inputs fundiert beantwortet und die Reflexion zeigt die Möglichkeiten in der<br />
Umsetzung in der eigenen Praxis.<br />
Brigitte Portmann, Luzern - Dozentin, Schulische Heilpädagogin<br />
Heilpädagogik und Integrative <strong>Pädagogik</strong><br />
3 DO-Abende 18.00-21.00<br />
03.11./ 10.11./ 17.11.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
9 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern<br />
3 MO-Abende 18.00-21.00<br />
07.11./ 14.11./ 21.11.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
9 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern
Heilpädagogik und Integrative <strong>Pädagogik</strong><br />
23.27 DER NON-AVOIDANCE-ANSATZ IN DER STOTTERTHERAPIE<br />
Lehrpersonen für Logopädie, SHP<br />
Inhalte<br />
In einem ersten Teil geht es um die Differentialdiagnostik Stottern – normale<br />
Unflüssigkeiten und um die Entscheidung, ob das Stottern behandlungsbedürftig ist oder<br />
nicht.<br />
Schwerpunkt dieses Seminars ist dann die praxisnahe Vermittlung des Non-Avoidance-<br />
Ansatzes für stotternde Vorschulkinder und Schulkinder.<br />
Den Teilnehmenden wird vermittelt, wie sie Schritt für Schritt die Umsetzung dieses<br />
Ansatzes in der Therapie mit stotternden Kindern gestalten können. Es geht um eine<br />
spielerische, kindgerechte und gleichzeitig direkte Arbeit am Stottern und an den<br />
Stotterereignissen. Wichtige Themen sind die Enttabuisierung des Stotterns bzw. der<br />
Vorbeugung von Anstrengungs- und Vermeidensreaktionen, die Wahrnehmung des<br />
Stotterns und die Modifikation des spannungsvollen Stotterns in eine lockere, dem<br />
physiologischen motorischen Ablauf des Sprechens möglichst angenäherten flüssigeren<br />
Form des Stotterns und des Sprechens.<br />
Ziele<br />
Das Seminar ist sehr praxisorientiert. Die Teilnehmenden sind nach dem Seminar in der<br />
Lage, stotternde Kinder nach dem Non-Avoidance-Konzept zu behandeln. Theoretische<br />
Hintergründe werden in dem Umfang vorgestellt, wie sie für die praktische therapeutische<br />
Umsetzung relevant sind.<br />
Arbeitsweise<br />
Theoretische Einführung, Demonstrationen der Referentin, Praktische Übungen, Ton- und<br />
Videovorführungen, Diskussion<br />
Susanne Gehrer, Ulm (D) - Lehrlogopödin, NLP-Master<br />
1 Freitag 09.00-18.00<br />
1 Samstag 09.00-16.00<br />
13.04./ 14.04.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
13.5 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong><br />
Bemerkungen<br />
Voraussetzung für die Teilnahme:<br />
Kenntnisse im Fachbereich<br />
Stottern (Ätiologie des Stotterns,<br />
Symptomatik des Stotterns:<br />
Primär- und<br />
Sekundärsymptomatik,<br />
Grundkenntnisse in der Therapie<br />
des Stotterns)<br />
23.28 PSYCHOMOTORISCHE ANSÄTZE BEI VERHALTENSAUFFÄLLIGKEIT<br />
Kindergarten, Primarstufe, SHP, Lehrpersonen für Integrative Förderung / Psychomotorik, Mitarbeitende<br />
in Tagesstrukturen<br />
Kinder mit starken Verhaltensauffälligkeiten haben oft einen anderen <strong>Zug</strong>ang zur Realität,<br />
ihre Wahrnehmungsfähigkeit ist beeinträchtigt. Dies kann eine Folge von<br />
Entwicklungsverzögerungen, einem ADS oder familiären Problemen sein.<br />
Der psychomotorische Ansatz geht solche Schwierigkeiten auf einzigartige Weise an: Das<br />
Kind kann wichtige Kompetenzen in nonverbaler Kommunikation, z.B. Bewegungsspielen,<br />
neu entdecken. In diesem Kurs werden konkrete Situationen aus dem Schulalltag<br />
analysiert, die Lehrpersonen erhalten die Gelegenheit, das eigene Verhalten zu<br />
reflektieren. Psychomotorische Lösungswege werden erarbeitet.<br />
Theresia Buchmann-Brander, Luzern - Fachlehrerin, Psychomotoriktherapeutin<br />
2 MI-Nachmittage 14.00-17.00<br />
14.09./ 21.09.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
6 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern<br />
108
109<br />
Heilpädagogik und Integrative <strong>Pädagogik</strong><br />
23.29 SYSTEMORIENTIERTE PÄDAGOGIK: HANDLUNGSSICHERHEIT IM UMGANG<br />
MIT VERHALTENSAUFFÄLLIGKEITEN<br />
stufenübergreifend, SHP, Lehrpersonen für Integrative Förderung<br />
Der Einbezug systemischer Modelle gibt eine tragende Grundlage für erfolgreiche Arbeit,<br />
auch in schwierigen Situationen. Systemische Modelle werden praxisorientiert entwickelt<br />
und mit konkreten Beispielen verknüpft.<br />
Diese Sequenz vermittelt erste Grundkompetenzen in der Diagnostik und daraus<br />
abgeleiteten Interventionen in Bezug auf Kontextfragen (Klasse / Eltern / Team /<br />
interdisziplinäre Zusammenarbeit).<br />
Marc Getzmann, Sursee - Geschäftsführer Mariazell Sursee<br />
3 DO-Abende 18.30-<strong>20</strong>.30<br />
<strong>20</strong>.10./ 03.11./ 10.11.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
6 Std.<br />
Kursort<br />
Sursee, LU<br />
Bemerkungen<br />
Materialkosten: Fr. 30.-<br />
23.30 WIR LASSEN UNS NICHT BEHINDERN – WIR SPIELEN THEATER!<br />
SHP<br />
Ziele, Inhalte<br />
Dieser Kurs richtet sich an Heilpädagog/-innen und Sozialpädagog/-innen, die mit<br />
Menschen mit geistiger Behinderung Theater spielen wollen.Der Kurs besteht aus drei<br />
Teilen:<br />
1.Teil: Die Teilnehmenden spielen selber Theater und entwickeln ihr eigenes spielerische<br />
Potenzial<br />
(Bewegung, Non verbale Spiele, Darstellendes Spiel, Improvisation);<br />
2.Teil: Die Teilnehmenden befassen sich mit den Fragen: Was ist gleich, was ist anders in<br />
der<br />
Theaterarbeit mit Menschen mit einer Behinderung? Wo liegen ihre Fähigkeiten? Welche<br />
dramaturgischen Mittel gibt es? Wie wird das Theaterspiel geleitet? Welcher Stoff eignet<br />
sich zur Umsetzung?<br />
3.Teil: Welche organisatorischen Schritte führen zu einem erfolgreichen Projekt? Wie<br />
werden Kostüme,<br />
Bühnenbild und Requisiten wirksam eingesetzt?<br />
Arbeitsweise<br />
Der Schwerpunkt liegt im praktischen Tun. Jede Kurseinheit beinhaltet alle drei Teile. Wir<br />
werden den Kurs mit einer kleinen Werkschau beschliessen.<br />
Transfer: Die erarbeitete Spielsammlung dient als Fundus im beruflichen Alltag.<br />
Ursula Hildebrand, Emmebrücke - Theaterpädagogin<br />
Agnes Niederberger, Wädenswil - Universitätsklinik Zürich<br />
2 Samstage 08.30-16.00<br />
3 MI-Nachmittage 13.30-17.30<br />
14.01./ 18.01./ 25.01./ 01.02.<strong>20</strong>12/<br />
04.02.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
27 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern
Heilpädagogik und Integrative <strong>Pädagogik</strong><br />
Bitte beachten Sie auch folgende Kurse in anderen Themenbereichen:<br />
12.08 Eine integrative Schule braucht eine integrative Zusammenarbeit<br />
21.04 Individuelles und teilautonomes Lernen in der Grundacher Schule<br />
21.17 Diagnostik auf dem schulpsychologischen Dienst<br />
21.<strong>20</strong> Umgang mit Kindern mit ADHS und Verhaltensauffälligkeiten<br />
21.21A Kreative Interventionen zu typischen ADHS-Themen (Grundkurs)<br />
21.21B Kreative Interventionen zu typischen ADHS-Themen (Aufbaukurs)<br />
22.11 Hochbegabte Kinder erkennen und fördern<br />
43.14 Produktives Lernen mit lernschwachen Schüler/Innen – Fördern durch Fordern<br />
43.17 Diagnostik bei Rechenschwäche<br />
53.16 Budenberg - Lernsoftware zur Förderung<br />
62.13 Sonderschüler im Textilen Werken<br />
Miteinander gegeneinander<br />
Dieser Jass offenbart strategische Visionen bis auf Regierungsebene. Was als normaler Jass startet, entpuppt sich rasch als vom<br />
Glück abhängiges Scharmützel. Seine Attraktivität liegt, so behaupten Insider, in seiner manipulativen Offenheit und dem Versagerbonus.<br />
Die leise Ahnung einer Falle sitzt immer im Nacken, man ist sich selbst am nächsten.<br />
Kurz: ein intensiver, launischer und ökologischer Jass<br />
Welcher Jass ist hier beschrieben?<br />
� Differenzler<br />
� Hose-Runter<br />
� Molotow<br />
� Quoi faire (Volksmund: Coiffeur)<br />
� Schellenjass<br />
� Schieber<br />
� Smørrebrød<br />
� Tschau Sepp<br />
� <strong>Zug</strong>er Jass<br />
110
111<br />
Deutsch als Zweitsprache und Interkulturelle <strong>Pädagogik</strong><br />
24 DEUTSCH ALS ZWEITSPRACHE UND INTERKULTURELLE PÄDAGOGIK<br />
24.01A LEHRMITTELEINFÜHRUNG: "HOPPLA"<br />
Kindergarten, Unterstufe<br />
Ziele<br />
Die Teilnehmenden setzen sich mit den verschiedenen Komponenten und Angeboten des<br />
Lehrmittels "HOPPLA" auseinander und gewinnen einen Einblick in die dem Lehrmittel zu<br />
Grunde liegenden theoretischen Ansätze. Sie befassen sich mit verschiedenen<br />
Einsatzmöglichkeiten (ganze Klasse, DaZ-Unterricht u.a.) und lernen eine Einheit aus dem<br />
Lehrmittel vertieft kennen.<br />
Inhalte<br />
� Überblick über die Lehrwerkteile<br />
� Einsatzmöglichkeiten<br />
� Die Lehrmittelfiguren<br />
� Didaktische Grundsätze<br />
� Überblick über die 67 Lieder von Gerda Bächli<br />
� Arbeit mit einer Einheit<br />
Arbeitsweise<br />
Inputs, Diskussion, Arbeit in Gruppen, Austausch von Praxiserfahrungen aus dem<br />
Unterricht, individuelle Arbeit mit dem Lehrmittel<br />
Mita Ray von Siebenthal, Zürich - Autorin, Mitarbeiterin Institut für Interkulturelle<br />
Kommunikation IIK<br />
2 MI-Nachmittage 14.00-17.30<br />
07.09./ 28.09.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
7 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong>
Deutsch als Zweitsprache und Interkulturelle <strong>Pädagogik</strong><br />
24.01B LEHRMITTELEINFÜHRUNG: "HOPPLA"<br />
Kindergarten, Unterstufe<br />
Ziele<br />
Die Teilnehmenden setzen sich mit den verschiedenen Komponenten und Angeboten des<br />
Lehrmittels "HOPPLA" auseinander und gewinnen einen Einblick in die dem Lehrmittel zu<br />
Grunde liegenden theoretischen Ansätze. Sie befassen sich mit verschiedenen<br />
Einsatzmöglichkeiten (ganze Klasse, DaZ-Unterricht u.a.) und lernen eine Einheit aus dem<br />
Lehrmittel vertieft kennen.<br />
Inhalte<br />
� Überblick über die Lehrwerkteile<br />
� Einsatzmöglichkeiten<br />
� Die Lehrmittelfiguren<br />
� Didaktische Grundsätze<br />
� Überblick über die 67 Lieder von Gerda Bächli<br />
� Arbeit mit einer Einheit<br />
Arbeitsweise<br />
Inputs, Diskussion, Arbeit in Gruppen, Austausch von Praxiserfahrungen aus dem<br />
Unterricht, individuelle Arbeit mit dem Lehrmittel<br />
Mita Ray von Siebenthal, Zürich - Autorin, Mitarbeiterin Institut für Interkulturelle<br />
Kommunikation IIK<br />
24.02 DEUTSCH ALS ZWEITSPRACHE<br />
Kindergarten, Unterstufe<br />
Für viele in der Schweiz aufwachsende Kinder ist Deutsch die Zweitsprache. Was heisst<br />
dies für den Unterricht und für die Zusammenarbeit mit den Eltern?<br />
Ziele, Inhalte<br />
� Input zum Zweitspracherwerb und zum Hintergrund der Migration<br />
� Fallbeispiele aus dem Unterrichtsalltag der Teilnehmenden<br />
� Praktische Tipps zu erprobten Lehr- und Lernformen<br />
� Einblick in verschiedene Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien<br />
Arbeitsweise<br />
Theoretische Inputs mit Filmbeispiel und Bezug zur Praxis, Diskussionen zu Fallbeispielen,<br />
Einblick in verschiedene Lehrmittel<br />
Regula Kuhn, Adligenswil - Fachstelle für Beratung & Integration von Ausländerinnen und<br />
Ausländern<br />
Sumathy Manikkapoody, Luzern - Tamilische Lehrerin<br />
Lisbeth Wyrsch-Tschudi, Beckenried - DaZ-Lehrperson<br />
2 MI-Nachmittage 14.00-17.30<br />
24.08./ 14.09.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
7 Std.<br />
Kursort<br />
Goldau, SZ<br />
Bemerkungen<br />
Materialkosten: Fr. 5.-<br />
4 MO-Abende 18.00-21.00<br />
29.08./ 05.09./ 12.09./ 19.09.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
12 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern<br />
112
113<br />
Deutsch als Zweitsprache und Interkulturelle <strong>Pädagogik</strong><br />
24.03 DIE CHANCEN DER VIELFALT NUTZEN: INTEGRATION DER ERSTSPRACHEN<br />
Primarstufe, Schulsozialarbeitende<br />
Viele Kinder sprechen zu Hause eine andere Sprache als Deutsch. Wie können diese<br />
Erstsprachen in den Unterricht miteinbezogen, förderlich genutzt und wertgeschätzt<br />
werden? Wie kann der Sprachenreichtum der Klasse für alle Kinder gewinnbringend<br />
eingebracht werden? Welche Bedeutung hat die Erstsprache für den Erwerb der<br />
Zweitsprache Deutsch?<br />
Ziele<br />
� Wissen um die Bedeutung der Erstsprache für den Zweitspracherwerb<br />
� Kennenlernen von Methoden und Formen des Einbezugs der Erstsprachen<br />
� Mehrsprachige Unterrichtsbeispiele und -projekte kennen lernen<br />
Arbeitsweise<br />
Inputreferate, Filmbeispiele, Vorstellen von einfachen Übungen zum Einbezug der<br />
Erstsprachen bis zu Mehrsprachigkeitsprojekten<br />
Bruno Rütsche, Luzern - Dozent <strong>PHZ</strong> Luzern, Heilpädagoge, Schulberater FABIA<br />
3 DI-Abende 18.00-21.00<br />
30.08./ 06.09./ 13.09.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
9 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern<br />
24.04 DEUTSCH ALS ZWEITSPRACHE - SPRACHFÖRDERUNG IN DER<br />
SEKUNDARSTUFE 1<br />
Sekundarstufe 1, SHP, Lehrpersonen für Integrative Förderung<br />
Sprachkompetenz ist unabdingbare Voraussetzung für Schulerfolg. Sprachförderung -<br />
vornehmlich auch für Jugendliche nichtdeutscher Herkunftssprache - gehört daher zur<br />
Aufgabe aller Schulstufen und aller an der Schule tätigen Lehrpersonen.<br />
Ziele<br />
Der Kurs vermittelt Hintergrundinformationen zum Zweitspracherwerb sowie zu<br />
Möglichkeiten der integrativen Sprachförderung auf der Sekundarstufe 1. Er möchte für die<br />
Chancen und Herausforderungen im Umgang mit Mehrsprachigkeit sensibilisieren und<br />
geeignete Lernformen für die Arbeit mit sprachlich heterogenen Klassen aufzeigen.<br />
Inhalte<br />
Folgende Themen werden anhand von theoretischen Inputs, Fallbeispielen und<br />
Diskussionen bearbeitet:<br />
� Zweitspracherwerb und seine Bedingungen<br />
� Möglichkeiten integrativer Sprachförderung<br />
� Instrumente der Sprachstandserhebung<br />
� Herausforderung Mehrsprachigkeit<br />
Elke-Nicole Kappus, Luzern - Dozentin Bildungs- und Sozialwissenschaften <strong>PHZ</strong> Luzern<br />
Bruno Rütsche, Luzern - Dozent <strong>PHZ</strong> Luzern, Heilpädagoge, Schulberater FABIA<br />
4 FR-Abende 18.00-21.00<br />
25.11./ 02.12./ 09.12./ 16.12.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
12 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern
Deutsch als Zweitsprache und Interkulturelle <strong>Pädagogik</strong><br />
24.05 EINFÜHRUNG IN DEN ISLAM UND IN DIE ISLAMISCHE KULTUR<br />
Stufenübergreifend<br />
Jugendliche zwischen Tradition und Schweizer Kultur<br />
Minarett, Burka, Burkini, Schwimmunterricht, Schulreise - muslimische Kinder besuchen<br />
die Schule und begeben sich auf eine «Gratwanderung» zwischen den Kulturen. Die<br />
Lehrerschaft ist gefordert, manchmal überfordert, weil ihr die islamische Kultur fremd ist.<br />
Ziele, Inhalte<br />
Dieser Kurs gibt eine Einführung in den Islam und einen Einblick in die islamischen<br />
Kulturen und Gesellschaften. Kulturelle Werte und Bruchlinien zwischen islamischer<br />
Tradition und der schweizerischen Kultur werden analysiert. Konfliktsituationen sollen<br />
diskutiert werden. Der Dozent ist an Hochschulen und Schulen tätig, ist Einwohnerrat und<br />
Grossrat im Aargau. Er arbeitet in Pakistan für Frauen- und Mädchenprojekten für<br />
www.LivingEducation.org - unter anderem auch im<br />
Talibangebiet.<br />
Arbeitsweise<br />
Ein Skript führt durch diesen Kurs. Das Lernziel, "Erweiterung der sozialen Kompetenz",<br />
soll durch Ausführungen des Dozenten, Gruppenarbeit, Analyse von Videomaterial und<br />
Diskussion erreicht werden. Fragen der Teilnehmenden stehen im Mittelpunkt!<br />
Yahya Hassan Bajwa, Baden - Dr. phil., Leiter Büro Trans Communication<br />
1 FR-Abend 18.00-21.00<br />
1 Samstag 09.00-16.30<br />
27.01./ 28.01.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
9.5 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern<br />
Bemerkungen<br />
Materialkosten: Fr. <strong>20</strong>.-<br />
114
115<br />
Deutsch als Zweitsprache und Interkulturelle <strong>Pädagogik</strong><br />
24.06 DIE WELT IM KLASSENZIMMER – INTERKULTURELLE KOMPETENZ IM<br />
SCHULALLTAG<br />
Stufenübergreifend<br />
Ziele<br />
Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen zu unterrichten<br />
ist eine Herausforderung für Lehrpersonen. In diesem Kurs erhalten die Teilnehmenden<br />
mit Hilfe des IDI (Intercultural Development Inventory) eine persönliche und vertrauliche<br />
Aussensicht auf ihr eigenes interkulturelles Kompetenzprofil. Auf dieser Grundlage lernen<br />
sie konkrete interkulturelle Situationen im Schulalltag einfacher und effektiver zu meistern.<br />
Inhalte<br />
� Kennenlernen des Entwicklungsmodells interkultureller Sensibilität (DMIS,<br />
Developmental Model of Intercultural Sensitivity von Bennet & Hammer) sowie dessen<br />
Anwendungspotential für Schule und Unterricht<br />
� Stichhaltige Einschätzung der individuellen interkulturellen Kompetenz anhand des IDI<br />
sowie Identifizierung individueller Entwicklungsschritte<br />
� Bearbeitung von konkreten interkulturellen Situationen aus dem Berufsalltag der<br />
Teilnehmenden.<br />
Arbeitsweise<br />
Die Teilnehmenden füllen im Vorfeld des Kurses den IDI aus (online - Fragebogen auf<br />
Deutsch, Zeitaufwand ca. 45 Min.). Im ersten Kursblock lernen die Teilnehmenden das<br />
DMIS kennen und bearbeiten auf dem Hintergrund dieses Entwicklungsmodells<br />
interkultureller Sensibilität eigene Erfahrungen aus dem Schulalltag. Anschliessend<br />
erhalten die Teilnehmenden eine vertrauliche individuelle Rückmeldung zu ihren IDI-<br />
Ergebnissen in einem Einzelgespräch; diese Ergebnisse werden dabei in Bezug zum<br />
eigenen Erleben der Teilnehmenden gesetzt. Ein weiterer gemeinsamer Kursblock kann<br />
nach Wunsch der Teilnehmenden folgen: konkrete herausfordernde Situationen aus dem<br />
Schulalltag der Teilnehmenden werden mit Hilfe von kurzen Inputs und mit praktischen<br />
Übungen bearbeitet, so dass die Teilnehmenden einen stimmigen und zielführenden<br />
Umgang mit diesen Situationen entwickeln können.<br />
Transfer<br />
Zwischen den Kursblöcken wenden die Teilnehmenden das Gelernte in der Praxis an und<br />
tauschen sich in der Kursgruppe über die gemachten Erfahrungen aus.<br />
Eveline Steinger, <strong>Zug</strong> - wissenschaftliche Mitarbeiterin IZB, <strong>PHZ</strong> <strong>Zug</strong><br />
1 MI-Nachmittag 14.00-17.00<br />
18.01.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
3 Std.<br />
Kursort<br />
<strong>Zug</strong>, <strong>PHZ</strong><br />
Bemerkungen<br />
Einzelgespräche nach individueller<br />
Vereinbarung, Dauer pro Person 1<br />
Std.<br />
2. Kursblock: Termin nach<br />
Absprache mit den<br />
Teilnehmenden
Deutsch als Zweitsprache und Interkulturelle <strong>Pädagogik</strong><br />
24.07 SCHULE UND MIGRATION<br />
Sekundarstufe 1, Sekundarstufe 2, Schulsozialarbeitende<br />
Das Wissen rund um Fragen von Migration und Integration spielt im Umgang mit<br />
migrationsbedingter Heterogenität eine wichtige Rolle. Im Kurs werden Daten und Fakten<br />
rund um Migration/Integration und Schule präsentiert und diskutiert. Dabei werden sowohl<br />
historische Entwicklungen, gesetzliche Rahmenbedingungen (Ausländergesetz,<br />
Empfehlungen der EDK, kantonale Richtlinien etc.) als auch pädagogische Strömungen<br />
(Ausländerpädagogik, Interkulturelle <strong>Pädagogik</strong>, <strong>Pädagogik</strong> der Vielfalt) behandelt. Der<br />
Kurs möchte - anhand von Inputreferaten, Filmen, Diskussionen u.a. - neue Perspektiven<br />
auf ein altes, stets aktuelles Thema eröffnen.<br />
Elke-Nicole Kappus, Luzern - Dozentin Bildungs- und Sozialwissenschaften, <strong>PHZ</strong> Luzern<br />
1 SA 08.30-16.00<br />
1 SA-Vormittag 08.30-12.00<br />
26.11./ 03.12.<strong>20</strong>11<br />
Kursdauer<br />
10 Std.<br />
Kursort<br />
Luzern<br />
116
117<br />
Deutsch als Zweitsprache und Interkulturelle <strong>Pädagogik</strong><br />
24.08 FILME – EINBLICKE IN BEKANNTE UND FREMDE WELTEN<br />
Mittelstufe 1, Mittelstufe 2<br />
Globales Lernen und bewegte Bilder<br />
Filme können Zusammenhänge erschliessen und Einblicke in neue, unbekannte<br />
Perspektiven ermöglichen. Im Untericht sind sie ein beliebtes und gutes Medium um ein<br />
Unterrichtsthema zu vertiefen. Aber vermögen Filme die eigenen stereotypen Bilder in<br />
unseren Köpfen zu bewegen oder werden diese bestätigt? Mit welchen Fragen kann man<br />
im Unterricht an einen Film herangehen? – Die Teilnehmenden erhalten eine Einführung in<br />
Globales Lernen, diskutieren ausgehend am Beispiel eines Films, was im Sinne des<br />
Globalen Lernens gute Filme sind, erhalten konkrete Anregungen für den Unterricht und<br />
Hintergrundinformationen zum aufgegriffenen Thema.<br />
Ziele: Die Teilnehmenden<br />
� setzen sich mit Filmen, Bildern und Wahrnehmungen auseinander.<br />
� erwerben Hintergrundwissen zu Perspektiven, Alltag von Kindern und Jugendlichen<br />
sowie zu Kinder- und Menschenrechten.<br />
� erhalten Anregungen für die konkrete Umsetzung im Unterricht.<br />
� erhalten Einblick in verschiedene Materialien zum Globalen Lernen.<br />
Inhalte<br />
� Film und Wirklichkeit<br />
� Merkmale eines Films<br />
� Filme im Unterricht<br />
� Filme und Globales Lernen<br />
Arbeitsweise und Transfer<br />
Einzel- und Gruppenarbeiten, Diskussionen, Faktenvermittlung, Filmausschnitte<br />
Christina Jacober, Zürich - Pädagogische Mitarbeiterin<br />
Bitte beachten Sie auch folgende Kurse in anderen Themenbereichen:<br />
33.05 Migrantenjugendliche bei der Berufswahl unterstützen<br />
1 MI-Nachmittag 13.30-17.00<br />
01.02.<strong>20</strong>12<br />
Kursdauer<br />
3.5 Std.<br />
Kursort<br />
Kanton <strong>Zug</strong><br />
Bemerkungen<br />
Bezugsquelle der verwendeten<br />
Filme (inkl. didaktisches<br />
Begleitmaterial):<br />
www.filmeeinewelt.ch