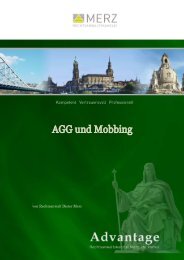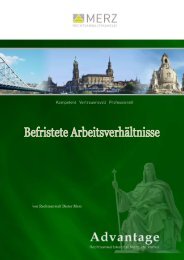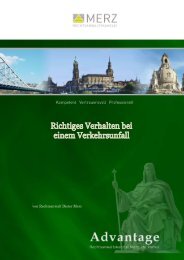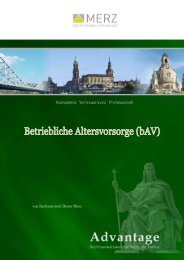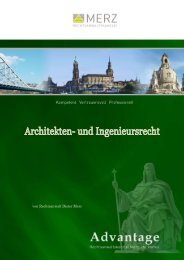von Rechtsanwalt Tobias Stöhr - Anwaltskanzlei Merz - Dresden
von Rechtsanwalt Tobias Stöhr - Anwaltskanzlei Merz - Dresden
von Rechtsanwalt Tobias Stöhr - Anwaltskanzlei Merz - Dresden
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Anders ausgedrückt: Jeder Internethändler<br />
muss seine Widerrufsbelehrung abändern,<br />
wenn das Gesetz in Kraft tritt. Auch hier<br />
dürfte es jedoch wichtig sein, dass<br />
vermieden wird, dass der Verbraucher mit<br />
unterschiedlichen Widerrufsbelehrungen<br />
konfrontiert wird (z.B. bei eBay). Ferner<br />
sollte die Widerrufsbelehrung, über die im<br />
Internet selbst informiert wird, derjenigen<br />
entsprechen, die der Verbraucher auch<br />
später in Textform (bspw. Email) erhält.<br />
Regelung des Wertersatzes<br />
Der Europäische Gerichtshof hat nicht<br />
ausgeurteilt, dass ein Wertersatz unter<br />
keinen Umständen geltend gemacht<br />
werden darf. Ein Wertersatz kann lediglich<br />
für ein "Ausprobieren" der Ware nicht<br />
geltend gemacht werden. Der EuGH hat<br />
ausdrücklich den Punkt offen gelassen,<br />
dass unter Berücksichtigung <strong>von</strong> Treu und<br />
Glauben sehr wohl ein Wertersatz geltend<br />
gemacht werden kann. Aus diesem Grund<br />
spricht der Gesetzgeber auch da<strong>von</strong>, dass<br />
ein Wertersatz dann zu leisten ist, wenn<br />
die Ware in einer Art und Weise genutzt<br />
wurde, die über die Prüfung der<br />
Eigenschaften und der Funktionsweise<br />
hinausgeht. Die wirtschaftlichen Folgen<br />
hat der Gesetzgeber hierbei durchaus<br />
erkannt. Es heißt insofern in der<br />
Gesetzesbegründung:<br />
"Soweit der Verbraucher die Ware in einer<br />
Weise nutzt, die nicht erforderlich ist, um<br />
sein Widerrufsrecht effektiv auszuüben,<br />
entspricht es daher den allgemeinen<br />
Grundsätzen <strong>von</strong> Treu und Glauben, für<br />
diese weitergehende Nutzung bzw.<br />
Abnutzung der Ware Wertersatz leisten zu<br />
müssen. Es wäre unbillig, wenn der<br />
Unternehmer diesen Nachteil tragen<br />
müsste. Denn nicht selten kann eine<br />
benutzte Sache nicht mehr als neuwertig<br />
verkauft werden und ist daher für den<br />
Unternehmer faktisch wertlos. Darüber<br />
hinaus wäre es dem Verbraucher bei einer<br />
Regelung, nach der er generell keinen<br />
Wertersatz leisten müsste, ohne weitere<br />
Konsequenzen möglich, eine Ware über<br />
mindestens zwei Wochen vollständig zu<br />
nutzen und dann wieder zurückzugeben.<br />
Die Beweislast für eine Nutzung der Ware,<br />
die im Einzelfall über die Prüfung der<br />
Eigenschaften und der Funktionsweise<br />
hinausgeht, liegt beim Unternehmer.<br />
Diesem kommt nach Ansicht des<br />
Gesetzgebers der Beweis des ersten<br />
Anscheins zugute.<br />
Weist die Ware deutliche bzw. erhebliche<br />
Gebrauchsspuren auf, entspricht die<br />
allgemeine Lebenserfahrung dafür, dass<br />
dies typische Folge einer intensiven<br />
Nutzung und nicht lediglich einer Prüfung<br />
ist. Erheblich sein kann aber nicht nur die<br />
Intensität der Gebrauchsspuren. Neben<br />
anderen Indizien kann unter Umständen<br />
auch die Gesamtsituation herangezogen<br />
werden. Wird etwa ein Kommunionskleid<br />
nach dem Weißen Sonntag<br />
zurückgesandt, kann ggf. aus den<br />
Umständen geschlossen werden, dass es<br />
getragen und nicht nur ausprobiert wurde,<br />
auch wenn das Kleid keinerlei<br />
Gebrauchsspuren aufweist."<br />
Soweit die Theorie - in der Praxis dürfte es<br />
dem Verkäufer schwierig werden,<br />
nachzuweisen, dass Schuhe bei einer<br />
Hochzeit getragen wurden oder ein<br />
Kommunionskleid einmalig genutzt wurde.<br />
Gleiches gilt auch für die Mitnahme einer<br />
Kamera in einen Urlaub, der weniger als<br />
zwei Wochen dauert.<br />
Der Gesetzgeber vertritt ferner die<br />
Auffassung, dass eine entsprechende<br />
Prüfung bei Öffnen einer Verpackung, bei<br />
der dies nach Verkehrssitte nicht üblich ist<br />
(bspw. verschweißte Medikamente) zu<br />
einer Wertersatzpflicht führt. Grund: eine<br />
derartige Prüfung konnte nicht im<br />
Ladengeschäft vorgenommen werden.<br />
Dies hat die Rechtsprechung bisher<br />
anders gesehen.<br />
17