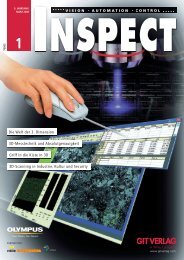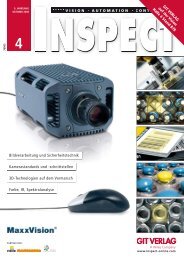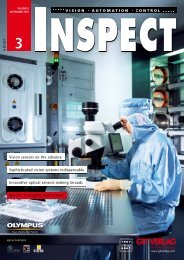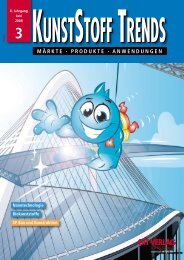Entscheiderbrief - GIT Verlag
Entscheiderbrief - GIT Verlag
Entscheiderbrief - GIT Verlag
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
14<br />
Wer bekommt was?<br />
Kostenträger <strong>Entscheiderbrief</strong> 1/2008<br />
Wie verhalten sich Ressourcenknappheit und der Bedarf an innovativen Therapien zueinander?<br />
Warum spielt die Wirtschaftlichkeit bei innovativen<br />
Therapien eigentlich eine Rolle?<br />
Die medizinische Leistungsfähigkeit einer<br />
Innovation sollte doch ausschließlich ausschlaggebend<br />
für ihren Einsatz sein.<br />
Prof. Dr. Oliver Schöffski,<br />
Universität Erlangen-Nürnberg,<br />
Lehrstuhl für Gesundheitsmanagement<br />
Aufgrund der Ressourcenknappheit kann das<br />
aber nicht uneingeschränkt der Fall sein. Nehmen<br />
wir einmal an, dass an einer chronischen,<br />
progredienten Erkrankung eine Mio. Personen<br />
in Deutschland leiden. Diese Krankheit ist nicht<br />
lebensbedrohlich, führt aber zu einer massiven<br />
Einschränkung der Lebensqualität. Therapierbar<br />
ist die Krankheit bislang noch nicht. Nun<br />
erhält allerdings eine bahnbrechende Arzneimittelinnovation<br />
die Zulassung. Bei einem<br />
großen Teil der Patienten kommt es durch die<br />
Behandlung zu einer Verbesserung der Situation,<br />
bei einem Teil kann das Voranschreiten der<br />
Erkrankung zumindest gestoppt werden, nur<br />
bei einem kleineren Teil zeigt sich keine Wirkung.<br />
Die Nebenwirkungen sind medizinisch<br />
und kostenmäßig im Vergleich zu diesen positiven<br />
Aspekten vernachlässigbar. Aus medizinischer<br />
Sicht ist damit alles klar. Allerdings<br />
tauchen zwei Probleme auf: Erstens, die Therapie<br />
muss lebenslang fortgesetzt werden, ansonsten<br />
schreitet die Krankheit weiter voran; zweitens,<br />
die jährlichen Therapiekosten betragen<br />
10.000 € pro Jahr.<br />
Und jetzt eine „Milchmädchenrechnung“: Eine<br />
Mio. Betroffene mit jährlich 10.000 € zusätzlichen<br />
Behandlungskosten macht 10 Mrd.<br />
€ zusätzliche Kosten, die die Kostenträger, d.h.<br />
insbesondere die gesetzlichen Krankenkassen<br />
zu tragen haben. Die Krankenkassen geben aktuell<br />
ca. 140 Mrd. € pro Jahr aus, zehn zusätzliche<br />
Mrd. € bedeuten einen Ausgabenanstieg<br />
um ca. 7 %. Was bedeutet das für den Beitragssatz<br />
der Krankenkassen? Wenn dieser durchschnittlich<br />
derzeit 14 % beträgt, bedeutet ein<br />
Ausgabenwachstum von 7 % bei gleichen Einnahmen<br />
einen Anstieg des Beitragssatzes um<br />
einen Prozentpunkt auf 15 %. Dieser ist zurückzuführen<br />
auf nur eine Innovation bei einer Indikation.<br />
Rationierung – wichtiges Thema<br />
Sind die Zahlen der Milchmädchenrechnung<br />
unrealistisch gewählt? Nein, es gibt eine Reihe<br />
von Erkrankungen, die mehr als eine Mio. Patienten<br />
in Deutschland betreffen. Viele innovative<br />
Therapien weisen Jahrestherapiekosten<br />
höher als 10.000 € auf. Unrealistisch ist sicherlich,<br />
dass jeder Patient in der Indikation lebenslang<br />
behandelt wird. Hier hat sicherlich eine<br />
Überschätzung stattgefunden. Aber diese eine<br />
dargestellt (fiktive) Arzneimittelinnovation ist<br />
nur eine unter vielen, die aktuell auf den Markt<br />
drängen, hinzu kommen Innovationen im medizin-technischen<br />
Bereich. Das von der Politik<br />
immer noch offensiv vertretene Motto „Jeder<br />
bekommt alles was für ihn gut ist“ kann nicht<br />
mehr funktionieren. Natürlich gibt es noch Rationalisierungsreserven<br />
im deutschen Gesundheitssystem,<br />
aber nicht in der Größenordnung,<br />
die nötig wären, um die Kostensteigerungen<br />
durch Innovationen in den nächsten Jahren auffangen<br />
zu können. Rationierung wird damit ein<br />
immer wichtigeres Thema im deutschen Gesundheitswesen<br />
der nächsten Jahre werden.<br />
Ein akzeptabler Weg ist zu finden<br />
Rationierung kann auf unterschiedliche Methoden<br />
durchgeführt werden – sie kann verdeckt<br />
oder offen geschehen, neue Technologien können<br />
komplett vom Markt ferngehalten werden,<br />
durch immer weitere Erhöhungen der Zuzahlung<br />
kann die Rationierung auch über die Zahlungsfähigkeit<br />
der Patienten erfolgen, nur die<br />
am stärksten Betroffenen könnten die Innovationen<br />
erhalten oder diejenigen, die am meisten<br />
davon profitieren würden. Auch das Alter der<br />
Patienten kann als Rationierungskriterium herangezogen<br />
werden, natürlich kann auch durch<br />
Los entschieden werden. Die Gesundheitsökonomie<br />
beschäftigt sich unter anderem mit der<br />
Frage, wie solche (zwingend notwendigen) Rationierungsentscheidungen<br />
rational und nachvollziehbar<br />
getroffen werden können.<br />
In den letzten Jahren ist diesbezüglich eine Reihe<br />
von Methoden und Ansätzen entwickelt<br />
worden und in jüngster Zeit beschäftigt sich<br />
auch das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit<br />
im Gesundheitswesen (IQWiG) mit der<br />
Frage, wie solche Kosten-Nutzen-Abschätzungen<br />
valide und gesellschaftlich akzeptiert durchgeführt<br />
werden können, damit eine effiziente<br />
Steuerung des Gesundheitswesens möglich<br />
wird. Es ist aber nicht zu beschönigen: Es geht<br />
im Endeffekt um Rationierung und damit um<br />
ein unangenehmes Thema, dem man sich in<br />
Zukunft aber verstärkt stellen muss.<br />
2 Kontakt:<br />
Prof. Dr. Oliver Schöffski<br />
Universität Erlangen-Nürnberg<br />
Lehrstuhl für Gesundheitsmanagement<br />
D-Nürnberg<br />
Tel.: 0911/5302313<br />
Fax: 0911/5302285<br />
oliver@schoeffski.de<br />
© Foto: www.pixelio.de/el Fausto