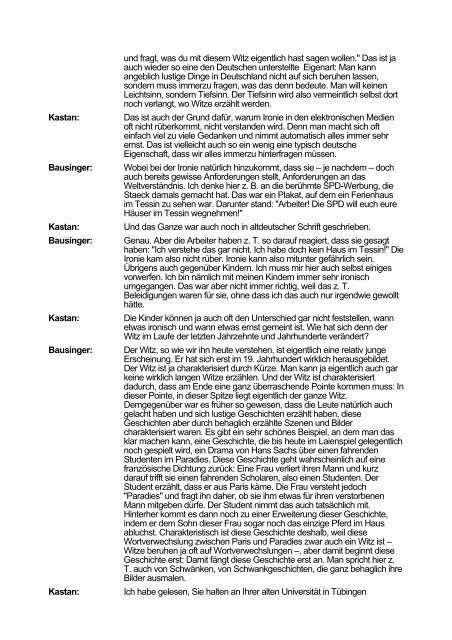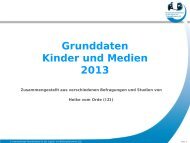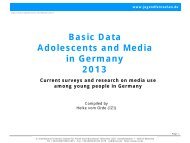Prof. Dr. Hermann Bausinger Kulturwissenschaftler im Gespräch mit ...
Prof. Dr. Hermann Bausinger Kulturwissenschaftler im Gespräch mit ...
Prof. Dr. Hermann Bausinger Kulturwissenschaftler im Gespräch mit ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
und fragt, was du <strong>mit</strong> diesem Witz eigentlich hast sagen wollen." Das ist ja<br />
auch wieder so eine den Deutschen unterstellte Eigenart: Man kann<br />
angeblich lustige Dinge in Deutschland nicht auf sich beruhen lassen,<br />
sondern muss <strong>im</strong>merzu fragen, was das denn bedeute. Man will keinen<br />
Leichtsinn, sondern Tiefsinn. Der Tiefsinn wird also vermeintlich selbst dort<br />
noch verlangt, wo Witze erzählt werden.<br />
Kastan: Das ist auch der Grund dafür, warum Ironie in den elektronischen Medien<br />
oft nicht rüberkommt, nicht verstanden wird. Denn man macht sich oft<br />
einfach viel zu viele Gedanken und n<strong>im</strong>mt automatisch alles <strong>im</strong>mer sehr<br />
ernst. Das ist vielleicht auch so ein wenig eine typisch deutsche<br />
Eigenschaft, dass wir alles <strong>im</strong>merzu hinterfragen müssen.<br />
<strong>Bausinger</strong>: Wobei bei der Ironie natürlich hinzukommt, dass sie – je nachdem – doch<br />
auch bereits gewisse Anforderungen stellt, Anforderungen an das<br />
Weltverständnis. Ich denke hier z. B. an die berühmte SPD-Werbung, die<br />
Staeck damals gemacht hat. Das war ein Plakat, auf dem ein Ferienhaus<br />
<strong>im</strong> Tessin zu sehen war. Darunter stand: "Arbeiter! Die SPD will euch eure<br />
Häuser <strong>im</strong> Tessin wegnehmen!"<br />
Kastan: Und das Ganze war auch noch in altdeutscher Schrift geschrieben.<br />
<strong>Bausinger</strong>: Genau. Aber die Arbeiter haben z. T. so darauf reagiert, dass sie gesagt<br />
haben: "Ich verstehe das gar nicht. Ich habe doch kein Haus <strong>im</strong> Tessin!" Die<br />
Ironie kam also nicht rüber. Ironie kann also <strong>mit</strong>unter gefährlich sein.<br />
Übrigens auch gegenüber Kindern. Ich muss mir hier auch selbst einiges<br />
vorwerfen. Ich bin nämlich <strong>mit</strong> meinen Kindern <strong>im</strong>mer sehr ironisch<br />
umgegangen. Das war aber nicht <strong>im</strong>mer richtig, weil das z. T.<br />
Beleidigungen waren für sie, ohne dass ich das auch nur irgendwie gewollt<br />
hätte.<br />
Kastan: Die Kinder können ja auch oft den Unterschied gar nicht feststellen, wann<br />
etwas ironisch und wann etwas ernst gemeint ist. Wie hat sich denn der<br />
Witz <strong>im</strong> Laufe der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte verändert?<br />
<strong>Bausinger</strong>: Der Witz, so wie wir ihn heute verstehen, ist eigentlich eine relativ junge<br />
Erscheinung. Er hat sich erst <strong>im</strong> 19. Jahrhundert wirklich herausgebildet.<br />
Der Witz ist ja charakterisiert durch Kürze. Man kann ja eigentlich auch gar<br />
keine wirklich langen Witze erzählen. Und der Witz ist charakterisiert<br />
dadurch, dass am Ende eine ganz überraschende Pointe kommen muss: In<br />
dieser Pointe, in dieser Spitze liegt eigentlich der ganze Witz.<br />
Demgegenüber war es früher so gewesen, dass die Leute natürlich auch<br />
gelacht haben und sich lustige Geschichten erzählt haben, diese<br />
Geschichten aber durch behaglich erzählte Szenen und Bilder<br />
charakterisiert waren. Es gibt ein sehr schönes Beispiel, an dem man das<br />
klar machen kann, eine Geschichte, die bis heute <strong>im</strong> Laienspiel gelegentlich<br />
noch gespielt wird, ein <strong>Dr</strong>ama von Hans Sachs über einen fahrenden<br />
Studenten <strong>im</strong> Paradies. Diese Geschichte geht wahrscheinlich auf eine<br />
französische Dichtung zurück: Eine Frau verliert ihren Mann und kurz<br />
darauf trifft sie einen fahrenden Scholaren, also einen Studenten. Der<br />
Student erzählt, dass er aus Paris käme. Die Frau versteht jedoch<br />
"Paradies" und fragt ihn daher, ob sie ihm etwas für ihren verstorbenen<br />
Mann <strong>mit</strong>geben dürfe. Der Student n<strong>im</strong>mt das auch tatsächlich <strong>mit</strong>.<br />
Hinterher kommt es dann noch zu einer Erweiterung dieser Geschichte,<br />
indem er dem Sohn dieser Frau sogar noch das einzige Pferd <strong>im</strong> Haus<br />
abluchst. Charakteristisch ist diese Geschichte deshalb, weil diese<br />
Wortverwechslung zwischen Paris und Paradies zwar auch ein Witz ist –<br />
Witze beruhen ja oft auf Wortverwechslungen –, aber da<strong>mit</strong> beginnt diese<br />
Geschichte erst: Da<strong>mit</strong> fängt diese Geschichte erst an. Man spricht hier z.<br />
T. auch von Schwänken, von Schwankgeschichten, die ganz behaglich ihre<br />
Bilder ausmalen.<br />
Kastan: Ich habe gelesen, Sie halten an Ihrer alten Universität in Tübingen