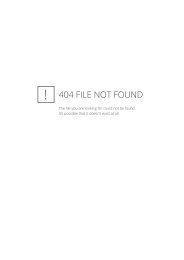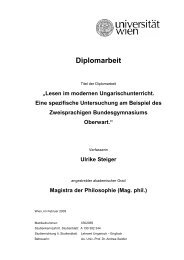Techniken der frühkindlichen Fremdsprachenvermittlung - UMIZ
Techniken der frühkindlichen Fremdsprachenvermittlung - UMIZ
Techniken der frühkindlichen Fremdsprachenvermittlung - UMIZ
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Vielau (2007: 238) spricht von einem didaktischen Modell einerseits, „das die<br />
Einflüsse und ihr Zusammenwirken verständlich macht“ und einem methodischen<br />
Kalkül an<strong>der</strong>erseits, „das aussagt, was man in einer bestimmtem Konstellation tun kann,<br />
um eine Fremdsprache mit Erfolgsaussicht (effektiv) und ohne zu großen Aufwand<br />
(optimal) zu lehren“. Beides ist erfor<strong>der</strong>lich, um „zwischen alternativen<br />
Lernanordnungen begründet auswählen zu können“ (ebd.). Genau diese Auswahl ist<br />
aber schwierig, da auf jede Unterrichtssituation eine Vielzahl von Faktoren wirkt.<br />
Es sind dies nach Neuner und Hunfeld (2000: 8-13) übergreifende<br />
gesellschaftliche Faktoren, Aspekte von allgemeiner Pädagogik und Aspekte von Schule<br />
als Institutionen <strong>der</strong> Gesellschaft, weiters Faktoren, die Deutsch als Unterrichtsfach<br />
betreffen, sowie solche, die sich unmittelbar aus <strong>der</strong> Konstellation in einer Lehrgruppe /<br />
Schulklasse ergeben. All diese Faktoren beeinflussen die Lehrmethoden und sind<br />
jeweils „systemartig mit den an<strong>der</strong>en verbunden“ (Vielau 2007: 238). Am Beginn einer<br />
wissenschaftlichen Arbeit, die sich mit Methodik befasst, muss in diesem<br />
Zusammenhang auf ein Grundproblem <strong>der</strong> Methodik hingewiesen werden: Das<br />
Zusammenspiel <strong>der</strong> Faktoren und <strong>der</strong> „Kausalzusammenhang von Prozess und<br />
Ergebnis, Ursache und Wirkung“ (ebd.: 239) sind unklar und in ihrer Komplexität noch<br />
nicht ausreichend erforscht bzw. dort gar nicht erforschbar, wo wir es mit den<br />
individuellen Lernvoraussetzungen je<strong>der</strong>/s einzelnen Lernenden zu tun haben.<br />
Während über die Unterscheidung zwischen Methodik und Didaktik noch relative<br />
Einigkeit herrscht – auch wenn Ortner (1998: 17) eine klare Trennung zwischen den<br />
Begriffsumfängen als nicht haltbar erachtet –, tut sich die Fachliteratur mit einer<br />
einheitlichen Definition von „Methoden“ schwerer.<br />
Generell werden Methoden als „Lehrverfahrensinstrumente gedeutet. Sie sind aus<br />
<strong>der</strong> Perspektive <strong>der</strong> Lehrenden und als Anwendungsrichtlinien für diese“<br />
(Ortner 1998: 20) verfasst. Einen Überblick über verschiedene allgemeine, spezifische<br />
und alternative Methodenbegriffe sowie über die diesbezügliche Fachdiskussion und<br />
historische Verän<strong>der</strong>ungen geben Ortner (1998: 17ff) und Neuner (2007).<br />
Neuner und Hunfeld (2000: 14ff) halten fest, dass für die eindeutige Festlegung<br />
des Methodenbegriffs in einem Land o<strong>der</strong> einem kulturellen Kontext ein „Konsens<br />
14