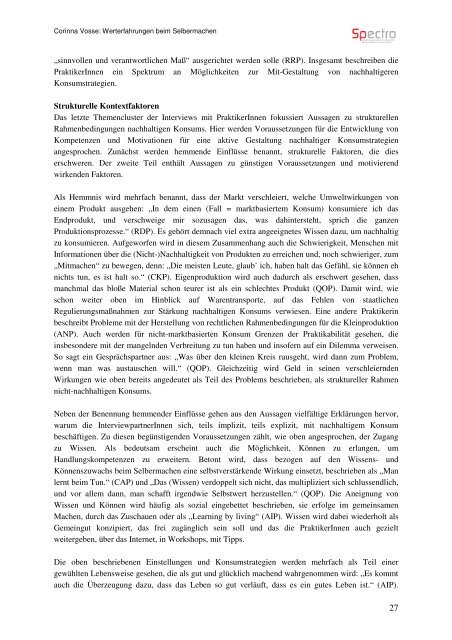Werterfahrungen beim Selbermachen. - Stiftungsgemeinschaft ...
Werterfahrungen beim Selbermachen. - Stiftungsgemeinschaft ...
Werterfahrungen beim Selbermachen. - Stiftungsgemeinschaft ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Corinna Vosse: <strong>Werterfahrungen</strong> <strong>beim</strong> <strong>Selbermachen</strong><br />
„sinnvollen und verantwortlichen Maß“ ausgerichtet werden solle (RRP). Insgesamt beschreiben die<br />
PraktikerInnen ein Spektrum an Möglichkeiten zur Mit-Gestaltung von nachhaltigeren<br />
Konsumstrategien.<br />
Strukturelle Kontextfaktoren<br />
Das letzte Themencluster der Interviews mit PraktikerInnen fokussiert Aussagen zu strukturellen<br />
Rahmenbedingungen nachhaltigen Konsums. Hier werden Voraussetzungen für die Entwicklung von<br />
Kompetenzen und Motivationen für eine aktive Gestaltung nachhaltiger Konsumstrategien<br />
angesprochen. Zunächst werden hemmende Einflüsse benannt, strukturelle Faktoren, die dies<br />
erschweren. Der zweite Teil enthält Aussagen zu günstigen Voraussetzungen und motivierend<br />
wirkenden Faktoren.<br />
Als Hemmnis wird mehrfach benannt, dass der Markt verschleiert, welche Umweltwirkungen von<br />
einem Produkt ausgehen: „In dem einen (Fall = marktbasiertem Konsum) konsumiere ich das<br />
Endprodukt, und verschweige mir sozusagen das, was dahintersteht, sprich die ganzen<br />
Produktionsprozesse.“ (RDP). Es gehört demnach viel extra angeeignetes Wissen dazu, um nachhaltig<br />
zu konsumieren. Aufgeworfen wird in diesem Zusammenhang auch die Schwierigkeit, Menschen mit<br />
Informationen über die (Nicht-)Nachhaltigkeit von Produkten zu erreichen und, noch schwieriger, zum<br />
„Mitmachen“ zu bewegen, denn: „Die meisten Leute, glaub’ ich, haben halt das Gefühl, sie können eh<br />
nichts tun, es ist halt so.“ (CKP). Eigenproduktion wird auch dadurch als erschwert gesehen, dass<br />
manchmal das bloße Material schon teurer ist als ein schlechtes Produkt (QOP). Damit wird, wie<br />
schon weiter oben im Hinblick auf Warentransporte, auf das Fehlen von staatlichen<br />
Regulierungsmaßnahmen zur Stärkung nachhaltigen Konsums verwiesen. Eine andere Praktikerin<br />
beschreibt Probleme mit der Herstellung von rechtlichen Rahmenbedingungen für die Kleinproduktion<br />
(ANP). Auch werden für nicht-marktbasierten Konsum Grenzen der Praktikabilität gesehen, die<br />
insbesondere mit der mangelnden Verbreitung zu tun haben und insofern auf ein Dilemma verweisen.<br />
So sagt ein Gesprächspartner aus: „Was über den kleinen Kreis rausgeht, wird dann zum Problem,<br />
wenn man was austauschen will.“ (QOP). Gleichzeitig wird Geld in seinen verschleiernden<br />
Wirkungen wie oben bereits angedeutet als Teil des Problems beschrieben, als struktureller Rahmen<br />
nicht-nachhaltigen Konsums.<br />
Neben der Benennung hemmender Einflüsse gehen aus den Aussagen vielfältige Erklärungen hervor,<br />
warum die InterviewpartnerInnen sich, teils implizit, teils explizit, mit nachhaltigem Konsum<br />
beschäftigen. Zu diesen begünstigenden Voraussetzungen zählt, wie oben angesprochen, der Zugang<br />
zu Wissen. Als bedeutsam erscheint auch die Möglichkeit, Können zu erlangen, um<br />
Handlungskompetenzen zu erweitern. Betont wird, dass bezogen auf den Wissens- und<br />
Könnenszuwachs <strong>beim</strong> <strong>Selbermachen</strong> eine selbstverstärkende Wirkung einsetzt, beschrieben als „Man<br />
lernt <strong>beim</strong> Tun.“ (CAP) und „Das (Wissen) verdoppelt sich nicht, das multipliziert sich schlussendlich,<br />
und vor allem dann, man schafft irgendwie Selbstwert herzustellen.“ (QOP). Die Aneignung von<br />
Wissen und Können wird häufig als sozial eingebettet beschrieben, sie erfolge im gemeinsamen<br />
Machen, durch das Zuschauen oder als „Learning by living“ (AIP). Wissen wird dabei wiederholt als<br />
Gemeingut konzipiert, das frei zugänglich sein soll und das die PraktikerInnen auch gezielt<br />
weitergeben, über das Internet, in Workshops, mit Tipps.<br />
Die oben beschriebenen Einstellungen und Konsumstrategien werden mehrfach als Teil einer<br />
gewählten Lebensweise gesehen, die als gut und glücklich machend wahrgenommen wird: „Es kommt<br />
auch die Überzeugung dazu, dass das Leben so gut verläuft, dass es ein gutes Leben ist.“ (AIP).<br />
27