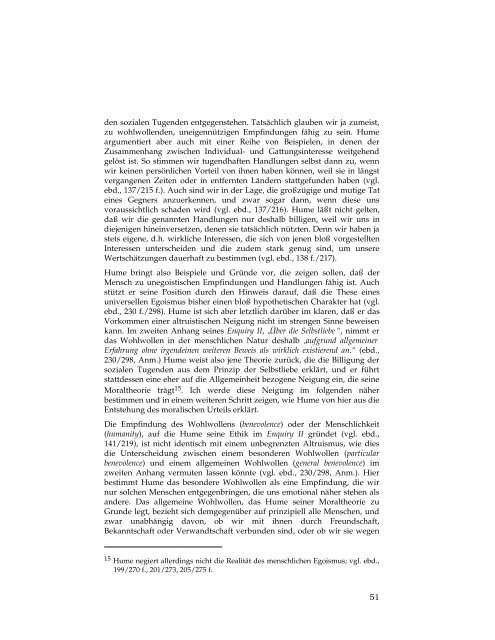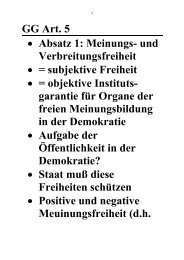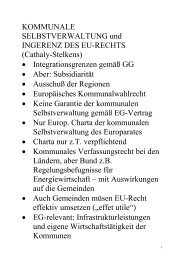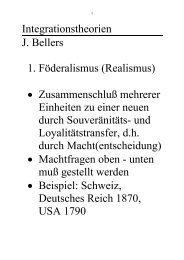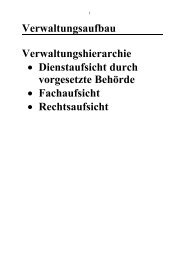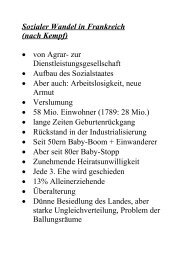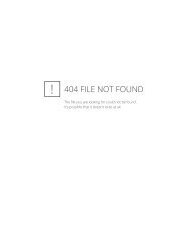Einführung in die Sozialwissenschaften - Jürgen Bellers
Einführung in die Sozialwissenschaften - Jürgen Bellers
Einführung in die Sozialwissenschaften - Jürgen Bellers
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
den sozialen Tugenden entgegenstehen. Tatsächlich glauben wir ja zumeist,<br />
zu wohlwollenden, uneigennützigen Empf<strong>in</strong>dungen fähig zu se<strong>in</strong>. Hume<br />
argumentiert aber auch mit e<strong>in</strong>er Reihe von Beispielen, <strong>in</strong> denen der<br />
Zusammenhang zwischen Individual- und Gattungs<strong>in</strong>teresse weitgehend<br />
gelöst ist. So stimmen wir tugendhaften Handlungen selbst dann zu, wenn<br />
wir ke<strong>in</strong>en persönlichen Vorteil von ihnen haben können, weil sie <strong>in</strong> längst<br />
vergangenen Zeiten oder <strong>in</strong> entfernten Ländern stattgefunden haben (vgl.<br />
ebd., 137/215 f.). Auch s<strong>in</strong>d wir <strong>in</strong> der Lage, <strong>die</strong> großzügige und mutige Tat<br />
e<strong>in</strong>es Gegners anzuerkennen, und zwar sogar dann, wenn <strong>die</strong>se uns<br />
voraussichtlich schaden wird (vgl. ebd., 137/216). Hume läßt nicht gelten,<br />
daß wir <strong>die</strong> genannten Handlungen nur deshalb billigen, weil wir uns <strong>in</strong><br />
<strong>die</strong>jenigen h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>versetzen, denen sie tatsächlich nützten. Denn wir haben ja<br />
stets eigene, d.h. wirkliche Interessen, <strong>die</strong> sich von jenen bloß vorgestellten<br />
Interessen unterscheiden und <strong>die</strong> zudem stark genug s<strong>in</strong>d, um unsere<br />
Wertschätzungen dauerhaft zu bestimmen (vgl. ebd., 138 f./217).<br />
Hume br<strong>in</strong>gt also Beispiele und Gründe vor, <strong>die</strong> zeigen sollen, daß der<br />
Mensch zu unegoistischen Empf<strong>in</strong>dungen und Handlungen fähig ist. Auch<br />
stützt er se<strong>in</strong>e Position durch den H<strong>in</strong>weis darauf, daß <strong>die</strong> These e<strong>in</strong>es<br />
universellen Egoismus bisher e<strong>in</strong>en bloß hypothetischen Charakter hat (vgl.<br />
ebd., 230 f./298). Hume ist sich aber letztlich darüber im klaren, daß er das<br />
Vorkommen e<strong>in</strong>er altruistischen Neigung nicht im strengen S<strong>in</strong>ne beweisen<br />
kann. Im zweiten Anhang se<strong>in</strong>es Enquiry II, „Über <strong>die</strong> Selbstliebe “ , nimmt er<br />
das Wohlwollen <strong>in</strong> der menschlichen Natur deshalb „aufgrund allgeme<strong>in</strong>er<br />
Erfahrung ohne irgende<strong>in</strong>en weiteren Beweis als wirklich existierend an.“ (ebd.,<br />
230/298, Anm.) Hume weist also jene Theorie zurück, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Billigung der<br />
sozialen Tugenden aus dem Pr<strong>in</strong>zip der Selbstliebe erklärt, und er führt<br />
stattdessen e<strong>in</strong>e eher auf <strong>die</strong> Allgeme<strong>in</strong>heit bezogene Neigung e<strong>in</strong>, <strong>die</strong> se<strong>in</strong>e<br />
Moraltheorie trägt 15 . Ich werde <strong>die</strong>se Neigung im folgenden näher<br />
bestimmen und <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em weiteren Schritt zeigen, wie Hume von hier aus <strong>die</strong><br />
Entstehung des moralischen Urteils erklärt.<br />
Die Empf<strong>in</strong>dung des Wohlwollens (benevolence) oder der Menschlichkeit<br />
(humanity), auf <strong>die</strong> Hume se<strong>in</strong>e Ethik im Enquiry II gründet (vgl. ebd.,<br />
141/219), ist nicht identisch mit e<strong>in</strong>em unbegrenzten Altruismus, wie <strong>die</strong>s<br />
<strong>die</strong> Unterscheidung zwischen e<strong>in</strong>em besonderen Wohlwollen (particular<br />
benevolence) und e<strong>in</strong>em allgeme<strong>in</strong>en Wohlwollen (general benevolence) im<br />
zweiten Anhang vermuten lassen könnte (vgl. ebd., 230/298, Anm.). Hier<br />
bestimmt Hume das besondere Wohlwollen als e<strong>in</strong>e Empf<strong>in</strong>dung, <strong>die</strong> wir<br />
nur solchen Menschen entgegenbr<strong>in</strong>gen, <strong>die</strong> uns emotional näher stehen als<br />
andere. Das allgeme<strong>in</strong>e Wohlwollen, das Hume se<strong>in</strong>er Moraltheorie zu<br />
Grunde legt, bezieht sich demgegenüber auf pr<strong>in</strong>zipiell alle Menschen, und<br />
zwar unabhängig davon, ob wir mit ihnen durch Freundschaft,<br />
Bekanntschaft oder Verwandtschaft verbunden s<strong>in</strong>d, oder ob wir sie wegen<br />
15 Hume negiert allerd<strong>in</strong>gs nicht <strong>die</strong> Realität des menschlichen Egoismus; vgl. ebd.,<br />
199/270 f., 201/273, 205/275 f.<br />
51