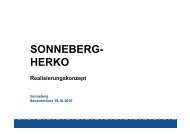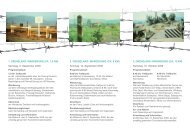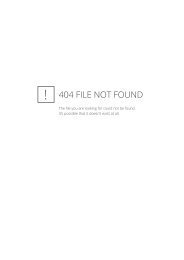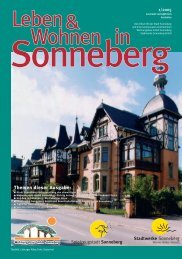Themen dieser Ausgabe: - Sonneberg
Themen dieser Ausgabe: - Sonneberg
Themen dieser Ausgabe: - Sonneberg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Männergesangverein 1865 Hönbach<br />
Im Jahre 1865 wandten sich mehrer junge Männer<br />
des Ortes an den damals amtierenden Lehrer<br />
Oscar Pommer, einem Amtsvorgänger von<br />
Ludwig Spieß, der erstmals über die Geschichte<br />
des Gesangvereines im Jahre 1927 schrieb, mit<br />
der Bitte, mit ihnen einen Gesangsverein zu<br />
gründen. Es wurde sofort zur Gründung geschritten<br />
und ein Satzungsentwurf erarbeitet. In<br />
der heute noch original vorhandenen Satzung<br />
heißt es im § 1: „Es sind im Maerz des Jahres<br />
mehrere junge Männer und Burschen hiesigen<br />
Ortes zusammen getreten, welche sich zur Aufgabe<br />
gemacht haben, die Kunst des Gesanges<br />
in edelster Bedeutung des Wortes zu pflegen.“<br />
Aus dem Inhalt der damals ausliegenden Singbücher<br />
ging hervor, dass jener Gesangverein,<br />
der sich stolz Sängerbund nannte, verschiedene<br />
bekannte Volkslieder und andere Lieder eingeübt<br />
hatte. So z. B. „Heiter mein liebes Kind“<br />
von Zöllner, „Lützows wilde verwegene Jagd“<br />
von Karl Maria v. Weber, „Der Jäger Abschied“<br />
von Mendelson-Bartholdy oder das schwäbische<br />
Volkslied „Die drei Röslein“. Als Ludwig<br />
Spieß als junger Lehrer im Jahre 1876 aus dem<br />
Seminar nach Hönbach kam, wurde er von den<br />
mehreren Mitgliedern gebeten, die Leitung zu<br />
übernehmen.<br />
Ludwig Spieß über seine Anfänge: „Ich ließ mir<br />
von den Sängern aus den alten Heften einige<br />
Lieder vortragen und fand, dass diese, obwohl<br />
auf Dynamik, Aussprache etc. noch nicht so großer<br />
Wert gelegt wurde, wie dies gegenwärtig<br />
der Fall ist, doch sonst gut und klangrein gesungen<br />
wurden. Ich erklärte, es versuchen zu<br />
wollen. Es wurden neue Hefte angelegt, und die<br />
Proben wurden im Lehrsaal des damaligen<br />
Schulhauses, jetzigem Schulhaus des Herrn<br />
Louis Schillig (heute Bernd Stammberger) abgehalten.<br />
Zu den alten Mitgliedern, soweit sie<br />
noch Lust zum Singen hatten, kamen mit der<br />
Zeit noch mehrere neue Sänger hinzu. Nachdem<br />
die Proben einige Jahre mit Erfolg in dem<br />
genannten Lokal stattgefunden hatten, gaben<br />
mehrer Mitglieder der Ansicht Ausdruck, dass<br />
die gesanglichen Leistungen dadurch wesentlich<br />
gefördert werden könnten, dass den Sängern<br />
Gelegenheit geboten werde, die während<br />
des Singens trocken gewordene Kehlen von Zeit<br />
zu Zeit etwas anzufeuchten. Daher machten sie<br />
den Vorschlag, die Proben in eine Wirtschaft zu<br />
verlegen. Dem Wunsch wurde stattgegeben.<br />
Gewählt wurde das Bauersche Wirtshaus.“<br />
(später Friedelsches Wirtshaus, heute Privathaus<br />
Roschlau)<br />
Über viele Jahre hinweg blieb man dem Prinzip<br />
des Anfeuchtens der Kehle während der Proben<br />
treu, änderte nur die Lokalitäten. Es folgte die<br />
Fischersche Wirtschaft (heute Rottenbach/Arlt)<br />
und wieder das Friedelsche Gasthaus in der Lindenstraße<br />
und dann das Gasthaus „Grüner<br />
Baum“(heute noch Gasthaus) in der Neustadter<br />
Straße. Heute wird das Bürgerhaus in Hönbach<br />
für die Proben genutzt.<br />
Um 1885 entwickelte sich aus dem Gesangverein<br />
heraus auch ein Rauchklub, den sie nach<br />
dem Vorbild des Preußenkönig Friedrich Wilhelm<br />
I. den Namen „Tabakskollegium“ verliehen.<br />
Ein eifriges Mitglied des Rauchklubs war<br />
Bahnmeister Kiesewetter, der von sich behauptete,<br />
nur beim Essen und Schlafen nicht zu rauchen.<br />
Dieser Kiesewetter regte an, da er selbst<br />
ein guter Klarinettenspieler war, eine kleine Musikkapelle<br />
innerhalb des Gesangvereins zu<br />
gründen. Herr Kiesewetter übernahm das Klarinettenspiel,<br />
August Goegel, Trompete, Ludwig<br />
Spieß die 1. Geige. Ein zweiter Geiger war nicht<br />
vorhanden, und so fand sich aus den Reihen der<br />
Sänger Ehrenfried Suffa, dem ein paar Griffe<br />
beigebracht wurden. Anton Friedel (Ehrenfried)<br />
wurde als Cellist ausgebildet, Eduart Goegel bediente<br />
eine Posaune und Philipp Rebhan ein<br />
Horn. Ludwig Spieß schrieb darüber: „Nachdem<br />
mehrere Proben stattgefunden hatten, konnten<br />
wir uns auch von der Öffentlichkeit hören lassen,<br />
und wer recht bescheidene Ansprüche an<br />
die Leistungsfähigkeit einer kleinen Dorfkapelle<br />
stellte, kam einigermaßen auf seine Rechnung,<br />
hatten wir es doch dahin gebracht, dass wir die<br />
Musik zu unseren Bällen selbst ausführen<br />
konnten. Sonst haben wir anderen Musikchören<br />
keine Konkurrenz gemacht.“ Die Kapelle<br />
und auch der Rauchklub existierten nur wenige<br />
Jahre, da auch der Initiator Kiesewetter versetzt<br />
wurde und Hönbach verließ.<br />
Auch im Gesangvereinsleben scheint damals eine<br />
kleine Unterbrechung stattgefunden zu haben.<br />
Leider sind durch Abbruch des Friedelschen<br />
Hauses einigen Unterlagen darüber verloren<br />
gegangen. Sängerfeste, Frühjahrsausflüge<br />
(1900 sogar nach Meiningen) und Grabgesänge<br />
bei Sterbefällen im Ort bestimmten die<br />
Öffentlichkeitsarbeit des Gesangvereins. Preiswettgesänge<br />
waren damals noch selten. 1897<br />
wurde das erste „Pianino“ gekauft. Der Ankauf<br />
wurde durch <strong>Ausgabe</strong> von Anteilscheinen ermöglicht.<br />
Am 19. Juni 1898 feierte der Verein seine<br />
Fahnenweihe. Die Fahne mit den damaligen<br />
Landesfarben Grün/Weiß wurde in der Fabrik<br />
von Arnold in Coburg hergestellt und trägt als<br />
Inschrift den bekannten Sängergruß : „Grüß<br />
Gott mit hellem Klang, Heil deutschem Wort<br />
und Sang“. Damals kostete diese Fahne 380<br />
Mark. Heute würde sie ca. 10.000 € kosten.<br />
Die Fahne hängt heute im Bürgerhaus Hönbach<br />
und wird bei besonderen Anlässen getragen.<br />
Am 30. Juli 1901 wurde das 25jährige Jubiläum<br />
-13-<br />
<strong>Sonneberg</strong>er Vereine<br />
stellen sich vor:<br />
gefeiert (man nahm damals das Jahr 1876 als<br />
Gründungsjahr an). Das Fest wurde von 21 Vereinen<br />
mit 394 Mitgliedern besucht. Eine rege<br />
Vereinstätigkeit entwickelte sich, bis der<br />
1. Weltkrieg ausbrach. Notgedrungen musste<br />
der Gesangverein seine Tätigkeit einstellen.<br />
Ludwig Spieß: „Wie die meisten Vereine, so<br />
musste auch der Gesangverein seine Tätigkeit<br />
einstellen, da einmal die Sangeslust auf den<br />
Nullpunkt gesunken war und sodann so viele<br />
Mitglieder zur Fahne eilen mussten, dass ein regelrechter<br />
Gesangunterricht gar nicht mehr<br />
möglich war.“ Erst 1919 setzten sich die Mitglieder<br />
wieder zusammen, und zu den alten Mitgliedern<br />
traten auch neue jüngere Kräfte dazu.<br />
Die gesangliche Leitung übergab Ludwig Spieß<br />
seinem Kollegen Barnicol, der leider nach bereits<br />
zwei Jahren aus unbekannten Gründen<br />
sein Amt wieder niederlegte. Man trat wieder an<br />
Ludwig Spieß heran, der so den Verein mit kleinen<br />
Unterbrechungen 50 Jahre musikalisch leitete.<br />
Heute erinnert eine Straße in Hönbach mit<br />
seinem Namen an sein unermüdliches Schaffen.<br />
Nach Ludwig Spieß übernahm im Jahre<br />
1926 Albin Knoch die musikalische Leitung, ein<br />
musikalisch begabter junger Mann, der die Sänger<br />
bis 1966 ausbildete. 1926 bestand der Verein<br />
aus 44 aktiven und passiven Mitgliedern.<br />
Die weitere Entwicklung des Gesangvereines<br />
soll durch folgende Eckdaten charakterisiert<br />
werden:<br />
1934 – Die Liederbücher sollen abgegeben werden,<br />
in denen von den Nazis verbotene Komponisten<br />
stehen. Chorleiter Albin Knoch versteckt<br />
diese Bücher während der gesamten Nazizeit<br />
und bringt sie erst nach 1945 wieder hervor.<br />
1947 – Wiederaufnahme des Chorlebens. Der<br />
Chor zählt 1948 insgesamt 65 Mitglieder.<br />
1965 – Einhundertjahrfeier des Chores in Hönbach.<br />
Umzug im Ort. Freundschaftssingen mit<br />
dem Judenbacher Volkschor<br />
1966 – Burkhardt Linß, Musiklehrer an der Musikschule<br />
<strong>Sonneberg</strong>, übernimmt die musikalische<br />
Leitung des Chores bis 1996.<br />
1981 – Der Chor organisiert das erste bis heute<br />
bekannte und beliebte „Hönbacher Teichfest“.<br />
1996 – Roland Heublein übernimmt die musikalische<br />
Leitung des Chores und stellt im Jahr<br />
2000 eine freundschaftliche Verbindung mit<br />
dem Chor in Rohrbach bei Coburg her; Verleihung<br />
der Zelter Medaille<br />
2004 – Der langjährige Vorsitzende des Vereins,<br />
Horst Stegner, verstirbt. Detlef Migge wird<br />
neuer Vorsitzender.<br />
2005 – 140-Jahr-Feier. Es werden langjährige<br />
Chormitglieder ausgezeichnet:<br />
Siegfried Motschmann 40 Jahre Chormitglied<br />
Norbert Reumann 30 Jahre Chormitglied<br />
Roland Heublein 25 Jahre Dirigententätigkeit<br />
Für 50jährige musikalische Tätigkeit wird durch<br />
das Mitglied des Landtages Christine Zitzmann<br />
(heutige Landrätin) Siegfried Motschmann ausgezeichnet.<br />
2006 – Besuch des Landtages in Erfurt auf Einladung<br />
MdL Christine Zitzmann<br />
Interessenten sind zu den Chorproben,<br />
die jeden Freitag im Gemeindehaus in<br />
Hönbach stattfinden, recht herzlich eingeladen.<br />
Text und Fotos von Siegfried Motschmann und<br />
Günter Sommer.