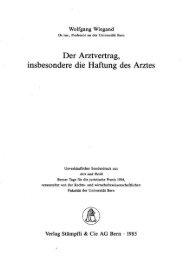149-158 (2718 KB)
149-158 (2718 KB)
149-158 (2718 KB)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
138 Rechtsprechung recht 1990 Heft 4<br />
sehen. Sie lassen sich in der schweizerischen<br />
Rechtsprechung durch zahlreiche Beispiele<br />
belegen, von denen die Annahme der Pistensicherungspflicht<br />
des Skiliftunternehmens als<br />
vertragliche Nebenpflicht aus Beförderungsvertrag<br />
nur das signifikanteste darstellt 15 .<br />
c) Als Ergebnis ist festzuhalten: Die Nebenpflichten<br />
sind entstanden im Zuge der Verfeinerung<br />
der Schuldrechtsdogmatik, die das<br />
Schuldverhältnis als einen sich entwickelnden<br />
Organismus begreift. Im Rahmen dieses Organismus<br />
werden die Nebenpflichten zur Risikoverteilung<br />
und zur Kompensation von Ungleichgewichtslagen<br />
eingesetzt. Das entsprechende<br />
dogmatische Instrumentarium, mit<br />
dem diese Ziele verwirklichtwerden, bilden die<br />
culpa in contrahendo und die positive Vertragsverletzung.<br />
Diese Funktion der Nebenpflichten<br />
wird schliesslich ganz besonders<br />
deutlich durch die Formulierungen, mit denen<br />
deren Begründung in der Literatur beschrieben<br />
wird. Sie sind, so Kramet 6 , «aus ausdrücklicher<br />
Vereinbarung, aus Vertragsergänzung<br />
oder einfach objektiv aus Artikel 2ZGB abzuleiten».<br />
Gerade diese Wendung führt zurück zu<br />
dem hierzu besprechenden Entscheid.<br />
4. Die Haftungserweiterung bei Dienstleistungen<br />
Das Bundesgericht hat in BGE 77511 62ff., wie<br />
oben bereits dargelegt 17 , die Sorgfalts- und<br />
Treuepflicht des Beauftragten konkretisiert. Es<br />
hat damit nichts anderes getan als das, was in<br />
der eben zitierten Formel von Kramer umschrieben<br />
wird. Der einzige Unterschied besteht<br />
darin, dass auf den Rückgriff auf Art.2<br />
ZGB weitgehend verzichtet werden konnte,<br />
weil im Bereich des Auftragsrechts die Nebenpflichten<br />
gewissermassen institutionalisiert<br />
sind, verpflichtet doch der Gesetzgeber den<br />
Beauftragten in Art.398 OR generell zur Sorgfalt<br />
und Treue. Im übrigen gilt all das, was für<br />
die Nebenpflichten allgemein gesagt wurde,<br />
für diejenigen des Beauftragten in gleicher<br />
Weise Dies lässtsich sowohl aus der Methode<br />
des Vorgehens des Bundesgerichtes als aus<br />
den von ihm gewonnenen Ergebnissen belegen.<br />
a) Das Bundesgericht geht von der zutreffenden<br />
These aus, dass der Beauftragte nicht für<br />
,5 Dazu Weberin 14) und Wiegand/Koller-Tumler (Fn 6)<br />
16 Kramer. a a.O. N.97<br />
" Siehe oben S 136<br />
den Erfolg seiner Tätigkeit einzustehen habe.<br />
Es fügt aber sofort an, dass eine unsorgfältige<br />
oder treuwidrige Erfüllung, die den Auftraggeber<br />
schädigt, den Beauftragten zum Schadenersatz<br />
verpflichtet.<br />
Im Hinblick darauf werden nun die Massstäbe<br />
der Sorgfalt in Stufen festgelegt. Beginnend<br />
mit der nach objektiven Kriterien zu bestimmenden<br />
Sorgfalt eines gewissenhaften<br />
Beauftragten, gesteigert durch höhere Anforderungen<br />
an einen entgeltlich und berufsmässig<br />
Handelnden, wird der Sorgfaltsmassstab<br />
im Hinblick auf die besonderen Umstände des<br />
Einzelfalls sowie die Art des Auftrags verfeinert<br />
und schliesslich durch berufstypische Verhaltensregeln<br />
und Usancen ergänzt.<br />
Es liegt auf der Hand, dass mit diesen Kriterien<br />
das Mass der Sorgfalt, das vom Beauftragten<br />
verlangt wird, praktisch beliebig ausgedehnt<br />
werden kann. Die vom Bundesgericht<br />
verwendeten und auch in der Literatur 18 herangezogenen<br />
Kriterien lassen breiten Ermessensspielraum<br />
offen, und eine Verschärfung<br />
der Massstäbe wird nur in seltensten Fällen als<br />
willkürlich bezeichnet werden können. Dies<br />
bedeutet aber, dass durch eine Haftungsverschärfung<br />
das Risiko der Durchführung des<br />
Auftrags weitgehend vom Auftraggeber auf<br />
den Beauftragten verlagert werden kann, ohne<br />
dass man dessen unmittelbare Erfolgshaftung<br />
begründen müsste 19 .<br />
b) Noch deutlicher lassen sich diese Phänomene<br />
bei der vom Bundesgericht vorgenommenen<br />
Umschreibung der Treuepflicht beobachten.<br />
Ausgehend von der sehr vagen Interessenwahrnehmungspflicht<br />
wird daraus eine<br />
Beratungs- und Informationspflicht abgeleitet.<br />
Die Beratung hat regelmässig zu erfolgen und<br />
umfasst die Verpflichtung von «Anweisungen,<br />
welche den Interessen des Auftraggebers zuwiderlaufen<br />
... abzuraten». Noch umfassender<br />
wird die Informationspflicht umschrieben, deren<br />
«Gegenstand ... bildet alles, was für den<br />
Auftraggeber von Bedeutung ist». Darüber hinaus<br />
soll der Beauftragte auch unaufgefordert<br />
über Zweckmässigkeit, Weisungen, Kosten<br />
sowie Erfolgschancen Auskunft geben 20 .<br />
18<br />
Neben den in Entscheid Zitierten vgl die umfassende<br />
Darstellung bei Derend/nger Die Nicht- und die nichtrichtige<br />
Erfüllung des einfachen Auftrages. 2 nachgef Aufl Fribourg<br />
1990. N 77ff., insbes 126ff, sowie generell Weber Sorgfaltswidrigkeit<br />
- quo vadis?. ZSR 19881 39ff<br />
19<br />
Zur eventuellen Entlastung durch den Exkulpationsbeweis<br />
siehe unten S.141<br />
20<br />
Siehe oben Erw 3a; in der Literatur und der deutschen<br />
Judikatur wird die noch weitergehende Auffassung vertreten.