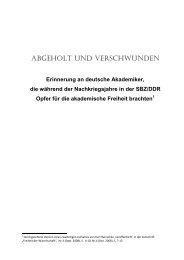freiheit der - Bund Freiheit der Wissenschaft eV
freiheit der - Bund Freiheit der Wissenschaft eV
freiheit der - Bund Freiheit der Wissenschaft eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
dete Reformuniversität Konstanz berufen<br />
worden war.<br />
Was in seinem Aufsatz von 1960 angelegt<br />
war, trug er in seiner Antrittsvorlesung<br />
vom 24. Januar 1968 als programmatische<br />
Streitschrift in die Öffentlichkeit.<br />
2 Er führte darin den in <strong>der</strong> Öffentlichkeit<br />
weitgehend akzeptierten, wenn<br />
nicht gutgeheißenen Nie<strong>der</strong>gang des humanistischen<br />
Gymnasiums auf den Zerfall<br />
seines geistigen und personellen<br />
Fundamentes <strong>der</strong> Altertumswissenschaften<br />
zurück: Der Neuhumanismus<br />
hatte während <strong>der</strong> preußischen Befreiungskriege<br />
die griechisch begründete<br />
Antike systematisch zu erforschen begonnen,<br />
um das idealisierte griechische<br />
Vorbild des deutschen Bildungsbürgertums<br />
wissenschaftlich zu legitimieren.<br />
Damit avancierte gleichzeitig <strong>der</strong> Philologe<br />
vom theologischen Hilfsberuf zum<br />
beamteten Repräsentanten des Gymnasiums<br />
und – da dieses als einzige höhere<br />
Schule zum Abitur führte – zum Lehrmeister<br />
<strong>der</strong> akademischen Elite. Die Altertumswissenschaft<br />
selbst zerstörte<br />
durch ihre Forschungen das Idealbild<br />
<strong>der</strong> Antike, so daß es zur bürgerlichen<br />
Ideologie <strong>der</strong> klassischen Philologie erstarrte.<br />
Diese konnte ihren Absolventen<br />
nicht mehr das zur Rechtfertigung des<br />
humanistischen Gymnasiums notwendige<br />
Selbstverständnis vermitteln, als es<br />
1900 <strong>der</strong> Konkurrenz mit mo<strong>der</strong>neren<br />
zur Studienberechtigung führenden Bildungsformen<br />
ausgeliefert wurde.<br />
Deshalb schlug Fuhrmann vor, das Studium<br />
<strong>der</strong> alten Sprachen nicht mehr auf<br />
das klassische Altertum in seiner Totalität<br />
und Einmaligkeit auszurichten,<br />
son<strong>der</strong>n es wie bei den mo<strong>der</strong>nen Philologien<br />
auf eine Sprache als Hauptfach<br />
zu konzentrieren und dieses durch ihre<br />
Wirkungsgeschichte bis zur Gegenwart<br />
zu ergänzen. Dies erfor<strong>der</strong>e beim Studium<br />
des Lateins eine angemessene<br />
Berücksichtigung <strong>der</strong> christlichen<br />
spätantiken, mittel-, neulateinischen Literatur<br />
und <strong>der</strong> Nachwirkung antiker<br />
Elemente in den mo<strong>der</strong>nen Sprachen<br />
und Kulturen. Eine solche Reform erlaube<br />
nicht nur eine zeitgemäße Erneuerung<br />
<strong>der</strong> klassischen Philologie, sie ermögliche<br />
auch eine bessere Ausbildung<br />
<strong>der</strong> meisten Studierenden klassischer<br />
Sprachen, die Latein mit einem an<strong>der</strong>en<br />
Fach als Griechisch kombinieren möchten.<br />
Fuhrmann war von den Ergebnissen einer<br />
1963 veröffentlichten Enquête ausgegangen,<br />
bei <strong>der</strong> 53 Repräsentanten<br />
<strong>der</strong> deutschen und österreichischen Politik,<br />
Literatur und <strong>Wissenschaft</strong> von<br />
Konrad Adenauer bis Reinhold Zsalatz<br />
ihre Meinung zur Krise des humanistischen<br />
Gymnasiums geäußert hatten. Die<br />
darauf folgende Ursachen- und Situationsanalyse<br />
fiel nicht nur aus Zeitgründen<br />
<strong>der</strong>art plakativ und provokativ aus,<br />
daß die stärker differenzierenden Fußnoten<br />
und die pragmatischen Leitsätze<br />
des Nachwortes in <strong>der</strong> gedruckten Fassung<br />
die kategorische Ablehnung <strong>der</strong> erwägenswerten<br />
Reformvorschläge durch<br />
das empörte Gros <strong>der</strong> Fachkollegen<br />
nicht verhin<strong>der</strong>n konnten. Daran än<strong>der</strong>te<br />
auch eine Aussprache in <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>versammlung<br />
1970 <strong>der</strong> Mommsen-<br />
Gesellschaft nichts. 3<br />
Reformerische Energie und<br />
freudige Arbeitskraft<br />
Fuhrmann zog daraus die Konsequenzen<br />
und richtete seine reformerische<br />
Energie direkt auf den altsprachlichen<br />
Gymnasialunterricht, demonstrierte in<br />
Fortbildungskursen, wie man die üblichen<br />
Autoren sachgerecht und doch lebendig<br />
interpretieren und durch interessante<br />
Lesestoffe aus Mittelalter und Humanismus<br />
ergänzen könne. Er wirkte<br />
bei <strong>der</strong> Ausarbeitung neuer Lehrmittel<br />
und Textsammlungen mit und verbreitete<br />
seine Vorstellungen in den entsprechenden<br />
Zeitschriften, um beispielsweise<br />
die ideologisch belastete, didaktisch<br />
fragwürdige Anfängerlektüre Cäsars<br />
durch bewährte Schulautoren des italienischen<br />
und nordeuropäischen Humanismus<br />
zu ersetzen 4 o<strong>der</strong> um die Asterix<br />
Comics als „geheimen Miterzieher“ zur<br />
Freude am Lateinunterricht einzusetzen.<br />
Im übrigen hielt er sich an die Mahnung<br />
von Voltaires Candide und pflegte mit<br />
nie nachlassen<strong>der</strong> freudiger Arbeitskraft<br />
wörtlich und in übertragenem Sinn seinen<br />
weiten Garten. Das „Auf dem<br />
Stein“ oberhalb <strong>der</strong> Stadt Überlingen<br />
abgelegene Haus bot zugleich Ruhe und<br />
einen inspirierenden Rundblick auf die<br />
Bodenseelandschaft bis zu den Alpen.<br />
Es erlaubte ihm, das Treiben auf seinem<br />
Interessengebiet mit <strong>der</strong> nötigen Distanz<br />
zu beobachten und das gebildete Publikum<br />
regelmässig auf beachtenswerte<br />
Neuerscheinungen aufmerksam zu machen.<br />
Das konnte ebenso eine zweibändige<br />
fachwissenschaftliche Neuinterpretation<br />
des König Oedipus sein 5 wie<br />
1984 Christa Wolfs Kassandra, 1986 ihr<br />
Essay über Penthesilea und 1996 ihre<br />
Umdeutung <strong>der</strong> Medea 6 wie auch Grünbeins<br />
dichterische Auseinan<strong>der</strong>setzung<br />
mit dem Rom <strong>der</strong> Kaiserzeit. 7<br />
Seine wirkungsgeschichtlichen Anliegen<br />
fanden während seiner langjährigen<br />
Mitarbeit in <strong>der</strong> Konstanzer Forschungsgruppe<br />
Poetik und Hermeneutik<br />
kollegiale Anregung und Anerkennung,<br />
bis er in den neunziger Jahren als Mitglied<br />
<strong>der</strong> Heidelberger Akademie <strong>der</strong><br />
<strong>Wissenschaft</strong>en einen breiteren kollegialen<br />
Kreis für diese Interessen fand<br />
und nach seinem bahnbrechenden Antrittsvortrag<br />
über die kulturpolitische<br />
Umdeutung des antiken Europabegriffs<br />
im Spätmittelalter und im italienischen<br />
Humanismus mit <strong>der</strong> Leitung <strong>der</strong> langfristigen<br />
Edition des Reuchlin Briefwechsels<br />
beauftragt wurde.<br />
Neben den Reden Ciceros übersetzte er<br />
1971 die Germania des Tacitus, 1977<br />
die Wolken des Aristophanes, 1982 unter<br />
dem Titel „Christen in <strong>der</strong> Wüste“<br />
Hieronymuslegenden, 1986 Platons<br />
Apologie des Sokrates und beschäftigte<br />
sich eingehend mit <strong>der</strong> Theorie <strong>der</strong><br />
Übersetzung, <strong>der</strong>en krönendes Ergebnis<br />
1986 die Edition von Wielands Übersetzung<br />
des Horaz in <strong>der</strong> Bibliothek deutscher<br />
Klassiker war. Er brachte die Bibliothek<br />
<strong>der</strong> Alten Welt und die Tusculumreihe<br />
zum Abschluß und zur Verbreitung<br />
unter Lesern, die sich für bestimmte<br />
Themenbereiche des antiken<br />
Schrifttums interessierten.<br />
Akademischen Ämtern ging er ebenso<br />
aus dem Wege wie Einladungen zu<br />
Gastsemestern, die ihn längere Zeit von<br />
seinem Tusculanum ferngehalten hätten<br />
(obwohl er neben seiner holländischen<br />
Muttersprache die europäischen Konferenzsprachen<br />
beherrschte). Ebenso zog<br />
er es vor, seine Korrespondenz und seine<br />
zahlreichen Arbeit mit sicherer Hand<br />
auf <strong>der</strong> vertrauten Schreibmaschine zu<br />
tippen, statt sich mit dem ständig komplizierter<br />
und unübersichtlicher werdenden<br />
Fortschritt <strong>der</strong> elektronischen<br />
Textverarbeitung herumzuschlagen.<br />
Die Bodenseelandschaft war dem am<br />
Teutoburger Wald aufgewachsenen<br />
Norddeutschen so ans Herz gewachsen,<br />
dass er es kaum versäumte, am<br />
wöchentlichen Stammtisch <strong>der</strong> Überlinger<br />
Honoratioren teilzunehmen und an<br />
<strong>der</strong> Verleihung des Bodensee-Literaturpreises<br />
mitzuwirken. Seine Laudatio<br />
auf Golo Mann Jugendjahre am Bodensee<br />
gestaltete er zu einem weit über den<br />
Anlaß hinausreichenden Stück Erzie-<br />
1/2005 fdw 31