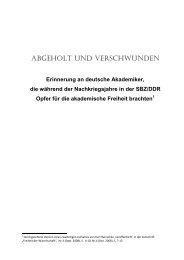freiheit der - Bund Freiheit der Wissenschaft eV
freiheit der - Bund Freiheit der Wissenschaft eV
freiheit der - Bund Freiheit der Wissenschaft eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Prominent besetzt: Podium des Forums II Foto: Joerss<br />
„So fern und doch so nah: Natur- und<br />
Geisteswissenschaften – eine Schicksalsgemeinschaft?“,<br />
lautete die Überschrift<br />
von Forum II des Symposiums.<br />
Auf dem Podium: Professor Dr. Jürgen<br />
Mlynek (Rektor <strong>der</strong> Humboldt-Universität,<br />
Berlin), Professor Dr. Wilhelm<br />
Vossenkuhl (Philosopohie, LMU München),<br />
Professor Dr. Erika Fischer-Lichte<br />
(Theaterwissenschaften, FU Berlin),<br />
Professor Dr. Wolfgang M. Heckl (Generaldirektor<br />
des Deutschen. Museums,<br />
München), Professor Dr. Julian Nida-<br />
Rümelin (Kulturstaatsminister a. D.,<br />
Philosophie/Politologie, LMU München),<br />
Dr. Konrad Adam (Mo<strong>der</strong>ator,<br />
Chefredakteur Die WELT). In seinem<br />
einleitenden Thesenreferat stellte Professor<br />
Dr. Jürgen Mlynek die Frage, ob<br />
„Humboldt neu denken“ auch bedeute,<br />
„die Universität als Ganzes neu zu erfinden“.<br />
Die deutsche Universität sieht er<br />
auch im Zeichen <strong>der</strong> Globalisierung als<br />
„Ort, wo Wissen neu erzeugt wird“. Das<br />
Gelehrtendasein stelle sich in gewisser<br />
Weise auch als „intellektuelles Abenteuer“<br />
dar, bei dem gleichzeitig Studienreformen,<br />
Profilbildung und Nachwuchswerbung<br />
vorangetrieben werden müßten.<br />
Er for<strong>der</strong>te das zeitlose Postulat<br />
Wilhelm von Humboldts ein, demzufolge<br />
Lehre(r) und Forschung „für die <strong>Wissenschaft</strong>“<br />
da zu sein haben, und legte<br />
Wert auf die Feststellung, daß <strong>der</strong> Weg<br />
zum B.A./M.A. konsequent als einzige<br />
Alternative verfolgt werden solle. Ob dabei<br />
die Universität die akademische<br />
<strong>Freiheit</strong> verliere, sei eine Gefahr, <strong>der</strong> dadurch<br />
entgegengewirkt werden könne,<br />
daß die grundlegenden Begriffe geschärft<br />
würden: Bildung als unverzichtbare<br />
Persönlichkeitsbildung, Ausbildung<br />
als Berufsorientierung. Hier müßten<br />
Natur- und Geisteswissenschaften<br />
notwendigerweise „an einem Strang<br />
ziehen“, um eine Balance zwischen einer<br />
extremen Leistungsanfor<strong>der</strong>ung und<br />
den akademischen Traditionen durch<br />
ein eigenes Profil je<strong>der</strong> Universität zu<br />
erreichen. Es stelle sich dabei heraus,<br />
daß Natur- und Geisteswissenschaften<br />
zwar „thematisch unterschiedliche Disziplinen“<br />
seien, die aber „den gleichen<br />
Zielen dienten, nämlich <strong>der</strong> Wahrheitssuche<br />
im jeweils eigenen Forschungsbereich“.<br />
In <strong>der</strong> These, daß die Geisteswissenschaften<br />
von <strong>der</strong> Vergangenheit<br />
(Tradition) lebten, die sich täglich rechtfertigen<br />
müssten, den Naturwissenschaften<br />
aber die „Zukunft gehöre“, sehe<br />
er ein fast unausrottbares Vorurteil.<br />
Am Beispiel des „iconic turn“, dem<br />
Wechsel von <strong>der</strong> Text- zur Bild-Orientierung<br />
in den Geisteswissenschaften,<br />
sehe er ein Feld <strong>der</strong> Annäherung. Für<br />
beide Bereiche gelte ein Zitat Georg<br />
Christoph Lichtenbergs (1742–1799),<br />
<strong>der</strong> sowohl die geistige Zuchtlosigkeit<br />
als auch die Pedanterie bekämpft hatte:<br />
„Das Neue liegt am Rande“ – ein Plädoyer<br />
auch für die „kleinen Fächer“, die<br />
„Exoten“?<br />
In seinem „Korreferat“ sprach sich Professor<br />
Dr. Wilhelm Vossenkuhl gegen<br />
die These aus, <strong>der</strong>zufolge die Geisteswissenschaften<br />
eine „an<strong>der</strong>e Wirklichkeit<br />
des Gehirns vor sich“ hätten als die<br />
Neurobiologen und sah im „Auf und Ab<br />
<strong>der</strong> Disziplinen“ einen Zusammenhang<br />
mit <strong>der</strong> „Evolution des Marktes <strong>der</strong><br />
<strong>Wissenschaft</strong>en“. Die Autonomie <strong>der</strong><br />
<strong>Wissenschaft</strong>(en) habe gewissermaßen<br />
einen „Antimarkt-Effekt“. Das Gegensatzpaar<br />
Wert und Nutzen illustrierte er<br />
am Beispiel des Standardwerkes <strong>der</strong><br />
deutschen Geschichtswissenschaften<br />
über das 19. Jahrhun<strong>der</strong>t (Professor Dr.<br />
Thomas Nipperdey, LMU München). Er<br />
for<strong>der</strong>te die Disziplinen auf, um ihre<br />
Eigenständigkeit zu kämpfen, um die<br />
akademische <strong>Freiheit</strong> nicht zwischen<br />
staatlichen Vorgaben, Wettbewerbsdruck<br />
und verständlichem, aber vor<strong>der</strong>gründigem<br />
öffentlichem Interesse an „schnellen<br />
Forschungsergebnissen“ (vor allem<br />
in <strong>der</strong> Medizin o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Pharmazie)<br />
zunehmend schwinden zu sehen. Er<br />
spreche sich auch stets gegen ein „geheucheltes<br />
wechselseitiges Interesse“<br />
<strong>der</strong> <strong>Wissenschaft</strong>sbereiche untereinan<strong>der</strong><br />
aus und for<strong>der</strong>e die „Solidarität <strong>der</strong><br />
<strong>Wissenschaft</strong>en“.<br />
Professor Dr. Julian Nida-Rümelin<br />
erwähnte, daß bis etwa 1970 die Geisteswissenschaften<br />
das „Feld <strong>der</strong> Gymnasiallehrer“<br />
gewesen seien, weitgehend<br />
abgeschottet vom übrigen <strong>Wissenschaft</strong>sbereich(Lehramt/Diplomstudiengänge).<br />
So erkläre sich zum Teil die<br />
„defensive Situation heute“, denn das<br />
vielfach beklagte „akademische Proletariat“<br />
weise wenige Absolventen <strong>der</strong><br />
Geisteswissenschaften auf. Er erinnerte<br />
daran, daß es die zündende Idee Wilhelm<br />
von Humboldts war, die Universität<br />
von den „drei Ausbildungsgängen<br />
<strong>der</strong> Hohen Schule des Mittelalters“, orientiert<br />
an den „septem artes liberales“,<br />
in die akademische <strong>Freiheit</strong> als Konsequenz<br />
<strong>der</strong> Aufklärung zu führen, die<br />
„eben nicht berufsbild-, son<strong>der</strong>n wissenschaftsorientiert“<br />
sein sollte. Er verwies<br />
ferner auf den Beschluß <strong>der</strong> Kultusministerkonferenz<br />
von Oktober 2003<br />
zur Neuorientierung <strong>der</strong> Studiengänge:<br />
berufsorientierte und wissenschaftsorientierte<br />
Wege sollten sich ergänzen.<br />
Das Spezifikum <strong>der</strong> Geisteswissenschaften<br />
sehe er dabei in <strong>der</strong> Grundfor<strong>der</strong>ung,<br />
„präzise formulieren zu können“<br />
– unverzichtbar auch in <strong>der</strong> Anwendung<br />
in den Naturwissenschaften:<br />
6 fdw 1/2005