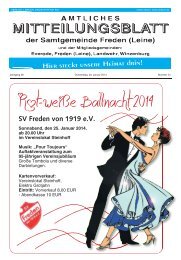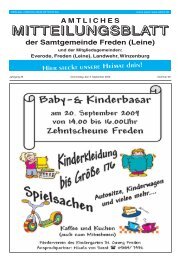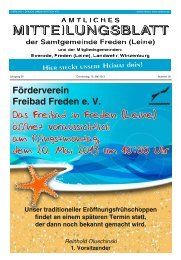Jahrgang 38 Donnerstag, 01. November 2012 Nummer 11
Jahrgang 38 Donnerstag, 01. November 2012 Nummer 11
Jahrgang 38 Donnerstag, 01. November 2012 Nummer 11
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Freden – 7 – Nr. <strong>11</strong>/<strong>2012</strong><br />
Anlässlich des Brustkrebsmonats Oktober empfiehlt die DAK- Gesundheit,<br />
sich über die Brustkrebs-Früherkennung zu informieren und regelmäßig<br />
Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen.<br />
Je früher eine Veränderung der Brust festgestellt wird, umso größer sind<br />
die Heilungschancen einer bösartigen Tumorerkrankung. Meike Fitting,<br />
Expertin der DAK-Gesundheit, rät daher dringend zur Prävention: „Eine<br />
regelmäßige Brustkrebs-Vorsorge sollte für Frauen jeden Alters eine<br />
Selbstverständlichkeit sein!“<br />
Eine wichtige Möglichkeit zur Vorsorge ist die Brustkrebs-Früherkennung<br />
beim Frauenarzt, an der jede Frau ab 30 Jahren mindestens einmal im<br />
Jahr teilnehmen sollte. Der Arzt beginnt die körperliche Untersuchung mit<br />
dem Betrachten der Brüste. Hierbei wird vor allem auf Seitenunterschiede,<br />
Hautveränderungen und Entzündungsanzeichen geachtet. Die Tastuntersuchung<br />
erstreckt sich auf beide Brüste und das Gebiet der Achselhöhlen.<br />
Mammographie: Röntgen der Brust<br />
Schon sehr kleine, nicht tastbare Tumore können mit Hilfe einer sogenannten<br />
Mammographie entdeckt werden. Hierbei handelt es sich um eine<br />
Röntgenuntersuchung der Brust, die Frauen im Alter von 50 bis 69 alle zwei<br />
Jahre empfohlen wird. Auf den Röntgenbildern lassen sich Veränderungen<br />
der Gewebedichte oder auch kleinere Verkörnungen erkennen. „Das Vorliegen<br />
einer Veränderung bedeutet aber nicht automatisch, dass sich ein<br />
bösartiger Tumor entwickelt hat“ erläutert Meike Fitting. „Eine endgültige<br />
Diagnose ist erst nach einer ergänzenden bildgebenden Untersuchung<br />
oder nach der Laboruntersuchung einer Gewebeprobe möglich.“<br />
Mehr Informationen zur Röntgenuntersuchung der Brust gibt die Kooperationsgemeinschaft<br />
Mammographie unter www.mammoprogramm.<br />
de. Im Rahmen der Aktion „Gut informiert?“ im Brustkrebsmonat Oktober<br />
beantworten Mitarbeiter des Krebsinformationsdienst (KID) Fragen zur<br />
Früherkennung von Brustkrebs individuell und unabhängig: Entweder über<br />
die kostenlose Service-Hotline 0800-420 30 40 oder im Online-<br />
Dialogforum auf www.gut-informiert.de.<br />
Selbstuntersuchung noch zu selten<br />
Neben den ärztlichen Vorsorgeterminen können Frauen durch das regelmäßige<br />
Abtasten der Brust selbst dazu beitragen, einen eventuellen Krebs<br />
frühzeitig zu entdecken. Welche wichtige Rolle diese Selbstuntersuchung<br />
bei der Früherkennung spielt, zeigt der klinische Alltag.<br />
„Etwa 80 bis 90 Prozent der betroffenen Frauen nehmen eine Veränderung<br />
beziehungsweise einen Knoten in ihrer Brust immer noch früher als ihre<br />
Ärzte wahr“, weiß die Expertin der DAK-Gesundheit. Nur wenige Frauen<br />
bauen die Vorsorge jedoch bisher in ihren Alltag mit ein. „Lediglich 10 bis<br />
15 Prozent der Frauen in Deutschland führen regelmäßig eine Selbstuntersuchung<br />
durch“, so Fitting.<br />
Eine Anleitung, wie Frauen selbst ihre Brust abtasten und so eine wichtige<br />
Vorsorgemaßnahme bequem zuhause durchführen können, gibt es im Internet<br />
unter www.brustkrebs-info.de. Meike Fitting von der DAK-Gesundheit<br />
warnt allerdings davor, sich allein auf die Selbstuntersuchung zu verlassen:<br />
„Die eigenständige Untersuchung ist wichtig und ein wesentlicher Bestandteil<br />
der Brustkrebsvorsorge. Es handelt sich aber um eine Ergänzung<br />
und sollte niemals die regelmäßigen Vorsorgetermine beim Frauenarzt<br />
ersetzen!“ warnt Maike Fitting.<br />
Weitere Informationen zum Thema:<br />
Kooperationsgemeinschaft Mammographie in der ambulanten vertragsärztlichen<br />
Versorgung GbR: www.koop-mammo.de<br />
Fragen an Experten für interessierte Frauen: www.gut-informiert.de<br />
Bundesweite Fotoausstellung „Mitten im Leben“ der Fotokünstlerin Bettina<br />
Flitner:<br />
www.mammo-programm.de/fotoausstellung/idee-der-ausstellung.php<br />
Kontakt: Carolin Wollschläger, carolin.wollschlaeger@dak.de<br />
Texte und kostenlose Fotos können Sie unter www.presse.dak.de downloaden.<br />
Die Pressestelle der DAK-Gesundheit twittert.<br />
Folgen Sie uns unter www.twitter.com/dak presse<br />
Mitteilungen der BARMER GEK<br />
Jeder Vierte leidet an Kopfschmerzen<br />
Die pochende Volkskrankheit<br />
Ob Mann oder Frau, jung oder alt - fast jedem dröhnt ab und an einmal<br />
der Schädel. Experten schätzen, dass etwa 70 Prozent aller Menschen<br />
zeitweise unter Kopfschmerzen leiden, etwa jeder Vierte wird regelmäßig<br />
von dem Leiden geplagt. Nach wie gibt es viele Fragen und Unsicherheiten.<br />
Rüdiger Leopold, Bezirksgeschäftsführer der BARMER GEK in Alfeld, liefert<br />
die wichtigsten Fakten zu der pochenden Volkskrankheit.<br />
Was sind Kopfschmerzen?<br />
Bei über 200 verschiedenen Formen gibt es nicht die typischen Kopfschmerzen.<br />
Besonders häufig treten allerdings Migräne und Spannungskopfschmerzen<br />
auf. Mediziner unterscheiden außerdem zwischen primären<br />
und sekundären Kopfschmerzen. Bei der sekundären Form sind die<br />
Kopfschmerzen „nur“ ein Symptom einer anderen Krankheit und können<br />
somit auch geheilt werden. „Ist die Grunderkrankung erfolgreich therapiert,<br />
treten auch die<br />
Kopfschmerzen nicht mehr auf“, so Leopold. Bei der primären Form stellen<br />
die Schmerzen ein eigenes Krankheitsbild dar. Es handelt sich dabei auch<br />
um Fehlfunktionen von Nerven und Blutgefäßen im Gehirn, deren Ursachen<br />
bislang noch nicht beseitigt werden können. Allerdings können die<br />
Kopfschmerzen gelindert und die Anzahl der Attacken reduziert werden.<br />
Wie unterscheiden sich Migräne und Spannungskopfschmerz?<br />
Bei Migräne verstärkt sich der Kopfschmerz, wenn man sich körperlich betätigt<br />
- das ist bei Spannungskopfschmerzen in der Regel nicht der Fall. Die<br />
Migräne-Kopfschmerzen werden meist stechend, pochend oder pulsierend<br />
wahrgenommen. Eine Attacke führt zu relevanten Beeinträchtigungen im<br />
Alltag, während dumpf-drückende Spannungskopfschmerzen eher langsam<br />
an Intensität zunehmen. Das Erbrechen ist charakteristisch für die Migräne,<br />
leichte Übelkeit sowie Licht- und Lärmempfindlichkeit können bei beiden<br />
Kopfschmerzarten vorkommen.<br />
Kann man Kopfschmerzen selbst behandeln?<br />
Wer unter akuten Kopfschmerzen leiden, kann diese meist recht gut selbst<br />
behandeln. Ein Gespräch mit dem Hausarzt liefert wichtige Tipps, was im<br />
Fall der Fälle zu tun ist. Er kann auch Arzneimittel nennen, die sich zur<br />
Selbstmedikation eignen. Die wichtigsten Präparate in diesem Rahmen sind<br />
Schmerzmittel, die alle über einen ähnlichen Wirkmechanismus verfügen.<br />
Ihre Eigenschaften sind Schmerzlinderung, Fiebersenkung und Entzündungshemmung<br />
(Ausnahme: Paracetamol). Diese Eigenschaften sind bei<br />
den einzelnen Wirkstoffen unterschiedlich stark ausgeprägt, ähnlich die<br />
Verträglichkeiten. Starke Schmerzen, die auch durch die angegebenen<br />
Höchstdosen dieser Medikamente nicht zu beeinflussen sind, gehören<br />
unbedingt in die Hand eines Arztes. Das gilt auch für mehrfach wiederkehrende<br />
Beschwerden in kurzen Zeiträumen.<br />
Der BARMER GEK Teledoktor bietet Rat<br />
Ein Team besonders geschulter Fach- und Allgemeinärzte beantwortet<br />
schnell und kompetent Ihre Fragen zu den unterschiedlichsten Gesundheitsproblemen<br />
vom Asthma bis zum Zahnschmerz unter der Telefonnummer<br />
0800 45 40 250. Anrufe aus den deutschen Fest- und Mobilfunknetzen<br />
sind kostenfrei. Der Teledoktor hat immer Sprechstunde und keine Wartezeiten.<br />
7 Tage die Woche, rund um die Uhr.<br />
Stimmungstief - Was tun gegen die Herbst-Depression<br />
Die Tage werden kürzer, die dunkle Jahreszeit beginnt. Wenn der Morgen<br />
endlich graut, erwartet uns feucht-kaltes Nieselwetter, das im Laufe<br />
des Tages lediglich die Grauschattierungen wechselt. „Wer schon beim<br />
Gedanken daran am liebsten gar nicht aufstehen möchte, zu nichts mehr<br />
richtig Lust hat und sich innerlich leer fühlt, der könnte in einer Herbst-<br />
Winter-Depression stecken“, warnt Rüdiger Leopold von der BARMER<br />
GEK in Alfeld.<br />
Mit dem Herbst steigt die Zahl der depressiven Erkrankungen sprunghaft<br />
an: Die Neuerkrankungen liegen hier bei zirka zehn Prozent. Allein in<br />
Niedersachsen und Bremen leiden nach Expertenmeinung jedes Jahr<br />
rund 80.000 Menschen, davon zwei Drittel Frauen, unter dieser saisonalen<br />
Depressionsform. Kennzeichen: große Traurigkeit, mangelnder Antrieb,<br />
Erschöpfung, Hoffnungslosigkeit und Angst, innere Unruhe, Nervosität<br />
oder Schlafstörungen. Dazu können noch Beschwerden wie Nacken-,<br />
Rücken- oder Magenschmerzen kommen. Als Ursachen gelten der Mangel<br />
an Tageslicht und die verminderte Lichtintensität, die Auswirkungen auf<br />
die hormonelle Steuerung des Körpers haben. „Betroffene sollten zum<br />
Arzt gehen“, rät Leopold.<br />
Psychische Krankheiten wie eine depressive Verstimmung sind häufig die<br />
Folge einer allgemeinen Dauerbelastung. Komplexe Anforderungen in Beruf<br />
und Alltag, Zeitdruck und immer höhere Technisierung sind nicht mehr nur<br />
ein Problem für ältere Menschen. Zunehmend fühlen sich auch Jüngere dem<br />
Alltag nicht mehr gewachsen. Die Auslöser einer depressiven Verstimmung<br />
sind jedoch von Person zu Person unterschiedlich. Ein Stimmungstief<br />
kann beinahe jeden so unverhofft wie eine Grippe treffen. Die eigentliche<br />
Ursache des Stimmungstiefs liegt in einer Funktionsstörung des Nervensystems:<br />
Es fehlen Botenstoffe, die für unser Wohlbefinden und unsere<br />
Lebensenergie verantwortlich sind. In erster Linie geht es also darum, das<br />
biologische Gleichgewicht wieder herzustellen. Dazu beitragen kann man<br />
selbst, z. B. mit pflanzlichen Arzneimitteln: Johanniskraut-Präparate stellen<br />
nach und nach die Balance der Botenstoffe im Gehirn wieder her. Aufgrund<br />
dieser Wirkungsweise ist eine Anlaufzeit von ein bis zwei Wochen nötig.<br />
Johanniskraut bessert die Stimmung, wirkt Angst lösend oder anregend.