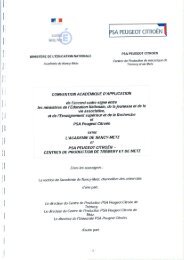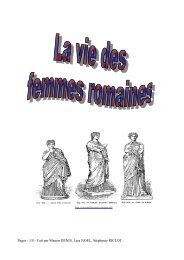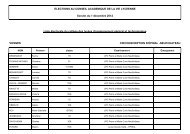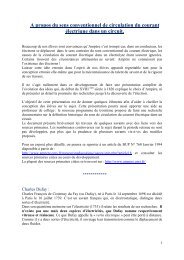Die Grundlagen der Arithmetik. Eine logisch mathematische ...
Die Grundlagen der Arithmetik. Eine logisch mathematische ...
Die Grundlagen der Arithmetik. Eine logisch mathematische ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Gottlob Frege – <strong>Die</strong> <strong>Grundlagen</strong> <strong>der</strong> <strong>Arithmetik</strong> - 36<br />
In Bezug auf Eins und Einheit blieb die Frage, wie die Willkühr <strong>der</strong> Auffassung zu<br />
beschränken sei, die jeden Unterschied zwischen <strong>Eine</strong>m und Vielen zu verwischen schien.<br />
<strong>Die</strong> Abgegrenztheit, die Ungetheiltheit, die Unzerlegbarkeit sind keine brauchbaren Merkmale<br />
für das, was wir durch das Wort „Ein“ ausdrücken.<br />
Wenn man die zu zählenden Dinge Einheiten nennt, so ist die unbedingte Behauptung, dass<br />
die Einheiten gleich seien, falsch. Dass sie in gewisser Hinsicht gleich sind, ist zwar richtig aber<br />
werthlos. <strong>Die</strong> Verschiedenheit <strong>der</strong> zu zählenden Dinge ist sogar nothwendig, wenn die Zahl<br />
grösser als 1 werden soll.<br />
So schien es, dass wir den Einheiten zwei wi<strong>der</strong>sprechende Eigenschaften beilegen müssten:<br />
die Gleichheit und die Unterscheidbarkeit.<br />
Es ist ein Unterschied zwischen Eins und Einheit zu machen. Das Wort „Eins“ ist als<br />
Eigenname eines Gegenstandes <strong>der</strong> <strong>mathematische</strong>n Forschung eines Plurals unfähig. Es ist also<br />
sinnlos, Zahlen durch Zusammenfassen von Einsen entstehen zu lassen. Das Pluszeichen in<br />
1+1=2 kann nicht eine solche Zusammenfassung bedeuten.<br />
§ 46. <strong>Die</strong> Zahlangabe enthält eine Aussage von einem Begriffe. Einwand, dass bei unverän<strong>der</strong>tem<br />
Begriffe die Zahl sich än<strong>der</strong>e.<br />
Um Licht in die Sache zu bringen, wird es gut sein, die Zahl im Zusammenhange eines<br />
Urtheils zu betrachten, wo ihre ursprüngliche Anwendtingsweise hervortritt. Wenn ich in<br />
Ansehung <strong>der</strong>selben äussern Erscheinung mit <strong>der</strong>selben Wahrheit sagen kann: „dies ist eine<br />
Baumgruppe“ und „dies sind fünf Bäume“ o<strong>der</strong> „hier sind vier Compagnien“ und „hier sind 500<br />
Mann,“ so än<strong>der</strong>t sich dabei we<strong>der</strong> das Einzelne noch das Ganze, das Aggregat, son<strong>der</strong>n meine<br />
Benennung. Das ist aber nur das Zeichen <strong>der</strong> Ersetzung eines Begriffes durch einen an<strong>der</strong>n. Damit<br />
wird uns als Antwort auf die erste Frage des vorigen Paragraphen nahe gelegt, dass die Zahlangabe<br />
eine Aussage von einem Begriffe enthalte. Am deutlichsten ist dies vielleicht bei <strong>der</strong> Zahl 0. Wenn<br />
ich sage: „die Venus hat 0 Monde“, so ist gar kein Mond o<strong>der</strong> Aggregat von Monden da, von dem<br />
etwas ausgesagt werden könnte; aber dem Begriffe „Venusmond“ wird dadurch eine Eigenschaft<br />
beigelegt, nämlich die, nichts unter sich zu befassen. Wenn ich sage: „<strong>der</strong> Wagen des Kaisers wird<br />
von vier Pferden gezogen“, so lege ich die Zahl vier dem Begriffe „Pferd, das den Wagen des<br />
Kaisers zieht“, bei.<br />
Man mag einwenden, dass ein Begriff wie z. B. „Angehöriger des deutschen Reiches“, obwohl<br />
seine Merkmale unverän<strong>der</strong>t bleiben, eine von Jahr zu Jahr wechselnde Eigenschaft haben würde,<br />
wenn die Zahlangabe eine solche von ihm aussagte. Man kann dagegen geltend machen, dass auch<br />
Gegenstände ihre Eigenschaften än<strong>der</strong>n, was nicht verhin<strong>der</strong>e, sie als dieselben anzuerkennen.<br />
Hier lässt sich aber <strong>der</strong> Grund noch genauer angeben. Der Begriff „Angehöriger des deutschen<br />
Reiches“ enthält nämlich die Zeit als verän<strong>der</strong>lichen Bestandtheil, o<strong>der</strong>, um mich mathematisch<br />
auszudrücken, ist eine Function <strong>der</strong> Zeit. Für „a ist ein Angehöriger des deutschen Reiches“ kann<br />
man sagen: „a gehört dem deutschen Reiche an“ und dies bezieht sich auf den gerade<br />
gegenwärtigen Zeitpunkt. So ist also in dem Begriffe selbst schon etwas Fliessendes. Dagegen<br />
kommt dem Begriffe „Angehöriger des deutschen Reiches zu Jahresanfang 1883 berliner Zeit“ in<br />
alle Ewigkeit dieselbe Zahl zu.<br />
§ 47. <strong>Die</strong> Thatsächlichkeit <strong>der</strong> Zahlangabe erklärt sich aus <strong>der</strong> Objectivität des Begriffes.<br />
Dass eine Zahlangabe etwas Thatsächliches von unserer Auffassung Unabhängiges ausdrückt,<br />
kann nur den Wun<strong>der</strong> nehmen, welcher den Begriff für etwas Subjectives gleich <strong>der</strong> Vorstellung hält.<br />
Aber diese Ansicht ist falsch. Wenn wir z. B. den Begriff des Körpers dem des Schweren o<strong>der</strong> den<br />
des Wallfisches dem des Säugethiers unterordnen, so behaupten wir damit etwas Objectives. Wenn<br />
nun die Begriffe subjectiv wären, so wäre auch die Unterordnung des einen unter den an<strong>der</strong>n als<br />
Beziehung zwischen ihnen etwas Subjectives wie eine Beziehung zwischen Vorstellungen. Freilich<br />
auf den ersten Blick scheint <strong>der</strong> Satz<br />
„alle Wallfische sind Säugethiere“<br />
von Thieren, nicht von Begriffen zu handeln ; aber, wenn man fragt, von welchem Thiere denn die<br />
Rede sei, so kann man kein einziges aufweisen. Gesetzt, es liege ein Wallfisch vor, so behauptet<br />
doch von diesem unser Satz nichts. Man könnte aus ihm nicht schliessen, das vorliegende Thier sei



![Développement d'applications nationales [PDF - 67 Ko ]](https://img.yumpu.com/22700484/1/184x260/developpement-dapplications-nationales-pdf-67-ko-.jpg?quality=85)