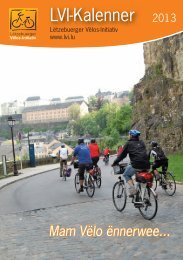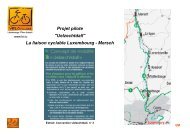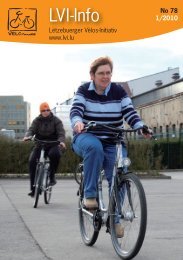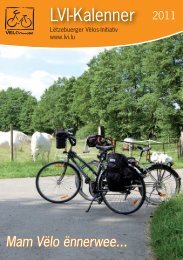Mam Vëlo do! - lvi.lu | Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ
Mam Vëlo do! - lvi.lu | Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ
Mam Vëlo do! - lvi.lu | Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
153<br />
Romain Molitor<br />
Das Fahrrad als<br />
Verkehrsmittel?<br />
Dass das „Veloziped“ vom Luxusspielzeug zum vollwertigen Fortbewegungsmittel avancierte, verdankt es<br />
unter anderem dem technischen Fortschritt und der Leichtigkeit, mit der Wege zurückgelegt werden können.<br />
Doch para<strong>do</strong>xerweise, so zeigt der folgende Rückblick auf die Verkehrsgeschichte, wurde das Potenzial des<br />
Fahrrads im Alltagsverkehr von der Verkehrspolitik und den Verkehrsplanern lange Zeit unterschätzt –<br />
nicht nur in Luxemburg.<br />
Die Anfänge<br />
„Auf der Ebene, bei trockenen Fußwegen, [geht die<br />
Maschine] wie ein Pferd im Galopp […]. Berg ab,<br />
schneller als ein Pferd in Carrière.“ In der Patentschrift<br />
zum „Veloziped“, dem Urahn des Fahrrads, pries Karl<br />
Freiherr von Drais (1785–1851) die Schnelligkeit seiner<br />
„Laufmaschine“. Doch die Erfindung wurde zunächst als<br />
Spielzeug missverstanden.<br />
In seiner Kulturgeschichte des Radfahrens<br />
bezeichnet Andreas Hochmuth die Drais’sche<br />
Lauf maschine, obwohl es sich um eine durchaus<br />
praxisgerechte Konstruktion mit sattelähnlichem Sitz<br />
und einer deichselähnlichen Lenkstange handelte, als<br />
ein höchst <strong>lu</strong>xuriöses Unikum, als revo<strong>lu</strong>tionär und dem<br />
„konservativen Zeitgeist höchst unbequemes Gefährt“.<br />
Die Laufmaschine wurde, so Hochmuth, zu einem<br />
schicken Accessoire von Dandies und wohl habenden<br />
Freidenkern (siehe Artikel von Jean-Paul Hoffmann in<br />
diesem Band, S. 16f.).<br />
Dass das Drais’sche Veloziped als exzentrisches<br />
Freizeitinstrument abgetan wurde, erklärt sich zum Teil<br />
durch den Zustand des damaligen Straßennetzes, der<br />
zu dieser Zeit generell nicht wirklich zum Radfahren<br />
geeignet war: Gerd Hüttmann berichtet in seiner Drais-<br />
Portrait von<br />
Karl Freiherr<br />
von Drais.<br />
Biografie, dass die Fahrbahnen von den Fuhrwerken<br />
stark zerfurcht waren, so dass die „Draisinen-Reiter“<br />
in den Städten gerne auf die glatteren und besser zu<br />
fahrenden – oder soll man besser sagen „zu reitenden“<br />
– Gehwege auswichen. Polizeiliche Verbote und Strafen<br />
waren die Folge. Diese Verbote und Rege<strong>lu</strong>ngen waren<br />
regional sehr unterschiedlich. Manche Städte, wie Köln,<br />
verboten zwischen 1869 und 1894 bei Strafe „das Reiten<br />
auf Velocipeden“, während Dresden oder München<br />
das „Velociped“ unterstützten. Andere führten eigene<br />
Regeln für Radfahrer ein; sie reichten von Verboten,