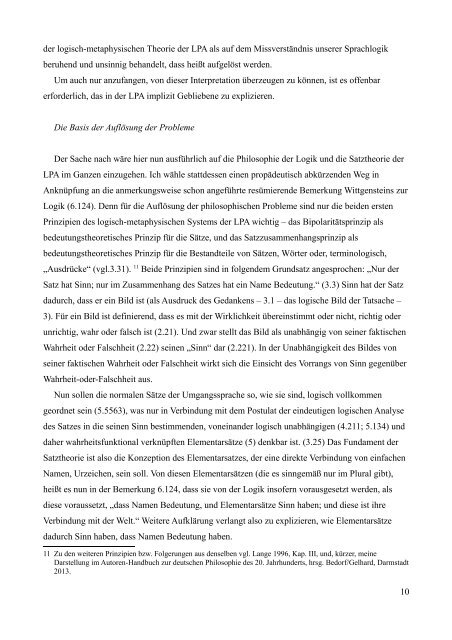'philosophisches' Problem? - Ernst Michael Lange
'philosophisches' Problem? - Ernst Michael Lange
'philosophisches' Problem? - Ernst Michael Lange
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
der logisch-metaphysischen Theorie der LPA als auf dem Missverständnis unserer Sprachlogik<br />
beruhend und unsinnig behandelt, dass heißt aufgelöst werden.<br />
Um auch nur anzufangen, von dieser Interpretation überzeugen zu können, ist es offenbar<br />
erforderlich, das in der LPA implizit Gebliebene zu explizieren.<br />
Die Basis der Auflösung der <strong>Problem</strong>e<br />
Der Sache nach wäre hier nun ausführlich auf die Philosophie der Logik und die Satztheorie der<br />
LPA im Ganzen einzugehen. Ich wähle stattdessen einen propädeutisch abkürzenden Weg in<br />
Anknüpfung an die anmerkungsweise schon angeführte resümierende Bemerkung Wittgensteins zur<br />
Logik (6.124). Denn für die Auflösung der philosophischen <strong>Problem</strong>e sind nur die beiden ersten<br />
Prinzipien des logisch-metaphysischen Systems der LPA wichtig – das Bipolaritätsprinzip als<br />
bedeutungstheoretisches Prinzip für die Sätze, und das Satzzusammenhangsprinzip als<br />
bedeutungstheoretisches Prinzip für die Bestandteile von Sätzen, Wörter oder, terminologisch,<br />
„Ausdrücke“ (vgl.3.31). 11 Beide Prinzipien sind in folgendem Grundsatz angesprochen: „Nur der<br />
Satz hat Sinn; nur im Zusammenhang des Satzes hat ein Name Bedeutung.“ (3.3) Sinn hat der Satz<br />
dadurch, dass er ein Bild ist (als Ausdruck des Gedankens – 3.1 – das logische Bild der Tatsache –<br />
3). Für ein Bild ist definierend, dass es mit der Wirklichkeit übereinstimmt oder nicht, richtig oder<br />
unrichtig, wahr oder falsch ist (2.21). Und zwar stellt das Bild als unabhängig von seiner faktischen<br />
Wahrheit oder Falschheit (2.22) seinen „Sinn“ dar (2.221). In der Unabhängigkeit des Bildes von<br />
seiner faktischen Wahrheit oder Falschheit wirkt sich die Einsicht des Vorrangs von Sinn gegenüber<br />
Wahrheit-oder-Falschheit aus.<br />
Nun sollen die normalen Sätze der Umgangssprache so, wie sie sind, logisch vollkommen<br />
geordnet sein (5.5563), was nur in Verbindung mit dem Postulat der eindeutigen logischen Analyse<br />
des Satzes in die seinen Sinn bestimmenden, voneinander logisch unabhängigen (4.211; 5.134) und<br />
daher wahrheitsfunktional verknüpften Elementarsätze (5) denkbar ist. (3.25) Das Fundament der<br />
Satztheorie ist also die Konzeption des Elementarsatzes, der eine direkte Verbindung von einfachen<br />
Namen, Urzeichen, sein soll. Von diesen Elementarsätzen (die es sinngemäß nur im Plural gibt),<br />
heißt es nun in der Bemerkung 6.124, dass sie von der Logik insofern vorausgesetzt werden, als<br />
diese voraussetzt, „dass Namen Bedeutung, und Elementarsätze Sinn haben; und diese ist ihre<br />
Verbindung mit der Welt.“ Weitere Aufklärung verlangt also zu explizieren, wie Elementarsätze<br />
dadurch Sinn haben, dass Namen Bedeutung haben.<br />
11 Zu den weiteren Prinzipien bzw. Folgerungen aus denselben vgl. <strong>Lange</strong> 1996, Kap. III, und, kürzer, meine<br />
Darstellung im Autoren-Handbuch zur deutschen Philosophie des 20. Jahrhunderts, hrsg. Bedorf/Gelhard, Darmstadt<br />
2013.<br />
10