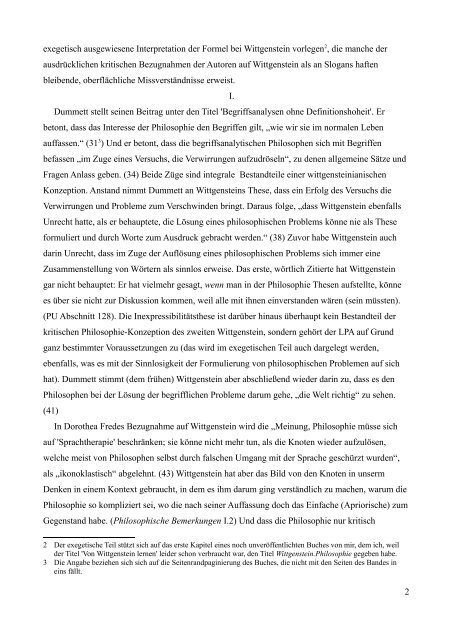'philosophisches' Problem? - Ernst Michael Lange
'philosophisches' Problem? - Ernst Michael Lange
'philosophisches' Problem? - Ernst Michael Lange
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
exegetisch ausgewiesene Interpretation der Formel bei Wittgenstein vorlegen 2 , die manche der<br />
ausdrücklichen kritischen Bezugnahmen der Autoren auf Wittgenstein als an Slogans haften<br />
bleibende, oberflächliche Missverständnisse erweist.<br />
I.<br />
Dummett stellt seinen Beitrag unter den Titel 'Begriffsanalysen ohne Definitionshoheit'. Er<br />
betont, dass das Interesse der Philosophie den Begriffen gilt, „wie wir sie im normalen Leben<br />
auffassen.“ (31 3 ) Und er betont, dass die begriffsanalytischen Philosophen sich mit Begriffen<br />
befassen „im Zuge eines Versuchs, die Verwirrungen aufzudröseln“, zu denen allgemeine Sätze und<br />
Fragen Anlass geben. (34) Beide Züge sind integrale Bestandteile einer wittgensteinianischen<br />
Konzeption. Anstand nimmt Dummett an Wittgensteins These, dass ein Erfolg des Versuchs die<br />
Verwirrungen und <strong>Problem</strong>e zum Verschwinden bringt. Daraus folge, „dass Wittgenstein ebenfalls<br />
Unrecht hatte, als er behauptete, die Lösung eines philosophischen <strong>Problem</strong>s könne nie als These<br />
formuliert und durch Worte zum Ausdruck gebracht werden.“ (38) Zuvor habe Wittgenstein auch<br />
darin Unrecht, dass im Zuge der Auflösung eines philosophischen <strong>Problem</strong>s sich immer eine<br />
Zusammenstellung von Wörtern als sinnlos erweise. Das erste, wörtlich Zitierte hat Wittgenstein<br />
gar nicht behauptet: Er hat vielmehr gesagt, wenn man in der Philosophie Thesen aufstellte, könne<br />
es über sie nicht zur Diskussion kommen, weil alle mit ihnen einverstanden wären (sein müssten).<br />
(PU Abschnitt 128). Die Inexpressibilitätsthese ist darüber hinaus überhaupt kein Bestandteil der<br />
kritischen Philosophie-Konzeption des zweiten Wittgenstein, sondern gehört der LPA auf Grund<br />
ganz bestimmter Voraussetzungen zu (das wird im exegetischen Teil auch dargelegt werden,<br />
ebenfalls, was es mit der Sinnlosigkeit der Formulierung von philosophischen <strong>Problem</strong>en auf sich<br />
hat). Dummett stimmt (dem frühen) Wittgenstein aber abschließend wieder darin zu, dass es den<br />
Philosophen bei der Lösung der begrifflichen <strong>Problem</strong>e darum gehe, „die Welt richtig“ zu sehen.<br />
(41)<br />
In Dorothea Fredes Bezugnahme auf Wittgenstein wird die „Meinung, Philosophie müsse sich<br />
auf 'Sprachtherapie' beschränken; sie könne nicht mehr tun, als die Knoten wieder aufzulösen,<br />
welche meist von Philosophen selbst durch falschen Umgang mit der Sprache geschürzt wurden“,<br />
als „ikonoklastisch“ abgelehnt. (43) Wittgenstein hat aber das Bild von den Knoten in unserm<br />
Denken in einem Kontext gebraucht, in dem es ihm darum ging verständlich zu machen, warum die<br />
Philosophie so kompliziert sei, wo die nach seiner Auffassung doch das Einfache (Apriorische) zum<br />
Gegenstand habe. (Philosophische Bemerkungen I.2) Und dass die Philosophie nur kritisch<br />
2 Der exegetische Teil stützt sich auf das erste Kapitel eines noch unveröffentlichten Buches von mir, dem ich, weil<br />
der Titel 'Von Wittgenstein lernen' leider schon verbraucht war, den Titel Wittgenstein.Philosophie gegeben habe.<br />
3 Die Angabe beziehen sich sich auf die Seitenrandpaginierung des Buches, die nicht mit den Seiten des Bandes in<br />
eins fällt.<br />
2