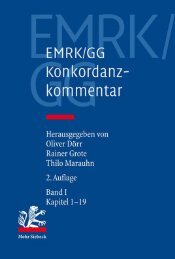Gottesdienstlehre - Mohr Siebeck Verlag
Gottesdienstlehre - Mohr Siebeck Verlag
Gottesdienstlehre - Mohr Siebeck Verlag
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
3. Schwelle und Unterbrechung: Der liturgische Ort und die liturgische Zeit<br />
die Sicherheit, die in modellhaften Handlungsmustern erworben wurde, vermehrte<br />
Gestaltungsmöglichkeiten auch in anderen Formen eröffnet. In diesem<br />
Sinne hilft der Sonntagsgottesdienst als Grundmodell den liturgisch Tätigen<br />
zu Stilsicherheit und zu einer gebildeten, im Bewusstsein für die eigenen<br />
Handlungsmöglichkeiten ausgeübten Routine. Gerade am Sonntagsgottesdienst<br />
als dem Normalfall lässt sich die Dialektik von Regelwerk und<br />
regelrechter Regelverletzung 5 lernen, die für das künstlerische Handeln charakteristisch<br />
ist.<br />
Zu dieser ästhetischen Perspektive des liturgischen Handelns sei schließlich<br />
noch einmal wiederholt, dass dabei nicht an den genialischen Künstler gedacht<br />
werden soll, der die Aufmerksamkeit auf sich selbst und sein Können<br />
lenkt. Es geht vielmehr gerade um eine Art der Darstellung, die den Gottesdienstbesuchern<br />
eigene Eindrücke erschließt und sie zum eigenen Ausdrücken<br />
glaubender Erfahrung ermutigt. Im Sinne der in den letzten vier Paragraphen<br />
beschriebenen ästhetischen Perspektive sollen bei der liturgischen<br />
Kunst nicht die Protagonisten bewundert werden, sondern die Wahrnehmungen<br />
und glaubenden Erfahrungen in eine „lebendige Circulation“ geraten<br />
(Schleiermacher 49f. 65).<br />
3. Schwelle und Unterbrechung: Der liturgische Ort<br />
und die liturgische Zeit<br />
Das liturgische Handeln ist nicht nur deswegen künstlerisch, weil es mit<br />
verschiedenen Künsten (Rede, Musik, Darstellung im Raum) einhergeht,<br />
sondern weil es grundsätzlich darin besteht, etwas darzustellen, was sich<br />
gleichzeitig eng auf die Realität bezieht und sich doch von ihr unterscheidet,<br />
wie das in der ästhetischen Theorie Theodor W. Adornos ausführlich beschrieben<br />
wurde (→ § 31.3.4). Der evangelische Gottesdienst ist insofern ein<br />
Kunstwerk, als er keine Sonderwelt inszeniert, sondern die vorhandene Welt<br />
als eine andere darstellt und erkennen lässt. Die Realität des Alltags wird<br />
nicht negiert, aber unter einem anderen Vorzeichen dargestellt. Die empirische,<br />
politische und psychologische Wahrnehmung wird nicht außer Kraft<br />
gesetzt, sondern in einen anderen Interpretationskontext gestellt.<br />
Das eigene Lebensglück wird liturgisch als Segen dargestellt und verstehbar, das Leiden<br />
wird mit der Passion Jesu verbunden, die Ungerechtigkeit mit der Weisung zum Leben<br />
und mit dem prophetischen Protest. Das Unveränderliche bleibt wenigstens nicht unaussprechlich,<br />
weil es im Gebet vor Gott gebracht wird. Das Unzulängliche des eigenen<br />
5 Für die Kunst der Predigtsprache kann so das Finden kreativer Metaphern unter der<br />
Maxime „Regelrecht gegen die Regeln“ beschrieben werden, dazu s. Wilfried Engemann:<br />
Semiotische Homiletik. Prämissen – Analysen – Konsequenzen, Tübingen 1993,<br />
187–192.<br />
Leseprobe aus Meyer-Black: <strong>Gottesdienstlehre</strong><br />
(c) 2011 <strong>Mohr</strong> <strong>Siebeck</strong> www.mohr.de<br />
393