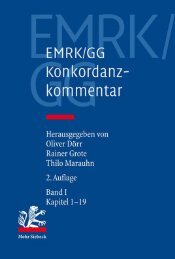Gottesdienstlehre - Mohr Siebeck Verlag
Gottesdienstlehre - Mohr Siebeck Verlag
Gottesdienstlehre - Mohr Siebeck Verlag
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
§ 49 Rückblick und Ausblick<br />
haben. Das schlechte Vortragen eines Textes – das gilt für Predigt wie Gebete<br />
– lässt auf die mangelnde Identifikation mit dem Inhalt und damit auf<br />
eine zu geringe eigene Auseinandersetzung mit der Sache schließen. Dadurch<br />
wird nicht nur die akustische Rezeption, sondern auch die gedankliche „Circulation“<br />
in der Gemeinde erschwert oder verhindert. Die claritas des biblischen<br />
Evangeliums verdient die klare Erkennbarkeit des Sprechers und seiner<br />
Worte.<br />
Zusammenfassung<br />
Bei der Vorbereitung sind drei wichtige Unterscheidungen zu treffen: Erstens<br />
erfordert die Planung des Gottesdienstprogramms weite Zeiträume, während<br />
die Vorbereitung des einzelnen Gottesdienstes in einem Dreischritt von Assoziation,<br />
Reflexion und Konkretion im Rhythmus von Anfang, Mitte und<br />
Ende der Woche erfolgen kann. Zweitens ist die gemeinsame Vorbereitung<br />
mit anderen von der eigenen gedanklichen Vorbereitung des Liturgen und<br />
Predigers zu unterscheiden. Dabei ist die letztere durch nichts zu ersetzen<br />
und erweist sich gerade für die Vorbereitung in einer Gruppe als besonders<br />
fruchtbar. Schließlich ist drittens die theoretisch konsistente Darstellung der<br />
Vorbereitungsergebnisse in einer Predigtarbeit oder in einem Examensentwurf<br />
für den gesamten Gottesdienst von der tatsächlichen kreativen Arbeit<br />
zu unterscheiden: Die Darstellungslogik soll konsequent und schlüssig sein,<br />
während die Vorbereitungslogik das assoziative Ineinander der verschiedenen<br />
Reflexionsebenen erfordert.<br />
Die Arbeit an der eigenen Sprache schließlich ist eine lebenslange Aufgabe,<br />
die auch eigene literarische Bildung erfordert. Liturgen und Prediger sind<br />
nicht zuletzt Sprachkünstler, weil sie der Mitteilung und Darstellung des<br />
Evangeliums immer wieder neu Gestalt geben und wöchentlich eigene Texte<br />
zur Aufführung bringen.<br />
§ 49 Rückblick und Ausblick<br />
Literatur: Michael Meyer-Blanck: Inszenierung und Präsenz. Zwei Kategorien des<br />
Studiums Praktischer Theologie, in: WzM 49 (1997), 2–16 ♦ Michael Meyer-<br />
Blanck: Liturgiewissenschaft und Kirche. Eine ökumenische Verhältnisbestimmung<br />
in zehn Thesen, in: ders. (Hg.): Liturgiewissenschaft und Kirche. Ökumenische Perspektiven,<br />
Rheinbach 2003, 111–138 ♦ Michael Meyer-Blanck: Evangelische <strong>Gottesdienstlehre</strong><br />
heute. Ein Überblick, in: ThLZ 133 (2008), 3–20 ♦ Michael Meyer-<br />
Blanck: Der Sonntagsgottesdienst. Elemente einer praktisch-theologischen Theorie<br />
des „Normalfalles“, in: Kristian Fechtner/Lutz Friedrichs (Hg.), Normalfall Sonntagsgottesdienst?<br />
Gottesdienst und Sonntagskultur im Umbruch, Stuttgart 2008, 72–81<br />
544<br />
Leseprobe aus Meyer-Black: <strong>Gottesdienstlehre</strong><br />
(c) 2011 <strong>Mohr</strong> <strong>Siebeck</strong> www.mohr.de