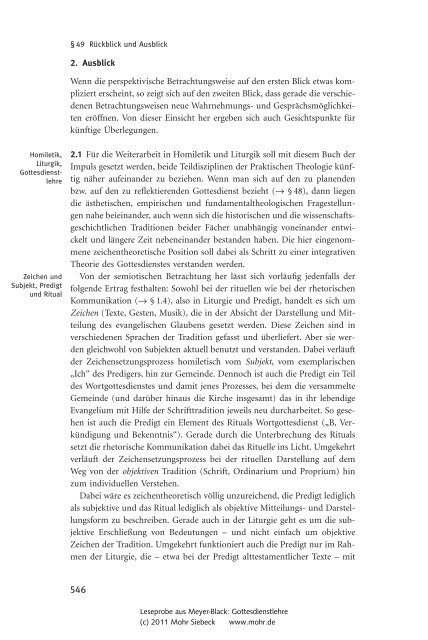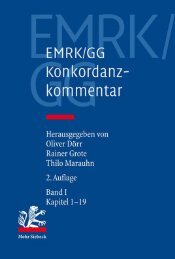Gottesdienstlehre - Mohr Siebeck Verlag
Gottesdienstlehre - Mohr Siebeck Verlag
Gottesdienstlehre - Mohr Siebeck Verlag
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
§ 49 Rückblick und Ausblick<br />
2. Ausblick<br />
Wenn die perspektivische Betrachtungsweise auf den ersten Blick etwas kompliziert<br />
erscheint, so zeigt sich auf den zweiten Blick, dass gerade die verschiedenen<br />
Betrachtungsweisen neue Wahrnehmungs- und Gesprächsmöglichkeiten<br />
eröffnen. Von dieser Einsicht her ergeben sich auch Gesichtspunkte für<br />
künftige Überlegungen.<br />
Homiletik,<br />
Liturgik,<br />
<strong>Gottesdienstlehre</strong><br />
Zeichen und<br />
Subjekt, Predigt<br />
und Ritual<br />
2.1 Für die Weiterarbeit in Homiletik und Liturgik soll mit diesem Buch der<br />
Impuls gesetzt werden, beide Teildisziplinen der Praktischen Theologie künftig<br />
näher aufeinander zu beziehen. Wenn man sich auf den zu planenden<br />
bzw. auf den zu reflektierenden Gottesdienst bezieht (→ § 48), dann liegen<br />
die ästhetischen, empirischen und fundamentaltheologischen Fragestellungen<br />
nahe beieinander, auch wenn sich die historischen und die wissenschaftsgeschichtlichen<br />
Traditionen beider Fächer unabhängig voneinander entwickelt<br />
und längere Zeit nebeneinander bestanden haben. Die hier eingenommene<br />
zeichentheoretische Position soll dabei als Schritt zu einer integrativen<br />
Theorie des Gottesdienstes verstanden werden.<br />
Von der semiotischen Betrachtung her lässt sich vorläufig jedenfalls der<br />
folgende Ertrag festhalten: Sowohl bei der rituellen wie bei der rhetorischen<br />
Kommunikation (→ § 1.4), also in Liturgie und Predigt, handelt es sich um<br />
Zeichen (Texte, Gesten, Musik), die in der Absicht der Darstellung und Mitteilung<br />
des evangelischen Glaubens gesetzt werden. Diese Zeichen sind in<br />
verschiedenen Sprachen der Tradition gefasst und überliefert. Aber sie werden<br />
gleichwohl von Subjekten aktuell benutzt und verstanden. Dabei verläuft<br />
der Zeichensetzungsprozess homiletisch vom Subjekt, vom exemplarischen<br />
„Ich“ des Predigers, hin zur Gemeinde. Dennoch ist auch die Predigt ein Teil<br />
des Wortgottesdienstes und damit jenes Prozesses, bei dem die versammelte<br />
Gemeinde (und darüber hinaus die Kirche insgesamt) das in ihr lebendige<br />
Evangelium mit Hilfe der Schrifttradition jeweils neu durcharbeitet. So gesehen<br />
ist auch die Predigt ein Element des Rituals Wortgottesdienst („B, Verkündigung<br />
und Bekenntnis“). Gerade durch die Unterbrechung des Rituals<br />
setzt die rhetorische Kommunikation dabei das Rituelle ins Licht. Umgekehrt<br />
verläuft der Zeichensetzungsprozess bei der rituellen Darstellung auf dem<br />
Weg von der objektiven Tradition (Schrift, Ordinarium und Proprium) hin<br />
zum individuellen Verstehen.<br />
Dabei wäre es zeichentheoretisch völlig unzureichend, die Predigt lediglich<br />
als subjektive und das Ritual lediglich als objektive Mitteilungs- und Darstellungsform<br />
zu beschreiben. Gerade auch in der Liturgie geht es um die subjektive<br />
Erschließung von Bedeutungen – und nicht einfach um objektive<br />
Zeichen der Tradition. Umgekehrt funktioniert auch die Predigt nur im Rahmen<br />
der Liturgie, die – etwa bei der Predigt alttestamentlicher Texte – mit<br />
546<br />
Leseprobe aus Meyer-Black: <strong>Gottesdienstlehre</strong><br />
(c) 2011 <strong>Mohr</strong> <strong>Siebeck</strong> www.mohr.de