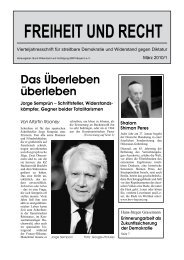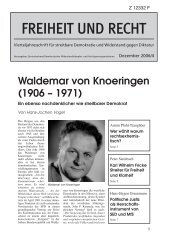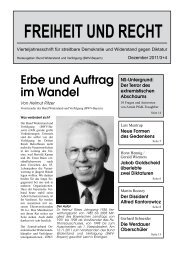FuR 2008-1+2.pdf - Der BWV-Bayern
FuR 2008-1+2.pdf - Der BWV-Bayern
FuR 2008-1+2.pdf - Der BWV-Bayern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Neuerscheinungen<br />
Janbernd Oebbecke/Bodo Pieroth/Emanuel Towfigh<br />
(Hrsg.):<br />
Islam und Verfassungsschutz<br />
Dokumentation der Tagung am 7. Dezember 2006<br />
an der Universität Münster,<br />
Frankfurt/M. 2007 (Peter Lang-Verlag), 157 S., 34 2<br />
Wie diese Übersicht schon veranschaulicht, stehen in<br />
dem Buch einigen abgewogenen Darstellungen kontroverse<br />
Texte gegenüber. Aber gerade das macht mit den<br />
intellektuellen Reiz des Tagungsbandes aus. Besondere<br />
Beachtung inhaltlicher Art verdienen etwa Poschers<br />
Hinweis, wonach Religionsgemeinschaften laut Grundgesetz<br />
keine Pflicht zur Verfassungstreue abverlangt<br />
werden könne, und Puschneraths klare Unterscheidung,<br />
wie sich Islam und Islamismus in der Perspektive des<br />
Verfassungsschutzes differenziert betrachten lassen.<br />
Murswieks Beitrag zu den rechtlichen Anforderungen<br />
an die Verfassungsschutzberichte hätte sicherlich auch<br />
noch eine kritische Entgegnung verdient. Und schließlich<br />
wirkt die Kontroverse zwischen Karahan und Möller<br />
inhaltlich und methodisch überaus reizvoll, stellt sich<br />
hier doch ein prominenter Verfassungsschützer in einer<br />
öffentlichen Kontroverse der Kritik aus einem Beobachtungsobjekt.<br />
Mitunter wirkt der interessante Band etwas<br />
zu juristisch, er erschien aber auch in einer Schriftenreihe<br />
mit dem Titel „Islam und Recht“.<br />
Armin Pfahl-Traughber<br />
Welchen Anforderungen müssen religiöse – insbesondere<br />
muslimische – Organisationen von Verfassungs<br />
wegen genügen? Und: Wie angemessen ist die Beobachtung<br />
islamistischer Organisationen durch den<br />
Verfassungsschutz? Diese beiden Fragen bildeten den<br />
Schwerpunkt einer Fachtagung mit dem Titel „Islam<br />
und Verfassungsschutz“, die im Dezember 2006 von<br />
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität<br />
Münster durchgeführt wurde. Die dort gehaltenen Vorträge<br />
– ergänzt um einige zusätzliche Beiträge – liegen<br />
nun als wissenschaftliche Aufsätze in einem Sammelband<br />
gleichen Titels vor. Herausgegeben haben ihn die<br />
beiden Kommunalwissenschaftler Janbernd Oebbecke<br />
und Emanuel Towfigh sowie der Jurist Bodo Pieroth von<br />
der Universität Münster.<br />
Die acht Beiträge widmen sich unterschiedlichen Themen:<br />
Dem Verhältnis von Religion und Verfassungstreue<br />
geht der Jurist Ralf Poscher nach. Sein Kollege<br />
Kurt Graulich erörtert die verfassungsrechtlichen Anforderungen<br />
an religiöse Organisationen. Das Verständnis<br />
von Islamismus aus Sicht des Verfassungsschutzes stellt<br />
die Historikerin Tania Puschnerath dar. <strong>Der</strong> Jurist Dietrich<br />
Murswiek kritisiert die Verdachtsberichterstattung<br />
in den Verfassungsschutzberichten. Ebenfalls kritisch<br />
zur Nennung der „Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs“<br />
(IGMG) in Verfassungsschutzberichten äußert sich<br />
der IGMG-Funktionär Engin Karahan. Ihm antwortet<br />
der Leiter des Verfassungsschutzes Nordrhein-Westfalen<br />
Hartwig Möller in einer direkten Stellungnahme.<br />
<strong>Der</strong> Philosoph Heiner Bielefeldt kommentiert danach<br />
den politischen Umgang mit dem Islam in Deutschland.<br />
Und schließlich widmet sich der Kulturwissenschaftler<br />
Werner Schiffauer der Berichterstattung über die IGMG<br />
und den „Kalifatsstaat“ in den Verfassungsschutzberichten.<br />
Eckhard Jesse/Hans-Peter Niedermeier (Hrsg.):<br />
Politischer Extremismus und Parteien<br />
Berlin, Duncker&Humblot, 2007<br />
Die Erforschung des politischen Extremismus gehört<br />
mittlerweile zu den etablierten Fachgebieten in der Politikwissenschaft.<br />
Von einem teilweise belächelten Orchideenfach<br />
hat sich die Disziplin zu einem anerkannten und<br />
aus der Forschungslandschaft nicht mehr wegzudenkenden<br />
Gebiet entwickelt. Einen wesentlichen Beitrag hat<br />
dazu Eckhard Jesse geleistet, der fast unermüdlich die<br />
vergleichende Extremismusforschung vorantreibt. Für<br />
die Forschung fruchtbar ist die Minimaldefinition von<br />
politischem Extremismus, die Eckhard Jesse gemeinsam<br />
mit Uwe Backes entwickelt und implementiert hat. Danach<br />
gilt jede politisch Richtung als extremistisch, die<br />
die fundamentalen Werte der freiheitlichen Demokratie<br />
und insbesondere den Pluralismus ablehnt. <strong>Der</strong> Vorteil<br />
dieser Definition ist die Anwendbarkeit auf bekannte<br />
Erscheinungen des politischen Extremismus (wie z. B.<br />
Links- und Rechtsextremismus oder den islamistischen<br />
Fundamentalismus), aber auch auf neue und bislang unbekannte<br />
Akteure, deren Ideologie sich aus unterschiedlichen<br />
extremistischen Versatzstücken zusammensetzt.<br />
Ein Beispiel für die Breite des extremismustheoretischen<br />
Ansatzes kann man jetzt anhand des Bandes „Politischer<br />
Extremismus und Parteien“ ablesen. Gemeinsam mit<br />
Hans-Peter Niedermeier gibt Eckhard Jesse die Arbeitsergebnisse<br />
des gleichlautenden Promotionskolleg<br />
heraus. Die Bilanz und das Themenspektrum des von<br />
der Hanns-Seidel-Stiftung geförderten Vorhabens ist beeindruckend:<br />
24 Autoren befassen sich mit unterschiedlichen<br />
Facetten des aktuellen, aber auch des zeitgeschichtlichen<br />
Extremismus inklusive einiger Aspekten<br />
der SED-Diktatur.<br />
Die Analyse der PDS bildet mit insgesamt sechs Arbeiten<br />
einen Schwerpunkt. Standen in den frühen Studien<br />
zur PDS die Entwicklung der Partei sowie ihre Haltung<br />
zur Demokratie im Vordergrund, so hat sich nun das<br />
Themenspektrum erweitert. Die wirtschaftspolitischen<br />
Positionen werden von drei Autoren (mit)diskutiert<br />
(Tim Peters, Sebastian Prinz und Thomas Schubert).<br />
Tim Peters macht deutlich, dass eine wie auch immer<br />
geartete sozialistische Zentralwirtschaft die mit (entschädigungslosen)<br />
Enteignungen Wirtschaftspolitik betreibt,<br />
mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist, da eine<br />
freiheitliche Wirtschaftsverfassung ihre Entsprechung in<br />
30