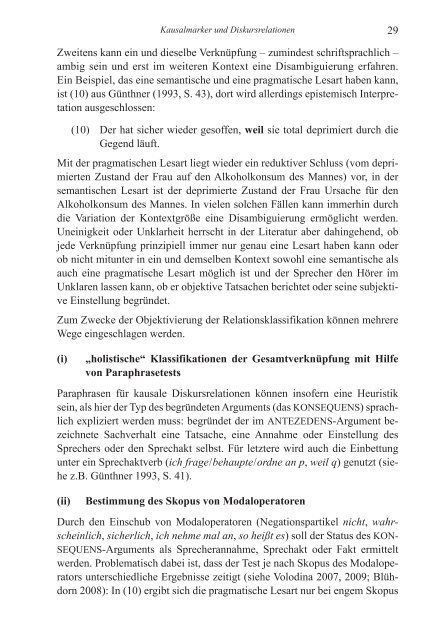Breindl_Walter_Der_Ausdruck_von Kausalität_2009.pdf
Breindl_Walter_Der_Ausdruck_von Kausalität_2009.pdf
Breindl_Walter_Der_Ausdruck_von Kausalität_2009.pdf
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kausalmarker und Diskursrelationen 29<br />
Zweitens kann ein und dieselbe Verknüpfung – zumindest schriftsprachlich –<br />
ambig sein und erst im weiteren Kontext eine Disambiguierung erfahren.<br />
Ein Beispiel, das eine semantische und eine pragmatische Lesart haben kann,<br />
ist (10) aus Günthner (1993, S. 43), dort wird allerdings epistemisch Interpretation<br />
ausgeschlossen:<br />
(10) <strong>Der</strong> hat sicher wieder gesoffen, weil sie total deprimiert durch die<br />
Gegend läuft.<br />
Mit der pragmatischen Lesart liegt wieder ein reduktiver Schluss (vom deprimierten<br />
Zustand der Frau auf den Alkoholkonsum des Mannes) vor, in der<br />
semantischen Lesart ist der deprimierte Zustand der Frau Ursache für den<br />
Alkoholkonsum des Mannes. In vielen solchen Fällen kann immerhin durch<br />
die Variation der Kontextgröße eine Disambiguierung ermöglicht werden.<br />
Uneinigkeit oder Unklarheit herrscht in der Literatur aber dahingehend, ob<br />
jede Verknüpfung prinzipiell immer nur genau eine Lesart haben kann oder<br />
ob nicht mitunter in ein und demselben Kontext sowohl eine semantische als<br />
auch eine pragmatische Lesart möglich ist und der Sprecher den Hörer im<br />
Unklaren lassen kann, ob er objektive Tatsachen berichtet oder seine subjektive<br />
Einstellung begründet.<br />
Zum Zwecke der Objektivierung der Relationsklassifikation können mehrere<br />
Wege eingeschlagen werden.<br />
(i)<br />
„holistische“ Klassifikationen der Gesamtverknüpfung mit Hilfe<br />
<strong>von</strong> Paraphrasetests<br />
Paraphrasen für kausale Diskursrelationen können insofern eine Heuristik<br />
sein, als hier der Typ des begründeten Arguments (das KONSEQUENS) sprachlich<br />
expliziert werden muss: begründet der im ANTEZEDENS-Argument bezeichnete<br />
Sachverhalt eine Tatsache, eine Annahme oder Einstellung des<br />
Sprechers oder den Sprechakt selbst. Für letztere wird auch die Einbettung<br />
unter ein Sprechaktverb (ich frage / behaupte / ordne an p, weil q) genutzt (siehe<br />
z.B. Günthner 1993, S. 41).<br />
(ii)<br />
Bestimmung des Skopus <strong>von</strong> Modaloperatoren<br />
Durch den Einschub <strong>von</strong> Modaloperatoren (Negationspartikel nicht, wahrscheinlich,<br />
sicherlich, ich nehme mal an, so heißt es) soll der Status des KON-<br />
SEQUENS-Arguments als Sprecherannahme, Sprechakt oder Fakt ermittelt<br />
werden. Problematisch dabei ist, dass der Test je nach Skopus des Modaloperators<br />
unterschiedliche Ergebnisse zeitigt (siehe Volodina 2007, 2009; Blühdorn<br />
2008): In (10) ergibt sich die pragmatische Lesart nur bei engem Skopus