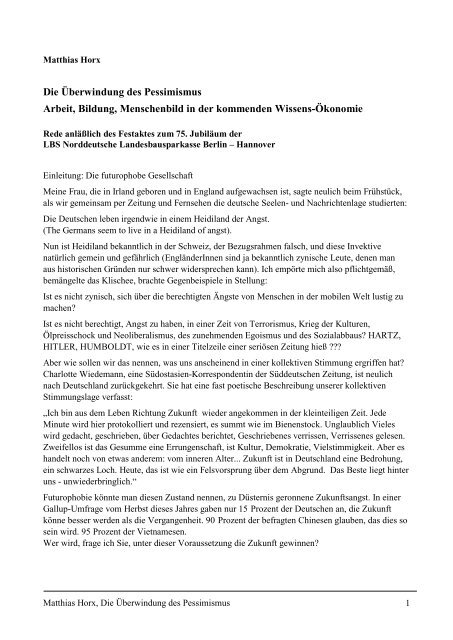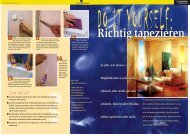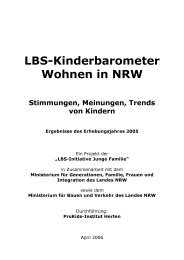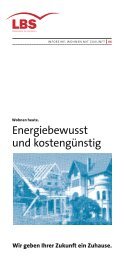Die Überwindung des Pessimismus Arbeit, Bildung ... - LBS
Die Überwindung des Pessimismus Arbeit, Bildung ... - LBS
Die Überwindung des Pessimismus Arbeit, Bildung ... - LBS
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Matthias Horx<br />
<strong>Die</strong> <strong>Überwindung</strong> <strong>des</strong> <strong>Pessimismus</strong><br />
<strong>Arbeit</strong>, <strong>Bildung</strong>, Menschenbild in der kommenden Wissens-Ökonomie<br />
Rede anläßlich <strong>des</strong> Festaktes zum 75. Jubiläum der<br />
<strong>LBS</strong> Norddeutsche Lan<strong>des</strong>bausparkasse Berlin – Hannover<br />
Einleitung: <strong>Die</strong> futurophobe Gesellschaft<br />
Meine Frau, die in Irland geboren und in England aufgewachsen ist, sagte neulich beim Frühstück,<br />
als wir gemeinsam per Zeitung und Fernsehen die deutsche Seelen- und Nachrichtenlage studierten:<br />
<strong>Die</strong> Deutschen leben irgendwie in einem Heidiland der Angst.<br />
(The Germans seem to live in a Heidiland of angst).<br />
Nun ist Heidiland bekanntlich in der Schweiz, der Bezugsrahmen falsch, und diese Invektive<br />
natürlich gemein und gefährlich (EngländerInnen sind ja bekanntlich zynische Leute, denen man<br />
aus historischen Gründen nur schwer widersprechen kann). Ich empörte mich also pflichtgemäß,<br />
bemängelte das Klischee, brachte Gegenbeispiele in Stellung:<br />
Ist es nicht zynisch, sich über die berechtigten Ängste von Menschen in der mobilen Welt lustig zu<br />
machen?<br />
Ist es nicht berechtigt, Angst zu haben, in einer Zeit von Terrorismus, Krieg der Kulturen,<br />
Ölpreisschock und Neoliberalismus, <strong>des</strong> zunehmenden Egoismus und <strong>des</strong> Sozialabbaus? HARTZ,<br />
HITLER, HUMBOLDT, wie es in einer Titelzeile einer seriösen Zeitung hieß ???<br />
Aber wie sollen wir das nennen, was uns anscheinend in einer kollektiven Stimmung ergriffen hat?<br />
Charlotte Wiedemann, eine Südostasien-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung, ist neulich<br />
nach Deutschland zurückgekehrt. Sie hat eine fast poetische Beschreibung unserer kollektiven<br />
Stimmungslage verfasst:<br />
„Ich bin aus dem Leben Richtung Zukunft wieder angekommen in der kleinteiligen Zeit. Jede<br />
Minute wird hier protokolliert und rezensiert, es summt wie im Bienenstock. Unglaublich Vieles<br />
wird gedacht, geschrieben, über Gedachtes berichtet, Geschriebenes verrissen, Verrissenes gelesen.<br />
Zweifellos ist das Gesumme eine Errungenschaft, ist Kultur, Demokratie, Vielstimmigkeit. Aber es<br />
handelt noch von etwas anderem: vom inneren Alter... Zukunft ist in Deutschland eine Bedrohung,<br />
ein schwarzes Loch. Heute, das ist wie ein Felsvorsprung über dem Abgrund. Das Beste liegt hinter<br />
uns - unwiederbringlich.“<br />
Futurophobie könnte man diesen Zustand nennen, zu Düsternis geronnene Zukunftsangst. In einer<br />
Gallup-Umfrage vom Herbst dieses Jahres gaben nur 15 Prozent der Deutschen an, die Zukunft<br />
könne besser werden als die Vergangenheit. 90 Prozent der befragten Chinesen glauben, das dies so<br />
sein wird. 95 Prozent der Vietnamesen.<br />
Wer wird, frage ich Sie, unter dieser Voraussetzung die Zukunft gewinnen?<br />
Matthias Horx, <strong>Die</strong> <strong>Überwindung</strong> <strong>des</strong> <strong>Pessimismus</strong> 1
Folgende Elemente führen zu diesem Syndrom<br />
Erstens: die erlernte Hilflosigkeit stammt aus einer fünzigjährigen Erfahrung der Klage, die immer<br />
zu Subventionen führte. Sie ist antrainiert und als solche eine natürliche Reaktion auf die<br />
Verhältnisse.<br />
Zweitens: die kulturpessimistischen Eliten, die uns seit vielen Jahren begleiten. <strong>Die</strong> Intellektuellen<br />
<strong>des</strong> Schuldvorwurfs. <strong>Die</strong> Zukunftsforscher der Vergangenheit, die mit den dunklen Augenbrauen,<br />
die uns anstarrten und sagten: Es wird übel enden – und ihr seid schuld. „Wir haben unsere Angst<br />
zu erweitern“, schrieb Günther Anders 1957. „Habe keine Angst vor der Angst, habe Mut zur<br />
Angst. Ängstige Deinen Nachbarn wie dich selbst!“<br />
Drittens: die Medien, die in ständiger Überkonkurrenz auf dem Aufmerksamkeitsmarkt ums<br />
Überleben kämpfen. Und was errregte Aufmerksamkeit besser als Angst? Was lässt sich besser in<br />
endlosen Fearshows inszenieren als die Steigerung der Befürchtung in immer neuen Kaskaden<br />
wortreicher Ratlosigkeit? Denken Sie an Sabine Christiansens Talkshow, die die bösartige ‚Zeit‘<br />
einmal als ‚Altherrenblähung am Sonntagabend‘ titulierte.<br />
Viertens die tiefen Traumata der Deutschen Geschichte. Wir haben keine Tradition im Verändern,<br />
umso mehr eine dunkle Geschichte <strong>des</strong> gewaltsamen Verändert-Werdens. Unsere Idealismen – oder<br />
vielmehr die unsere Väter und Großväter – sind missbraucht worden.<br />
Fünftens mangelt es uns an dem, was Menschen brauchen, um sich bewegen und wandeln zu<br />
können. Einem kohärenten, stimmigen Zukunftsbild. Einer Vision einer zukünftigen Gesellschaft.<br />
Bevor wir jetzt ganz Deutschland via Trinkwasser unter solide Antidepressiva setzen – manche<br />
Pharmafirmen werden sicher davon träumen - können wir vielleicht eine Verbesserung <strong>des</strong><br />
Patienten bewirken, indem wir uns offensiv mit Wandel beschäftigen. Mit den Megatrends, die<br />
unsere Welt in großen historischen Zyklen nicht nur zum Schlechteren verändern.<br />
Megatrends müssen in der Logik der Zukunftsforschung min<strong>des</strong>tens drei Bedingungen erfüllen:<br />
Sie müssen eine Halbwertzeit von min<strong>des</strong>tens 25 Jahren, also epochalen Charakter haben.<br />
Sie müssen „ubiquitär“ sein, lateinisch für „überall vorkommend“. Das heißt: Man muss ihre<br />
Wirkungen in allen menschlichen Bereichen, vom Konsum über die Politik bis ins Private spüren.<br />
Sie müssen im Kern globalen Charakter haben. Auch wenn sie nicht überall auf unserem Planeten<br />
bereits in voller Blüte stehen.<br />
Megatrend Globalisierung<br />
<strong>Die</strong> Menschheit ist vor 100.000 Jahren in Afrika aufgebrochen, um den Planeten zu erwandern.<br />
Kolumbus, Vasco da Gama –waren das nicht alles Globalisierer? Unstrittig ist jedoch, dass dieser<br />
Prozess erst seit dem weltweiten Flugverkehr und der Entwicklung von Echtzeit-Märkten durch<br />
Computernetze seine volle Dynamik entfaltete.<br />
Globalisierung verändert alles:<br />
Unsere Produktionsweisen, die sich nun in neuen <strong>Arbeit</strong>steilungen quer über den Planeten<br />
organisieren.<br />
Matthias Horx, <strong>Die</strong> <strong>Überwindung</strong> <strong>des</strong> <strong>Pessimismus</strong> 2
<strong>Die</strong> Art und Weise, wie wir Politik im Nationalstaat gestalten oder eben nicht mehr alleinig<br />
gestalten können.<br />
Globalisierung bringt uns – das ist ihre Habenseite – aber auch jenen Reichtum, jene Vielfalt , in der<br />
Kultur wirklich spannend, weltumspannend wird. Wollen wir wirklich wieder nur Bratwurst und<br />
Blasmusik? Nun essen wir genüsslich Thailändische Lukullitäten und trinken chilenischen Wein,<br />
während wir in typisch deutscher Manier über die Globalisierungsfalle lamentieren .<br />
Während die Menschen in der Zivilisation fortschreiten, und kleine Stämme in größere Einheiten<br />
verschmelzen, sagt ihnen die Vernunft, dass sie ihre sozialen Instinkte und Sympathien auf alle<br />
Menschen ausdehnen sollten, selbst wenn sie persönlich nicht mit ihnen bekannt sind.<br />
Von wem stammt dieses Zitat? Es stammt ausgerechnet vom Entdecker <strong>des</strong> knallharten Prinzips<br />
Auslese und Anpassung. Von Charles Darwin. Survival of the Fittest – das heißt eben nicht Sieg der<br />
Stärksten, Mächtigsten. Wer fit ist im Globalen Zeitalter, kann zwischen dem Verschiedenen<br />
vermitteln. Er übt sich in Moderation von Vielfalt – das ist in der globalen Ära eine wichtige<br />
Ressource von Wachstum und Kraft.<br />
Glokalisierung: Lokal plus Global = GLOKAL<br />
Muss Globalisierung zu einem kulturellen Einheitsbrei führen, in dem wir von Shanghai bis zum<br />
Nordkap immer in derselben Boutique einkaufen? Wir glauben, dass Globalisierung sich zur<br />
Glokalisierung weiter entwickelt – Lokal plus Global gleich GLOKAL!<br />
In der Sprachbildung könnte Glokalisierung darin bestehen, dass wir Dialekt und Englisch sprechen<br />
– und auf das Hochdeutsch verzichten.<br />
Im neuen Europa werden die Regionen die entscheidende Rolle spielen, nicht mehr die alten<br />
Nationalstaaten <strong>des</strong> Industriezeitalters. . 1<br />
In der Konsumkultur hat sich gezeigt, dass reine Weltprodukte gescheitert sind. Das Weltauto von<br />
Ford war ein Flop. Deshalb experimentiert McDonalds mit regionaler Küche, bringt Dönerburger<br />
oder Marillenknödel. Coca Cola stößt, als Monoprodukt auf kulturelle Grenzen. In Rußland wird<br />
Coca Cola die Fähigkeit zugesprochen, Falten zu glätten. In Haiti wird Coke in Voodoo-<br />
Zeremonien eingesetzt, um Tote wieder zum Leben zu erwecken. <strong>Die</strong> taiwanesische Übersetzung<br />
<strong>des</strong> Pepsi-Slogans „Come alive with the Pepsi-Generation” lautet „Pepsi erweckt ihre Vorfahren<br />
wieder zum Leben”. i<br />
In Österreich geht man bei niedrigem Blutdruck zum Arzt, Engländer halten das für Humbug. Das<br />
berühmteste Beispiel globalisierter Trivialkultur, Dallas, zeigt, wie radikal verschieden Rezeptionen<br />
sein können. Algerier finden in „Dallas“ die Bestätigung der Bedeutung der Großfamilie. <strong>Die</strong><br />
immigrierten Russen sahen Dallas mit Verachtung über die mangelnde Familien-Kultur der<br />
1 Das Markforschungsinstitut INRA in einer Studie 1998: Ein heimatgeschichtlicher Rückblick über die letzten 10<br />
Jahre scheint einen Trend weg vom Nationalen, vom Bun<strong>des</strong>staatlichen, hin zur kleinen Heimat der Region zu<br />
belegen. 41 Prozent der Deutschen assoziieren mit Heimat das Dorf oder die Stadt, vor zehn Jahren waren es erst 25<br />
Prozent, 23 Prozent geben die Region an, früher 18%.<br />
Matthias Horx, <strong>Die</strong> <strong>Überwindung</strong> <strong>des</strong> <strong>Pessimismus</strong> 3
Amerikaner. <strong>Die</strong> Deutschen empfanden gleichzeitig tiefe Verbundenheit mit Miss Ellie, die als<br />
tugendhafte Mutter den Umtrieben ihres Sohnes Grenzen setzt. <strong>Die</strong> Japaner langweilten sich nur,<br />
und Dallas musste nach 6 Monaten abgesetzt werden.<br />
Megatrend Asien<br />
Ein typischer Megatrend, denn er verfügt über beide Dimensionen – sowohl die kulturelle wie die<br />
ökonomische. China wird spätestens im Jahre 2030 die größte Wirtschaftsmacht der Erde sein. In<br />
Indien gibt es im Jahre 2010 150 Millionen Mittelstandshaushalte mit Fernsehern, Kühlschränken<br />
und Couchgarnituren.<br />
Welche Einflüsse hat unsere Alltagskultur in den letzten Jahren adaptiert? Pokemon und Mangas<br />
bei den Kindern. Zen-Architektur, asiatisches Essen. An jedem zweiten Neubau hängt heute der<br />
Name <strong>des</strong> Feng-Shui-Beraters. Der kulturelle Wind hat sich längst gedreht. Er weht nicht mehr aus<br />
Westen, sondern aus OSTEN!<br />
Und das gilt nicht zuletzt für die Medizin, die ja nun Ayurveda, Akupunktur und chinesische<br />
Heilkunde in großem Ausmaß importiert!<br />
Der Megatrend Frauen<br />
<strong>Die</strong> Kraft dieses Megatrends beruht nicht auf emanzipatorischen Gerüchten oder Meinungen.<br />
Sondern auf einer knallharten Umverteilung. Umverteilt wird, weitgehend unbemerkt von den<br />
Männern, die Kernressource der kommenden Ökonomie: <strong>Die</strong> <strong>Bildung</strong>.<br />
Der einflussreiche Neurologe Möbius schrieb in Berlin 1902, die Frau sei aufgrund ihrer geringen<br />
Hirnmasse zu geistiger Leistung nicht in der Lage. Am 16. Mai 1904 erließ der württembergische<br />
König als einer der ersten ein Dekret, nach der Frauen sich an der Universität überhaupt<br />
immatrikulieren konnten. 1910 betrug der Frauenanteil an den deutschen Universitäten 3 Prozent.<br />
Vor allem in den letzten 30 Jahren hat sich in fast allen OECD-Ländern eine atemberaubende<br />
weibliche <strong>Bildung</strong>srevolution entwickelt. Der Anteil der Abiturientinnen stieg auf heute etwa 55<br />
Prozent aller Abitur-Klassen. In derselben Zeit stieg der Anteil der weiblichen Studierenden von 19<br />
auf 48 Prozent, wobei in den Jahren 2000 bis 2002 die Anzahl der weiblichen Studienanfängerinnen<br />
die der männlichen zum ersten Mal überstieg.<br />
In fast allen spätindustriellen Ländern und in vielen Schwellenländern gilt seit etwa dem Jahr 2000:<br />
<strong>Die</strong> Mädels sind schlauer und gebildeter als die Jungs! Glauben wir wirklich, dass das ohne<br />
Konsequenzen bleiben wird? Hinter jedem erfolgreichen Manne steht eine Frau, die ihm den<br />
Rücken freihält. So einfach, meine Herren, wird es nicht mehr werden. In der Gesellschaft der<br />
Zukunft werden Frauen und Männer sich ganz anders vermitteln und verhandeln müssen.<br />
Beide haben nun Lust und Anspruch auf ein Berufsleben. Beide kämpfen mit dem Problem der<br />
Work-Life-Balance, der Balance zwischen der Karriere und der Familie.<br />
Das ist anstrengend. Das ist schwierig. Das können wir vielleicht – noch - auf unsere Kinder<br />
abschieben. Aber es ist auch spannend! Und die Alternative dazu ist letzten<strong>des</strong> eine zynische<br />
emotionale Haltung gegenüber dem anderen Geschlecht, die inzwischen sehr sehr verbreitet ist.<br />
Männer gehen wieder Saufen und zum Fußballspielen, Frauen ziehen sich in ihre Frauennetzwerke<br />
Matthias Horx, <strong>Die</strong> <strong>Überwindung</strong> <strong>des</strong> <strong>Pessimismus</strong> 4
zurück. Man verkehrt miteinander über Anwälte oder aus der sicheren Distanz der Single-Haushalte<br />
heraus.<br />
Irgendwann führt das dann zu einer Haltung <strong>des</strong> pseudofeministischen Rassismus, wie sie sich in<br />
einer Titelgeschichte <strong>des</strong> SPIEGEL im letzten Jahr offenbart. Dort hieß es:<br />
Eine Krankheit namens Mann – Als Fötus sind sie empfindlicher, in der Schule scheitern sie,<br />
häufiger sie neigen zu Gewalt und Kriminalität, und sie sterben früher: Sind Männer die<br />
Mängelwesen der Natur? Nun offenbaren auch noch die Biologen: Das Y-Chromosom ist ein<br />
Krüppel, der Mann dem Untergang geweiht (in 200.000 Jahren).<br />
<strong>Die</strong> Silberne Revolution<br />
Nein, ich möchte nicht von Vergreisung, Rentenkatastrophe, Krieg der Generationen sprechen. Ich<br />
möchte nicht jenen Ton anschlagen, den Frank Schirrmacher, FAZ, in seinem Buch ‚Das<br />
Methusalem Komplott‘ wählt, obwohl er auf etwas Richtiges hinweist:<br />
...Unsere Gesellschaft wird die Alterung als einen Schock erleben, der mit dem der Weltkriege<br />
vergleichbar ist. ... <strong>Die</strong> Menschheit altert in unvorstellbarem Ausmaß. Wir müssen das Problem<br />
unseres Alterns lösen, um das Problem der Welt zu lösen. <strong>Die</strong> große Mobilmachung hat begonnen.<br />
Am Horizont baut sich eine erbitterte Streitmacht gegen die Alten auf... Das Euthanasische Zeitalter<br />
beginnt...<br />
Das ist die Sprache <strong>des</strong> Krieges. <strong>Die</strong> Sprache der Welt-Erlösung. Der Mobilmachung gegen einen<br />
imaginären Feind, den wir auf diese Weise vielleicht erst aufbauen.<br />
Vielleicht sollten wir die Fragen anders stellen:<br />
Wer sagt denn, wie alt eine Gesellschaft sein kann, darf, muss?<br />
Muss eine jugendliche Kultur immer frisch, lebendig, klug agieren – man denke an die islamischen<br />
Länder!<br />
Sind ältere Herrschaften in der Politik von Übel – man denke an Adenauer, Churchill...<br />
Sind Ältere immer unkreativ, reaktionär, lustfeindlich – Wie war das mit Picasso? (Immendorf ist<br />
immerhin auch schon 64)...<br />
Hippokrates von Kos, der Begründer der Medizin, wurde 56 Jahre alt und war der Überzeugung,<br />
dass mit 42 Jahren „die Lebenssäfte aus den Menschen wichen“. <strong>Die</strong> durchschnittliche<br />
Lebenserwartung Europas lag vor 100 Jahren bei 43 Jahren, sie wird im Lauf <strong>des</strong> 21. Jahrhunderts<br />
auf 82 Jahre im Jahre 2020 und 85 bis 90 Jahre im Jahre 2050 steigen. In allen Ländern der Erde,<br />
mit Ausnahme einiger GUS-Länder und der Bürgerkriegsgebiete Afrikas, erweitert sich die<br />
menschliche Lebensspanne im statistischen Durchschnitt um 6 bis 7 Wochen pro Jahr!<br />
Wir alle haben sofort die Bilder <strong>des</strong> Siechtums im Kopf, die unsere visuellen Medien prägen:<br />
Menschen am Stock, Hilfsbedürftig, allein. Palliativmedizin fällt uns ein. Aber wer dauerhaft<br />
bettlägerig wird, hat noch eine mittlere Lebensdauer von sechs Monaten – alt werden können wir<br />
nur in Bewegung.<br />
<strong>Die</strong>s erfordert in der Tat eine Entscheidung. Eine alternde Gesellschaft braucht in weitesten Sinne<br />
eine Mobilisierung. Und eben nicht nur bei den Älteren!<br />
Matthias Horx, <strong>Die</strong> <strong>Überwindung</strong> <strong>des</strong> <strong>Pessimismus</strong> 5
Sie braucht andere <strong>Arbeit</strong>sbilder, in der wir die industrielle Betrachtensweise vom „Alten Eisen“ in<br />
Rente gehen lassen! Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr – das heißt nur, dass<br />
Hänschen keinen blassen Schimmer hat! In Island arbeiten die Menschen im Schnitt bis 67 1/2<br />
Jahre, 90 Prozent aller Männer zwischen 56 und 65 sind berufstätig – in Deutschland gerade einmal<br />
35 Prozent. Müssen alle Isländer bis ins hohe Alter Fronarbeit leisten? Nein, es heißt, dass<br />
Erwerbsarbeit in der Wissensökonomie Teil unserer Selbstverwirklichung bis ins hohe Alter sein<br />
kann. Wenn wir sie richtig organisieren.<br />
Sie braucht andere Körperbilder. <strong>Die</strong> Frage, ob wir aktiv und gesund altern oder siech und krank,<br />
wird nicht mit 60 entschieden, sondern mit 40. Oder eigentlich schon mit 20! Oder noch früher !<br />
1990 waren 1.7 Millionen Menschen in Deutschland Mitglieder in Fitness-Studios. Im Jahre 2003<br />
waren es fünf Millionen. 1990 betrieben etwa 1 Million Deutsche den Laufsport. Heute sind es über<br />
10 Millionen.<br />
Wir brauchen vor allem andere biographische Bilder. Simone de Beauvoir schrieb im Jahr 1970<br />
prophetisch:<br />
In der idealen Gesellschaft würde, so kann man hoffen, das Alter gar nicht mehr existieren. Der<br />
Mensch würde, wie es bei manchen Privilegierten vorkommt, nur unauffällig geschwächt, aber<br />
nicht offenkundig vermindert; er stürbe irgendwann an einer Krankheit, ohne eine Herabwürdigung<br />
erfahren zu haben. Das letzte Lebensalter entspräche dann einer Existenzphase, die sich von Jugend<br />
und Erwachsensein unterscheidet, aber ihr eigenes Gleichgewicht und ihre eigene Hoffnung besitzt.<br />
Wir sind noch weit von dieser Utopie entfernt. Aber wir sind ihr ein kräftiges Stück näher<br />
gekommen. Je älter man wird, <strong>des</strong>to ähnlicher wird man sich selbst, sagte einmal Maurice<br />
Chevalier. Radikaler könnte man formulieren: Nur wer wirklich Alt wird, hat die Chance, sich<br />
wirklich kennen zu lernen.<br />
Kindererziehung zum Beispiel wird in verlängerten Lebenshorizonten von einer Lebensaufgabe zu<br />
einer - womöglich erfüllteren – Phase <strong>des</strong> Lebens. Wir lernen, Kinder auch wieder loszulassen.<br />
Beruflicher Wechsel, Multi-Karrieren, auch die Erfahrung mehrerer Wohnorte und (sagen wir es<br />
offen!): Partnerschaften – all das lässt sich – mit all den Korrekturen und Selbsthinterfragungen, die<br />
damit verbunden sind - sinnvoll nur in langen Lebensspannen verwirklichen.<br />
Das, meine Damen und Herren, ist einer der faszinierendsten zivilisatorischsten Prozesse unserer<br />
Zeit. Der Horizont <strong>des</strong> Lebens weitet sich. <strong>Die</strong> Langlebigkeits-Gesellschaft wäre, kulturell<br />
adaptiert, eine Kultur der Achtsamkeit, in der wir reife Individualität, Selbstentwicklung, vielleicht<br />
sogar Weisheit als Lebensziel in einer ganz anderen Weise leben könnten als in der alten,<br />
kurzlebigeren Industriekultur.<br />
Wie kann die Bau- und Finanzierungsbranche auf diese Phänomene reagieren? Denn das ist ja über<br />
weite Strecken ein gesellschaftliches Paradox!<br />
Wir sind in der Spannung zwischen einer zunehmnden Mobilisierung unseres Lebens, für die wir<br />
andere Sozialtechniken benötigen.<br />
Navigieren. Auch gegen den Wind kreuzen.<br />
Scheitern Lernen. Schöner Scheitern.<br />
Matthias Horx, <strong>Die</strong> <strong>Überwindung</strong> <strong>des</strong> <strong>Pessimismus</strong> 6
Dem steht das Hausbauen als eine Sehnsucht nach Cocooning, nach Geborgenheit, Sesshaftigkeit,<br />
Bleiben gegenüber. Aber mit diesem Niederlassen in die eigene Höhle ist auch Immobilität<br />
verbunden.<br />
Wie kann man diese Widersprüche auflösen?<br />
Nein, nicht so sehr, indem man hochspezialisierte Bauformen anbietet, Häuser für ausgefuchste<br />
Individualisten. Denn der nächste Individualist wird den Boden aus kenianischer Zeder, den der<br />
Vorkäufer so schick fand, plötzlich als geschmacklos empfinden. Und ihn wieder herausreissen.<br />
Offene „beschreibbare“ Architekturen, ein reichhaltiges Angebot in allen Wohngrössen und<br />
Formen, und vor allem: Preiswertere Bauformen, die nicht ein Lebensvermögen in eine Immobilie<br />
fixieren, die dann niemals wieder verlassen werden können.<br />
Bunkerbau gehört der Vergangenheit an. Und ebenfalls Bunker-Finanzierung: Konvergenz bei<br />
Finanzierungen ist angesagt! Warum kann man eine Baufinanzierung nicht in eine Rente<br />
umwandeln? Und umgekehrt. <strong>Die</strong> Herausforderung für die Finanzierungsbranche ist es, die<br />
Flexibilisierung der Lebenslagen nachzuvollziehen, in Produkten abzubilden, in anderen<br />
Menschenbildern zu begründen, in denen der Einzelne ein Portfolio hat, ein Talent, ein<br />
Humankapital. Und eben kein festes Gehalt mehr.<br />
Menschen in der Modernen Gesellschaft haben eine grosse Ambivalenz gegenüber ihren<br />
Lebensentscheidungen. So flüchten viele Städter aufs Land. Dort aber fühlen sie sich irgendwann<br />
gelangweilt, isoliert. Wir sehnen uns, gerade wenn wir älter werden, nach dem Urbanen, den<br />
kulturellen <strong>Die</strong>nstleistungen, Wir wollen soziale Dichte. Aber bieten uns das die deutschen Städte?<br />
Können wir nicht weiterkommen in einem neuen Begriff von Urbanität, der Individualität und<br />
Vernetzung verbindet, Kultur mit Lebensqualität verbindet?<br />
<strong>Die</strong> Vision der Wissensgesellschaft<br />
Setzen wir nun die Teile <strong>des</strong> Puzzles neu zusammen. Fünf Elemente sind die Bedingungen einer<br />
Ökonomie <strong>des</strong> Wissens:<br />
1.<br />
Ein ständiger dynamischer Wissens- und Kompetenzzuwachs der gesamten Bevölkerung. Auch der<br />
unteren Schichten.<br />
In Neuseeland haben 64% der Jüngeren einen Hochschulabschluß! In Finnland nahezu 90 Prozent<br />
der Jüngeren ein Abitur! Jetzt kann man sagen, dass dies alles zweitklassige Studien sind. In der Tat<br />
wird man in Neuseeland wenige philosophierende Taxifahrer finden, die mit 31 von der Alma<br />
Mater direkt in die partielle <strong>Arbeit</strong>slosigkeit abdriften. Hochschulabsolventen sind mit 24 Jahren<br />
meistens im Beruf und gehen dann mit 40 wieder auf eine Hochschule. <strong>Die</strong>ser dynamische<br />
<strong>Bildung</strong>sbegriff hat sich in den meisten postindustriellen Ländern durchgesetzt. Kanada hat 50%,<br />
die USA fast ebensoviel, Irland, Japan und Finnland knapp unter 50% Hochschulabsolventen. In<br />
Südkorea, Taiwan, Singapur, ist der <strong>Bildung</strong>sgrad der Bevölkerung heute breiter und höher als in<br />
Zentraleuropa. Indien bildet trotz bildungsfeindlichem Kastensystem jährlich 100.000<br />
Programmierer aus – 25 Prozent der Unternehmen im Silicon Valley gehören heute indischen<br />
Unternehmern.<br />
Matthias Horx, <strong>Die</strong> <strong>Überwindung</strong> <strong>des</strong> <strong>Pessimismus</strong> 7
Noch immer wird in unseren Schulen und Universitäten im Grunde industrielles Fertigungs-Lernen<br />
praktiziert: Ein Lehrer, ein Stoff, dreißig Schüler, eine frontale Lern-Situation mit wachsenden<br />
Motorik- und Disziplin-Schwierigkeiten. Dabei geht es um ganz andere soft scills: Um<br />
Selbstwissen, Selbstlernen. <strong>Die</strong> Fähigkeit zum Eigenen, zur Kooperation und Kommunikation.<br />
2.<br />
Ständige Weiterentwicklung von <strong>Die</strong>nstleistungsressourcen. Das Zentrum der Wertschöpfung<br />
verlagert sich dabei von einfachen Services in immer komplexere <strong>Die</strong>nstleistungen, von Urlaub zu<br />
Wellness, von Produzieren zum Providen, vom <strong>Die</strong>nen zum Coachen. Produktion wird nicht<br />
abgeschaftt, sondern verdienstleistet. Und gerade im Wohnen ist diese Frage entscheidend:<br />
Servicewohnen ist, in der unruhigen und anstrengenden <strong>Arbeit</strong>s- und Lebenswelt, in der Männer<br />
und Frauen arbeiten, die entscheidende Entwicklung.<br />
3.<br />
Eine kontinuierlich steigende Produktivität in allen Sektoren der Wirtschaft. Eine Produktivitätssteigerung<br />
von 2,5 Prozent pro Jahre, die die US-Wirtschaft über längere Strecken realisiert (und<br />
von der wir in Zentraleuropa weit entfernt sind) verdoppelt den Wohlstand alle 24 Jahre. Bei 1,4<br />
Prozent dauert dieser Prozess 50 Jahre.<br />
4.<br />
Aktivierende Sozialsysteme und, dahinterliegend, ein Gesellschaftskontrakt, in dem nicht mehr der<br />
Staat alle menschlichen Verhältnisse dominiert. Nein, nicht Rückzug <strong>des</strong> Staates ist hier gemeint,<br />
sondern seine intelligente Neupositionierung.<br />
5.<br />
Ein neues Menschenbild <strong>des</strong> „Empowerment“. <strong>Die</strong>ses Menschenbild geht von der Annahme aus,<br />
dass nicht nur eine kleine Elite von Menschen zu Selbst- und Eigenständigkeit fähig ist. Dass nicht<br />
nur (lebenslange) Sicherheiten, sondern auch Freiheiten, Aufbrüche, Wachstums- und Emanzipationsprozesse<br />
in unseren Lebensplänen eine wichtige Rolle spielen.<br />
Wer genau hinschaut, sieht, das diese Elemente auf verblüffende Weise ineinander greifen. Er<br />
versteht aber auch, weshalb eine derart heillose Verwirrung in der politischen Debatte herrscht. Das<br />
Projekt der Wissensökonomie ist keine Frage von Links oder Rechts. Für einige dieser Elemente<br />
brauchen wir starke Interventionen <strong>des</strong> Staates. Andere lassen sich nur auf einer kulturellen Ebene<br />
lösen. Wieder andere kombinieren gesellschaftliche und staatliche Elemente. Wie immer in der<br />
Evolution geht es um geschickte Re-Kombination. Um höhere Intelligenz unserer Systeme.<br />
Lohnte es sich nicht, für ein solches Gesellschaftsmodell einzutreten und sich zu engagieren?<br />
Irgendwann habe ich dann verstanden, was meine Frau in ihrem gediegenen englischen Zynismus<br />
meinte. Heidiland der Angst, das meint, dass wir Ängste in falscher Weise professionalisieren, sie<br />
Ideologisieren, Kultivieren, Inszenieren.<br />
Heidiland der Angst heißt aber auch, dass wir aufhören können, das Spiel mitzuspielen. Wir können<br />
aus dem Schlangestehen an der Kasse der Angst-Lobbyisten aussteigen. Und sei es mit Humor und<br />
Ironie!<br />
Matthias Horx, <strong>Die</strong> <strong>Überwindung</strong> <strong>des</strong> <strong>Pessimismus</strong> 8
The Pessimist is the man who believes things couldn´t possibly be worse.<br />
To which the optimist replies: Oh Yes, they could!<br />
Sagte Vladimir Bukovsky.<br />
Nehmen wir also Abschied vom Alm-Öhi, der ganz sicher zu wissen glaubt, dass früher alles immer<br />
besser war. Sagen wir Frau Rottensteiner Adieu, mit ihrem stechenden Blick der Strafung für je<strong>des</strong><br />
kleine Vergnügen. Verabschieden wir uns auch vom Ziegenpeter mit seinem hektischen<br />
Naturgehabe und seinem linkischen Betroffenheitsgetue.<br />
Wir befinden uns nicht in einer Endzeit, sondern in einem Übergang. <strong>Die</strong> Wissensgesellschaft, die<br />
nun als faszinieren<strong>des</strong> Versprechen vor uns liegt, ist die nächste Stufe <strong>des</strong> zivilisatorischen<br />
Abenteuers, die nach der tribalen, der agrarischen, der industriellen Welt auf uns wartet.<br />
Lassen Sie mich mit der Parabel von den Kühen schließen, die uns den Weg in die Zukunft<br />
der Ökonomie weisen.<br />
Pur kapitalistische Ökonomie:<br />
Sie besitzen zwei Kühe. Sie verkaufen eine und kaufen eine Bullen, um eine Herde zu züchten.<br />
Christdemokratische Ökonomie:<br />
Sie besitzen zwei Kühe. Ihr Nachbar besitzt keine. Sie behalten eine und schenken ihrem armen<br />
Nachbarn die andere. Danach bereuen Sie es.<br />
Sozialdemokratische Ökonomie:<br />
Sie besitzen zwei Kühe. Sie wählen Leute in die Regierung, die ihre Kühe besteuern. Das zwingt<br />
sie, eine Kuh zu verkaufen, um die Steuern bezahlen zu können. <strong>Die</strong> Leute, die Sie gewählt haben,<br />
nehmen dieses Geld, kaufen eine Kuh und geben diese Ihrem Nachbarn. Sie fühlen sich<br />
rechtschaffen. Udo Lindenberg singt für Sie.<br />
EU Ökonomie:<br />
Sie besitzen zwei Kühe. <strong>Die</strong> EU nimmt Ihnen beide ab, tötet eine, melkt die andere, bezahlt Ihnen<br />
eine Entschädigung aus dem Verkaufserlös der Milch und schüttet diese dann in die Nordsee.<br />
(Das Geld, welches die OECD-Staaten für Agrarsubventionen ausgeben, würde ausreichen, um<br />
allen 56 Millionen Kühe, die in diesen Ländern leben, einen Erster-Klasse-Flug rund um die Welt<br />
zu spendieren. Je<strong>des</strong> Rindvieh würde sogar noch zirka 1000 US-Dollar übrig behalten, um sich in<br />
den Duty Free Shops etwas Nettes zu kaufen (ganz abgesehen von den Bonusmeilen).<br />
(Rechenexempel <strong>des</strong> neuseeländischen Wissenschaftler Ronnie Horesch in der libertären Zeitschrift<br />
"eigentümlich frei")<br />
Französische Ökonomie:<br />
Sie besitzen zwei Kühe. Sie streiken, weil Sie drei Kühe haben wollen. Sie gehen Mittagessen. Das<br />
Leben ist schön.<br />
Amerikanische Ökonomie:<br />
Sie besitzen zwei Kühe. Sie verkaufen eine und leasen sie zurück. Sie gründen eine<br />
Aktiengesellschaft. Sie zwingen beide Kühe, das Vierfache an Milch zu geben. Sie wundern sich,<br />
Matthias Horx, <strong>Die</strong> <strong>Überwindung</strong> <strong>des</strong> <strong>Pessimismus</strong> 9
als eine tot umfällt. Sie geben eine Presseerklärung heraus, in der Sie erklären, Sie hätten Ihre<br />
Kosten um 50 Prozent gesenkt. Ihre Aktien steigen.<br />
Schweizer Ökonomie:<br />
Sie verfügen über 5000 Kühe, von denen Ihnen aber keine einzige gehört. Sie betreuen die Tiere für<br />
andere. Wenn die Kühe Milch geben, erzählen sie es niemandem.<br />
New Economy:<br />
Sie verkaufen superturbogeile Melkmaschinen. Und nehmen dafür die letzte Kuh in Zahlung.<br />
Next Economy:<br />
Sie lassen die Kühe frei grasen und geben jeder eine e-mail-Nummer. Sie spielen ihnen Lounge-<br />
Musik vor und massieren sie nachts bei Mondschein. Ihren Kunden verkaufen Sie über das Internet<br />
Aktien mit dem Titel „Watch your happy cow growing!“. Als Dank geben die Kühe keine Milch<br />
mehr, sondern Cappucino Milk Shakes. Und pures Carpaccio!<br />
i <strong>Die</strong> Ethnologinnen Joana Breidenbach und Ina Zukrigl i haben in ihrer Studie „Tanz der Kulturen” viele dieser Beispiele<br />
gesammelt.<br />
Matthias Horx, <strong>Die</strong> <strong>Überwindung</strong> <strong>des</strong> <strong>Pessimismus</strong> 10