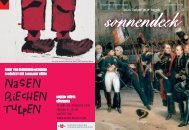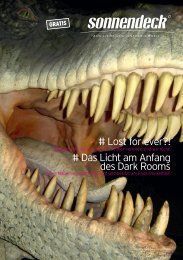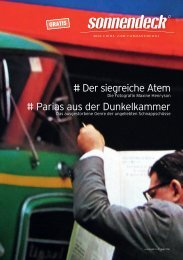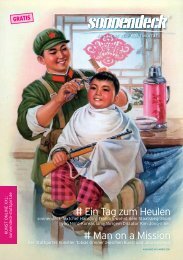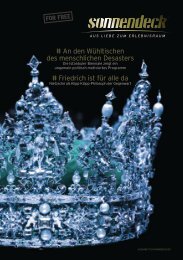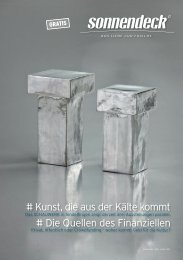Galerien der Stadt Esslingen am Neckar Villa Merkel ... - Sonnendeck
Galerien der Stadt Esslingen am Neckar Villa Merkel ... - Sonnendeck
Galerien der Stadt Esslingen am Neckar Villa Merkel ... - Sonnendeck
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
„Singing for Sex“ ist ihm zu wenig:<br />
Der Autor Winfried Menninghaus<br />
Winfried Menninghaus:<br />
Wozu Kunst? Ästhetik nach Darwin<br />
Suhrk<strong>am</strong>p Verlag,<br />
318 Seiten, 24,90 Euro<br />
4 – BRISE<br />
WER SCHÖNES HERVORBRINGT,<br />
WILL NICHT AUTOMATISCH AUCH SEX<br />
Kunst und sonstige kulturelle Begleiterscheinungen<br />
des menschlichen Daseins im Lichte <strong>der</strong> Evolutionstheorie.<br />
Es gehört zum Wesen <strong>der</strong> ernsten<br />
Wissenschaften, Fragen zu stellen,<br />
<strong>der</strong>en Beantwortung niemandem<br />
unter den Nägeln brennt. Es gehört<br />
zum Glück des Wissenschaftlers<br />
auch aus sinnlosen Fragestellungen,<br />
hilfreiche bis bedeutende Ergebnisse<br />
herausquetschen zu können. Jetzt hat<br />
es mal wie<strong>der</strong> einer geschafft: Winfried<br />
Menninghaus, Literaturprofessor<br />
an <strong>der</strong> FU Berlin, hat erneut eine<br />
uralte Frage gestellt – Wozu Kunst?<br />
– und seine 300-seitige Antwort<br />
dem Suhrk<strong>am</strong>p Verlag zukommen<br />
lassen. Hierin seziert Menninghaus<br />
Kunst, Literatur, Tanz, Musik mit<br />
den selten zimperlichen Gerätschaften<br />
<strong>der</strong> Evolutionstheorie. Fragt nach<br />
dem in dieser Wissenschaftsdisziplin<br />
alles entscheidenden Nutzen für die<br />
„Fortentwicklung <strong>der</strong> Spezies durch<br />
die Weitergabe günstiger genetischer<br />
Merkmale“. Nun kann man sich vorstellen,<br />
dass eine solch hemdärmelige<br />
Behandlung, den zarten Früchtchen<br />
unseres Kulturbetriebs nicht gerade<br />
willkommen ist. Wie überhaupt die<br />
Frage nach dem Nutzen o<strong>der</strong> Sinn<br />
ihrer Tätigkeit und Werke, unter<br />
Künstlern verpönt bis tabu ist. Etwas<br />
Erleichterung verschafft im vorliegenden<br />
Falle, dass <strong>der</strong> „Scharfrichter“<br />
Menninghaus selbst Professor für<br />
Literatur ist, also zumindest eine<br />
gewisse Hingezogenheit zu Kunsterzeugnissen<br />
vorausgesetzt werden<br />
darf. Nicht auszudenken, hätte man<br />
auf „unsere Kunst“ einen Molekularbiologen,<br />
Verfassungsrechtler o<strong>der</strong><br />
Teilchenforscher losgelassen.<br />
Nun wird die Frage „Wozu Kunst“<br />
typischerweise von Kunstfeinden<br />
gestellt. Von Leuten also, die alles von<br />
<strong>der</strong> Erdoberfläche tilgen möchten,<br />
was nicht unmittelbar volkswirtschaftlich<br />
verwertbar ist. In <strong>der</strong> nun<br />
Jahrhun<strong>der</strong>te währenden Debatte<br />
um den Nutzen <strong>der</strong> Kunst führen die<br />
Kunstliebhaber aktuell folgende Vorteile<br />
ins Feld: Kunst als Bildungswert,<br />
als Erprobungsfeld zur Erlernung von<br />
„Schlüsselkompetenzen“ o<strong>der</strong> gleich<br />
einen „Standortfaktor Kreativität“;<br />
brechen also die Bedeutung <strong>der</strong> Kunst<br />
auf praktische Nutzwerte herunter<br />
und begeben sich so mit ihrer Verteidigung<br />
exakt in den Wertekanon <strong>der</strong><br />
Feinde <strong>der</strong> Kunst, wonach „gut ist,<br />
was <strong>der</strong> Wirtschaft dient“. Die klügere<br />
Verteidigung freilich hält Menninghaus<br />
bereit: Man möge sich vorstellen<br />
welche gravierenden Pathologien in<br />
<strong>der</strong> Gesellschaft entstünden, entferne<br />
man nur für die Dauer eines Jahres<br />
sämtliche Hervorbringungen <strong>der</strong><br />
Künste aus unserer Lebenswelt. Und<br />
weil er eben Wissenschaftler ist, reicht<br />
Menninghaus gleich Studienergebnisse<br />
hinterher, die belegen, dass <strong>der</strong><br />
Genuss von Kulturveranstaltungen,<br />
als auch die künstlerische Betätigung<br />
selbst, die Lebenserwartung des<br />
Individuums eindeutig verlängern –<br />
unabhängig von sonstigen Faktoren<br />
wie Ernährungsgewohnheiten, Einkommen<br />
etc. Hier deutet sich schon<br />
ein evolutionstheoretischer Vorteil<br />
des Kulturtreibens an, Künste scheinen<br />
ein soziales Klima zu schaffen,<br />
das ganz allgemein dem Überleben<br />
<strong>der</strong> Spezies zuträglich ist. Über die<br />
genauen Gründe kann nur spekuliert<br />
werden, da es - zumindest <strong>der</strong>zeit noch<br />
– keine Gesellschaft gibt, die komplett<br />
kunstfrei ist. Vorstellbar ist ein lin<strong>der</strong>n<strong>der</strong><br />
Effekt <strong>der</strong> Künste auf Par<strong>am</strong>eter<br />
wie die Konfliktträchtigkeit<br />
einer Gesellschaft, das Stressniveau<br />
und den allgemein vorherrschenden<br />
psychotischen Druck. Kunst, Kultur<br />
und Sport dienen typischerweise als<br />
Schauplätze unblutiger Stellvertreterkriege<br />
und bereiten ein Feld für<br />
gesellschaftliche Selbstreflektion, wie<br />
für kollektive Verarbeitungsprozesse.<br />
Desweiteren eröffnen sie Projektionsmöglichkeiten<br />
im Falle individueller<br />
existenzieller Krisen; sind insges<strong>am</strong>t<br />
also ein wichtiges Korrektiv zur Vermeidung<br />
extremer, unheilvoller o<strong>der</strong><br />
sonstiger fataler Entwicklungen.<br />
Diesen erfreulichen Bescheid erfahren<br />
wir freilich erst gegen Ende des<br />
Menninghaus’schen Buchs, zunächst<br />
gilt es die beinharten Gefilde <strong>der</strong> Darwinschen<br />
Weltsicht zu durchwaden.<br />
Der Begrün<strong>der</strong> <strong>der</strong> Evolutionstheorie<br />
weist in seinem Tiermodell <strong>der</strong> Künste<br />
auf den Umstand hin, dass Vögel<br />
mit Hilfe kurzer Rufe untereinan<strong>der</strong><br />
kommunizieren. Ein schriller Laut<br />
reicht aus, um die Artgenossen auf<br />
Gefahren o<strong>der</strong> eine Nahrungsquelle<br />
hinzuweisen. Die Vogelgesänge jedoch<br />
sind viel kapriziöser und tragen keine<br />
Botschaft im Sinne einer Mitteilung,<br />
sie sind Aufführungen von Kunstfertigkeit<br />
und verweisen auf den<br />
individuellen Vogel selbst, nach dem<br />
Motto „hört her, wie schön ich singen<br />
kann“. Dadurch beeindrucken sie das<br />
an<strong>der</strong>e Geschlecht und entmutigen<br />
die Konkurrenz. Einleuchtend ist es<br />
für Menninghaus, darin Vorformen<br />
<strong>der</strong> menschlichen Künste des Singens,<br />
Tanzens und <strong>der</strong> Selbstverzierung<br />
auszumachen. Womit sexuelle Konkurrenz<br />
zwar in seine hypothetische<br />
Ursprungsgeschichte künstlerischer<br />
Praktiken eingeht, aber im Lauf <strong>der</strong><br />
Geschichte durch fortschreitende<br />
ästhetische Verfeinerungen <strong>der</strong><br />
Aspekt des sexuellen Werbens eine<br />
immer marginalere Rolle eingenommen<br />
hat, zugunsten <strong>der</strong> Nutzlosigkeit,<br />
des „l’art pour l’art“. In unserer Hingezogenheit<br />
zu den Künsten könnte<br />
also das schwache Echo von Affekten<br />
nachklingen, von denen uns bereits<br />
<strong>der</strong> Blick ins Tierreich Zeugnis gibt.<br />
Hier zeigt sich, dass Menninghaus<br />
eine Position zwischen hartem Darwinismus<br />
und klassischer Ästhetik<br />
einnimmt. Für einen orthodoxen Darwinisten<br />
ist klar: Wir singen, tanzen,<br />
spielen, schreiben, malen – für Sex.<br />
Während es seit den Tagen <strong>der</strong> klassischen<br />
Ästhetik selbstverständlich ist,<br />
den Nutzen <strong>der</strong> Künste darin zu sehen,<br />
dass sie von Nutzenerwägungen freigestellt<br />
sind. Menninghaus überwindet<br />
das simple Schema des „singing for<br />
sex“, indem er es um einige Faktoren<br />
erweitert. Der Kunsttreibende weise<br />
selbstverständlich auf seine Person hin,<br />
nehme aber das Publikum genauso für<br />
seine Kunst ein, die losgelöst von <strong>der</strong><br />
Person des Künstlers bestand habe.<br />
Wer Schönes hervorbringt, will nicht<br />
automatisch auch Sex. Die Kunst<br />
dreht sich ganz allgemein um das, was<br />
das menschliche Leben zu bieten hat:<br />
um die ganze Wirklichkeit <strong>der</strong> Kultur.<br />
Diese Differenzierung war beim alten<br />
Darwin schon vorgesehen. Einigen<br />
Kapiteln von „Descent of Man“ (1871)<br />
handeln von <strong>der</strong> Schönheit tierischer<br />
und menschlicher Körper. Das üppige<br />
Fe<strong>der</strong>kleid o<strong>der</strong> <strong>der</strong> gewaltige Lie<strong>der</strong>schatz<br />
mancher Vogelarten folgen laut<br />
Darwin einer Dyn<strong>am</strong>ik, <strong>der</strong>en vielfältige<br />
Neuerungen von Mensch und<br />
Tier „um ihrer selbst willen“ geliebt<br />
werden. Demnach ist Darwin kein<br />
Darwinist gewesen, denn für letztere<br />
ist Schönheit auf bloße Attraktivität<br />
reduziert, <strong>der</strong>en Formensprache einzig<br />
dem Nutzen <strong>der</strong> Arterhaltung diene.<br />
Darwin jedoch zöge trotz aller Empirie<br />
eine „Poetik des Kapriziösen“ in<br />
Erwägung.<br />
Menninghaus’ Brückenschlag ist hilfreich<br />
weil er Bewegung in verhärtete<br />
Positionen bringt. Seine vorläufige<br />
Neuverortung <strong>der</strong> Kunst zwischen<br />
den Polen Darwinismus und Ästhetizismus<br />
schenkt neue Luft zum Atmen<br />
und tut keiner <strong>der</strong> zwei Fraktionen<br />
weh: Kunst ist autonom, aber deshalb<br />
keineswegs funktionslos, son<strong>der</strong>n<br />
eine ganz eigene soziale Kraft.<br />
Hansjörg Fröhlich<br />
BRISE – 5