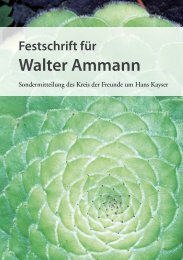Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie, Bd - entsteht die ...
Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie, Bd - entsteht die ...
Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie, Bd - entsteht die ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
266 K. Ammann<br />
Vergrößert man eine Senkrechtaufnahme des Reliefs durch visuelles Anpassen eines Ausschnittes an eine moderne<br />
topographische Karte (Landeskarte 1 :50.000, Ausgabe 1947), so lassen sich <strong>die</strong> Ketten des Aargrates <strong>und</strong> jene des<br />
Zinggenstockes, <strong>die</strong> einzelnen Bergspitzen des Löffelhornes (L), des Ulricher Stockes (U) <strong>und</strong> des hintern <strong>und</strong> vorderen<br />
Zinggenstockes (hZ, vZ) <strong>und</strong> auch der Oberaarbach zwischen Relieffoto <strong>und</strong> Karte recht gut in Übereinstimmung<br />
bringen. Es wird dabei sofort auffallen, daß <strong>die</strong> Zungenspitze des Oberaar-Gletschers - falls Müller sie auch nur<br />
einigermaßen korrekt einmodellierte - etwa in den Bereich zwischen den Wällen 3 <strong>und</strong> 4, eventuell näher bei 3, zu<br />
liegen kommt: vgl. Abb. 7.<br />
Leider war es bis zur Drucklegung der Arbeit nicht möglich, den jetzigen Standort des hier interessierenden Teils des<br />
großen Schweizer-Alpen-Reliefs von J. E. Müller (1799-1806) im Maßstab von etwa 1:40.000 in Zürich ausfindig zu<br />
machen. Dieses Relief, obwohl später fertiggestellt, hätte eventuell noch mehr Informationen geliefert.<br />
3.2. 19. JAHRHUNDERT<br />
Naturgemäß vermehrten <strong>die</strong> besseren Verkehrsverhältnisse <strong>die</strong> Quellen, <strong>die</strong> sich direkt mit dem Oberaargletscher<br />
befassen, im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert gewaltig. Die immer aktiver werdenden Gletscher stießen auch ganz allgemein auf<br />
vermehrtes Interesse.<br />
2a: Am 12. August 1806 zeichnete H. K. Escher von der Lindt vom kleinen Sidelhorn (2764,4 m) aus Entwürfe zu<br />
einem Panorama, dessen endgültige Tusche- <strong>und</strong> Aquarelldarstellung auch den Oberaargletscher in prachtvoller<br />
Farbigkeit <strong>und</strong> Schärfe wiedergibt (Abb. 8). Escher eröffnet damit einen schönen Reigen von Panoramadarstellungen<br />
vom kleinen Sidelhorn aus: z. B. J. R. Bühlmann, 1835 (Abb. 9); G. Studer, 1838 (Abb. 10); A. Escher, 1842; Foto J.<br />
Beck, 1884 (Abb. 15) <strong>und</strong> Foto H. Zumbühl, 1972 (Abb. 18).<br />
Die abgebildeten Ausschnitte <strong>die</strong>ser Panoramen sind alle auf ungefähr <strong>die</strong>selbe Vergrößerung gebracht. Darin sind <strong>die</strong><br />
folgenden Felsvorsprünge, <strong>die</strong> seitlich in das linke Ufer des Gletschers vorragen, von W nach E mit 1-5 nummeriert :<br />
Tieralpi: Nr. 1 <strong>und</strong> 2; Schafalpi westlicher Teil: Nr. 3; Großer Nollen: Nr. 4; Nr. 5: Felsvorsprung unterhalb Moor I (nur<br />
in einem Teil der Abb. sichtbar! Lage: vgl Landeskarte Abb. 1). Escher lieferte in <strong>die</strong>ser „Circularaussicht“ auch <strong>die</strong><br />
erste bisher bekannt gewordene Bilddarstellung des Oberaargletschers. Leider ist gerade das äußerste Zungenende des<br />
Gletschers durch den unteren Bildrand (<strong>und</strong> übrigens auch durch den Vordergr<strong>und</strong> der Bäregg) gekappt, es dürfte kaum<br />
derart spitz zugelaufen sein, wie <strong>die</strong>s das Bild suggeriert. Es fallen im Vergleich mit dem Foto Abb. 18 vom selben<br />
Standort aus vor allem in den tieferen Lagen größere Abweichungen von der Wirklichkeit auf, was nicht verw<strong>und</strong>ern<br />
darf: Die damaligen Panoramazeichner hatten allen Gr<strong>und</strong>, in der knapp bemessenen Zeichnungszeit sich auf <strong>die</strong><br />
Gipfelkulisse zu konzentrieren. Da auch der unterste Zungenbereich des Oberaargletschers in <strong>die</strong>se ungenau gezeichnete<br />
Zone tieferer Lagen fällt, <strong>und</strong> zudem gute Geländevergleichsmarken hier rar sind, ist es schwierig, aus dem Panorama<br />
allein <strong>und</strong> ohne Vergleich mit späteren Darstellungen auf einen bestimmten Gletscherstand zu schließen. Im Vergleich<br />
mit dem Panorama von G. Studer, 1838 (Abb. 10) jedoch zeigt sich <strong>für</strong> 1806 ein niedrigeres Niveau des linken Eisufers<br />
des Gletschers: Während im Bereich des Tieralpi am Fuße des Scheuchzerhornes <strong>die</strong> ins Eis vorspringenden Rippen 1<br />
<strong>und</strong> 2 im Studer-Panorama von 1838 klein erscheinen <strong>und</strong> förmlich in Eis <strong>und</strong> Firn ertrinken, wirken <strong>die</strong>selben Rippen 1<br />
<strong>und</strong> 2 weniger stark eisbedeckt im Escher-Panorama. Allerdings müssen wir dabei berücksichtigen, daß Studer sein<br />
Panorama am 15. Juli skizzierte, Escher jedoch seines fast einen Monat später, <strong>die</strong> Schneeschmelze also damals weiter<br />
fortgeschritten sein dürfte. Auch der „große Nollen“ (Rippe Nr. 4) ragte bei hohem Gletscherstand scharfwinkelig in das<br />
linke Eisufer des Gletschers (Abb. 10 <strong>und</strong> 15), während sie bei niederem Stand nicht oder nur schwach in <strong>die</strong>ser<br />
Panoramaperspektive zur Geltung kommt (Abb. 18). Beim Panorama Eschers drängt es sich angesichts der schwach<br />
ausgeprägten Rippe Nr. 4 auf, einen relativ niederen Gletscherstand zu postulieren. Die Reisenotizen von H. K. Escher<br />
(Manuskript: Mikrofilm in Zentralbibliothek Zürich) lieferten zum Stand des Oberaargletschers keine näheren Angaben.