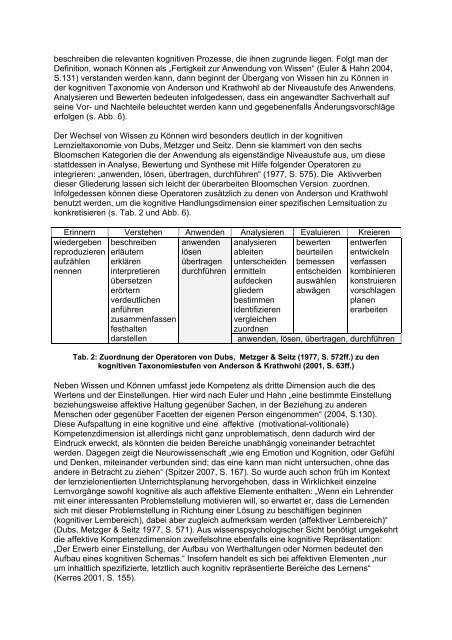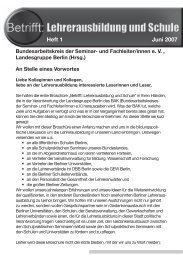„Geht's auch konkreter?“ – Wie können wir Kompetenzen in ... - BAK
„Geht's auch konkreter?“ – Wie können wir Kompetenzen in ... - BAK
„Geht's auch konkreter?“ – Wie können wir Kompetenzen in ... - BAK
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
eschreiben die relevanten kognitiven Prozesse, die ihnen zugrunde liegen. Folgt man der<br />
Def<strong>in</strong>ition, wonach Können als „Fertigkeit zur Anwendung von Wissen<strong>“</strong> (Euler & Hahn 2004,<br />
S.131) verstanden werden kann, dann beg<strong>in</strong>nt der Übergang von Wissen h<strong>in</strong> zu Können <strong>in</strong><br />
der kognitiven Taxonomie von Anderson und Krathwohl ab der Niveaustufe des Anwendens.<br />
Analysieren und Bewerten bedeuten <strong>in</strong>folgedessen, dass e<strong>in</strong> angewandter Sachverhalt auf<br />
se<strong>in</strong>e Vor- und Nachteile beleuchtet werden kann und gegebenenfalls Änderungsvorschläge<br />
erfolgen (s. Abb. 6).<br />
Der Wechsel von Wissen zu Können <strong>wir</strong>d besonders deutlich <strong>in</strong> der kognitiven<br />
Lernzieltaxonomie von Dubs, Metzger und Seitz. Denn sie klammert von den sechs<br />
Bloomschen Kategorien die der Anwendung als eigenständige Niveaustufe aus, um diese<br />
stattdessen <strong>in</strong> Analyse, Bewertung und Synthese mit Hilfe folgender Operatoren zu<br />
<strong>in</strong>tegrieren: „anwenden, lösen, übertragen, durchführen<strong>“</strong> (1977, S. 575). Die Aktivverben<br />
dieser Gliederung lassen sich leicht der überarbeiten Bloomschen Version zuordnen.<br />
Infolgedessen <strong>können</strong> diese Operatoren zusätzlich zu denen von Anderson und Krathwohl<br />
benutzt werden, um die kognitive Handlungsdimension e<strong>in</strong>er spezifischen Lernsituation zu<br />
konkretisieren (s. Tab. 2 und Abb. 6).<br />
Er<strong>in</strong>nern Verstehen Anwenden Analysieren Evaluieren Kreieren<br />
wiedergeben beschreiben anwenden analysieren bewerten entwerfen<br />
reproduzieren erläutern lösen ableiten beurteilen entwickeln<br />
aufzählen<br />
nennen<br />
erklären<br />
<strong>in</strong>terpretieren<br />
übertragen<br />
durchführen<br />
unterscheiden<br />
ermitteln<br />
bemessen<br />
entscheiden<br />
verfassen<br />
komb<strong>in</strong>ieren<br />
übersetzen<br />
erörtern<br />
verdeutlichen<br />
anführen<br />
zusammenfassen<br />
festhalten<br />
aufdecken<br />
gliedern<br />
bestimmen<br />
identifizieren<br />
vergleichen<br />
zuordnen<br />
auswählen<br />
abwägen<br />
konstruieren<br />
vorschlagen<br />
planen<br />
erarbeiten<br />
darstellen<br />
anwenden, lösen, übertragen, durchführen<br />
Tab. 2: Zuordnung der Operatoren von Dubs, Metzger & Seitz (1977, S. 572ff.) zu den<br />
kognitiven Taxonomiestufen von Anderson & Krathwohl (2001, S. 63ff.)<br />
Neben Wissen und Können umfasst jede Kompetenz als dritte Dimension <strong>auch</strong> die des<br />
Wertens und der E<strong>in</strong>stellungen. Hier <strong>wir</strong>d nach Euler und Hahn „e<strong>in</strong>e bestimmte E<strong>in</strong>stellung<br />
beziehungsweise affektive Haltung gegenüber Sachen, <strong>in</strong> der Beziehung zu anderen<br />
Menschen oder gegenüber Facetten der eigenen Person e<strong>in</strong>genommen<strong>“</strong> (2004, S.130).<br />
Diese Aufspaltung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e kognitive und e<strong>in</strong>e affektive (motivational-volitionale)<br />
Kompetenzdimension ist allerd<strong>in</strong>gs nicht ganz unproblematisch, denn dadurch <strong>wir</strong>d der<br />
E<strong>in</strong>druck erweckt, als könnten die beiden Bereiche unabhängig vone<strong>in</strong>ander betrachtet<br />
werden. Dagegen zeigt die Neurowissenschaft „wie eng Emotion und Kognition, oder Gefühl<br />
und Denken, mite<strong>in</strong>ander verbunden s<strong>in</strong>d; das e<strong>in</strong>e kann man nicht untersuchen, ohne das<br />
andere <strong>in</strong> Betracht zu ziehen<strong>“</strong> (Spitzer 2007, S. 167). So wurde <strong>auch</strong> schon früh im Kontext<br />
der lernzielorientierten Unterrichtsplanung hervorgehoben, dass <strong>in</strong> Wirklichkeit e<strong>in</strong>zelne<br />
Lernvorgänge sowohl kognitive als <strong>auch</strong> affektive Elemente enthalten: „Wenn e<strong>in</strong> Lehrender<br />
mit e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>teressanten Problemstellung motivieren will, so erwartet er, dass die Lernenden<br />
sich mit dieser Problemstellung <strong>in</strong> Richtung e<strong>in</strong>er Lösung zu beschäftigen beg<strong>in</strong>nen<br />
(kognitiver Lernbereich), dabei aber zugleich aufmerksam werden (affektiver Lernbereich)<strong>“</strong><br />
(Dubs, Metzger & Seitz 1977, S. 571). Aus wissenspsychologischer Sicht benötigt umgekehrt<br />
die affektive Kompetenzdimension zweifelsohne ebenfalls e<strong>in</strong>e kognitive Repräsentation:<br />
„Der Erwerb e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>stellung, der Aufbau von Werthaltungen oder Normen bedeutet den<br />
Aufbau e<strong>in</strong>es kognitiven Schemas.<strong>“</strong> Insofern handelt es sich bei affektiven Elementen „nur<br />
um <strong>in</strong>haltlich spezifizierte, letztlich <strong>auch</strong> kognitiv repräsentierte Bereiche des Lernens<strong>“</strong><br />
(Kerres 2001, S. 155).