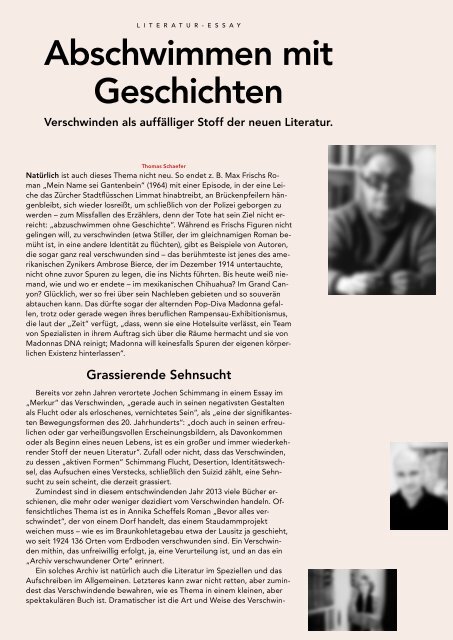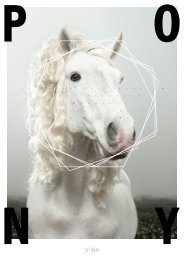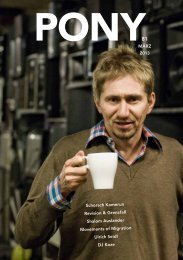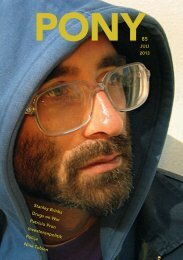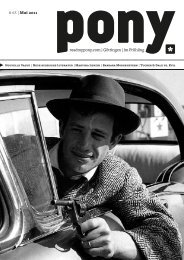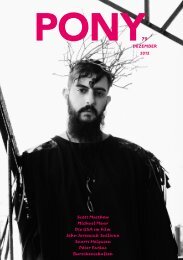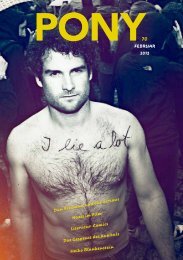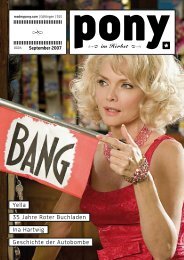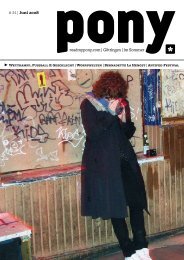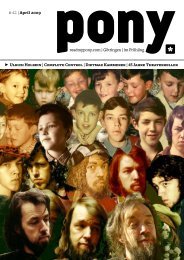Aktuelle Ausgabe als PDF runterladen. - Pony
Aktuelle Ausgabe als PDF runterladen. - Pony
Aktuelle Ausgabe als PDF runterladen. - Pony
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
L i t e r a t u r - E s s a y<br />
Abschwimmen mit<br />
Geschichten<br />
Verschwinden <strong>als</strong> auffälliger Stoff der neuen Literatur.<br />
Thomas Schaefer<br />
Natürlich ist auch dieses Thema nicht neu. So endet z. B. Max Frischs Roman<br />
„Mein Name sei Gantenbein“ (1964) mit einer Episode, in der eine Leiche<br />
das Zürcher Stadtflüsschen Limmat hinabtreibt, an Brückenpfeilern hängenbleibt,<br />
sich wieder losreißt, um schließlich von der Polizei geborgen zu<br />
werden – zum Missfallen des Erzählers, denn der Tote hat sein Ziel nicht erreicht:<br />
„abzuschwimmen ohne Geschichte“. Während es Frischs Figuren nicht<br />
gelingen will, zu verschwinden (etwa Stiller, der im gleichnamigen Roman bemüht<br />
ist, in eine andere Identität zu flüchten), gibt es Beispiele von Autoren,<br />
die sogar ganz real verschwunden sind – das berühmteste ist jenes des amerikanischen<br />
Zynikers Ambrose Bierce, der im Dezember 1914 untertauchte,<br />
nicht ohne zuvor Spuren zu legen, die ins Nichts führten. Bis heute weiß niemand,<br />
wie und wo er endete – im mexikanischen Chihuahua? Im Grand Canyon?<br />
Glücklich, wer so frei über sein Nachleben gebieten und so souverän<br />
abtauchen kann. Das dürfte sogar der alternden Pop-Diva Madonna gefallen,<br />
trotz oder gerade wegen ihres beruflichen Rampensau-Exhibitionismus,<br />
die laut der „Zeit“ verfügt, „dass, wenn sie eine Hotelsuite verlässt, ein Team<br />
von Spezialisten in ihrem Auftrag sich über die Räume hermacht und sie von<br />
Madonnas DNA reinigt; Madonna will keinesfalls Spuren der eigenen körperlichen<br />
Existenz hinterlassen“.<br />
Grassierende Sehnsucht<br />
Bereits vor zehn Jahren verortete Jochen Schimmang in einem Essay im<br />
„Merkur“ das Verschwinden, „gerade auch in seinen negativsten Gestalten<br />
<strong>als</strong> Flucht oder <strong>als</strong> erloschenes, vernichtetes Sein“, <strong>als</strong> „eine der signifikantesten<br />
Bewegungsformen des 20. Jahrhunderts“: „doch auch in seinen erfreulichen<br />
oder gar verheißungsvollen Erscheinungsbildern, <strong>als</strong> Davonkommen<br />
oder <strong>als</strong> Beginn eines neuen Lebens, ist es ein großer und immer wiederkehrender<br />
Stoff der neuen Literatur“. Zufall oder nicht, dass das Verschwinden,<br />
zu dessen „aktiven Formen“ Schimmang Flucht, Desertion, Identitätswechsel,<br />
das Aufsuchen eines Verstecks, schließlich den Suizid zählt, eine Sehnsucht<br />
zu sein scheint, die derzeit grassiert.<br />
Zumindest sind in diesem entschwindenden Jahr 2013 viele Bücher erschienen,<br />
die mehr oder weniger dezidiert vom Verschwinden handeln. Offensichtliches<br />
Thema ist es in Annika Scheffels Roman „Bevor alles verschwindet“,<br />
der von einem Dorf handelt, das einem Staudammprojekt<br />
weichen muss – wie es im Braunkohletagebau etwa der Lausitz ja geschieht,<br />
wo seit 1924 136 Orten vom Erdboden verschwunden sind. Ein Verschwinden<br />
mithin, das unfreiwillig erfolgt, ja, eine Verurteilung ist, und an das ein<br />
„Archiv verschwundener Orte“ erinnert.<br />
Ein solches Archiv ist natürlich auch die Literatur im Speziellen und das<br />
Aufschreiben im Allgemeinen. Letzteres kann zwar nicht retten, aber zumindest<br />
das Verschwindende bewahren, wie es Thema in einem kleinen, aber<br />
spektakulären Buch ist. Dramatischer ist die Art und Weise des Verschwindens<br />
nicht denkbar, wie sie dem Matrosenschüler Tjark Evers in Astrid Dehes<br />
und Achim Engstlers Buch „Auflaufend Wasser“ widerfährt: Im Winter<br />
1866 lässt Evers sich vermeintlich am Strand der Insel Baltrum absetzen,<br />
um dann feststellen zu müssen, dass er einem Irrtum aufsaß: Er ist auf einer<br />
Sandbank gelandet, und während er verzweifelt grübelt, wie er seinem<br />
Untergang entrinnen kann, steigt die Flut. Kaum zu glauben, aber wahr, die<br />
Geschichte, die Evers aufschrieb und einer Kiste anvertraute, bevor ihn das<br />
Meer verschluckte.<br />
Tatsachen entspricht auch das „Das Verschwinden des Philip S.“ in Ulrike<br />
Edschmids Buch, in dem sie von ihrem früheren Lebensgefährten erzählt,<br />
dem Schweizer Philip Sauber, mit dem sie in den wilden Jahren des 68er Berlins<br />
zusammenlebte – bis beide festgenommen wurden. Die ungerechtfertigte<br />
Untersuchungshaft treibt das Paar auseinander: Edschmid will nie wieder<br />
in den Knast und entscheidet sich für ein Leben auf der sicheren Seite, S.<br />
geht in den Untergrund und taucht erst 1975 auf einem Kölner Parkplatz auf,<br />
wo er bei einer Schießerei mit der Polizei getötet wird.<br />
Akute Befindlichkeiten<br />
In Terézia Moras so vorhersehbar wie unverdient mit dem Deutschen<br />
Buchpreis prämierten Roman „Das Ungeheuer“ gibt es eine Episode, in der<br />
ein in einer psychiatrischen Klinik arbeitender Arzt ein Auto „mit einem Geheimfach“<br />
sucht, „in dem ein erwachsener Mann Platz hat“. Darin will er sich<br />
verstecken und sterben, in der Hoffnung, dass das verlassen wirkende Fahrzeug<br />
abtransportiert und samt Arztleiche verschrottet wird: „wieso tut er so<br />
etwas? Wieso will er sich nicht einfach umbringen, sondern gleich verschrotten<br />
lassen wie ein Stück Müll?“ Das ist die Frage. Anders <strong>als</strong> bei Dehe/Engstler<br />
oder Edschmid ist hier das Verschwinden ein poetisch stilisiertes: Moras<br />
Held Tobias Kopp verschwindet ja auch, allerdings nur für ein Jahr, indem er<br />
sich nach dem Selbstmord seiner Frau in seiner Wohnung verschanzt, wo er<br />
keinen Kontakt zur Außenwelt unterhält, allenfalls Pizza bestellt. Exakt das<br />
macht (sogar zwei Jahre) der Held in Thomas Glavinics pompösem Roman<br />
„Das größere Wunder“, der sich einem noch radikaleren Verschwinden aussetzt,<br />
indem er den Mount Everest besteigt. Die Perspektive, dort in einer<br />
Gletscherspalte auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden, hat eher Verlockendes<br />
denn Abschreckendes.<br />
Mora und Glavinic reagieren auf manierierte Weise auf akute Befindlichkeiten,<br />
die durchaus die Sehnsucht zu verschwinden hervorrufen können:<br />
Wäre die nicht ein zwingender Reflex auf die immer engmaschigere Videoüberwachung,<br />
die Rundumüberwachung, der wir uns mittels Facebook etc.<br />
aussetzen? Bietet nicht grade das Internet, das wir nutzen, uns rund um die<br />
Uhr zu präsentieren, Möglichkeiten, sich zu entziehen? Oder ist ein Bedürfnis<br />
zu verschwinden allenfalls das Anliegen älterer Herren wie Michael Krüger,<br />
in dessen 2013 erschienenem Lyrikband „Umstellung der Zeit“ das Gedicht<br />
„Klassentreffen“ steht, in dem es heißt: „Einer ist Tischler geworden, / einer<br />
Anwalt, eine arbeitete / in der Pressestelle der ARD. / (…) Eine hat‘s geschafft.<br />
/ Sie wollte Waldbeeren / sammeln in Finnland / und wurde nie mehr<br />
gesehn“? Wir bleiben dran.<br />
Astrid Dehe/Achim Engstler: „Auflaufend<br />
Wasser“ (Steidl, 2013, 113<br />
Seiten, 16,- Euro)<br />
Ulrike Edschmid: „Das Verschwinden<br />
des Philip S.“ (Suhrkamp, 2013, 157<br />
Seiten, 15,95 Euro)<br />
Thomas Glavinic: „Das größere<br />
Wunder“ (Hanser, 2013, 528 Seiten,<br />
22,90 Euro)<br />
Michael Krüger: „Umstellung der<br />
Zeit“ (Suhrkamp, 2013, 117 Seiten,<br />
18,95 Euro)<br />
Terézia Mora: „Das Ungeheuer“<br />
(Luchterhand, 2013, 688 Seiten,<br />
22,99 Euro)<br />
Annika Scheffel: „Bevor alles verschwindet“<br />
(Suhrkamp, 2013, 411<br />
Seiten, 19,95 Euro)<br />
BYE BYE<br />
17