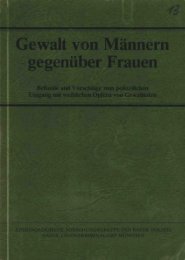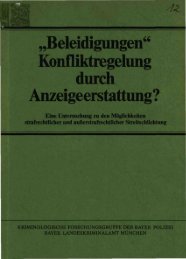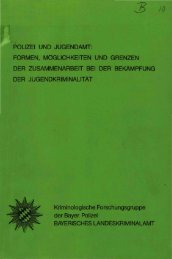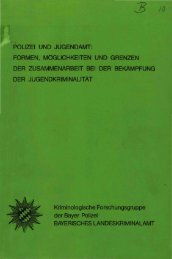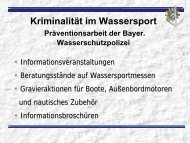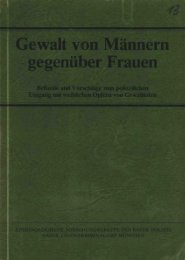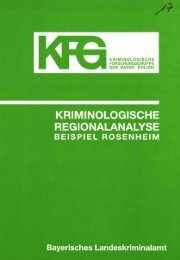Sicherheit für Senioren - Polizei Bayern
Sicherheit für Senioren - Polizei Bayern
Sicherheit für Senioren - Polizei Bayern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
IV<br />
IV<br />
IV.9<br />
IV.9<br />
Prof. Dr. Michael Walter<br />
Expertenstatements<br />
84<br />
IV.9 Prof. Dr. Michael Walter<br />
Ältere und pflegebedürftige Menschen als Opfer<br />
Eine total erfolgreiche Kriminalprävention ist nicht in Sicht und wohl auch nicht gewollt.<br />
Sonst wäre es schwer verständlich, warum fürderhin Staatsanwälte und Richter auf<br />
Lebenszeit ernannt werden. Pointiert könnte man sagen: Wir streben die Kriminalprävention<br />
an, weil wir wissen, dass sie nur sehr begrenzt erreicht wird.<br />
Alle Bestrebungen der kommunalen Kriminalprävention betonen den gesamtgesellschaftlichen<br />
Ansatz. Kriminalität imponiert als der gemeinsame Feind. Zwar können<br />
gemeinsame Feinde nach innen hin einen. Doch erscheint der gemeinsame Feind als solcher<br />
zweifelhaft, solange unsere moderne Gesellschaft in verschiedenen Bereichen durch<br />
Massenkriminalität gekennzeichnet ist. Bekämpft wird vorwiegend die Kriminalität der<br />
jeweils „anderen“. Indessen stellt Kriminalität kein gesellschaftliches Externum dar; sie<br />
gehört vielmehr unausweichlich zu unserer Gesellschaft hinzu, ist selbst ein gesellschaftliches<br />
Phänomen.<br />
Im Zuge einer allgemeinen Sensibilisierung gegenüber Gewalt sind in den letzten Jahren<br />
vor allem Gewalttätigkeiten junger Menschen in den Vordergrund gerückt. Dabei werden<br />
die korrespondierenden Risiken durch „Fremde“ für ältere Menschen tendenziell<br />
überzeichnet. Nachdem die Gefahren, die aus der häuslichen Gewalt gegenüber Kindern<br />
und dem Lebensgefährten, überwiegend der Lebensgefährtin, erwachsen, bereits seit<br />
längerem „entdeckt“ worden sind, erscheint nunmehr die Wahrnehmung der häuslichen<br />
Gewalt alten Menschen gegenüber als geradezu folgerichtiger nächster Schritt.<br />
Präventive Maßnahmen in dieser Richtung gehen von realen Gegebenheiten aus, da<br />
Grund zu der Annahme besteht, insoweit mit einem breiten Dunkelfeld der Gewalt in<br />
häuslicher und institutioneller Pflege konfrontiert zu sein.<br />
Zwar nehmen generell gesehen mit höherem Lebensalter die Viktimisierungsrisiken ab.<br />
Erste Forschungen weisen jedoch auf spezifische Gefährdungen pflegedürftiger und<br />
hochbetagter Menschen hin. Sie können mit schriftlichen Befragungen aus verschiedenen<br />
Gründen, insbesondere wegen ihrer Gebrechlichkeit und der Übermacht der potenziellen<br />
Täter(innen), nur schwer erreicht werden. Schon die Anzeichen, die unterhalb<br />
dieser Schwelle der Benachteiligung liegen, lassen einen erheblichen Gefahrenbereich<br />
erkennen. Gleichsam amtlich anerkannt ist ein Pflegenotstand, bei dem zu wenige und<br />
teilweise nicht gut ausgebildete Pflegerinnen und Pfleger mit einer Überzahl von<br />
Betreuten zurechtkommen müssen. Praktiker im Feld bestätigen Spannungen und auch<br />
Missstände. Die Problematik kommt ferner indirekt dadurch zum Ausdruck, dass bei den<br />
Pflegern häufig der Wunsch nach einem Berufswechsel geäußert wird. Vor allem große<br />
Pflegeeinrichtungen dürften zu „rationellen“ Vorgehensweisen – mit Gewaltkomponenten<br />
– neigen. Die Öffentlichkeit wurde in der Vergangenheit durch Serientötungen<br />
in Alteneinrichtungen aufgeschreckt, bei denen „Todesengel“ lange Phasen hindurch<br />
unbemerkt tätig sein konnten. Diese Ereignisse betreffen indessen nur Extremfälle,<br />
wohingegen Heimskandale wesentlich häufiger mitgeteilt werden. Durch in der Regel<br />
vermeidbare Liegegeschwüre können tödliche Wunden entstehen, die – wie viele andere<br />
„rechtlich relevante“ Todesursachen – bei der Leichenschau nicht selten unerkannt bleiben.<br />
Die wahren Ausmaße der Gewalt im Kontext institutioneller und häuslicher Pflege<br />
werden sich erst noch schrittweise herausstellen, vergleichbar der Entwicklung beim<br />
sexuellen Kindesmissbrauch, dessen Ausmaße anfangs ebenfalls unterschätzt wurden.<br />
Anders als Kinder senden alte Menschen von ihrer körperlichen Konstitution her keine<br />
Schlüsselreize aus, die in den mit ihnen befassten Pflegern Schutzimpulse wachriefen.<br />
Ganz im Sinne des neueren Präventionsansatzes drängen sich hier situationsbezogene<br />
präventive Ansätze auf. Freilich besteht die generelle Schwierigkeit, überhaupt an die<br />
Tatsituationen heranzukommen. Letztere sind ja durch Intimität und mangelnde Kontrolle<br />
seitens Dritter gekennzeichnet. Das Opfer ist nur sehr eingeschränkt in der Lage,<br />
seine Bedürfnisse zu artikulieren.<br />
Von dieser Ausgangslage aus werden niedrigschwellige Angebote erforderlich, die<br />
relativ leicht den Zugang zu helfenden Dritten eröffnen – wie insbesondere einfache<br />
Notrufnummern. Sie müssen auch für Menschen im Umfeld, zum Beispiel Nachbarn,<br />
zugänglich sein. Ferner braucht man eine „Komm-Struktur“, mithin Möglichkeiten, die<br />
betreffenden Pflegeempfänger aufzusuchen. Da nicht erwartet werden kann, dass die<br />
Hilferufe schon thematisch genauer strukturiert sind, müssen weiter klärungsbedürftige<br />
Ersuchen für erste Schritte der angerufenen Agentur ausreichen. Deren Leistung könnte<br />
gerade darin liegen, frei von Eigeninteressen eine fachgerechte Kanalisierung des Hilfsersuchens<br />
vorzunehmen. Durch derartige Vermittlungen werden einerseits unnötige<br />
neue Initiativen vermieden. Andererseits erfahren die vorhandenen Einrichtungen, in<br />
welchen Hinsichten sie gebraucht werden. So ist beispielsweise beklagt worden, dass<br />
sich Einrichtungen für Frauen mit Gewalterfahrungen oft nur um jüngere Frauen kümmerten,<br />
obwohl sich eine solche Beschränkung aus keiner Regelung ergibt.<br />
Bestrebungen, auch älteren Menschen ein geschütztes und dennoch von sozialer Teilhabe<br />
geprägtes Leben zu vermitteln, gibt es weltweit und mit zunehmender Tendenz.<br />
So sind u. a. Beratungsstellen in der Erprobung, vergleichbar den Erziehungsberatungsstellen.<br />
Die reizvolle Frage, in welchem Maße Einrichtungen und Ansätze der Jugendund<br />
Familienhilfe nicht analog auf den Umgang mit älteren Menschen übertragen werden<br />
könnten und sollten, muss als noch weit gehend ungeklärt angesehen werden.<br />
Eine wirkungsvolle Kriminalprävention ist letztlich von einer viel umfassenderen Lebensgestaltung<br />
nicht abtrennbar. Diese aber kann nicht aus der beschränkten Sicht der<br />
Verbrechensverhütung konzipiert werden. Vielmehr beinhaltet Kriminalprävention im<br />
Ensemble der Gestaltungsgrundsätze nur einen einzelnen Gesichtspunkt: Er trägt dazu<br />
bei, flankierend die soziale Teilhabe zu sichern.<br />
Prof. Dr. Michael Walter<br />
Expertenstatements<br />
85