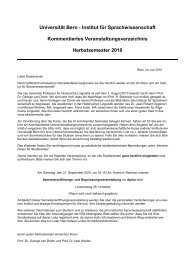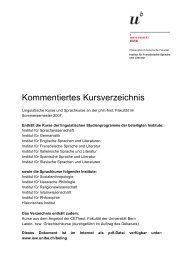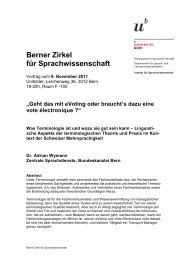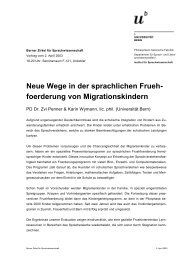BeLing WS 05/06 (pdf, 192KB) - Institut für Sprachwissenschaft ...
BeLing WS 05/06 (pdf, 192KB) - Institut für Sprachwissenschaft ...
BeLing WS 05/06 (pdf, 192KB) - Institut für Sprachwissenschaft ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Deutsche <strong>Sprachwissenschaft</strong><br />
Außenstehende zum Problem werden, und sie wird schwierig, wenn sie auch interkulturell funktionieren soll.<br />
Kommunikation in <strong>Institut</strong>ionen ist demnach nicht nur vielfältig, sondern auch komplex. Die Beschäftigung mit ihr<br />
bietet uns eine Fülle von Möglichkeiten, um Probleme der linguistischen Pragmatik zu diskutieren und<br />
unterschiedliche Methoden der sprachwissenschaftlichen Pragmatik zu erproben.<br />
Zur Anschaffung empfohlen:<br />
Knapp, Karlfried et al. eds. (2004): Angewandte Linguistik. Ein Lehrbuch. Tübingen: Francke. (= UTB 8275)<br />
Krallmann, Dieter & Andreas Ziemann (2001): Grundkurs Kommunikationswissenschaft. Mit einem Hypertext-<br />
Vertiefungsprogramm im Internet. München: Fink (= UTB 2249)<br />
Zur Einführung:<br />
Günthner, Susanne & Helga Kotthoff eds. (1992): Die Geschlechter im Gespräch. Kommunikation in <strong>Institut</strong>ionen.<br />
Stuttgart: J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung.<br />
Brünner, Gisela ed. (1999): Angewandte Diskursforschung. Opladen: Westdeutscher Verlag.<br />
Solan, Lawrence & Peter Meijes Tiersma (20<strong>05</strong>): Speaking of Crime. The Language of Criminal Justice. Chicago,<br />
Ill.: The University of Chicago Press.<br />
Basismodul B, Teil 1/Proseminar Pragmatik: Kommunikationsformen in den neuen Medien<br />
Freitag 14–17<br />
Dr. Franc Wagner<br />
KP: für BA: 5 ECTS, für Liz.: 6 ECTS, 04.11.20<strong>05</strong>–10.02.20<strong>06</strong><br />
Im Proseminar „Kommunikationsformen in den neuen Medien“ werden die Grundlagen der Pragmatik am Beispiel<br />
der Funktionalität von Medientexten aufgezeigt. Das in der Vorlesung „Einführung in die<br />
Kommunikationswissenschaft“ und dem zugehörigen Propädeutikum erworbene Wissen soll anhand von<br />
konkreten Beispielstexten eingeübt und vertieft werden. Hierzu eignen sich Texte aus neuen Medien in<br />
besonderem Maße: Neben schriftlich konzipierten Nachrichten-, Presse- und Werbe-Texten finden sich<br />
konzeptionell mündliche Kommunikationsformen wie z.B. Chat- und Foren-Beiträge sowie Mischformen wie z.B.<br />
E-Mails, Weblogs und Guestbooks. In kleinen Gruppen sollen Beispiele solcher Kommunikationsformen<br />
recherchiert und analysiert werden. Ziel dabei ist es, die neuen Medien nicht nur passiv, sondern auch aktiv zu<br />
nutzen. Ein Teil der Gruppen-Kommunikation soll in Weblogs und Wikis stattfinden.<br />
Das Proseminar wird gefördert vom Virtuellen Campus der Universität Bern und findet vorbehaltlich der<br />
Genehmigung statt.<br />
Literaturangaben:<br />
Kleinberger Günther, U. & Wagner, F. (Hrsg.) (2004). Neue Medien — neue Kompetenzen? (Bonner Beiträge zur<br />
Medienwissenschaft 3). Frankfurt a.M.: Lang.<br />
Basismodul B, Teil 2/Proseminar: Textlinguistik<br />
Mittwoch 12–14<br />
PD Dr. Gesine Schiewer<br />
KP: für BA: 5 ECTS, für Liz.: 6 ECTS, 02.11.20<strong>05</strong>–08.02.20<strong>06</strong><br />
Die Veranstaltung hat eine vertiefte Diskussion der Angewandten Linguistik hinsichtlich der Textlinguistik, ihrer<br />
Methoden und Grundlagen sowie die aktive Einübung wissenschaftlicher Arbeitstechniken zum Gegenstand. Ziel<br />
ist die Erarbeitung eines fundierten Basiswissens aufgrund der exemplarischen Auseinandersetzung mit Fragen<br />
des Sprachgebrauchs und des sprachlichen Handelns. Hierzu gehören die Reflexion des Textbegriffes, Modelle<br />
der Textanalyse, die Verbindung von Textoberfläche und -bedeutung. Zu berücksichtigen sind insbesondere<br />
stilistische und rhetorische Instrumente differenzierter, auch indirekter Kommunikation sowie die Bezugnahme auf<br />
den Leser einschließlich seiner Verstehensleistung. Die Beschreibung kommunikativer Gattungen und Textsorten<br />
verweist schließlich auf den “kommunikativen Haushalt” (Thomas Luckmann) einer Gesellschaft und impliziert<br />
deren Variabilität und Historizität.<br />
Die Thematik der Textlinguistik soll in dem Kurs diskutiert werden im Ausgang von der disziplingeschichtlichen<br />
Entwicklung und wird neben den Anknüpfungspunkten zu anderen Disziplinen wie Semiotik,<br />
Sozialwissenschaften und Literaturwissenschaft sowohl rational orientierte Konzepte der Verständigung als auch<br />
emotionslinguistische Ansätze einbeziehen.<br />
Literaturangaben:<br />
Adamzik, Kirsten (2004): Textlinguistik. Tübingen: Niemeyer.<br />
Brinker, Klaus (Hg.) (2000 f.): Text- und Gesprächslinguistik. 2 Bde. Berlin: de Gruyter.<br />
Brinker, Klaus (20<strong>05</strong>): Linguistische Textanalyse. Berlin: Erich Schmidt.<br />
Heinemann, Margot/Heinemann, Wolfgang (2002): Grundlagen der Textlinguistik. Tübingen: Niemeyer.<br />
Knapp, Karlfried et al. (Hrsg.) (2004): Angewandte Linguistik. Ein Lehrbuch. Tübingen/Basel: Francke.<br />
13