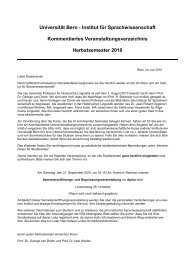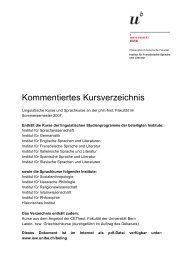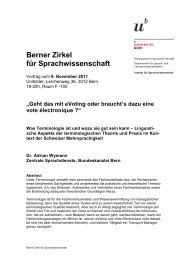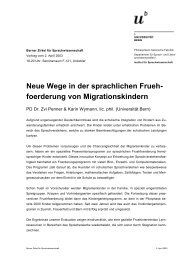BeLing WS 05/06 (pdf, 192KB) - Institut für Sprachwissenschaft ...
BeLing WS 05/06 (pdf, 192KB) - Institut für Sprachwissenschaft ...
BeLing WS 05/06 (pdf, 192KB) - Institut für Sprachwissenschaft ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Deutsche <strong>Sprachwissenschaft</strong><br />
Vertiefungskurs/Aufbaukurs/Hauptseminar: Aspekte einer europäischen Sprachgeschichtsschreibung:<br />
Impulse der Kontaktlinguistik<br />
Dienstag 12–14<br />
PD Dr. Gesine Schiewer<br />
KP: für BA/MA: 6/7 ECTS, für Liz.: 7 ECTS, 01.11.20<strong>05</strong>–07.02.20<strong>06</strong><br />
„was haben wir denn gemeinsames als unsere sprache und literatur?“ fragt Jacob Grimm 1854 und markiert auf<br />
diese Weise die gemeinschaftsstiftende Funktion von Sprache, das heißt die Gründung von Gemeinschaften auf<br />
Sprache. Vor dem Hintergrund der verbreiteten Engführung des Kriteriums der Sprachgemeinschaft als nationaler<br />
Einzelsprache mit dem Begriff der Nation ist bei dieser Äußerung auch der historische Kontext der<br />
Sprachreflexion Grimms zu berücksichtigen: die Genese eines deutschen Nationalstaats. Das Konzept des an<br />
Friedrich Schiller orientierten Paradigmas von Nationalkultur und -literatur ist hier eine wesentliche<br />
Voraussetzung.<br />
Die soziologischen Grundbegriffe „Gemeinschaft“ (mit den Merkmalen Homogenität, gegenseitiges Vertrauen,<br />
emotionale Anbindung) und „Gesellschaft“ (aus Interessen und Zwecksetzungen resultierende, durch lockere<br />
Sozialbeziehungen gekennzeichnete Lebensformen) wurden dann 1887 durch Ferdinand Tönnies voneinander<br />
abgegrenzt und seither vielfältig modifiziert. Für die Reflexion des Komplexes von Gemeinschaftsbildung und<br />
Gemeinschaftshandeln, Sprache und einzelstaatliche Legitimation bleiben diese Begriffe jedoch prinzipiell von<br />
heuristischem Wert. Insbesondere sind auf ihrer Grundlage die Fragen einer einzelsprachbezogenen gegenüber<br />
einer kontaktbezogenenen Sichtweise zu akzentuieren, die im Hinblick auf eine europäische Sprachgeschichtsschreibung<br />
ins Bewusstsein zu rücken sind.<br />
Denn Gegenstand der Kontaktlinguistik sind Fragen des sozialen Kontakts zweier oder mehrerer natürlicher<br />
Einzelsprachen. Sie ist konzentriert auf Aspekte der Mehrsprachigkeit sowie die Problematik von<br />
Sprachkonflikten, Sprachminderheiten, inner- und außersprachlichen Sprachkontakten. Der Bereich der<br />
Spracheinstellungen mit Aspekten wie Sprachattitüde, Prestige und Stigma findet ebenfalls Berücksichtigung.<br />
Neben dem linguistischen Forschungsinteresse kommt dabei inter- und transdisziplinären Zugängen mit<br />
soziologischen, psychologischen, ethnologischen, anthropologischen und geschichtswissenschaftlichen<br />
Perspektiven eine wichtige Rolle zu.<br />
Literaturangaben (Auswahl):<br />
Bochmann, K./Nelde, P.H./Wölck, W. (Hgg.) (2003): Methodology of Conflict Linguistics — Methodologie der<br />
Konfliktlinguistik — Méthodologie de la linguistique de conflit. St. Augustin: Asgard.<br />
Bott-Bodenhausen, K. (Hg.) (1996): Unterdrückte Sprachen. Sprachverbote und das Recht auf Gebrauch der<br />
Minderheitensprachen. Frankfurt am Main: Lang.<br />
Fürbeth, F./Krügel, P./Metzner, E.E./Müller, O. (Hgg.) (1999): Zur Geschichte und Problematik der Nationalphilologien<br />
in Europa. 150 Jahre Erste Germanistenversammlung in Frankfurt am Main. Tübingen:<br />
Niemeyer.<br />
Gardt, A. (Hg.) (2000): Nation und Sprache. Die Diskussion ihres Verhältnisses in Geschichte und Gegenwart.<br />
Berlin/New York: de Gruyter.<br />
Goebl, H./Nelde, P.H./Stary, Z./Wölck, W. (Hgg.) (1996 f.): Kontaktlinguistik. Ein internationales Handbuch<br />
zeitgenössischer Forschung. 2 Halbbde. Berlin/New York: de Gruyter.<br />
Manz, Viviane (2002): Sprachenvielfalt und europäische Integration. Sprachenrecht im Spannungsfeld von<br />
Wirtschaft, Politik und Kultur. Bern: Stämpfli.<br />
Williams, G. (1992): Sociolinguistics. A Sociological Critique. London/New York: Routledge.<br />
Ergänzungskurs/Colloquium: Colloquium für Fortgeschrittene<br />
Blockveranstaltung<br />
Prof. Dr. Dr. Ernest W. B. Hess-Lüttich<br />
KP: für BA/MA: 3 ECTS, für Liz.: 4 ECTS. Blockveranstaltung; Auftaktsitzung: Dienstag, 01.11.20<strong>05</strong>, 16–18;<br />
Dienstag bis Samstag, 31.01.20<strong>06</strong>–04.02.20<strong>06</strong>, jeweils 14–18<br />
Der Ergänzungskurs bzw. das Colloquium soll in erster Linie fortgeschrittenen Studierenden der Germanistik<br />
(Doktoranden, Examenskandidaten, vor allem mit Hauptfach Angewandte Linguistik und<br />
Kommunikationswissenschaft) Gelegenheit geben, ihre Projekte vorzustellen und die dabei auftretenden<br />
Probleme zu diskutieren. Darüberhinaus können Themen von gemeinsamem Interesse bearbeitet werden.<br />
Literaturangaben:<br />
Sokal, Alan & Jean Bricmont 1999: Eleganter Unsinn. Wie die Denker der Postmoderne die Wissenschaften<br />
mißbrauchen, München: C.H. Beck<br />
Wunderlich, Otto (ed.) 1993: Entfesselte Wissenschaft. Beiträge zur Wissenschaftsbetriebslehre, Opladen:<br />
Westdeutscher Verlag<br />
Anmeldungen mit Projektvorschlägen ab sofort persönlich oder per e-mail (hess@germ.unibe.ch)<br />
15