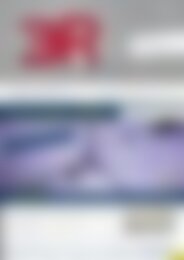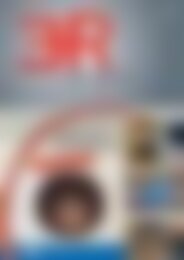3R Gipfelstürmer (Vorschau)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
12/2011<br />
ISSN 2191-9798<br />
K 1252 E<br />
Vulkan-Verlag,<br />
Essen<br />
Fachzeitschrift für sichere und<br />
effiziente Rohrleitungssysteme<br />
Erhalten<br />
was wir erhielten<br />
Die Natur ist ein fragiles System. Die größten<br />
Belastungen für die Natur entstehen durch<br />
urbane Gebiete. Helfen Sie mit, die Natur so<br />
gering wie möglich zu belasten. Rohre und<br />
Schächte aus Beton und Stahlbeton sind das<br />
Fundament, auf das Sie bauen können.<br />
www.fbsrohre.de
Als gedrucktes<br />
Heft oder<br />
digital als ePaper<br />
erhältlich<br />
Clever kombiniert und doppelt clever informiert<br />
<strong>3R</strong> + gwf Gas Erdgas<br />
im Kombi-Angebot<br />
Wählen Sie einfach das<br />
Bezugsangebot, das<br />
Ihnen am besten zusagt!<br />
· Als Heft das gedruckte,<br />
zeitlos- klassische Fachmagazin<br />
· Als ePaper das moderne, digitale<br />
Informationsmedium für Computer,<br />
Tablet oder Smartphone<br />
+<br />
<strong>3R</strong> erscheint in der Vulkan-Verlag GmbH, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen<br />
gwf Gas Erdgas erscheint in der Oldenbourg Industrieverlag GmbH, Rosenheimerstr. 145, 81671 München<br />
Oldenbourg Industrieverlag · Vulkan-Verlag<br />
www.oldenbourg-industrieverlag.de · www.vulkan-verlag.de<br />
Vorteilsanforderung per Fax: +49 (0) 931 / 4170 - 492 oder im Fensterumschlag einsenden<br />
Ja, ich möchte clever kombinieren und bestelle für ein Jahr die Fachmagazine <strong>3R</strong> (12 Ausgaben) und<br />
gwf Gas/Erdgas (12 Ausgaben) im attraktiven Kombi-Bezug.<br />
□ als Heft für 541,- zzgl. Versand (Deutschland: € 57,-/Ausland: € 66,50) pro Jahr.<br />
□ als ePaper (PDF-Datei als Einzellizenz) für 541,- pro Jahr.<br />
Vorzugspreis für Schüler und Studenten (gegen Nachweis):<br />
□ als Heft für 270,50 zzgl. Versand (Deutschland: € 57,-/Ausland: € 66,50) pro Jahr.<br />
□ als ePaper (PDF-Datei als Einzellizenz) für 270,50 pro Jahr.<br />
Nur wenn ich nicht bis von 8 Wochen vor Bezugsjahresende kündige, verlängert sich der Bezug um<br />
ein Jahr. Die sichere, pünktliche und bequeme Bezahlung per Bankabbuchung wird mit einer Gutschrift<br />
von € 20,- auf die erste Jahresrechnung belohnt.<br />
Antwort<br />
Leserservice <strong>3R</strong><br />
Postfach 91 61<br />
97091 Würzburg<br />
Firma/Institution<br />
Vorname/Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
E-Mail<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise □ Bankabbuchung □ Rechnung<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, E-Mail) oder durch<br />
Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige<br />
Absendung des Widerrufs oder der Sache an den Leserservice <strong>3R</strong>, Postfach 91 61, 97091 Würzburg<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pfl ege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten<br />
erfasst, gespeichert und verarbeitet. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich vom Oldenbourg Industrieverlag oder vom<br />
Vulkan-Verlag □ per Post, □ per Telefon, □ per Telefax, □ per E-Mail, □ nicht über interessante, fachspezifi sche Medien- und Informationsangebote<br />
informiert und beworben werde. Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen<br />
Bank, Ort<br />
Bankleitzahl<br />
✘<br />
Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer<br />
PA<strong>3R</strong>IN1211
Editorial<br />
Ein ereignisreiches Jahr geht zu<br />
Ende – und hinterlässt tiefe Spuren<br />
Liebe Leserinnen, liebe Leser,<br />
im Rückblick auf das Jahr 2011 nimmt die<br />
Reaktorkatastrophe von Fukushima einen<br />
besonderen Platz ein. Das Ereignis hatte in<br />
Deutschland zwar keinen Paradigmenwechsel<br />
zur Folge, denn der Ausstieg aus der<br />
Kernenergie war politisch bereits beschlossen<br />
und verankert, führte aber zu einer vehementen<br />
Beschleunigung dieses Vorhabens.<br />
Die dadurch verursachten „Fliehkräfte“ stellten<br />
und stellen vor allem die Versorgungsunternehmen<br />
vor große wirtschaftliche Probleme,<br />
die Atomkraftwerke betreiben. Strukturelle<br />
Veränderungen in diesen Unternehmen<br />
werden zwangsläufig daraus resultieren<br />
und die Versorgungsbranche verändern.<br />
Eine Folge aus der Katastrophe war allerdings<br />
auch, dass die Gasversorgung in<br />
Deutschland wieder in den Mittelpunkt einer<br />
zukunftsausgerichteten, sicheren Energieversorgung<br />
rückte: Kein anderes Medium<br />
bietet sich derart an, um die aus regenerativen<br />
Quellen erzeugte Energie sicher und<br />
zeitunabhängig speichern und verteilen zu<br />
können.<br />
Der Ausbau und die Werterhaltung der<br />
Netze sowie deren intelligente Verknüpfung<br />
sind die Aufgaben der nächsten Dekade, bei<br />
denen der Rohrleitungsbau eine wesentliche<br />
Rolle spielen wird. Dass dieser Ausbau nicht<br />
immer reibungslos ablaufen kann, zeigt eine<br />
Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes<br />
Lüneburg (OVG) vom 29.06.2011, das<br />
die Arbeiten an Teilbereichen an der Nordeuropäischen<br />
Erdgasleitung stoppte. Der Hintergrund<br />
zu dieser Entscheidung und die Bedeutung<br />
für den Pipelinebau in Deutschland<br />
wird in der Stellungnahme des Technischen<br />
Komitees Gastransportleitungen des DVGW<br />
„Sicherheit von Gasfernleitungen – das<br />
technische Regelwerk im Licht der aktuellen<br />
Rechtsprechung“ in dieser <strong>3R</strong>-Ausgabe verdeutlicht.<br />
Der Garant für die Sicherheit von Gasfernleitungen<br />
für die öffentliche Versorgung<br />
in Deutschland ist das DVGW-Regelwerk.<br />
Dass die darin verankerte Sicherheitsphilosophie<br />
für den Bau und Betrieb von Gasfernleitungen<br />
in der Praxis funktioniert, zeigen<br />
die Schadensstatistiken der letzten Jahrzehnte<br />
sehr deutlich.<br />
Noch einige weitere Themen haben uns in<br />
diesem Jahr beschäftigt, wie z. B. die Finanzkrise<br />
und deren Auswirkung auf die wirtschaftliche<br />
Entwicklung. Dieses Thema wird<br />
uns wohl auch noch im nächsten Jahr intensiv<br />
begleiten. Ein weiteres Thema war die Überprüfung<br />
und Instandhaltung von Grundstücksentwässerungsanlagen,<br />
das sowohl technisch<br />
als auch – auf den betroffenen Bürger bezogen<br />
– emotional „anspruchsvoll“ ist. Sowohl<br />
die Inspektions- als auch die Sanierungstechnik<br />
für diesen Bereich hat in den vergangenen<br />
Jahren enorme Fortschritte gemacht. Für die<br />
Qualitätsüberwachung der auf diesem Gebiet<br />
ausgeführten Arbeiten wurde Mitte des Jahres<br />
die Gütegemeinschaft Grundstücksentwässerung<br />
gegründet, die am 28. September<br />
ihre erste Mitgleiderversammlung abhielt, siehe<br />
Bericht in dieser Ausgabe.<br />
Das nächste Jahr wird voller Herausforderungen<br />
sein und wieder viele Veranstaltungs-<br />
Highlights bieten, wie das Oldenburger Rohrleitungsforum,<br />
die IFAT oder ACHEMA.<br />
Bevor wir uns dort hineinstürzen, wünsche<br />
ich Ihnen und Ihren Familien zum Jahresende<br />
besinnliche und ruhige Tage, ein frohes<br />
Weihnachtsfest und ein gesundes und<br />
erfolgreiches Neues Jahr 2012.<br />
Nico Hülsdau<br />
Vulkan Verlag GmbH<br />
12 / 2011 893
12/2011<br />
Inhalt<br />
S. 898 S. 906<br />
Editorial<br />
893 Ein ereignisreiches Jahr<br />
geht zu Ende – und<br />
hinterlässt tiefe Spuren<br />
Nico Hülsdau<br />
Nachrichten<br />
Industrie und Wirtschaft<br />
898 AUMA erfolgreich bei den European Business Awards<br />
898 SKZ startet Benchmarking zum Energieverbrauch<br />
899 Deutsch-Russische Zusammenarbeit für sauberes Wasser<br />
900 Tunnel als geothermisches Kraftwerk<br />
901 NORMA Group auf Rekordkurs<br />
901 SIMONA im dritten Quartal 2011 mit gutem Ergebnis<br />
Verbände und Organisationen<br />
902 Nach der Kür geht’s jetzt an die Pflicht<br />
903 Netzwerke für eine nachhaltige Wasserwirtschaft<br />
904 „Training made in Germany“ ist erfolgreich<br />
Veranstaltungen<br />
906 26. Oldenburger Rohrleitungsforum 2012<br />
907 8. GSTT–Kanalcocktail<br />
908 27. FDBR-Fachtagung Rohrleitungstechnik<br />
909 Hochwassermanagement durch Geodaten<br />
Faszination Technik<br />
928 <strong>Gipfelstürmer</strong><br />
Rinninger<br />
910 Kathodischer Korrosionsschutz für Wasserrohrleitungen aus Stahl<br />
910 Kunststoffe im Anlagenbau<br />
911 GeoTHERM 2012 – Eine Branche präsentiert sich<br />
894 12 / 2011
S. 912<br />
Normen & Regelwerk<br />
Stellungnahme<br />
912 Sicherheit von Gasfernleitungen – das technische<br />
Regelwerk im Licht der aktuellen Rechtsprechung<br />
Technisches Komitee Gastransportleitungen des DVGW<br />
Fachbericht<br />
920 Die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes<br />
(EEG)<br />
Von Julian Menze<br />
Leistung auf Dauer präzise<br />
Kraftvoll, präzise, korrosionsgeschützt<br />
AUMA produziert Antriebe für Armaturen mit wenigen Zentimetern<br />
Durchmessern bis hin zu metergroßen Schützen an Wehren. Kombiniert<br />
mit den modernen AUMA Steuerungskonzepten und ideal eingebunden<br />
in leistungsfähige Feldbus-Leitsysteme.<br />
Interview<br />
925 Für Qualität beim Kunststoffrohrschweißen<br />
Michael Dommer, WIDOS GmbH<br />
■<br />
■<br />
■<br />
■<br />
Im modularen AUMA Konzept perfekt angepasst<br />
Intelligente Antriebslösungen entlasten das Leitsystem<br />
Perfekt angepasst an unterschiedlichste Armaturentypen<br />
und -größen<br />
Weltweite Erfahrung, globaler Service<br />
Produkte & Verfahren<br />
Stellantriebe für die Wasserwirtschaft<br />
932 Ultraschall-Prüfverfahren zeigt Fehlstellen in 3D<br />
932 Tauchmotorpumpen halten Tunnelbaustelle<br />
trocken<br />
933 Hochtemperaturleiter für schnellen und günstigen<br />
Netzausbau geeignet<br />
933 Sauberes Trinkwasser dank norm gerechtem<br />
Systemtrenner<br />
934 Automatische Überwachung für Leichtflüssigkeitsabscheider<br />
934 Überwachungssysteme für Nah- und Fernwärmenetze<br />
AUMA Riester GmbH & Co. KG<br />
Postfach 1362 • 79373 Müllheim, Germany<br />
Tel. +49 7631 809-0 • riester@auma.com<br />
www.auma.com<br />
12 / 2011 895
12/2011<br />
Inhalt<br />
S. 940 S. 956 S. S. 960 350<br />
Gasversorgung & Pipelinebau<br />
Fachbericht<br />
936 Leitungsbau in Zeiten der Energiewende – Ausbau auf allen Ebenen<br />
Von Lukas Romanowski und Dieter Hesselmann<br />
Fachbericht<br />
940 Kathodischer Korrosionsschutz von Rohrleitungsstählen<br />
Von Markus Büchler und Hanns-Georg Schöneich<br />
Fachbericht<br />
948 CO 2<br />
-Mess- und Regelanlage: Anforderungen eines Netzbetreibers<br />
Von Klaus Steiner<br />
Fachbericht<br />
952 Experimentelle Untersuchung der PE-Werksumhüllung einer erdverlegten<br />
Erdgasfernleitung unter sicherheitstechnischen Aspekten<br />
Von Sebastian Rolwers, Bernd-Andre Stratmann und Urs Pedrazza<br />
Projekt kurz beleuchtet<br />
956 Querungen von Verkehrswegen im dynamischen Rammverfahren –<br />
Aktuelles vom NEL-Pipelinebau<br />
Projekt kurz beleuchtet<br />
958 Ertüchtigung der Gas-Druckregel- und Messanlage des Werks<br />
Dow Stade<br />
Services<br />
967 Marktübersicht<br />
992 Praxis-Tipps<br />
993 Terminkalender<br />
3.US Impressum<br />
Wasserversorgung<br />
Fachbericht<br />
960 Reinigung, Desinfektion und Armatureninspektion<br />
Von Dr. Norbert Klein<br />
Projekt kurz beleuchtet<br />
965 Nachhaltige Wassergewinnung in Jordanien dank deutscher Pumpentechnik<br />
– Wilo beteiligt sich an Vorzeigeprojekt der Entwicklungshilfe<br />
896 12 / 2011
Abwasserentsorgung<br />
Fachbericht<br />
978 Wurzeleinwuchs in private und kommunale<br />
Kanalsysteme<br />
Von Michael Honds<br />
Fachbericht<br />
982 Gestickte Materialien zur Unterstützung der<br />
Reinigung von Abwasserleitungen<br />
Von Nora Grawitter und Jörg Labahn<br />
Projekt kurz beleuchtet<br />
986 Ausbau des Hochwasserschutzes in Glashütte<br />
6. Praxistag<br />
Korrosionsschutz<br />
am 13. Juni 2012<br />
in Gelsenkirchen<br />
Veranstaltet von:<br />
Projekt kurz beleuchtet<br />
988 Schlauchlining im Großprofil mit 90°-Bogen<br />
Projekt kurz beleuchtet<br />
990 Instandsetzung des Abwasserpumpwerks in<br />
Halle-Neustadt<br />
www.praxistag-korrosionsschutz.de<br />
7. - 9 . 2 . 2 0 1 2<br />
E s s e n / G e r m a n y<br />
GAS ALS TREIBER DER ENERGIEWENDE<br />
ANALYSIEREN SIE NEUESTE ENTWICKLUNGEN UND STRATEGIEN AUF<br />
DEM KONGRESS DER E-WORLD ENERGY & WATER<br />
Das goldene Zeitalter des Gas<br />
und die Perspektiven für den<br />
deutschen Markt<br />
Gaspreise, Ölpreise, Kohlepreise:<br />
Zusammenhang und Bedeutung<br />
der Preisentwicklungen<br />
Wärmemarkt und Stromerzeugung<br />
im Zeichen der<br />
„Energiewende“<br />
Shale Gas in Europa:<br />
Welche Potenziale<br />
bestehen wirklich?<br />
Gasvertrieb:<br />
Ein Geschäftsmodell für<br />
den Endkundenvertrieb<br />
Wie behaupten sich kleinere<br />
Stadtwerke im Gasmarkt?<br />
PROGRAMM UND ANMELDUNG FINDEN SIE UNTER<br />
www.e-world-2012.com/kongress<br />
12 / 2011 897
Industrie und Wirtschaft<br />
Nachrichten<br />
AUMA erfolgreich bei den European Business<br />
Awards<br />
Die AUMA-Geschäftsführer Henrik Newerla und Matthias Dinse freuen sich über die<br />
Auszeichnung. Links Franz-Josef Schürmann vom Hauptsponser Infosys, ganz rechts<br />
Adrian Tripp, Gründer und Geschäftsführer der European Business Awards<br />
Die Spannung war groß bei der Preisverleihung<br />
am 22. November im Palau de Congressos<br />
de Catalunia in Barcelona, als die<br />
Gewinner der European Business Awards<br />
bekanntgegeben wurden. Ganz gereicht<br />
hat es für die AUMA Riester GmbH & Co KG<br />
aus Müllheim nicht. Der erste Preis in der<br />
Kategorie Business of the Year ging an das<br />
Modeunternehmen H & M in Schweden.<br />
„Dass wir uns erst auf der Zielgeraden einem<br />
Weltunternehmen mit Milliardenumsätzen<br />
geschlagen geben müssen ist für<br />
uns als Mittelständler ein großer Erfolg“, so<br />
Matthias Dinse, AUMA-Geschäftsführer.<br />
AUMA wurde, wie alle Finalisten, mit<br />
dem Ruban d’Honneur ausgezeichnet. Bewertet<br />
wurde das gesamte Geschäftsmodell<br />
der Bewerber, dazu zählen die Innovationskraft<br />
bei der Produktentwicklung, die<br />
Kundenorientierung, der Umgang mit den<br />
Mitarbeitern, aber auch das soziale Engagement<br />
des Unternehmens. Die hochkarätig<br />
besetzte Jury, darunter der frühere<br />
belgische Ministerpräsident Yves Leterme,<br />
der ehemalige EU Kommisar Günter Verheugen<br />
und BP Vizepräsident Luc Bardin,<br />
legte eine besonderes Augenmerk darauf,<br />
wie die Firmen die Wirtschaftskrise der<br />
vergangenen beiden Jahre bewältigt haben.<br />
„Nur wer in all diesen Punkten überzeugte,<br />
konnte in diesem Wettbewerb bestehen“,<br />
sagt der technische Geschäftsführer<br />
Henrik Newerla, „ die Auszeichnung<br />
ist eine schöne Bestätigung der AUMA-<br />
Firmenphilosophie.“<br />
AUMA ist ein weltweit führender Hersteller<br />
elektrischer Stellantriebe. Diese<br />
Geräte spielen eine entscheidende Rolle<br />
bei der Automatisierung prozesstechnischer<br />
Anlagen. Dazu zählen beispielsweise<br />
Wasserwerke, Kläranlagen, Kraftwerke,<br />
Raffinerien oder Tanklager. Am<br />
Firmenhauptsitz in Müllheim beschäftigt<br />
das Unternehmen 600 Mitarbeiter, weltweit<br />
sind es 2 000.<br />
SKZ startet Benchmarking zum Energieverbrauch<br />
Bei der Herstellung von Rohren, z. B. aus<br />
PE-HD, PP oder PVC, werden Kosten und<br />
Gewinn maßgeblich von den Rohstoffkosten<br />
dominiert, so dass nur noch wenig<br />
Spielraum zur Senkung der Produktkosten<br />
besteht. Eine der wenigen verbleibenden<br />
Einflussmöglichkeiten ist die Reduzierung<br />
des Energieverbrauchs.<br />
Dementsprechend haben viele Anlagenhersteller<br />
und Verarbeiter frühzeitig<br />
Maßnahmen zur Energieeinsparung eingeleitet<br />
und dafür ihre spezifischen technologischen<br />
Ansätze und Prozessoptimierungen<br />
gewählt. Erkenntnisse über Einsparungspotenziale<br />
und Lösungswege beschränken sich<br />
damit jeweils auf das eigene Unternehmen.<br />
Ein umfassender Vergleich im Branchenumfeld<br />
findet nicht statt. Somit werden Chancen<br />
vertan, alternative Lösungswege, zusätzliche<br />
erzielbare Potenziale und mögliche<br />
Synergieeffekte bleiben ungenutzt. Die<br />
notwendige Voraussetzung dies zu ändern,<br />
ist eine unabhängige energetische Analyse<br />
der Herstellungsverfahren nach einem reproduzierbaren<br />
Messschema.<br />
Hier setzt ein neues Projekt des SKZ an:<br />
„Energiebenchmarking und Steigerung der<br />
Energieeffizienz für Rohrextrusionsverfahren“.<br />
Vorrangiges Ziel ist die energetische<br />
Analyse verschiedener Extrusionsverfahren<br />
für unterschiedliche Kunststoffrohre. Den<br />
Impuls gab ein großer deutscher Rohrhersteller,<br />
der auch im Projekt mitarbeitet.<br />
Mit den Ergebnissen der Analyse wird<br />
Verarbeitern erstmals eine unabhängige,<br />
objektive Daten- und Bewertungsgrundlage<br />
zur Verfügung stehen. Individuell gemessene<br />
Verbrauchswerte werden dabei<br />
vertraulich behandelt, während das Spektrum<br />
der Ergebnisse jedem teilnehmenden<br />
Unternehmen die energetische Einordnung<br />
der eigenen Herstellungsprozesse innerhalb<br />
des Branchenspektrums ermöglicht. Die<br />
detaillierten Messergebnisse dienen zudem<br />
als Basis für weitergehende Optimierungen<br />
der Energieeffizienz.<br />
Die Messungen umfassen die Aufnahme<br />
elektrischer, thermischer und pneumatischer<br />
Energie im industriellen Produktionszyklus.<br />
Die ermittelten spezifischen Kennzahlen,<br />
z. B. die spezifischen Antriebs-,<br />
Heiz-, Vakuum- und Rückkühlenergien,<br />
werden für die unterschiedlichen Verfahren<br />
und Produkte anschließend nach Kunststoff,<br />
Rohrdimension und Maschine gruppiert, um<br />
eine Vergleichbarkeit innerhalb der Ergebnisse<br />
zu gewährleisten. Für jedes Unternehmen<br />
wird abschließend eine individuelle<br />
Auswertung aufbereitet und präsentiert.<br />
Das SKZ lädt interessierte Unternehmen<br />
dazu ein, noch in das jüngst gestartete<br />
Projekt einzusteigen.<br />
Kontakt: SKZ – TeConA GmbH,<br />
Würzburg, Dr. Jürgen Wüst,<br />
Tel. +49 931-4104-238,<br />
E-Mail: j.wuest@skz.de, www.skz.de<br />
898 12 / 2011
Deutsch-Russische<br />
Zusammenarbeit für<br />
sauberes Wasser<br />
Am 29. November wurde in der russischen Gebietshauptstadt<br />
Khabarovsk, nahe der chinesischen Grenze,<br />
der erste Abschnitt einer neuen Trinkwasserwasserversorgung<br />
eingeweiht. Bis 2018 soll hier das<br />
weltweit größte Wasserwerk mit unterirdischer Aufbereitung<br />
entstehen. Das Projekt ist eines der größten<br />
Infrastrukturvorhaben Russlands: Allein bis 2013<br />
betragen die Investitionen etwa 11 Mrd. Rubel. Die<br />
Planungs- und Ingenieurgesellschaft ARCADIS ist an<br />
der Entwicklung und dem Bau der Anlage maßgeblich<br />
beteiligt.<br />
Die Inbetriebnahme des Startkomplexes erfolgte<br />
durch den Gouverneur des Khabarovsker Gebiets,<br />
Wjatscheslav Schport, den stellvertretenden Minister<br />
für Regionalentwicklung Vladimir Tokarev und den Bürgermeister<br />
von Khabarovsk, Alexander Sokolov. Vladimir<br />
Steblevsky von dem städtischen Versorgungsunternehmen<br />
betonte den internationalen Charakter und die<br />
strategische Bedeutung des Projekts für Russland. Tatsächlich<br />
findet das Khabarovsker-Projekt russlandweit<br />
Beachtung. Auch Ministerpräsident Putin informierte<br />
sich bereits vor Ort über den Fortgang der Arbeiten,<br />
denn die Versorgung mit sauberem Trinkwasser ist in<br />
Russland ein Problem.<br />
In Khabarovsk soll die Trinkwassergewinnung von<br />
Oberflächenwasser aus dem Fluss Amur, der durch Zuflüsse<br />
aus China stark mit Chemikalien verunreinigt ist,<br />
auf Grundwasser umgestellt werden. Dies könnte ein<br />
mögliches Modell für viele Regionen Russlands sein,<br />
ebenso wie die unterirdische Wasseraufbereitung.<br />
Das Verfahren, bei dem Eisen und Mangan entfernt<br />
werden, bevor das Wasser an die Oberfläche gepumpt<br />
wird, bietet Vorteile: Weil das Eisen entfernt wird, bevor<br />
das Wasser die Rohre durchfließt, kann es sich in<br />
ihnen nicht ablagern, wodurch die Brunnen eine hohe<br />
Lebensdauer haben. Wartungs- und energieaufwändige<br />
oberirdische Filteranlagen sind nicht nötig. Der Einsatz<br />
von Chemikalien entfällt ebenso wie die Behandlung<br />
bzw. Entsorgung von Spülwasser und Schlämmen.<br />
Bevor der örtliche Wasserversorger Vodokanal<br />
ARCADIS mit der Planung der ersten Sektion des Wasserwerks<br />
beauftragte, war die Machbarkeit der unterirdischen<br />
Aufbereitung zunächst in einem mehrjährigen,<br />
von ARCADIS geplanten und durchgeführten Pilotprojekt<br />
untersucht und – nach Verfahrensverbesserungen<br />
– bestätigt worden.<br />
Die jetzt eingeweihte erste Sektion des Wasserwerks<br />
umfasst zwölf Brunnen mit einer Förderkapazität<br />
von 25.000 m 3 pro Tag. Bis 2018 sollen vier weitere<br />
baugleiche Sektionen realisiert werden.<br />
Treffpunkt der Wirtschaft und Wissenschaft, Marktplatz<br />
umfangreichen Know-hows und Neuestem aus<br />
der Fachwelt.<br />
26. Oldenburger Rohrleitungsforum<br />
09. bis 10. Februar 2012<br />
mehr als 3.000 Besucher aus Praxis und<br />
Hochschule, der freien Wirtschaft und aus<br />
der Wissenschaft<br />
mehr als 100 Fachvorträge aus allen<br />
Facetten der Branche, schaffen Wissen<br />
für die Praxis und sorgen für Impulse für die<br />
Forschung<br />
mehr als 350 internationale Aussteller zeigen<br />
nicht nur Neuestes aus Wissenschaft und Praxis,<br />
sondern fördern den Austausch unter- und<br />
miteinander.<br />
Anmeldungen und weitere Informationen:<br />
Institut für Rohrleitungsbau<br />
an der Fachhochschule Oldenburg e.V.<br />
Ofener Straße 18 / 26121 Oldenburg<br />
Frau Ina Kleist<br />
Tel. 0441 361039-0 / Fax 0441 361039-10<br />
E-mail ina.kleist@iro-online.de / www.iro-online.de<br />
12 / 2011 899
Industrie und Wirtschaft<br />
Nachrichten<br />
Tunnel als geothermisches Kraftwerk<br />
Tunnelbauwerke können durch ihre großen<br />
Flächen, die an das Erdreich oder den Fels<br />
anliegen, ein hohes Maß an geothermischer<br />
Energie liefern. Auch die Tunnelluft kann einen<br />
nicht unerheblichen Beitrag zur Energiegewinnung<br />
leisten. Dieses energetische<br />
Potenzial wird zunehmend erkannt und dabei<br />
versucht, es nutzbar zu machen. Der<br />
Polymerspezialist Rehau hat hierzu ein einzigartiges<br />
System entwickelt.<br />
Thermische Nutzung der Flächen<br />
Da die Flächen eines Tunnels meist<br />
aus Beton hergestellt werden, können sie<br />
durch Einlegen von Absorberleitungen<br />
thermisch aktiviert und zu Wärmetauschzwecken<br />
genutzt werden. Hierzu werden<br />
Rohrleitungen in den Frischbeton integriert,<br />
durch die später ein Wärmeträger<br />
strömt. Auf diese Weise kann zum Beispiel<br />
im Winter aus dem Bauwerk Wärme entzogen<br />
und zu Heizzwecken in der Umgebung<br />
verwendet werden. Im Sommer hingegen<br />
kann Abwärme in das kühlere Bauwerk<br />
abgeführt werden. Darüber hinaus<br />
können Tunnelbauwerke, die zu Überhitzung<br />
neigen (zum Beispiel U-Bahn-Tunnel),<br />
über die Temperierung der Konstruktion<br />
gekühlt werden.<br />
Rehau hat hierfür das Rohrleitungssystem<br />
RAUWAY flex entwickelt. Das äußerst<br />
robuste Kollektorrohr besteht aus hochdruckvernetztem<br />
Polyethylen (PE-Xa) und<br />
ist mit einer UV-stabilisierten grauen Außenschicht<br />
versehen. Es ist unempfindlich<br />
gegenüber Kerben, Riefen und Punktlas-<br />
ten und auch bei engen Biegeradien betriebssicher.<br />
Energietübbings im Jenbach-Tunnel<br />
Um die Wärme auch bei maschinell vorgetriebenen<br />
Tunneln bestmöglich nutzen<br />
zu können, wurde in enger Zusammenarbeit<br />
von Rehau mit der Züblin AG ein sogenannter<br />
Energietübbing entwickelt. Tübbings<br />
sind Betonfertigteile, die gemeinsam<br />
die Tunnelschale bilden. Damit sie der Umgebung<br />
Wärme entziehen oder sie in das<br />
Bauwerk einspeisen können, werden in die<br />
Energietübbings RAUWAY flex-Rohrleitungen<br />
verlegt. Schließlich werden sie zu einem<br />
Kreislauf verbunden und an eine Wärmepumpe<br />
angeschlossen.<br />
Nachdem der Energietübbing bereits in<br />
Labor- und Feldversuchen ausgiebig getestet<br />
wurde, wurde er erstmals im Eisenbahntunnel<br />
Jenbach zur Versorgung eines Gebäudes<br />
eingebaut. Dazu wurde eine Tunnellänge<br />
von 54 m mit Energietübbings<br />
ausgerüstet. Die integrierten Absorberleitungen<br />
wurden über einen Rettungsschacht<br />
an die Oberfläche geführt und dort mit einer<br />
Wärmepumpe verbunden, die den Bauhof<br />
der österreichischen Gemeinde Jenbach<br />
mit Heizenergie versorgt. Bei diesem Projekt<br />
handelt es sich um das erste in einem<br />
maschinell aufgefahrenen Tunnel integrierte<br />
Geothermie-Kraftwerk.<br />
Ähnliche Projekte wurden auch in<br />
Deutschland mit dem Ausbau des Stadtbahnabschnittes<br />
der U6 in Stuttgart sowie<br />
im Katzenbergtunnel erfolgreich durchgeführt.<br />
International Tunneling Award 2011<br />
Diese innovative und auf dem Markt einzigartige<br />
Technik hat weltweites Interesse<br />
ausgelöst. So wurde Rehau gemeinsam<br />
mit dem Planungsbüro Arup und dem Gesamtunternehmer<br />
Züblin am 01. Dezember<br />
2011 in Hong Kong in der Kategorie „Technische<br />
Innovation des Jahres“ mit dem International<br />
Tunneling Award 2011 ausgezeichnet.<br />
Für die thermische Nutzung von Tunnelflächen hat Rehau das Rohrleitungssystem RAUWAY<br />
flex aus hochdruckvernetztem Polyethylen (PE-Xa) entwickelt. Um die Tunnelwände thermisch<br />
zu aktivieren, werden in die Energietübbings die RAUWAY flex-Rohrleitungen eingelegt<br />
(Bildrechte: REHAU AG + Co)<br />
900 12 / 2011
NORMA Group auf Rekordkurs<br />
Nach den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres<br />
2011 liegt die NORMA<br />
Group AG weiterhin auf Rekordkurs.<br />
Das SDAX-Unternehmen steigerte seinen<br />
Umsatz von Januar bis September<br />
2011 um 22,2 % auf 441,7 Millionen Euro<br />
(Vorjahr: 361,5 Millionen Euro). Davon<br />
entfallen 16,4 % auf organisches<br />
und 7,4 % auf akquisitorisches Wachstum.<br />
Das bereinigte betriebliche Ergebnis<br />
(bereinigtes EBITA) hat NORMA Group<br />
gegenüber dem Vergleichszeitraum des<br />
vergangenen Jahres um 23,6 % auf 80,1<br />
Millionen Euro (Vorjahr: 64,8 Millionen<br />
Euro) verbessert. Die bereinigte EBITA-<br />
Marge lag bei 18,1 % (Vorjahr: 17,9 %).<br />
Das dritte Quartal zeigte ein anhaltend<br />
dynamisches Wachstum. Der Quartalsumsatz<br />
verbesserte sich gegenüber<br />
dem Vorjahreswert um 11,4 % auf 145,8<br />
Millionen Euro (Vorjahr: 131,0 Millionen<br />
Euro). Das operative Quartalsergebnis<br />
(bereinigtes EBITA) erhöhte sich um<br />
15,3 % auf 26,2 Millionen Euro (Vorjahr:<br />
22,7 Millionen Euro).<br />
Aufgrund der erfreulichen Geschäftsentwicklung<br />
hat NORMA Group die Prognose<br />
für das Umsatzwachstum verbessert.<br />
Für das Gesamtjahr 2011 erwartet<br />
das Unternehmen jetzt einen organischen<br />
Umsatzzuwachs von etwa 12 %.<br />
Dieser Wert liegt am oberen Ende der zuvor<br />
festgesetzten Bandbreite von 10 bis<br />
12 %. Damit liegt der erwartete Jahresumsatz<br />
einschließlich Akquisitionen bei<br />
rund 570 Millionen Euro. Beim operativen<br />
Ergebnis wird weiterhin eine bereinigte<br />
Ziel-EBITA-Marge für das Gesamtjahr<br />
nahe 18,0 % angestrebt. Das Auftragsbuch<br />
von rund 240 Millionen Euro sichert<br />
NORMA Group eine gute Visibilität bis<br />
zum Ende des Geschäftsjahres.<br />
SIMONA im dritten Quartal<br />
2011 mit gutem Ergebnis<br />
Auftraggeber und<br />
Auftragnehmer ...<br />
... gemeinsam für<br />
Qualität<br />
Ihr Partner bei<br />
der Bewertung der<br />
■ Fachkunde<br />
■ technischen<br />
Leistungsfähigkeit<br />
■ technischen<br />
Zuverlässigkeit<br />
der ausführenden<br />
Unternehmen<br />
Der SIMONA-Konzern konnte auch im<br />
dritten Quartal 2011 bei Absatz und<br />
Umsatz zulegen. Das Wachstum hat sich<br />
jedoch verlangsamt. Grund ist vor allem<br />
die Banken- und Staatsfinanzenkrise, die<br />
seit Mitte des Jahres zunehmend Unsicherheiten<br />
auf den Märkten auslöst. Das<br />
hemmt die Investitionsneigung in wichtigen<br />
Kundenbranchen, insbesondere in<br />
der Photovoltaik- und Solarindustrie.<br />
Insgesamt wurden im Konzern bis zum<br />
30.09.2011 Umsatzerlöse von 241,2<br />
Mio. EUR (Vj. 199,7 Mio. EUR) erzielt<br />
und damit 20,8 % mehr als im Vorjahreszeitraum.<br />
Im ersten Halbjahr 2011 wurde<br />
noch ein Umsatzwachstum von 25,1 %<br />
gegenüber dem Vorjahr erzielt. Im dritten<br />
Quartal 2011 betrug der Konzernumsatz<br />
78,9 Mio. EUR nach 70,0 Mio.<br />
EUR im dritten Quartal 2010. Das entspricht<br />
einer Steigerung von 12,8 %.<br />
Im Geschäftsbereich Halbzeuge<br />
konnten extrudierte und gepresste<br />
Platten aus Polypropylen die größten<br />
Zuwächse erzielen. Das Wachstum bei<br />
PVC Platten fiel verhaltener aus. Im Geschäftsbereich<br />
Rohrleitungsbau haben<br />
sich die Umsatzerlöse mit Formteilen aus<br />
PE deutlich erhöht, während der Umsatz<br />
von PE Rohren rückläufig war.<br />
Auch im dritten Quartal zeigten sich<br />
die Rohstoffpreise auf sehr hohem Niveau,<br />
wenn auch mit leicht rückläufiger<br />
Tendenz. Trotz eines fast unverändert<br />
hohen Materialaufwands konnte<br />
das EBIT auf 5,5 Mio. EUR (3. Q.<br />
2010: 1,7 Mio. EUR) gesteigert werden.<br />
Die EBIT-Marge beträgt 7,0 Prozent.<br />
Das Ergebnis vor Ertragsteuern<br />
beträgt 5,5 Mio. EUR (3. Q. 2010:<br />
1,5 Mio. EUR).<br />
neutral – fair –<br />
zuverlässig<br />
Gütesicherung Kanalbau<br />
steht für eine objektive<br />
Bewertung nach einheitlichem<br />
Maßstab<br />
Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961<br />
12 / 2011 901
Verbände und Organisationen<br />
Nachrichten<br />
Güteschutz Grundstücksentwässerung<br />
Nach der Kür geht’s jetzt an die Pflicht<br />
Um die Qualität von Anlagen der Grundstücksentwässerung<br />
zu verbessern, und<br />
insbesondere um Verunreinigungen von<br />
Grundwasser, Gewässer und Boden zu<br />
vermeiden, hat die DWA (Deutsche Vereinigung<br />
für Wasserwirtschaft, Abwasser<br />
und Abfall e.V.) zusammen mit dem<br />
ZVSHK (Zentralverband Sanitär Heizung<br />
Klima), dem Güteschutz Kanalbau, der<br />
GFA (Gesellschaft zur Förderung der Abwassertechnik<br />
e.V.) und der ÜWG-SHK<br />
(Überwachungsgemeinschaft Technische<br />
Anlagen der SHK-Handwerke e.V.)<br />
seit Jahren intensiv an der Erarbeitung<br />
eines RAL-Gütezeichens für die Grundstücksentwässerung<br />
gearbeitet. Einheitliche<br />
Qualitätsstandards für die Herstellung,<br />
baulichen Unterhalt, Prüfung und<br />
Sanierung von Grundstücksentwässerungsanlagen<br />
sind nun in den Güte- und<br />
Prüfbestimmungen des RAL-GZ 968 niedergeschrieben<br />
und werden von der neuen<br />
Gütegemeinschaft Grundstücksentwässerung<br />
überwacht.<br />
Das RAL Deutsches Institut für Gütesicherung<br />
und Kennzeichnung e.V. bescheinigte<br />
am 26. Mai 2011 seine Zustimmung<br />
zur Satzung der neuen Gütegemeinschaft<br />
Grundstücksentwässerung.<br />
Bereits fünf Tage später, am 1. Juni 2011,<br />
BILD (v.r.n.l.): Rolf Usadel, Dirk Bellinghausen (Geschäftsführer), Fritz Schellhorn<br />
(stellv. Vorsitzender), Karl-Heinz Flick (Vorstandsvorsitzender), Dr. Marco Künster,<br />
Norbert Wulf<br />
wird der Verein unter „Gütegemeinschaft<br />
Herstellung, baulicher Unterhalt, Sanierung<br />
und Prüfung von Grundstücksentwässerungen<br />
e.V. – „Güteschutz Grundstücksentwässerung“<br />
mit der notariellen<br />
Urkunde URNr. 869/11 im Vereinsregister<br />
beim Amtsgericht Siegburg angemeldet;<br />
Dipl.-Ing. Dirk Bellinghausen tritt am<br />
gleichen Tag die Geschäftsführung an. Die<br />
Eintragung ins Vereinsregister erfolgte am<br />
15. Juli 2011 unter der Register-Nummer<br />
VR 3057. Mit der Bescheinigung für<br />
das neue Gütezeichen Grundstücksentwässerung<br />
und der Übereinkunftserklärung<br />
durch RAL am 22. August 2011 ist<br />
das RAL-Anerkennungsverfahren abgeschlossen.<br />
Das Gütezeichen kann nun als<br />
Kollektivmarke beim Deutschen Patentund<br />
Markenamt angemeldet und eingetragen<br />
werden.<br />
RAL hatte vor dieser formalen Anerkennung<br />
zur Voraussetzung gemacht, dass<br />
Beurteilungsgruppen, die sich ausschließlich<br />
auf die Grundstücksentwässerung beziehen,<br />
zwingend in die neue Gütegemeinschaft<br />
zu integrieren sind. Dies betrifft die<br />
heutige Beurteilungsgruppe G der Gütesicherung<br />
Kanalbau, also den kombinierten<br />
Nachweis für die Reinigung, Inspektion<br />
und Dichtheitsprüfung auf privaten Grundstücken.<br />
Gütezeicheninhaber der Beurteilungsgruppe<br />
„G“ erhalten ab dem 1. Januar<br />
2012 automatisch das korrespondierende<br />
Gütezeichen des Güteschutz Grundstücksentwässerung;<br />
bis dahin gilt selbstverständlich<br />
das bestehende Gütezeichen „Kanalbau“<br />
Gruppe G, RAL-GZ 961.<br />
Für Unternehmen, die ausschließlich<br />
die Beurteilungsgruppe G führen, endet<br />
vereinbarungsgemäß die Mitgliedschaft in<br />
der Gütegemeinschaft Kanalbau zum Jahresende.<br />
Unternehmen, die noch weitere<br />
Beurteilungsgruppen „Kanalbau“ führen,<br />
bleiben unverändert Mitglied in der Gütegemeinschaft<br />
Kanalbau. Eine zusätzliche<br />
Mitgliedschaft in der neuen Gütegemeinschaft<br />
Grundstücksentwässerung ist nicht<br />
erforderlich.<br />
Die vielen und positiven Berichte der<br />
Fachpresse über die Gründung der neuen<br />
Gütegemeinschaft haben zum einen<br />
schnell für einen großen Bekanntheitsgrad<br />
gesorgt und zum anderen den Startup unterstützt<br />
und erleichtert. Die begonnene<br />
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wird natürlich<br />
weiter vorangetrieben und kontinuierlich<br />
fortgeführt. Dazu gehört auch<br />
die Nutzung verschiedener Plattformen,<br />
wie z.B.<br />
Veranstaltungen der DWA und Regionalveranstaltungen<br />
der DWA-Landesverbände<br />
Sitzungen des DWA-Hauptausschusses<br />
Entwässerungssysteme HA-ES<br />
die Seminarreihe zum Arbeitsblatt<br />
DWA-A 139<br />
die Kanalinspektionstage Dortmund<br />
(Dezember 2011)<br />
die Gemeinschaftstagung ZVSHK und<br />
DWA, Gebäude- und Grundstücksentwässerung,<br />
Fulda (Januar 2012)<br />
Auch wird an der Internetpräsenz mit<br />
Hochdruck gearbeitet, die neue Homepage<br />
wird in Kürze online geschaltet, und<br />
unter www.gs-ge.de erreichbar sein. Auf<br />
der 1. Mitgliederversammlung am 28.<br />
September 2011 in Berlin begrüßte der<br />
Vorstandsvorsitzende, Bau-Ass. Dipl.-Ing.<br />
Karl-Heinz Flick, die Mitglieder und Gäste<br />
und stellte ihre ordnungsgemäße Einberufung<br />
und Beschlussfähigkeit fest.<br />
Im Fokus der Veranstaltung standen<br />
die Gespräche mit den Verbänden<br />
902 12 / 2011
VSB (Verband Zertifizierter Sanierungsberater<br />
für Entwässerungssysteme e.V.),<br />
VDRK (Verband Deutscher Rohr- und Kanal-Technik-Unternehmen<br />
e.V.) sowie RSV<br />
e.V. (Rohrleitungssanierungsverband). Das<br />
Thema Sanierung in der Grundstücksentwässerung<br />
ist zurzeit der Hinderungsgrund<br />
für den Beitritt des VDRK und des<br />
RSV. Beide Vorstandsvorsitzende, Andreas<br />
Herrmann, VDRK, und Dipl.-Ing. Lutz<br />
Kretschmann, RSV, nahmen als Gäste an<br />
der Mitgliederversammlung teil. Es wird<br />
derzeit versucht, Schnittstellen aufzuzeigen,<br />
da auch der Ausführungsbereich Sanierung<br />
in die Gütegemeinschaft Grundstücksentwässerung<br />
gehört.<br />
Die Gütegemeinschaft bleibt mit den<br />
vorgenannten Verbänden weiter im Gespräch<br />
und wird sich zur Thematik Gütesicherung<br />
Sanierung in der Grundstücksentwässerung<br />
„S-GE“ neu positionieren.<br />
Nach der Abhandlung rein organisatorischer<br />
Angelegenheiten wählte die Mitgliederversammlung<br />
einstimmig für die<br />
Dauer von zwei Jahren Dipl.-Ing. Karsten<br />
Flansche<br />
Rohrbogen<br />
T-Stücke<br />
Reduzierungen<br />
Direkt vom<br />
Fachhandel<br />
Im Finigen 17; D-28832 Achim-Uesen<br />
Tel: 04202 9555 0; Fax: 04202 9555 10<br />
Website: www.pmfi ttings.de; E-Mail: info@pmfi ttings.de<br />
Anzeige_PM.indd 1 31.03.2010 14:14:44<br />
Selleng (Obmann), Franz-Josef Heinrichs,<br />
Dipl.-Ing. H.C. Möser, Dipl.-Ing. Norbert<br />
Wulf und Dipl.-Ing. Ulrich Bachon in den<br />
Güteausschuss des Güteschutz Grundstücksentwässerung.<br />
Ab sofort prüft der Güteausschuss Gütezeichenanträge,<br />
benennt neutrale Prüfstellen<br />
für die Prüfung von Gütezeichenanträgen<br />
und überwacht die Einhaltung<br />
der Güte- und Prüfbestimmungen nach<br />
RAL-GZ 968.<br />
Weitere Auskünfte erteilt die Geschäftsstelle<br />
Güteschutz Grundstücksentwässerung<br />
e.V. (www.gs-ge.de).<br />
Netzwerke für eine nachhaltige Wasserwirtschaft<br />
Bild (v.l.): Tom Vereijken, EWP, und Michael Beckereit,<br />
GWP (Quelle WILO SE)<br />
Wie deutsche Unternehmen vor dem Hintergrund<br />
der globalen Herausforderungen<br />
im Wassersektor im internationalen Projektgeschäft<br />
erfolgreich sein können, war<br />
Thema der gemeinsamen GWP-WILO-<br />
Fachtagung am 10.11.2011 in Berlin. Unter<br />
dem Motto „Den<br />
Wandel im Netzwerk gestalten<br />
– aktiv, vorausschauend,<br />
nachhaltig“<br />
trafen sich mehr als 100<br />
international tätige Mitgliedsunternehmen<br />
und<br />
Vertreter/-innen aus Politik<br />
und Verbänden zum<br />
Erfahrungsaustausch.<br />
Eine der zentralen Botschaften<br />
war, dass die<br />
Wettbewerbsposition<br />
der deutschen Wasserwirtschaft<br />
auf den weltweiten<br />
Zukunftsmärkten<br />
durch Kooperationen<br />
und die Bündelung<br />
von Know-how weiter<br />
gestärkt werden muss.<br />
Am Vorabend der Veranstaltung<br />
unterzeichneten<br />
German Water Partnership (GWP)<br />
und European Water Partnership (EWP)<br />
ein Memorandum of Understanding zur<br />
Intensivierung der Zusammenarbeit. Tom<br />
Vereijken, Vorsitzender von EWP, sprach<br />
der rasanten Entwicklung und den internationalen<br />
Erfolgen und Ansehen von GWP<br />
seine Anerkennung aus. Michael Beckereit,<br />
Vorstandsvorsitzender von GWP, unterstrich<br />
in seinen Worten besonders das<br />
Engagement und die Erfolge von EWP auf<br />
der politischen Ebene.<br />
Gemeinsames Ziel von GWP und EWP<br />
ist es, das Thema Wasser wirksamer auf<br />
der politischen Agenda zu verankern und<br />
die Dringlichkeit der Herausforderungen<br />
im Bereich Wasser stärker in den Fokus von<br />
politischen Entscheidungsträgern, Unternehmen<br />
und Verbänden der Wasserwirtschaft<br />
zu rücken. Darüber hinaus soll die<br />
Partizipation deutscher Unternehmen an<br />
europäischen Programmen gefördert werden.<br />
Bestreben ist es, die Kompetenzen<br />
zielführend zusammenzubringen und so<br />
eine praxisorientierte Begleitung des Di-<br />
12 / 2011 903
Verbände und Organisationen<br />
Nachrichten<br />
alogs zwischen Politik, Wasserwirtschaft<br />
und -forschung in Deutschland und Europa<br />
zu entwickeln.<br />
German Water Partnership bündelt als<br />
Gemeinschaftsinitiative von derzeit 332<br />
Mitgliedern die Kompetenzen der deutschen<br />
Wasserwirtschaft und -forschung,<br />
und ist für ausländische Partner damit<br />
zentraler Ansprechpartner für alle Belange<br />
des Wassersektors. Ziel des Netzwerkes<br />
ist es, die Positionierung der deutschen<br />
Wasserwirtschaft in internationalen Märkten<br />
zu stärken und bei wasserwirtschaftlichen<br />
Problemen integrierte und nachhaltige<br />
Lösungsansätze anzubieten. Dabei<br />
unterstützt GWP ausdrücklich die Erreichung<br />
der Millenniumsziele. Bei den Projekt-<br />
und Kooperationsaktivitäten verfolgt<br />
GWP den Ansatz einer interdisziplinären<br />
Zusammenarbeit aller Beteiligten. EWP<br />
fördert die Entwicklung von Innovationen<br />
im Management- und Technologiebereich<br />
sowie die Entwicklung von Modellprojekten<br />
zu Demonstration dieser Technologien<br />
und Lösungen. Anliegen von EWP sind die<br />
Unterstützung der Millennium Development<br />
Goals in einem erweiterten Europa<br />
und die aktive Begleitung von Maßnahmen<br />
und Projekten zur Erreichung der Ziele der<br />
Wasserrahmenrichtlinie in Europa. Im Fokus<br />
der zukünftigen Aktivitäten liegt zunehmend<br />
die Implementierung und Etablierung<br />
von Technologien und Konzepten<br />
auf dem internationalen Markt unter Einbeziehung<br />
der jeweiligen Stakeholder. Der<br />
globalen Herausforderung, im Hinblick auf<br />
die weltweiten demographischen Entwicklungen<br />
und die Auswirkungen des Klimawandels<br />
angepasste und umweltgerechte<br />
Lösungen für ein nachhaltiges Management<br />
der kostbaren Ressource Wasser zu<br />
entwickeln, werden sich in Zukunft GWP<br />
und EWP verstärkt gemeinsam stellen.<br />
Auf der Fachtagung wurden die verschiedenen<br />
Aspekte, Entwicklungen und<br />
Anforderungen hinsichtlich eines weltweit<br />
nachhaltigen Wasserressourcenmanagements<br />
diskutiert. Die unterschiedlichen<br />
demographischen und wirtschaftlichen<br />
Entwicklungen sowie die Auswirkungen<br />
des Klimawandels erfordern internationale<br />
Kooperationen auf allen Ebenen zur<br />
Entwicklung und Umsetzung angepasster<br />
Lösungen.<br />
So bewertete beispielsweise Dr. Helge<br />
Wendenburg vom Bundesministerium<br />
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit<br />
(BMU) vor diesem Hintergrund<br />
die Aussichten der deutschen Wasserwirtschaft<br />
auf dem wachsenden Weltmarkt.<br />
Mit einem Volumen von rund 800<br />
Mrd. Euro wird er im Jahr 2020 mehr als<br />
doppelt so groß sein wie 2007. Er betonte,<br />
dass die Erreichung der Entwicklungsziele<br />
in den Bereichen Energieversorgung,<br />
Ernährungssicherheit und Wasserbewirtschaftung<br />
wesentlich davon abhängen,<br />
ob Wasser in ausreichender Quantität und<br />
Qualität verfügbar ist. Hier kann GWP entscheidend<br />
zur Lösung wasserwirtschaftlicher<br />
Probleme beitragen. Die Integration<br />
verschiedener Politikfelder mit Querbezügen<br />
zu Wasser muss national und international<br />
unbedingt weiter vorangetrieben<br />
werden.<br />
„Training made in Germany“ ist erfolgreich<br />
Bild 1: Die praxisorientierte Weiterbildung von Fach- und Führungskräften ist es, die<br />
das SKZ zum gefragten Partner macht<br />
Das SKZ steht nun bereits seit 50 Jahren<br />
für kompetente Aus- und Weiterbildung<br />
in der Kunststoffindustrie. Die Erfahrung<br />
seiner Mitarbeiter macht das SKZ<br />
zu einem gefragten Partner, wenn es um<br />
die praxisorientierte Weiterbildung von<br />
Fach- und Führungskräften geht, aber<br />
auch wenn Beratung und Planung von nationalen<br />
wie internationalen Projekten auf<br />
dem Plan stehen. Seit vielen Jahren sind<br />
Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen<br />
des SKZ auch in Ländern außerhalb<br />
Deutschlands sehr gefragt. So unterhält<br />
das SKZ derzeit Bildungseinrichtungen in<br />
den Vereinigten Arabischen Emiraten, in<br />
China, in Russland, in den USA, in Algerien<br />
und im Iran und veranstaltet Seminare,<br />
Tagungen und Kongresse für ein internationales<br />
Publikum. Das Prädikat „Training<br />
made in Germany“ wird mehr und mehr<br />
auch im Ausland sehr gut aufgenommen<br />
und so wird das SKZ seine internationalen<br />
Weiterbildungsmaßnahmen künftig noch<br />
weiter ausbauen. Das Angebot von Pra-<br />
904 12 / 2011
xislehrgängen auf internationalem Boden<br />
und das Mitwirken bei internationalen<br />
Projekten machen das Kunststoff-Zentrum<br />
somit zu einem „global<br />
player“ im Bereich der Kunststoffe in<br />
Europa und weltweit.<br />
Dubai (V.A.E.)<br />
Seit der Eröffnung des ersten „SKZ<br />
Training Centre Middle East“ in Dubai<br />
im Jahr 2008 hat das SKZ zusammen<br />
mit seinem Partner vor Ort, BMC Gulf<br />
LLC, bereits über 200 Kunststoffschweißer<br />
nach deutschen DVGW-<br />
Richtlinien weitergebildet und geprüft.<br />
Dieses Weiterbildungsangebot<br />
ist speziell konzipiert für Ingenieure<br />
und Fachkräfte, die bei Projekten mit<br />
Kunststoffrohrsystemen für die Planung,<br />
Konstruktion und Überwachung<br />
verantwortlich sind, für Schweißaufsichten,<br />
die die Schweißarbeiten vor<br />
Ort prüfen und überwachen, sowie<br />
für Kunststoffschweißer, um die<br />
Schweißarbeiten von HDPE-Rohrsystemen<br />
fachgerecht durchführen zu<br />
können. Die in Theorie und Praxis aufgeteilten<br />
Lehrgänge sind einzigartig im<br />
gesamten Mittleren Osten. Das SKZ<br />
Training Centre in Dubai ist technisch<br />
komplett ausgestattet und bietet die<br />
Möglichkeit zur Vermittlung theoretischer<br />
Grundlagen aus verschiedenen<br />
Bereichen der Kunststoffindustrie<br />
ebenso wie praktische Workshops<br />
an bzw. mit entsprechenden Geräten<br />
und Anlagen nach aktuellem Stand der<br />
Technik zur Verbesserung der Fertigkeiten<br />
beim Schweißen von Kunststoffrohren.<br />
China<br />
In China werden Kunststoffschweißer<br />
sowohl im industriellen als auch im<br />
erdverlegten Rohrleitungsbau durch<br />
staatliche Institutionen ausgebildet.<br />
Die Qualität der Ausbildung ist dabei<br />
allerdings nicht auf dem Niveau wie es<br />
beispielsweise in Deutschland zu finden<br />
ist. Entsprechend häufig kommt es<br />
dadurch zu Reklamationen an Rohrleitungssystemen.<br />
Der volkswirtschaftliche<br />
Schaden ist folglich immens.<br />
Die Notwendigkeit, das Niveau<br />
der Ausbildung schnellstens anzuheben,<br />
hat inzwischen auch die chinesische<br />
Regierung erkannt und einen entsprechenden<br />
Handlungsbedarf festgestellt.<br />
Dem SKZ ist es gelungen, mit<br />
den für diese Ausbildung zuständigen<br />
Organisationen Kontakt herzustellen<br />
und erste Koordinationsgespräche zu<br />
führen. Die künftige Ausbildung von<br />
Kunststoffschweißern in China wird<br />
sich sehr an das deutsche System anlehnen,<br />
auch deshalb, weil die Standards<br />
des DVS bereits Eingang in chinesischen<br />
Standards gefunden haben.<br />
Das SKZ bietet hierzu sein Know-how<br />
bei der Einrichtung von Schweißwerkstätten<br />
an. Es werden sowohl Lehrgänge<br />
für Schweißer als auch Trainingsprogramme<br />
für Ausbilder – sogenannte<br />
„train the trainer“-Programme<br />
– angeboten. Um näher am Kunden<br />
sein zu können, gründete das SKZ im<br />
Frühjahr 2010 in China eine eigene<br />
Niederlassung unter dem Namen SI-<br />
NO – German Plastic Technology Service<br />
(Cheng De) Co., Ltd.<br />
Algerien<br />
Ein weiteres internationales Projekt,<br />
an dem das SKZ maßgeblich beteiligt<br />
war, fand im Juni 2010 mitten in der<br />
Sahara in Algerien statt. Die Aufgabe<br />
der SKZ-Mitarbeiter bestand darin, die<br />
Facharbeiter vor Ort im Heizelementstumpfschweißen<br />
auszubilden, um in<br />
einem Gasfeld ein Rohrleitungssystem<br />
aus Kunststoff zu installieren,<br />
das Löschwasser bereitstellen soll.<br />
Die Schulungsteilnehmer wurden sowohl<br />
über den verwendeten Werkstoff<br />
HDPE als auch über die Besonderheiten<br />
der Schweißprozesse unterrichtet.<br />
Auch die Dokumentation der Arbeiten<br />
und die visuelle Qualitätskontrolle<br />
der Schweißverbindungen zählten<br />
zu den Aufgaben der SKZ Mitarbeiter.<br />
Die hohen Temperaturen und der starke<br />
Wind, der den feinen Sand immer<br />
wieder in die Luft wirbelte, waren eine<br />
große Herausforderung für Mensch,<br />
Material und Maschinen. In der Schulung<br />
lernten die Teilnehmer mit diesen<br />
Extrembedingungen umzugehen. Eine<br />
weitere Aufgabe, die die Mitarbeiter<br />
des SKZ zu lösen hatten, war die Verbindung<br />
unterschiedlicher Standards:<br />
So wurden die eingesetzten Maschinen<br />
nach deutschen Standards gebaut,<br />
die Kunststoffrohre aber nach amerikanischen<br />
Vorgaben.<br />
16. Wiesbadener<br />
Kunststoffrohrtage<br />
Forum für Rohrsysteme aus<br />
polymeren Werkstoffen<br />
26. – 27. April 2012, Wiesbaden<br />
Informieren Sie sich über den Einsatz von<br />
Kunststoffrohren bei regenerativen Energieformen<br />
und profitieren Sie von Praxis- und<br />
Erfahrungsberichten verschiedener Anwender<br />
im Bereich Gas, Wasser und Abwasser.<br />
Themen des Forums<br />
Regenerative Energien<br />
Aktuelles aus den Regelwerken<br />
Qualitätssicherung<br />
Betriebserfahrung<br />
Anwenderberichte<br />
Veranstaltungspreis<br />
€ 650,– zzgl. gesetzlicher USt.<br />
Medienpartner<br />
Anmeldung und Auskünfte<br />
TÜV SÜD Akademie GmbH<br />
Tagungen und Kongresse<br />
Susanne Hummler<br />
Telefon +49 89 5791-2846<br />
susanne.hummler@tuev-sued.de<br />
www.tuev-sued.de/tagungen<br />
12 / 2011 905
Veranstaltungen<br />
Nachrichten<br />
26. Oldenburger Rohrleitungsforum 2012<br />
Die viel zitierte Energiewende, weg von<br />
Kohlenwasserstoffwirtschaft und Atomstrom,<br />
hin zu neuen Systemen auf der Basis<br />
regenerativer Energieträger, ist unbestrittener<br />
Megatrend des angehenden 21.<br />
Jahrhunderts und wird es in den kommenden<br />
Jahrzehnten bleiben. Da ein Großteil<br />
der heutigen, erdverlegten Rohrleitungsinfrastruktur<br />
der Energieversorgung dient,<br />
stellt sich dem Institut für Rohrleitungsbau<br />
Oldenburg –iro- folgerichtig die Frage,<br />
welche Rolle dem Rohr im Rahmen der<br />
neuen Versorgungskonzepte künftig zukommt.<br />
Genau diese Frage gibt das iro als<br />
Veranstaltungs-Motto ans Publikum weiter,<br />
wenn es am 9. und 10. Februar 2012<br />
zum 26. Oldenburger Rohrleitungsforum<br />
an den Standort Oldenburg der Jade<br />
Hochschule einlädt. Erwartet werden rund<br />
3000 Teilnehmer, darunter die Mitarbeiter<br />
von etwa 330 Ausstellern der kongressbegleitenden<br />
Fachmesse.<br />
Energieversorgung im Wandel<br />
Rohrleitungsnetze sind in doppelter Hinsicht<br />
Energie-relevant: Erstens spielen sie<br />
eine tragende Rolle als Transportmedium<br />
für Primärenergieträger wie Gas und Öl<br />
wie auch für den Betrieb von Fern- und<br />
Nahwärmesystemen; zum anderen ist ihr<br />
Betrieb selbst natürlich auch auf der Verbrauchsseite<br />
energetisch bedeutsam. Das<br />
wiederum gilt nicht nur für Versorgungsnetze<br />
sondern auch für Abwasser-Entsorgungssysteme.<br />
Diese wiederum gelten<br />
aufgrund der in ihnen transportierten<br />
wärmehaltigen Abwasserströme als Quelle<br />
möglicherweise nutzbarer „Abfall“-Energie.<br />
Es mangelt also keineswegs an aktuellen<br />
Bezügen zum Motto „Rohrleitungen<br />
– in neuen Energieversorgungskonzepten“,<br />
wenn Anfang Februar 2012 zum nunmehr<br />
26sten Mal die Fachwelt nach Oldenburg<br />
strömt, um das Arbeitsjahr mit der größten<br />
Fachveranstaltung rund ums Rohr zu<br />
beginnen.<br />
Wohin der Zug in puncto Versorgungskonzepte<br />
absehbar fährt, erfahren die Besucher<br />
von berufener Stelle, nämlich von<br />
Dietmar Schütz, dem Präsidenten des<br />
Bundesverbandes Erneuerbarer Energien<br />
e.V. (BEE), gleich in der Eröffnungsrunde<br />
des Kongresses am ersten Veranstaltungstag.<br />
Solchem Einstieg folgt unmittelbar ein<br />
Highlight mit Oldenburger Lokalbezug,<br />
nämlich die Präsentation des Pilotprojektes<br />
„Abwasserwärme in Oldenburg“, welches<br />
der Oldenburgisch-Ostfriesische<br />
Wasserverband (OOWV) gemeinsam mit<br />
dem iro quasi vor dessen „Haustür“ realisiert.<br />
Danach geht es bereits technisch<br />
ans „Eingemachte“, nämlich zu der Frage<br />
der Zukunft der vorhandenen Erdgasnetze<br />
und deren gegebenenfalls modifizierten<br />
Nutzung. Nach den vorgesehenen Vorträgen<br />
könnten Erdgasnetze ebenso ein „Auslaufmodell“<br />
sein wie ein kommendes System<br />
zur Energiespeicherung. Ein Thema<br />
der Zukunft sind auch „Smart grids“ oder<br />
„Intelligente Netze“: In Oldenburg wird die<br />
Möglichkeit einer Konvergenz von Netzinfrastrukturen<br />
vor dem Hintergrund moderner<br />
Informations- und Regelungstechnik<br />
beleuchtet.<br />
Offshore-Leitungsbau mit HDD<br />
Das Thema der neuen Energiekonzepte ist<br />
auf das Engste mit dem Klimawandel verknüpft.<br />
Insofern macht es auch Sinn, wenn<br />
innovative Konzepte im Energie- und Abwassersektor<br />
unter dem Aspekt der Klimaneutralität<br />
analysiert und diskutiert<br />
werden. Wie in den Medien als Politikum<br />
thematisiert, wird es neue Energieversorgungskonzepte<br />
künftig nicht ohne neue<br />
(Stromleitungs)-Trassen geben. Da diese<br />
teils „offshore“ in der Nordsee liegen,<br />
stehen hinter dieser Aufgabe nicht zuletzt<br />
erhebliche bauliche Herausforderungen:<br />
Eben dies – der Offshore-Leitungsbau –<br />
wird ein weiterer hochaktueller Vortragsschwerpunkt<br />
auf dem Rohrleitungsforum<br />
2012 sein. Da geht erfahrungsgemäß<br />
kaum etwas ohne Horizontal Directional<br />
Drilling (HDD)-Techniken, die auch 2012<br />
wieder einmal mit zwei gut besetzten Vortragsblöcken<br />
Besucher anlocken.<br />
Rund um das Thema Abwasser<br />
Abwasser als Energieträger – das ist beim<br />
26. Oldenburger Rohrleitungsforum eine<br />
wichtige, doch keineswegs die einzige Per-<br />
BILD 1: Neue Energieträger und Rohrleitungen treffen beim<br />
26. Oldenburger Rohrleitungsforum am 10./11. Februar 2012<br />
thematisch aufeinander (Foto: Amitech Germany)<br />
BILD 2: Im Wasserkraftwerkbau geht es von je her nicht ohne<br />
Rohre (Foto: Etertec)<br />
906 12 / 2011
spektive auf die Abwassernetze. Selbstverständlich<br />
nimmt die Sanierung dieser<br />
Infrastruktur auch 2012 breiten Raum<br />
im Programm ein. Ein Schwerpunkt unter<br />
anderen ist der status quo in Sachen<br />
Schlauchlining-Sanierung – eine Technologie,<br />
die auf nunmehr 40 Jahre Praxiserfahrungen<br />
zurückblicken kann und in der<br />
grabenlosen Kanalsanierung praktisch unverzichtbar<br />
ist. Intensiv setzen sich auch<br />
die Oldenburger Auftritte der Fachverbände<br />
GSTT und RSV mit aktuellen Fragen der<br />
Kanalsanierung auseinander.<br />
Auch die Diskussion im Café hat den<br />
Abwasserexperten 2012 eine interessante<br />
Thematik zu bieten: Das Spannungsfeld,<br />
in dem sich Ingenieurleistungen der<br />
Kanalsanierung in der Praxis bewegen. Einerseits<br />
spielen sie bei der Ausschreibung<br />
eine Schlüsselrolle für den Projekterfolg,<br />
anderseits ist ihre Vergütung allzu oft unangemessen,<br />
wenn man die Bedeutung<br />
dieser Leistungen berücksichtigt. Defizite<br />
an dieser Stelle führen fast zwangsläufig<br />
zu Konflikten und erzeugen Probleme<br />
bis hin zum völligen Scheitern von Vorhaben.<br />
Stets steht irgendwie der Ingenieur<br />
mit im Fokus – aber ist er deshalb auch<br />
„schuld“ an den Problemen? Eine Frage, zu<br />
der durchaus engagierte Statements der<br />
Expertenrunde und Diskussionen mit dem<br />
Publikum erwartet werden dürfen.<br />
Gestörte Bauabläufe<br />
Auch der Bautechniker und -organisator<br />
kommt wieder einmal nicht zu kurz: Größte<br />
Aufmerksamkeit hat ein „leidiges“ Problem<br />
der Baupraxis verdient, mit dem sich<br />
auf dem Rohrleitungsforum gleich mehrere<br />
Referenten auseinandersetzen: Gestörte<br />
Bauabläufe, hier speziell solche im Zuge<br />
des Pipelinebaus.<br />
Gestörte Verdauungsabläufe, hervorgerufen<br />
durch exzessiven Grünkohlverzehr,<br />
sind zwar auch zu Beginn des<br />
zweiten Vierteljahrhunderts „Ollnburger<br />
Gröönkohlabend“ ein latentes Restrisiko.<br />
Es sollte aber durch verantwortungsvollen<br />
Umgang mit den fleischlichen Beilagen der<br />
Oldenburger Identitätspflanze und durch<br />
prophylaktische Einnahme des einen oder<br />
anderen klaren Schnapses auch 2012 in<br />
vertretbarem Rahmen zu halten sein – für<br />
den Oldenburg-Routinier ebenso wie für<br />
Novizen.<br />
Mit der „IRO-App“ immer den<br />
richtigen Weg finden<br />
Mit rund 330 Ausstellern den Rahmen zu<br />
sprengen droht – auch dies schon eine liebe<br />
Gewohnheit – die Begleitausstellung in<br />
dem Gürtel von Temporärbauwerken, den<br />
das iro rund um die Fachhochschule hat errichten<br />
lassen. Gründe genug also, auch im<br />
folgenden Jahr wieder den Weg zur Jade-<br />
Weser-Fachhochschule zu suchen und zu<br />
finden. Wenn irgend möglich allerdings, so<br />
die dringende Bitte des Gastgebers, ohne<br />
Auto.<br />
Zur besseren Orientierung<br />
vor Ort wird das<br />
iro in Zusammenarbeit<br />
mit dem Vulkan-Verlag<br />
im nächsten Jahr<br />
erstmalig eine „IRO-<br />
App“ bereitstellen,<br />
die ab Mitte Januar<br />
2012 kostenfrei<br />
über die Internetseite<br />
des<br />
iro (www.iroonline.de)<br />
und<br />
der Zeitschrift <strong>3R</strong><br />
(www.<strong>3R</strong>-Rohre.de)<br />
downloadbar sein wird.<br />
Kontakt: Institut für Rohrleitungsbau<br />
Oldenburg (iro), Ina Kleist, Tel. +49 441<br />
3610390, E-Mail: kleist@iro-online.de,<br />
www.iro-online.de<br />
8. GSTT–Kanalcocktail<br />
Grundstücksentwässerung – wie kann die<br />
Kommune dieses Thema umsetzen? Wie<br />
können die Möglichkeiten genutzt und die<br />
Grenzen erkannt werden? Der Bürger muss<br />
mit ins Boot genommen werden und die<br />
Kosten dürfen nicht ausufern. Sowohl bei<br />
der Kamerabefahrung als auch in der Sanierungstechnik<br />
gibt es inzwischen Weiterentwicklungen.<br />
Zudem sind schon erste<br />
Erfahrungen gesammelt worden, seit der<br />
Runderlass vom Juni 2011 in Kraft getreten<br />
ist. Auf dieser soliden Basis zeigt der 8.<br />
GSTT-Kanalcocktail, der am 26.01.2012 in<br />
Schwerte stattfindet, Lösungen auf, um alle<br />
Anforderungen zu erfüllen. Zur Veranstaltung<br />
sind wieder zahlreiche Aussteller geladen,<br />
die mit Exponaten und Vorführungen<br />
das Thema veranschaulichen und gut verständlich<br />
die Praxis demonstrieren.<br />
Inhaltlich wird über folgende Einzelthemen<br />
referiert:<br />
Do you speak EN-Norm? Der unabhängige<br />
Sachkundige in der Verantwortung<br />
Bürgerfrust und Gesetzeslust in der<br />
Praxis<br />
Haftungsfragen bei der detaillierten<br />
Beratung durch die Kommune<br />
Podiumsdiskussion „Umsetzung § 61a<br />
unter den Augen der kritischen Bürgerinitiativen“<br />
Sanierungen von GEAs und ihre Langlebigkeit<br />
Kopieren ist auch keine Lösung- kommunaler<br />
Eintopf bei der Umsetzung<br />
Sanierungsplanung durch den Netzbetreiber<br />
– der Weg zum schlichten<br />
Sanierungsplan<br />
Podiumsdiskussion „Bei Risiken und<br />
Nebenwirkungen fragen Sie wen?“<br />
Kontakt: GSTT Arbeitsgruppe 5<br />
Güteüberwachung Grundstücksentwässerung<br />
c/o Hermes Technologie<br />
GmbH, Schwerte, Tel. +49 2304<br />
971230, E-Mail: info@kanalcocktail.de,<br />
www.kanalcocktail.de<br />
12 / 2011 907
Veranstaltungen<br />
Nachrichten<br />
27. FDBR-Fachtagung Rohrleitungstechnik<br />
Mit seiner 27. Fachtagung Rohrleitungstechnik,<br />
die am 27. und 28. März 2012<br />
stattfindet, macht der FDBR wieder Station<br />
in Magdeburg. Veranstaltungsort ist das<br />
Maritim Hotel, dessen imposante Lichthalle<br />
mit angrenzendem Ballsaal der begleitenden<br />
Fachausstellung den richtigen Rahmen gibt.<br />
Mit ihrem hochwertigen und breit gefächerten<br />
Liefer- und Leistungsangebot haben<br />
sich die industriellen Rohrleitungsbauer<br />
in Deutschland an der Spitze des globalen<br />
Wettbewerbs festgesetzt. Sie sorgen<br />
für Sicherheit und Effizienz in industriellen,<br />
chemischen und petrochemischen Anlagen<br />
sowie Kraftwerken und stellen sich zugleich<br />
dem wachsenden Forschungsbedarf<br />
für ökologischen und Ökonomischen Fortschritt.<br />
Mehr denn je steht die Branche des<br />
industriellen Rohrleitungsbaus heute für<br />
Innovation, Serviceorientierung und Wirtschaftlichkeit“,<br />
betont FDBR-Geschäftsführer<br />
Dr. Reinhard Maaß. „Sie bietet interessante<br />
Arbeitsplätze vom gewerblichen Bereich<br />
bis hin zu Ingenieurberufen und unterstreicht<br />
auch in puncto Zuverlässigkeit,<br />
Qualität und Sicherheit immer wieder nachhaltig<br />
ihre weltweit führende Rolle.“<br />
Die zentrale Bedeutung des industriellen<br />
Rohrleitungsbaus spiegelt auch die<br />
FDBR-Fachtagung Rohrleitungstechnik<br />
wider. Mit rund 400 Teilnehmern, davon<br />
etwa 50 Aussteller, hat sich die Vortragsveranstaltung<br />
mit begleitender Fachausstellung<br />
über die Jahre zu einer der führenden<br />
Veranstaltungen im industriellen<br />
Rohrleitungsbau entwickelt. Sie ist eine<br />
stabile Plattform für den intensiven und<br />
fundierten Erfahrungsaustausch und fördert<br />
den Dialog zwischen den in der Branche<br />
aktiven Unternehmen, Dienstleistern<br />
und der Wissenschaft. Sie bündelt Kompetenz<br />
und schafft Synergien. Teilnehmer, die<br />
die FDBR-Fachtagung Rohrleitungstechnik<br />
erstmals besuchen, loben nicht nur die<br />
Qualität der Vorträge und die vielseitige<br />
Ausstellung sondern auch die Möglichkeit,<br />
vertiefende Fachgespräche führen<br />
und Kontakte aufbauen zu können.<br />
Namhafte Referenten<br />
Auf die Teilnehmer wartet an beiden Veranstaltungstagen<br />
ein vielfältiges Vortragsprogramm<br />
mit 16 Fachbeiträgen von Referenten<br />
aus den Bereichen Kraftwerksrohrleitungen,<br />
Fernleitungen, Industrieanlagen,<br />
auch im Hochdruckbereich, sowie Überwachung<br />
und Planung. Zur Sprache gebracht<br />
werden die Themenbereiche Entwicklung,<br />
Planung, Berechnung und Konstruktion,<br />
Einsatz von Ausrüstungsteilen<br />
und Zubehör sowie Fertigung, Montage<br />
und Inbetriebnahme.<br />
Nach dem einleitenden Referat von<br />
Prof. Dr. Armin Grunwald vom Karlsruher<br />
Institut für Technologie (KIT) und Institut<br />
für Technikfolgenabschätzung und<br />
Systemanalyse (ITAS), Eggenstein-Leopoldshafen,<br />
zur Technikfolgeabschätzung<br />
mit dem Schwerpunkt Energie und Chemie<br />
startet die Fachtagung am Morgen<br />
des ersten Tages mit dem Themenkomplex<br />
„Entwicklung, Planung, Berechnung<br />
und Konstruktion“. Begleitet von den Moderatoren<br />
Prof. Dr.-Ing. Günter Micklisch<br />
und Dipl.-Ing. Ralph-Harry Klaer befasst<br />
sich Dipl.-Ing. Andreas Kittel von der Linde<br />
AG, Höllriegelskreuth, mit einem Konzept für<br />
die Überarbeitung von EN 13480 Teil 5: Prüfung.<br />
Anschließend beleuchtet Dr. Andreas<br />
Rick von der SIGMA Ingenieurgesellschaft<br />
mbH, Unna, mit der Klassifizierung von Primär-<br />
und Sekundärlasten beim Übergang<br />
zwischen Rohrstatik und Behälterstatik,<br />
während Dipl.-Ing. Dirk Koldehoff von der<br />
Bayer Technology Services GmbH, Dormagen,<br />
Unterschiede und Gemeinsamkeiten<br />
beim Bauen und Planen von Rohrleitungen<br />
in China und in Deutschland darlegt.<br />
Zukunftsthema Virtual Reality<br />
Abgerundet wird der Vormittag des ersten<br />
Tages mit dem Thema Virtual Reality im<br />
Lebenszyklus einer Anlage, dem sich Oliver<br />
Schwarz von der eSZett GmbH & Co. KG,<br />
Duisburg, widmet. Virtuelle Technologien<br />
spielen für die Projektierung, Konstruktion,<br />
908 12 / 2011
den Bau, das Training und den sicheren Betrieb<br />
von Anlagen eine immer größere Rolle.<br />
Sie gewährleisten unter anderem mehr<br />
Transparenz über alle Lebenszyklusphasen<br />
von Anlagen, steigern Produktivität und Effektivität<br />
in allen Funktionen und Arbeitsbereichen<br />
und erhöhen die Anlagenverfügbarkeit.<br />
Das Einsparpotenzial durch den Einsatz<br />
von virtuellen Technologien ist somit groß.<br />
Zugleich nimmt die Planungssicherheit zu.<br />
Mit dem Themenkomplex „Einsatz von<br />
Ausrüstungsteilen und Zubehör“ geht die<br />
FDBR-Fachtagung in den Nachmittag. Unter<br />
der Leitung der Moderatoren Dipl.-Ing.<br />
Ingo Wurzel und Dipl.-Ing. Manfred Rieke<br />
befasst sich Uwe Sprengholz vom TÜV<br />
Thüringen e. V., Service-Center Ostthüringen,<br />
Jena, zunächst mit Baugruppen mit<br />
CE-Kennzeichnung. Danach erläutert Dr.<br />
Werner Pritzl von der Erne Fittings GmbH<br />
aus dem österreichischen Schlins die Anwendung<br />
von EN 10253 „Formstücke zum<br />
Einschweißen“, während sich Jürgen Stauffer<br />
von der Rolf Kuhn GmbH, Tutzing, mit<br />
Brandschutz-Durchführungen von Rohrleitungen<br />
für nichtbrennbare und brennbare<br />
Medien (DIN 4102 und DIN EN 13501)<br />
auseinandersetzt. Abschließend behandelt<br />
Dipl.-Ing. Peter Kolenbrander von der BHR<br />
Hochdruck-Rohrleitungsbau GmbH, Oberhausen,<br />
das Thema „Abnahme- und Verrechnungsmessungen<br />
mit klassischen Wirkdruckgebern<br />
(EN ISO 5167) – Genauigkeiten<br />
und Kalibrierinstitute“.<br />
Am Vormittag des zweiten Tags steht<br />
das Themengebiet „Fertigung, Montage,<br />
Inbetriebnahme“ im Fokus. Moderiert von<br />
Dipl.-Ing. Jürgen Mühlenbein-Severin und<br />
Dipl.-Ing. Stefan Hübner startet Dipl.-Ing.<br />
Roland Seydel von der Meeraner Dampfkesselbau<br />
GmbH, Meerane, mit der Verarbeitung<br />
von 7CrMoVTiB 10-10 (T 24). Im<br />
Anschluss setzt sich Dr.-Ing. Andrey Bulavinov<br />
vom Fraunhofer-IZFP, Saarbrücken,<br />
mit der Prüftechnik von Rohrnähten von<br />
der „phased array“ zur „sampling phased<br />
array“ auseinander, während Klaus Ebernau<br />
von der Amitech Germany GmbH, Mochau,<br />
über Herstellung und Montage von GFK-<br />
Kühlwasserleitungen bis DN 3400 unter<br />
besonderer Berücksichtigung der Verbindungstechnik<br />
informiert. Über Erfahrungen<br />
bei der Herstellung und Weiterverarbeitung<br />
von Rohren aus chinesischer Fertigung beim<br />
HZÜ-Wechsel im Kraftwerk Jänschwalde<br />
berichtet Dipl.-Ing. Lutz Bergmann von der<br />
Finow Rohrsysteme GmbH, Eberswalde.<br />
Wie gewohnt schließt die FDBR-Fachtagung<br />
Rohrleitungstechnik mit dem Thema<br />
„Betrieb, Instandhaltung“, das unter der Moderation<br />
von Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Malingriaux<br />
und Dipl.-Ing. Alexander Wrobel steht.<br />
Mit dem Nachweis der Ausblassicherheit von<br />
Flanschverbindungen in Theorie und Praxis<br />
beschäftigen sich Prof. Dr.-Ing. Eberhard<br />
Roos, Dr.-Ing. Hans Kockelman sowie Dipl.-<br />
Ing. Rolf Hahn von der Universität Stuttgart,<br />
Materialprüfungsanstalt Stuttgart. Nachfolgend<br />
erläutert Dipl.-Ing. Christian Schröder<br />
von der TÜV Süd Industrie Service GmbH,<br />
Mannheim, optimale Prüfkonzepte und<br />
prüftechnische Anforderungen für Kraftwerke<br />
mit erhöhten Betriebstemperaturen,<br />
während Dipl.-Ing. Jürgen Potthoff von der<br />
Bayer Technology Services GmbH, Leverkusen,<br />
Kriterien und Vorgehensweise der RISK<br />
based inspection skizziert. Den Schlusspunkt<br />
der Tagung setzt Dipl.-Ing. Nicole Sohn von<br />
der TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG,<br />
Hamburg, mit Erfahrungsberichten von benannten<br />
Stellen und zugelassenen Überwachungsstellen<br />
bei der Umsetzung der Druckgeräterichtlinie<br />
und der Betriebssicherheitsverordnung.<br />
Nicht nur für die gestandenen Profis ist<br />
die FDBR-Fachtagung Rohrleitungstechnik<br />
eine wichtige Info- und Kontaktbörse. Auch<br />
Nachwuchskräfte aus technisch-naturwissenschaftlichen<br />
Fachbereichen sind willkommende<br />
Teilnehmer. Studierende und Berufseinsteiger<br />
werden auf den aktuellen Stand im<br />
Rohrleitungsbau gebracht und können mit<br />
Unternehmen und Experten wichtige Kontakte<br />
knüpfen. Für Studenten der Ingenieurwissenschaften<br />
ist die Teilnahme kostenlos.<br />
„Es gehört zu den zentralen Themen des<br />
FDBR, dem Mangel an hoch qualifizierten<br />
Fachkräften entschlossen entgegenzutreten“,<br />
erklärt Maaß. „Dazu gehört explizit die<br />
gezielte Förderung des Nachwuchses. Nur<br />
so kann sich die deutsche Rohrleitungsbranche<br />
in der globalen Wettbewerbsarena auch<br />
in Zukunft an vorderster Front behaupten.“<br />
Kontakt: Fachverband Dampfkessel-,<br />
Behälter- und Rohrleitungsbau e. V.,<br />
Düsseldorf, Linda Kaiser, Tel. +49 211<br />
49870-32, E-Mail: mc@fdbr.de, www.<br />
fdbr.de<br />
Hochwassermanagement durch Geodaten<br />
Der Einsatz von Geoinformationssystemen<br />
(GIS) wird für das Wasserdatenmanagement<br />
immer bedeutender. Die Nutzung<br />
verlässlicher Geodaten und der Aufbau einer<br />
umfassenden Geodateninfrastruktur<br />
(GDI) ermöglicht zielorientiertes Handeln<br />
mit intelligenten wasserwirtschaftlichen<br />
Lösungen. Die Deutsche Vereinigung für<br />
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.<br />
V. (DWA) widmet sich dem Thema in einer<br />
Veranstaltung mit dem Titel „Die Hochwasserrisikomanagementrichtlinie<br />
im Fokus<br />
von GIS und GDI“. Die Tagung zu den Möglichkeiten<br />
von geografischen Informationssystemen<br />
in der Wasserwirtschaft findet<br />
am 25. und 26. Januar 2012 in Kassel statt.<br />
Die Veranstaltung befasst sich unter anderem<br />
mit der Frage, wie Geoinformationssysteme<br />
und Geodateninfrastrukturen für<br />
den Schutz vor Hochwasser, im Management<br />
der Unterhaltung von Gewässern oder<br />
als Werkzeug der Wasserrahmen- sowie der<br />
Hochwasserrisikomanagementrichtlinie eingesetzt<br />
werden können. Vortragsschwerpunkte<br />
sind unter anderem die Umsetzung<br />
einer neuen Geodateninfrastruktur in Bayern,<br />
die Entwicklung numerischer Simulationsmodelle<br />
für Starkregenabflüsse sowie<br />
der von DWA und Wupperverband erstellte<br />
„Objektkatalog Wasserwirtschaft“, der<br />
definiert, welche Einzugsgebiete, Dämme,<br />
Wehre, Gewässernetze u. ä. in Form von<br />
Geodaten veröffentlicht werden müssen.<br />
Die Tagung richtet sich an Fach- und<br />
Führungskräfte in Behörden, Planungsbüros,<br />
Forschungseinrichtungen, Verbänden<br />
sowie bei Betreibern wasserwirtschaftlicher<br />
Anlagen. Die Tagung in Kassel wird<br />
von einer Fachausstellung begleitet.<br />
Kontakt: DWA, Sarah Heimann, Tel.<br />
+49 2242 872 192, E-Mail: heimann@<br />
dwa.de, www.dwa.de<br />
12 / 2011 909
Veranstaltungen<br />
Nachrichten<br />
Kathodischer Korrosionsschutz für<br />
Wasserrohrleitungen aus Stahl<br />
Am 13.03. und 14.03.2012 kommen in Erfurt<br />
zum vierten Mal Experten, d. h. Planer<br />
und Praktiker aus Wassernetzbetreibereinrichtungen<br />
zusammen, die mit konkreten<br />
betrieblichen Erfahrungen zum KKS<br />
aufwarten können und bereit sind, diese<br />
zur Diskussion zu stellen. Veranstalter ist<br />
das Zentrum für Weiterbildung der Jadehochschule<br />
in Oldenburg.<br />
Der Workshop lebt von Beiträgen der<br />
teilnehmenden Fachleute. Teilnehmer können<br />
nach Rücksprache einen Sachverhalt<br />
aus ihrer Praxis präsentieren. Auf jeden<br />
Fall soll es sich – wie in den Jahren zuvor<br />
– nicht um eine reine Vortragsveranstaltung<br />
sondern um wechselseitigen Austausch<br />
handeln. Moderator ist Dipl.-Phys.<br />
Rainer Deiss von der EnBW Regional AG<br />
in Stuttgart.<br />
Impulse für die Diskussionen liefern<br />
Vorträge von Rainer Deiss und Hans Gaugler,<br />
Stadtwerke München, zu folgenden<br />
Themen:<br />
Betriebsüberwachung gem. DVGW<br />
W 392-2 durch KKS-Fernüberwachung<br />
nach DVGW GW 16<br />
Möglichkeit der Zustandsbewertung<br />
von kathodisch schützbaren und kathodisch<br />
nicht schützbaren Wasserleitungen<br />
aus metallischen Werkstoffen<br />
Nachumhüllungen an in Betrieb befindlichen<br />
Leitungen, Nachumhüllungssysteme<br />
Messungen an Dükern: Beispiel Inndüker,<br />
Beispiel Isardüker<br />
Darstellung des aktuellen Stands des<br />
2. DVGW-Forschungsvorhabens zur<br />
AC-Korrosion<br />
Anwendung des Referenzwertverfahrens<br />
gem. DVGW GW 10 zum Nachweis<br />
der Wirksamkeit des KKS an kathodisch<br />
geschützten Wasserleitungen<br />
– Erfahrungsaustausch<br />
Kontakt: Jadehochschule<br />
Wilhelmshaven Oldenburg Elsfleth,<br />
Zentrum für Weiterbildung, Oldenburg,<br />
Tel. +49 441 361039 20, E-mail: zfw@<br />
jade-hs.de, www.jade-hs.de/zfw/<br />
Kunststoffe im Anlagenbau<br />
Am 7. und 8. März 2012 veranstaltet die<br />
TÜV SÜD Akademie GmbH die 3. Internationale<br />
Fachtagung „Kunststoffe im Anlagenbau“.<br />
Die Tagung legt neben der Werkstoffauswahl<br />
und Auslegung von Thermoplasten<br />
verstärkt Fokus auf industrielle Rohrleitungssysteme<br />
sowie den Behälter- und Apparatebau.<br />
Praxisberichte und Betriebserfahrungen<br />
mit dem Einsatz von technischen<br />
Kunststoffen im Anlagenbau stehen im Vordergrund<br />
der Veranstaltung. Die Berechnung<br />
von Behältern und Änderungen bei relevanten<br />
Gesetzen, Normen und Richtlinien<br />
werden vorgestellt sowie zukünftige Trends<br />
beleuchtet. Im Einzelnen werden folgende<br />
Themen behandelt:<br />
Werkstoffauswahl, Auslegung und<br />
Realisierung<br />
PVC-U and PVC-C in demanding industrial<br />
applications<br />
Auskleidungen aus Schmelze-extrudierten<br />
Fluorkunststoffen für den Anlagenbau:<br />
Materialien und Anwendungen<br />
Thermoplastic materials in contact<br />
with strong acids used in pickling applications<br />
Industrielle Rohrleitungssysteme<br />
Leakage detection system for piping<br />
systems<br />
Permanent überwachte Polyolefinrohrsysteme<br />
– Funktionsprinzip, Möglichkeiten<br />
und Praxiseinsätze<br />
Auslegung und Einsatz von industriellen<br />
Kunststoffarmaturen<br />
Polypropylen (PP-R) Rohrsystem im<br />
Einsatz für Großanlagen in der Reinstwasser-Aufbereitung<br />
und Verteilung<br />
Innovative Anwendungsmöglichkeiten<br />
von PE – Beispiele für den Einsatz im<br />
Abwassersystem eines Industrieunternehmens<br />
Installierung einer PE 100 Abluftleitung<br />
DN 2700 mit Drosselklappen und<br />
Kompensatoren<br />
SIMOFUSE – eine effiziente Verbindungstechnik<br />
für den industriellen Anlagenbau<br />
Experiences and observations of repairs<br />
and welds made in process equipment<br />
after some time in service<br />
Stand der Regelwerke<br />
Fügen von Kunststoffen – Aktuelles<br />
aus der DVSRichtlinienarbeit<br />
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden<br />
Stoffen – Veränderungen<br />
der rechtlichen Rahmenbedingungen<br />
Vorgehensweise bei Abweichungen von<br />
DIBt-Zulassungen<br />
Behälterbau<br />
Kunststoff-Kraftstoffbehälter (KKB) im<br />
Automobilbau<br />
Erweiterte Anwendungsmöglichkeiten<br />
im Behälter- und Apparatebau bei der<br />
Verwendung von PE 100-RC<br />
Einsatz, Erfahrungen und Vorteile mit<br />
PE 100-RC im Behälter- und Apparatebau<br />
Berechnung und konstruktive Ausbildung<br />
von Lagerbehältern für wassergefährdende<br />
Flüssigkeiten zur Aufstellung<br />
in Erdbebengebieten<br />
Statische Berechnung von Behältern<br />
– Berücksichtigung von äußeren Ein-<br />
910 12 / 2011
wirkungen (z.B. Wind und<br />
Schnee) nach neuen Regelwerken<br />
Standsicherheitsnachweise<br />
für Einstiegsöffnungen in<br />
Flachbodenbehälter aus Thermoplasten<br />
Projektbericht: Standsicherheitsnachweis<br />
eines Biotricklingbehälters<br />
Materialeffizienz im Apparateund<br />
Behälterbau: Verarbeitung<br />
und Anwendung von geschäumten<br />
Polyolefinplatten<br />
Die Fachtagung richtet sich an<br />
Anlagenplaner und Anlagenbauer,<br />
Apparate- und Behälterbauer,<br />
Rohrleitungs- und Lüftungsbauer,<br />
Ingenieure und Konstrukteure,<br />
Betreiber von Anlagen, Rohstoff-<br />
und Halbzeughersteller,<br />
Forschung und Entwicklung sowie<br />
Behörden und Verbände.<br />
Kontakt: TÜV SÜD Akademie<br />
GmbH, München, Susanne<br />
Hummler, Tel. +49 89 5791-<br />
2846, E-Mail: congress@tuevsued.de<br />
GeoTHERM 2012 – Eine<br />
Branche präsentiert sich<br />
Mit der GeoTHERM – expo &<br />
congress, die am 1. und 2. März<br />
2012 zum sechsten Mal bei der<br />
Messe Offenburg stattfindet,<br />
wird die Geothermie-Branche<br />
sich größer als jeweils zuvor darstellen.<br />
Im sechsten Jahr in Folge<br />
wird die Hallenfläche konsequent<br />
vergrößert und zur GeoTHERM<br />
2012 wird die Flächenkapazität<br />
der zweiten Messehalle erstmals<br />
komplett genutzt. „Das steigende<br />
Interesse der Wirtschaft bestätigt,<br />
dass unser Service von<br />
den Branchen-Akteuren geschätzt<br />
und anerkannt wird. Dies<br />
freut uns sehr und mit über 130<br />
Ausstellern zum momentanen<br />
Zeitpunkt erwarten wir einen<br />
neuen Aussteller-Rekord“, berichtet<br />
Werner Bock, Geschäftsführer<br />
der Messe Offenburg.<br />
Das bewährte Konzept der<br />
Veranstaltung wird auch mit der<br />
Hallenvergrößerung weitergeführt:<br />
Die zwei parallel laufenden<br />
Kongresse zur Oberflächennahen<br />
und Tiefen Geothermie sowie Europas<br />
größte Fachmesse sind unter<br />
einem Dach in unmittelbarer<br />
Nähe verbunden. Aufgrund der<br />
hohen Internationalität der Veranstaltung<br />
werden alle Kongress-<br />
Beiträge simultan übersetzt:<br />
Deutsch – Englisch – Französisch.<br />
Auch Verbände und Institute<br />
verstärken ihre Aktivitäten im<br />
Rahmen der GeoTHERM. „Insgesamt<br />
besteht der Partnerkreis aus<br />
über 30 ideellen Unterstützern.<br />
Die Mitarbeit, die wir auf Seiten<br />
der Geothermie-Branche erleben<br />
dürfen, ist beeindruckend und<br />
für mich persönlich beispiellos“,<br />
so Sandra Kircher, Projektleiterin<br />
GeoTHERM. Neue Kooperationsvereinbarungen<br />
zur GeoTHERM<br />
2012 wurden mit dem EGEC European<br />
Geothermal Energy Council<br />
sowie dem Bundesverband Wärmepumpe<br />
geschlossen.<br />
Zu den Fachbesuchern der<br />
GeoTHERM zählen: Architekten,<br />
Ingenieure und Planer, Handwerker<br />
und Bauträger, Geologen und<br />
Brunnenbauer, Geothermie- und<br />
Bohrindustrie, Kommunen und<br />
Verwaltungen, Energieversorger<br />
und Stadtwerke, Betreiber und Investoren,<br />
Wissenschaft und Forschung.<br />
Kontakt: Geo THERM,<br />
Tel. +49 781 922632, E-Mail:<br />
geotherm@messeoffenburg.<br />
de, www.geothermoffenburg.de<br />
12 / 2011 911
STellungnahme<br />
Normen & regelwerk<br />
Sicherheit von Gasfernleitungen –<br />
das technische Regelwerk im Licht<br />
der aktuellen Rechtsprechung<br />
Technisches Komitee Gastransportleitungen des DVGW<br />
Mit Eilentscheidungen vom 29.06.2011 hat das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg (OVG) die Arbeiten<br />
an einzelnen Abschnitten der Nordeuropäischen Erdgasleitung (NEL) gestoppt. Im Rahmen der Entscheidungen<br />
hat sich das OVG mit dem aktuellen Stand der Technik bei der Bestimmung der Leitungsführung auseinandergesetzt,<br />
dabei wichtige Bestimmungen der technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V.<br />
(DVGW) erörtert und diese mit anderen Regelwerken und Studien verglichen. Im Ergebnis ist das OVG zu vorläufigen<br />
Schlussfolgerungen gelangt, die aus sicherheitstechnischer Sicht nicht haltbar sind. Das OVG bewertet die Sicherheit<br />
von Ferngasleitungen losgelöst von der üblichen Vorgehensweise bei Risiken von technischen Anlagen und verengt die<br />
Maßnahmen zur Absicherung dieser Leitungen in einer sicherheitstechnisch bisher nicht bekannten Weise auf Abstände<br />
(zu Wohnbebauungen). Dagegen hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim (VGH) am<br />
14.11.2011 den Stand der Technik zur Leitungsführung nach dem geltenden technischen Regelwerk differenziert und<br />
treffend bestätigt.<br />
Das OVG Lüneburg hat mit Eilbeschlüssen zur NEL deren Trassenführung<br />
als rechtsfehlerhaft bewertet. Das Gericht bewertet<br />
erstmals eine Ferngasleitung in Deutschland, die nach<br />
dem Regelwerk des DVGW installiert und betrieben werden<br />
soll, als nicht inhärent sicher und nimmt deshalb mit Blick auf<br />
vermeintlich unzureichende Abstände zur Wohnbebauung einen<br />
Verstoß gegen den Stand der Technik an. Es hält allgemeine<br />
Abstandsregeln für vorzugswürdig.<br />
Über den Schutzstreifen hinausgehende besondere Mindestabstände<br />
zwischen Gasfernleitungen der öffentlichen<br />
Versorgung und Wohnbebauung sind nicht Stand der Technik<br />
in der deutschen Gasversorgung. Die Leitungen sollen durch<br />
Schutzmaßnahmen, die im DVGW-Regelwerk aufgrund jahrelanger<br />
Erfahrung beim Betrieb von Gasfernleitungen vorgegeben<br />
sind, so sicher ausgeführt werden, dass katastrophale<br />
Ereignisse gar nicht erst entstehen und a priori nicht<br />
unterstellt werden müssen. Die bewährte Praxis in Deutschland<br />
sorgt durch eine Vielzahl von Maßnahmen für eines der<br />
höchsten Sicherheitsniveaus weltweit.<br />
Der DVGW ist nach dem Willen des Gesetz- und Verordnungsgebers<br />
für die technische Regelsetzung von Gasfernleitungen<br />
der öffentlichen Versorgung in Deutschland verantwortlich<br />
und damit der oberste Hüter der technischen Sicherheit<br />
in der öffentlichen deutschen Gasversorgung. Er bündelt<br />
die Fachkenntnis von Experten und widerspricht der Auffassung<br />
in den Eilbeschlüssen des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg<br />
mit Blick auf die folgenden Aspekte:<br />
1. Versorgungsleitungen müssen an Lebens- und Wirtschaftsräume<br />
herangeführt werden – Der Standort<br />
Deutschland zeichnet sich durch eine hohe Industrieund<br />
Siedlungsdichte aus und muss über eine ausreichende<br />
und sichere Energieversorgung verfügen. Energierechtlich<br />
manifestiert sich dies im Gebot der Versorgung der<br />
Allgemeinheit mit Energie gemäß §1 Energiewirtschaftsgesetz<br />
(EnWG). Hierzu müssen die Versorgungsleitungen<br />
an die Lebens- und Wirtschaftsräume herangeführt werden.<br />
Um diesem öffentlichen Versorgungsauftrag gerecht<br />
zu werden, hat der Gesetzgeber die rechtlichen Rahmenbedingungen<br />
in einem eigenen Rechtsregime verankert.<br />
Für Gasfernleitungen der öffentlichen Versorgung wurde<br />
dies neuerdings mit Inkrafttreten der neu überarbeiteten<br />
Gashochdruckleitungsverordnung (GasHDrLtgV) vom Mai<br />
2011 nochmals bekräftigt.<br />
2. Schutz der Leitung ist der effektivste Schutz für<br />
die Allgemeinheit – Die rechtlichen Anforderungen<br />
an die technische Sicherheit von Gashochdruckleitungen<br />
der öffentlichen Versorgung ergeben sich maßgeblich<br />
aus der GasHDrLtgV, die ebenso wie das EnWG auf<br />
die technischen Regeln des DVGW verweist. Weder die<br />
GasHDrLtgV noch das DVGW-Regelwerk verlangen, dass<br />
eine Gasfernleitung über den Schutzstreifen hinausgehende<br />
Abstände zu bebauten Gebieten einzuhalten bzw.<br />
diese großräumig zu meiden hat. Insbesondere kann Ziff.<br />
3.1.1 der Technischen Regel des DVGW-Arbeitsblattes<br />
G 463 nicht als Vorgabe zur Einhaltung von Sicherheitsabständen<br />
verstanden werden. Im Gesamtkontext des<br />
DVGW-Regelwerks ergibt sich vielmehr, dass die Trasse<br />
so gewählt werden soll, dass ihre Integrität nicht durch<br />
aus der Umgebung auf die Leitung folgenden Belastungen<br />
gefährdet wird.<br />
3. Im Schutzstreifen geschützte Leitungen brauchen<br />
keine sonstigen Sicherheitsabstände – Eine Annähe-<br />
912 12 / 2011
ung von Gasfernleitungen an bebaute Gebiete wird aufgrund<br />
einer klaren Entscheidung des Verordnungsgebers<br />
akzeptiert. Dabei hat der Verordnungsgeber anerkannt,<br />
dass die Dimensionierung der Gashochdruckleitungen<br />
stetig zunimmt und diese Leitungen auch durch besiedelte<br />
Gebiete trassiert werden. In seiner Begründung<br />
zur neuen GasHDrLtgV 2011 stellt der Verordnungsgeber<br />
heraus, dass sich die Verordnung in der Praxis bei<br />
der Gewährleistung der technischen Sicherheit von Gashochdruckleitungen<br />
bewährt hat.<br />
4. Nicht nur Abstände, sondern alle Maßnahmen müssen<br />
berücksichtigt werden – Das DVGW-Regelwerk<br />
sieht aus guten Gründen keine starren Vorgaben<br />
für die Entfernungen zu Wohnbebauungen vor. Auch andere<br />
technische Regelwerke für Rohrleitungen enthalten<br />
keine starren Regeln zur vorrangigen Einhaltung von<br />
Abständen. Die Entscheidung des VGH Mannheim vom<br />
14.11.2011 bestätigt dies. Dies entspricht dem erklärten<br />
Willen der zuständigen Bundesministerien. Stattdessen<br />
müssen alle möglichen Maßnahmen zur Gewährleistung<br />
der technischen Sicherheit erwogen und das beste<br />
Sicherheitskonzept umgesetzt werden.<br />
5. Die Untersuchung der BAM betrachtet nur Teilaspekte<br />
– Der Forschungsbericht 285 der Bundesanstalt<br />
für Materialforschung und -prüfung (BAM Forschungsbericht)<br />
aus dem Jahr 2009 „Zu den Risiken des<br />
Transports flüssiger und gasförmiger Energieträger in<br />
Pipelines“ stellt weder den durch die GasHDrLtgV und<br />
das DVGW-Regelwerk noch den durch andere technische<br />
Regelwerke zum Rohrleitungsbau gewährleisteten<br />
Stand der Technik in Frage. Auch dies wird durch die<br />
Entscheidung des VGH Mannheim vom 14.11.2011 bestätigt.<br />
Der BAM Forschungsbericht wertet hauptsächlich<br />
weltweite Unfälle von Pipelines aus, die nach anderen<br />
Standards errichtet worden sind. Hierzu gehören auch<br />
teilweise veraltete technische Regeln, die nicht zu dem in<br />
Deutschland üblichen hohen Sicherheitsstand führen.<br />
I. Einführung<br />
Über die NEL soll neben der bereits fertig gestellten Ostseepipeline<br />
Anbindungsleitung (OPAL) das zukünftig in Lubmin<br />
bei Greifswald über die Nord Stream Pipeline aus Russland anlandende<br />
Gas weitertransportiert werden. Die NEL verläuft<br />
von Lubmin, durch Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen<br />
bis Rehden, siehe Bild 1. Sie hat einen Durchmesser<br />
von 1400 mm (DN 1400) und kann mit einem Druck von<br />
bis zu 100 bar (MOP 100) betrieben werden. Es handelt sich<br />
um eines der bedeutendsten europäischen Infrastrukturprojekte,<br />
das maßgeblich zur nationalen und europäischen Energieversorgungssicherheit<br />
beitragen soll und deswegen von<br />
der Europäischen Union auch zu den wichtigsten Transeuropäischen<br />
Energieprojekten gezählt wird. Die nach der Kernkraftwerkskatastrophe<br />
in Japan beschlossene Energiewende<br />
in Deutschland verstärkt die Bedeutung solcher Erdgastransportpipelines<br />
für die Sicherung der deutschen Energieversorgung<br />
noch zusätzlich.<br />
Bild 1: Trassenverlauf der NEL<br />
In mehreren Eilverfahren hat das OVG Lüneburg am<br />
29.06.2011 die aufschiebende Wirkung eines Teils der Klagen<br />
gegen den Planfeststellungsbeschluss für den niedersächsischen<br />
Abschnitt der NEL angeordnet. Weitere Anträge<br />
wurden abgewiesen. In den betroffenen Teilbereichen kann<br />
der Bau der NEL bis auf Weiteres nicht fortgesetzt werden.<br />
Nach Auffassung des Gerichts ist nach Möglichkeit ein<br />
Mindestabstand von 350 m zu bebauten Gebieten einzuhalten.<br />
Nur soweit wegen „unüberwindbarer Raumwiderstände“<br />
alternative Trassenverläufe nicht zur Verfügung stehen, sollen<br />
geringere Abstände akzeptabel sein, welche ggf. durch zusätzliche<br />
technische Maßnahmen kompensiert werden sollen.<br />
Das Gericht stützt seine Abstandsforderung maßgeblich<br />
auf den BAM-Forschungsbericht sowie die Technischen<br />
Regeln für Gashochdruckleitungen (TRGL) für nicht der öffentlichen<br />
Versorgung dienende Gashochdruckleitungen und<br />
die Technischen Regeln für Rohrfernleitungen (TRFL). Diese<br />
technischen Regeln und den Forschungsbericht setzt es in<br />
eine Gesamtschau mit dem für die NEL einschlägigen technischen<br />
Regelwerk, dem des DVGW, insbesondere dem Arbeitsblatt<br />
G 463. Dieses Vorgehen des OVG ist grundsätzlich<br />
zu begrüßen. Allerdings liegen den Schlussfolgerungen<br />
dann falsche Bewertungen zu Grunde, da das OVG in den<br />
Eilverfahren einige wesentliche Gesichtspunkte, insbesondere<br />
die umfassenden Maßnahmen für die Technische Sicherheit<br />
in der deutschen Gasversorgung, noch nicht ausreichend<br />
gewürdigt hat.<br />
Mit seiner Forderung zur vorrangigen Einhaltung von<br />
möglichst mehreren hundert Metern Abstand zur Wohnbebauung<br />
und der Verweisung von (zusätzlichen) technischen<br />
Maßnahmen auf eine nachgeordnete Stufe weicht das Gericht<br />
vom DVGW-Regelwerk und der seit langem in Deutschland<br />
etablierten Planungspraxis ab.<br />
II. Sicherheit und Zuverlässigkeit der<br />
Gasversorgung<br />
Energieanlagen im Sinne des § 3 Nr. 15 EnWG sind nach § 49<br />
Abs. 1 EnWG „... so zu errichten und zu betreiben, dass die technische<br />
Sicherheit gewährleistet ist“. Im Gasbereich betrifft dies<br />
alle Anlagen zur Erzeugung, Speicherung, Fortleitung und der<br />
12 / 2011 913
Stellunghame<br />
Normen & regelwerk<br />
Abgabe von Gas. Diese Anlagen umfassen auch die Gaspipelines,<br />
die der Versorgung der Allgemeinheit mit Gas dienen.<br />
Das DVGW-Regelwerk bildet für alle energierechtlich definierten<br />
Gasanlagen die zu beachtenden allgemein anerkannten<br />
Regeln der Technik und den Stand der Technik<br />
ab. Die Umsetzung des Regelwerks in der Praxis wird durch<br />
das ganzheitliche Sicherheitskonzept maßgeblich unterstützt.<br />
Auf diese Weise wurden ein hoher Sicherheitsstandard<br />
und eine hohe Zuverlässigkeit geschaffen und erhalten, die<br />
sich beispielsweise anhand der stets sinkenden Anzahl von<br />
Unfällen belegen lassen: Im Zeitraum 1980-2010 konnte eine<br />
fast 90%-ige Reduktion von Unfällen an Gastransportund<br />
-verteilleitungen erreicht werden. Dies trotz der gleichzeitig<br />
angewachsenen Gasinfrastruktur: Die Rohrnetzlänge<br />
stieg im gleichen Zeitraum von 130.000 km auf 560.000<br />
km (Transport: 16.000 km auf rund 50.000 km) und die Anzahl<br />
der gasversorgten Haushalte von 7 auf 18 Millionen. Die<br />
Versorgungsunterbrechungen in der öffentlichen Gasversorgung<br />
liegen bei weniger als 1,5 Minuten pro Kunde und Jahr.<br />
Dies wird auch durch den Gesetzgeber anerkannt, indem<br />
er den energierechtlichen Verweis auf das DVGW-Regelwerk<br />
bei allen Neuregelungen des Energiewirtschaftsgesetzes seit<br />
Jahrzehnten beibehält.<br />
III. Energiewirtschaftsgesetz,<br />
Gashochdruckleitungsverordnung und<br />
DVGW-Regelwerk<br />
1. Anwendungsbereich<br />
Zur Gewährleistung der technischen Sicherheit sind nach<br />
§ 49 Abs. 1 EnWG 1) die allgemein anerkannten Regeln der<br />
Technik zu beachten. Die Einhaltung der allgemein anerkannten<br />
Regeln der Technik wird nach § 49 Abs. 2 EnWG vermutet,<br />
wenn die technischen Regeln des DVGW eingehalten<br />
werden. Dem entspricht § 3 Abs. 4 GasHDrLtgV, wonach für<br />
die der öffentlichen Versorgung dienenden Gashochdruckleitungen<br />
mit dem genannten Betriebsdruck die Einhaltung<br />
des Standes der Technik vermutet wird, wenn die technischen<br />
Regeln des DVGW beachtet worden sind. Die im Mai<br />
dieses Jahres erlassene Neufassung der GasHDrLtgV hat daran<br />
nichts geändert (§ 2 Abs. 2 S. 1 GasHDrLtgV). Dies zeigt,<br />
dass dem technischen Regelwerk des DVGW von Gesetzes<br />
wegen ein hohes Gewicht zukommt. Wird es eingehalten,<br />
wird sowohl die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln<br />
der Technik als auch des Standes der Technik vermutet.<br />
Für Planung, Errichtung, Bauausführung, Überwachung<br />
und Inbetriebnahme von Gashochdruckleitungen sind die<br />
Technischen Regeln des DVGW-Arbeitsblattes G 463 aus<br />
dem Jahr 2001 einschlägig.<br />
Der Geltungsbereich umfasst „Gasleitungen aus Stahlrohren<br />
für einen maximal zulässigen Betriebsdruck > 16 bar“<br />
– hinsichtlich des Betriebsdrucks wird eine Untergrenze,<br />
aber keine Obergrenze definiert. Die NEL kann mit einen<br />
maximalen Druck von 100 bar betrieben werden, so<br />
1) Vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften – wie der auf<br />
Grundlage des § 49 Abs. 4 EnWG erlassenen GasHDrLtgV.<br />
dass das Arbeitsblatt uneingeschränkt anzuwenden ist. Dafür<br />
spricht auch, dass das DVGW-Arbeitsblatt G 463 unter<br />
Ziff. 9.4 u.a. auf die flankierend heranzuziehende DIN-<br />
Norm EN 334 „Gasdruckregelgeräte für Eingangsdrücke bis<br />
100 bar“ hinweist.<br />
Somit ist die These des OVG Lüneburg, das DVGW-Arbeitsblatt<br />
G 463 habe primär das örtliche Verteilernetz im<br />
Blick, nicht nachvollziehbar. Leitungen des örtlichen Verteilernetzes<br />
erreichen den für die Anwendung der G 463 notwendigen<br />
Mindestdruck von 16 bar nicht. Die spezifischen<br />
Anforderungen an das örtliche Verteilnetz sind in separaten<br />
Regelwerken (z.B. DVGW-Arbeitsblatt G 462) niedergelegt.<br />
2. Anforderungen an die Leitungsführung und<br />
die technische Sicherheit<br />
Weder in der GasHDrLtgV noch im DVGW-Arbeitsblatt G 463<br />
findet sich eine Regel zur Meidung von bebauten Gebieten,<br />
wie sie das OVG verlangt. Eine derartige Regel ist angesichts<br />
des Versorgungsauftrages der Allgemeinheit mit Gas und des<br />
hohen Sicherheitsstandards der unter die GasHDrLtgV fallenden<br />
Gashochdruckleitungen nicht geboten und sicherheitstechnisch<br />
entbehrlich. Dabei steht außer Frage, dass im Gashochdruckleitungsbau<br />
als auch im späteren Betrieb der Sicherheit<br />
des Menschen und der Umwelt höchste Bedeutung<br />
zukommt. Das DVGW-Arbeitsblatt G 463 bringt dies in Ziff.<br />
3.1 und Ziff. 3.1.1 deutlich zum Ausdruck, wonach dies die<br />
wichtigsten Einflussgrößen bei der Trassierung sind.<br />
Die Maßnahmen zur Realisierung der Sicherheitsforderung<br />
werden im DVGW-Regelwerk nicht im Einzelnen definiert.<br />
Dafür gibt es Gründe: Die Sicherheit von Mensch und<br />
Umwelt kann auf unterschiedliche Weise gewährleistet werden.<br />
Die jeweils wirksamsten sicherheitstechnischen Maßnahmen<br />
können und müssen im Einzelfall bestimmt werden.<br />
Die Ziele – Schutz des Menschen und der Umwelt – können<br />
je nach Gegebenheit auch unterschiedlich miteinander interagieren.<br />
Eine primär zu beachtende Meidungsregel, wie sie<br />
das OVG aufstellt, führt zu einem Regel-Ausnahme-Verhältnis<br />
zwischen Sicherheitsabständen und technischen Sicherheitsmaßnahmen.<br />
Diese Schaffung eines Rangverhältnisses<br />
greift in das Prinzip der Einzelfallprüfung ein und führt eben<br />
nicht zu einer optimalen Gewährleistung der technischen Sicherheit.<br />
Schon in dieser (grundlegenden) Ausgangsfrage gehen<br />
die Intention des DVGW-Regelwerks und die Auslegung<br />
des OVG auseinander.<br />
Die Bevorzugung von Sicherheitsabständen gegenüber<br />
technischen Sicherheitslösungen entspricht auch deshalb<br />
nicht dem DVGW-Regelwerk, weil durch technische Lösungen<br />
oft ebenso viel oder mehr Sicherheit als durch Abstände<br />
gewonnen werden kann. Dementsprechend wird zur Erreichung<br />
der Sicherheit im DVGW-Regelwerk im Schwerpunkt<br />
auf zwei Mechanismen gesetzt: der Schutz der Leitungen vor<br />
Einwirkungen Dritter und die hohe technische Sicherheitsausstattung<br />
der Leitungen.<br />
Im Einzelnen ist die Trassierungsregel der Ziff. 3.1.1 zunächst<br />
auf den Schutz der Leitung vor Einwirkungen Dritter<br />
ausgerichtet, weshalb bei der Trassierung alles berücksichtigt<br />
werden muss, was die Leitung gefährden könnte. Auf<br />
914 12 / 2011
diese Weise wird zugleich das Umfeld vor Leitungsschäden<br />
geschützt. Dem Schutzstreifen und der regelmäßigen intensiven<br />
Kontrolle dieses Streifens kommt deshalb eine sehr<br />
große Bedeutung zu. Im Schutzstreifen dürfen für die Dauer<br />
des Bestehens der Gasleitung keine Gebäude oder bauliche<br />
Anlagen errichtet und keine sonstigen Einwirkungen erfolgen,<br />
die den Bestand oder Betrieb der Gasleitung beeinträchtigen<br />
oder gefährden. Aus technischer Sicht ist daher<br />
eine Regel zur Meidung von Wohnbebauung, die nicht schon<br />
bei der Verhinderung des Schadenseintritts, sondern erst<br />
bei einem unterstellten Schadensfall und dessen Folgen ansetzt,<br />
entbehrlich.<br />
Dementsprechend wird im Anschluss an Ziff. 3.1.1 in den<br />
Ziff. 3.1.2 bis 3.1.4 konkretisiert, was bei der Trassierung zu<br />
berücksichtigen ist (Schutzstreifen; Abstände zu unterirdischen<br />
Anlagen; Hochspannungsleitungen, elektrifizierte Bahnstrecken<br />
und Windkraftanlagen). Ergänzend zu dieser Herangehensweise<br />
ist gemäß Ziff. 3.1.1 Satz 2 des DVGW-Arbeitsblattes<br />
G 463 das örtliche Planungsrecht zu berücksichtigen.<br />
Von überragender Bedeutung für die Sicherheit von Gasleitungen<br />
ist des Weiteren, dass das DVGW-Regelwerk hohe<br />
Anforderungen an die technische Auslegung und technische<br />
Überwachung stellt. Dazu ist zunächst festzuhalten, dass das<br />
DVGW-Regelwerk spezielle Anforderungen an Leitungen im<br />
Nahbereich von Wohnbebauung enthält. In den Technischen<br />
Regeln, u.a. G 463 Ziff. 3.2.5 und in der G 466-1 Ziff. 5.3,<br />
werden besondere Anforderungen an die Leitungskonstruktion<br />
und die betriebliche Überwachung im Bereich von Bebauungen<br />
definiert. Hierzu gehören<br />
besondere sicherheitstechnische Anforderungen an die<br />
Druckprüfung (z. B. Stresstestverfahren),<br />
die zerstörungsfreie Prüfung der Schweißnähte,<br />
die Zeitabstände für die Leitungsüberwachung und<br />
die Überwachung von Baumaßnahmen.<br />
Nachweislich trat an keiner Fernleitung, die einer Festigkeitsprüfung<br />
nach dem Stresstestverfahren unterzogen wurde, ein<br />
Versagen infolge betrieblicher Einflüsse auf.<br />
Darüber hinaus enthält das Regelwerk zahlreiche weitere<br />
Anforderungen an die technische Auslegung und die technische<br />
Überwachung, die der Schadensprävention dienen und<br />
die gewährleisten, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit<br />
keine Schäden auftreten. Diese sog. primären<br />
Sicherheitsmaßnahmen bestehen beispielsweise in<br />
einer einheitlichen Auslegung der Rohre und Rohrleitungsteile<br />
mit einem Sicherheitsfaktor von 1,6, während<br />
in Europa (DIN EN 1594) nur ein Mindestsicherheitsfaktor<br />
von 1,39 gefordert ist,<br />
dem Einbau von Absperrarmaturen zur Begrenzung der<br />
Austrittsmenge,<br />
einer mindestens 100%-igen Prüfung der Baustellenschweißnähte<br />
(d. h. dass jede Schweißnaht vollständig<br />
zerstörungsfrei geprüft wird, teilweise sogar mehrfach<br />
und nach verschiedenen Verfahren),<br />
einer hydrostatischen Dichtheits- und Festigkeitsprüfung<br />
der einzelnen Rohrabschnitte und zusätzlich Stresstest<br />
in bebauten Gebieten, wobei sämtliche drucktragenden<br />
Bauteile durch Sachverständige einer Abnahmeprüfung<br />
Bild 2: Zeitliche Entwicklung von Unfällen an Gasrohrleitungen in<br />
Deutschland 2)<br />
unterzogen und mit einem gültigen Abnahmeprüfzeugnis<br />
belegt werden,<br />
der Kennzeichnung des Trassenverlaufs der Leitung mit<br />
Schilderpfählen,<br />
einem passiven (Rohrumhüllung) und aktiven kathodischen<br />
Korrosionsschutz mit Messstellen zur Überwachung<br />
der Funktionsfähigkeit,<br />
einer Überprüfung des Umhüllungsschutzes durch sog.<br />
Intensivmessung,<br />
einem kurzen Begehungs- und Befliegungsrhythmus der<br />
Trasse zur Beobachtung von Aktivitäten im Schutzstreifen,<br />
der Inspektion mittels moderner Molchtechnologie, durch<br />
die Pipelines auch im Betrieb in regelmäßigen Abständen<br />
vollständig auf Schwächungen oder Schädigungen untersucht<br />
werden.<br />
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen werden heute häufig eingesetzt,<br />
zum Beispiel<br />
höhere Überdeckung als in DIN EN 1594 (0,8 m) gefordert,<br />
Verlegen von Trassenwarnbändern,<br />
hydrostatischer Stresstest in allen Rohrabschnitten,<br />
Dichtheitskontrollen zur Ermittlung von Kleinstleckagen.<br />
Aus sicherheitstechnischen Gründen besonders zu erwähnen<br />
ist der nach DVGW-Regelwerk einzuhaltende sog. Sicherheitsbeiwert<br />
von S=1,6 (für den Werkstoff L 485 MB)<br />
bei der rechnerischen Dimensionierung der Wanddicke von<br />
Rohren. Dieser dem DVGW-Regelwerk zugrunde liegende Sicherheitsbeiwert<br />
beruht auf – technisch belegten (dazu näher<br />
unten III.2.) – Erfahrungen und übertrifft den in der DIN<br />
EN 1594 geforderten Sicherheitsbeiwert von S=1,39 deutlich<br />
– das ist eine über 50 % höhere Sicherheitsreserve. Auf<br />
diese Weise wird gewährleistet, dass mit an Sicherheit grenzender<br />
Wahrscheinlichkeit keine Schäden auftreten. So werden<br />
auch Zusatzspannungen, wie z.B. Verlegespannungen,<br />
Formabweichungen, Eigenspannungen im Rohr, sicherheits-<br />
2) A. Klees, Folgen der Marktöffnung auf die Sicherheit des Gasnetzbetriebes,<br />
energie | wasser-praxis, 10/2011.<br />
12 / 2011 915
Stellunghame<br />
Normen & regelwerk<br />
technisch Rechnung getragen. Die weiteren Werkstoffeigenschaften<br />
stellen sicher, dass kein plötzliches Versagen der<br />
Rohrwandung eines Bauteils, keine Langzeitschädigung oder<br />
plötzliches Versagen eines Bauteiles aufgrund von Wechselbelastungen<br />
und kein Risswachstum auftreten können.<br />
Mit dem skizzierten Stand der Technik im Bereich der<br />
Leitungssicherheit korrespondiert, dass eine Pflicht zur Meidung<br />
von bebauten Gebieten entbehrlich ist. Auch europäische<br />
Standards verlangen eine derartige Regel nicht. Der DIN<br />
EN 1594 kann eine verbindliche Forderung von Abständen<br />
nach Maßgabe des OVG nicht entnommen werden. Dieser europäische<br />
Standard sieht unter Ziff. 5.2 lit. d) zwar als mögliche<br />
Maßnahme zur Gewährleistung der Leitungssicherheit<br />
die Einhaltung von geeigneten Abständen zu Gebäuden vor.<br />
Zur konkreten Ausgestaltung wird jedoch auf nationale Regelungen<br />
und/oder die individuellen Leitungsparameter verwiesen.<br />
Welche Maßnahmen im Einzelnen ergriffen werden, soll<br />
auch gemäß Ziff. 5.1 des europäischen Standards den spezifischen<br />
Umständen vorbehalten bleiben.<br />
Nichts anderes ergibt sich aus den vom OVG in Bezug genommenen<br />
„Safety Guidelines – Good Practices for Pipelines“<br />
der Economic Commission for Europe (UNECE-Empfehlungen).<br />
Darin wird grundsätzlich die Empfehlung ausgesprochen,<br />
zu Wohngebäuden und zu empfindlichen Gebieten (z.B.<br />
Wasserschutzgebiete) nicht näher spezifizierte angemessene<br />
Abstände einzuhalten. Die Festsetzung der Schutzstreifen<br />
und die Trassierungsanforderungen nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
G 463 Ziff. 3.1.1 verfolgt – wie auch in der GasHDrLtgV<br />
formuliert – den Schutz von Mensch und Umwelt. Dies entspricht<br />
der Zielsetzung der UNECE-Empfehlungen. Zudem<br />
ist die Intention des UNECE zu berücksichtigen: es fokussiert<br />
insbesondere den Austausch mit und die Unterstützung der<br />
Reformländer, in denen erfahrungsgemäß kein vergleichbar<br />
bewährtes gastechnisches Regel- oder Gesetzeswerk wie in<br />
Deutschland existiert.<br />
Insgesamt verfolgen die GasHDrLtgV und das DVGW-Regelwerk<br />
das Ziel, einen Leitungsschaden mit an Sicherheit<br />
grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Hierdurch<br />
wird unter anderem gewährleistet, dass eine Bebauung bis<br />
an den Schutzstreifen der Leitung ohne Einschränkungen der<br />
Sicherheit nachträglich erfolgen kann.<br />
3. Bestätigung durch Begründung zur<br />
GasHDrLtgV und Schadensstatistik<br />
Dass die GasHDrLtgV und das DVGW-Regelwerk auch ohne<br />
hunderte Meter Abstand zur Wohnbebauung eine ausreichende,<br />
dem Stand der Technik entsprechende Sicherheit gewährleisten,<br />
entspricht dem Willen des Gesetz- und Verordnungsgebers<br />
und wird durch die EGIG 3) - und DVGW-Schadensstatistik<br />
eindrucksvoll bestätigt.<br />
Ausweislich der Begründung der Bundesregierung zur<br />
GasHDrLtgV 1974 hat der Gesetz- bzw. Verordnungsgeber<br />
3) Die EGIG (European Gas Pipeline Incident Data Group) ist<br />
ein Zusammenschluss der wichtigsten europäischen Betreiber<br />
von Gaspipelines mit der Zielsetzung, einen hohen Sicherheitsstandard<br />
zu gewährleisten.<br />
seiner Verordnung die (uneingeschränkt anerkannte) Situation<br />
zugrunde gelegt, die sich durch „Ferngasleitungen über große<br />
Strecken, immer höhere Betriebsdrücke und häufige Trassierung<br />
durch dicht besiedelte Gebiete“ kennzeichnet (BR-Drs.<br />
563/74, Kursivsetzungen hinzugefügt). Dementsprechend<br />
legt der Gesetz- bzw. Verordnungsgeber als eine wesentliche<br />
Grundlage für seine Rechtsetzung den Umstand zugrunde,<br />
dass eine Annäherung zur Wohnbebauung stattfindet. In<br />
seiner Begründung zur neuen GasHDrLtgV aus dem Jahr 2011<br />
führt der Verordnungsgeber aus, dass sich die Verordnung in<br />
der Praxis bei der Gewährleistung der technischen Sicherheit<br />
von Gashochdruckleitungen bewährt hat und die Anforderungen<br />
an die technische Sicherheit größtenteils übernommen<br />
werden (BR-Drs. 123/11).<br />
Bestätigt wird die Beurteilung des Gesetz- und Verordnungsgebers<br />
auch durch die Schadensstatistiken. In einer gemeinsamen<br />
Datenbank der 15 größten europäischen Gasgesellschaften<br />
(EGIG) werden statistische Daten über Schadenshäufigkeiten<br />
sowie Schadensursachen an Erdgasleitungen<br />
ab 1970 dokumentiert. Die Statistik zeigt, dass die<br />
Schadenshäufigkeit mit Zunahme des Leitungsdurchmessers<br />
deutlich abnimmt. Wissenschaftliche Untersuchungen<br />
bestätigen den Trend, dass insbesondere relevante Schäden<br />
durch Dritte ab einer Wanddicke von ca. 12 mm (abhängig von<br />
Werkstoffparametern) mit üblichen Baggern nicht möglich<br />
sind 4) . Weiterhin stellt die große Wanddicke zusätzlich zum<br />
aktiven und passiven Korrosionsschutz eine hohe Sicherheit<br />
gegen Korrosion dar. Dass diese Trends auch für die NEL-Leitung<br />
mit DN 1400 und ca. 22 mm Wanddicke gelten, bestätigt<br />
die EGIG, in der Leitungen mit ähnlichen Wanddicken bereits<br />
berücksichtigt sind. Für Wanddicken größer 15 mm traten<br />
nach EGIG bislang keine Schäden durch Korrosion oder<br />
Beschädigung durch Dritte auf.<br />
Für Fernleitungen > DN 1100 wird über den betrachteten<br />
Zeitraum von 1970 bis 2007 kein Schaden mit Gasaustritt<br />
infolge äußerer Beschädigung oder Korrosion ausgewiesen.<br />
Die seit nunmehr 37 Jahren geführte europäische Schadensstatistik<br />
spiegelt den hohen Sicherheitsstand von Gashochdruckleitungen<br />
wider, Bild 3. Die Schadenhäufigkeit hat pro<br />
1.000 km Leitungslänge und Jahr von 0,37 (1970 bis 2007)<br />
auf 0,14 (im Schnitt der letzten fünf Jahre) deutlich abgenommen.<br />
Nach wie vor weisen Fernleitungen als Transportsysteme<br />
das mit Abstand niedrigste Gefährdungspotenzial<br />
auf. Somit zählen Gashochdruckleitungen zu den sichersten<br />
Transportmitteln für Energie weltweit.<br />
IV. Andere Regelwerke, insb. TRGL und<br />
TRFL, und BAM-Forschungsbericht<br />
1. Anwendungsbereich von TRGL und TRFL<br />
Die TRGL enthalten Regeln für nicht der öffentlichen Versorgung<br />
dienende Gashochdruckleitungen für brennbare, giftige<br />
oder ätzende Gase (ausgenommen Acetylen). Dementsprechend<br />
gelten sie nicht für Gashochdruckleitungen wie<br />
4) EPRG Methods for assessing the tolerance and resistance of<br />
pipelines to external damage, <strong>3R</strong> int. 10-12/99.<br />
916 12 / 2011
Bild 3: Schadensentwicklung<br />
nach EGIG<br />
die NEL. Die TRFL ist nicht auf unter die GasHDrLtgV fallende<br />
Gashochdruckleitungen, die der öffentlichen Gasversorgung<br />
dienen, anwendbar. Eine behelfsweise Heranziehung dieser<br />
beiden technischen Regelwerke ist schon deshalb zweifelhaft.<br />
Sie ist zudem entbehrlich, weil das DVGW-Regelwerk mit der<br />
im EnWG und der GasHDrLtgV vom Gesetzgeber angeordneten<br />
Vermutungswirkung zu Gunsten der technischen Regeln<br />
des DVGW die Maßnahmen bei Errichtung und Betrieb<br />
der Leitung in der Nähe von Bebauung regelt.<br />
Eine Übertragung von Inhalten der TRGL und TRFL auf die<br />
der GasHDrLtgV unterfallenden Gashochdruckleitungen für<br />
die öffentliche Versorgung ist auch vom Gesetz- und Verordnungsgeber<br />
nicht vorgesehen, im Gegenteil. Bereits in der ursprünglichen<br />
GasHDrLtgV war eine Unterscheidung zwischen<br />
Erdgasfernleitungen, die der öffentlichen Versorgung dienen,<br />
und solchen, bei denen das nicht der Fall ist, angelegt. Dies<br />
hat der Gesetz- bzw. Verordnungsgeber in seiner Begründung<br />
betont und dazu erläutert (BR-Drs. 563/74): „Für die der öffentlichen<br />
Versorgung dienenden Gashochdruckleitungen sind<br />
einige Regelungen und Anforderungen insbesondere im Anhang<br />
anders ausgestaltet als für die Gashochdruckleitungen,<br />
die nicht der öffentlichen Versorgung dienen. Dies beruht auf<br />
Unterschieden in den Eigenschaften der Gase, in der Abnahmestruktur<br />
(einerseits ein engmaschiges Verbundnetz mit<br />
einer Vielzahl von Stichleitungen, andererseits in der Regel<br />
Direktleitungen vom Erzeuger zu wenigen Abnehmern) und<br />
in der bisherigen Überwachungspraxis durch die Betreiber.“<br />
Durch die GasHDrLtgV 2011 wird die Trennung zwischen<br />
Gashochdruckleitungen, die der öffentlichen Versorgung dienen,<br />
und solchen, bei denen das nicht der Fall ist, noch einmal<br />
verstärkt, worauf der Gesetz- bzw. Verordnungsgeber in<br />
seiner Begründung zur neuen GasHDrLtgV ausdrücklich hinweist.<br />
Danach gibt es einerseits die Rohrfernleitungsverordnung<br />
(RohrFLtgV), die nach ihrem Anwendungsbereich nicht<br />
für Leitungen im Sinne des EnWG gilt, und andererseits die<br />
GasHDrLtgV für (bestimmte) Gashochdruckleitungen, die<br />
als Energieanlagen im Sinne des EnWG der Versorgung mit<br />
Gas dienen (BR-Drs. 123/11 vom 28.02.11, Seite 23; Kursivsetzung<br />
hinzugefügt): „Damit bestehen nun klar getrennte<br />
Rechtsregime, einerseits für Leitungen, die der Gasversorgung<br />
i. S. d. EnWG dienen und bei entsprechendem Druck der<br />
GasHDrLtgV unterstehen und andererseits für sonstige Rohrleitungen,<br />
die unter die RohrFLtgV bzw. als überwachungsbedürftige<br />
Anlagen unter das Geräte- und Produktsicherheitsgesetz<br />
fallen.“<br />
2. Anforderungen an die Leitungsführung und<br />
die technische Sicherheit<br />
Die Eilbeschlüsse werfen dennoch die Frage auf, ob und ggf.<br />
warum in der TRGL und TRFL mit der Meidung von bebauten<br />
Gebieten anders umgegangen wird als im DVGW-Regelwerk.<br />
Sowohl die TRGL als auch die TRFL enthalten vom DVGW-<br />
Regelwerk abweichende Formulierungen, wobei ausweislich<br />
der Vorbemerkung zur TRFL a.F. mit dieser technischen Regel<br />
zugleich einige weitere technische Regelwerke, darunter<br />
die TRGL, an den Stand der Technik angepasst werden. Nach<br />
dem Text der TRGL und TRFL ist die Trasse so zu wählen, dass<br />
die von der Leitung ausgehenden Gefahren für die Umgebung<br />
und die von der Umgebung ausgehenden Gefahren für die Leitung,<br />
auch unter Berücksichtigung von anzunehmenden Störfällen<br />
(TRGL) bzw. Schadensfällen (TRFL), so gering wie möglich<br />
gehalten werden (Ziff. 2.1 TRGL 101, Ziff. 1.1 TRGL 111,<br />
Ziff. 3.1 TRFL). Darüber hinaus sollen Gashochdruckleitungen<br />
nach Möglichkeit nicht in bebautem oder in einem Bauleitplan<br />
zur Bebauung ausgewiesenen Gelände errichtet werden (Ziff.<br />
1.3 TRGL 111, Ziff. 3.1.1 TRFL). Erfolgt dies doch, sind gem.<br />
1.4 TRGL 111 besondere Maßnahmen vorzusehen (Ziff. 1.4<br />
TRGL 111, Ziff. 3.1.1 TRFL).<br />
Was das im Einzelnen bedeutet, sagen auch die TRGL und<br />
die TRFL nicht. Ob damit die vom OVG im Rahmen seiner Eilbeschlüsse<br />
aufgestellte Meidungsregel mit einer Abstandsforderung<br />
von bis zu mehreren hundert Metern gemeint ist,<br />
12 / 2011 917
Stellunghame<br />
Normen & regelwerk<br />
erscheint höchst zweifelhaft. In der TRFL wurden diese Konsequenzen<br />
aus dem vom OVG maßgeblich herangezogenen<br />
BAM-Forschungsbericht (dazu noch unten IV.3.) nicht gezogen,<br />
obwohl dazu in der Neufassung der TRFL Gelegenheit<br />
bestand. Zu dieser Zeit lag der Forschungsbericht bereits vor.<br />
Dennoch fehlt in der im März 2010 neu bekannt gemachten<br />
TRFL eine Regel zur Einhaltung von Abständen, wie sie<br />
das OVG statuiert. Ebenso fehlt dort ein striktes Stufenverhältnis<br />
im Sinne der Eilbeschlüsse des OVG zur NEL, wonach<br />
(nur) bei unüberwindbaren Hindernissen von bestimmten Abständen<br />
abgesehen werden darf und (erst) dann (zusätzliche)<br />
technische Vorkehrungen zum Zuge kommen. Diese Auslegung<br />
der TRFL durch das OVG entspricht offensichtlich nicht<br />
dem Verständnis des Verordnungsgebers.<br />
Dazu hat das für den Anwendungsbereich der RohrFLtgV<br />
federführende BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz<br />
und Reaktorsicherheit auf Rückfrage des Landtags<br />
von Baden-Württemberg im Zusammenhang mit einer Petition<br />
betreffend Sicherheitsabstände zur dort geplanten Ethylen-Pipeline<br />
im Vorfeld der genannten Neubekanntmachung<br />
der TRFL erläutert (Landtag von Baden-Württemberg, Drs.<br />
14/6687, S. 28): „In Kenntnis des Forschungsberichtes der<br />
BAM wird auch die neue TRFL keine generellen Vorgaben für<br />
einzuhaltende Mindestabstände zu Gebieten mit Wohnbebauung<br />
enthalten. Das BMU teilte mit, dass die Neufassung<br />
der TRFL bewusst auf die Festsetzung von solchen Sicherheitsabständen<br />
verzichte. Man müsse im Einzelfall entscheiden,<br />
welche konkreten Maßnahmen man ergreife. Einzelfall in<br />
diesem Sinne seien Sondersituationen, wie sie in der Nr. 5.2.5<br />
TRFL angesprochen und behandelt werden. Nachdem die in<br />
dieser Ziffer genannten Einzelmaßnahme nicht abschließend<br />
(„z. B.“) aufgeführt seien, könne man die Erhöhung des Abstandes<br />
zu diesen Maßnahmen rechnen. Das bedeute, dass<br />
im konkreten Einzelfall zu prüfen sei, ob durch eine/mehrere<br />
der genannten Maßnahmen das konkrete erhöhte Gefährdungspotential<br />
ausgeglichen werden könne/müsse, wobei allein<br />
durch die Nähe zur Wohnbebauung noch nicht eine derartige<br />
Sondersituation gegeben sei.“<br />
Insgesamt ist damit auch der Stand der Technik im Sinne<br />
der TRFL ein anderer, als das OVG in seinen Eilbeschlüssen<br />
annimmt. Bestätigt und erläutert wird dies durch den bereits<br />
erwähnten Beschluss des VGH Mannheim vom 14.11.2011:<br />
Danach „enthält die TRFL keine Technische Regel über Mindestabstände<br />
zwischen einer Rohrfernleitung und der nächsten<br />
Wohnbebauung oder sonstigen schutzwürdigen Objekten.<br />
[…] Die TRFL verbietet nicht, Rohrfernleitungen in Wohngebieten<br />
zu errichten. Allerdings müssen in diesen Gebieten besondere<br />
Schutzmaßnahmen gemäß Nr. 5.2.5 TRFL getroffen<br />
werden. […] Die TRFL verfolgt mit Rücksicht auf die Besonderheiten<br />
von Rohrfernleitungen, mit denen im dicht besiedelten<br />
Bundesgebiet zwangsläufig Siedlungsgebiete durchquert<br />
oder zumindest gestreift werden müssen, ein primär auf die<br />
Sicherheit der Anlage selbst ausgerichtetes Sicherheitskonzept.<br />
Sie enthält daher keine technische Regel über Mindestabstände<br />
zwischen einer Rohrfernleitung und der nächsten<br />
Wohnbebauung oder sonstigen schutzwürdigen Objekten. Eine<br />
solche Regel lässt sich nicht aus Nr. 3.1 TRFL herleiten, in<br />
der die „Wahl der Trasse unter Gefährdungsgesichtspunkten“<br />
geregelt wird. […] Hierbei handelt es sich um eine allgemeine<br />
– einem Optimierungsangebot ähnliche – Forderung, die<br />
dem Entscheidungsträger einen Einschätzungsspielraum einräumt,<br />
jedoch nicht zur Einhaltung bestimmter Sicherheitsabstände<br />
verpflichtet. Auch Nr. 3.1.1 TRFL („Vermeidung bebauter<br />
Gebiete“) kann eine Forderung nach Sicherheitsabständen<br />
zu einer Wohnbebauung nicht entnommen werden. […] Diese<br />
Regelungen enthalten zwar die Vorgabe, vorrangig bereits<br />
durch die Trassenführung Gefährdungen zu minimieren. Damit<br />
werden aber keine technischen Sicherheitsabstände im Sinne<br />
einer technischen Regel gefordert. Das Regelwerk ist primär<br />
darauf ausgerichtet, schwerwiegende Gefahren erst gar<br />
nicht entstehen zu lassen […]. Darin liegt kein unzumutbares<br />
Sicherheitsrisiko, weil nach dem Regelwerk die erforderliche<br />
Sicherheit auf andere Weise herzustellen ist. Das Sicherheitskonzept<br />
der TRFL ist darauf ausgelegt, anstelle von Abständen<br />
Sicherheitsmaßnahmen an der Leitungsanlage selbst vorzunehmen.<br />
Es baut nicht auf Abständen zu schutzwürdigen Objekten,<br />
sondern schwerpunktmäßig auf einem Primärschutz<br />
auf. […] Geringe oder – bis auf den Schutzstreifen […] – fehlende<br />
Abstände zu Schutzobjekten werden durch eine Erhöhung<br />
der Sicherheitsmaßnahmen kompensiert. […] Eine hinreichende<br />
Sicherheit vor den von einer Rohrfernleitung ausgehenden<br />
Gefahren für Menschen wäre durch Sicherheitsabstände<br />
nur zu erreichen, wenn sichergestellt wäre, dass sich<br />
Menschen in den entstehenden Schutzzonen nicht aufhalten.<br />
Ein solches Konzept ließe sich nicht verwirklichen, weil Rohrfernleitungen<br />
zwangsläufig Gebiete streifen oder queren müssen,<br />
in denen sich Personen aufhalten. […] Eine Notwendigkeit,<br />
dort einen von jeglicher Nutzung freizuhaltenden Korridor von<br />
mehreren hundert Metern zu schaffen, würde jeglichen Pipelinebau<br />
verhindern. […] Die Sicherheit dieser Menschen ist nur<br />
durch technische Maßnahmen garantiert, die an der Leitung<br />
selbst und ihrer Überwachung ansetzen. Das Regelwerk sieht<br />
daher bewusst von einer Forderung nach Sicherheitsabständen<br />
zur Schadensbegrenzung ab.“ Zu Recht stellt der VGH<br />
außerdem heraus, dass die Bündelung mit vorhandenen Anlagen<br />
ein wichtiger Grund dafür sein kann, eine Rohrfernleitung<br />
in bebauten Gebieten zu errichten; die Anforderung der<br />
Ziff. 3.1.1 TRFL, nach Möglichkeit bebaute Gebiete zu meiden,<br />
steht dem nicht entgegen (S. 15, 18, 23–26).<br />
3. BAM-Forschungsbericht 285<br />
Schließlich führt der BAM-Forschungsbericht 285 nicht dazu,<br />
dass für die dem DVGW-Regelwerk unterfallenden Gashochdruckleitungen<br />
die vom OVG für die Zwecke des Eilbeschlusses<br />
festgelegte Meidung von 350 m zwischen Leitung und<br />
bebauten Gebieten sachlich gerechtfertigt ist. Obwohl man<br />
sich in dem BAM-Forschungsbericht schwerpunktmäßig mit<br />
Unfällen an Erdgaspipelines befasste, wurden die Daten aus<br />
der Langjahres-Statistik der DVGW-Schaden- und Unfallerfassung<br />
weder angefragt noch berücksichtigt.<br />
Des Weiteren wurden im BAM-Forschungsbericht 285<br />
teilweise weit in der Vergangenheit liegende Pipelineunfälle<br />
bewertet. Höchst bedeutsam für das Verständnis des Forschungsberichts<br />
ist daher, dass es sich bei den meisten dort<br />
918 12 / 2011
gwfGas<br />
Erdgas<br />
2Hefte<br />
gratis<br />
zum<br />
Kennenlernen!<br />
ausgewerteten Unfällen um Leitungen handelt, die nach einem<br />
heute überholten Stand der Technik errichtet worden sind,<br />
oder die im außereuropäischem Ausland unter Zugrundelegung<br />
anderer Regelwerke vorgekommen sind. Zudem werden<br />
ausschließlich Schadensauswirkungsbetrachtungen durchgeführt;<br />
Unfallursachen oder Schadenseintrittswahrscheinlichkeiten<br />
bleiben ausgeblendet. Die Ermittlung von Schadensausmaßen,<br />
wie den im Forschungsbericht genannten Gefährdungsradien,<br />
oder die Berechnung von Risiken durch den Betrieb<br />
von Gasleitungen, sind insoweit von sehr begrenzter<br />
Aussagekraft.<br />
Zum BAM-Forschungsbericht 285 stellt der VGH Mannheim<br />
im Beschluss vom 14.11.2011 dementsprechend heraus:<br />
„Dieser erlaubt […] nicht den Schluss, dass der Verzicht<br />
der TRFL auf feste Sicherheitsabstände durch Erkenntnisfortschritte<br />
in Wissenschaft und Technik überholt ist und das Regelwerk<br />
damit den gesetzlichen Anforderungen nicht mehr<br />
gerecht wird. [… Er enthält] keine den Stand der Technik widerspiegelnde<br />
neue Technische Regel in Form einer allgemeinen<br />
Abstandsempfehlung von 350 m zu Wohnbebauung zur<br />
Vermeidung und Reduzierung von Risiken bei Leitungsunfällen.<br />
[…] Soweit er in seiner Zusammenfassung auf den Seiten<br />
29 und 30 ausführt, die Auswertung habe ergeben, dass<br />
für eine Risikoanalyse zur Flächennutzungsplanung die Wirkungen<br />
der Wärmestrahlung und der Druckwelle bis zu einer<br />
Entfernung von 350 m, gemessen ab Mitte Pipelinetrasse,<br />
zu berücksichtigen sind’, kann in dieser Aussage trotz der<br />
strikten Formulierung keine valide Abstandsempfehlung zur<br />
Begrenzung der Auswirkungen von Pipelineunfällen im Sinne<br />
einer Technischen Regel gesehen werden. […] Ein Abrücken<br />
von den in dem Regelwerk niedergelegten Standards setzt<br />
gesicherte Erkenntnisfortschritte in Wissenschaft und Technik<br />
voraus“ (S. 26 f). Wie der VGH Mannheim schließlich auf<br />
S. 27 f ausführt, ist dem BAM-Forschungsbericht selbst zu<br />
entnehmen und wird von dessen Mitautorin zusätzlich bestätigt,<br />
dass damit keine Forderung nach Einhaltung bestimmter<br />
Abstände aufgestellt wurde.<br />
Autor<br />
Die Fachzeitschrift für<br />
Gasversorgung und<br />
Gaswirtschaft<br />
Jedes zweite Heft mit<br />
Sonderteil R+S<br />
Recht und Steuern im<br />
Gas- und Wasserfach<br />
Vom Fach fürs Fach<br />
Sichern Sie sich regelmäßig diese führende<br />
Publi kation. Lassen Sie sich Antworten geben auf<br />
alle Fragen zur Gewinnung, Erzeugung, Verteilung<br />
und Verwendung von Gas und Erdgas.<br />
Oldenbourg Industrieverlag München<br />
www.gwf-gas-erdgas.de<br />
✁<br />
gwf Gas/Erdgas erscheint in der Oldenbourg Industrieverlag GmbH, Rosenheimer Str. 145, 81671 München<br />
Vorteilsanforderung per Fax: +49 (0)931 / 4170-492<br />
oder per Post: Leserservice gwf • Postfach 91 61 • 97091 Würzburg<br />
Ja, senden Sie mir die nächsten beiden Ausgaben des Fachmagazins gwf Gas/<br />
Erdgas gratis zu. Nur wenn ich überzeugt bin und nicht innerhalb von 14 Tagen<br />
nach Erhalt des zweiten Hefts schriftlich absage, bekomme ich gwf Gas/Erdgas<br />
für zunächst ein Jahr (12 Ausgaben) zum Preis von € 170,- zzgl. Versand<br />
(Deutschland: € 15,- / Ausland: € 17,50) pro Halbjahr.<br />
Vorzugspreis für Schüler und Studenten (gegen Nachweis) € 85,- zzgl. Versand<br />
pro Halbjahr.<br />
Technisches Komitee<br />
Gastransportleitungen des DVGW<br />
Firma/Institution<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
Ansprechpartner DVGW<br />
PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Dipl.-Ing. Alfred Klees<br />
Josef-Wirmer-Straße 1–3, 53123 Bonn<br />
Tel. +49 228 91 88-900<br />
Fax +49 228 91 88-994<br />
E-Mail: klees@dvgw.de<br />
E-Mail<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
✘<br />
Datum, Unterschrift<br />
PA<strong>3R</strong>IN1211<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail)<br />
oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt<br />
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an den Leserservice gwf, Postfach 91 61, 97091 Würzburg<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene<br />
Daten erfasst, gespeichert und verarbeitet. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich vom Oldenbourg Industrieverlag<br />
12 / 2011 oder vom Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per E-Mail, nicht über interessante Fachangebote 919 informiert und beworben<br />
werde. Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
Fachbericht<br />
Normen & Regelwerk<br />
Die Novelle des Erneuerbare-<br />
Energien-Gesetzes (EEG)<br />
Von Julian Menze<br />
Das Gesetz zur Neuregelung des Rechtsrahmens für die Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien<br />
besteht im Wesentlichen aus einer Novelle des Gesetzes über den Vorrang erneuerbarer Energien (kurz EEG) und tritt<br />
am 1. Januar 2012 in Kraft. Die folgenden Ausführungen werden sich mit den wichtigsten Neuerungen des EEG befassen<br />
und einen Überblick über das EEG 2012 vornehmen.<br />
Hintergrund und Ziele<br />
Die Bundesregierung hat am 28. September 2010 ein Energiekonzept<br />
beschlossen, das u.a. den stetigen Ausbau der erneuerbaren<br />
Energien vorsieht. Die Ausbauziele für den Stromsektor<br />
aus diesem Energiekonzept sind zukünftig im EEG als<br />
Mindestziele verankert. Demzufolge soll der Anteil der erneuerbaren<br />
Energien an der Stromversorgung spätestens 2020<br />
mindestens 35 % betragen; bis 2030 soll dieser Anteil 50 %<br />
betragen, bis 2040 65 % und bis 2050 ganze 80 %. Obgleich<br />
diese Zielsetzung als sehr ambitioniert zu bewerten ist (insbesondere<br />
die Tatsache, dass der Anteil der Stromerzeugung<br />
aus erneuerbaren Energien in Deutschland innerhalb eines<br />
Jahrzehnts somit zu verdoppeln ist), bleibt festzuhalten, dass<br />
hierdurch eine langfristige Perspektive eröffnet wird, die den<br />
betroffenen Akteuren Planungssicherheit gewährt.<br />
Eckpunkte der EEG-Novelle<br />
Wie bereits dargestellt, befasst sich das neue EEG damit, den<br />
Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland voranzutreiben,<br />
es muss allerdings gleichzeitig klar sein, dass die Energiewende<br />
in Deutschland nicht allein durch die zunehmende<br />
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien möglich ist. Mit<br />
dem bisherigen Prinzip der Stromerzeugung, wann immer sie<br />
möglich ist und nicht allein dann, wenn der Strom gebraucht<br />
wird (sog. „produce and forget“), ist dies nicht denkbar. Vielmehr<br />
bedarf es einer sicheren und bedarfsorientierten Verfügbarkeit<br />
des Stroms, soll die Versorgungssicherheit gesichert<br />
werden. Durch bedarfsgerechte Stromerzeugung sollen<br />
die erneuerbaren Energien auch Systemverantwortung (bspw.<br />
Lösung der Probleme hinsichtlich Frequenz- und Spannungshaltung)<br />
übernehmen ohne dabei die Kosteneffizienz des EEG<br />
aus dem Blick zu verlieren.<br />
Markt-, Netz- und Systemintegration<br />
Bisher erfolgte der Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren<br />
Energien völlig losgelöst vom Bedarf. Um zukünftig<br />
das Zusammenspiel von erneuerbaren Energien, konventionellen<br />
Kraftwerken, Speichern und dem Stromverbrauch zu<br />
optimieren enthält das EEG 2012 nun folgende Instrumente<br />
und Anreize:<br />
Marktprämie<br />
Mit dem 1. Januar 2012 können alle Betreiber einer EEG-<br />
Anlage ihren Strom selbst vermarkten, sei es durch Liefervertrag<br />
oder an der Strombörse. Dafür verzichten die Betreiber<br />
auf ihre feste Vergütung nach dem EEG, erhalten<br />
nun aber eine Marktprämie neben dem Verkaufserlös. Die<br />
Marktprämie ist also optional und errechnet sich aus der<br />
Differenz zwischen der EEG-Einspeisevergütung und dem<br />
durchschnittlichen Börsenstrompreis (im Vergleich zur gewöhnlichen<br />
EEG-Vergütung erfolgt also keine Schlechterstellung<br />
der Betreiber). Den Wechsel zur Direktvermarktung<br />
müssen die EEG-Anlagenbetreiber ihrem Netzbetreiber<br />
mitteilen, der Wechsel ist jedoch nur zum ersten Kalendertag<br />
eines Monats möglich.<br />
Grundgedanke des Marktprämienmodells ist, dass die<br />
Marktintegration erneuerbarer Energien insbesondere dadurch<br />
gehemmt wird, dass der durchschnittliche Marktpreis<br />
i.d.R. geringer ist als die EEG-Vergütung. Die EEG-Anlagenbetreiber<br />
sollen durch die Direktvermarktung einen Anreiz erhalten,<br />
ihre Anlagen marktorientiert, d.h. entsprechend dem<br />
Strombedarf, zu betreiben, um so die erneuerbaren Energien<br />
allmählich an den Strommarkt heranzuführen. Denn erzielt<br />
der EEG-Anlagenbetreiber mit der Direktvermarktung nach<br />
dem Marktprämienmodell einen höheren als den aktuellen<br />
Börsenpreis, besteht für ihn auf diese Weise die Möglichkeit,<br />
zusätzliche Erlöse zu erlangen. Dieser Weg eröffnet sich für<br />
den Anlagenbetreiber, indem er − statt die Einspeiseleistung<br />
fortwährend unverändert beizubehalten − in Tiefpreisphasen<br />
weniger und in Hochpreisphasen mehr produziert. Diese Steuerung<br />
durch den EEG-Anlagenbetreiber stellt sich bei fluktuierenden<br />
erneuerbaren Energien grundsätzlich schwieriger dar,<br />
sodass das Marktprämienmodell hier wohl nur für größere −<br />
aktiv bewirtschaftete − Anlagen attraktiv ist.<br />
Die Anreizsetzung, Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbare<br />
Energien nachfrageorientiert zu betreiben, soll<br />
die fluktuierende Stromerzeugung aus Windkraft und Photovoltaik<br />
ausgleichen und stärkt gleichzeitig den Wettbewerb.<br />
In der Folge ergibt sich eine völlig neue Marktsituation,<br />
da bisher allein die vier Übertragungsnetzbetreiber den<br />
so erzeugten Strom an der Strombörse vermarkten konnten.<br />
Soweit sich durch die Selbstvermarktung Kosten für<br />
920 12 / 2011
Quelle: Stadtwerke München<br />
die Anlagenbetreiber ergeben, werden ihnen diese (wie zuvor<br />
schon den Übertragungsnetzbetreibern) erstattet und<br />
auf den Stromverbraucher umgelegt. Die hierdurch entstehenden<br />
Kosten belaufen sich voraussichtlich auf maximal<br />
200 Mio. Euro im Jahr.<br />
Flexibilitätsprämie<br />
Um die bedarfsgerechte Erzeugung von Strom aus Biogas<br />
zu fördern, hat der Gesetzgeber zudem eine Flexibilitätsprämie<br />
eingeführt. Damit sollen Investitionen in Generatoren<br />
und Gasspeicher ermöglicht werden, um die Stromerzeugung<br />
aus Biomasse um bis zu 12 Stunden aufzuschieben.<br />
Den Anspruch auf die Flexibilitätsprämie erwirbt der Betreiber<br />
einer Anlage zur Stromproduktion aus Biogas, wenn er<br />
zusätzlich zu der bereits installierten Leistung weitere Leistung<br />
für eine bedarfsorientierte Stromproduktion zur Verfügung<br />
stellt. Hintergrund ist die Überlegung, dass eine am konkreten<br />
Strombedarf ausgerichtete Stromerzeugung in Biogasanlagen<br />
die Nutzung größerer Mengen aus fluktuierenden<br />
erneuerbaren Energien stammenden Stroms ermöglicht.<br />
Die Flexibilitätsprämie soll die hierzu notwendigen Investitionen<br />
ermöglichen.<br />
Grünstromprivileg<br />
Das Grünstromprivileg ist im EEG bereits eine etablierte<br />
Form der Direktvermarktung, wurde im Rahmen der EEG-<br />
Novelle jedoch ebenfalls einer legislativen Neujustierung unterzogen.<br />
Die Bedeutung des Grünstromprivilegs hatte zuvor<br />
immer weiter zugenommen, da die EEG-Umlage fortwährend<br />
gestiegen und somit die finanzielle Bedeutung der<br />
Befreiung von der Umlage immer weiter gewachsen war. So<br />
beträgt die EEG-Umlage für das Jahr 2011 3,53 ct/kWh,<br />
während sie noch im Jahr 2010 2,047 ct/kWh betrug.<br />
Das Grünstromprivileg knüpft demzufolge an die EEG-<br />
Umlage an und befreit ein Energieversorgungsunternehmen,<br />
das seine Kunden zu mindestens 50 % mit aus erneuerbaren<br />
Energien gewonnenem Strom beliefert, von der Umlage. Dies<br />
führt zu einer steigenden Nachfrage nach direkt vermarktetem<br />
Strom und steht daher mit den Neuregelungen zur Direktvermarktung<br />
im EEG 2012 in direktem Zusammenhang.<br />
Die Änderung der bestehenden Regelungen wurde notwendig,<br />
weil starke Mitnahmeeffekte zu beobachten waren<br />
und die Befürchtung bestand, dass die EEG-Umlage zukünftig<br />
von immer weniger Stromkunden finanziert werden würde.<br />
Statt einer vollständigen Befreiung von der EEG-Umlage<br />
wird die Begünstigung durch das Grünstromprivileg daher<br />
auf maximal 2 ct/kWh begrenzt (diese Rechtsfolge ist allerdings<br />
schon zum 1. Mai 2011 durch das Europarechtsanpassungsgesetz<br />
in das EEG eingeführt worden).<br />
Das Energieversorgungsunternehmen, das in den Genuss<br />
des Grünstromprivilegs kommen möchte, muss zukünftig zudem<br />
weitere Voraussetzungen erfüllen:<br />
Der Strom muss einerseits − wie auch bisher − zu mindestens<br />
50 % aus Strom i.S.d. §§ 23−33 EEG 2012 zusammengesetzt<br />
sein, d.h. aus Strom aus erneuerbaren Energien.<br />
Zudem müssen mindestens 20 % des insgesamt gelieferten<br />
Stroms aus EEG-Anlagen i.S.d. §§ 29−33 EEG 2012 stammen,<br />
d.h. Strom aus fluktuierenden erneuerbaren Energien.<br />
Bezugspunkt ist bei all diesen Angaben das Kalenderjahr. Die<br />
o.g. Anforderungen sind dabei in mindestens acht Monaten<br />
des jeweiligen Jahres von dem Energieversorgungsunternehmen<br />
zu erfüllen.<br />
12 / 2011 921
Fachbericht<br />
Normen & Regelwerk<br />
Energieversorgungsunternehmen, die das Grünstromprivileg<br />
in Anspruch nehmen wollen, sind zudem verpflichtet,<br />
dies bereits zum 30. September des Vorjahres ihrem jeweiligen<br />
Übertragungsnetzbetreiber mitzuteilen; die Berechnung<br />
erfolgt dabei durch Abstellen auf die erste Hälfte des<br />
Vorjahres.<br />
Weiterhin sind die Energieversorgungsunternehmen nunmehr<br />
ausdrücklich dazu verpflichtet, ihrem jeweiligen Übertragungsnetzbetreiber<br />
das Vorliegen der o.g. Anforderungen<br />
für ihren Bilanzkreis i.S.d. § 50 EEG 2012 nachzuweisen.<br />
Für das Grünstromprivileg ist der Strom zudem in Zukunft<br />
i.S.d. § 42 EnWG zu kennzeichnen.<br />
Der Strom muss überdies von den EEG-Anlagenbetreibern<br />
ordnungsgemäß direkt vermarktet werden nach § 33 b<br />
Nr. 2 EEG 2012.<br />
Erfüllt das Energieversorgungsunternehmen nur eine dieser<br />
Anforderungen nicht, bleibt es zur Zahlung der EEG-Umlage<br />
in voller Höher verpflichtet (Alles-oder-Nichts-Prinzip).<br />
Weitere Maßnahmen<br />
Der Gesetzgeber versucht zudem die Integration der erneuerbaren<br />
Energien zu verbessern, indem er Photovolta-<br />
ikanlagen in das Einspeisemanagement mit einbezieht. Damit<br />
können in Zukunft Photovoltaikanlagen − wie zuvor auch<br />
schon andere EEG-Anlagen − vom Netzbetreiber in für das<br />
Stromnetz kritischen Situationen abgeregelt werden. Da die<br />
EEG-Anlagenbetreiber in dieser Situation an der Stromeinspeisung<br />
gehindert werden, werden sie allerdings entsprechend<br />
entschädigt. Zudem wurde ein ressortübergreifendes<br />
Speicherprogramm, das ebenfalls der Systemintegration<br />
dient, auf die Beine gestellt und neue Speicher im EnWG<br />
von Netzentgelten befreit.<br />
Regelungen zu den verschiedenen erneuerbaren<br />
Energien<br />
Die Vergütungen, die das EEG festlegt, verfolgen verschiedene<br />
Ziele. So sollen zum einen die entstehenden Kosten gedeckt<br />
und durch eine ansprechende Rendite weitere Investitionen<br />
möglichst attraktiv gemacht werden, um so den weiteren<br />
Ausbau voranzutreiben. Gleichzeitig soll jedoch eine Überförderung<br />
vermieden werden, um den Strompreis durch die<br />
Auswirkungen der EEG-Umlage nicht in die Höhe zu treiben.<br />
Das EEG 2012 enthält nunmehr verschiedene Maßnahmen,<br />
um diese Ziele zu erreichen:<br />
Windenergie<br />
Bei der Förderung der Windenergie durch das EEG 2012 ist<br />
zwischen der Stromerzeugung an Land (onshore) und auf See<br />
(offshore) zu differenzieren, da der technologische Durchbruch<br />
bei der Stromgewinnung auf See bisher nicht erfolgt<br />
ist und Investitionen in diesem Bereich außerordentlich kostspielig<br />
sind.<br />
© Rebel - Fotolia.com<br />
Wind onshore<br />
Die Stromerzeugung aus Windenergie an Land wird bis auf<br />
Weiteres den Großteil der erneuerbaren Energien darstellen,<br />
das neue EEG setzt daher die Förderung der Windenergie an<br />
Land größtenteils wie bisher fort. Folgende Änderungen sind<br />
dabei dennoch zu beachten:<br />
Die jährliche Degression der Vergütungssätze wird von 1 %<br />
auf 1,5 % erhöht, um so einen Anreiz für Kostensenkungen<br />
zu schaffen. Vor dem Hintergrund gesunkener Anlagenpreise<br />
stellt sich die raschere Absenkung der Vergütung<br />
dabei als durchaus gerechtfertigt dar.<br />
Der Systemdienstleistungsbonus wurde für Neuanlagen um<br />
ein Jahr bis Ende 2014 verlängert, für Bestandsanlagen sogar<br />
bis Ende 2015. Er hat allein den Zweck, die Kosten abzudecken,<br />
die dadurch entstehen, dass Windenergieanlagen die<br />
Fähigkeit haben müssen, an der Netzintegration mitzuwirken<br />
(im Jahr 2012 beträgt er 0,48 ct/kWh).<br />
Der Anwendungsbereich des Repowering-Bonus wurde<br />
zudem erheblich ausgeweitet, dabei jedoch auf alte, netztechnisch<br />
problematische Anlagen beschränkt, die vor<br />
2002 in Betrieb genommen wurden. Neuere Anlagen wurden<br />
in den Repowering-Bonus nicht einbezogen, da dies<br />
einer dauerhaften „Abwrackprämie“ gleichkäme. Er dient<br />
lediglich einer Ersetzung alter, netztechnisch problematischer<br />
Anlagen bzw. der Korrektur einer raumplanerisch<br />
ungewünschten Verteilung der Anlagen.<br />
922 12 / 2011
Betreiber einer Anlage mit einer installierten Leistung von<br />
bis zu 50 kW müssen kein Referenzgutachten vorlegen. Sie<br />
erhalten zukünftig den erhöhten Anfangsvergütungssatz<br />
über den gesamten Zeitraum (8,93 ct/kWh in 2012).<br />
Wind offshore<br />
Ziel der Neuregelungen im EEG 2012 ist es, die Windenergie<br />
auf See neben der an Land als wichtigsten Teil der Stromerzeugung<br />
aus erneuerbaren Energien zu etablieren. Aufgrund<br />
mangelnder Erfahrung und schwierigster Bedingungen bei<br />
der Errichtung gestaltet sich jedoch die Finanzierung mithin<br />
äußerst kompliziert. Das EEG 2012 fördert daher die Stromerzeugung<br />
aus Windenergie auf See − entsprechend ihrem<br />
Entwicklungsstand und den mit der Technologie verbundenen<br />
Kosten − besonders intensiv:<br />
Die bis 2015 befristete Sprinterprämie von 2 ct/kWh wird<br />
in die Anfangsvergütung eingegliedert, sodass diese auf 15<br />
ct/kWh steigt.<br />
Der Degressionsbeginn wird von 2015 auf 2018 verschoben,<br />
diese dafür im Gegenzug von jährlich 5 % auf 7 %<br />
angehoben, da sich der Ausbau der Windenergie auf See<br />
erheblich verzögert hat.<br />
Die Netzanbindungspflicht für die Übertragungsnetzbetreiber<br />
nach EnWG bzw. NABEG ist zukünftig unbefristet.<br />
Es wird ein optionales Stauchungsmodell eingeführt, das<br />
eine Anfangsvergütung von 19 ct/kWh für 8 Jahre verspricht,<br />
während die generelle Vergütung 15 ct/kWh über<br />
12 Jahre hinweg gewährt. Das Stauchungsmodell ist kostenneutral<br />
ausgestaltet und wird wohl dazu führen, dass<br />
nicht länger die Grundvergütung in Anspruch genommen,<br />
sondern der Strom stattdessen direkt vermarktet wird.<br />
Photovoltaik<br />
Der Ausbau der Stromerzeugung mittels Photovoltaikanlagen<br />
wurde zuletzt stark forciert. So wurden bspw. im Jahr 2010<br />
80 % aller Investitionen in erneuerbare Energien in diesem<br />
Sektor getätigt, das entspricht etwa 7.400 MW. Daher wurden<br />
bereits im vergangenen Jahr die Vergütungen gekürzt<br />
und die Degression verstärkt (sog. „atmender Deckel“). Das<br />
EEG 2012 beschäftigt sich demgegenüber allein mit der Verbesserung<br />
der Netzintegration. Folgende Justierungen wurden<br />
vorgenommen:<br />
Die Eigenverbrauchsregelung bleibt unverändert, wird allerdings<br />
bis zum Jahr 2013 verlängert.<br />
Die bestehende Degressionsregelung und auch der Ausbaukorridor<br />
werden beibehalten. Es erfolgt weiterhin − wie auch<br />
schon im Jahr 2011 − eine halbjährliche Anpassung.<br />
Es wird zukünftig keine Vergütung mehr für Freiflächenanlagen<br />
geben, die auf Konversionsflächen in Nationalparks<br />
gelegen sind.<br />
Zukünftig unterliegen Anlagen ab 100 kW dem Einspeisemanagement<br />
und Anlagen ab 30 kW einem vereinfachten<br />
Einspeisemanagement. Letzteren steht es frei, am<br />
Einspeisemanagement teilzunehmen. Tun sie dies jedoch<br />
nicht, wird ihre Einspeiseleistung am Netzanschlusspunkt<br />
auf maximal 70 % begrenzt; es erfolgt keine Entschädigung.<br />
Diese Maßnahmen wurden notwendig, da mit dem<br />
stetigen Ausbau der Stromerzeugung mittels Photovoltaik<br />
(allein bis Ende 2010 17.400 MW installierte Leistung) die<br />
Sicherstellung der Netzstabilität eine zentrale Herausforderung<br />
des weiteren Ausbaus geworden ist. Da 90 % der<br />
in Deutschland vorhandenen Photovoltaikanlagen eine<br />
Einspeiseleistung von weniger als 30 kW aufweisen, ist<br />
es notwendig, auch diese Anlagen zu regeln. Vereinfachtes<br />
Einspeisemanagement bedeutet dabei, dass die Anlagen<br />
nur mit einer technischen Einrichtung zur Abregelung<br />
ausgestattet sind, auf eine Lastgangmessung und Übertragung<br />
der Daten aber aus Kostengründen verzichtet<br />
wird.<br />
Biomasse<br />
Derzeit leistet die Stromerzeugung aus Biomasse neben der<br />
aus Windenergie den wichtigsten Beitrag zur Stromerzeugung<br />
aus erneuerbaren Energien. Die EEG-Novelle beschäftigt sich<br />
nun damit, die Vergütung und Förderung einfacher und übersichtlicher<br />
zu machen, da mit dem EEG 2009 teilweise eine<br />
intransparente Förderstruktur sowie Überförderungen und<br />
ökologische Fehlanreize einhergingen. Im Einzelnen:<br />
Das Vergütungsniveau sinkt um durchschnittlich 10 bis<br />
15 %, insbesondere bei Kleinanlagen.<br />
Die jährliche Degression steigt von 1 % auf 2 %, dies<br />
bezieht sich allerdings allein auf den einsatzstoffunabhängigen<br />
Vergütungsteil. Die Einsatzstoffvergütung unterliegt<br />
damit in Zukunft nicht mehr der Degression. Grund hierfür<br />
ist, dass die Rohstoffpreise für die Einsatzstoffe auf dem<br />
Weltmarkt bestimmt werden, eine Kostensenkung mithin<br />
nicht möglich ist.<br />
Der Einsatz von Mais und Getreidekorn wird auf 60 % der<br />
Masse begrenzt und die Altholzverbrennung bei Neuanlagen<br />
nicht länger gefördert, um einer Nutzungskonkurrenz<br />
vorzubeugen. Zudem erfolgt zukünftig bei Neuanlagen<br />
keine Förderung der Stromgewinnung aus flüssiger Biomasse<br />
mehr.<br />
Die Einsatzstoffvergütung erfolgt in Zukunft anteilig,<br />
sodass nun sämtliche Einsatzstoffklassen gemischt werden<br />
können.<br />
Zudem müssen Biogasanlagen zukünftig 60 % Wärmenutzung<br />
oder Gülleeinsatz nachweisen oder eine Direktvermarktung<br />
des Stroms vornehmen. Für kleine Hofanlagen<br />
wird eine Sonderkategorie eingeführt (Voraussetzung ist<br />
der Einsatz von mindestens 80 % Gülle). Die Vergütung<br />
von 25 ct/kWh dient insbesondere dem Klimaschutz, da<br />
so Methanemissionen der Gülle verringert werden sollen.<br />
Das stark vereinfachte Vergütungssystem kennt nunmehr<br />
nur noch vier (leistungsbezogene) Anlagenkategorien und<br />
zwei verschiedene Einsatzstoffklassen.<br />
Bioabfallvergärungsanlagen werden gesondert vergütet,<br />
da sie die Nutzung von Abfall- und Reststoffen möglich<br />
machen. Zudem wird die Biomethaneinspeisung in Zukunft<br />
ebenfalls zusätzlich vergütet.<br />
Geothermie<br />
Der Ausbau der Geothermie vollzieht sich bisher sehr schleppend.<br />
Grund hierfür ist insbesondere das hohe Risiko, das<br />
12 / 2011 923
Fachbericht<br />
Normen & Regelwerk<br />
sich einerseits aus der Frage ergibt, ob man überhaupt fündig<br />
wird, andererseits aus der Gefahr seismischer Aktivitäten<br />
(vgl. bspw. die Ereignisse in Basel oder Landau). Um den<br />
daraus resultierenden Finanzierungsproblemen zu begegnen,<br />
sieht die EEG-Novelle folgende Neuregelungen vor:<br />
Der Frühstarter- sowie der Wärmenutzungsbonus werden<br />
zukünftig in die Grundvergütung integriert. Diese steigt<br />
damit von 16 ct/kWh auf 23 ct/kWh. Zusätzlich wird die<br />
Vergütung um weitere 2 ct/kWh erhöht, da es bisher nur<br />
eine geringe Anzahl von Geothermieprojekten gibt.<br />
Der Degressionsbeginn wird von 2015 auf 2018 verschoben.<br />
Die Degression wird dafür im Gegenzug von jährlich<br />
1 % auf 5 % erhöht.<br />
Für petrothermale Projekte wird der Technologiebonus von<br />
4 ct/kWh auf 5 ct/kWh angehoben.<br />
Wasserkraft<br />
Die Wasserkraft bietet nur noch ein relativ geringes Ausbaupotential.<br />
Das EEG 2012 beschäftigt sich daher maßgeblich<br />
mit der Vereinfachung und Vereinheitlichung der Vergütungsstrukturen.<br />
Zudem knüpft die Vergütung in Zukunft an die im<br />
WHG formulierten ökologischen Anforderungen an:<br />
Die Degression beträgt zukünftig einheitlich 1 %.<br />
Der Vergütungszeitraum wird ebenfalls vereinheitlicht und<br />
beträgt demnach 20 Jahre.<br />
Bestehende Speicher bzw. -kraftwerke mit natürlichem<br />
Zufluss werden zukünftig in die Vergütung mit aufgenommen.<br />
Ausgleichsregelung<br />
Um deutsche Unternehmen durch den Ausbau der Stromgewinnung<br />
aus erneuerbaren Energien in ihrer Wettbewerbsfähigkeit<br />
nicht über alle Maßen zu beeinträchtigen, enthielt<br />
bereits das EEG 2009 eine Ausgleichsregelung. Durch die<br />
Novellierung des EEG erfährt die Ausgleichsregelung nunmehr<br />
eine deutliche Ausweitung, die die Regelung allerdings<br />
auf die Branchenklasse Bergbau und verarbeitendes Gewerbe<br />
beschränkt, um Missbrauch bspw. durch Ausgliederung<br />
stromintensiver Unternehmensteile zu begegnen. Durch die<br />
Absenkung der Eingangsschwelle von 10 GW/Jahr auf 1 GW/<br />
Jahr sowie die Verringerung des erforderlichen Stromkostenanteils<br />
an der Bruttowertschöpfung um einen Prozentpunkt<br />
auf 14 % werden in Zukunft erheblich mehr Unternehmen<br />
die Ausgleichsregelung in Anspruch nehmen können. Dieser<br />
„gleitende Einstieg“ kommt insbesondere mittelständischen<br />
Unternehmen zugute. Da somit zukünftig auch mittelständische<br />
energieintensive Unternehmen diese Regelung in Anspruch<br />
nehmen können, wird die EEG-Umlage für alle übrigen<br />
Stromkunden voraussichtlich um 0,05 bis 0,1 ct/kWh<br />
ansteigen.<br />
Eigenverbrauch<br />
Strom, der von einem Unternehmen erzeugt und selbst verbraucht<br />
wird, ist unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls<br />
von der EEG-Umlage befreit. Das EEG 2012 fordert hierfür<br />
zukünftig, dass der erzeugte Strom nicht über das öffentliche<br />
Netz geleitet wird, um einen Missbrauch der Regelung<br />
zu verhindern. Ausnahme: der Strom wird im räumlichen Zusammenhang<br />
mit der Stromerzeugungsanlage verbraucht,<br />
für Speicher erzeugt oder − im Rahmen einer Übergangsbestimmung<br />
− von Unternehmen erzeugt, die schon zuvor von<br />
der EEG-Umlage befreit waren.<br />
Kosten<br />
Wie die Änderung des EEG sich in finanzieller Hinsicht auswirken<br />
wird, hängt zum Großteil von den EEG-Differenzkosten<br />
ab, die sich als Differenz zwischen der an jeden Anlagenbetreiber<br />
zu zahlenden EEG-Vergütung und dem Erlös<br />
ergeben, der für den Strom an der Strombörse erzielt<br />
wurde. Über die EEG-Umlage werden sie gleichmäßig auf<br />
den dem EEG unterworfenen Stromverbrauch verteilt. Eine<br />
weitere Prognose der Kosten und damit der Entwicklung<br />
der EEG-Umlage gestaltet sich jedoch schwierig. Denn<br />
berücksichtigt man, dass die vermehrte Verfügbarkeit von<br />
Strom aus EEG-Anlagen am Strommarkt auch einen preissenkenden<br />
Effekt haben wird, so lässt sich nicht sagen, wie<br />
sich das neue EEG auf die Stromkosten privater Haushalte<br />
und von Unternehmen auswirken wird. Zudem sind die positiven<br />
Auswirkungen des Ausbaus der Stromgewinnung aus<br />
erneuerbaren Energien ebenfalls zu berücksichtigen, wozu<br />
insbesondere das deutlich verminderte Risiko von Umweltund<br />
Gesundheitsschäden zu zählen ist. Diese Vorteile lassen<br />
sich − bedingt durch ihre Natur − allerdings statistisch<br />
nur schwer erfassen.<br />
Fazit<br />
Das neue EEG nimmt keine Abkehr von den bisherigen Grundsätzen<br />
vor, es will weiterhin die Stromerzeugung aus erneuerbaren<br />
Energien fördern. Allerdings setzt das EEG 2012 dabei<br />
sein Hauptaugenmerk auf Maßnahmen, die der Netz- und<br />
Systemintegration der erneuerbaren Energien dienen, da die<br />
Netzstabilität aufgrund der Schwankungen in der Einspeiseleistung<br />
nunmehr von allergrößter Wichtigkeit ist. Gleichzeitig<br />
behält die Novelle dabei die Kosten, die durch die EEG-Umlage<br />
auf jeden Stromkunden umgewälzt werden, immer im<br />
Blick und nimmt Überförderungen zurück, intensiviert aber<br />
zugleich die Förderung von Technologien, deren Durchbruch<br />
mitunter noch bevorsteht.<br />
Autor<br />
Julian Menze<br />
Erdgas Münster GmbH, Münster<br />
E-Mail: julian.menze@erdgas.de<br />
924 12 / 2011
Interview<br />
Für Qualität beim<br />
Kunststoffrohrschweißen<br />
Interview mit Michael Dommer, Leiter Vertrieb und Teilhaber der WIDOS GmbH<br />
Sehr geehrter Herr Dommer, die Firma Widos<br />
feierte in diesem Jahr 65jähriges Firmenjubiläum<br />
und blickt somit auf eine lange Tradition zurück. Wie<br />
begann ihre Erfolgsgeschichte?<br />
Nach dem zweiten Weltkrieg begann Wilhelm Dommer mit<br />
einem LKW und führte Fahrdienstleistungen aus, es war der<br />
erste LKW in der Region. Mit dem Umzug in eine Autoreparturwerkstatt<br />
und Tankstelle in Stuttgart gründete er einen<br />
metallverarbeitenden Betrieb. Schon früh begann man mit<br />
dem Bau von Maschinen für die Sanitärbranche. Die Söhne<br />
Armin und Dieter Dommer konstruierten die erste Stumpfschweißmaschine<br />
für PE-Rohre. Seitdem wuchs das Unternehmen<br />
stetig und das Programm der Stumpfschweißmaschinen<br />
für Baustelle und Werkstatt wurde mit Rohrsägen,<br />
Sondermaschinen und vielem mehr erweitert.<br />
Heute befindet sich das Unternehmen in der dritten Generation<br />
und ist zu einer internationalen Unternehmensgruppe gewachsen.<br />
Das zeigt sich vor allem in der Konstanz bei den langjährigen<br />
weltweiten Partnerschaften, die mitunter seit der Gründerzeit<br />
Bestand haben. Wir sind stolz darauf, in Deutschland<br />
zu produzieren, und die Werte eines Traditionsunternehmens<br />
aus Baden-Württemberg werden auch heute mit Erfolg gelebt.<br />
Welche Meilensteine liegen auf dem zurückgelegten<br />
Weg und welche Maschinen-High-lights<br />
würden Sie besonders hervorheben?<br />
Die erste Stumpfschweißmaschine mit der Modellbezeichnung<br />
FLIZ 955 wurde 1967 gebaut und mit den Modellen<br />
WIDOS 4000, 4500, 5000, 6000 wurden die ersten Maschinen<br />
für den Baustellenbetrieb 1970 konzipiert.<br />
Mit der ersten CNC-Steuerung für Werkstattmaschinen im<br />
Jahre 1980 konnte erstmalig der Schweißprozess automatisiert<br />
werden. 1987 begannen wir mit der WIDOS 4600<br />
CNC auch Baustellenmaschinen zu automatisieren. Dabei<br />
12 / 2011 925
Ihre Maschinen finden Anwendung in den verschiedensten<br />
Marktsegmenten wie z. B. Wasser- und Gasversorgung,<br />
Abwasserentsorgung oder Anlagenbau.<br />
Welche Gemeinsamkeiten findet man dort?<br />
Michael Dommer,<br />
Leiter Vertrieb<br />
und Teilhaber der<br />
WIDOS GmbH<br />
wurden die Schweißparameter ebenfalls schon automatisch<br />
protokolliert.<br />
Im Jahr 1991 gründeten wir eine Niederlassung in Chemnitz,<br />
um den osteuropäischen und russischen Markt besser bedienen<br />
zu können. Seit 2008 wird das Werk in verschiedenen<br />
Abschnitten ausgebaut.<br />
Da Kunststoffrohre in immer größeren Rohrdimensionen zum<br />
Einsatz kommen, war es notwendig auch in der Schweißgerätetechnik<br />
entsprechend nachzuziehen. Daher haben wir in 2010<br />
die WIDOS 24000 für Baustellenschweißungen und später<br />
die WIDOS 24000 WM zur Bauteilproduktion gebaut, die PE-<br />
Großrohre bis d 2,4 m stumpfschweißen können. Was andere<br />
als „Größe XL“ bezeichnen, ist für uns höchstens „Größe M“.<br />
Alle bedeutenden Maschinenelemente, wie Maschinengestelle,<br />
Hydrauliksysteme, Heizelemente und Planhobel sind Eigenentwicklung.<br />
Zu den Produkt-High-lights zählen weiterhin, dass bei den Baustellen-Stumpfschweißmaschinen<br />
der 4. Ring abnehmbar ist<br />
und dadurch auch kürzeste Rohrenden geschweißt werden können.<br />
Eine Führung in der Rohrachsenmitte bringt dabei zusätzliche<br />
Stabilität des Rahmens – auch eine Widos-Erfindung.<br />
Die Hydraulik der Anlagen ist langlebig und energiesparend,<br />
da wir keine Dauerlaufpumpe einsetzen. Spezialdichtungen<br />
ermöglichen zudem extrem leichtgängigen Lauf.<br />
Die Heizelemente besitzen eine Temperaturverteilung, genauer<br />
als von DVS 2208 Teil 1 gefordert. Sie sind mehrfach<br />
antihaft-beschichtet und besonders langlebig. Für die Herstellung<br />
von reduzierten T-Stücken stehen gummiartige, flexible<br />
Heizelemente zur Verfügung.<br />
Die Spannschalen sind mit sehr geringen Toleranzen gefertigt<br />
und erleichtern den Versatzausgleich beim Schweißen.<br />
Mit ca. 70 % hat Ihr Unternehmen eine hohe<br />
Exportquote. Wie stellt sich die Wettbewerbssituation<br />
dar und speziell das Thema Produktpiraterie?<br />
Wir sind in der Branche bekannt als Hersteller von Maschinen<br />
höchster Qualität. Diese ist für Hersteller, die unsere Maschinen<br />
nachbauen, unerreicht.<br />
Zu unserem Schutz haben wir erst kürzlich verschiedene Markennamen<br />
eingeführt. Diese heißen WI-FORCE, WI-HEAT,<br />
WI-PRECISION, WI-CUT, WI-ENERGY und WI-FIX.<br />
Hersteller, die unter dem Motto „billiger und noch billiger“ Chinaware<br />
als europäische Produktion verkaufen, stellen eher ein<br />
Problem für die gesamte Kunststoffrohrbranche dar, da am<br />
Ende das Gesamtsystem unter Kritik geraten kann.<br />
Die Gemeinsamkeiten für unsere Maschinen sind Langlebigkeit,<br />
Sicherheit und einfache Bedienbarkeit. Im weiteren Sinne<br />
zählen aber auch weltweiter Service und schnelle Ersatzteilverfügbarkeit<br />
dazu.<br />
Wir erfüllen nicht nur die einschlägigen Standards bzw. Normen<br />
für Maschinen, sondern setzen auch neue Maßstäbe.<br />
Beispielsweise sind wir an der Erstellung der DVS-Richtlinie<br />
2208-1 beteiligt und arbeiten in nationalen und internationalen<br />
Normungsgremien intensiv mit.<br />
Ein entscheidendes Thema beim<br />
Kunststoffschweißen ist die Qualitätssicherung.<br />
Welchen Anteil hat heute die Maschinentechnik bei der<br />
Sicherstellung der Qualität und wo kann der Faktor<br />
Mensch noch Einfluss nehmen?<br />
Im Laufe der Jahrzehnte wurden unsere Maschinen auch verändert,<br />
um den neuen Anforderungen, wie z. B. neue Materialien,<br />
Dimensionen oder Verlegetechniken, gerecht zu werden.<br />
Mit der Einführung der automatischen Schweißprotokollierung<br />
„plus“ automatischer Schweißprozesssteuerung wurden<br />
die Fehlermöglichkeiten auf ein Minimum reduziert. Der<br />
Einflussfaktor „menschlicher Fehler“ ist heute als eher gering<br />
zu bewerten, aber dennoch ist das Gesamtsystem „Mensch,<br />
Maschine und Material“ nur so gut wie jeder der Einzelfaktoren.<br />
Zur richtigen Qualitätssicherung zählt daher nach wie<br />
vor die Schweißerausbildung.<br />
Bei der Entwicklung neuer Maschinen arbeiten Sie<br />
eng mit Ihren Kunden und dem SKZ zusammen. Welche<br />
neuen Produkte sind zurzeit in der Entwicklung?<br />
Derzeit werden, zum Teil in Forschungsprojekten des SKZ, zukünftige<br />
Innovationen entwickelt. Dazu können wir natürlich<br />
nicht vorgreifen. Als wichtige Themenbereiche für uns wären<br />
zu nennen „Energieeffizienz“ und „Optimierung des Handling“.<br />
Welche Entwicklungen und Herausforderungen<br />
sehen Sie in den nächsten Jahren auf den nationalen<br />
und den internationalen Rohrmarkt zukommen?<br />
Der Mengen- und Marktanteil für Kunststoffrohre wird nach<br />
unserer Meinung weiter wachsen. Eine Herausforderung dabei<br />
ist es, die Anwender über die Vorteile von Kunststoffrohrsystemen<br />
zu informieren. Manche Branchen, wie z.B. die Wasserversorgung,<br />
weltweit betrachtet, reagieren aus unserer Sicht<br />
oft sehr träge auf Neuentwicklungen. Dies liegt manchmal<br />
auch an der Politik, wie z.B. im Falle des maroden Abwassernetzes<br />
und den Landesregierungen in Deutschland.<br />
Den Systemgedanken dürfen alle in unserer Branche nicht aus<br />
den Augen verlieren, damit Kunststoffrohre weltweit mehr<br />
Anwendung finden.<br />
Sehr geehrter Herr Dommer, wir danken Ihnen für<br />
das Gespräch.<br />
926 12 / 2011
Meister findet<br />
Kommune<br />
findet Meister.<br />
Einzelleistung oder Gesamtprojekt? Montieren oder Bauen?<br />
Öffentliche Ausschreibungen bieten viele spannende Auftragschancen. Aber sie sind kein Spielfeld<br />
für Zufallsbegegnungen. Immer gilt: die Partner müssen zusammenpassen. Vergabe24 ist<br />
die zentrale Plattform, auf der alle gut zueinander finden.<br />
Klingt einfach. Ist wegweisend.<br />
www.Vergabe24.de
Faszination Technik
<strong>Gipfelstürmer</strong><br />
FotoQuelle: Rinninger
Europas höchstgelegene<br />
Kanalbaustelle<br />
Es ist eine Baumaßnahme vor einer außergewöhnlichen Kulisse: Im Auftrag der<br />
Vorarlberger Illwerke AG werden von 2009 bis 2012 Erhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen<br />
an der Staumauer des Silvrettasees durchgeführt.<br />
Der 1,31 km² große Stausee liegt in den österreichischen Alpen im Bundesland<br />
Vorarlberg auf einer Seehöhe von 2.030 m ü. A. in einer Senke der Silvretta-Gruppe.<br />
Während der Bauphase wird das Wasser des Stausees abgelassen und die Ill, die<br />
dem nahegelegenen Ochsentalgletscher entspringt und im Silvrettasee aufgestaut<br />
wird, über eine ca. 200 m lange Leitung aus Stahlbetonrohren um das Baufeld<br />
herum geleitet. Hierbei handelt es sich um FBS-Stahlbetongroßrohre DN 1600<br />
nach DIN EN 1916 - DIN V 1201 mit Falzmuffe und Keilgleitdichtung am Spitzende.<br />
Sie wurden von der Hans Rinninger u. Sohn GmbH & Co. im Betonwarenwerk in<br />
Kißlegg im Allgäu produziert und bereits im Dezember 2010 zur Einbaustelle<br />
transportiert.<br />
Zu den umfangreichen Baumaßnahmen zählen unter anderem die Erneuerung der<br />
Staumauerkrone und die Montage einer Dichtfolie an der Wasserseite der<br />
Staumauer. Zusätzlich werden die Abdichtung im Gründungsbereich sowie die<br />
stählernen wasserbaulichen Absperrorgane und Einlaufrechen der Triebwasserführung<br />
und der Grundablässe erneuert. Darüber hinaus werden Erhaltungsmaßnahmen<br />
an der Luftseite der Staumauer durchgeführt und ein neues Einlaufbauwerk<br />
für die zukünftige Triebwasserführung errichtet. Durch diese nach dem<br />
neuesten Stand der Technik projektierten Maßnahmen wird nach Aussage des<br />
Auftraggebers sichergestellt, dass die Staumauer Silvrettasee ihre Funktionstüchtigkeit<br />
in den kommenden Jahrzehnten wie bisher erfüllt.<br />
Faszination Technik<br />
Für Sie in jeder <strong>3R</strong>-Ausgabe eine spannende<br />
Bilddokumentation über Rohrsysteme und ihr Umfeld –<br />
die Lebensadern moderner Gesellschaften<br />
Kontakt zur Redaktion:<br />
Barbara Pflamm, Tel. 0201 82002-28, E-Mail: b.pflamm@vulkan-verlag.de
Wissen für die praxis<br />
RSV-Regelwerk<br />
RSV Merkblatt 1<br />
Renovierung von Entwässerungskanälen und -leitungen mit vor Ort härtendem Schlauchlining<br />
2006, 31 Seiten, DIN A4, broschiert, € 35,-<br />
RSV Merkblatt 2<br />
Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit Rohren aus<br />
thermoplastischen Kunststoffen durch Liningverfahren ohne Ringraum<br />
2009, 38 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 2.2<br />
Renovierung mit dem TIP-Verfahren ohne Ringraum (in Bearbeitung)<br />
RSV Merkblatt 3<br />
Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen durch Liningverfahren mit Ringraum<br />
2008, 40 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 4<br />
Reparatur von drucklosen Abwässerkanälen und Rohrleitungen durch vor Ort härtende Kurzliner<br />
(partielle Inliner)<br />
2009, 25 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 5<br />
Reparatur von Entwässerungsleitungen und Kanälen durch Roboterverfahren<br />
2007, 22 Seiten, DIN A4, broschiert, € 27,-<br />
RSV Merkblatt 6<br />
Sanierung von begehbaren Entwässerungsleitungen und -kanälen sowie Schachtbauwerken<br />
2007, 23 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 6.2<br />
Schachtsanierung (in Bearbeitung)<br />
RSV Merkblatt 7.1<br />
Renovierung von drucklosen Leitungen / Anschlußleitungen mit vor Ort härtendem Schlauchlining<br />
2009, 24 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 7.2<br />
Hutprofiltechnik zur Einbindung von Anschlußleitungen – Reparatur / Renovierung<br />
2009, 31 Seiten, DIN A4, broschiert, € 30,-<br />
RSV Merkblatt 8<br />
Erneuerung von Entwässerungskanälen und Anschlussleitungen mit dem Berstliningverfahren<br />
2006, 27 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 10<br />
Kunststoffrohre für grabenlose Bauweisen<br />
2008, 55 Seiten, DIN A4, broschiert, € 37,-<br />
Vulkan-Verlag<br />
www.vulkan-verlag.de<br />
Faxbestellschein an: 0201/82002-34<br />
Ja, ich / wir bestelle(n) gegen Rechnung:<br />
___ Ex. RSV-M 1 € 35,-<br />
___ Ex. RSV-M 2 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 2.2 in Bearbeitung<br />
___ Ex. RSV-M 3 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 4 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 5 € 27,-<br />
Antwort<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
___ Ex. RSV-M 6 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 6.2 in Bearbeitung<br />
___ Ex. RSV-M 7.1 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 7.2 € 30,-<br />
___ Ex. RSV-M 8 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 10 € 37,-<br />
zzgl. Versandkosten<br />
Firma/Institution<br />
Vorname/Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
E-Mail<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise □ Bankabbuchung □ Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Garantie: Dieser Auftrag kann innerhalb von 14 Tagen bei der Vulkan-Verlag GmbH, Postfach 10 39 62, 45039 Essen schriftlich widerrufen<br />
werden. Die rechtzeitige Absendung der Mitteilung genügt. Für die Auftragsabwicklung und die Pflege der Kommunikation werden Ihre<br />
persönlichen Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich per Post, Telefon, Telefax<br />
oder E-Mail über interessante Verlagsangebote informiert werde. Diese Erklärung kann ich jederzeit widerrufen.<br />
Bankleitzahl<br />
✘<br />
Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer
Produkte & Verfahren<br />
Ultraschall-Prüfverfahren zeigt Fehlstellen in 3D<br />
Bei der Ultraschallprüfung von Rohrleitungen<br />
und Schweißnähten kommt zunehmend<br />
das Digital Focus Array-Verfahren<br />
zum Einsatz. Wesentlicher Vorteil ist die<br />
zwei- und dreidimensionale Fehlerbildrekonstruktion<br />
in Echtzeit – auch unter hohen<br />
Prüfgeschwindigkeiten.<br />
Die zerstörungsfreie Prüfung mittels<br />
Ultraschall ist ein etabliertes Verfahren<br />
bei der Qualitätssicherung. Werkstücke<br />
mit einer ausgeprägten Materialstruktur<br />
sind einer Ultraschallprüfung allerdings<br />
nur schwer zugänglich, da die Strukturen<br />
die Richtungsabhängigkeit der akustischen<br />
Eigenschaften beeinflussen können. Doch<br />
genau dafür bietet das Mehrkanalkonzept<br />
eine Lösung.<br />
Diese neuartige Gruppenstrahlertechnik<br />
basiert auf der Beschallung des zu prüfenden<br />
Volumens mit divergenten Kugelwellen,<br />
die durch Elemente eines Prüfkopf-Arrays<br />
angeregt und empfangen werden. Aus den<br />
empfangenen Signalen wird ein Schnittbild<br />
des Bauteils berechnet und visualisiert. Dies<br />
geschieht, indem in einzelne Bildelemente<br />
(Pixel) mit Amplitudenwerten von einzelnen<br />
Ultraschallsignalen der Array-Elemente<br />
unter Berücksichtigung der Ultraschall-<br />
Laufzeit überlagert werden (SAFT-Prinzip).<br />
Damit ist eine tomographische zwei- und<br />
dreidimensionale Bildgebung auch bei hoher<br />
Prüfgeschwindigkeit möglich.<br />
Innerhalb eines Prüfzyklus lassen sich<br />
an einem Bauteil damit auch zwei übereinander<br />
liegende Fehler in verschiedenen<br />
Tiefen unterscheiden. Mit bisher üblichen<br />
Einschwingerprüfköpfen wurden überlagerte<br />
Fehler meist nur als Einzelfehler registriert,<br />
was die Ausgangsbedingung für<br />
nachträgliche Reparaturen erschwert. Die<br />
hohe Genauigkeit birgt allerdings auch die<br />
Gefahr einer Überbewertung von Befunden.<br />
„Die Herausforderung liegt darin, auf<br />
Grundlage vorliegender Anzeigen die bauteilkritischen<br />
Fehler herauszufiltern und zu<br />
entscheiden, wenn evt. ein unkritischer<br />
Fehler belassen werden kann“, sagt Hans<br />
Christian Schröder, Leiter Kraftwerksund<br />
Anlagenservice bei TÜV SÜD Industrie<br />
Service. Die Grundlage für das der<br />
Saarbrücker I-Deal Technologies GmbH<br />
entwicklelte Digital Focus Array-Verfahren<br />
bildet das Sampling Phased Array-Verfahren<br />
des Fraunhofer-IZFP.<br />
Kontakt: www.tuev-sued.de/is,<br />
www.i-deal-technologies.com, www.izfp.<br />
fraunhofer.de<br />
Tauchmotorpumpen halten Tunnelbaustelle trocken<br />
Mit einer Gesamtlänge von 32,5 km verbindet<br />
der so genannte Koralm-Eisenbahntunnel<br />
zukünftig die österreichischen<br />
Städte Graz und Klagenfurt. Die Bauarbeiten<br />
begannen im Januar dieses Jahres<br />
und werden Ende dieses Jahrzehnts abgeschlossen<br />
sein. Die Essener Söndgerath<br />
Pumpen GmbH lieferte bislang über<br />
20 Tauchmotorpumpen der Baureihe SPX<br />
322. Sie pumpen das mit 50 Litern pro Sekunde<br />
anfallende Bergwasser im Dauerbetrieb<br />
aus der unterirdischen Baustelle.<br />
Der Eisenbahntunnel ist in drei Lose<br />
unterteilt, bezeichnet als Kat eins bis drei,<br />
und wird als zweiröhriges, jeweils eingleisiges<br />
Tunnelsystem ausgeführt. Kat eins<br />
entsteht im herkömmlichen Verfahren als<br />
Sprengvortrieb von außen nach innen auf<br />
einer Länge von 3,5 km. Das zweite Los ist<br />
mit Abstand das größte, das parallel sowohl<br />
nach Norden Richtung Graz als auch<br />
nach Süden Richtung Klagenfurt entsteht.<br />
Dazu bohrten die Ingenieure des Konsortialführers<br />
Strabag einen senkrechten Bauschacht<br />
bis auf 60 m Tiefe nahe Deutschlandsberg<br />
in der Steiermark. Aufgrund der<br />
Gesteinsformation ließen sich die ersten<br />
1.700 m nur im Sprengvortrieb erstellen.<br />
Dort entstanden große Kavernen zur<br />
Montage der beiden Schildtunnelbohrmaschinen,<br />
die in Einzelteilen durch den vertikalen<br />
Schacht vor Ort gebracht wurden.<br />
Sie bohren die zwei Röhren mit einem<br />
Durchmesser von je 9,9 m Durchmesser.<br />
Das bei den Arbeiten aus dem Gestein<br />
austretende Bergwasser fließt in Gräben, in<br />
denen es in regelmäßigen Abständen aufgestellte<br />
Pumpen zu einem 4 m tiefen Pumpenschacht<br />
fördern. Von dort pumpen es<br />
leistungsfähige Tauchmotorpumpen über<br />
60 m den Bauschacht hoch und zur Reinigung<br />
in ein Absetzbecken. Derzeit fallen<br />
täglich 4.320 m 3 Schlammwasser an. Mit<br />
fortschreitendem Baufortschritt können<br />
noch mit größere Wassermengen anfallen.<br />
Mit den Tauchmotorpumpen der SPX-<br />
Serie des Essener lassen sich sand- und<br />
kieshaltiges Schmutzwasser fördern, darüber<br />
hinaus aber auch Schlamm, Schlick,<br />
Bohremulsionen, Bentontit und ähnliche<br />
problematische Gemische. Dazu sind die<br />
Pumpen der R-Serie mit einem auf die Welle<br />
montierten Rührwerk versehen, das die<br />
Fließfähigkeit des Mediums entscheidend<br />
verbessert. Bei allen Pumpen dieser Serie<br />
sind das Gehäuse sowie die Bodenplatte aus<br />
massivem Gusseisen gefertigt. Das Laufrad<br />
und – soweit vorhanden – der Rührkopf<br />
bestehen aus Chromstahl. Die Edelstahlwelle<br />
verfügt über wartungsfreie, gekapselte<br />
Kugellager und doppelte mechanische<br />
Gleitringdichtungen. Alle zwei- bzw.<br />
vierpoligen (SPX-R) Motoren sind absolut<br />
trockenlaufsicher. Ihre Leistung ist wählbar<br />
von 1,5 bis 22 kW, wobei alle Pumpen einen<br />
Kraftstromanschluss benötigen. Tauchmotorpumpen<br />
dieser Bauart eigenen sich hervorragend<br />
für den harten Einsatz im Bergbau,<br />
auch im Dauerbetrieb.<br />
Kontakt: Söndgerath Pumpen GmbH,<br />
Essen, Tel. +49 201 766 906, E-Mail:<br />
sptpumpen@aol.com<br />
932 12 / 2011
Studie der RWTH Aachen<br />
Hochtemperaturleiter für schnellen<br />
und günstigen Netzausbau geeignet<br />
Der Ausbau des Stromnetzes ist unproblematischer<br />
als bislang angenommen. Denn<br />
Stromtrassen können durch die Ertüchtigung<br />
mit modernen Hochtemperaturleiterseilen<br />
die doppelte Strommenge aufnehmen. Und<br />
wie eine neue Studie der Rheinisch-Westfälischen<br />
Technischen Hochschule Aachen<br />
(RWTH) belegt, kann die Netzertüchtigung<br />
wirtschaftlicher als ein Netzaus- oder -neubau<br />
mit herkömmlichen Stromseilen sein, da<br />
beim Tausch der Leiterseile die vorhandenen<br />
Strommasten weiter verwendet werden.<br />
Langwierige Planfeststellungsverfahren<br />
könnten entfallen. Die RWTH berechnete<br />
im Auftrag der 3M Deutschland GmbH aus<br />
Neuss mehrere Szenarien für das Hochtemperaturleiterseil<br />
ACCR (Aluminum Conductor<br />
Composite Reinforced), ein Seil aus einer<br />
speziellen Aluminium-Keramik-Verbindung<br />
(www.3m.com/accr).<br />
Deutliche wirtschaftliche<br />
Vorteile<br />
Bei einem Szenario der Studie mit beispielsweise<br />
200 km Länge käme die Ertüchtigung<br />
der bestehenden Leitung mit dem ACCR-Seil<br />
von 3M (219 Mio. Euro) um 19 % günstiger<br />
als ein Ersatz der Strecke mit neuen Masten<br />
und herkömmlichen Seilen (269 Mio. Euro).<br />
Bei einem anderen Szenario mit 50 km wären<br />
es zwölf bzw. 28 %, je nach Ersatzvariante<br />
(42 zu 48 bzw. zu 58 Mio. Euro). In der<br />
Studie unberücksichtigt blieb die Tatsache,<br />
dass eine Ertüchtigung mit ACCR im Gegensatz<br />
zu den anderen Varianten üblicherweise<br />
kein Planfeststellungsverfahren benötigt,<br />
was zu kürzeren Realisierungszeiten führt<br />
und einen enormen gesellschaftlich-volkswirtschaftlichen<br />
Vorteil birgt.<br />
War die Netzstudie der Deutschen Energie-Agentur<br />
(Dena) 2010 bei ihren Berechnungen<br />
mit älteren Hochtemperaturleitern<br />
noch zu wesentlich höheren Kosten gekommen<br />
(+70 %!), liefert die RWTH-Studie nun<br />
eine Ergänzung, die den mittlerweile aktuellen<br />
Stand der Technik berücksichtigt. Dr.<br />
Ralf Puffer, von der Leitung des RWTH-Instituts<br />
für Hochspannungstechnik: „Moderne<br />
Hochtemperaturleiter mit geringem Durchhang<br />
können bei der Ertüchtigung vorhandener<br />
Leitungen eine wirtschaftlich günstige<br />
Alternative zum Neubau einer Leitung sein.<br />
Hochtemperaturleiter wie der ACCR-Leiter<br />
von 3M haben im Gegensatz zu älterer Technik<br />
den Vorteil, dass sie einerseits sehr hohe<br />
Ströme führen können, und andererseits in<br />
der Regel gegen einen vorhandenen Leiter<br />
auf bestehende Masten ausgetauscht werden<br />
können. Das senkt Kosten und spart Zeit,<br />
denn die hier notwendigen Genehmigungsverfahren<br />
sind vergleichsweise kurz. Die genaue<br />
Identifikation der vorhandenen Leitungen,<br />
die für einen Einsatz von Hochtemperaturleitern<br />
in Frage kommen, erfordert umfangreiche<br />
weitere Untersuchungen.“<br />
Das ACCR-Seil könnte sich im Extremfall<br />
– etwa bei plötzlich sehr hoher Einspeisung<br />
von Windstrom – noch bis über<br />
210 °C erhitzen, ohne sich zu verformen<br />
oder durchzuhängen. Herkömmliche Stahl-<br />
Alu-Seile sind dagegen nur bis 80 °C einsetzbar.<br />
Juergen Germann, Leiter der deutschen<br />
3M Elektro-Sparte: „Das ACCR-Seil<br />
ist seit vielen Jahren weltweit im Einsatz.<br />
Auch die deutschen Netzbetreiber verwenden<br />
ACCR und andere moderne Hochtemperaturleiter<br />
in Pilot-Projekten auf allen<br />
Spannungsebenen. Für den Netzausbau<br />
und die Energiewende ist es daher unverzichtbar,<br />
den neuesten Stand der Technik<br />
zu berücksichtigen. Dies war bei der Erstellung<br />
der Dena-II-Studie von 2006 bis 2010<br />
noch nicht möglich.“<br />
Kontakt: 3M, Juergen Germann,<br />
Tel. +49 2131 14 27 36,<br />
E-Mail: jgermann1@mmm.com,<br />
www.3m.de<br />
Sauberes Trinkwasser dank normgerechtem<br />
Systemtrenner<br />
Die Systemtrenner BA BM und BA BS von<br />
Watts Industries werden verwendet, um<br />
die öffentlichen Wasserversorgungsnetze<br />
vor Verunreinigungen durch rückfließende<br />
Flüssigkeiten zu schützen. Watts bietet<br />
mit den verschiedenen Ausführungen<br />
eine vollständige Serie an, die den europäischen<br />
Normen zum Schutz des Trinkwassers<br />
entspricht (EN 1717 und EN 12729).<br />
Der BA BM ist in den Nennweiten DN 15<br />
bis DN 50 erhältlich. Er ist wesentlich kompakter<br />
und kleiner als sein Vorgängermodell<br />
und dank der Verwendung<br />
eines Hochleistungskunststoffs<br />
wesentlich leichter. Sein modularer Aufbau<br />
vereinfacht die Handhabung für den Installateur<br />
bei der Montage und Wartung.<br />
Der Systemtrenner BA BS wurde speziell<br />
für Anwendungen mit geringen Volumenströmen<br />
konstruiert. Es gibt ihn in den Rohrweiten<br />
DN 6, DN 8 und DN 10. Seine membranlose<br />
Konstruktion stellt sicher, dass nur<br />
ein geringer Teil der Kunststoffoberfläche<br />
mit dem Trinkwasser in Berührung kommt.<br />
Auf diese Weise<br />
können sich keine Sedimente<br />
oder andere Verunreinigungen<br />
ablagern. Der<br />
Hersteller verwendet entzinkungsresistentes<br />
Messing<br />
(DZR) und ein kolbengesteuertes<br />
Entlastungsventil, das eine<br />
lange Lebensdauer garantiert.<br />
Kontakt: Watts Industries Deutschland<br />
GmbH, Landau, Tel. +49 6341 9656-0,<br />
E-Mail: info@wattsindustries.de<br />
12 / 2011 933
Produkte & Verfahren<br />
Automatische Überwachung für<br />
Leichtflüssigkeitsabscheider<br />
Gemäß DIN EN 858 müssen Leichtflüssigkeitsabscheider<br />
mit selbsttätigen Warneinrichtungen,<br />
die eine Zulassung für den<br />
Betrieb im explosionsgefährdeten Bereich<br />
Zone 0 haben, ausgerüstet sein. Die DIN<br />
schreibt vor, dass Abscheider bei Erreichen<br />
der maximalen Leichtflüssigkeits-Speichermenge<br />
außer Betrieb gesetzt werden.<br />
Um bereits vor diesem Zeitpunkt einen<br />
Hinweis über den Stand der Leichtflüssigkeit<br />
zu erhalten, müssen Warnanlangen<br />
eingesetzt werden, die bei rund 80 % der<br />
maximalen Speichermenge ein optisches<br />
und akustisches Signal erzeugen. So bleibt<br />
genügend Zeit, um die Leichtflüssigkeit zu<br />
entsorgen und der Betrieb des Abscheiders<br />
kann ungestört fortgesetzt werden.<br />
Der Entwässerungsspezialist Kessel<br />
hat ein automatisches Messgerät<br />
für Leichtflüssigkeitsabscheider entwickelt.<br />
SonicControl bietet drei Warneinrichtungen<br />
in einem Gerät. Es alarmiert<br />
nicht nur bei einem Aufstau,<br />
das heißt sobald der<br />
höchstzulässige Leichtflüssigkeitsstand<br />
im Abscheider<br />
erreicht ist, sondern<br />
überwacht auch Ölund<br />
Schlammschicht zentimetergenau.<br />
Die Werte<br />
können bequem am<br />
Schaltgerät ausgelesen<br />
werden; aufwändige<br />
Sichtkontrollen entfallen.<br />
Da das Messgerät ununterbrochen<br />
den exakten<br />
Stand von Öl- und Schlammschicht liefert,<br />
ist eine frühzeitige Planung der Entsorgung<br />
damit gewährleistet. Auch die<br />
nachträgliche Installation in alle Kessel-<br />
Leichtflüssigkeitsabscheider ist möglich.<br />
Zum Auslesen der im elektronischen<br />
Betriebstagebuch gespeicherten Daten<br />
befindet sich am Schaltgerät ein USB-<br />
Anschluss. Mit der Software „Sonic Control<br />
Viewer“ kann der Betreiber die Daten<br />
archivieren und die zunehmende Öl- und<br />
Schlammschicht in Form von Tabellen und<br />
Diagrammen visualisieren.<br />
Kontakt: KESSEL AG, Joachim Ziob,<br />
Lenting, Tel. +49 8456 27-35,<br />
www.kessel.de<br />
Überwachungssysteme für Nah- und<br />
Fernwärmenetze<br />
Beim Bau eines Systems zur Wärmeversorgung<br />
macht das Rohrleitungsnetz den teuersten<br />
Anteil aus. Seine tatsächliche Nutzungsdauer<br />
ist damit einer der Schlüssel<br />
zum wirtschaftlichen Erfolg der gesamten<br />
Investition. Wird ein Überwachungssystem<br />
für das Rohrnetz eingesetzt, verlängert<br />
sich die Lebensdauer. Störungen werden<br />
frühzeitig erkannt und können schnell beseitigt<br />
werden.<br />
Zur Verteilung der Wärme werden<br />
meist Kunststoffmantelrohre (KMR)<br />
verlegt. Das sind starre Rohre, mit einem<br />
Mediumrohr aus Stahl, einer Polyurethan-Wärmedämmung<br />
und einem Außenmantel<br />
aus Polyethylen. Häufig werden<br />
auch flexible Rohrleitungen mit Mediumrohren<br />
aus Edelstahl oder Kunststoff<br />
eingesetzt. All diese Rohrtypen haben im<br />
Laufe der wohl heute 40-jährigen Entwicklung<br />
einen sehr hohen fertigungstechnischen<br />
Standard erreicht. Auch<br />
die zur Verfügung stehenden Materialien<br />
zur Nachisolierung der Verbindungsstellen<br />
sind mittlerweile von zuverlässiger<br />
Qualität.<br />
Gefahr droht jedoch bei der<br />
Verarbeitung<br />
Widrige äußere Einflüsse bei der Rohrverlegung,<br />
wie z.B. schlechtes Wetter oder<br />
enge Gräben, erschweren das ordnungsgemäße<br />
Verlegen. Unsachgemäße Verarbeitung<br />
auf der Baustelle ist wohl die häufigste<br />
Ursache für teure Reparaturen. Undichte<br />
Schweißnähte an Stahlrohren, nicht<br />
fachgerecht ausgeführte Pressverbindungen<br />
oder Verschraubungen an PEX-Rohren,<br />
undichte Mantelrohrmuffen – all diese<br />
Fehler lassen bei und nach der Verlegung<br />
Feuchte in den Isolierschaum eindringen.<br />
Auch können die erdverlegten Rohre<br />
nachträglich beschädigt werden, z.B. durch<br />
Tiefbauarbeiten.<br />
Gefährdung auch im<br />
Anlagenbetrieb<br />
Unabhängig von der Rohrkonstruktion<br />
sind die Anforderungen an die Rohrtechnik<br />
sehr hoch. Im Betrieb treten starke Temperaturwechsel<br />
auf, die mit großen mechanischen<br />
Spannungen verbunden sind.<br />
Stahlrohre sind naturgemäß robuster als<br />
PEX-Rohre, vertragen problemlos sowohl<br />
höhere Temperatur als auch einen höheren<br />
Betriebsdruck. Sie bieten dadurch wesentlich<br />
bessere Reserven im Betrieb und<br />
auch im späteren Netzausbau. PEX-Rohre<br />
stoßen im Vergleich dazu viel schneller<br />
an ihre Grenzen. Die Einschränkung und<br />
das Risko durch Betriebsdruck und Temperatur<br />
sollte daher bei der Wahl beachtet<br />
werden. Fehler in der Betriebsweise<br />
934 12 / 2011
BILD 1: Leckage mit gerissenem Mantelrohr<br />
BILD 2: Schaden am Stahlrohr<br />
können hier ebenfalls zerstörende Wirkung<br />
zeigen.<br />
Unsachgemäße Verlegung, nachträgliche<br />
Beschädigung oder Fehler in der Betriebsweise<br />
sind demnach Gefahren für<br />
den Zustand des Nah- oder Fernwärmenetzes.<br />
So robust ein vorisoliertes Rohr<br />
auch ist, so empfindlich reagiert es auf<br />
Feuchtigkeit in der Dämmung. Neben erhöhtem<br />
Wärmeverlust führt Feuchtigkeit<br />
bei Heizwasser-Temperaturen von bis<br />
zu 130 °C zu einer Zerstörung der Dämmung.<br />
Korrosion schädigt darüber hinaus<br />
das metallische Mediumrohr und die Verbindungselemente.<br />
Unerkannt ist dies ein sich selbst verstärkender<br />
und fortschreitender Prozess.<br />
Das Rohr wird oft auf große Strecken irreparabel<br />
geschädigt. Die Lebensdauer sinkt<br />
unter die geplante Rentabilitätsgrenze. Im<br />
schlimmsten Fall müssen lange Rohrleitungsabschnitte<br />
komplett ausgetauscht<br />
werden.<br />
BILD 3: Aufbau<br />
eines Kunststoffmantelrohrs<br />
mit integrierten<br />
Überwachungsadern<br />
Überwachungs-Systeme<br />
Große Fernwärme-Versorger wissen seit<br />
vielen Jahren von dieser Problematik. Sie<br />
setzen deshalb konsequent drahtgebundene<br />
Überwachungssysteme zur Detektion<br />
von Feuchtigkeit in der Dämmung der<br />
Rohre ein. Rohrschäden lassen sich so im<br />
Entstehen aufdecken und mit minimalem<br />
Aufwand reparieren.<br />
BRANDES hat dafür ein System entwickelt,<br />
das speziell zur Überwachung von<br />
vorisolierten Rohren konzipiert ist. Dazu<br />
werden die BRANDES-Sensordrähte<br />
werkmäßig in die Dämmung eingebracht.<br />
Mit entsprechender Überwachungsgeräten<br />
wird damit Feuchtigkeit in der Dämmung<br />
sofort festgestellt und punktgenau<br />
automatisch lokalisiert.<br />
Oft wird empfohlen, bei flexiblen Rohren<br />
auf drahtgebundene Überwachung zu<br />
verzichten. Das ist nicht nachvollziehbar<br />
und in der Folge fatal. Flexible Rohre sind<br />
wegen der begrenzten Längswasserdichtheit<br />
durch Schadenswasser besonders gefährdet.<br />
Erfahrungen aus der Praxis zeigen,<br />
dass binnen weniger Stunden nach Schadenseintritt<br />
mehr als 50 m Dämmung im<br />
Rohr durchnässt wurden. Teure Komplettsanierungen<br />
sind die Folge. Die Bilder zeigen<br />
die Ursache und die Folgen einer Leckage.<br />
Durch eine undichte Verbindungsstelle<br />
an einem PEX-Rohr ohne integriertes<br />
Überwachungssystem ist unbemerkt die<br />
gesamte Hauszuleitung durchnässt worden.<br />
Der Rohrabschnitt musste komplett<br />
ausgetauscht werden.<br />
Mit dem Einbau einer Rohrnetz-Überwachungsanlage<br />
beginnt die Absicherung<br />
der Rentabilität und Sicherung der langfristigen<br />
Nutzungsdauer. Das Überwachungssystem<br />
gewährleistet die Qualitätssicherung<br />
bei der Rohrverlegung und<br />
Einhaltung definierter Abnahmekriterien.<br />
Montagefehler werden meistens schon<br />
sofort oder spätestens innerhalb der Gewährleistung<br />
erkannt. So können auch eine<br />
mechanische Beschädigungen und dessen<br />
Verursacher sofort festgestellt werden.<br />
Die frühzeitige Erkennung und Ortung<br />
von Feuchteschäden ermöglicht dem Betreiber<br />
ein schnelles Eingreifen. Dadurch<br />
können die Kosten für Instandhaltung<br />
minimiert werden. Die Lebensdauer<br />
des Rohrsystems verlängert sich signifikant.<br />
Damit wird die Wirtschaftlichkeit<br />
des Netzes gewährleistet, die Rentabilität<br />
durch langfristige Verfügbarkeit gesichert<br />
und störungsfreier Betrieb bei minimalem<br />
Pflegeaufwand gewährleistet.<br />
Kontakt: BRANDES GmbH, Eutin,<br />
Tel. +49 4521 8070, E-Mail: brandes@<br />
brandes.de, www.brandes.de<br />
12 / 2011 935
Fachbericht<br />
Gasversorgung & Pipelinebau<br />
Leitungsbau in Zeiten der<br />
Energiewende – Ausbau auf allen<br />
Ebenen<br />
Von Lukas Romanowski und Dieter Hesselmann<br />
Die Umsetzung der Energiewende in Deutschland und der dafür notwendige Netzausbau haben tiefgreifende Auswirkungen<br />
auf die gesamte Versorgungswirtschaft. Auf die Mittelstandsunternehmen des deutschen Leitungsbaus kommen<br />
enorme Aufgaben zu, die zu einer noch ungeahnten Herausforderung in Bezug auf Struktur, Personal und ingenieurtechnischer<br />
Leistungsfähigkeit führen werden. Unterstützung erfahren die Unternehmen vom Rohrleitungsbauverband<br />
e.V. (rbv) und der Bundesfachabteilung Leitungsbau (BFA LTB). Sie fördern Umfang und Qualität des unumgänglichen<br />
Dialoges zwischen Leitungsbauern, Versorgungswirtschaft und Politik. Konsequent werden die aktuellen<br />
Infrastrukturthemen begleitet und die Interessen der Unternehmen des Leitungsbaus gebündelt, formuliert und in die<br />
allgemeine Debatte eingebracht.<br />
Bild 1: VPE Kabel<br />
(Foto:Eurocable)<br />
Stromnetz sicher<br />
Die Stromnetze in Deutschland gelten als die sichersten in Europa.<br />
Der europäische Vergleich zeigt: Vor allem auf Grund ihrer<br />
Engmaschigkeit sind die deutschen Netze deutlich weniger anfällig<br />
für Störungen als die Netze in vergleichbaren Industrieländern.<br />
Das wird durch einschlägige Untersuchungen belegt. So<br />
müssen die Stromkunden in Deutschland im Durchschnitt nur<br />
mit 18 Minuten Stromausfall im Jahr rechnen. Hieraus ergibt<br />
sich eine Zuverlässigkeit von 99 %. Das ist ein hervorragender<br />
Wert, den es zu erhalten gilt. Ausgelöst durch den Wandel in<br />
der Energiewirtschaft werden hohe Anforderungen an die Leistungsfähigkeit<br />
der Netze gestellt. In Zukunft müssen wachsende<br />
Mengen an Strom aus erneuerbaren Energien aufgenommen<br />
und in die Verbrauchszentren transportiert werden. Darüber<br />
hinaus müssen die Netze auf eine Ausweitung des grenzüberschreitenden<br />
Stromhandels ausgelegt und zu intelligenten<br />
Stromnetzen, den so genannten Smart Grids, weiterentwickelt<br />
werden. Hieraus ergibt sich die Konsequenz, die Stromnetze in<br />
Deutschland auf allen Spannungsebenen auszubauen.<br />
Flexibilität gefragt<br />
Je stärker die Erzeugungskapazitäten bei den erneuerbaren<br />
Energien ausgebaut werden, desto schwankender wird<br />
die Stromerzeugung. So sorgt zum Beispiel ein Sturm über<br />
der Nordsee dafür, dass eine enorme Menge Strom von den<br />
Windparks kurzfristig ins Netz eingespeist wird. Diesen Überschuss<br />
gilt es sinnvoll zu verteilen, um Angebot und Nachfrage<br />
in ein Gleichgewicht zu bringen und eine Überlastung der<br />
Stromnetze, die zu einem Komplettausfall in Teilnetzen führen<br />
kann, zu verhindern. Zum Ausgleich werden konventionelle<br />
Kraftwerke heruntergefahren oder es wird andernorts überschüssiger<br />
Strom in Pumpspeicherkraftwerken zwischengespeichert,<br />
bis er wieder gebraucht wird. Das bedeutet, dass<br />
die Stromnetze flexibler werden müssen.<br />
Bild 2: GIL-Leitung (Foto: Siemens AG)<br />
Erhöhung der Kapazitäten<br />
Deshalb wird es auf allen Netzstufen zu Veränderungen kommen.<br />
So müssen die Übertragungsnetzbetreiber ihre Höchst-<br />
936 12 / 2011
Bild 3: HGÜ Kabel (Foto: ABB AG)<br />
Bild 4: Trasse HGÜ Kabel (Foto: ABB AG)<br />
spannungsnetze in erheblichem Umfang ausbauen, damit<br />
Strom aus Windkraftanlagen aus den Erzeugungszentren im<br />
Norden Deutschlands oder sogar vor der Küste in die Verbrauchszentren<br />
im Westen und Süden transportiert werden<br />
kann. Die Kapazitäten der Kuppelstellen an den nationalen<br />
Grenzen sollen erhöht werden, damit einerseits der europäische<br />
Stromverbund noch besser funktioniert, andererseits,<br />
damit der grenzüberschreitende Stromhandel ausgebaut und<br />
somit der von der EU angestrebte europäische Energie-Binnenmarkt<br />
weiter vorangetrieben werden kann. Hinzu kommt:<br />
Die regionalen Netzbetreiber mit ihren Mittelspannungsnetzen<br />
müssen zunehmend Strom aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen<br />
oder aus Biomasse-Kraftwerken aufnehmen und die<br />
lokalen Verteilnetzbetreiber müssen in vielen Regionen die<br />
Leitungen in Wohngebieten verstärken und Anlagen umbauen,<br />
um das Stromangebot aus den zahlreichen Photovoltaikanlagen<br />
ohne Störung der Versorgungssicherheit abzutransportieren.<br />
Smart Grids – die Zukunft<br />
Ziel der Ausbaumaßnahmen ist die Schaffung intelligenter<br />
Energienetze, so genannter Smart Grids, die die Zukunft unserer<br />
Energieversorgung bestimmen werden. Dabei handelt<br />
es sich um Systeme, in denen Stromerzeuger, Stromspeicher,<br />
Übertragungs- und Verteilnetze sowie die Energieverbraucher<br />
über modernste Informations- und Kommunikationstechnologie<br />
derart miteinander verbunden sind, dass die zur<br />
Verfügung stehende Primärenergie so effizient, aber auch so<br />
sicher, wirtschaftlich und umweltfreundlich wie möglich genutzt<br />
wird.<br />
Um die Planungs- und Genehmigungsphase bei der Umsetzung<br />
zu beschleunigen und Fehlplanungen zu vermeiden,<br />
hat die Bundesregierung im Juli 2011 das Netzausbaubeschleunigungsgesetz<br />
(NABEG) verabschiedet. Grundlage des<br />
Gesetzes sind die Netzstudie I und II der Deutschen Energie<br />
Agentur (dena). Die Studien haben ergeben, dass in Deutschland<br />
bis zum Jahr 2020 rund 4.400 km an neuen Höchstspannungsleitungen<br />
notwendig werden. Das Gesetz trägt dazu bei,<br />
dass eine deutschlandweit koordinierte Netzausbauplanung<br />
stattfindet, die länderübergreifend von der Bundesnetzagentur<br />
gesteuert wird. Besondere Beachtung verdient die Tatsache,<br />
dass aufgrund einer deutlich schwindenden Akzeptanz<br />
der Bevölkerung in Bezug auf den geplanten Netzausbau und<br />
den damit verbundenen Bau von weiteren Strommasten die<br />
Variante der Erdverlegung von Stromleitungen in das NABEG<br />
verankert wurde. So sollen auf alle neuen Trassen mit einer<br />
Nennspannung von 110 kV überwiegend als Erdkabel ausgeführt<br />
werden. Das ist unter anderem deshalb erwähnenswert,<br />
da bisher Erdkabel vor allem aus Kostengründen relativ<br />
selten verlegt wurden.<br />
Techniken der Erdverkabelung<br />
VPE-Kabel Wechselstrom<br />
Die Kabel mit „vernetzter Polyethylen-Isolierung (VPE)“<br />
(Bild 1) sind eine Weiterentwicklung der seit fast 80 Jahren<br />
genutzten Öl- bzw. Ölpapierkabel. Die Übertragungskapazität<br />
kann durch die Anzahl der Kabel beliebig erhöht werden.<br />
Für 3.000 MW benötigt man drei Systeme aus je drei Einleiterkabeln<br />
mit einem Querschnitt von 2.500 mm 2 .<br />
Gasisolierte Leitung (GIL) Wechselstrom<br />
Das gasisolierte Leitungssystem (GIL) wurde erstmals 1976<br />
eingesetzt. Mittlerweile gibt es ein System der zweiten Generation,<br />
das über die Jahre hinweg ständig verbessert wurde<br />
und inzwischen ausgereift ist. Ein GIL-System ähnelt einer<br />
Pipeline mit Innenleiter, die mit einem Gasgemisch (80 %<br />
Stickstoff und 20 % SF6, 7 bar Druck) als Isoliermedium gefüllt<br />
ist (Bild 2).<br />
HGÜ/HVDC<br />
Die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) ist<br />
ein Verfahren der elektrischen Energieübertragung mit hoher<br />
Gleichspannung von über 100 kV. Der in der Praxis gelegentlich<br />
verwendete englische Begriff lautet High Voltage<br />
Direct Current (HVDC). Die Bautechnik ist ähnlich wie bei der<br />
VPE-Verkabelung (Bild 3 und Bild 4).<br />
Erste Projekte in dem neuen Sektor der erdverlegten Kabel<br />
wurden von Mitgliedsfirmen des Rohrleitungsbauverband e.V.<br />
12 / 2011 937
Fachbericht<br />
Gasversorgung & Pipelinebau<br />
(rbv) in Norddeutschen Küstenraum bewältigt. Dabei wurden<br />
die Offschore-Windparks mit den Umspannwerken an Land<br />
verbunden und angeschlossen, um den grünen Strom ins nationale<br />
Netz einspeisen zu können. Der Leitungsbau wird laut<br />
Studien und politischen Aussagen in den nächsten Jahren eine<br />
Vielzahl an erdverlegten Kabelprojekten bewältigen müssen.<br />
Chancen bei Strom und Gas<br />
Viele Kommunen und Gemeinden haben die Chancen, die sich<br />
durch die Energiewende ergeben, ergriffen, und mit öffentlichen<br />
Zuschüssen neue Blockheizkraftwerke (BHKW) und<br />
Fernwärmenetze zu bauen. Vorrangiges Ziel ist es, möglichst<br />
viel Energie günstig zu erzeugen, beziehungsweise möglichst<br />
wenig Energie zu verbrauchen. In diesem Marktsegment sind<br />
auch Leitungsbauunternehmen tätig. Einige bauen komplette<br />
Anlagen, die zum Beispiel Biogas erzeugen, das über Rohrleitungen<br />
in ein Blockheizkraftwerk gespeist wird. In diesem<br />
wird mit einer Turbine nicht nur Wärme sondern auch Strom<br />
erzeugt. Bei dem aus dieser Entwicklung resultierenden Bedarf<br />
an Neu- und Ausbau der für die Verteilung nötigen erdverlegten<br />
Fernwärmesysteme sind Leitungsbaufirmen in hohem<br />
Maße beteiligt.<br />
Eine weitere moderne Technologie, die durch die Energiewende<br />
starke Impulse für ihre Weiterentwicklung erhält,<br />
nennt sich Power2Gas. Dabei werden die bestehenden Gasnetze<br />
als temporärer Speicher für überschüssigen Strom genutzt,<br />
der nicht ins Netz gespeist werden kann. Die Technologie<br />
basiert – unter Einsatz von elektrischer Energie – auf<br />
der Spaltung von Wasser in Wasserstoff und in Sauerstoff.<br />
Der Wasserstoff kann entweder in ein synthetisches Methangas<br />
umgewandelt und damit praktisch unbegrenzt gespeichert<br />
werden oder direkt ins Gasnetz eingespeist und bei<br />
Bedarf zu Ökostrom und erneuerbarer Wärme umgewandelt<br />
werden. Ein Ziel der neuen Technologie ist eine flexiblere<br />
Planbarkeit der Energieproduktion aus Windparks und Solarkraftwerken<br />
und eine Entlastung der bestehenden Stromnetze.<br />
Obwohl die Versuchsanlagen zurzeit noch nicht den<br />
gewünschten Wirkungsgrad erreichen, sind die an der Entwicklung<br />
beteiligten Wissenschaftler optimistisch, bis 2020<br />
die Effektivität der Anlagen erheblich steigern zu können.<br />
Auch für die Power2Gas-Anlagen ist ein funktionstüchtiges<br />
und sicheres Gasnetz erforderlich, dessen Bau und Instandhaltung<br />
neue Betätigungsfelder für rbv-Mitgliedsunternehmen<br />
eröffnet.<br />
Investitionen dringend erforderlich<br />
Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Versorgungsunternehmen<br />
ihre Investitionszurückhaltung ablegen. Mit Einführung<br />
der Anreizregulierung Gas am 01. Januar 2009 wurden<br />
allen Netzbetreibern von der Bundesnetzagentur individuelle<br />
Erlösobergrenzen vorgegeben, um mehr Wettbewerb<br />
und sinkende Energiepreise für Verbraucher zu generieren.<br />
Mittlerweile befindet sich die Anreizregulierung Gas im dritten<br />
Jahr und erreicht mit der Kostenprüfung zur zweiten Regulierungsperiode<br />
eine wichtige Phase. Die geplante Ausgestaltung<br />
und Integration eines Qualitätselements Gas, das in<br />
der zweiten Regulierungsperiode die Qualität der Versorgung<br />
sicherstellen soll, wurde von der Bundesnetzagentur bislang<br />
noch nicht vorgestellt. Bereits vor Einführung der Anreizregulierung<br />
reichte die Erneuerungsrate von weniger als 0,5 %<br />
zum Erhalt der Rohrleitungsnetze nicht aus. Die Bestrebungen<br />
der Versorgungsunternehmen, ihre Kosten aufgrund der<br />
nun vorgeschriebenen Erlösobergrenze weitestgehend zu minimieren,<br />
sorgt für eine zusätzliche Zurückhaltung bei Investitionen<br />
in die Instandhaltung der Netzinfrastruktur – und das<br />
trotz täglich wachsenden Bedarfs. Dieser wird bereits heute<br />
auf einen zweistelligen Milliardenbetrag geschätzt. Diese<br />
Entwicklungen werden zu einer weiteren Verschlechterung<br />
Bild 5: Von<br />
Wind- und Sonnenenergie<br />
zu Gas<br />
(Bild: DVGW)<br />
938 12 / 2011
Sichere und effiziente<br />
Rohrleitungssysteme<br />
NEU<br />
Jetzt als Heft<br />
oder als ePaper<br />
erhältlich<br />
Nutzen Sie das Know-how der führenden Fachzeitschrift<br />
für die Entwicklung von Rohrleitungen, Komponenten und<br />
Verfahren im Bereich der Gas- und Wasserversorgung, der<br />
Abwasserentsorgung, der Nah- und Fernwärmeversorgung,<br />
des Anlagenbaus und der Pipelinetechnik.<br />
Mit zwei englischsprachigen Specials pro Jahr.<br />
Bild 6: Strom trifft Gas (Bild: DBI Gas- und Umwelttechnik<br />
GmbH)<br />
des Zustands der Netze führen, was langfristig auch für den<br />
Verbraucher spürbar sein wird.<br />
Die genannten Beispiele machen deutlich, dass die Energiewende<br />
die Infrastrukturen der Energieträger Gas und Strom<br />
zusammenwachsen lässt. Es ist abzusehen, dass in Deutschland<br />
aufgrund der Einbindung von fluktuierenden Energiequellen<br />
flexible Energiesysteme benötigt werden. Diese Aufgabe<br />
stellt eine große technische, organisatorische und regulative<br />
Herausforderung an alle Beteiligten dar.<br />
Autoren<br />
Dipl.-Wirtsch.-Ing.<br />
Lukas Romanowski<br />
Rohrleitungsbauverband e.V. (rbv), Köln<br />
Tel. +49 221 37668-41<br />
E-Mail: romanowski@rbv-koeln.de<br />
Dipl.-Wirtsch.-Ing.<br />
Dieter Hesselmann<br />
BFA Leitungsbau im Hauptverband der<br />
Deutschen Bauindustrie e.V., Berlin<br />
Rohrleitungsbauverband e.V. (rbv), Köln<br />
Tel. +49 221 37668-49<br />
E-Mail: leitungsbau@bauindustrie.de<br />
Wählen Sie einfach das Bezugsangebot,<br />
das Ihnen zusagt!<br />
· Als Heft das gedruckte, zeitlos-klassische Fachmagazin<br />
· Als ePaper das moderne, digitale Informationsmedium für<br />
Computer, Tablet oder Smartphone<br />
· Als Heft + ePaper die clevere Abo-plus-Kombination<br />
ideal zum Archivieren<br />
Alle Bezugsangebote und Direktanforderung<br />
finden Sie im Online-Shop unter<br />
www.3r-rohre.de<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
www.3r-rohre.de<br />
<strong>3R</strong> erscheint in der Vulkan-Verlag GmbH, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen<br />
12 / 2011 939
Fachbericht<br />
Gasversorgung & Pipelinebau<br />
Kathodischer Korrosionsschutz von<br />
Rohrleitungsstählen<br />
Von Markus Büchler und Hanns-Georg Schöneich<br />
Der kathodische Korrosionsschutz hat sich im praktischen Einsatz für erdverlegte Rohrleitungen aus Stahl hervorragend<br />
bewährt. Dies wird statistisch belegt durch eine signifikant geringere Schadenshäufigkeit im Vergleich zu nicht<br />
kathodisch geschützten Rohrleitungen.<br />
Basierend auf thermodynamischen Betrachtungen beschreibt der vorliegende Beitrag die Wirkungsweise des kathodischen<br />
Korrosionsschutzes und die regelgerechte Einstellung des Potentials an der Phasengrenze Stahl/Erdboden im<br />
praktischen Einsatz. Daran anschließend werden die Korrosionsszenarien diskutiert, die auftreten können, wenn es während<br />
des – jahrzehntelangen – Betriebes zu einer fehlerhaften Einstellung des Potentials kommt, die auch durch das<br />
Versagen einzelner Komponenten des Korrosionsschutzsystems, z. B. der Rohrleitungsumhüllung, bedingt sein kann.<br />
Der kathodische Korrosionsschutz (KKS) ist eine bewährte<br />
Technik für den Schutz erdverlegter Rohrleitungen aus Stahl,<br />
dessen Einrichtung bei Leitungen für den Transport von Erdgas,<br />
Erdöl o.ä. aus Gründen der Betriebssicherheit häufig in<br />
den technischen Regelwerken vorgeschrieben ist [1]. Bei den<br />
zum Einsatz kommenden Werkstoffen handelt es sich in der<br />
Regel um unlegierte Qualitätsstähle nach DIN EN 10208-2<br />
[2] (im Folgenden „Stahl“ genannt). Die Rohre und Rohrverbindungen<br />
sind immer mit isolierenden Umhüllungen oder Beschichtungen<br />
aus thermoplastischen (z. B. Polyethylen) oder<br />
duromeren (z. B. Epoxidharz) Kunststoffen versehen, deren<br />
wichtigste Eigenschaften sind<br />
dauerhaft hoher elektrischer Widerstand,<br />
hohe mechanische Festigkeit gegen mechanische Beanspruchungen,<br />
die insbesondere während der Verlegephase<br />
auftreten,<br />
gute Haftung auf der Stahloberfläche über die gesamte<br />
Betriebszeit oder mindestens dauerhafte formstabile<br />
Nachzeichnung der Kontur des Stahlrohres,<br />
hohe Alkalienbeständigkeit.<br />
Die Wirkung des kathodischen Korrosionsschutzes beschränkt<br />
sich damit auf die Fehlstellen in der Rohrumhüllung, an denen<br />
die Umhüllung z. B. durch mechanische Einwirkung beschädigt<br />
ist und wo die Stahloberfläche des Rohres mit dem umgebenden<br />
Erdreich in Kontakt steht.<br />
Eine statistische Auswertung des DVGW (Deutscher<br />
Verein des Gas und Wasserfaches) zum Korrosionsschutz<br />
von Rohrleitungen, die entsprechend dem gültigen technischen<br />
Regelwerk geplant und betrieben werden (dies gilt in<br />
Deutschland umfassend für Gasleitungen mit einem Betriebsdruck<br />
> 16 bar), zeigt, dass bei Anwendung des KKS nur 0,17<br />
Korrosionsschäden pro 100 km und Jahr auftreten, während<br />
bei nicht kathodisch geschützten Leitungen die Schadensrate<br />
um den Faktor 50 bis 100 höher liegt.<br />
Der folgende Beitrag beschreibt zunächst die Korrosionsgefährdung<br />
von Stahl in Erdböden aufgrund der Ausbildung<br />
galvanischer Elemente und wendet sich dann der Wirkung des<br />
kathodischen Korrosionsschutzes zu. Im Weiteren werden dann<br />
die Bedingungen für einen störungsfreien Betrieb des KKS angegeben<br />
und es werden Korrosionsszenarien beschrieben, die<br />
auftreten können, wenn an einzelnen Komponenten des Korrosionsschutzsystems<br />
im Laufe der Zeit Fehler auftreten.<br />
Bild 1: Pourbaix Diagramm des Systems Fe/H 2<br />
O mit Angabe<br />
des „Arbeitspunktes“ für korrodierendes und kathodisch geschütztes<br />
Eisen. Bild und Erläuterungen nach [4]<br />
Korrosion von Stahl im Erdboden<br />
Die Korrosion von Stahl im Erdboden entspricht einer Sauerstoffkorrosion<br />
mit den folgenden Teilreaktionen:<br />
940 12 / 2011
anodische Teilreaktion: Fe → Fe 2+ + 2e – (1)<br />
kathodische Teilreaktion: O 2<br />
+ 2H 2<br />
O + 4e – → 4OH – (2)<br />
Wegen der guten elektrischen Längsleitfähigkeit einer Rohrleitung<br />
können die Umhüllungsfehlstellen, an denen die beiden<br />
Teilreaktionen ablaufen, weit voneinander entfernt sein. Die<br />
Korrosionsgeschwindigkeit – am Ort der anodischen Teilreaktion<br />
– wird durch das Ausmaß der anodischen Polarisation<br />
bestimmt, die zunächst unmittelbar vom in der Regel diffusionskontrollierten<br />
Sauerstoffangebot – am Ort der kathodischen<br />
Teilreaktion – abhängt. Darüber hinaus wird die Korrosionsgeschwindigkeit<br />
von den physikalischen und chemischen<br />
Eigenschaften des Bodens, wie seinem spezifischen Widerstand,<br />
dem Neutralsalzgehalt und seinen deckschichtbildenden<br />
Eigenschaften bestimmt [3]. Erfahrungsgemäß liegt sie<br />
bei Werten um 0,1-0,2 mm/a. Wenn Rohrleitungen in komplexen<br />
Anlagen (Mess- und Regel-Anlagen) z. B. mit stahlbewehrten<br />
Betonfundamenten elektrisch leitend verbunden<br />
sind, wird die anodische Polarisation durch deren im Vergleich<br />
zum Stahl positiveren Ruhepotential entscheidend verstärkt,<br />
sodass die Korrosionsgeschwindigkeit bis 1 mm/a betragen<br />
kann. Ein Sonderfall liegt vor, wenn die anodische Polarisation<br />
durch eine Fremdstrombeeinflussung hervorgerufen wird.<br />
Dieser Fall ist z. B. gegeben, wenn die Rohrleitung in der Nähe<br />
gleichstrombetriebener Straßenbahnen verlegt ist und wird<br />
als Streustrombeeinflussung bezeichnet. Als kathodische Teilreaktion<br />
muss hier – wegen der Diffusionshemmung des Sauerstoffs<br />
– auch die Wasserspaltung nach<br />
2H 2<br />
O + 2e – → H 2<br />
+ 2OH – (3)<br />
in Betracht gezogen werden.<br />
In der Technik des kathodischen Korrosionsschutzes werden<br />
Potentialmesswerte auf die gesättigte Cu/CuSO 4<br />
-Elektrode<br />
(CSE) bezogen, deren Potential gegen die Normal-Wasserstoffelektrode<br />
320 mV beträgt.<br />
Bild 2: Auszug aus Bild 1 mit Angabe des Potentialbereiches<br />
für den kathodischen Korrosionsschutz (Ellipse a)<br />
Bild 3: Auszug aus Bild 1 mit Angabe des Potentialbereiches<br />
bei anodischer Polarisation (Ellipse b)<br />
Kathodischer Korrosionsschutz<br />
Die Wirkung des kathodischen Korrosionsschutzes kann anhand<br />
des in Bild 1 dargestellten Potential-pH-(Pourbaix)-<br />
Diagrammes des Systems Fe/H 2<br />
O (bei einer angenommenen<br />
Konzentration des gelösten Eisens von c Fe2+<br />
= 10 -6 mol/l) erläutert<br />
werden [4]. Dabei wird angenommen, dass die Elektrolytlösung<br />
neben gelöstem Sauerstoff keine weiteren reduzierbaren<br />
oder oxidierbaren Substanzen enthält.<br />
Unter ungeschützten Bedingungen liegt der Arbeitspunkt<br />
des Stahls im Feld „Korrosion“. Durch die Wirkung eines kathodischen<br />
Schutzstromes wird bei Reduktion des Sauerstoffs<br />
das Potential abgesenkt bis zur Begrenzung des Stabilitätsbereiches<br />
des Wassers (Wasserstoffentwicklung). Abhängig<br />
von der Höhe des Schutzstromes (Stromdichte J etwa um<br />
0,1A/m 2 ) werden nach Gleichung (2) und Gleichung (3) an<br />
der Phasengrenze Stahl/Elektrolytlösung Hydroxilionen produziert,<br />
wodurch der Arbeitspunkt – bei weiterer Absenkung<br />
des Potentials – entlang der Linie der Wasserstoffentwicklung<br />
hin zu höheren pH-Werten (ca. 9 – 12) in den Bereich<br />
der Passivität verschoben wird. Der Stahl wird hier durch eine<br />
dünne Oxidschicht gegen Korrosion geschützt. Der letztlich<br />
erreichte „stationäre Zustand“ wird durch das Gleichgewicht<br />
aus der Produktion von Hydroxilionen und deren Abtransport<br />
von der Stahloberfläche durch Migration, Diffusion<br />
und Konvektion bestimmt.<br />
Nach diesen Überlegungen führt beim kathodischen Korrosionsschutz<br />
die Kombination der Effekte der Potentialabsenkung,<br />
der Reduktion des Sauerstoffs und der Passivierung<br />
zu einer Verminderung der Korrosionsgeschwindigkeit<br />
von Stahl im Erdboden, die dann einen Wert von 0,01 mm/a<br />
nicht mehr überschreitet. Diese Schutzwirkung wird erreicht,<br />
wenn für das Potential des Stahls gilt U CSE<br />
< -0,85V. Der für<br />
den KKS nutzbare Potential- (zwischen -0,85 V und etwa<br />
-1,2 V) und pH-Bereich (zwischen 9 und 12) ist mit der Ellipse<br />
a in Bild 2 gekennzeichnet. Weiterhin sind mit den Ellipsen<br />
b, c, d die Bereiche angedeutet, in denen jeweils spezifische<br />
Korrosionsschäden auftreten, wenn an kathodisch geschützten<br />
Rohrleitungen einzelne Komponenten des Korrosionsschutzsystems<br />
fehlerhaft betrieben werden oder im Laufe<br />
der Zeit versagen. Diese Schadenszenarien werden in den<br />
folgenden Abschnitten diskutiert.<br />
Korrosionsschäden bei anodischer<br />
Polarisation<br />
In Bild 3 ist der Potential- (zwischen -0,6 V und etwa -0,7 V)<br />
und pH-Bereich (zwischen etwa 5 – 6), der bei anodischer<br />
Polarisation zu erwarten ist, angedeutet (Ellipse b). Korrosionsschäden,<br />
die auf einen entsprechenden Betrieb einer<br />
Rohrleitung zurückgeführt werden können, sind heute nicht<br />
mehr bekannt. Die folgenden Bedingungen könnten zu einer<br />
unzulässigen anodischen Polarisation führen:<br />
12 / 2011 941
Fachbericht<br />
Gasversorgung & Pipelinebau<br />
Fehlerhafter Anschluss des Gleichrichters, der den kathodischen<br />
Schutzstrom liefert, an Rohrleitung und Anode.<br />
Elektrischer Kontakt der kathodisch geschützten Rohrleitung<br />
mit einer Anlage, die ein positiveres Ruhepotential<br />
aufweist, z. B. einem stahlbewehrten Betonfundament<br />
(Ruhepotential U CSE<br />
ca. -0,2 V).<br />
Unzulässige Beeinflussung der kathodisch geschützten<br />
Rohrleitung durch Potentialgradienten im Erdboden, wodurch<br />
das Potential der Rohrleitung positiver wird. Derartige<br />
Potentialgradienten können durch fremde gleichstrombetriebene<br />
Anlagen hervorgerufen werden, wie<br />
z. B. kreuzende kathodisch geschützte Rohrleitungen anderer<br />
Betreiber.<br />
Bei zeitlich konstanter oder variierender aber ausschließlich<br />
anodischer Polarisation folgt der Massenabtrag (bzw. die Korrosionsgeschwindigkeit)<br />
dem Faradayschen Gesetz. Im Falle<br />
einer zeitlich veränderlichen Beeinflussung, bei der anodische<br />
und kathodische Polarisationsphasen einander abwechseln<br />
(dieser Fall ist z. B. bei einer Beeinflussung einer Rohrleitung<br />
durch eine Gleichstrom betriebene Straßenbahn gegeben),<br />
Bild 4: Auszug aus Bild 1 mit Angabe des Potentialbereiches<br />
bei fehlender oder mangelhafter kathodischer Polarisation<br />
(Ellipse c)<br />
Bild 5: Falten in der Umhüllung einer Rohrleitung<br />
ist die Korrosionsgeschwindigkeit aber tendenziell geringer<br />
[5]. Nach dem heutigen Kenntnisstand ist dieser Effekt vermutlich<br />
auf einen ähnlichen Mechanismus zurückzuführen,<br />
der weiter unten im Zusammenhang mit der Wechselstromkorrosion<br />
vorgestellt wird [4]: Danach können 2-wertige Eisenionen,<br />
die während ausreichend langer kathodischer Polarisationsphasen<br />
in der Passivschicht oder einer darüber liegenden<br />
dünnen Rostschicht gebunden und elektrochemisch<br />
zugänglich sind, während anodischer Polarisationsphasen zu<br />
3-wertigen Eisenionen oxidiert werden und damit die Korrosionsreaktion<br />
nach Gleichung (1) „entlasten“.<br />
Die Maßnahmen zur Vermeidung und Erkennung entsprechender<br />
Schäden werden in technischen Regelwerken angegeben<br />
[6].<br />
Korrosionsschäden bei fehlender<br />
oder mangelhafter kathodischer<br />
Polarisation<br />
In Bild 4 ist der Potential- (um etwa -0,7 V) und pH-Bereich<br />
(zwischen 6 und 8), der bei fehlender oder mangelhafter kathodischer<br />
Polarisation zu erwarten ist, angedeutet (Ellipse c).<br />
Schäden bei fehlender kathodischer<br />
Polarisation<br />
Wegen des hohen elektrischen Widerstandes der Umhüllung<br />
ist eine Polarisation der Stahloberfläche unter der Umhüllung<br />
nicht möglich. Mit einer Korrosionsgefährdung des Rohres ist<br />
demnach zu rechnen, wenn Wasser und Sauerstoff zwischen<br />
Umhüllung und Stahloberfläche gelangen. Dieser Fall ist gegeben,<br />
wenn die Werksumhüllung eines Rohres oder die Baustellenumhüllung<br />
einer Rundschweißnaht die Haftung auf der<br />
Stahloberfläche verliert. Solange die Umhüllung aber weiterhin<br />
formstabil an der Stahloberfläche anliegt (dies ist z. B.<br />
bei Polyethylen-Umhüllungen wegen der im Umfangsrichtung<br />
des Rohres wirkenden Eigenspannungen aus dem Produktionsprozess<br />
gegeben), ist nur mit einer technisch vernachlässigbaren<br />
Korrosionsgeschwindigkeit (
se weiter auskorrodierte Risse, die sich u.U. auch zu längeren<br />
Rissen vereinigen können. Als Korrosionsprodukt<br />
wird häufig FeCO 3<br />
(Siderit) auf der Stahloberfläche gefunden.<br />
Weiterhin beträgt der pH-Wert des unter der<br />
Umhüllung vorgefundenen Bikarbonat-haltigen Mediums<br />
i.d.R. zwischen 6 und 7. Diese Befunde legen einen Korrosionsmechanismus<br />
nahe, bei dem die korrosiven Eigenschaften<br />
eines CO 2<br />
-haltigen Mediums mit den mechanischen<br />
Spannungen in der Rohrwand zusammenwirken.<br />
Die Rissentstehung und -fortpflanzung erfolgt vermutlich<br />
aufgrund der Wechselwirkung zwischen dem aus der<br />
Dissoziation der Kohlensäure und der Korrosionsreaktion<br />
entstehenden Wasserstoff und betriebsbedingten Spannungsspitzen<br />
in der Rohrwand. Weitere Erläuterungen zu<br />
diesem Korrosionsmechanismus und eine Zusammenstellung<br />
der zu dieser Korrosionsart existierenden Literatur<br />
findet man z. B. in [8].<br />
Interkristalline Spannungsrisskorrosion wird unter ähnlichen<br />
Bedingungen (bevorzugt bei erhöhten Betriebstemperaturen)<br />
beobachtet, wenn der pH-Wert des Carbonat/Bikarbonat-Mediums<br />
(möglicherweise unter der Einwirkung<br />
eines schwachen kathodischen Stromes) Werte<br />
um 8,4 oder höher erreicht. Es handelt sich hierbei<br />
um eine bevorzugte anodische Auflösung der Korngrenzen,<br />
während das Korn selbst in dem alkalischen Medium<br />
passiviert. Das für den Betrieb von Gashochdruckleitungen<br />
wichtige Ergebnis einer Studie aus den 1980er Jahren<br />
war, dass auf der Rohroberfläche verbliebene Oxidschichten<br />
(in Form von Walzzunder) einen entscheidenden<br />
Einfluss auf die Rissbildung haben [9]. Bei gestrahlten<br />
Rohroberflächen wurden keine Risse gefunden.<br />
In [8] werden die beiden Spannungsriss-Korrosionsarten<br />
im Rahmen einer Betrachtung der pH-Abhängigkeit der<br />
Dissoziationsgleichgewichte im System CO 2<br />
/ H 2<br />
O thematisch<br />
zusammengeführt.<br />
Durch Spannungsrisskorrosion verursachte Schäden können<br />
bei erdverlegten Rohrleitungen z. B. durch eine intelligente<br />
Ultraschall-Molchung detektiert werden.<br />
Die wichtigste Maßnahme zur Vermeidung dieser Schadensart<br />
ist die Verwendung formstabiler Umhüllungen oder<br />
Beschichtungen (z. B. mit extrudiertem Polyethlen oder gesintertem<br />
Epoxidharz), wodurch der strömende Transport von<br />
Wasser zwischen Umhüllung und Stahloberfläche auch bei<br />
Verlust der Haftung ausgeschlossen wird.<br />
Schäden bei mangelhafter kathodischer<br />
Polarisation<br />
Mangelhafte kathodische Polarisation kann unter den folgenden<br />
Bedingungen auftreten:<br />
Die Umhüllung oder Beschichtung der Rohrleitung weist<br />
eine große Beschädigung auf; da die Stromdichte des kathodischen<br />
Schutzstromes tendenziell mit der Fläche der<br />
Fehlstelle abnimmt, wird – bei gegebener Einstellung des<br />
KKS – oberhalb einer bestimmten Fläche ein Punkt erreicht,<br />
an dem der aus dem Boden/Grundwasser an die<br />
Stahloberfläche transportierte Sauerstoff nicht mehr<br />
vollumfänglich reduziert wird.<br />
Bild 6: Oberflächiger Riss in einer Rohrwand, der unter einer<br />
abgelösten Umhüllung entstanden ist. Der Rissverlauf ist<br />
überwiegend transkristallin, es sind aber auch interkristalline<br />
Bereiche erkennbar. An einzelnen Stellen ist der Riss auskorrodiert<br />
Bild 7: Auszug aus Bild 1 mit Angabe des Potentialbereiches<br />
bei kathodischem Überschutz (Ellipse d)<br />
Mit vergleichbaren Bedingungen kann gerechnet werden,<br />
wenn in schlecht leitfähigen Böden (z. B. felsigem Untergrund)<br />
der Schutzstrom vermindert ist. Generell gilt, dass<br />
der Transport des Oxidationsmittels (des Sauerstoffs) zur<br />
Stahloberfläche die erforderliche Höhe der Schutzstromdichte<br />
zum Erreichen einer ausreichenden kathodischen<br />
Polarisation bestimmt.<br />
12 / 2011 943
Fachbericht<br />
Gasversorgung & Pipelinebau<br />
Mängel dieser Art können bei kathodisch geschützten Rohrleitungen<br />
mit Hilfe einer Intensivmessung [10] identifiziert<br />
werden.<br />
An der Rohroberfläche ist unter diesen Bedingungen mit<br />
einem Korrosionsabtrag zu rechnen, der in Form von unregelmäßigen<br />
Korrosionsmulden auftritt, deren Gesamtfläche der<br />
Größe der Fehlstelle entspricht. Die Korrosionsgeschwindigkeit<br />
überschreitet i.d.R. nicht 0,1 – 0,2 mm/a (s.o.).<br />
Korrosionsschäden bei kathodischem<br />
Überschutz<br />
In Bild 7 ist der Potential- (um -1,2 V bis -1,3 V) und pH-Bereich<br />
(zwischen 12 bis 13), der bei kathodischem Überschutz<br />
zu erwarten ist, angedeutet (Ellipse d).<br />
Aus elektrochemischer Sicht wird bei höheren kathodischen<br />
Stromdichten (J > 1 A/m 2 ) entsprechend Gleichung<br />
(3) vermehrt Wasserstoff erzeugt und die Konzentration der<br />
Bild 8: a) Fehlstellen in der Umhüllung einer 3-Lagen-Polyethylenumhüllung;<br />
b) wegen kathodischer Enthaftung kann die<br />
Umhüllung im Umkreis von etwa 5 cm um die Fehlstellen entfernt<br />
werden<br />
Hydroxilionen an der Phasengrenze Stahl/Boden nimmt zu.<br />
Allerdings erreicht der pH-Wert selbst bei extremen kathodischen<br />
Stromdichten um 50 A/m 2 in ruhenden Boden-ähnlichen<br />
Elektrolytlösungen nur pH-Werte um 13,5 [11] und<br />
die Korrosionsgeschwindigkeit bleibt vernachlässigbar gering.<br />
Immer wieder geäußerte Vermutungen, dass durch die<br />
weitere Anhebung des pH-Wertes das in Bild 1 am unteren<br />
rechten Bildrand dargestellte Korrosionsfeld erreicht würde,<br />
konnten in Laboruntersuchungen nicht bestätigt werden. Bei<br />
zunehmender kathodischer Überspannung erreicht der Arbeitspunkt<br />
des Stahls den Bereich der Immunität. Die zuvor<br />
gebildete Passivschicht wird dabei irreversibel reduziert und<br />
verbleibt als „Rostschicht“ auf der Stahloberfläche. Im Folgenden<br />
werden die möglichen Schäden diskutiert, die bei kathodischem<br />
Überschutz in Betracht gezogen werden müssen:<br />
Kathodische Enthaftung<br />
Beim kathodischen Korrosionsschutz erfolgt am Umhüllungsrand<br />
um eine Fehlstelle ein Haftungsverlust, der<br />
generell auf eine Beeinträchtigung der Bindungskräfte<br />
zwischen der Stahloberfläche und dem Umhüllungsmaterial<br />
– u. a. durch den Einfluss der OH - -Ionen – zurückgeführt<br />
wird (Bilder 8a, 8b). Die Geschwindigkeit<br />
des Fortschreitens dieser Enthaftungsgrenze nimmt mit<br />
zunehmender kathodischer Polarisation zu. Eine Korrosionsgefährdung<br />
ist mit der kathodischen Enthaftung<br />
nicht verbunden, solange die Umhüllung formstabil an<br />
der Stahloberfläche anliegt. Die zulässige kathodische<br />
Enthaftung ist eine Kenngröße bei der Formulierung der<br />
Anforderungen an eine Umhüllung oder Beschichtung,<br />
vgl. [12].<br />
Wechselstromkorrosion<br />
Wenn eine kathodisch geschützte Rohrleitung einer betrieblichen<br />
Beeinflussung durch 50 Hz-Drehstrom-<br />
Hochspannungsfreileitungen und/oder durch 16,7 Hz-<br />
Fahrleitungen der Bahn unterliegt, können Wechselspannungen<br />
(maximal zulässig sind aus Gründen des Berührungsschutzes<br />
60 V) induziert werden. In den Fehlstellen<br />
der Rohrumhüllung werden die kathodischen Schutzströme<br />
dann von häufig um ein Vielfaches höheren Wechselströmen<br />
überlagert und der Gesamtstrom durchläuft<br />
(mit der Frequenz der Wechselspannung) anodische<br />
und kathodische Phasen. In gut leitfähigen Böden werden<br />
Wechselstromdichten von deutlich mehr als 30 A/<br />
m 2 erreicht. Unter diesen Bedingungen wird Materialabtrag<br />
durch Wechselstromkorrosion beobachtet. Der Mechanismus<br />
wird mit Bild 9 (mit Bezug auf Bild 1) qualitativ<br />
erläutert.<br />
Ausgehend von einer Stahloberfläche, die frei von Oxidschichten<br />
ist, wird durch den anodischen Strom ein Passivfilm<br />
gebildet, der während der darauffolgenden kathodischen<br />
Phase zu einer Rostschicht reduziert wird, die<br />
keine schützenden Eigenschaften besitzt. Unter dieser<br />
Rostschicht entsteht während der nächsten anodischen<br />
Halbwelle ein neuer Passivfilm und in der Rostschicht<br />
werden elektrochemisch zugängliche Fe 2+ -Ionen zu Fe 3+ -<br />
Ionen oxidiert. Während der nachfolgenden kathodischen<br />
Halbwelle werden letztere zunächst wieder reduziert und<br />
944 12 / 2011
erst dann wird auch der neue Passivfilm reduziert, wobei<br />
die Dicke der Rostschicht zunimmt. Die beobachtete<br />
Korrosion ist damit eine Folge der bei jeder Periode<br />
wieder beginnenden Bildung eines neuen Passivfilms und<br />
dessen nachfolgender irreversibler Reduktion. Eine wichtige<br />
Maßnahme für den Schutz gegen Wechselstromkorrosion<br />
ist die Begrenzung der kathodischen Stromdichte<br />
in den Fehlstellen der Rohrumhüllung auf Werte
Fachbericht<br />
Gasversorgung & Pipelinebau<br />
Beeinflussung fremder erdverlegter Anlagen<br />
Bedingt durch hohe Ströme, die beim kathodischen Überschutz<br />
zur Rohrleitung fließen, werden im Erdboden Potentialgradienten<br />
erzeugt, die fremde erdverlegte Anlagen<br />
anodisch polarisieren und damit zu abtragender Korrosion<br />
führen (siehe oben „Korrosionsschäden bei anodischer<br />
Polarisation“)<br />
In der Korrosionsschutz-Praxis werden Betriebsbedingungen,<br />
die dem kathodischen Überschutz entsprechen, weitestgehend<br />
vermieden.<br />
Schlussfolgerung<br />
Der kathodische Korrosionsschutz hat sich im praktischen<br />
Einsatz hervorragend bewährt. Obwohl Korrosionsprozesse<br />
nicht vollständig ausgeschlossen werden können, wird generell<br />
durch den KKS eine signifikante Erhöhung der Nutzungsdauer<br />
von erdverlegten Stahlleitungen beobachtet.<br />
Diese empirischen Beobachtungen werden von aktuellen<br />
Forschungsergebnissen sowie thermodynamischen und kinetischen<br />
Betrachtungen gestützt. Das vertiefte Verständnis<br />
der ablaufenden Prozesse und involvierten Mechanismen ermöglicht<br />
heute einen stark verbesserten Betrieb des kathodischen<br />
Korrosionsschutzes. Bei optimalem Betrieb der Schutzanlagen<br />
sowie beim Einsatz von modernen Umhüllungssystemen<br />
können heute Korrosionsschäden weitestgehend ausgeschlossen<br />
werden.<br />
Autoren<br />
Dr. Markus Büchler<br />
SGK Schweizerische Gesellschaft für<br />
Korrosionsschutz, Zürich (CH)<br />
Tel. +41 44 213 1595<br />
E-Mail: markus.buechler@sgk.ch<br />
Dr. Hanns-Georg Schöneich<br />
Open Grid Europe, Essen<br />
Tel. +49 201 3642-18440<br />
E-Mail: hanns-georg.schoeneich@<br />
open-grid-europe.com<br />
Literatur<br />
[1] Verordnung über Gashochdruckleitungen (Gashochdruckleitungsverordnung<br />
– GasHDrLtgV); 2011<br />
DVGW-Arbeitsblatt G 463 „Gasleitungen aus Stahlrohren<br />
für einen Betriebsdruck > 16 bar – Errichtung“ (2001)<br />
Bekanntmachung der Technischen Regel für Rohrfernleitungen<br />
nach § 9 Absatz 5 der Rohrfernleitungsverordnung<br />
(TRFL); 2010<br />
[2] DIN EN 10208 – 2 „Stahlrohre für Rohrleitungen für<br />
brennbare Medien – Technische Lieferbedingungen –<br />
Teil 2: Rohre der Anforderungsklasse B“ (2009)<br />
[3] DIN 50929 – 3 „Korrosion der Metalle; Korrosionswahrscheinlichkeit<br />
metallischer Werkstoffe bei äußerer Korrosionsbelastung;<br />
Rohrleitungen und Bauteile in Böden und<br />
Wässern“ (1985)<br />
[4] Büchler, M.: Kathodischer Korrosionsschutz: Diskussion der<br />
grundsätzlichen Mechanismen und deren Auswirkung auf<br />
Grenzwerte; <strong>3R</strong> international 49 (2010) S. 342-347<br />
[5] Bette, U.: Materialabtrag bei wechselnder anodischer und<br />
kathodischer Beeinflussung; Mitteilungen des Fachverband<br />
Kathodischer Korrosionsschutz fkks; Nr. 61 (2006)<br />
[6] DIN EN 50162 „Schutz gegen Korrosion durch Streuströme<br />
aus Gleichstromanlagen“ (2005)<br />
AfK-Empfehlung Nr. 2 „Beeinflussung von unterirdischen<br />
metallischen Anlagen durch Streuströme von Gleichstromanlagen“<br />
(2009)<br />
[7] Schwenk, W.; Heim, G.; Wedekind, B.; Schäfer, T.: Untersuchung<br />
der Korrosionsschutzwirkung von Umhüllungen auf<br />
Stahrohrleitungen nach langzeitiger Auslagerung in Wasser<br />
und Erdboden; <strong>3R</strong> international 35 (1996) S. 676-685<br />
[8] Castaneda, H.; Leis, B.N.; Rose, S.E.: Report on Model Modules<br />
to Assist Assessing and Controlling SCC, prepared for<br />
US Deparment of Transportation PHMSA, 2008<br />
[9] Delbeck, W.; Engel, A.; Müller, D.; Spörl, R.; Schwenk, W.:<br />
Schutzmaßnahmen gegen interkristalline Spannungsrisskorrosion<br />
von Gashochdruckleitungen aus Stahl bei erhöher<br />
Betriebstemperatur; Werkstoffe und Korrosion 37<br />
(1986) S. 176-182<br />
[10] Kompetenzcenter der Open Grid Europe GmbH (Hrsg);<br />
Korrosionsschutz erdverlegter Rohrleitungen, Kap. 6; Vulkan<br />
Verlag GmbH, Essen, 2008<br />
[11] Büchler, M.; Voute, C.-H.; Schöneich, H.-G.: Die Auswirkung<br />
des kathodischen Schutzniveaus; <strong>3R</strong> international 47<br />
(2008) S. 344-349<br />
[12] ISO 21809-3 „Erdöl- und Erdgasindustrie – Umhüllungen<br />
für erd- und wasserverlegte Rohrleitungen in Transportsystemen<br />
– Teil 3: Umhüllungen für Schweißverbindungen“<br />
(2008)<br />
[13] AfK-Empfehlung Nr. 11 „Beurteilung der Korrosionsgefährdung<br />
durch Wechselstrom bei kathodisch geschützten<br />
Stahlrohrleitungen und Schutzmaßnahmen“ (Veröffentlichung<br />
in Kürze)<br />
[14] Punter, A.; Fikkers, A.T.; Vanstaen, G.: Hydrogen-Induced<br />
Stress Corrosion Cracking on a Pipeline; Materials Performance,<br />
31 No. 6 (1992) p. 24-28<br />
[15] Schwenk, W.: Investigation into the Cause of Corrosion<br />
Cracking in High Pressure Gas Transmission Pipelines; <strong>3R</strong><br />
international 33 (1994) p. 343 – 349<br />
[16] Pohl, M.; Kühn, S.: Einfluss von Kaltverfestigung auf die<br />
Anfälligkeit des Werkstoffes StE 480.7 TM für Wasserstoff-induzierte<br />
Spannungsrisskorrosion; Studie im Auftrag<br />
der Open Grid Europe GmbH, 2009<br />
[17] Webseite der European Pipeline Research Group; http://<br />
www.eprg.net/; Juli 2011<br />
946 12 / 2011
gas2energy.net<br />
Systemplanerische Grundlagen<br />
der Gasversorgung<br />
Das Fachbuch wendet sich an Fachleute, Studierende,<br />
Hochschullehrer, Mitarbeiter von Behörden und „Quereinsteiger“,<br />
die in der Praxis der Energie-, insbesondere der<br />
Gasversorgung tätig und mit der Konzipierung, Planung und<br />
dem Betrieb von Gasleitungen/Gasnetzen befasst sind.<br />
Unter Beachtung der allgemeinen physikalischen, strömungstechnischen<br />
und thermodynamischen Grundlagen werden<br />
die Charakteristika der Systemelemente der Gasversorgung<br />
beschrieben: Rohrleitungen, Verdichterstationen, Gasdruckregel-<br />
und Messanlagen und Gasspeicher.<br />
Das Werk ist bewusst nicht als „klassisches“ Lehrbuch<br />
konzipiert, sondern behandelt problembezogen, jeweils in sich<br />
geschlossen Schwerpunktthemen, die für die Konzipierung von<br />
Gasversorgungssystemen von Bedeutung sind. Hierbei wird der<br />
Stand der Technik erfasst, so dass das Buch eine belastbare<br />
Grundlage für die Durchführung eigener Unter suchungen<br />
darstellt.<br />
Sie haben die<br />
Wahl !<br />
Hrsg.: J. Mischner, H.-G. Fasold, K. Kadner<br />
1. Aufl age 2011, ca. 750 Seiten, Farbdruck, Hardcover<br />
Buch + CD-ROM<br />
Buch + DVD<br />
mit Zusatzinhalten<br />
mit vollständigem eBook<br />
Oldenbourg-Industrieverlag GmbH<br />
www.oldenbourg-industrieverlag.de<br />
Vorteilsanforderung per Fax: +49 (0) 201 / 820 02 - 34 oder im Fensterumschlag einsenden<br />
Ja, ich bestelle gegen Rechnung 3 Wochen zur Ansicht<br />
___ Ex.<br />
___ Ex.<br />
gas2energy.net + CD (Zusatzinhalte)<br />
1. Aufl age 2011 – ISBN: 978-3-8356-3205-9 für € 110,- (zzgl. Versand)<br />
gas2energy.net + DVD (eBook)<br />
1. Aufl age 2011 – ISBN: 978-3-8356-3236-3 für € 150,- (zzgl. Versand)<br />
Die bequeme und sichere Bezahlung per Bankabbuchung wird mit einer Gutschrift<br />
von € 3,- auf die erste Rechnung belohnt.<br />
Antwort<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
Versandbuchhandlung<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
Firma/Institution<br />
Vorname/Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
E-Mail<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
Telefax<br />
Bevorzugte Zahlungsweise Bankabbuchung Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Bankleitzahl<br />
<br />
Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer<br />
PAG2EN2011<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen.<br />
Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an die Vulkan-Verlag GmbH, Versandbuchhandlung, Postfach 10 39 62, 45039 Essen.<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pfl ege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst, gespeichert und verarbeitet. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich vom<br />
Oldenbourg Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per E-Mail, nicht über interessante Fachangebote informiert und beworben werde. Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
Fachbericht<br />
Gasversorgung & Pipelinebau<br />
CO 2<br />
-Mess- und Regelanlage:<br />
Anforderungen eines<br />
Netzbetreibers<br />
Von Klaus Steiner<br />
Vom Emittenten bis zur Speicherung durchläuft Kohlendioxid (CO 2<br />
) in der CCS-Prozesskette (Carbon Capture and Storage)<br />
alle Druckstufen von leichtem bis zu mehreren hundert bar Überdruck. „Custody Transfer“ von CO 2<br />
in einer europäischen<br />
CCS-Infrastruktur führt zu einem Bedarf von bis zu 2.000 Zählern für gasförmiges und dichtes CO 2<br />
pro Jahr.<br />
Die Technologien der CO 2<br />
-Mengenmessgeräte sind dabei die gleichen, wie sie vom Erdgas her bekannt sind. Eingesetzt<br />
werden die Zähler in CO 2<br />
-Mess- und/oder Regelanlagen. Regelung ist primär in Form der Mengenregelung erforderlich,<br />
da der Transporteur die genutzte Kapazität entlang der CCS-Kette vermarktet. Obwohl in Europa und Nordamerika<br />
bereits industriell genutzt, fehlen insb. in Deutschland Erfahrungen mit der CCS-Verfahrenstechnik. Anforderungen<br />
an die Mengenmess- und Regeltechnik werden nachfolgend aus Sicht eines CCS-Netzbetreibers diskutiert.<br />
Aufgrund der ablehnenden Haltung des Bundesrates im<br />
Herbst 2011 zu der Gesetzesinitiative des Bundestages lässt<br />
die Erprobung der unterirdischen Speicherung von Kohlendioxid<br />
(CO 2<br />
) in Deutschland noch auf sich warten [1,2]. Pilotprojekte<br />
wie von Total in Frankreich oder die industrielle Nutzung<br />
des Wertstoffes CO 2<br />
wie bei Statoil in Norwegen sind<br />
in Deutschland daher zunächst nicht möglich [3,4]. Und das<br />
obwohl Bedarf bei technischer Machbarkeit gegeben ist. Die<br />
Treibhausgasemissionen sind 2009 laut einem Artikel in der<br />
Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 26. September 2011<br />
[5] weltweit um 5,5 % auf 31 Mrd. Tonnen geklettert. Davon<br />
trägt Deutschland allein ca. 960 Mill. Tonnen bei. Diesen<br />
Emissionen stehen geschätzte 930 Mrd. Tonnen Speichervolumen<br />
gegenüber.<br />
CCS-Kette<br />
Die Speicherung ist das letzte Glied der gesamten verfahrenstechnischen<br />
CCS-Kette (Carbon Capture and Storage),<br />
die bei der CO 2<br />
-Abscheidung beim Emittenten beginnt. Teil<br />
dieser Kette ist der Transport des Kohlendioxids vom Ort der<br />
Entstehung, z. B. einem Kraftwerk oder einem Industriebetrieb,<br />
bis zum Ort der Speicherung. Durch den Handel mit<br />
Emissionszertifikaten erfährt das transportierte Kohlendioxid<br />
einen Wert, der bestimmt werden muss. Der Durchschnittspreis<br />
einer EU-Emissionsberechtigung für 1 t CO 2<br />
wird von<br />
2013 bis 2020 bei 28 Euro gesehen [6]. Die zu bestimmende<br />
Messgröße ist die Masse, da die Basiseinheit eines Emissionszertifikates<br />
eine Tonne CO 2<br />
darstellt. Gemäß Monitoring-Leitlinien<br />
ist die Masse des weitergeleiteten CO 2<br />
mit einer<br />
Gesamtmessunsicherheit von 1,5 % zu bestimmen [7].<br />
Es ist davon auszugehen, dass an der gesamten CCS-Prozesskette<br />
unterschiedliche Betreiber beteiligt sein werden.<br />
Dies sind in einem einfachen Fall der Emittent wie ein Kraftwerksbetreiber,<br />
ein Transporteur und ein Speicherbetreiber.<br />
An den Grenzen der Zuständigkeiten der verschiedenen Betreiber<br />
wird ein Wertgut, das transportierte CO 2<br />
übergeben.<br />
Das sind Schnittstellen, an denen die übergebene und transportierte<br />
Menge bestimmt, also gemessen wird. Des Weiteren<br />
ist davon auszugehen, dass dem Transporteur die CO 2<br />
-<br />
Menge nicht gehört. Er erbringt die klassische Transportdienstleistung<br />
(Custody Transfer). Es liegt in seinem Interesse,<br />
die übernommenen und übergebenen Mengen genauestens<br />
zu bestimmen, da er für den mengenabhängigen Transport<br />
bezahlt wird. Darüber hinaus betreibt er eine Pipeline, auf der<br />
der Transport gesteuert werden muss. Dies erfordert eine<br />
Mengenmesstechnik zur Überwachung des Flusses.<br />
Betreiber einer CO 2<br />
-Pipeline halten eine Transportkapazität<br />
vor. Diese wird neben dem Transport vermarktet. Transportkapazitäten<br />
werden gebucht und anstehende Transporte<br />
nominiert. Die Messtechnik dient daher auch dazu, exakt die<br />
bestellten Mengen zu leiten, die später bezahlt werden. Neben<br />
der Messung muss die Menge daher auch (mengen)-geregelt<br />
werden. Damit sind mengengeregelte CO 2<br />
-Druckregel und<br />
Messanlagen entlang der CCS-Transportkette erforderlich.<br />
In einem Beitrag in Heft 1 2011 im Magazin e/m/w [8]<br />
wird die Vision für 2030 von einer CCS-Infrastruktur mit<br />
mehreren angeschlossenen fossilen Kraftwerksblöcken skizziert.<br />
Es ist daher davon auszugehen, dass ein CO 2<br />
-Transporteur<br />
den Anschluss mehrerer Kraftwerke an sein Netz nutzen<br />
möchte, um seine Infrastruktur optimal auslasten zu können.<br />
Dies ist der klassische „Third Party Access“, der in der<br />
Energiebranche hinreichend bekannt ist. Jeder Zugang (Entry-Punkt)<br />
liefert einen Wertstoff in die Prozesskette, der bestimmt<br />
werden muss. Zusätzlich müssen die Gasbeschaffenheiten<br />
quantifiziert werden, da die Begleitstoffe abhängig von<br />
den CO 2<br />
-Abscheideverfahren variieren. Die Komponenten zur<br />
Vermeidung von unzulässigen Drucküberschreitungen in den<br />
angeschlossenen Leitungen und zur Steuerung des Mengenflusses<br />
komplettieren die erforderlichen CO 2<br />
-Mess- und Re-<br />
948 12 / 2011
gelanlagen in einer Weise, die denen der Erdgasinfrastruktur<br />
nahe kommt.<br />
Dies ist aber noch nicht alles bei der erforderlichen Messtechnik.<br />
In der gesamten CCS-Kette kommt dem Speicherbetreiber<br />
eine besondere Rolle zu. Er hat die Aufgabe das CO 2<br />
langfristig zu speichern. Er besitzt in der Regel nicht einen einzigen<br />
Speicher sondern ein Speicherfeld mit unterschiedlichen<br />
Bohrungen. Er muss nachweisen, welche Menge in welchem<br />
Speicherfeld eingeleitet worden ist. Das heißt, er hat an jeder<br />
Injektionspipeline bzw. jeder Bohrung Messtechnik zu installieren,<br />
die ihm die zeitlich und örtlich aufgelöste Auskunft zu<br />
den geflossenen und gespeicherten CO 2<br />
-Mengen gibt.<br />
CO 2<br />
-Transport<br />
Bild 1 zeigt ein einfaches Druck-Temperatur-Phasendiagramm<br />
von reinem CO 2<br />
. Zu sehen ist deutlich die Grenze, die gasförmiges<br />
von flüssigem bzw. dichtem CO 2<br />
trennt. Überlagert<br />
sind dem Diagramm Betriebsbereiche für den Transport des zu<br />
speichernden CO 2<br />
. Die neue Qualität im Unterschied zum Erdgastransport<br />
liegt darin, dass abhängig vom Ort der Transportkette<br />
das CO 2<br />
in unterschiedlichen Phasen vorliegt. Es ist davon<br />
auszugehen, dass z. B. an einem Kraftwerk nach der Abscheidung<br />
das CO 2<br />
gasförmig mit leichtem Überdruck übergeben<br />
wird. Danach wird es vom ersten Verdichter der Transportkette<br />
angesaugt und komprimiert. Die Autoren des Artikels<br />
[8] schlagen einen Transportdruck von 100 bis 140 bar vor.<br />
Es gibt auf Seiten der Energieversorger aber auch Diskussionen<br />
den Transportdruck auf max. 100 bar zu begrenzen, da<br />
er dem MOP in anderen Pipelinetransporten wie z. B. dem des<br />
Erdgases gleicht. Dahinter verbirgt sich die Vermutung, dass<br />
die Begrenzung des Druckes auf weit praktizierte Niveaus auf<br />
größere Akzeptanz aller Beteiligten stößt. Der Transport in der<br />
Pipeline wird aber auf jeden Fall in der dichten Phase stattfinden,<br />
um das transportierte Volumen drastisch zu verringern.<br />
Am Speicher wird der Druck von der Tiefe der Lagerstätte<br />
und der geologischen Formation abhängen. Erforderliche<br />
Injektionsdrücke bis zu 250 bar bei 2500 m geologischer<br />
Tiefe werden berechnet. In Deutschland wird das Potenzial<br />
der Speicherkapazitäten in salinen Aquiferen auf 20 +/- 8<br />
Mrd. Tonnen und in erschöpften Erdgasfeldern auf 2,75 Mrd.<br />
Tonnen CO 2<br />
geschätzt [8]. Da die Lagerstätten überwiegend<br />
in Norddeutschland und Kraftwerke in den Kohlerevieren in<br />
West-, Mittel- und Ostdeutschland liegen, wird von mehren<br />
hunderten von Kilometern Pipeline auszugehen sein.<br />
Derzeit wird die Speicherung im großtechnischen Maßstab<br />
in Europa nur von der Statoil praktiziert. CO 2<br />
wird in die<br />
Öl- und Erdgaslagerstätten Sleipner, Snohvit und Mongstad<br />
in der Nordsee gedrückt. Allein in Snohvit können jährlich bis<br />
zu 700.000 t CO 2<br />
gespeichert werden. Positiver Nebeneffekt<br />
ist, dass CO 2<br />
Erdgas verdrängt und die Erdgasfelder damit<br />
ergiebiger sind (Enhanced Gas Recovery) [4].<br />
Druck [bar]<br />
200<br />
175<br />
150<br />
125<br />
100<br />
75<br />
50<br />
25<br />
1150<br />
1100<br />
1050<br />
1000<br />
Dichte von CO 2 [kg/m 3 ]<br />
950<br />
900<br />
850<br />
800<br />
750<br />
0<br />
-50 -25 0 25 50 75 100 125 150<br />
Temperatur [°C]<br />
700<br />
650<br />
600<br />
CO 2<br />
-Messtechnik<br />
Messanlagen bestimmen an den Betreiber- und Transportschnittstellen<br />
CO 2<br />
-Mengen in gasförmigem und dichtem Zustand.<br />
Um eine Vorstellung von der Anzahl der erforderlichen<br />
Messgeräte zu bekommen, soll folgende Überlegung<br />
hilfreich sein.<br />
Ein mittelgroßes Kohlenkraftwerk mit 500 MW el<br />
produziert<br />
etwa 320 t CO 2<br />
/h. Bei Kosten von 15 Euro pro CO 2<br />
-Zertifikat<br />
und 5.000 Betriebsstunden entspricht dies einem jährlichen<br />
Zusatzaufwand von rund 24 Mio. Euro. Die produzierte<br />
CO 2<br />
-Masse beträgt bei Normaldruck ungefähr 160.000 m³/h<br />
im gasförmigen Zustand. Wird mit ähnlicher Auslegung der<br />
Messstrecken wie beim Erdgastransport gemessen, ist mit<br />
Reservestrecke von 10 erforderlichen Messstrecken bei ca.<br />
2 bar nach der CO 2<br />
-Abscheidung auszugehen. Verlangt der<br />
Betreiber eine redundante Messung mit Dauerreihenschaltung<br />
aus zwei Messgeräten in Serie zur gegenseitigen Überwachung<br />
der Messgeräte sind dies 20 Gaszähler.<br />
In der Transportpipeline wird aus Prozessgründen nach den<br />
Verdichtern bzw. Pumpstationen gemessen werden. Pro Messstation<br />
sind aufgrund des dichten Zustandes des Mediums lediglich<br />
jeweils ein Zähler in der Haupt- und ein Zähler in der Reservestrecke<br />
erforderlich. Bei geforderter Redundanz mit Dauerreihenschaltung<br />
werden vier Zähler pro Messanlage eingebaut.<br />
Zusammen werden in der Mustertransportpipeline damit<br />
zwischen 12 und 24 Mengenmessgeräten betrieben werden.<br />
Vor dem Speicherfeld gilt die gleiche Überlegung. Im Falle<br />
von drei Bohrungen des Speicherfeldes wird bei Redundanz<br />
mit Serienschaltung der Zähler zur gegenseitigen Überwachung<br />
(Dauerreihenschaltung) von 12 Zählern für dichtes<br />
CO 2<br />
auszugehen sein.<br />
„Third Party Access“ eines weiteren Einspeisers mit einer<br />
weiteren Messstation am Entry Punkt wird vernachlässigt.<br />
Das heißt, dass je nach Redundanzanforderung der Beteiligten<br />
in der Muster-CCS-Transportkette von 20 bis 40 Zählern<br />
zur Massebestimmung des Fluides im gasförmigen und<br />
dichten Zustand auszugehen ist.<br />
2010 gab es rund 11.000 Emittenten innerhalb der EU-<br />
27. Davon sind in Deutschland 1.660 und in Großbritannien<br />
1.105 [9,10]. In der 3. EU ETS-Periode ab 2013 wird die Anzahl<br />
größer werden. Gründe sind die Einbeziehung von 100 %<br />
aller Kraftwerksemissionen in den ETS-Handel [8]. Angenommen<br />
der Aufbau der CCS-Kette benötigt 20 Jahre Zeit, um<br />
550<br />
500<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
Betriebsbereiche<br />
Kopf der<br />
Bohrung<br />
Kraftwerksaustritt<br />
Transport<br />
zum Vergleich:<br />
Erdgas-Transport<br />
BILD 1: p-r-T Diagramm von reinem Kohlenstoffdioxid; Messung in<br />
gasförmigem, flüssigem und dichtem CO 2<br />
erforderlich; Vermeidung von<br />
2-Phasengemischen, Phasengrenzen und Dichtesprüngen<br />
12 / 2011 949
Fachbericht<br />
Gasversorgung & Pipelinebau<br />
nur 10 % der europäischen Emittenten zu integrieren, werden<br />
zw. 20.000 und 40.000 CO 2<br />
-Mengenmessgeräte erforderlich<br />
sein. Über 20 Jahre verteilt sind dies 1.000 bis 2.000<br />
jährlich. Etwa die Hälfte misst gasförmiges und die andere<br />
Hälfte dichtes CO 2<br />
.<br />
In Nordamerika gibt es die meiste Erfahrung mit CO 2<br />
-Messungen<br />
in Transportpipelines [11,12]. Dort ist seit Jahren eine<br />
Reihe von CO 2<br />
-Leitungen in Betrieb. I.d.R. handelt es sich um<br />
Custody Transfer Transport, deren Messergebnisse u.a. zu Abrechnungszwecken<br />
genutzt werden. Typisch sind Messblenden<br />
und Turbinen für die Mengenbestimmung. In Europa und insbesondere<br />
in Deutschland liegen keine Erfahrung bei der CCS-<br />
Transportkette mit Custody Transfer Messtechnik vor. Daher<br />
sind viele Fragen zum regulatorischen Umfeld insbesondere<br />
zu den Kalibrationsanforderungen und Einbaubedingungen wie<br />
erforderliche Ein- und Auslauflängen unklar. Dies bedeutet, es<br />
entsteht ein komplett neuer Markt, der für Messgerätehersteller<br />
und Forschungseinrichtungen interessant sein dürfte.<br />
CO 2<br />
-Beschaffenheit<br />
Die ganze obige Diskussion wurde ohne die Beschaffenheit des<br />
abgeschiedenen Kohlendioxids geführt. Beim Stoffstrom aus<br />
dem Kraftwerk handelt es sich im besten Fall um ein CO 2<br />
-reiches<br />
Fluid. Begleitstoffe sind je nach Abscheideverfahren insbesondere<br />
Wasser, Stickstoff und Sauerstoff. Zum Schutz der<br />
Pipeline vor Korrosionsangriffen wird der Transporteur auf die<br />
Trocknung des Fluides Wert legen. Dabei werden Wasserbestandteile<br />
unter 150 ppm angestrebt. Gasbegleitstoffe verändern<br />
in geringen Konzentrationen das Phasenverhalten. So<br />
kann z. B. die Phasengrenze zwischen gasförmigem und flüssigem<br />
Medium bereits bei 2 % Stickstoff deutlich um mehrere<br />
bar nach oben verschoben werden [13]. Darüber hinaus<br />
weitet sich die Phasengrenze zu einem Zweiphasengebiet auf.<br />
Mit schwankenden oder ansteigenden Konzentrationen der<br />
Begleitstoffe muss schon bei hohen Lastgradienten wie im Fall<br />
des An- und Abfahren des Kraftwerkes gerechnet werden. Des<br />
Weiteren ist im Teillastbetrieb die Konzentration der Gasbegleitstoffe<br />
höher. Beim Verschieben der Phasengrenze in den<br />
Messbereich kann das Messgerät signifikant gestört werden.<br />
I.d.R. sind Mehrphasengemische zu vermeiden, um hohe Messgenauigkeiten<br />
zu bekommen. Bei der Vernetzung der CCS-<br />
Transportinfrastruktur werden unterschiedlich beschaffene<br />
CO 2<br />
-reiche Massenströme gemischt. Welche Auswirkungen<br />
dies auf das Phasenverhalten und möglicherweise auf Messgeräte<br />
hat, bedarf noch intensiver Untersuchung. Aus diesem<br />
Grunde kommt der Gasbeschaffenheitsbestimmung besondere<br />
Bedeutung zu.<br />
CO 2<br />
-Messanlagen<br />
Es gibt eine Reihe von dokumentierten Beispielen in der Literatur<br />
für den Aufbau von CO 2<br />
-Mess- (und Regel-) -anlagen<br />
[11,12]. Grundsätzlich gleicht der Aufbau den Erdgas-Anlagen.<br />
Es sind z.T. automatisierte Ein- bzw. Ausgangsarmaturen, Filter,<br />
Messstrecken und, falls erforderlich, Regelstrecken vorgesehen.<br />
Je nach Redundanzanforderungen kann die Messstrecke<br />
aus einem einzigen oder zwei Zählern in Serie als Dauerreihenschaltungen<br />
bestehen. Aus Gründen der Verfügbarkeit<br />
sollte auch eine Reservestrecke geplant werden, da dann auch<br />
im Falle einer Wartung der Transport aufrechterhalten werden<br />
kann. Aus betrieblichen Überwachungsgründen werden sämtliche<br />
Anlagenteile überflur aufgebaut. Beim Boden-Luftübergang<br />
sollten aus Gründen des aktiven Korrosionsschutzes der Pipeline<br />
Isoliertrennstellen liegen, bei denen das Oberteil noch einsehbar<br />
ist. Entwürfe solcher Anlagen zeigen Bild 2 und Bild 3.<br />
Unterscheiden sich die Druckstufen, bedarf es Sicherheitsabsperreinrichtungen<br />
(SAE). Die Druckfestigkeitsgrenze<br />
BILD 2: CO 2<br />
mengengeregelte Mess- und Regelanlage mit folgenden Eigenschaften:<br />
−<br />
−−reinen Messanlagen fehlt die Regelstrecke<br />
−<br />
−<br />
−−Druckstufentrennung unter Berücksichtigung der Prozesskette<br />
−<br />
− grundsätzlich gleicher Anlagenaufbau für gasförmige, flüssige und dichte Phase<br />
− Automation, Leit- und Fernwirktechnik, Fernüberwachung und Energietechnik wie bei Erdgas-Anlagen<br />
− Konzept der technischen Betriebssicherheit abgestimmt auf CO 2<br />
(nicht brennbar, geruchlos, schwerer als Luft)<br />
− Automatische Entspannungsmöglichkeiten in allen absperrbaren Teilabschnitten („Fail Safe“)<br />
950 12 / 2011
BILD 3: Redundanzkonzept einer CO 2<br />
mengengeregelten Mess- und Regelanlage:<br />
−<br />
−−zwei Sicherheitsabsperrventile<br />
−−Betriebs- und Reservestrecke(n)<br />
− Dauerreihenschaltung von Zählern zur permanenten Überwachung des Abrechnungszählers (Wert der transportierten Menge)<br />
sollte erst an der nächsten vordruckfesten Armatur nach der<br />
Regelstrecke liegen. Bei SAE ist aber schon darauf zu achten,<br />
dass bei Schnellschluss von Armaturen der sog. „Hammer-<br />
Schlag“ um ein vielfaches höher ausfallen kann als beim Erdgas.<br />
Bei dichten bzw. flüssigen CO 2<br />
ist dieses Phänomen signifikant<br />
größer. Eine unzulässige MIP-Überschreitung kann da-<br />
Literatur<br />
[1] Effizienz der CO 2<br />
-Trennung und –Speicherung macht Fortschritte:<br />
VDI Nachrichten, Nr. 28/29 vom 15.7.2011, S. 19<br />
[2] Länder stoppen Speicherung von Kohlendioxid, Frankfurter<br />
Allgemeine Zeitung vom 24.9.2011, S. 13<br />
[3] M. Stabenow: Die letzte Ruhestätte für Kohlendioxid,<br />
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 6.8.2011, S. 17<br />
[4] Statoil: Underground storage of carbon dioxide – Emission<br />
mitigation which counts, Firmenbroschüre, Nov. 2009,<br />
www.statoil.com<br />
[5] A. Mihm: Das Geschäft mit den Emissionsrechten, Frankfurter<br />
Allgemeine Zeitung vom 26.9.2011, S. 16<br />
[6] Unternehmen blicken mit Unbehagen auf die CO 2<br />
-Handelsperiode<br />
ab 2013, VDI Nachrichten, 9.9.2011, S. 11<br />
[7] Studie zur CO 2<br />
-Gasmengenmesstechnik der Physikalisch<br />
Technischen Bundesanstalt für E.ON Ruhrgas vom<br />
29.8.2011<br />
[8] C. Linden, A. Holder und R. Rümler: CO2-Transport und<br />
Speicherkosten für Carbon Capture & Storage, e/m/w,<br />
Heft 1/11, Seite 52-55<br />
[9] Deutscher CO 2<br />
-Handel treibt Klimaschutz voran: VDI<br />
Nachrichten, Nr. 21 vom 22.5.2009, S. 9<br />
[10] CO 2<br />
-Handel darf auf Wachstum setzen: VDI Nachrichten,<br />
Nr. 20 vom 21.5.2010, S. 11<br />
[11] M. Mohitpour, H. Golshan und A. Murray: Pipeline Design<br />
& Construction, The American Society of Mechanical Engineers,<br />
ASME press, New York, 2007, Seite 590-613<br />
[12] G.W. Marsden und D.G.Wolter: Pipeline measurement of<br />
supercritical carbon dioxide, in Pipeline Rules of Thumb<br />
Handbook, E.W. McAllister, Gulf Professional Publishing/<br />
Elsevier, Burlington, 2009, Seite 523-529<br />
[13] P. Seevam, Newcastle University, Presentation to IEA Summer<br />
School, 2008<br />
her drohen. Eventuell ist auf die Begrenzung der Verschlusszeiten<br />
zu achten und/oder ein deutlich höherer DP als MOP.<br />
Ein weiterer sicherheitsrelevanter Unterschied zum Erdgas<br />
stellt die höhere Dichte von CO 2<br />
dar. Beim Austritt von<br />
CO 2<br />
sinkt die Menge zu Boden. Hier muss eine ausreichende<br />
Belüftung sichergestellt werden. Z. B. kann die Anlage erhöht<br />
auf tragfähigen Gitterrosten stehen, um eine für Personen<br />
gefahrlose Ableitung von CO 2<br />
-Mengen zu gewährleisten. Ein<br />
weiterer Unterschied zum Erdgas besteht darin, dass dichtes<br />
CO 2<br />
so gut wie nicht weiter komprimiert werden kann. Geringe<br />
Temperaturunterschiede lassen daher den Druck in abgeschlossenen<br />
Abschnitten der Anlage erheblich ansteigen. Daher<br />
sollte jeder absperrbare Abschnitt der Anlage mit Sicherheitsabblaseeinrichtungen<br />
versehen werden, um unzulässige<br />
Drucküberschreitungen zu vermeiden. Zur Vermeidung von<br />
Trockeneisbildung und/oder Hydraten sollte eine Vorwärmung<br />
der sicherheitsrelevanten Funktionsleitungen wie Ausbläser in<br />
Betracht gezogen werden.<br />
Generell soll an dieser Stelle darauf verwiesen werden,<br />
dass die Auslegung insbesondere der integritätsrelevanten<br />
Bestandteile der Anlage einer Gefährdungsanalyse des Betreibers<br />
vorbehalten ist. Der fehlende gesetzliche Rahmen für die<br />
CCS-Technik in Deutschland wird aber generell Fortschritte in<br />
der Technologieentwicklung und die Gestaltung eines technischen<br />
Regelwerkes hierzulande weiter hemmen. Die hieraus<br />
mangelnde Erfahrung potenzieller Deutscher CCS-Infrastrukturbetreiber<br />
wird daher nur über Dritte z. B. europäische<br />
Partner kompensierbar sein.<br />
Autor<br />
Dr. Klaus Steiner<br />
E.ON Ruhrgas AG, Essen<br />
Tel. +49 201 184 8052<br />
klaus.steiner@eon-ruhrgas.com<br />
12 / 2011 951
Fachbericht<br />
Gasversorgung & Pipelinebau<br />
Experimentelle Untersuchung<br />
der PE-Werksumhüllung einer<br />
erdverlegten Erdgasfernleitung<br />
unter sicherheitstechnischen<br />
Aspekten<br />
Von Sebastian Rolwers, Bernd-Andre Stratmann und Urs Pedrazza<br />
Die heutigen Einbettungsmethoden von Gashochdruckleitungen aus Stahl orientieren sich vornehmlich an den mechanischen<br />
Eigenschaften der schützenden PE-Umhüllung. Um mögliche mechanische Sicherheitsreserven der PE-<br />
Umhüllung aufzudecken, wurden Untersuchungen mit anspruchsvollen Einbettungsmaterialien durchgeführt. Hierzu<br />
wurden im Institut für Rohrleitungsbau (iro) auf Initiative der WINGAS Transport GmbH Szenarien nachgestellt, die<br />
einem Ausnahmezustand (worst case) entsprachen. Es wurde gezeigt, dass nur wenn sich im schlechtesten Fall das<br />
Rohr im Zentimeterbereich bewegt, die isolierende Wirkung der Polyethylenumhüllung nicht mehr gegeben ist.<br />
In Zusammenarbeit zwischen dem Institut für Rohrleitungsbau<br />
(iro) und der WINGAS Transport GmbH wurden werksumhüllte<br />
Rohrbleche DN 1400 30 cm x 30 cm (Stahldicke 22,3<br />
mm) auf realen Bodenproben untersucht. Die Bodenproben<br />
aus dem Trassenverlauf der OPAL dienten als Referenzobjekt,<br />
die tatsächliche Einbettung der Leitung wurde regelkonform<br />
nach den einschlägigen Normen und Richtlinien ausgeführt.<br />
Es sollten im Versuch Situationen simuliert werden, die ein<br />
mögliches Versagen der Schutzmaßnahmen der PE-Umhüllung<br />
darstellten. Bei diesem Untersuchungsprogramm wurde<br />
die Werksumhüllung der Pipeline nur über relativ kurze Zeiträume<br />
(Wochen) betrachtet.<br />
Die stärkste mechanisch schädigende Beeinflussung erfährt<br />
die Polyethylen-Umhüllung einer Ferngasleitung in der<br />
Regel während der Bauphase, insbesondere während der<br />
Stressdruckprüfung {Ref. VdTÜV 1060} und hier vor allem<br />
Bild 1: Bodenproben entlang der OPAL-Trasse<br />
an den Prüfabschnittsenden. Zusammen mit der statischen<br />
Wassergewichtsbelastung - im Falle der OPAL rund 1,5 Tonnen<br />
pro Laufmeter Leitung - beansprucht vor allem die dabei<br />
auftretende axiale Verschiebung die Umhüllung. Die stärkste<br />
thermische Beeinflussung hingegen tritt in der Regel hinter<br />
Verdichterstationen auf, während des regulären Betriebes<br />
der Ferngasleitung.<br />
Diese beiden Haupteinflüsse, mechanische und thermische<br />
Beeinflussung, wurden auf Versuchständen am iro nachgebildet.<br />
Die Bodenproben wurden erst im Labor für Bodenmechanik<br />
an der Jade Hochschule in Oldenburg gemäß<br />
DIN 18196 analysiert und bestimmt. Die Bandbreite der verwendeten<br />
Bodenproben erstreckte sich, wie in Bild 1 dargestellt,<br />
vom schluffigen Kies bis hin zum gebrochenen Fels. Die<br />
Bodenproben entstammten der Leitungstrasse der OPAL im<br />
Bereich des Erzgebirges. Hierbei handelt es sich teilweise um<br />
ausgehobenen Fels, der mit einem Walzenbrecher auf Größe<br />
gebracht wurde. Auch diese gebrochenen Böden weisen einen<br />
hohen Feinanteil auf.<br />
Der auf der OPAL maximal gemessene Wert der Längsverschiebung<br />
des Rohrstrangs betrug 25,3 cm bei einer<br />
Druckerhöhung auf 186,0 bar. Die dabei gefahrenen Verschiebegeschwindigkeiten<br />
errechneten sich aus exemplarischen<br />
Drucksteigerungs- und Druckablasszeiträumen gemäß<br />
VdTÜV 1060. Die für die Versuche in der iro-Forschungshalle<br />
verwendeten Prüfsegmente wurden aus OPAL-Pipelinerohren<br />
herausgeschnitten und der Ist-Zustand aufgezeichnet<br />
(Gipsabdrücke, Fotographien, Schraffuren). Die Dicke der<br />
PE-Umhüllung über alle Segmente betrug 4,3 ± 0,46 mm. Die<br />
Segmente wurden vor und nach jedem Versuch einer Hochspannungsdurchschlagsprüfung<br />
unterzogen (25 kV gemäß<br />
DIN 30670).<br />
952 12 / 2011
Tabelle 1: Versuchsarten<br />
Versuchsreihen<br />
Die OPAL-Rohrsegmentstücke wurden in modifizierten Scheiteldruckversuchsständen<br />
belastet, vgl. Bild 2.<br />
Für die Nachbildung der verschiedenen Einwirkungen<br />
wurden insgesamt fünf Belastungsfälle erstellt. In Tabelle 1<br />
werden die verschiedenen Versuche aufgeführt und kurz erläutert.<br />
Für alle Versuche bis auf den unterfütterten Einbettungsversuch<br />
(EV) gilt der in Bild 2 aufgeführte Grundaufbau<br />
in Bezug auf die Lastaufbringung sowie -einleitung.<br />
Für den axialen EV und dem unterfütterten EV wurden<br />
die Versuchsstände entsprechend erweitert. Die mechanische<br />
Belastung der Versuche, ausgenommen des thermischen<br />
und überhöhten Einbettversuches, betrug 6,0 kN pro Versuchsstand.<br />
Die Dauer der Versuche betrug mindestens zwei Wochen,<br />
entsprechend der durchschnittlichen Verweildauer des Wassers<br />
während der Stressdruckprüfung. Der überhöhte Versuch<br />
dauerte acht Wochen.<br />
Der thermische Einbettungsversuch diente zur Nachbildung<br />
der erhöhten Temperatur hinter einer Verdichterstation<br />
während des regulären Betriebes. Entsprechend ist die Last<br />
auf 4,4 kN vermindert worden (Wegfall der Wasserlast). Hier<br />
wurde in einem ersten Durchgang für einen Zeitraum von zwei<br />
Wochen bei 40 °C und in einem weiteren Durchgang für fünf<br />
Tage bei 44 °C belastet. Dieser Versuch fand in einer eigens<br />
dafür konstruierten Klimakammer statt, welche konstante<br />
Temperaturen gewährleistete.<br />
Beim axialen EV wurde zur Simulation der Längenänderung<br />
während der Stressdruckprüfung eine verschiebbare<br />
Probenaufnahme konstruiert. Der in Bild 3 dargestellte Versuchsaufbau<br />
lässt erkennen, dass die Bodenprobe unter dem<br />
eingespannten Segment bewegt wird. Diese axiale Verschiebung<br />
wurde nach Setzung der Probe eingeleitet.<br />
Versuch<br />
realer Einbettungsversuch<br />
(EV)<br />
überhöhter EV<br />
thermischer EV<br />
axialer EV<br />
Bodenproben<br />
Beschreibung<br />
9 Proben Bildet statisch die Gewichtsbelastung nach, die<br />
während der Stressdruckprüfung einwirkt<br />
5 Proben<br />
(2 Proben)*<br />
1 Probe<br />
(1 Probe)*<br />
3 Proben<br />
(2 Proben)*<br />
Stellt eine überdurchschnittliche Belastung nach,<br />
die sich an der maximalen Belastungsfähigkeit der<br />
Versuchsstände orientiert<br />
Belastung unter erhöhter Temperatur, wie sie<br />
hinter Verdichterstationen während des regulären<br />
Betriebes vorkommt<br />
Simuliert Verschiebungen während der Stressdruckprüfung<br />
* = „work in progress“ weiterführende Langzeitversuche werden derzeit im iro<br />
durchgeführt<br />
Ergebnisse der Testreihen<br />
Die Polyethylenumhüllung hielt den statischen Versuchen<br />
ausnahmslos stand. Die dabei erzeugten maximalen Eindringungen<br />
einzelner Steine und Bodenkörner sind in Bild 4 anhand<br />
des realen Einbettungsversuches exemplarisch aufgeführt.<br />
Auch haben sich bei einer überhöhten Belastung die Eindringungen<br />
nur leicht erhöht, jedoch einen Wert von 1 mm<br />
nicht überschritten.<br />
Der Vergleich des thermischen EV mit dem realen EV, wie<br />
in Bild 5 dargestellt, hat gezeigt, dass die mittlere Tiefe der<br />
Beschädigungen größer war als die des realen Einbettungsversuches.<br />
Jedoch ist die beim thermischen EV gemessene Eindringtiefe<br />
höher. Wird die geringere Krafteinwirkung infolge<br />
der nicht vorhandenen Wasserfüllung berücksichtigt, so kann<br />
gezeigt werden, dass die Widerstandsfähigkeit der PE-Umhüllung<br />
gegen mechanische Einwirkungen unter Erhöhung der<br />
Temperatur deutlich abnimmt. Bei einem erneuten Versuch<br />
konnte bei der doppelten Belastungsdauer eine proportionale<br />
Vergrößerung der Eindringung festgestellt werden. Innerhalb<br />
des Betrachtungszeitraumes von vier Wochen stellte sich nach<br />
zwei Wochen eine maximale Eindringung von 0,24 mm ein,<br />
die bis zur Beendigung des Zeitraumes auf 0,49 mm anstieg.<br />
Bild 2: Modifizierter Scheiteldruckversuchstand<br />
Bild 3: Versuchsstand zur axialen Verschiebung<br />
12 / 2011 953
Fachbericht<br />
Gasversorgung & Pipelinebau<br />
Bei allen durchgeführten Versuchen führte einzig der axiale<br />
EV zu einem Versagen des passiven Korrosionsschutzes<br />
während des Untersuchungszeitraums. Die bei diesem Versuch<br />
entstandenen Beschädigungen waren nicht punktuell,<br />
sondern erstreckten sich stellenweise schlitzartig über das<br />
gesamte Segment. Die hierbei entstandenen Eindringungen<br />
gingen bis auf den Rohrstahl und führten zur Aufhebung des<br />
Schutzes.<br />
Fazit<br />
Zielstellung der Untersuchungen war es, Aussagen über die<br />
Auswirkungen von realen Einbettungsmaterialien auf die PE-<br />
Umhüllung einer Pipeline zu treffen. Die durchgeführten Versuche<br />
zeigten, dass eine Belastungsauswirkung ohne axiale<br />
Rohrverschiebung bei jeder untersuchten Bodenprobe zu<br />
keinem direkten Versagen der PE-Umhüllung führte. Selbst<br />
eine überhöhte Belastung der Segmente um das 5,3-fache<br />
der real auftretenden Belastung und einer Verlängerung der<br />
Versuchsdauer von zwei auf acht Wochen ergab im Rahmen<br />
der Untersuchung bei keiner Bodenprobe einen Spannungsdurchschlag<br />
bei 25 kV durch die Umhüllung.<br />
Bild 4: Eindringtiefen realer EV<br />
Der Vergleich zwischen dem realen Einbettungsversuch<br />
und dem Einbettungsversuch unter erhöhter Temperatur hat<br />
gezeigt, dass eine Temperaturerhöhung höhere Eindringtiefen<br />
mit sich bringt. Eine solche Erhöhung der Temperatur ist<br />
jedoch nur beim Stationsausgang von Verdichteranlagen zu<br />
beobachten.<br />
Fakten zur OPAL/ NEL<br />
Deutschland und Europa werden über die Nord-Stream-<br />
Pipeline mit den sibirischen Erdgasvorkommen verbunden.<br />
Landseitig wurde im Herbst 2009 mit dem Bau der<br />
Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung, kurz OPAL, begonnen,<br />
welche im Herbst 2011 kommerziell in Betrieb ging.<br />
Seit Frühjahr 2011 wird die zweite Anbindungsleitung der<br />
Nord Stream, die Nordeuropäische Erdgasleitung gebaut.<br />
Bislang gab es in Deutschland kein vergleichbares Infrastrukturprojekt<br />
in dieser Größenordnung. Beide Leitungen<br />
übernehmen das Erdgas aus der Nord Stream an<br />
der Anlandestation in Lubmin bei Greifswald. Die OPAL,<br />
die hier im Fokus stehen soll, verläuft 470 Kilometer in<br />
Richtung Süden. Zwischen Lubmin bei Greifswald und<br />
dem Zielpunkt Brandov im Erzgebierge kurz hinter der<br />
deutsch-tschechischen Grenze überwindet die Leitung<br />
eine Höhendifferenz von 700 Metern. Die Strecke führt<br />
insgesamt durch drei Bundesländer. Mit einem Rohrdurchmesser<br />
von DN 1400 ist die OPAL somit die erste<br />
56"-Leitung, die in Deutschland in dieser Druckstufe verlegt<br />
wurde. Der spätere Betriebsdruck der Leitung beträgt<br />
bis zu 100 bar. Über die gesamte Rohrleitungslänge<br />
wurden rund 27.000 Rohre zur Erstellung der Pipeline<br />
verbaut. Die Rohre haben eine durchschnittliche Länge<br />
von 18 Metern bei einem Gewicht von rund 15 Tonnen.<br />
Daraus resultiert ein späteres Gesamtgewicht des Rohrstranges<br />
von mehr als 400.000 Tonnen. Ein Rohr dieser<br />
Größe ist rund doppelt so schwer wie ein Rohr DN 1200.<br />
Diese 56"-Leitungen sind bis dato die größten Transportleitungen<br />
in Deutschland.<br />
Bild 5: Vergleich der Eindringtiefen thermischer EV/ realer EV<br />
Bild: Bau der OPAL, Absenken des Rohrstrangs<br />
954 12 / 2011
Tabelle 2: Bodenproben<br />
Einzig beim axialen Einbettungsversuch wurden Hochspannungs-Durchschläge<br />
beobachtet, die auf die scharfkantig<br />
gebrochenen Bestandteile der Bodenprobe zurückzuführen<br />
waren. Allerdings dürfen diese Böden nach einschlägigen<br />
Normen und Empfehlungen zusammen mit geeigneten<br />
Schutzmaßnahmen durchaus als Füllboden für die<br />
Rohrumgebung eingesetzt werden. Axiale Verschiebungen<br />
des Rohrstranges im Zentimeterbereich treten nur an den<br />
Druckprüfungsabschnittsenden auf. Dadurch entsteht je<br />
nach Bodenprobe unter Umständen eine höhere Gefährdung<br />
der Rohrumhüllung, die zum Beispiel im Falle eines intermittierenden<br />
Kies - Sandgemisches (BP 008, GI) in etwa<br />
dem 15-fachen des realen Einbettungsversuches entsprach.<br />
Kann eine Bewegung im Zentimeter-Bereich ausgeschlossen<br />
werden, können alle geprüften Einbettungsmaterialien<br />
ohne zusätzliche mechanische Schutzmaßnahmen<br />
eingesetzt werden.<br />
BP 001<br />
BP 002<br />
BP 003<br />
BP 004<br />
BP 005<br />
BP 006<br />
BP 007<br />
BP 008<br />
BP 009<br />
Autoren<br />
intermittierend gestufter Kies-Sand (GI)<br />
intermittierend gestufter Kies-Sand (GI)<br />
eng gestufter Kies (GE)<br />
weit gestufter Kies (GW)<br />
eng gestufter Kies (GE)<br />
weit gestufter Kies (GW)<br />
weit gestufter Kies (GW)<br />
intermittierend gestufter Kies-Sand (GI)<br />
eng gestufter Kies (GE)<br />
B. Eng. Sebastian Rolwers<br />
iro GmbH Oldenburg, Oldenburg<br />
Tel. +49 441 36 10 39 0<br />
E-Mail: rolwers@iro-online.de<br />
Ausblick<br />
Da die in den Untersuchungen angesetzten Prüfzeiten nur den<br />
ersten Teil der Lebensdauer einer Pipeline abdeckten, wurden<br />
als erste theoretische Langzeitabschätzung, Langzeitkriechdaten<br />
der Isolierung herangezogen.<br />
Es kann grob abgeschätzt werden, dass die Beschädigungstiefen<br />
in der Rohrumhüllung am Ende der Leitungslebensdauer<br />
um höchsten den Faktor 10 ansteigen. Diese<br />
Aussage wird insbesondere dadurch bestärkt, dass nach der<br />
Durchführung der Stressdruckprüfung die Gewichtsbelastung<br />
nur noch zwei Drittel der Ausgangssituation entspricht.<br />
Durchschläge sind somit nicht zu erwarten.<br />
Diese erste Abschätzung wird zurzeit in unserem Labor<br />
durch experimentelle Langzeitversuche verifiziert.<br />
B. Eng. Bernd-Andre Stratmann<br />
iro GmbH Oldenburg, Oldenburg<br />
Tel. +49 441 36 10 39 0<br />
E-Mail: stratmann@iro-online.de<br />
Dr. Urs Pedrazza<br />
WINGAS Transport GmbH, Kassel<br />
E-Mail: urs.pedrazza@wingas-transport.de<br />
… verbindet die Märkte<br />
10 / 2010 955<br />
12 / 2011 955
Projekt kurz beleuchtet<br />
Gasversorgung & Pipelinebau<br />
Aktuelles vom NEL-Pipelinebau<br />
Querungen von Verkehrswegen im<br />
dynamischen Rammverfahren<br />
Spezialist für das dynamische<br />
Rammverfahren<br />
Über die Nordeuropäische Erdgasleitung NEL der WinGas,<br />
Kassel wird das aus Russland kommende Erdgas in Deutschland<br />
und Nordwesteuropa verteilt. Der Erdgasspeicher Rheden<br />
ist Endpunkt der aus Lubmin kommenden Erdgaspipeline.<br />
Auf der über 440 km langen Trasse durch den Norden<br />
Deutschlands sind unzählige Straßen, Flüsse und Bahnlinien<br />
zu unterqueren. Den Auftrag für zwei Baulose mit insgesamt<br />
120 km Länge erhielt die Firma Bonatti S.p.A. aus Parma, Italien.<br />
In dessen Rahmen wurden von der renommierten Firma<br />
DALCAI HORIZONTALE WEGBORINGEN BV, einem Spezialunternehmen<br />
für horizontale Vortriebstechnik aus Nijverdal,<br />
Niederlande, drei Straßenquerungen mit dem dynamischen<br />
Rammverfahren ausgeführt.<br />
DALCAI hat sich bereits 1999 auf den dynamischen<br />
Rammvortrieb im Pipelinebau spezialisiert. Allein in den letzten<br />
zwei Jahren hat DALCAI mehr als 11 km Pipeline-Stahlrohre<br />
mit den druckluftbetriebenen Stahlrohrrammen vorgetrieben<br />
und verfügt über umfangreiche Erfahrungen, ent-<br />
sprechendes Know-How sowie Routine in der Abwicklung<br />
von Baustellen dieser Art. Der Geschäftsführer von DALCAI,<br />
Jan Willem Dalvoorde, ergänzt: „Der Einsatzerfolg hängt aber<br />
auch von der Maschinentechnik ab. Die Rammen müssen<br />
enormen Belastungen standhalten, wenn man bedenkt, dass<br />
die weltweit stärkste Ramme APOLLO eine Einzelschlagenergie<br />
bis über 40.500 Nm erzeugt.“<br />
Drei StraSSenquerungen in drei<br />
Arbeitstagen<br />
Die drei Straßenquerungen befanden sich der Nähe der A 24<br />
in Mecklenburg-Vorpommern, ca. 80 km östlich von Hamburg:<br />
in Perdöhl mit 34 m Länge, in Albertinenhof, mit 40 m<br />
Länge sowie in Schwartow mit 44 m Länge.<br />
Die Entscheidung fiel für den dynamischen Rammvortrieb,<br />
weil damit schneller und kostengünstiger, als mit einem<br />
Bohrpressvortrieb mit Schneckenräumung gearbeitet werden<br />
kann. Der Rammvortrieb kommt ohne Presswiderlager<br />
und schweren Pressrahmen aus, ist richtungsstabil und auch<br />
BILD 1: Die<br />
Ramme wird in<br />
Position gebracht<br />
956 12 / 2011
ei geringer Überdeckung einsetzbar. Der vorab verschweißte<br />
Rohrstrang kann mit einer Vortriebsgeschwindigkeit bis<br />
zu 10 m/h vorgetrieben werden, so dass eine Straßenquerung<br />
pro Arbeitstag ausgeführt werden konnte. Demgegenüber<br />
stehen kalkulierte fünf bis sieben Arbeitstage für einen<br />
Bohrpressvortrieb, da nur jeweils Einzelrohre vorgepresst<br />
werden können.<br />
Entgegen den im offenen Graben verlegten PE-umhüllten<br />
Stahlrohren (Ø 1420 x 22,7 mm) sind für die Straßenquerung<br />
Stahlrohre mit einer Glasfaserumhüllung vorgesehen.<br />
Drei Rohrlängen von je 18 m Länge wurden miteinander<br />
verschweißt, einer ersten Druckprüfung unterzogen<br />
und anschließend mit den vor Ort stationierten Rohrleger<br />
auf das sorgfältig austarierte Planum der Grabensohle gelegt.<br />
DALCAI setzte den Rammtyp APOLLO mit einer Schlagenergie<br />
von 40.500 Nm ein. Die Druckluftversorgung stellten<br />
zwei Kompressoren mit 63 m 3 und 45 m 3 Luftfördermenge<br />
sicher. Standard beim Einsatz sind sogenannte<br />
Schlagsegmente, die verhindern, dass sich die Produktrohre<br />
während des Vortriebs aufbördeln und die Rohre nach dem<br />
Vortrieb einwandfrei Stoß an Stoß verschweißt werden können.<br />
Zudem wird die Schlagenergie durch die Form der<br />
Schlagsegmente gleichmäßig in den Rohrstrang eingeleitet.<br />
Die vierteiligen Segmente sind rasch installiert und fixiert.<br />
Zeitgleich wurden zwei PE-HD-Rohre DN 125 in einer Vorrichtung<br />
am Stahlrohr fixiert. Die Rohre werden mit dem<br />
Stahlrohr vorgetrieben und als Leerrohr und für das Steuerkabel<br />
genutzt.<br />
Anschließend wurde der APOLLO positioniert und die<br />
Druckluftversorgung hergestellt. Danach begann der sukzessive<br />
Vortrieb des Rohrstrangs. Der Schneidschuh auf<br />
dem vorderen ersten Rohr verstärkt und schützt die Rohrwandung<br />
beim Vortrieb und vermindert die auf die<br />
Rohroberfläche einwirkende Mantelreibung. Im kompakten<br />
Sandboden war die Mantelreibung zeitweise trotzdem extrem<br />
stark. Dennoch verlief der Vortrieb reibungslos. Die<br />
andere Straßenseite der mit uralten Eichenbäumen gesäumten<br />
Allee erreichte der Rohrstrang nach nur 2,5 Stunden.<br />
Damit war der eigentliche Vortrieb beendet.<br />
Nun folgte die Abrüstung und der Abtransport von Ramme<br />
und Kompressoren zur nächsten Baustelle und der<br />
Hochdruck-Spülwagen mit 20 m 3 Fassungsvermögen kam<br />
zum Einsatz, um den Erdkern aus dem Rohr zu entfernen.<br />
Ein Spülbohrkopf bohrte sich in Teilschritten in den Erdkern<br />
vor und spülte beim Rückzug den Sandboden aus dem Rohr<br />
heraus. Mit der anschließenden weiteren Druckprüfung des<br />
verlegten Rohrstranges war die Maßnahme abgeschlossen.<br />
Alle drei Vortriebe wurden innerhalb von drei aufeinander<br />
folgenden Arbeitstagen abgeschlossen, da der Arbeitsablauf<br />
vorbildlich koordiniert war und trotz der Vielsprachigkeit<br />
(italienisch, deutsch und holländisch) routiniert ablief.<br />
BILD 2: Der<br />
Vortrieb beginnt –<br />
nach nur 2,5<br />
Stunden war die<br />
Rammung beendet<br />
BILD 3: Die Entleerung des Stahlrohres mit 1,40 m Durchmesser<br />
erfolgt mit einem speziellen Spülbohrkopf<br />
Kontakt<br />
www.dalcai.nl<br />
BILD 4: Hermen Jan und Jan Willem Dalvoorde vor Ort im Gespräch<br />
mit Günter Naujoks<br />
12 / 2011 957
Projekt kurz beleuchtet<br />
Gasversorgung & Pipelinebau<br />
Ertüchtigung der Gas-Druckregelund<br />
Messanlage des Werks<br />
Dow Stade<br />
Hintergrund<br />
Das Werk Dow Stade zählt zu den größten und wirtschaftlich<br />
bedeutendsten Industriebetrieben in Niedersachsen.<br />
Seit Inbetriebnahme des Werks im Jahr 1972 werden in Stade<br />
– einem von rund 20 deutschen Standorten des USamerikanischen<br />
Chemiekonzerns Dow Chemical – Epoxidharze,<br />
synthetisches Glycerin sowie weitere 20 Chemie-<br />
Produkte zur Weiterverarbeitung für die Automobil-, Elektro-,<br />
Bau- und Konsumgüterindustrie hergestellt. Die Erdgasversorgung<br />
des rund 550 Hektar großen Werksgeländes<br />
wird durch Gasunie Deutschland als Netzbetreiber gewährleistet<br />
und erfolgt über eine Gas-Druckregel- und Messanlage<br />
(GDRM), die von der Dow Deutschland Anlagengesellschaft<br />
mbH betrieben wird. Bei der in diesem Jahr abgeschlossenen<br />
Ertüchtigung der GDRM hatte die Projekthaus<br />
GmbH, ein Beratungs- und Planungsunternehmen für<br />
die Energiebranche, die technische Projektleitung inne. Das<br />
Bremer Unternehmen unterstützt seit 1997 Firmen bei der<br />
Konzeption, Koordination und Umsetzung von Projekten –<br />
darunter Ingenieur- und Planungsleistungen für GDRM sowie<br />
Biogaseinspeiseanlagen.<br />
Umfangreiche ErtüCHTIGUNGSmaSSnahmen<br />
notwendig<br />
Die GDRM des Werks Dow Stade, seit Mitte der 1980er Jahre<br />
in Betrieb, verfügt über zwei Druckreduzierungen: Die erste<br />
regelt den Eingangsdruck auf einen Ausgangsdruck für den<br />
Turbinenbetrieb von 40 bar. Die zweite Druckregelung reduziert<br />
den Druck für die Werksversorgung von 40 auf 15 bar.<br />
Zu Abrechnungszwecken wird die Gaszusammensetzung mittels<br />
Prozess-Gas-Chromatograph analysiert und über Turbinenradgaszähler<br />
der Gasdurchsatz gemessen.<br />
„Die für das Jahr 2010 anstehende Wartung und Instandhaltung<br />
der Regelgeräte der ersten Druckreduzierung<br />
konnten nicht durchgeführt werden, da für diese Bauteile<br />
keine Ersatzteile mehr am Markt verfügbar waren. Dow beschloss<br />
deshalb, nicht nur die Regelgeräte zu erneuern, sondern<br />
eine Reihe weiterer wesentlicher Ertüchtigungsmaßnahmen<br />
an der GDRM durchzuführen“, berichtet Helmut<br />
Tiedemann, Projektleiter bei Dow. Und Dow-Projektmanager<br />
Marco Süß ergänzt: „In diesem Zusammenhang bot es<br />
sich an, die Kesselanlage und die E-/EMSR-Technik ebenfalls<br />
zu modernisieren.“<br />
Der jährliche Gasverbrauch der GDRM entspricht in etwa<br />
dem einer Stadt wie Braunschweig. Daher stellt die Ertüchtigung<br />
einer Anlage dieser Dimension hohe Anforderung<br />
an alle Beteiligten. Mit der Planung der erforderlichen<br />
Maßnahmen für die Ertüchtigung der Gesamtanlage beauftragte<br />
Dow im Jahr 2009 die Projekthaus GmbH. „Als technische<br />
Projektleitung waren wir zunächst für die Planung,<br />
das Ausschreibungsverfahren inklusive der Erstellung eines<br />
Leistungsverzeichnisses und der Angebotsauswertung bis<br />
hin zu einem Vergabevorschlag zuständig“, erläutert Frank<br />
Matthes, Geschäftsführer der Projekthaus GmbH. Nach der<br />
Vergabe durch Dow verantwortete die Projekthaus GmbH<br />
das Projektmanagement und die technische Baubebegleitung.<br />
Bild 1: Vorbereitungen für das Hot Tapping (Installation des geteilten<br />
T-Stücks)<br />
Hot-tapping und -plugging<br />
„Bei der Ertüchtigung der GDRM galt es, die hohen bei Dow<br />
herrschenden Sicherheitsstandards einzuhalten und zugleich<br />
den fortwährenden Betrieb der Anlage und somit die<br />
Werksversorgung mit Erdgas zu gewährleisten“, ergänzt<br />
Judith Klein, Netzingenieurin Gas und bei Projekthaus zuständig<br />
für das Projektmanagement. Die Planung sah deshalb<br />
vor, dass die Umbaumaßnahmen an der in Betrieb befindlichen<br />
Anlage durchgeführt werden sollten. Im Verlauf<br />
958 12 / 2011
der Ertüchtigungsmaßnahmen stellte sich jedoch heraus,<br />
dass einige der Absperrarmaturen aus den 1980er Jahren<br />
eine zu hohe Leckrate aufwiesen. Für die Realisierung der<br />
Umbaumaßnahmen war es somit unumgänglich, die GDRM<br />
außer Betrieb zu nehmen. Um dennoch eine konstante Gasversorgung<br />
des gesamten Werks während dieser Phase sicherzustellen,<br />
war für die Dauer der Ertüchtigungsmaßnahmen<br />
die Errichtung mobiler GDRM-Stationen für die<br />
zwei Druckregelungen sowie die Anwendung des Hot-tapping-<br />
und -plugging-Verfahrens für deren Einbindung notwendig.<br />
Bei der Hot-tapping- und -plugging-Methode besteht<br />
die Herausforderung darin, dass sämtliche dafür erforderlichen<br />
Arbeitsschritte wie Schweißen, Anbohren und Absperren<br />
der Gasleitung unter Betriebsbedingungen erfolgen<br />
und somit der laufende Betrieb nicht unterbrochen wird. In<br />
diesem Falle waren zwei Hot taps für die 40 bar- (Nennweite<br />
DN 250) und 15 bar-Versorgung (Nennweite DN 400)<br />
notwendig.<br />
„Aufgrund der Menge des im Werk Stade für die Produktionsprozesse<br />
benötigten Erdgases war der Einsatz der<br />
mobilen GDRM und der Hot-tapping- und -plugging-Methode<br />
besonders anspruchsvoll“, führt Frank Matthes aus.<br />
Als Einsatzdauer der mobilen GDRM wurde deshalb ein Zeitraum<br />
von vier Wochen gewählt, währenddessen aufgrund<br />
von Revisionsarbeiten im Werk Stade ein niedrigerer Gasverbrauch<br />
als üblich gegeben war.<br />
Für die im Rahmen der Anlagenertüchtigung vorgesehene<br />
Errichtung einer neuen Kesselanlage, die hauptsächlich<br />
die Gasvorwärmung gewährleistet, bedurfte es ebenfalls<br />
der Aufstellung und Einbindung einer mobilen Wärmezentrale<br />
mit einer Leistung von etwa 1,5 Megawatt.<br />
Sämtliche Baumaßnahmen wurden Ende Mai 2011 erfolgreich<br />
abgeschlossen. Eine finale Baubesprechung fand<br />
Ende September 2011 statt.<br />
„Mit dem Verlauf und dem Ergebnis der Ertüchtigung<br />
unserer GDRM inklusive der E-/EMSR-Technik und der Kesselanlage<br />
sind wir mehr als zufrieden“, resümiert Dow-Projektleiter<br />
Helmut Tiedemann. „Alle während der Arbeiten<br />
aufgetretenen und unvorhergesehenen Aufgabenstellungen<br />
wurden kompetent gelöst, sodass dem Werk Dow Stade<br />
nun eine rundum erneuerte und moderne Anlage für die<br />
Gasversorgung zur Verfügung steht.“<br />
Bild 2: Armaturen für das Absperren (plugging) der Gasleitungen<br />
Kontakt<br />
Projekthaus GmbH, Bremen, Tel. +49 421 3302 78-0,<br />
E-Mail: mail@projekthaus.com, www.projekthaus.com<br />
Bild 3: Demontage der Ausblaseleitungen der Vollhub-SBVs<br />
12 / 2011 959
Fachbericht<br />
Wasserversorgung<br />
Reinigung, Desinfektion und<br />
Armatureninspektion<br />
Von Dr. Norbert Klein<br />
Leckagen in Trinkwasserleitungen werden vorrangig unter technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet.<br />
Wichtig sind aber auch die hygienischen Aspekte bei der Reparatur und der Wiederinbetriebnahme. Aus<br />
der Praxis sind Möglichkeiten des Eintrags von Verunreinigungen in das Leitungssystem bekannt. Der Aufsatz informiert<br />
über solche Beeinträchtigungen vor und während der Reparatur und gibt Hinweise zur Reinigung und Desinfektion,<br />
um reparierte Rohrleitungsabschnitte wieder in einen einwandfreien hygienischen Zustand zu bringen. Gerade<br />
bei Leckagen ist das Funktionieren der Absperrarmaturen wichtig, um Rohrleitungsabschnitte zur Reparatur außer<br />
Betrieb nehmen zu können. Falls größere Rohrnetzbereiche infolge von Leckagen kontaminiert sind, bietet sich<br />
die Kombination von Armatureninspektion, Ertüchtigung schlecht schließender Schieber, Intensivreinigung und Desinfektion<br />
an.<br />
Hygienische Beeinträchtigung durch<br />
Leckagen<br />
Die Rohrleitung ist die „Lebensmittelverpackung“ unseres<br />
Trinkwassers. Bevor eine neu gebaute Trinkwasserleitung in<br />
Betrieb gehen kann, ist eine ganze Reihe von Kriterien vor allem<br />
in Hinblick auf Hygiene zu erfüllen [1]. Wichtig ist, dass<br />
sich in der Rohrleitung keine Stoffe befinden, welche Mikroorganismen<br />
als Nährsubstrat dienen können. Folgende Beispiele<br />
zeigen Möglichkeiten auf, wie infolge von Leckagen die<br />
Hygiene beeinträchtigt werden kann.<br />
Bild 1: Reinigen eines kontaminierten Rohrleitungsabschnittes<br />
mittels Comprex-Verfahren<br />
Bild 2: Wasser- und Luftblöcke beim Reinigen mit dem Impulsspülverfahren<br />
Eine Ursache für Leckagen schon vor der Inbetriebnahme<br />
ist die mangelhafte Lagesicherung von Verbindungen. Sind<br />
beispielsweise längskraftschlüssige Verbindungen an Muffenformstücken<br />
nicht sachgerecht verriegelt, kann es vorkommen,<br />
dass sich diese Verbindungen bei der Druckprobe lösen. Das<br />
ausfließende Wasser überschwemmt den Rohrgraben und spült<br />
Boden in den betroffenen Leitungsabschnitt. Die Feststoffe<br />
setzen sich ab und haften an der ursprünglich sauberen Rohrleitungsoberfläche.<br />
Einfache Wasserspülungen reichen hier in den<br />
meisten Fällen nicht aus, um die Leitung in einen hygienisch einwandfreien<br />
Zustand zu versetzen und schließlich freizugeben.<br />
Leckagen an bestehenden Wasserrohrleitungen führen dazu,<br />
dass das austretende Wasser um die Schadstelle Boden<br />
aufwirbelt. Wird zur Reparatur der betroffene Rohrleitungsabschnitt<br />
außer Betrieb genommen und entleert, kann schlammhaltiges<br />
Wasser durch die Leckagen in die Rohrleitung eintreten.<br />
Die sich absetzenden Feststoffe bleiben an der mehr oder<br />
weniger mit Biofilm, Korrosionsprodukten oder sonstigen Ablagerungen<br />
belegten Rohrleitungsoberfläche haften. Mit dem<br />
schlammhaltigen Wasser werden auch unerwünschte Mikroorganismen<br />
eingetragen.<br />
Werden die Verunreinigungen vor der Wiederinbetriebnahme<br />
nach der Reparatur der Leckage nicht aus der Rohrleitung<br />
entfernt, sind sie Ursache für erhöhte Werte der mikrobiologischen<br />
Parameter im Trinkwasser. Immer noch häufig<br />
soll die Trinkwasserdesinfektion zum Ziel führen. Da sich<br />
hierdurch die Ursache nicht dauerhaft beseitigen lässt, bleibt<br />
der Erfolg aus. Nur eine wirksame, intensive Reinigung kann<br />
zielführend sein [2]. Das Comprex-Verfahren hat dabei seine<br />
Leistungsfähigkeit schon vielfach unter Beweis gestellt. Bild 1<br />
zeigt den prinzipiellen Aufbau beim Reinigen von kontaminierten<br />
Rohrleitungsabschnitten bis Nennweite DN 400. Liegen<br />
sehr hartnäckige Verunreinigungen vor, lässt sich die Wirksamkeit<br />
des Comprex-Verfahrens noch steigern, indem über<br />
eine spezielle Vorrichtung mit der Luft Feststoffe wie Eisstücke<br />
eingebracht werden.<br />
960 12 / 2011
Bild 3: Strömung, Fließgeschwindigkeit<br />
und Druck beim<br />
Comprex-Verfahren<br />
Bild 4: Spülwassertrübung<br />
im<br />
Schauglas<br />
Bild 5: Prinzipieller<br />
Trübungsverlauf<br />
Reinigen mittels Comprex-Verfahren<br />
Das Impulsspülverfahren Comprex basiert auf einer kontrollierten,<br />
impulsartigen Zugabe komprimierter, vierfach<br />
gefilteter Luft in einen definierten Spülabschnitt (Bild 1).<br />
Die sich an der Einspeisestelle bildenden Luftblöcke bewegen<br />
sich im Wechsel mit Wasserblöcken durch den Spülabschnitt<br />
(Bild 2).<br />
Der gedrosselte Schieber am Beginn des Spülabschnittes<br />
reduziert die Fließgeschwindigkeit des einströmenden Wassers<br />
(Bild 1). Die Luft für die Luftimpulse hat einen höheren<br />
Druck als die Wassersäule. Daher beschleunigen die Luftimpulse<br />
beim Einspeisen die bereits vorhandenen Wasserblöcke<br />
bis über 15 m/s, wobei sich in den Grenzbereichen Wasser/<br />
Luft/Rohrwand Verwirbelungen mit hohen Fließgeschwindigkeiten<br />
ausbilden (Bild 3).<br />
Die intermittierenden Fließgeschwindigkeiten induzieren<br />
eine äußerst intensive Schleppspannung. Die Verwirbelungen<br />
an den Phasengrenzen zwischen Wasser- und Luftblöcken<br />
bewirken weiterhin kontrollierte Kavitation. Wasserverteilungsnetze<br />
lassen sich damit effizient reinigen [3].<br />
Der Austrag an Verunreinigungen lässt sich visuell anhand<br />
der Trübung des Spülwassers im Schauglas verfolgen<br />
(Bild 4). Bild 5 zeigt den prinzipiellen Verlauf der Trübung<br />
während einer Comprex-Reinigung.<br />
Comprex_Anz_Komm_90x170_RZ:Comprex_Anz_1-4quer_RZ 17.02.2010 16:00 Uhr Seite 1<br />
Wasser ist unser Element:<br />
Das Impuls-Spül-Verfahren Comprex ®<br />
von Hammann.<br />
www.hammann-gmbh.de<br />
Wir übernehmen die Leitung für sauberes Wasser. Mit unserem Comprex ® -<br />
Verfahren reinigen wir Rohrnetze gründlich, schonend und nachhaltig.<br />
Ob kommunale Trinkwassernetze, Rohwasserleitungen oder Abwasser-Druckleitungen:<br />
mehr Hygiene und Betriebssicherheit ganz ohne Chemie, nur mit Wasser und Luft.<br />
Fordern Sie Informationsmaterial an oder besuchen Sie uns im Internet.<br />
■ Hammann GmbH<br />
Zweibrücker Straße 13<br />
D-76855 Annweiler am Trifels<br />
Tel. +49 (0)63 46/30 04-0<br />
info@hammann-gmbh.de<br />
12 / 2011 961
Fachbericht<br />
Wasserversorgung<br />
Das Impulsspülverfahren arbeitet wirksam, ohne die<br />
Rohrleitung zu beschädigen. Die häufig gestellte Frage nach<br />
Druckstößen lässt sich wie folgt beantworten: Zunächst<br />
bleibt der Druck der eingespeisten Luft immer unterhalb<br />
des Netzruhedrucks der Rohrleitung (Bild 3 Mitte). Weiterhin<br />
puffern die bereits in der Rohrleitung vorhandenen Luftblöcke<br />
die beschleunigten Wasserblöcke. Modellhaft lässt sich<br />
die Wirkungsweise der Luft- und Wasserblöcke in der Leitung<br />
wie eine Anordnung von Stäben als nicht komprimierbare<br />
Wasserblöcke und Federn als komprimierbare Luftblöcke<br />
erklären. Beim Anstoßen des ersten Stabs puffert die darauf<br />
folgende Feder den Stoß und gibt ihn verzögert an den<br />
nächsten Stab weiter. In der Praxis zeigen viele Projekte die<br />
Wirksamkeit des Verfahrens auch bei spröden Rohrleitungswerkstoffen<br />
wie Asbestzement oder Grauguss.<br />
Reparaturen<br />
Nach Reparaturen und sonstigen Arbeiten an der Rohrleitung<br />
muss der Rohrleitungsabschnitt möglichst schnell wieder<br />
in Betrieb gehen. Für eine standardmäßige Desinfektion<br />
und Probenahme mit Freigabe bleibt daher keine Zeit. In diesem<br />
Fall ist durch andere Maßnahmen sicherzustellen, dass<br />
sich die Trinkwasserleitung nach Abschluss der Arbeiten in hygienisch<br />
einwandfreiem Zustand befindet. Hier ist besonders<br />
auf Sauberkeit während der Arbeiten zu achten. Auf keinen<br />
Fall darf Wasser aus der Baugrube in die Leitung gelangen. Es<br />
empfiehlt sich, die Bauteile vor dem Einbau auf Reinheit zu<br />
überprüfen und mit Sprühlösung zu desinfizieren. Nach Beendigung<br />
der Arbeiten ist der Rohrleitungsabschnitt gründlich<br />
mit Wasser zu spülen, wenn möglich mit hoher Fließgeschwindigkeit.<br />
Durch Zugabe von Desinfektionsmitteln lässt<br />
sich ggf. eine Desinfektion mittels Durchlaufverfahren durchführen.<br />
Auf jeden Fall sind die Hinweise des DVGW-Arbeitsblattes<br />
W 291 zu beachten.<br />
Eine gründliche Reinigung ist die Voraussetzung für eine<br />
erfolgreiche Desinfektionsmaßnahme. Ergebnisse aus Forschungsprojekten<br />
[4] und Erfahrungen aus der Praxis bestätigen<br />
diese Aussage.<br />
Störfälle<br />
Es kommt immer wieder vor, dass die Wasserbeschaffenheit<br />
durch Störfälle, außergewöhnliche Vorkommnisse oder<br />
Notfälle beeinträchtigt wird. Beispiele sind Störungen bei<br />
der Wasseraufbereitung, das Eindringen von Fremdstoffen<br />
in die Trinkwasserleitung durch Lecks oder die unbeabsichtigte<br />
Verbindung mit Rohrleitungen, die kein Trinkwasser<br />
befördern. Über das Vorhalten einer hinreichenden Desinfektionskapazität<br />
in solchen Fällen gibt das Umweltbundesamt<br />
Empfehlungen [5]. Nach der örtlich begrenzten Desinfektion<br />
des Trinkwassers aus mobilen Anlagen muss vor allem<br />
die Ursache für die Beeinträchtigung erfasst werden.<br />
Im Anschluss an eine Sanierung ist die betroffene Trinkwasserversorgung<br />
gründlich zu reinigen. Da es sich hierbei normalerweise<br />
um hartnäckige Verunreinigungen handelt, sind<br />
gut wirkende Reinigungsmaßnahmen angebracht. Gerade<br />
hier hat sich das Impulsspülverfahren bewährt. Es lässt sich<br />
schnell ohne große Vorbereitungsarbeiten einsetzen, so dass<br />
die betroffene Trinkwasserversorgung zeitnah wieder in Betrieb<br />
gehen kann.<br />
Reinigung in Kombination mit<br />
Armatureninspektion<br />
In Rohrnetzen sind viele Absperrarmaturen, vorwiegend<br />
Schieber, eingebaut. Üblicherweise befinden sich in einem<br />
Rohrnetz von 100 km Länge etwa 1700 bis 1900 Absperrschieber.<br />
Während des Betriebs sind die meisten Schieber<br />
geöffnet. Ablagerungen können sich wie im gesamten Rohrnetz<br />
auch im Gehäuse der Schieber bilden. Vor allem metallisch<br />
dichtende Schieber reagieren empfindlich auf Ablagerungen<br />
im Schiebersack. Die Funktionsfähigkeit ist beeinträchtigt,<br />
wobei die Schieber unzureichend oder überhaupt<br />
nicht mehr schließen. Gerade bei Rohrbrüchen und Leckagen<br />
in Rohrleitungsabschnitten müssen Schieber funktionieren,<br />
um die betroffenen Stellen reparieren zu können.<br />
Auch bei Feuerwehreinsätzen kommt es darauf an, dass<br />
Absperrarmaturen schließen und Hydranten funktionieren.<br />
Die bisher übliche Armatureninspektion, die im DVGW-<br />
Arbeitsblatt W 392 beschrieben ist, sieht für Absperrarmaturen<br />
wie Schieber und Absperrklappen alle acht Jahre<br />
Inspektionsmaßnahmen vor. Dazu gehören folgende Prüfungen:<br />
Gängigkeit durch kurzfristiges Schließen und Öffnen<br />
(mindestens fünf Umdrehungen; Vorsicht bei geschlossenen<br />
bzw. gedrosselten Armaturen)<br />
leichte Beweglichkeit des Armaturenantriebes und Absperrteils<br />
Dichtheit der Spindelabdichtung<br />
Betriebsstellung (Anschlag prüfen)<br />
Äußere Dichtheit (Sichtkontrolle und Abhorchen)<br />
Zustand der Einbaugarnitur<br />
Korrosion an sichtbaren Teilen (Korrosionsschutz)<br />
Schließ- und Öffnungsstellung gemäß dem festgelegten<br />
Betriebszustand<br />
Zustand der Anzeigevorrichtung für die Erkennbarkeit der<br />
Stellung des Absperrkörpers<br />
Bei Zonentrennschiebern sind allerdings jährlich zu prüfen:<br />
Betriebsstellung „ZU"<br />
Dichtheit im Abschluss (auf Fließgeräusch achten)<br />
Im Rahmen der Armatureninspektion nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
W 392 lässt sich die eigentliche Funktion der Absperrarmaturen,<br />
nämlich der Dichtheit im Abschluss, nicht direkt<br />
prüfen. Dies ist nur möglich, wenn die Rohrleitung außer Betrieb<br />
ist, beispielsweise während der Rohrnetzreinigung [5].<br />
Rohrnetzreinigung und zustandsorientierte Schieberinstandhaltung<br />
ergänzen sich in idealer Weise. Denn vor und<br />
während der flächendeckenden Rohrnetzreinigung wird fast<br />
jeder Schieber im Netz mindestens einmal betätigt. Die meisten<br />
Hydranten werden bedient und als Ein- oder Ausspeisestelle<br />
verwendet. Dabei werden nicht oder schlecht funktionierende<br />
Schieber erkannt und können anschließend ertüchtigt<br />
werden.<br />
962 12 / 2011
Um nicht mehr funktionierende Schieber zu ertüchtigen,<br />
genügt in vielen Fällen das mehrmalige Betätigen der<br />
Spindel. Hier helfen moderne Schieberdrehmaschinen, die<br />
Schwergängigkeit zu reduzieren. Die Dichtheit im Abschluss<br />
lässt sich durch kontrollierte Kavitation erreichen. So genügt<br />
beispielsweise bei metallisch dichtenden Schiebern häufig<br />
das Absenken des Schieberkeils, um Ablagerungen durch<br />
den Wasserstrom aus dem Schiebersack zu entfernen. Bei<br />
hartnäckigen Ablagerungen unterstützt das Impulsspülverfahren<br />
die Reinigung. Auch hier erweist sich ein zustandsorientiertes<br />
Vorgehen als vorteilhaft: im ersten Schritt Erzeugen<br />
kurzzeitiger Kavitation durch Schließen des Schiebers<br />
und geringes Anheben des Schieberkeils, bei Bedarf<br />
Verstärken der Reinigungswirkung durch das Impulsspülverfahren.<br />
Erfahrungsgemäß lassen sich zwischen 50 % und 70 %<br />
der nicht oder schlecht schließenden Schieber ertüchtigen.<br />
Sie können ihren Dienst noch über weitere Jahre erfüllen. Da<br />
die Reinigung nach der Schieberinstandsetzung erfolgt, ist<br />
sichergestellt, dass alle aus den Schiebern abgelösten und<br />
mobilisierten Stoffe zuverlässig aus dem Rohrnetz ausgetragen<br />
werden.<br />
Die Kombination der zustandsorientierten Schieberinstandhaltung<br />
und der Rohrnetzreinigung bringt Rohrnetze<br />
wieder in einen ordentlichen Zustand und erweitert die Nutzungsdauer<br />
der Absperrarmaturen [6, 7]. Der Mehraufwand<br />
ist gering im Vergleich zum Nutzen für den Netzbetreiber.<br />
In einem weiteren Modul lässt sich auch die Armatureninspektion<br />
nach DVGW-Arbeitsblatt W 392 übernehmen. Der<br />
Vorteil für den Betreiber liegt in der Dokumentation des<br />
Rohrnetzzustandes. Notwendige Instandhaltungsarbeiten<br />
lassen sich planen und entsprechend ihrer Wichtigkeit und<br />
Dringlichkeit ausführen.<br />
Eine interessante Erweiterung der Instandhaltung ist die<br />
Aufnahme des Drehmoments aller Schieber im Rohrnetz [8].<br />
Die einfache Handhabung moderner elektrisch angetriebener<br />
Schieberdrehmaschinen ermöglicht, das Drehmoment<br />
über einen gesamten Schließ- und Öffnungszyklus zu messen<br />
und vor allem auch zu dokumentieren (Bild 6).<br />
Die Kombination von Rohrnetzreinigung und zustandsorientierter<br />
Schieberinstandhaltung zeigt neue Synergieeffekte<br />
auf. So lassen sich die Kosten für die Rohrnetzreinigung<br />
durch die Verlängerung der Nutzungsdauer der ertüchtigten<br />
Schieber kompensieren. Weitere Einsparpotenziale<br />
eröffnen sich bei geschickter Verteilung der Arbeiten<br />
Bild 6: Drehmomente beim 1. und 2. Schließen eines<br />
Schiebers [8]<br />
zwischen dem Dienstleister und dem Rohrnetzbetreiber. Ein<br />
Rechnerprogramm kann die möglichen Varianten kalkulieren.<br />
Nach Eingabe der Rohrnetzdaten und betreiberspezifischer<br />
Daten errechnet es die Kosten für die Maßnahmen<br />
und zeigt Einsparpotenziale auf.<br />
Zusammengefasst hat die Kombination von Rohrnetzreinigung<br />
und zustandsorientierter Schieberinstandhaltung<br />
folgende Vorteile:<br />
Hygienisch und hydraulisch einwandfreier Zustand des<br />
Rohrnetzes<br />
Überprüfung aller Schieber im Rohrnetz auf Funktion<br />
Ertüchtigung schlecht oder nicht schließender Schieber<br />
zu 50 % bis 70 %<br />
erhöhte Sicherheit bei Störfällen durch Absperren betroffener<br />
Bereiche<br />
Dokumentation der defekten Schieber und Kennzeichnung<br />
vor Ort<br />
Reduzierung der Anzahl auszutauschender Schieber<br />
Reduzierung von Tiefbaumaßnahmen infolge des Schieberaustausches<br />
weitere Armatureninspektion nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
W 392 möglich<br />
kleine Reparaturmaßnahmen während Reinigung und Armatureninspektion<br />
möglich<br />
Kostenoptimierung durch Verlängerung der Nutzungsdauer<br />
des Rohrnetzes einschließlich Armaturen insbesondere<br />
der Schieber<br />
Fazit<br />
Dringen bei Leckagen verunreinigtes Wasser oder sonstige<br />
Verunreinigungen in die Trinkwasserleitung ein, ist eine wirksame<br />
intensive Reinigung erforderlich. Das Impulsspülverfahren<br />
Comprex hat sich vielfach bewährt, die bestehenden<br />
Rohrleitungen wieder in einen einwandfreien hygienischen<br />
Zustand zu versetzen.<br />
12 / 2011 963
Fachbericht<br />
Wasserversorgung<br />
Sichere und effiziente<br />
Rohrleitungssysteme<br />
Nutzen Sie das Know-how der führenden Fachzeitschrift<br />
für die Entwicklung von Rohrleitungen, Komponenten und<br />
Verfahren im Bereich der Gas- und Wasserversorgung, der<br />
Abwasserentsorgung, der Nah- und Fernwärmeversorgung,<br />
des Anlagenbaus und der Pipelinetechnik.<br />
Mit zwei englischsprachigen Specials pro Jahr.<br />
NEU<br />
Jetzt als Heft<br />
oder als ePaper<br />
erhältlich<br />
Die vorbeugende, zustandsorientierte Instandhaltung<br />
von Rohrnetzen hat das Ziel, die Störfallhäufigkeit zu verringern,<br />
um den Verbrauchern jederzeit einwandfreies Trinkwasser<br />
liefern zu können. Die Armatureninspektion nach dem<br />
DVGW-Arbeitsblatt W 392 erfährt durch die zustandsorientierte<br />
Schieberinstandhaltung eine wesentliche Sicherheitskomponente.<br />
Wichtig ist, dass in kritischen Situationen beispielsweise<br />
bei Bränden oder Rohrbrüchen Absperrarmaturen<br />
schließen, Hydranten funktionieren und im Rohrnetz die<br />
Trinkwasserbeschaffenheit gemäß Trinkwasserverordnung<br />
erhalten bleibt. Die Dokumentation des aktuellen Zustands<br />
spielt dabei eine große Rolle. Hier stellt die Dokumentation<br />
der Drehmomente über einen gesamten Schließ- und Öffnungszyklus<br />
jeder Absperrarmatur eine bedeutende Erweiterung<br />
dar.<br />
Literatur<br />
Wählen Sie einfach das Bezugsangebot,<br />
das Ihnen zusagt!<br />
· Als Heft das gedruckte, zeitlos-klassische Fachmagazin<br />
· Als ePaper das moderne, digitale Informationsmedium für<br />
Computer, Tablet oder Smartphone<br />
· Als Heft + ePaper die clevere Abo-plus-Kombination<br />
ideal zum Archivieren<br />
[1] Klein, N.; Rammelsberg J.: Inbetriebnahme von Rohrleitungen<br />
mit Zementmörtelauskleidung; <strong>3R</strong> international 48<br />
(2009) Nr. 3-4, S. 144-151<br />
[2] Hammann, H.-G.; Klein, N.: Kontaminierte Wasserverteilungsnetze<br />
mit Comprex effizient reinigen; Der Hygieneinspektor<br />
(2010) Nr. 2, S. 78-80<br />
[3] Hammann, H.-G.; Klein, N.: Wasserverteilungsnetze effizient<br />
reinigen; energie, wasser-praxis (2010) Nr. 7/8, S.<br />
106-107<br />
[4] Empfehlung des Umweltbundesamtes – Coliforme Bakterien<br />
im Trinkwasser; Bundesgesundheitsbl. (2009) Nr. 4,<br />
S. 474-482<br />
[5] Erkenntnisse aus dem BMBF-Verbundprojekt „Biofilme in<br />
der Trinkwasser-Installation“ Die wichtigsten Erkenntnisse<br />
des Forschungsprojektes in Thesenform http://www.<br />
biofilm-hausinstallation.de/, kostenloser Download der<br />
Thesen: http://www.biofilm-hausinstallation.de/dokumente/Thesenpapie_2_0.PDF<br />
[6] Klein, N.; Hammann, H.-G.: Rohrnetzreinigung mit Schieberertüchtigung;<br />
<strong>3R</strong> (2010) Nr. 12, S. 712-715<br />
[7] Klein, N.; Hammann, H.-G.: Schieberertüchtigung in Kombination<br />
mit Rohrnetzreinigung; Industriearmaturen<br />
(2011) Nr. 1, S. 53-56<br />
[8] Mobile Automatisierung und zustandsorientierte Wartung<br />
von Armaturen; 3S Antriebe GmbH, Industriearmaturen<br />
(2011) Nr. 2, S. 118-119<br />
[9] DVGW-Arbeitsblatt W 291 „Reinigung und Desinfektion<br />
von Wasserverteilungsanlagen“<br />
[10] DVGW-Arbeitsblatt W 392 „Rohrnetzinspektion und Wasserverluste<br />
– Maßnahmen, Verfahren und Bewertungen“<br />
Autor<br />
Alle Bezugsangebote und Direktanforderung<br />
finden Sie im Online-Shop unter<br />
www.3r-rohre.de<br />
Dr. Norbert Klein<br />
Hammann GmbH, Annweiler am<br />
Trifels<br />
Tel. +49 6346 3004-42<br />
E-Mail: n.klein@hammann-gmbh.de<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
www.3r-rohre.de<br />
<strong>3R</strong> erscheint in der Vulkan-Verlag GmbH, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen<br />
964 12 / 2011
Projekt kurz beleuchtet<br />
Wasserversorgung<br />
Wilo beteiligt sich an Vorzeigeprojekt der Entwicklungshilfe<br />
Nachhaltige Wassergewinnung in<br />
Jordanien dank deutscher Pumpentechnik<br />
Mit dem Austausch ineffizienter Pumpen in einer Pumpstation<br />
nahe der Hauptstadt Amman trägt ein Entwicklungshilfsprojekt<br />
zur Verbesserung der jordanischen Wasserversorgung<br />
erste Früchte. Im Juli 2011 ging das modernisierte<br />
Pumpwerk Ebqoriyyeh als Pilotanlage in Betrieb. Es versorgt<br />
etwa 50.000 Menschen mit Trinkwasser. Der Ersatz der völlig<br />
veralteten Blockpumpen durch hochmoderne Druckmantelpumpen<br />
mit elektronischer Regelung steigerte die Kapazität<br />
und Zuverlässigkeit des Pumpwerks erheblich. Die<br />
Pumpentechnik sowie wertvolles technisches Know-how im<br />
Bereich der Wasserversorgung steuerte der Dortmunder<br />
Pumpenspezialist WILO SE bei. Weitere Projektpartner sind<br />
die German Water Partnership (GWP) sowie die Deutsche<br />
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).<br />
Hintergrund der Modernisierungsmaßnahme ist die schwierige<br />
Wasserversorgung in Jordanien, das zu den wasserärmsten<br />
Ländern der Welt zählt. Da es dort keine durchgehende<br />
Wasserversorgung gibt, lagert Wasser in der Regel in Tanks auf<br />
den Dächern der Wohnhäuser. Vor allem der Transport des Wassers<br />
stellt ein Problem dar. Pumpstationen fördern das Wasser<br />
für Millionen von Menschen aus dem Jordantal in die Hauptstadt<br />
Amman. Hierbei ist ein Höhenunterschied von 1.400 m<br />
zu überwinden. Veraltete Pumpentechnik verursacht einen<br />
enorm hohen Energieverbrauch. Allein 15 % der landesweit verbrauchten<br />
elektrischen Energie gehen auf das Konto der Was-<br />
serversorgung. Da in erster Linie fossile Brennstoffe der Energieerzeugung<br />
dienen, ist damit eine hohe CO 2<br />
-Belastung verbunden.<br />
Außerdem kommt es durch marode Anschlüsse zwischen<br />
Pumpen und Leitungen zu enormen Wasserverlusten.<br />
Ein auf mehrere Jahre angelegtes Projekt im Rahmen einer<br />
öffentlich-privatwirtschaftlichen Partnerschaft soll die Situation<br />
nachhaltig verbessern. Die German Water Partnership<br />
(GWP), die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit<br />
(GIZ) sowie der Pumpenhersteller WILO SE initiierten<br />
2008 das gemeinsame Entwicklungshilfsprojekt. Zur Steigerung<br />
der Energieeffizienz in Anlagen der jordanischen Wasserversorgungsbehörde<br />
(Water Authority of Jordan) haben die<br />
Projektbeteiligten begonnen, die marode Versorgungstechnik<br />
schrittweise auf einen zeitgemäßen und wirtschaftlichen Stand<br />
zu bringen. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz<br />
und Reaktorsicherheit (BMU) fördert das Projekt aus Mitteln<br />
im Rahmen der Internationalen Klimaschutzinitiative.<br />
Im Mittelpunkt des Projekts steht, die überalterten Aggregate<br />
in den Pumpwerken der jordanischen Wasserversorgungsbehörde<br />
gegen den neuesten Stand der Pumpentechnik auszutauschen.<br />
Ziel ist es, den Stromverbrauch und die damit verbundenen<br />
extremen Energiekosten und Schadstoffemissionen<br />
deutlich zu reduzieren. Das als Pilotanlage modernisierte<br />
Pumpwerk Ebqoriyyeh belegt eindrucksvoll die enormen Einsparpotenziale.<br />
Ein Verbrauchsmonitoring der Performance<br />
Bild 1: In den meisten Pumpwerken der jordanischen Wasserversorgung sind völlig veraltete Anlagen in Betrieb. Allein 15 % der in<br />
Jordanien verbrauchten elektrischen Energie gehen auf das Konto der Wasserversorgung (Bildquelle: WILO SE)<br />
12 / 2011 965
Management Unit (PMU) des jordanischen Ministeriums für<br />
Wasser und Bewässerung ergab eine um 35 % verbesserte<br />
Energieeffizienz im Vergleich zum Ausgangszustand. Durch den<br />
deutlich geringeren Stromverbrauch lassen sich rund 1.200<br />
Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Die Pumpen finanzieren sich<br />
über die geringeren Energiekosten. So rechnet sich ihr Kauf bereits<br />
nach zwei bis drei Jahren.<br />
Aufgrund der guten Erfahrungen aus dem Pilotprojekt sollen<br />
stromsparende Systemlösungen von Wilo in Zukunft landesweit<br />
zum Einsatz kommen. Sie tragen damit zu einer nachhaltigen<br />
Wasserversorgung in Jordanien bei. So ließen sich die<br />
Energiekosten für die dortige Wasserwirtschaft umgerechnet<br />
um bis zu eine Millionen Euro pro Jahr senken. Das durch die<br />
Modernisierungsmaßnahmen eingesparte Geld könnte wiederum<br />
in andere wichtige Entwicklungsprojekte fließen. Das Projekt<br />
hat zudem Signalcharakter für andere Länder. Es zeigt, dass<br />
Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit einander nicht widersprechen.<br />
Bild 2: Hochmoderne Wilo-Druckmantelpumpen mit elektronischer<br />
Regelung reduzieren im Vergleich zu den Altpumpen deutlich den<br />
Stromverbrauch und den damit verbundenen CO 2<br />
-Ausstoß<br />
(Bildquelle: WILO SE)<br />
Kontakt<br />
WILO SE, Dortmund, Tel. +49 231 4102-0,<br />
E-Mail: wilo@wilo.com, Internet: www.wilo.de<br />
Under the patronage of H.H Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Dubai Deputy Ruler<br />
7–9 February 2012<br />
Dubai International Exhibition Centre<br />
united arab emirates<br />
Meet over<br />
1000 exhibitors<br />
from around the world<br />
FOR FREE FAST-TRACK ENTRY:<br />
www.middleeastelectricity.com/<strong>3R</strong>3<br />
B<br />
M E M B E R S ’ C L U B<br />
Features at the show:<br />
• SMART POWER Conference<br />
• Power & Utilities Infrastructure Summit<br />
• Technical Seminars<br />
• Middle East Electricity Awards<br />
• Club 100<br />
For further information, visit:<br />
www.middleeastelectricity.com<br />
M<br />
L E A D E R S ’ F O R U M<br />
Partner Events<br />
Doing global business<br />
a power of gooD<br />
power<br />
lighting water nuclear renewable<br />
966 12 / 2011
Marktübersicht<br />
2011<br />
Rohre + Komponenten<br />
Maschinen + Geräte<br />
Korrosionsschutz<br />
Dienstleistungen<br />
Sanierung<br />
Institute + Verbände<br />
Fordern Sie weitere Informationen an unter<br />
Tel. 0201/82002-35 oder E-Mail: h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
www.3r-marktuebersicht.de
2011<br />
RohRe + Komponenten<br />
Marktübersicht<br />
Armaturen<br />
Armaturen + Zubehör<br />
Absperrklappen<br />
Anbohrarmaturen<br />
Schaugläser für Rohrleitungen<br />
Rohre<br />
Fernwärmerohre PE 100-RC Rohre Schutzmantelrohre<br />
968 12 / 2011
RohRe + Komponenten<br />
2011<br />
Kunststoff<br />
Formstücke<br />
Rohrdurchführungen<br />
Marktübersicht<br />
Dichtungen<br />
Ihr „Draht“ zur Anzeigenabteilung von<br />
Helga Pelzer<br />
Tel. 0201 82002-35<br />
Fax 0201 82002-40<br />
h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
12 / 2011 969
2011<br />
mAschInen + GeRäte<br />
Marktübersicht<br />
Kunststoffschweißmaschinen<br />
horizontalbohrtechnik<br />
Berstlining<br />
Ihr „Draht“ zur Anzeigenabteilung von<br />
Helga Pelzer<br />
Tel. 0201 82002-35<br />
Fax 0201 82002-40<br />
h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
970 12 / 2011
mAschInen + GeRäte<br />
2011<br />
Leckageortung<br />
Inspektion, Reparatur und Reinigung<br />
Marktübersicht<br />
KoRRosIonsschutZ<br />
Kathodischer Korrosionsschutz<br />
12 / 2011 971
2011<br />
KoRRosIonsschutZ<br />
Marktübersicht<br />
Kathodischer Korrosionsschutz<br />
Ihr „Draht“ zur Anzeigenabteilung von<br />
Helga Pelzer<br />
Tel. 0201 82002-35<br />
Fax 0201 82002-40<br />
h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
972 12 / 2011
KoRRosIonsschutZ<br />
2011<br />
Kathodischer Korrosionsschutz<br />
Marktübersicht<br />
Korrosionsschutz<br />
12 / 2011 973
2011<br />
KoRRosIonsschutZ<br />
Marktübersicht<br />
Korrosionsschutz<br />
DIenstLeIstunGen / sAnIeRunG<br />
Dienstleistungen<br />
Öffentliche Ausschreibungen<br />
Ingenieurdienstleistungen<br />
974 12 / 2011
DIenstLeIstunGen / sAnIeRunG<br />
2011<br />
sanierung<br />
Sanierung Gewebeschlauchsanierung Schächte<br />
Marktübersicht<br />
InstItute + VeRBänDe<br />
Institute<br />
12 / 2011 975
2011<br />
InstItute + VeRBänDe<br />
Marktübersicht<br />
Verbände<br />
976 12 / 2011
Wissen für die praxis<br />
RSV-Regelwerk<br />
RSV Merkblatt 1<br />
Renovierung von Entwässerungskanälen und -leitungen mit vor Ort härtendem Schlauchlining<br />
2006, 31 Seiten, DIN A4, broschiert, € 35,-<br />
RSV Merkblatt 2<br />
Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit Rohren aus<br />
thermoplastischen Kunststoffen durch Liningverfahren ohne Ringraum<br />
2009, 38 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 2.2<br />
Renovierung mit dem TIP-Verfahren ohne Ringraum (in Bearbeitung)<br />
RSV Merkblatt 3<br />
Renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen durch Liningverfahren mit Ringraum<br />
2008, 40 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 4<br />
Reparatur von drucklosen Abwässerkanälen und Rohrleitungen durch vor Ort härtende Kurzliner<br />
(partielle Inliner)<br />
2009, 25 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 5<br />
Reparatur von Entwässerungsleitungen und Kanälen durch Roboterverfahren<br />
2007, 22 Seiten, DIN A4, broschiert, € 27,-<br />
RSV Merkblatt 6<br />
Sanierung von begehbaren Entwässerungsleitungen und -kanälen sowie Schachtbauwerken<br />
2007, 23 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 6.2<br />
Schachtsanierung (in Bearbeitung)<br />
RSV Merkblatt 7.1<br />
Renovierung von drucklosen Leitungen / Anschlußleitungen mit vor Ort härtendem Schlauchlining<br />
2009, 24 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 7.2<br />
Hutprofiltechnik zur Einbindung von Anschlußleitungen – Reparatur / Renovierung<br />
2009, 31 Seiten, DIN A4, broschiert, € 30,-<br />
RSV Merkblatt 8<br />
Erneuerung von Entwässerungskanälen und Anschlussleitungen mit dem Berstliningverfahren<br />
2006, 27 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RSV Merkblatt 10<br />
Kunststoffrohre für grabenlose Bauweisen<br />
2008, 55 Seiten, DIN A4, broschiert, € 37,-<br />
Vulkan-Verlag<br />
www.vulkan-verlag.de<br />
Faxbestellschein an: 0201/82002-34<br />
Ja, ich / wir bestelle(n) gegen Rechnung:<br />
___ Ex. RSV-M 1 € 35,-<br />
___ Ex. RSV-M 2 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 2.2 in Bearbeitung<br />
___ Ex. RSV-M 3 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 4 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 5 € 27,-<br />
Antwort<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
___ Ex. RSV-M 6 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 6.2 in Bearbeitung<br />
___ Ex. RSV-M 7.1 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 7.2 € 30,-<br />
___ Ex. RSV-M 8 € 29,-<br />
___ Ex. RSV-M 10 € 37,-<br />
zzgl. Versandkosten<br />
Firma/Institution<br />
Vorname/Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
E-Mail<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise □ Bankabbuchung □ Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Garantie: Dieser Auftrag kann innerhalb von 14 Tagen bei der Vulkan-Verlag GmbH, Postfach 10 39 62, 45039 Essen schriftlich widerrufen<br />
werden. Die rechtzeitige Absendung der Mitteilung genügt. Für die Auftragsabwicklung und die Pflege der Kommunikation werden Ihre<br />
persönlichen Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich per Post, Telefon, Telefax<br />
oder E-Mail über interessante Verlagsangebote informiert werde. Diese Erklärung kann ich jederzeit widerrufen.<br />
Bankleitzahl<br />
✘<br />
Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer
Fachbericht<br />
Abwasserentsorgung<br />
Wurzeleinwuchs in private und<br />
kommunale Kanalsysteme<br />
Von Michael Honds<br />
Bild 1: Ahornstandort<br />
Hintergrund des Wurzeleinwuchses in<br />
Abwassersystemen<br />
Im Gegensatz zu den in der letzten Ausgabe der <strong>3R</strong> geschilderten<br />
Wurzelwuchsbildern im Versorgungsbereich [1] kommt<br />
es im Entsorgungsbereich aus unterschiedlichen Gründen zu<br />
Wurzeleinwüchsen in die Systeme. Im Versorgungsbereich<br />
wurzeln Bäume aufgrund der anstehenden Betriebsdrücke der<br />
Anlagen nur selten in diese hinein. In wenigen Fällen kommt<br />
es bei druckbetriebenen Wasserversorgungsleitungen zu Einwüchsen.<br />
Aufgrund biotoxischer Umgebungsbedingungen in<br />
Gasversorgungsleitungen wurzeln die Bäume generell nicht in<br />
diese ein. Nicht jedoch bei den Abwassersystemen. Hier stellen<br />
die unterirdischen Entsorgungsanlagen ein wahres Versorgungsparadies<br />
für die Baumwurzeln dar. Neben der lebenswichtigen<br />
Versorgung mit Wasser stellen diese offenen Systeme<br />
eine im hohen Maß sauerstoffangereicherte Zone dar.<br />
Aufgrund unterschiedlicher Untersuchungen und Beobachtungen<br />
kann man davon ausgehen, dass insbesondere dieses<br />
Sauerstoffangebot die Wurzeln veranlasst in diese Systeme<br />
einzuwurzeln.<br />
Als „Haupteinstiegsstelle“ müssen die Muffenverbindungen<br />
der Rohrsysteme angesehen werden. Auch ohne schadhafte<br />
Verbindungsstellen oder Undichtigkeiten stellen diese<br />
Verbindungen hauptsächlich die „Wurzeleinstiegsstelle“ dar.<br />
Kleinste Wurzelstränge bahnen sich den Weg durch die Gummidichtung<br />
oder Teerstrickmuffen und ebnen sich so den Einstieg<br />
in das System. In diesem angekommen, breiten sich die<br />
Wurzeln, je nach Betriebsart der Anlage, in dem System aus.<br />
Bei herkömmlichen Mischsystemen findet der Einwuchs zumeist<br />
von oben statt. Das bedeutet, die Wurzel durchstößt<br />
die Dichtung oberhalb des mittleren Wasserstands und zapft<br />
in dem System angekommen die anstehenden Nährstoffe an.<br />
Jedoch ist das hochorganisch angereicherte Abwasser innerhalb<br />
eines Mischwasserkanals für eine Baumwurzel unattraktiv.<br />
Lediglich bei Starkregenaufkommen, was zu einer Verdünnung<br />
des Substrates führt, nehmen die herabhängenden<br />
Wurzeln Flüssigkeit auf. Der eigentliche Grund für das Einwurzeln<br />
in die Mischwassersysteme scheint der Sauerstoffversorgung<br />
zu dienen.<br />
Bei den Regenwassersystemen kommt es hingegen oftmals<br />
auch zu Einwurzelungen von der Unterseite der Rohrleitung<br />
mit direktem Eindringen in die wasserführenden Leitungszonen.<br />
Es scheint, als erkenne die Wurzel um welches System es<br />
sich handelt, denn würde die Wurzel, wie bei einem getrennten<br />
System, die Leitung von unten anzapfen, würde sie im<br />
Mischsystem an dem überdüngten Substrat verenden.<br />
Bei den getrennten Systemen, wie z.B. einem reinen Regenwassersystem,<br />
findet der Einwuchs zumeist unterhalb der<br />
mittleren Wassersäule statt, denn hier erwartet die Wurzel<br />
ein weitestgehend reines und organisches Wasser, was diese<br />
dann aufnehmen und zur Versorgung weiterleiten kann.<br />
Ein Hauptunterscheidungsmerkmal einer Einwurzelung in<br />
ein Mischwassersystem und einem Regenwassersystem ist<br />
die Wurzelform innerhalb der Systeme. Ein Wurzelstrang in<br />
einem Mischwassersystem stellt sich zumeist als ein Wur-<br />
978 12 / 2011
Bild 2: Sichelförmiger Wurzelvorhang<br />
Bild 4: Kanalanlage mit Einwurzelstelle<br />
Bild 3: Wurzelstrang nach Entnahme<br />
Bild 5: Wurzelstrang nach Entnahme<br />
zelvorhang dar, der sichelförmig ausgebildet ist und mit nur<br />
wenigen einzelnen Haarsträngen in das anstehende Abwasser<br />
hineinragt.<br />
In einem getrennten System hingegen werden in Regenwasseranlagen<br />
oftmals meterlange Wurzelschleppen ausgebildet.<br />
Das Feinwurzeln über die Dichtungen in diese Systeme<br />
eindringen können, erscheint unter dem Aspekt, dass eine<br />
Feinwurzel einen Einpress- und Vortriebsdruck von bis zu 15<br />
bar aufbaut, nachvollziehbar.<br />
Einmal in dem System angelangt, breiten sich komplette<br />
Wurzelnetze im Rohrsystem aus. Diese führen dann in vielen<br />
Fällen zu einem geringeren Durchfluss oder gar zu Verstopfungen<br />
der Abwassersysteme.<br />
In kommunalen und privaten Abwassersystemen werden<br />
Verwurzelungen durch mechanische Eingriffe in regelmäßigen<br />
Abständen beseitigt. Dies führt jedoch je nach Verfahren<br />
zu einer erheblichen Neubildung der Wurzelmasse. An<br />
nicht versiegelten oder verödeten Wurzelschnitt- oder Fräsflächen<br />
entstehen schon innerhalb einer Vegetationsphase<br />
neue Wurzelstränge, die in Stärke und Masse das vorherige<br />
Einwurzelbild um ein Vielfaches übertreffen.<br />
Beispiele aus der Praxis<br />
Nachfolgend einige Praxisbeispiele:<br />
Beispiel 1: Ahorn, 35 Jahre, Mischwassersystem (Bild 1,<br />
2 und 3)<br />
Beispiel 2: Ahorn, 25 Jahre, Mischwassersystem mit ausgetrenntem<br />
Wurzelvorhang (Bild 4 und 5)<br />
Beispiel 3: Platane, 40 Jahre, Mischwassersystem (im<br />
Haus), (Bild 6, 7 und 8)<br />
12 / 2011 979
Fachbericht<br />
Abwasserentsorgung<br />
Bild 6: Mehrere Meter<br />
lange Wurzelschleppe<br />
Anhand der Bilder 6–8 wird deutlich, unter welchen Versorgungsengpässen<br />
ein Straßenbaum leidet, dass dieser zunächst<br />
rund 18 m Strecke zurücklegt, dann ein Hausfundament unterwurzelt,<br />
um dann nach der Unterwurzelung des Fundamentes in<br />
einem Spülkasten einer Toilettenanlage Nährstoffe vorzufinden.<br />
Bild 7: Baumstandort und Grundriss der unterwurzelten Bebauung<br />
Bild 8: Wurzelstrang in<br />
Toilettenanlage<br />
Ursache: Sauerstoff- und<br />
Wassermangel<br />
Neben der Unterversorgung mit Wasser tritt im innerstädtischen<br />
Bereich immer häufiger ein zu geringer Sauerstoffgehalt<br />
des Bodens auf. Diese Tatsache ist durch den immer höher<br />
werdenden Versiegelungsgrad im urbanen Umfeld zu erklären.<br />
Immer mehr Straßen, Gehwege, Fahrradwege und Bebauung<br />
führen zu einem immer höheren Versiegelungsgrad.<br />
Bäume werden in Baumscheiben mit zumeist 6 m² Versickerungsfläche<br />
in diese Asphaltwüsten gepflanzt. Das dieser bereitgestellte<br />
Raum für einen Baum nicht ausreicht ist nachvollziehbar.<br />
Diese Bäume suchen und finden andere Wege und Regionen,<br />
um die überlebenswichtige Versorgung sicherzustellen.<br />
Anhand des Bildes 9 kann der eigentliche Verlauf einer<br />
Einwurzelung in das Kanalnetz erläutert werden.<br />
Man erkennt eine Starkwurzel, die sich entlang der Rohrleitung<br />
in leicht gedrehter Form ausbildet. Im weiteren Umfeld<br />
sind keine weiteren Starkwurzeln erkennbar. Das bedeutet,<br />
dass dieses Umfeld nicht im statisch wirksamen Wurzelraum<br />
des Baumes liegt. Der Grund für die Unterwurzelung des Kanalrohres<br />
liegt im Bodenaufbau. Um die Leitung herum ist der<br />
Boden nicht in dem Maße verdichtet wie der anstehende Boden.<br />
Das bedeutet, dass durch den nachträglichen Einbau der<br />
Leitung dieses Wuchsfeld für den Baum erst erschlossen wurde.<br />
Die Wurzel nimmt diesen Bereich als leicht zu durchwurzelnden<br />
Raum an und schlängelt sich durch den jährlichen Längen-<br />
und Dickenzuwachs entlang der Leitung. An der Muffenverbindung<br />
der Rohrleitung angekommen erschließt die Wurzel<br />
mit ihrem Feinwurzelsystem die offene Verbindung vor der<br />
Gummidichtung, da hier ein hohes Sauerstoffangebot vorliegt.<br />
Durch den weiteren Zuwachs presst sich die Feinwurzel langsam<br />
aber stetig durch die Gummidichtung hindurch und legt<br />
den ersten Zugang zum Medium Sauerstoff und Wasser. Der<br />
jährliche Dickenzuwachs der Wurzel drückt von nun an die defekte<br />
Gummidichtung weiter auf und vergrößert so den Zugang.<br />
Das bedeutet, dass von nun an mit Versickerungen gerechnet<br />
werden muss. In vielen Fällen endet dieses Szenario<br />
erst mit dem kompletten Bruch der Muffenverbindung und<br />
mit nahezu vollständiger Versickerung.<br />
Entgegen der botanischen Baumartenverteilung bezüglich<br />
der potentiellen Gefahr bei den Versorgungsleitungen, kann bei<br />
der Einwurzelung keine Differenzierung vorgenommen werden.<br />
Sicherlich ist die Häufigkeit der Einwüchse bei Platane, Linde,<br />
Ahorn und Kastanie sehr hoch, was aber daran liegt, dass<br />
diese auch in einem besonders hohen Maß im urbanen Umfeld<br />
gepflanzt werden. Insbesondere im Bereich der privaten Anschlusszonen<br />
kommt jedoch die Baumart Birke und Weide hinzu.<br />
Aber auch alle bevorzugten Nadelgehölze wie Fichte, Zypresse<br />
und Eibe erwiesen sich in der Vergangenheit als einwurzelaktiv.<br />
Jedoch stellt sich aufgrund der bisherigen Untersuchungen<br />
keine Baumart heraus, die nicht zu Einwüchsen in das Kanalsystem<br />
neigen.<br />
Vielmehr gibt es nur einen Grund, weshalb ein Baum nicht<br />
in ein Abwassersystem einwurzelt: Er ist an seinem Standort<br />
ausreichend mit Sauerstoff und Wasser versorgt; dies ist<br />
aber nur bei einem verschwindend geringen Teil der Straßenbäume<br />
der Fall.<br />
980 12 / 2011
Eine Problematik, der nur mit sehr zielgerichteten, neuen<br />
Verfahren entgegengewirkt werden kann, die im Folgenden<br />
weiter erläutert und definiert werden.<br />
Schutz- und PräventivmaSSnahmen im<br />
Entsorgungsbereich<br />
Die Maßnahmen im Entsorgungsbereich erscheinen unter den<br />
jährlichen Sanierungskostenschätzungen als besonders wichtig.<br />
Hier fallen deutschlandweit jährlich mehrere Millionen Euro<br />
Sanierungskosten aufgrund der Wurzeleinwüchse in Kanalanlagen<br />
an.<br />
Entgegen der Wurzelproblematik bei der Versorgungstechnik<br />
haben wir es bei der Entsorgungstechnik weniger mit dynamischen<br />
und statischen Belastungen zu tun, sondern hier fördert<br />
der hohe Sauerstoff- und Wasseranteil der Leitungen (ohne<br />
Betriebsdruck) den Einwuchs der Wurzeln in diese Systeme.<br />
Die Wurzeln wachsen zunächst aufgrund der Drainagewirkung<br />
der Rohrbettung entlang dieser, stoßen dann gegen die<br />
Muffenverbindungen und wurzeln anschließend systematisch<br />
in die Rohrverbindung ein.<br />
Hier wird deutlich, dass auch bei dem Einbau der Entsorgungsleitungen<br />
der Verdichtung des Rohreinbettungsmaterials<br />
(analog der Versorgungstechnik) besondere Aufmerksamkeit<br />
zuteil werden muss.<br />
Bei der Entsorgungstechnik muss insbesondere im Bereich<br />
der Dichtungstechnik ein Quantensprung in Sachen Wurzelfestigkeit<br />
erreicht werden. Bisher stellen lediglich verschweißte<br />
Rohrsysteme eine wurzelfeste Verbindung dar.<br />
Weiterhin sollte auch ein chemischer (botanisch unbedenklicher)<br />
Ansatz verfolgt werden. Ein Bodenzusatzstoff, der die<br />
Wurzeln aus einer Region fernhalten würde, hätte sicherlich<br />
ausgezeichnete Schutzwirkungen.<br />
Hier ist wiederum die Industrie gefragt diese Thematik aufgrund<br />
der neuen Erkenntnisse und Erfahrungen aufzugreifen<br />
und Forschung zu betreiben, um neue Techniken zu entwickeln.<br />
Leider kann der Ansatz der botanischen Baumartenwahl<br />
zur Verringerung der Problematik (wie bei der Versorgungstechnik)<br />
nicht angewandt werden, da dem Autor bisher keine<br />
Baumarten bekannt sind, die ein Kanalsystem nicht annehmen<br />
würden. Sicherlich gibt es Baumarten, bei denen aufgrund der<br />
Wurzelform die Gefahr einer Durchwurzelung der Bodenzonen<br />
bis hin zur Entsorgungsleitung gering ist, dennoch kann<br />
aufgrund der schlechten Standortbedingungen im urbanen<br />
Umfeld dies nicht ausgeschlossen werden. Daher muss bis<br />
heute davon ausgegangen werden, dass nahezu alle Bäume<br />
zu Einwurzelungen in Entsorgungsanlagen neigen.<br />
Sicherlich stellt auch im Bereich der Entsorgungsanlagen<br />
die Absprache im Vorfeld neuer Verlegungen und Pflanzungen<br />
den besten Präventivschutz dar. Arbeitsgruppen, bestehend<br />
aus Mitarbeitern der Planungsbüros, den Entsorgungsunternehmen<br />
sowie Mitarbeitern der städtischen Grünflächenämter<br />
sollten sich bei Neuplanungen von Anlagen und<br />
Baumstandorten auch der Problematik der möglichen Einwurzelungen<br />
annehmen. Hier können eine ganze Reihe zukünftiger<br />
Gefahrenstandorte im Vorfeld bereinigt bzw. vermieden<br />
werden.<br />
Bild 9: Wurzelstrang unterhalb der Rohranlage<br />
Zusammenfassung und Ausblick<br />
Die Problematik der Baumwurzel-Rohrleitungs-Interaktionen<br />
ist einem Großteil der kommunalen Ver- und Entsorgungsunternehmen<br />
bekannt. Jährlich müssen deutschlandweit mehrere<br />
Million Euro bereitgestellt werden, um Schäden aufgrund<br />
dieser Koexistenz von urbanem Baum und kommunaler Verund<br />
Entsorgung zu beseitigen. Es macht jedoch nicht den Anschein<br />
als solle sich hier etwas ändern, denn konsequente Veränderungen<br />
sind weder in botanischer noch in versorgungstechnischer<br />
Sicht erkennbar.<br />
Einwurzelungen von Baumwurzeln in Kanalsysteme verursachen<br />
nicht selten komplette Verstopfungen, mit denen<br />
hohe Sanierungskosten einhergehen.<br />
Rohrleitungsgräben stellen in ihren heutigen Aufbauformen<br />
und Rohrbettungszonen ein Paradies für Wurzeln dar.<br />
Gefolgt dem Leitsatz des „Weg des geringsten Widerstands“<br />
stellen diese Zonen den bevorzugten Wuchsraum für die Wurzeln<br />
der Straßenbäume dar.<br />
Das bessere Verständnis der botanischen und versorgungstechnischen<br />
Zusammenhänge wird dazu führen, dass<br />
Problemstandorte in Zukunft unter neuen Gesichtspunkten<br />
beleuchtet werden.<br />
Literatur<br />
[1] Honds, M.: Baumwurzeln und erdverlegte Leitungsanlagen<br />
– Ursachen und Folgen einer komplexen Koexistenz,<br />
<strong>3R</strong> (2011), Nr. 11, S. 825–829<br />
Autor<br />
Michael Honds<br />
Sachverständiger für Baumwurzel-<br />
Rohrleitungs-Interaktionen,<br />
Mönchengladbach<br />
Tel. +49 2166 552390<br />
E-Mail: info@baumwurzeln.de<br />
12 / 2011 981
Fachbericht<br />
Abwasserentsorgung<br />
Gestickte Materialien zur<br />
Unterstützung der Reinigung von<br />
Abwasserleitungen<br />
Von Nora Grawitter und Jörg Labahn<br />
Durch strukturierte Rohrinnenoberflächen kann der Abtrag von Feststoffen beschleunigt und eine erneute Sedimentation<br />
im Abwasser- bzw. Kanalnetz verhindert werden. Im Rahmen des Verbundvorhaben „Gestickte Oberflächenstrukturen<br />
zur Optimierung der Strömungseigenschaften in Rohrleitungen“ wurden stick-, material- und fertigungstechnische<br />
Voraussetzungen geschaffen und strömungs- und einbautechnische Aspekte betrachtet, um den Effekt<br />
auf das Gewebeschlauchrelining übertragen zu können<br />
Einleitung<br />
Sticken ist heute weitaus mehr als nur eine beliebte Handwerkskunst.<br />
Das zeigen die Entwicklungen der letzten Jahre<br />
in diesem Bereich. Durch neue funktionelle Materialien im<br />
Faden sowie in der Fläche bietet das Sticken interessante Anwendungen<br />
in der Medizin, Elektronik, dem Bauwesen und<br />
Smart Textiles. Neben den traditionellen textilen Materialien<br />
werden zunehmend Werkstoffe wie Folien, faserverstärkte<br />
Kunststoffe oder Papier eingesetzt. Der große Vorteil des Stickens<br />
gegenüber anderen Textiltechnologien ist dessen freie<br />
zwei- bis dreidimensionale Positionierbarkeit der Fadensysteme.<br />
Damit sind nahezu unbegrenzte Legungsmöglichkeiten<br />
mit unterschiedlichsten Fadenmaterialien und Anordnungen<br />
gegeben. Das Sticken ist damit ein ideales Verfahren zur Erzielung<br />
technischer Strukturen. Es ermöglicht z. B. eine Integration<br />
von energie- und informationsleitenden Strukturen.<br />
Höhere Festigkeiten von Werkstoffverbünden werden durch<br />
ein gezieltes Verlegen von Verstärkungsmaterialien erreicht.<br />
Die Sticktechnik ermöglicht wie kein anderes textiles Verfahren<br />
die exakte Positionierung von nichtelektrischen und elektrischen<br />
Bauteilen, deren Anbindung an die textile Struktur, die<br />
Kontaktierung der elektrischen Bauteile und die Herstellung<br />
der elektrischen Leiter. Aggregate wie Soutage- oder Pailletteneinrichtungen<br />
bieten zusätzliche Bearbeitungsmöglichkeiten<br />
Bauteile, Schläuche und Drähte auf das Trägermaterial<br />
aufzubringen. Die Einsatzgebiete liegen in den Bereichen:<br />
der Übertragung von Energie und Daten durch textile<br />
elektrische Leiterbahnen,<br />
der Positionierung und elektrischen Kontaktierung von<br />
elektronischen Bauteilen (Bild 1),<br />
der lichttechnischen Applikationen auf textilen Materialien,<br />
von textilen Heiz- oder Kühlsystemen,<br />
textiler Elektroden für sensorische und aktuatorische Applikationen,<br />
faserverstärkter Kunststoffbauteile und<br />
der Integration von Sensoren sowie Scaffold Pads.<br />
Dass gestickte Strukturen auch in Abwasserrohren eine Funktion<br />
haben können, belegen die Ergebnisse aus dem Projekt<br />
„Gestickte Oberflächenstrukturen zur Optimierung der Strömungseigenschaften<br />
in Rohrleitungen“.<br />
Bild 1: Gestickte elektronische Schaltung<br />
Strukturierte Leitungssysteme<br />
Einen entscheidenden Einfluss auf das Strömungsverhalten in<br />
Rohrleitungen hat die Oberfläche der Innenseite. Deshalb ist<br />
man bestrebt, diese möglichst glatt auszubilden, um Rohrreibungsverluste<br />
gering zu halten und darüber hinaus zu gewährleisten,<br />
dass sich in kontinuierlich betriebenen Abwasserleitungen<br />
keine bzw. nur geringe Sedimente ablagern.<br />
Die Wirksamkeit ist jedoch eingeschränkt, da es bei Unterschreitung<br />
einer kritischen Transportgeschwindigkeit in der<br />
Kanalisation zur Ablagerung von Inhaltsstoffen des abgeleiteten<br />
Abwassers kommt. Mögliche Schadensfolgen sind u. a.<br />
982 12 / 2011
Reduzierung der hydraulischen Leistungsfähigkeit durch Ablagerungen<br />
insbesondere an der Kanalsohle bis zur Verstopfung<br />
des gesamten Querschnitts mit vollständiger Funktionsuntüchtigkeit<br />
des Kanals.<br />
Die Erkenntnisse auf dem Gebiet sich selbstreinigender<br />
Oberflächen, besser bekannt als vielfach publiziertes Phänomen<br />
des Lotuseffektes, waren die Initialzündung für die Idee<br />
von Mitarbeitern des FITR, die Innenseite von Rohrleitungen<br />
zu strukturieren, um dem Problem von Ablagerungen entgegenzuwirken.<br />
Weitere Vorbilder aus der Natur können Anregungen für<br />
eine gezielte Beeinflussung des Flüssigkeits- und Feststofftransportes<br />
in Rohrleitungen geben. Besonderes Augenmerk<br />
wurde hierbei auf das Flügeladersystem der Insekten sowie<br />
den Wasser- bzw. Stofftransport in Gefäßpflanzen geworfen.<br />
Im Flügeladersystem von Insekten bringen abwechselnd versteifte<br />
und nicht versteifte Wandbereiche positive Effekte auf<br />
die Fluidströmung hervor. Auch im wasserleitenden Gewebe<br />
vieler Holzpflanzen findet man Leitbahnen, die aufgelagerte,<br />
schraubenförmige Verdickungen aufweisen.<br />
Schließlich konnten im Rahmen experimenteller Untersuchungen<br />
makroskopische Strukturen für die Rohrinnenflächen<br />
ermittelt werden, die selbst bei niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten<br />
und bei geringem Gefälle durch Erzeugung<br />
von künstlichen Wirbeln in der wandnahen Zone den Abtrag<br />
von Feststoffen beschleunigen und eine erneute Sedimentation<br />
im Abwasser- bzw. Kanalnetz verhindern.<br />
Für eine Applikation der Neuentwicklung speziell für das<br />
Gewebeschlauchrelining war es durch die Anwendung des<br />
textiltechnischen Verfahrens Sticken möglich, mehrere Strukturvarianten<br />
auf Glasfasermatten aufzubringen.<br />
Sticktechnische Verarbeitung von<br />
Glasfasermaterialien<br />
Das Verarbeiten von Glasfasermaterialien an der Stickmaschine<br />
stellt eine Herausforderung dar, da sich die geringe Reißfestigkeit<br />
und Knickbruchbeständigkeit der Glasfasermaterialien<br />
negativ auf den Stickprozess auswirken. Sowohl bei den<br />
zu bestickenden Flächengebilden als auch die zu verstickenden<br />
Fadenmaterialien betreffend, liegen keine praxisrelevanten<br />
Erkenntnisse vor. Um eine Verarbeitung im Stickprozess<br />
dennoch zu realisieren, ist es notwendig die Glasfasermaterialien<br />
zu stabilisieren bzw. entsprechende Fadenkonstruktionen<br />
zu entwickeln.<br />
Gegenüber herkömmlichen Stickgründen weisen Glasfasergewebe<br />
bzw. -gelege ein hohes Flächengewicht von ca. 300<br />
bis 960 g/m 2 auf. Es ist festzustellen, dass sich ein Gewebe nur<br />
bedingt eignet, da die Fläche sehr instabil ist und sich bereits<br />
beim Aufspannen verzieht. Flächenstabilisiertes Multiaxialgelege<br />
weist durch seine Konstruktion bessere Verarbeitungseigenschaften<br />
auf und erleichtert das Handling an der Stickmaschine.<br />
So können die weiteren Verarbeitungsschritte bestmöglich<br />
gestaltet und ein sauberes Stickbild erzielt werden.<br />
Um die sehr biegesteifen Glasfasermaterialien verstickfähig<br />
zu gestalten, werden sie mit Polymeren beschichtet. Auch<br />
durch zusätzliche Umwindungen des Glasfasermaterials lassen<br />
Bild 2: Fadenkonstruktion aus Glasfaser auf Glasfasermultiaxialgelege<br />
Bild 3: Sticktechnisch hergestellte und in Harz getränkte<br />
Strukturkörper (Variante V1)<br />
sich die Verarbeitungseigenschaften verbessern. Abstehende<br />
Fasern werden hierdurch fixiert und der Faden erhält eine glattere<br />
Oberfläche. Im Vergleich zu herkömmlichen Stickgarnen<br />
sind die Umwindekonstruktionen immer noch sehr rau und der<br />
Faden sehr steif. Durch die Verlegung des zu verstickenden Fadens<br />
durch die Fadenführungselemente erfolgt eine hohe Beanspruchung.<br />
Dennoch ist es gelungen, textile fadenförmige<br />
Konstruktionen aus Glasfaser trotz ihrer geringen Bruchfestigkeit<br />
im Stickprozess zu verarbeiten (Bild 2).<br />
Das Zusammenspiel der verschiedenen Prozesse und Materialien<br />
sind entscheidende Faktoren zur individuellen Ausformung<br />
der Strukturierungen auf Glasfasermaterialien. Das<br />
Stickbild wird durch Parameter wie Stichtyp, Stichlänge, Stichdichte<br />
bestimmt. Wesentliche Einflussgrößen wie Ober- und<br />
Unterfaden, Einsatz der Sticknadeln, Stickgeschwindigkeit,<br />
Spannungen beim Fadenzulauf und Stickgrund sind aufeinander<br />
abzustimmen. Die hier eingesetzten Materialien müssen<br />
auch mit den Erfordernissen des Einbaus von Inlinern korrelieren.<br />
Der Verbund von Glasfaser Fadenmaterial, Schaumstoff<br />
und Glasfaser Stickgrund soll sich gut mit dem Harz verbinden<br />
und nach dem Aushärten einen robusten Strukturkörper<br />
herausbilden. Die Versuchsreihen, die mit Glasfaser gestickter<br />
Oberflächenstruktur speziell mit Variante V1 gemäß Bild 3<br />
durchgeführt wurden, belegen, dass im Abwasser- bzw. Kanalnetz<br />
durch diese strukturierten Rohrinnenoberflächen der<br />
Abtrag von Feststoffen beschleunigt und eine erneute Sedimentation<br />
verhindert werden kann.<br />
12 / 2011 983
Fachbericht<br />
Abwasserentsorgung<br />
Bild 4: Versuchsrinne mit 2/3-Gewebeliner-Rohrschalen DN 300 (links: Gesamtansicht; rechts oben: Zulauf; rechts unten: Ablauf)<br />
Tabelle 1: Umfang und Randbedingungen von Versuchen aus der<br />
Versuchsreihe 3<br />
Versuch Nummer Q*<br />
[l/s]<br />
v**<br />
[m/s]<br />
h***<br />
[m]<br />
Struktur<br />
Sedimentationsmaterial<br />
II 1 bis 4 13 0,52 0,125 V0 5 kg Sand<br />
IV 1 bis 3 13 0,39 0,13 V1<br />
(Korngröße 0 bis 2 mm)<br />
* Wasservolumenstrom am Zulauf<br />
** Strömungsgeschwindigkeit auf der Sohle beim 12. Meter<br />
*** Pegelstand beim 12. Meter<br />
Tabelle 2: Versuche aus der Versuchsreihe 3 (5 m-<br />
Gewebebahn, Q = 13 /s und Sand): Transportzeit zwischen<br />
13,67 m und 17 m<br />
Versuch Nummer 12. bis 17.<br />
Meter<br />
Transportzeit zwischen<br />
13,67 m und 17 m<br />
[min]<br />
[min]<br />
II 1 V0 13:50 12:36<br />
2 12:20<br />
3 12:30<br />
4 11:45<br />
IV 1 V1 07:50 7:47<br />
2 07:45<br />
3 07:45<br />
Laborversuche<br />
Die Untersuchungen zur Wirkung eines strukturierten Rohrinliners<br />
auf den Medientransport wurden an einer 24 m langen<br />
Versuchsrinne – bestehend aus 6 m langen 2/3-Gewebeliner-<br />
Rohrschalen DN 300 – mit einem Gefälle von I = 1 ‰ durchgeführt<br />
(Bild 4).<br />
Als Wasserzuführung wird ein geschlossener Wasserkreislauf<br />
genutzt. Für den Wasserzulauf dient ein Messkasten mit Einlaufblende,<br />
in dem das Wasser beruhigt wird und dann gleichmäßig<br />
in die Rinne fließt. Der Auslauf erfolgt als vollständiger Überfall<br />
in ein Becken mit Sandfang und Überfallwehr. Nach dem Verlassen<br />
des Sandfangs strömt das Wasser zurück in den Bevorratungskanal.<br />
Über einen Schieber wird der Wasservolumenstrom dosiert<br />
und mittels eines induktiven Durchflussmessers kontrolliert. Zur<br />
Registrierung der sich einstellenden Strömungsgeschwindigkeit<br />
steht ein Messflügel mit Anzeigegerät zur Verfügung.<br />
Aus der Versuchsreihe 3 sind in Tabelle 1 der Umfang und<br />
die Randbedingungen von zwei Versuchen mit 0,25 m breiten<br />
unstrukturierten (V0) und strukturierten (V1) Gelegebahnen –<br />
eingeharzt und eingebaut vom 12. bis 17. Meter – aufgeführt.<br />
Das Sedimentationsmaterial in Form von Sand wurde jeweils<br />
von 13,67 m bis 15,33 m verteilt (Bild 5, links). Mit dieser Variante<br />
wird der Fall nachgebildet, dass sich bereits Sediment abgelagert<br />
hat, welches durch die einsetzende Wasserströmung<br />
abgetragen werden soll (Bild 5, rechts).<br />
Es hat sich herausgestellt, dass die Strukturierung V1 eine<br />
Verringerung der Transportzeit um durchschnittlich 38 % bewirkt<br />
(Tabelle 2).<br />
Praktische Umsetzung<br />
In einem Feldversuch vom Zweckverband Wasser Abwasser<br />
Plauen/Vogtland zur Verfügung gestellten Stauraumka-<br />
984 12 / 2011
Bild 5: Sandschicht von<br />
13,67 m bis 15,33 m (links)<br />
und während eines Versuches<br />
- Pfeil: Strömungsrichtung<br />
(rechts)<br />
Bild 6: Stauraumkanal DN 1600 (links) und Einbauzustand der eingeharzten Glasfasermatte (rechts)<br />
nal DN 1600 (Bild 6) bei Adorf (Vogtland) konnte die Entwicklung<br />
in der Praxis getestet werden. Erstmals wurde ein<br />
75 m langer Abschnitt mit den im Stickprozess strukturierten<br />
und anschließend eingeharzten Glasfasermatten bestückt.<br />
Einen Monat nach dem Einbau erfolgte eine erste Begutachtung<br />
der im Kanal eingebrachten Strukturbahnen. Hierbei<br />
stellte sich heraus, dass sich die Gewebahnen mit dem Untergrund<br />
fest verbunden haben und die Strukturkörper sowohl<br />
die charakteristische Form als auch die Robustheit aufweisen,<br />
um den rauhen Betriebsbedingungen im Kanal standhalten<br />
und eine positive Beeinflussung des Medientransportes<br />
bewirken zu können.<br />
Allein im Jahr 2009 wurden im Bereich des ZWAV Plauen<br />
96.900 m Kanäle gespült. Durch den Einsatz dieser neuen<br />
Materialien sind Kosteneinsparungen vor allem im Bereich<br />
der Reinigung möglich.<br />
Danksagung<br />
Wir danken dem Bundesministerium für Bildung und Forschung<br />
für die finanzielle Förderung des Wachstumskerns highSTICK<br />
im Rahmen der Innovationsinitiative Neue Länder Unternehmen<br />
Region, die als Zuwendung aus dem Bundeshaushalt erfolgt,<br />
sowie dem Projektträger Jülich GmbH, Außenstelle Berlin<br />
für die Unterstützung.<br />
Autoren<br />
Dipl.-Des. (FH) Nora Grawitter<br />
Textilforschungsinstitut Thüringen-<br />
Vogtland e. V., Greiz<br />
Tel. +49 3661 6113 11<br />
E-Mail: n.grawitter@titv-greiz.de<br />
Dipl.-Phys. Jörg Labahn<br />
FITR – Forschungsinstitut für Tief- und<br />
Rohrleitungsbau gemeinnützige GmbH,<br />
Weimar, Fachbereich Leitungsbionik<br />
Tel. +49 3643 8268-32<br />
E-Mail: joerg.labahn@fitr.de<br />
12 / 2011 985
Projekt kurz beleuchtet<br />
Abwasserentsorgung<br />
Einsatz von Stahlbetonrohren für Erweiterung des<br />
Hochwasserrückhaltebeckens<br />
Ausbau des Hochwasserschutzes in<br />
Glashütte<br />
Hintergrund<br />
Die Erweiterung des Hochwasserrückhaltebeckens (HRB)<br />
Glashütte I im Tal des Prießnitzbaches ist Teil des Hochwasserschutzkonzeptes<br />
und dient dem Schutz der Stadt Glashütte<br />
und der Bewohner des Müglitztales. Im Auftrag des Sächsisches<br />
Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft,<br />
vertreten durch die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates<br />
Sachsen, wird das vorhandene Becken auf Grundlage neuester<br />
Berechnungen durch eine Erhöhung des vorhandenen<br />
Damms ausgebaut. Auch bei der Erstellung des 142 m langen<br />
Hochwasserentlastungsstollens setzten der Auftraggeber und<br />
das beauftragte Unternehmen, die STRABAG AG Direktion<br />
Sachsen, auf Qualität. Für das in offener Bauweise hergestellte<br />
Bauwerk kamen Stahlbetonrohre DN 3500/4300 in der Betonqualität<br />
C 40/50 zum Einsatz. Die bei der HABA-Beton Johann<br />
Bartlechner KG, einem Mitgliedsunternehmen der FBS,<br />
Fachvereinigung Betonrohre und Stahlbetonrohre e.V., gefertigten<br />
Falzmuffenrohre mit einer Baulänge von 2,50 m verfügen<br />
über eine Gleitringdichtung und wurden entsprechend der<br />
FBS-Qualitätsrichtlinie hergestellt.<br />
BILD 1: Rund 142 m lang ist der Hochwasserentlastungsstollen der im Rahmen der Erweiterungdes Hochwasserrückhaltebeckens<br />
(HRB) Glashütte I neu gebaut wird<br />
Foto: HABA<br />
986 12 / 2011
Die Schreckensbilder der Hochwasserkatastrophe im<br />
Sommer 2002 stehen den Beteiligten noch deutlich vor Augen.<br />
Damals brach der im Jahr 1953 erbaute Damm des Rückhaltebeckens,<br />
weil er den Wassermassen nicht mehr Stand<br />
halten konnte. Nun werden Damm und Becken, die in den Jahren<br />
2005 und 2006 wieder hergestellt wurden, noch einmal<br />
erweitert. Die Höhe des neuen Damms beträgt 28,28 m über<br />
Gewässersohle. Er verfügt über eine Kronenlänge von 167 m<br />
und eine Kronenbreite von 5 m. Der erweiterte Stauraum hat<br />
ein Fassungsvermögen von rund 1,05 Mio. m³. Nach Auskunft<br />
der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen<br />
wurden die ersten vorbereitenden Arbeiten zur Freimachung<br />
des Baufeldes im März 2009 begonnen und kontinuierlich bis<br />
zur Winterperiode 2009/2010 fortgeführt. Die Arbeiten des<br />
Bauhauptloses zur Dammerweiterung begannen im März<br />
2010 und sollen bis August 2012 abgeschlossen sein.<br />
BILD 2: Die eingesetzten Stahlbetonrohre DN 3500/4300<br />
wurden bei der HABA-Beton JohannBartlechner KG entsprechend<br />
der FBS-Qualitätsrichtlinie gefertigt<br />
Foto: HABA<br />
Stabile Rohrbettung<br />
Neben umfangreichen Erdarbeiten und der Erstellung von<br />
technischen Bauwerken zählen die Betonage des Betriebsauslasses<br />
und der Neubau der Hochwasser-Entlastungsanlage<br />
zu den auszuführenden Arbeiten. Die Hochwasser-Entlastungsanlage<br />
besteht aus einem Überfallturm mit Entlastungstrichter.<br />
Die Gesamtlänge beträgt rund 170 m, wovon 28 m<br />
auf das Tosbecken und 142 m auf den Hochwasserentlastungsstollen<br />
entfallen. Dieser wurde aus FBS-Stahlbetonrohren<br />
DN 3500/4300 errichtet. Die 28 t schweren Falzmuffenrohre<br />
wurden in der HABA-Beton Niederlassung Großsteinberg<br />
gefertigt und entsprechend der zeitlichen Vorgaben des<br />
bauausführenden Unternehmens zur Einbaustelle geliefert.<br />
Vor Ort setzte ein Mobilkran die Schwergewichte auf ein vorab<br />
hergestelltes Betonfundament, wobei Betonriegel als Auflager<br />
dienten. Nach dem Zusammenfügen der Rohre wurde<br />
die Bettungszone abschließend mit Beton vergossen.<br />
BILD 3: Vor Ort setzte ein Mobilkran die Schwergewichte auf<br />
ein vorab hergestelltes Betonfundament, wobei Betonriegel als<br />
Auflager dienten<br />
Foto: HABA<br />
Zeichen von Qualität<br />
Die eingesetzten Stahlbetonrohre entsprechen der FBS-Qualitätsrichtlinie<br />
Teil 1.1. Diese gilt für FBS-Betonrohre, FBS-<br />
Stahlbetonrohre, FBS-Vortriebsrohre und zugehörige FBS-<br />
Gelenkrohre und FBS-Passrohre Typ 2 mit Kreisquerschnitt<br />
nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, die von FBS-Mitgliedsfirmen<br />
hergestellt werden und das FBS-Qualitätszeichen tragen.<br />
„Damit verfügen die Rohre über ein zusätzliches Plus“,<br />
wie HABA-Werkleiter Dipl.-Ing. (FH) Dirk Hensel feststellt.<br />
Das FBS-Qualitätssicherungssystem mit seiner umfassenden<br />
werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) stellt eine für<br />
Rohrwerkstoffe einmalige und lückenlose Qualitätskontrolle<br />
von den Ausgangsstoffen über die Herstellung bis zu den<br />
Endprodukten sicher. Im Rahmen der halbjährlichen Fremdüberwachung<br />
durch bauaufsichtlich anerkannte Güteschutzgemeinschaften<br />
oder Prüfinstitute, wird die Erfüllung der<br />
Norm- und FBS-Anforderungen kontrolliert und bewertet.<br />
Hinter dem FBS-Qualitätszeiche steht damit ein System, das<br />
dem Anwender von FBS-Kanalbauteilen eine hohe Qualität<br />
garantiert.<br />
BILD 4: Nach dem Zusammenfügen der Rohre wurde die<br />
Bettungszone abschließend mit Beton vergossen<br />
Foto: HABA<br />
Kontakt<br />
FBS Fachvereinigung Betonrohre und Stahlbetonrohre e.V.,<br />
Bonn, Tel. +49 228 9545643 E-Mail: info@fbsrohre.de,<br />
www.fbsrohre.de<br />
12 / 2011 987
Projekt kurz beleuchtet<br />
Abwasserentsorgung<br />
Schlauchlining im Großprofil mit<br />
90°-Bogen<br />
Seit 2005 führt die Stadt Oer-Erkenschwick regelmäßig Sanierungsmaßnahmen<br />
an den städtischen Abwasserkanälen<br />
durch. Grundlage hierzu bildet das im Jahr 2004 fortgeschriebene<br />
Abwasserbeseitigungskonzept. Bei der Planung und<br />
Ausschreibung der Maßnahmen wird die Stadt Oer-Erkenschwick<br />
durch das Ingenieurbüro Henschel, Umwelttechnologie<br />
und Sanierung, aus Hattingen unterstützt.<br />
Für das Jahr 2011 war im Abwasserbeseitigungskonzept<br />
der Stadt Oer-Erkenschwick u. a. die Sanierung eines Großprofils<br />
DN 1500, das als Vorfluter für den im Stadtgebiet verlaufenden<br />
Westerbach dient, vorgesehen. Dieser Kanal<br />
stammt aus dem Jahr 1974 und wurde damals als Ortbetonbauwerk<br />
erstellt. Aufgrund der vorgefundenen Schadensbilder<br />
wie Innenkorrosion, Rissbildung, Infiltrationen usw. wurde<br />
vom planenden Ingenieurbüro eine Renovierung der gesamten<br />
Haltung vorgesehen. Neben den Schäden war die Geometrie<br />
des Kanals ein wichtiges Kriterium bei der Sanierungsplanung.<br />
Der insgesamt etwa 80 m lange Kanal verläuft in<br />
Fließrichtung zunächst ca. 60 m gradlinig. Bevor der Kanal als<br />
freier Auslauf in den Westerbach endet, ist er über eine Länge<br />
von 20 m als Kurvenbauwerk ausgebildet, so dass sich ein<br />
Bogen von etwa 90° ergibt. Dieser Bogenbereich war ebenfalls<br />
Bestandteil der Sanierungsplanung.<br />
Auswahl des Liners und vorbereitende<br />
Arbeiten<br />
Zur Ausführung kam das Angebot der Firma Insituform, Niederlassung<br />
Münster, das den Einbau eines Synthesefaser-Schlauchliners<br />
über die gesamte Haltungslänge einschließlich des Bogenbereiches<br />
vorsah. Ausschlaggebende Kriterien für die Vergabe<br />
waren für die Stadt Oer-Erkenschwick die geringe Querschnittsverringerung,<br />
die Vorteile eines muffenlosen Rohres<br />
nach der Sanierung, eine kurze Bauzeit, ein DIBt-zugelassenes<br />
Verfahren sowie die Erfahrungen des Auftragnehmers mit der<br />
Sanierung großer Profile. Obwohl im gesamten Stadtgebiet Oer-<br />
Bild 1: Inversion am Startschacht direkt vom LKW<br />
988 12 / 2011
Erkenschwick mittlerweile mehrere Kilometer Abwasserkanal<br />
mittels unterschiedlicher Liningverfahren renoviert wurden,<br />
stellte die Sanierung des Großprofils DN 1500 für die Beteiligten<br />
des Auftraggebers eine interessante Abwechslung dar.<br />
Im Rahmen der Kalibrierung vor der Herstellung des Liners<br />
wurden starke Maßtoleranzen innerhalb des Rohrquerschnittes<br />
festgestellt. So konnten Innendurchmesser zwischen<br />
DN 1401 und DN 1512 über die gesamte Haltungslänge<br />
verteilt gemessen werden. Aufgrund dieser Feststellung<br />
entschied sich IRT einen Sonderschlauch mit einem Durchmesser<br />
DN 1470 einzusetzen, um das Risiko einer Faltenbildung<br />
zu verringern, aber gleichzeitig die Ringspaltbildung innerhalb<br />
der zulässigen Grenzwerte gewährleisten zu können.<br />
Für die Wasserhaltungsmaßnahmen konnte ein parallel zu<br />
der zu sanierenden Haltung verlaufender Sammler DN 1600<br />
genutzt werden. Dazu wurde oberhalb der betroffenen Haltungen<br />
ein ca. 3,0 m langes Provisorium aus PVC-U DN 800<br />
zur Überleitung erstellt. Die notwendigen Tiefbaumaßnahmen<br />
bestanden aus einer Kleinbaugrube und dem Teilabbruch<br />
von zwei Schachtbauwerken. Aufgrund dieser Überleitung<br />
konnte der Aufwand für das Umpumpen des anfallenden<br />
Mischwassers erheblich reduziert werden. Zur Inversion des<br />
Liners musste am Startschacht der zu sanierenden Haltung<br />
lediglich die Abdeckplatte einschließlich Konus entfernt werden.<br />
Des Weiteren wurden im Vorlauf größere Undichtigkeiten,<br />
Ausbrüche und Ablagerungen im Großprofil händisch beseitigt.<br />
Bild 2: „Kopf“ (Schlauchende) des Liners während der<br />
Aushärtung<br />
Bild 3: Unwesentliche Faltenbildung im Bogenbereich<br />
Reibungsloser Projektablauf<br />
Der Einbau des Liners war für die KW 16 vorgesehen. Pünktlich<br />
zu diesem Zeitpunkt waren alle notwendigen vorbereitenden<br />
Maßnahmen (Tiefbauarbeiten, Baustraße, Wasserhaltung)<br />
abgeschlossen. Im Laufe des Montags wurde der Inversionsturm<br />
einschließlich Förderband aufgestellt und die<br />
Baustelle nach den Bedürfnissen des Auftragnehmers eingerichtet.<br />
Am Morgen des folgenden Tages erfolgte die Anlieferung<br />
des gekühlten Synthesefaser-Schlauchliners mit einer<br />
Wanddicke von 24 mm, so dass der Einbau wie geplant starten<br />
konnte. Der Einbau und die Aushärtung wurden im<br />
Schlauchlining-Verfahren mittels Inversion und Warmwasserhärtung<br />
durchgeführt. Da der Inversionsvorgang ohne Komplikationen<br />
gegen Nachmittag abgeschlossen war, konnte<br />
planmäßig mit der Heizphase begonnen werden.<br />
Das Ende des „umgestülpten“ Liners wurde durch den Einzug<br />
mehrerer Heizschläuche und Seile gesichert, so dass der<br />
Inversionsvorgang im Bereich des freien Auslaufs kontrolliert<br />
beendet werden konnte. Nach der Beendigung des Aushärtevorgangs<br />
gegen Ende der Woche wurde eine erste Begehung<br />
des eingebauten Liners vorgenommen. Das Ergebnis der<br />
Sanierungsmaßnahme beeindruckte alle Projektbeteiligten,<br />
da selbst innerhalb des Bogenbereiches und trotz der Nennweitenunterschiede<br />
keine nennenswerte Faltenbildung im Liner<br />
festgestellt werden konnte. Die maximal gemessene Faltenhöhe<br />
lag mit 10 mm weit unter den zugelassenen Werten.<br />
Die Ergebnisse der Dichtheitsprüfung und der Materialkennwerte<br />
bestätigten das sehr gute Sanierungsergebnis.<br />
Bild 4: Fertig sanierte Haltung mit parallel verlaufendem<br />
Sammler DN 1600<br />
Mit dem vorliegenden Beispiel konnte gezeigt werden,<br />
dass mit planerischem Know-how, bewährten Sanierungsverfahren<br />
und -materialien sowie optimalen Baustellenabläufen<br />
auch Sanierungsvorhaben mit außergewöhnlichen Randbedingungen<br />
erfolgreich umgesetzt werden können.<br />
Kontakt<br />
Ingenieurbüro Henschel, Dipl.-Ing. J. Wozniak,<br />
E-Mail: j.wozniak@ibhenschel.de<br />
12 / 2011 989
Projekt kurz beleuchtet<br />
Abwasserentsorgung<br />
Wasserdampfdiffusionsfähig, resistent gegen Schwefelsäure<br />
Instandsetzung des Abwasserpumpwerks<br />
in Halle-Neustadt<br />
Wenn Säure frisst<br />
In Halle-Neustadt stand die Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft<br />
GmbH vor einer Herausforderung: Das Abwasserpumpwerk,<br />
1967 erbaut, wies an einigen Bauteilen erhebliche<br />
Schäden auf, die behoben werden mussten. Für die Instandsetzung<br />
des Beckens durfte das Pumpwerk allerdings<br />
nur für kurze Zeit außer Betrieb gehen. Die Sanierung mit dem<br />
Hightech-Mörtel ombran MHP sowie einer anschließenden<br />
ombran CPS Beschichtung auf Basis der Hybrid-Silikat-Technologie<br />
der Bottroper MC Bauchemie war die Lösung: eine<br />
Technologie, die Resistenz auch gegen biogene Schwefelsäure<br />
bei Wasserdampfdiffusionsfähigkeit bietet.<br />
Aus betreiber- und sicherheitstechnischen Gründen war<br />
die Instandsetzung des Schmutzwassersammelbeckens und<br />
des Gerinnes unterhalb des Rechenraumes im Abwasserpumpwerk<br />
(APW) Halle-Neustadt nötig, um die Anforderungen<br />
der Standsicherung bestimmter Deckenabschnitte wieder<br />
herzustellen und um die Fortschreitung der baulichen<br />
Schädigung aufzuhalten. Diese ist altersbedingt unausweichlich.<br />
Abwasserbauwerke müssen sowohl im kommunalen als<br />
auch im industriellen Bereich höchsten Beanspruchungen<br />
standhalten. Im Kontakt mit Medien in pH-Bereichen von unter<br />
3,5 oder mit Chemikalien wie Schwefelsäure geraten<br />
zementgebundene Baustoffe an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit.<br />
In Pumpenschächten entsteht zwangsläufig biogene<br />
Schwefelsäure und die pH-Werte liegen in der Regel unter-<br />
halb von 3,5. In der Folge werden Betonbauteile geschädigt<br />
und regelrecht zerfressen.<br />
Wasserdampfdiffusionsfähigkeit -<br />
Ein groSSes Plus<br />
Die Hybrid-Silikattechnologie, auf deren Grundlage die MC<br />
Bauchemie, das Produkt ombran CPS für die Kanal- und<br />
Schachtinstandsetzung, entwickelt hat, schützt Bauwerke<br />
langfristig vor solchen aggressiven Angriffen.<br />
ombran CPS ist ein 3-komponentiges Beschichtungssystem<br />
bestehend aus Harz, Härter und Pulver. Beim Reaktionsverlauf<br />
nach der Mischung führt der Prozess der Trimerisation<br />
zu einem dreidimensionalen, voll vernetzten Molekülgerüst,<br />
das eine dichte, für Schadstoffe undurchdringbare Beschichtungsmatrix<br />
bildet.<br />
Trotz der hohen Dichtigkeit ist ombran CPS wasserdampfdiffusionsfähig<br />
– ein wesentliches Merkmal des Beschichtungsmaterials.<br />
Abwasserkanäle, -schächte und -pumpwerke grenzen direkt<br />
an das Erdreich. Hier findet ein physikalischer Konzentrationsausgleich<br />
zwischen feuchtem Erdreich und Bauwerk statt.<br />
Sind Beschichtungen nicht wasserdampfdiffusionsfähig, wird<br />
der natürliche Ausgleichsprozess zwischen Erdreich und Bauwerksinnenraum<br />
unterbrochen. So können sich Osmose- und<br />
Kapillardrücke aufbauen, denen diese Beschichtungen in der<br />
Regel nicht standhalten. Eine mögliche Folge: Blasenbildung,<br />
Bild 1: Ausbrüche im Bodenbereich (links) und geschädigte Bauwerksflächen durch BSK (rechts)<br />
990 12 / 2011
Ablösungen und Abplatzungen an der Beschichtung. Das sanierte<br />
Bauwerk muss kurzfristig wieder saniert werden.<br />
Die Wasserdampfdiffusionsfähigkeit von ombran CPS und<br />
die damit verbundene Dauerhaftigkeit waren Vorteile, die sowohl<br />
den Betreiber, die Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft<br />
GmbH, als auch die Ingenieure des beauftragten Weimarer<br />
Ingenieurbüros Peuker & Nebel überzeugten.<br />
Sanierung step by step<br />
Die Sanierung erfolgte in drei Bauabschnitten. Das Becken wurde<br />
mittels Trennwand geteilt. Während mit einer Beckenhälfte<br />
der laufende Betrieb des Pumpwerks sichergestellt wurde,<br />
konnte die andere Hälfte des Pumpwerks instand gesetzt werden.<br />
Die Installation der Trennwand musste bei Trockenwetter<br />
erfolgen, da nur dann eine Außerbetriebnahme des Pumpwerks<br />
möglich war. Problematisch dabei war das enge Zeitfenster:<br />
nur fünf Stunden standen dem ausführenden Unternehmen,<br />
der Bennert Ingenieurbau GmbH für den Einbau der Trennwand<br />
zur Verfügung. Nach Einbau der Trennwand wurden die vorbereitenden<br />
Arbeiten ausgeführt, das heißt, Sammelbecken<br />
und Gerinne wurden zunächst gereinigt und gestrahlt. In den<br />
nur fünf Stunden der Außerbetriebnahme wurde anschließend<br />
im Zulaufbereich des Gerinnes der schnell aushärtende Mörtel<br />
ombran MHP aufgebracht, um den Untergrund auszugleichen.<br />
In einem weiteren Arbeitsschritt wurde hier eine Polyuretanbeschichtung<br />
im Heißspritzverfahren appliziert.<br />
Der Schutzanstrich im Sammelbecken des Abwasserpumpwerks<br />
hatte sich größtenteils aufgelöst, der Oberflächenbeton<br />
war aufgeweicht, die Zementmatrix hatte sich gelöst.<br />
Außerdem war bereits punktuell eine Korrosion der Bewehrung<br />
erkennbar. Der zulässige Sulfatgehalt im Beton wurde<br />
teils ab einer Tiefe von vier Zentimetern erreicht. Die<br />
schadhafte Betonschicht wurde daher bis zum Kernbeton abgetragen,<br />
die freiliegende Bewehrung gesäubert und geschützt<br />
und anschließend die Betondeckung wieder hergestellt.<br />
Zum langfristigen Schutz des Bauwerks wurde schlussendlich<br />
die Beschichtung mit ombran CPS ausgeführt.<br />
Schutz gegen biogene Schwefelsäure<br />
Substanzverluste von mehreren Zentimetern Beton pro Jahr<br />
sind eine Folge der häufigsten Beanspruchung im Gasraum geschlossener<br />
Abwasserbauwerke: die biogene Schwefelsäurekorrosion<br />
(BSK). Dabei entstehen pH-Werte im Bereich von 0<br />
bis 3,5, die ungeschützte Betone und zementgebundene Mörtel<br />
zerstören. Die biogene Schwefelsäure zersetzt den Zementstein.<br />
In diesem Anwendungsfeld bleibt ombran CPS dank<br />
der Hybrid-Silikattechnologie auch dann noch beständig gegen<br />
Chemikalien, wenn andere Beschichtungen ihre Wirkung<br />
längst verloren haben. Schachtbauwerke, Abwasserkanäle und<br />
-pumpwerke werden vor der Beanspruchung durch die biogene<br />
Schwefelsäurekorrosion geschützt. Dabei ist ombran<br />
CPS sowohl im sauren (pH-Wert ≤ 1,0) als auch im alkalischen<br />
Bereich (pH-Wert ≥ 12,0) dauerhaft beständig.<br />
Neben der Wasserdampfdiffusionsfähigkeit und der BSK-<br />
Resistenz ist das System säuredicht, schlag und kratzfest.<br />
Bild 2: Spritzverarbeitung von ombran CPS<br />
Bild 3: Übergangsbereich Boden-Wand<br />
Instand gesetzt und langfristig<br />
geschützt<br />
In nur vier Monaten waren die wesentlichen Arbeiten der Instandsetzung<br />
abgeschlossen und das Pumpwerk konnte wieder<br />
in Betrieb genommen werden. Die Abnahmeuntersuchungen<br />
im Anschluss an die Instandsetzung überzeugte die Hallesche<br />
Wasser und Stadtwirtschaft GmbH.<br />
„Wir haben unser Ziel erreicht. Nach den fachmännisch<br />
ausgeführten Arbeiten und den positiven Ergebnissen der Abnahmeuntersuchung<br />
gehen wir davon aus, dass das sanierte<br />
Pumpwerk langfristig geschützt und der Betrieb dauerhaft<br />
gesichert ist“, resümiert André Pforte von der Halleschen<br />
Wasser und Stadtwirtschaft GmbH.<br />
Kontakt<br />
Hallesche Wasser- und Stadtwirtschaft GmbH, Halle (Saale),<br />
Dipl.-Ing. André Pforte, E-Mail: Andre.Pforte@hws-halle.de;<br />
Ingenieurbüro Peuker & Nebel GbR, Weimar, Dipl.-Ing Sabine<br />
Kleiner, E-Mail: s.kleiner@peuker-nebel.de; Bennert Ingenieurbau<br />
GmbH, Hopfgarten, Dipl.-Ing. Sascha Wehling,<br />
E-Mail: wehling.sascha@bennert.de;<br />
MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG, Bottrop, Gunter<br />
Kaltenhäuser, Tel. +49 2041 101-0, www.mc-bauchemie.de<br />
12 / 2011 991
Praxis-tipps<br />
Services<br />
Easypix<br />
Einfach und schnell Scans anfertigen<br />
Seiten rausreißen oder Texte abschreiben<br />
ist vorbei – heute wird nur noch gescannt!<br />
Und zwar überall. Und zu jeder Zeit komplett<br />
mobil! Der EasyScan Bluetooth<br />
scannt alle Dokumente (Bilder, Texte,<br />
Urkunden usw.) und versendet diese<br />
sofort per E-Mail an das Smartphone oder<br />
den Computer.<br />
Standardmäßig ist der EasyScan Bluetooth<br />
auf eine Auflösung von 300 x 300<br />
dpi eingestellt. Eine Schwarzweiß-Seite<br />
in A5 schafft er in zwei Sekunden. Die<br />
Scanbreite beträgt ungefähr 21,6 cm,<br />
die Länge variiert nach der eingestellten<br />
Auflösung. Falls die Seiten mal übergroß<br />
sein sollten, können die Scans mit Hilfe<br />
der beiliegenden Software zusammensetzen<br />
werden. Auch das OCR-Programm<br />
„ABBYY“ gehört zum Lieferumfang. Systemvoraussetzung<br />
für einen Anschluss<br />
an den Rechner sind Windows XP, Windows<br />
Vista, Windows 7 und Mac OS 10.4<br />
oder höher. Ist diese gegeben, kann man<br />
das Gerät direkt über USB 2.0 verbinden,<br />
ohne einen Treiber installieren zu müssen.<br />
Erhältlich ist der Scanstift schon ab 76<br />
Euro u.a. bei Amazon.<br />
Kontakt:<br />
www.easypix.eu<br />
Apple<br />
Das iPhone wird zum Projektor<br />
Mit dem Keymate iPhone Beamer wird es<br />
möglich Filme, Fotos und Präsentationen<br />
direkt und mobil an die Wand zu pojektizieren.<br />
So klein und flexibel war ein Beamer<br />
noch nie. Der Keymate Projektor ist kaum<br />
größer als eine Hülle für das iPhone. Der<br />
Beamer passt in jede Laptop- und Handtasche<br />
und ist speziell auf das iPhone 4<br />
ausgelegt. Im Gegensatz zu anderen Mini-<br />
Projektoren ist der Keymate Beamer noch<br />
kompakter und kommt ohne zusätzliche<br />
Verkabelung bei der Nutzung aus. Ein<br />
zusätzlicher Clou: Sollte man den Beamer<br />
nicht verwenden, dient er unterwegs als<br />
Extra-Akku, der die Laufzeit des iPhone<br />
um rund 50 % verlängert.<br />
Die Bedienung des Beamers erweist<br />
sich als unkompliziert: Das iPhone wird<br />
einfach in den Beamer eingesetzt, beide<br />
Geräte kommunizieren über den Dockanschluss<br />
des Smartphones mitein-<br />
ander. Nachdem der<br />
Beamer eingeschaltet<br />
wurde, können Bilder und<br />
Videos im Format 16:9<br />
an eine möglichst helle<br />
Fläche geworfen werden.<br />
Bei einer Auflösung von<br />
640 x 360 Pixel erreicht<br />
das Bild eine Helligkeit<br />
von 12 Lumen. Über ein<br />
kleines Rädchen an der<br />
Seite des Gerätes kann<br />
die Schärfe des Bildes<br />
reguliert werden. Ein zusätzlicher<br />
Lautsprecher sorgt für einen<br />
guten und ausreichend lauten Ton beim<br />
Abspielen von Videos. Der interierte Akku<br />
soll, laut Hersteller, für rund 2,5 Stunden<br />
ausreichen.<br />
Der Beamer kann mit seinem Mini-<br />
USB-Anschluss am Mac oder PC aufgeladen<br />
werden. Parallel wird das iPhone wie<br />
gewohnt geladen und synchronisiert. Preis<br />
des Minibeamers: 199 Euro.<br />
Kontakt:<br />
www.apple.com<br />
992 12 / 2011
Als gedrucktes<br />
Heft oder<br />
digital als ePaper<br />
erhältlich<br />
Clever kombiniert und doppelt clever informiert<br />
<strong>3R</strong> + gwf Wasser Abwasser<br />
im Kombi-Angebot<br />
Wählen Sie einfach das<br />
Bezugsangebot, das<br />
Ihnen am besten zusagt!<br />
· Als Heft das gedruckte,<br />
zeitlos- klassische Fachmagazin<br />
· Als ePaper das moderne, digitale<br />
Informationsmedium für Computer,<br />
Tablet oder Smartphone<br />
+<br />
<strong>3R</strong> International erscheint in der Vulkan-Verlag GmbH, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen<br />
gwf Wasser Abwasser erscheint in der Oldenbourg Industrieverlag GmbH, Rosenheimerstr. 145, 81671 München<br />
Oldenbourg Industrieverlag · Vulkan-Verlag<br />
www.oldenbourg-industrieverlag.de · www.vulkan-verlag.de<br />
Vorteilsanforderung per Fax: +49 (0) 931 / 4170 - 492 oder im Fensterumschlag einsenden<br />
Ja, ich möchte clever kombinieren und bestelle für ein Jahr die Fachmagazine <strong>3R</strong> (12 Ausgaben) und<br />
gwf Wasser Abwasser (12 Ausgaben) im attraktiven Kombi-Bezug.<br />
□ Als Heft für 528,- zzgl. Versand (Deutschland: € 57,-/Ausland: € 66,50) pro Jahr.<br />
□ Als ePaper (PDF-Datei) für 528,- pro Jahr.<br />
Vorzugspreis für Schüler und Studenten (gegen Nachweis):<br />
□ Als Heft für 264,- zzgl. Versand (Deutschland: € 57,-/Ausland: € 66,50) pro Jahr.<br />
□ Als ePaper (PDF-Datei) für 264,- pro Jahr.<br />
Nur wenn ich nicht bis von 8 Wochen vor Bezugsjahresende kündige, verlängert sich der Bezug um<br />
ein Jahr. Die sichere und pünktliche Bezahlung per Bankabbuchung wird mit einer Gutschrift von € 20,–<br />
auf die erste Jahresrechnung belohnt.<br />
Antwort<br />
Leserservice <strong>3R</strong><br />
Postfach 91 61<br />
97091 Würzburg<br />
Firma/Institution<br />
Vorname/Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
E-Mail<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise □ Bankabbuchung □ Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, E-Mail) oder durch<br />
Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige<br />
Absendung des Widerrufs oder der Sache an den Leserservice <strong>3R</strong>, Postfach 91 61, 97091 Würzburg.<br />
Bankleitzahl<br />
✘<br />
Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer<br />
PA<strong>3R</strong>IN0411<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pfl ege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst, gespeichert und verarbeitet. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich vom<br />
Oldenbourg Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag □ per Post, □ per Telefon, □ per Telefax, □ per E-Mail, □ nicht über interessante Fachangebote informiert und beworben werde. Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
Aktuelle Termine<br />
Services<br />
Seminare – brbv<br />
Spartenübergreifend<br />
Grundlagenschulungen<br />
Fachaufsicht (A/B) für horizontales Spülbohrverfahren<br />
nach GW 329<br />
09.-13.01.2012 Oldenburg<br />
09.-18.01.2012 Oldenburg<br />
Bauleiter (A/B) für horizontales Spülbohrverfahren<br />
nach GW 329<br />
16.-27.01.2012 Oldenburg<br />
16.01.-03.02.2012 Oldenburg<br />
Geräteführer (A/B) für horizontales Spülbohrverfahren<br />
nach GW 329<br />
16.-31.01.2012 Oldenburg<br />
16.01.-07.02.2012 Oldenburg<br />
GFK-Rohrleger nach DVGW-Arbeitsblatt W<br />
324 – Nachschulung<br />
13.01.2012 Gera<br />
13.02.2012 Gera<br />
Baustellenabsicherung und Verkehrssicherung<br />
RSA/ZTV-SA – 1 Tag<br />
17.01.2012 Berlin<br />
22.02.2012 Köln<br />
Informationsveranstaltungen<br />
Bauausführung<br />
24.01.2012 Halle<br />
Abnahme und Gewährleistung<br />
25.01.2012 Halle<br />
Arbeitssicherheit im Tief- und Rohrleitungsbau<br />
17.01.2012 Bad Zwischenahn<br />
16.02.2012 Kassel<br />
Baurecht 2012<br />
12.01.2012 Frankfurt/Main<br />
16.02.2012 Hamburg<br />
Einbau und Abdichtung von Netz- und<br />
Hausanschlüssen bei Neubau und Sanierung<br />
02.02.2012 Leipzig<br />
Gas/Wasser<br />
Grundlagenschulungen<br />
Zusatzqualifikation Netzingenieur/in –<br />
Modul Gas<br />
5 Termine ab 13.02.-21.03.2012<br />
Steinfurt und Essen<br />
GW 128 Grundkurs „Vermessung“<br />
9 Termine ab 16.01.2012<br />
bundesweit<br />
GW 128 Nachschulung „Vermessung“<br />
7 Termine ab 09.01.2012<br />
bundesweit<br />
Schweißaufsicht nach DVGW-Merkblatt<br />
GW 331<br />
16.-20.01.2012 Hannover<br />
23.-27.01.2012 Würzburg<br />
30.01.-03.02.2012 Aachen<br />
20.-24.02.2012 Leipzig<br />
PE-HD Schweißer nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
GW 330 – Grundkurs<br />
46 Termine ab 02.01.2012 bundesweit<br />
PE-HD Schweißer nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
GW 330 – Verlängerung<br />
74 Termine ab 03.01.2012 bundesweit<br />
Nachumhüllen von Rohren, Armaturen und<br />
Formteilen nach DVGW-Merkblatt GW 15<br />
– Grundkurs<br />
31 Termine ab 02.01.2012 bundesweit<br />
Nachumhüllen von Rohren, Armaturen und<br />
Formteilen nach DVGW-Merkblatt GW 15<br />
– Nachschulung<br />
37 Termine ab 04.01.2012 bundesweit<br />
Fachkraft für Muffentechnik metallischer<br />
Rohrsysteme – DVGW-Arbeitsblatt W 339<br />
30.01.-01.02.2012 Bad Zwischenahn<br />
27.-29.02.2012 Gera<br />
27.-29.02.2012 Leipzig<br />
Kunststoffrohrleger<br />
09.-11.01.2012 Gera<br />
Informationsveranstaltungen<br />
Aufbaulehrgänge Gas/Wasser<br />
16 Termine ab 10.01.2012 bundesweit<br />
Netzmeister/Rohrnetzmeister- Erfahrungsaustausch<br />
05./06.03.2012 Berlin<br />
19./20.03.2012 Köln<br />
Arbeiten an Gasleitungen – BGR 500 Kap.<br />
2.31<br />
10.01.2012 Mannheim<br />
15.02.2012 Nürnberg<br />
23.02.2012 Münster<br />
Kunststoffrohre in der Gas- und Wasserversorgung<br />
– Verlängerung zur GW 331<br />
07.02.2012 Bad Zwischenahn<br />
Bau von Gas- und Wasserrohrleitungen<br />
31.01./01.02.2012 Kassel<br />
Bau von Wasserrohrleitungen<br />
14./15.02.2012 Nürnberg<br />
Bau von Gasrohrnetzen bis 16 bar<br />
18./19.01.2012 Bremen<br />
Techniklehrgang für Vorarbeiter im Rohrleitungsbau<br />
– Gas/Wasser<br />
23.-27.01.2012 Hamburg<br />
06.-10.02.2012 Kerpen<br />
Reinigung und Desinfektion von Wasserverteilungsanlagen<br />
28.02.2012 Stuttgart<br />
DVGW-Arbeitsblatt GW 301 – Qualitätsanforderungen<br />
für Rohrleitungsbauunternehmen<br />
22.02.2012 Münster<br />
Praxisseminare<br />
Druckprüfung von Gasrohrleitungen<br />
17.01.2012 Frankfurt/Main<br />
Druckprüfung von Wasserrohrleitungen<br />
18.01.2012 Frankfurt/Main<br />
Arbeiten an Gasleitungen – BGR 500,<br />
Kap. 2.31 – Fachaufsicht<br />
23.-27.01.2012 Gera<br />
13.-17.02.2012 Gera<br />
Einführung in die Gasdruckregel- und<br />
Messtechnik<br />
27.-29.02.2012 Erfurt<br />
01.12.2011 Mellendorf<br />
Fernwärme<br />
Grundlagenschulungen<br />
Geprüfter Netzmeister Fernwärme –<br />
Vollzeitlehrgang<br />
30.01.-16.03.2012 Berlin und Köln<br />
Zusatzqualifikation Fernwärme<br />
30.01.-16.03.2012 Berlin und Köln<br />
Informationsveranstaltungen<br />
Bau und Sanierung von Nah- und Fernwärmeleitungen<br />
27./28.02.2012 Köln<br />
Aufbaulehrgang Fernwärme<br />
23.02.2012 Kerpen<br />
Kanalbau<br />
Informationsveranstaltungen<br />
Aufbaulehrgang Kanalbau<br />
22.02.2012 Hamburg<br />
29.02.2012 München<br />
Sanierung privater Abwasserkanäle<br />
10.01.2012 Mannheim<br />
08.02.2012 Bad Zwischenahn<br />
Kontaktadresse<br />
brbv<br />
Berufsförderungswerk des Rohrleitungsbauverbandes<br />
GmbH, Köln,<br />
Tel. 0221/37 658-20,<br />
E-Mail: koeln@brbv.de, www.brbv.de<br />
994 12 / 2011
Aktuelle Termine<br />
Services<br />
Seminare – Verschiedene<br />
DVGW<br />
Intensivschulungen<br />
Abnahme von Druckprüfungen an Gas- und<br />
Wasserrohrleitungen<br />
27.01.2012 Berlin<br />
09.02.2012 Rendsburg<br />
13.11.2012 Walsrode<br />
Abnahme von Druckprüfungen an Trinkwasserrohrleitungen<br />
26.04.2012 Grünberg<br />
06.11.2012 Karlsruhe<br />
04.12.2012 Hannover<br />
11.12.2012 Herdecke<br />
Aktuelles zur Trinkwasserhygiene und<br />
Trinkwasser-Installation für den verantwortlichen<br />
Fachmann aus Vertragsinstallationsunternehmen<br />
16.01.2012 Cottbus<br />
20.01.2012 Magdeburg<br />
30.01.2012 Nürnberg<br />
07.02.2012 Schweinfurt<br />
10.02.2012 Stuttgart<br />
14.02.2012 Berlin<br />
Aktuelles zur Trinkwasserinstallation und<br />
Trinkwasserhygiene für Wasserversorgungsunternehmen,<br />
Netzbetreiber und<br />
Netzserviceunternehmen<br />
06.03.2012 Magdeburg<br />
22.03.2012 Berlin<br />
EW Medien und<br />
Kongresse<br />
Seminar<br />
Gütesicherung im Kabelleitungstiefbau und<br />
Querverbund<br />
30.01.-03.02.2012 Mainz<br />
HDT<br />
Seminare<br />
Planung und Auslegung von Rohrleitungen<br />
17./18.01.2012 Essen<br />
Instandhaltung von Rohrleitungen<br />
26./27.01.2012 München<br />
Festigkeitsmäßige Auslegung von Druckbehältern<br />
06./07.02.2012 Essen<br />
03./04.12.2012 Essen<br />
Druckstöße, Dampfschläge und Pulsationen<br />
in Rohrleitungen<br />
07./08.02.2012 Essen<br />
20./21.03.2012 München<br />
08./09.05.2012 Berlin<br />
18./19.06.2012 Cuxhaven<br />
25./26.09.2012 Kochel<br />
04./05.12.2012 Leibstadt, Schweiz<br />
Fortbildungslehrgang für befähigte Personen/ehemalige<br />
Sachkundige für die<br />
Prüfung von Druckbehälteranlagen und<br />
Rohrleitungen, Druckstöße, Dampfschläge<br />
und Pulsationen in Rohrleitungen<br />
13.-15.02.2012 Bad Dürkheim<br />
Lecküberwachung an Rohrleitungen und<br />
Pipelines<br />
06.03.2012 Essen<br />
Rohrleitungsplanung für Industrie- und<br />
Chemieanlagen<br />
08./09.03.2012 Essen<br />
22./23.11.2012 Berlin<br />
Die Europäische Norm EN 1591 zur<br />
Flanschberechnung<br />
22.03.2012 Essen<br />
20.09.2012 Essen<br />
Prüfungen von Druckbehälteranlagen und<br />
Rohrleitungen nach der Betriebssicherheitsverordnung<br />
22.03.2012 Essen<br />
Dichtungen – Schrauben – Flansche<br />
29.03.2012 Essen<br />
10.05.2012 Berlin<br />
20.09.2012 Berlin<br />
Theorie und Praxis der Stopfbuchsen an<br />
Armaturen und Apparaten<br />
26.04.2012 Essen<br />
Dichtungstechnik im Rohrleitungs- und<br />
Apparatebau<br />
10.05.2012 Essen<br />
15.11.2012 Essen<br />
Schweißen von Rohrleitungen im Energieund<br />
Chemieanlagenbau<br />
23./24.05.2012 Essen<br />
21./22.11.2012 Essen<br />
Sicherheitsventile und Berstscheiben<br />
13.09.2012 München<br />
25.10.2012 Essen<br />
Radiodetection<br />
Praxisseminare<br />
Kabel- und Leitungsortung – Grundmodul<br />
07./08.02.2012 Erfurt<br />
27./28.03.2012 Erfurt<br />
17./18.04.2012 Erfurt<br />
26./27.06.2012 Erfurt<br />
18./19.09.2012 Erfurt<br />
06./07.11.2012 Erfurt<br />
13./14.11.2012 Erfurt<br />
Kabel- und Leitungsortung – Aufbaumodul<br />
15./16.05.2012 Erfurt<br />
04./05.12.2012 Erfurt<br />
Kabelfehlerortung<br />
20.-22.03.2012 Erfurt<br />
08.-10.05.2012 Erfurt<br />
27.-29.11.2012 Erfurt<br />
Tiefbau<br />
09.02.2012 Erfurt<br />
15.11.2012 Erfurt<br />
TAE<br />
Seminare<br />
Kanalinstandhaltung<br />
09./10.11.2011 Ostfildern<br />
Spezialtiefbau<br />
14./15.11.2011 Ostfildern<br />
Hochspannungsbeeinflussung erdverlegter<br />
Rohrleitungen<br />
02.12.2011 Ostfildern<br />
Mikrotunnelbau<br />
09.12.2011 Ostfildern<br />
TAH<br />
Seminare<br />
Lehrgang zum Zertifizierten Kanalsanierungs-Berater<br />
2011<br />
ab 10.10.2011 Weimar<br />
Instandhaltung von Abwasserkanalsystemen<br />
– Kanalsanierung von A bis Z<br />
28./29.09.2011 Hannover<br />
Auf den Punkt gebracht 2011<br />
08.11.2011 Münster<br />
09.11.2011 Rendsburg<br />
10.11.2011 Lüneburg<br />
23.11.2011 Mülheim/Ruhr<br />
24.11.2011 Limburg/Lahn<br />
TAW<br />
Seminare<br />
Schweißtechnik an Rohren in der chemischen<br />
Industrie und im Anlagenbau<br />
01./02.02.2012 Wuppertal<br />
Rohrleitungen in verfahrenstechnischen<br />
Anlagen planen und auslegen<br />
14./15.03.2012 Wuppertal<br />
Kontaktadresse<br />
DVGW<br />
Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches<br />
e.V., Bonn; Tel. 0228/9188-607,<br />
Fax 0228/9188-997, E-Mail: splittgerber@<br />
dvgw.de, www.dvgw.de<br />
HdT<br />
Haus der Technik, Essen; Tel. 0201/1803-1,<br />
E-Mail: hdt@hdt-essen.de, www.hdt-essen.de<br />
TAE<br />
Technische Akademie Esslingen e.V., Heike Baier,<br />
Tel. 0711/3 40 08-0, Fax 0711/3 40 08-27,<br />
E-Mail: heike.baier@taw.de, www.tae.de<br />
TAH<br />
Technische Akademie Hannover e.V.;<br />
Dr. Igor Borovsky, Tel. 0511/39433-30,<br />
Fax 0511/39433-40,<br />
E-Mail: borovsky@ta-hannover.de,<br />
www.ta-hannover.de<br />
TAW<br />
Technische Akademie Wuppertal;<br />
Dr.-Ing. Ulrich Reith,<br />
Tel. 0202/7495-207, Fax 0202/7495-228,<br />
E-Mail: taw@taw.de, www.taw.de<br />
12 / 2011 995
Aktuelle Termine<br />
Services<br />
Messen und Tagungen<br />
Tagung Rohrleitungsbau<br />
24./25.01.2012 in Berlin; figawa Service GmbH, Gabriele Borkes, Tel.<br />
0221/37658-46, Fax 0221/37658-63, E-Mail:<br />
borkes@figawaservice.de, www.brbv.de<br />
ACHEMA 2012<br />
18.-22.06.2012 in Frankfurt/Main; DECHEMA, Dr. Kathrin Rübberdt, Tel.<br />
069/7564-277/-296, Fax: 069/7564-272, E-Mail:<br />
presse@dechema.de, www.achema.de<br />
26. Oldenburger Rohrleitungsforum 2012<br />
09./10.02.2012 IRO GmbH Oldenburg, Tel. 0441/36 10 39-0, Fax<br />
0441/36 10 39–10, E-Mail: info@iro-online.de, www.<br />
iro-online.de<br />
IFAT ENTSORGA 2012<br />
07.-11.05.2012 in München; Messe München, E-Mail: newsline@messemuenchen.de,<br />
www.ifat.de<br />
6. Praxistag Korrosionsschutz<br />
13.06.2012 in Gelsenkirchen; Vulkan-Verlag, Barbara. Pflamm, Tel.<br />
0201/82002-28, Fax 0201/82002-40, E-Mail:<br />
b.pflamm@vulkan-verlag.de<br />
2. Praxistag Wasserversorgungsnetze – Leckortung und Netzoptimierung<br />
06.11.2012 in Essen; Vulkan-Verlag, Barbara. Pflamm, Tel.<br />
0201/82002-28, Fax 0201/82002-40, E-Mail:<br />
b.pflamm@vulkan-verlag.de<br />
Inserentenverzeichnis<br />
Firma<br />
16. Wiesbadener Kunststoffrohrtage 2012, Wiesbaden 905<br />
26. Oldenburger Rohrleitungsforum 2012, Oldenburg 899, Beilage<br />
3S Consult GmbH, Garbsen 963<br />
AUMA Riester GmbH & Co. KG, Müllheim 895<br />
e-world energy & water 2012, Essen 897<br />
FBS Fachvereinigung Betonrohre und Stahlbetonrohre e.V., Bonn<br />
Titelseite<br />
Güteschutz Kanalbau e.V., Bad Honnef 901<br />
Hammann GmbH, Annweiler am Trifels 961<br />
IE expo 2012, Shanghai, China 911<br />
MEE Middle East Electricity 2012, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate 966<br />
PM Fittings GmbH, Achim-Uesen 903<br />
Vergabe24 GmbH, Stuttgart 927<br />
wire 2012 / tube 2012, Düsseldorf<br />
Aufkleber<br />
Marktübersicht 967–976<br />
996 12 / 2011
Impressum<br />
Verlag<br />
© 1974 Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Postfach 10 39 62, 45039 Essen,<br />
Telefon +49(0)201-82002-0, Telefax +49(0)201-82002-40.<br />
Geschäftsführer: Carsten Augsburger, Jürgen Franke,<br />
Hans-Joachim Jauch<br />
Redaktion<br />
Dipl.-Ing. N. Hülsdau, Vulkan-Verlag GmbH, Huyssenallee 52-56,<br />
45128 Essen, Telefon +49(0)201-82002-33,<br />
Telefax +49(0)201-82002-40,<br />
E-Mail: n.huelsdau@vulkan-verlag.de<br />
Anzeigenverkauf<br />
Helga Pelzer, Vulkan-Verlag GmbH, Telefon +49(0)201-82002-<br />
35, Telefax +49(0)201-82002-40,<br />
E-Mail: h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
Anzeigenverwaltung<br />
Martina Mittermayer, Vulkan-Verlag/Oldenbourg Industrieverlag<br />
GmbH, Telefon +49(0)89-45051-471, Telefax +49(0)89-<br />
45051-300, E-Mail: mittermayer@oiv.de<br />
Abonnements/Einzelheftbestellungen<br />
Leserservice <strong>3R</strong> INTERNATIONAL, Postfach 91 61, 97091<br />
Würzburg, Telefon +49(0)931-4170-1616, Telefax +49(0)931-<br />
4170-492, E-Mail: leserservice@vulkan-verlag.de<br />
Gestaltung, Satz und Druck<br />
Gestaltung: deivis aronaitis design I dad I,<br />
Leonrodstraße 68, 80636 München<br />
Satz: e-Mediateam Michael Franke, Breslauer Str. 11,<br />
46238 Bottrop<br />
Druck: Druckerei Chmielorz, Ostring 13,<br />
65205 Wiesbaden-Nordenstadt<br />
Bezugsbedingungen<br />
<strong>3R</strong> erscheint monatlich mit Doppelausgaben im Januar/Februar,<br />
März/April und August/September · Bezugspreise: Abonnement<br />
(Deutschland): € 263,- + € 27,- Versand; Abonnement (Ausland):<br />
€ 263,- + € 31,50 Versand; Einzelheft (Deutschland): € 34,- +<br />
€ 3,- Versand; Einzelheft (Ausland): € 34,- + € 3,50 Versand;<br />
Einzelheft als ePaper (PDF): € 34,-; Studenten: 50 % Ermäßigung<br />
auf den Heftbezugspreis gegen Nachweis · Die Preise enthalten<br />
bei Lieferung in EU-Staaten die Mehrwertsteuer, für alle übrigen<br />
Länder sind es Nettopreise.<br />
Bestellungen sind jederzeit über den Leserservice oder jede Buchhandlung<br />
möglich. Die Kündigungsfrist für Abonnementaufträge<br />
beträgt 8 Wochen zum Bezugsjahresende.<br />
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen<br />
sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der<br />
engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung<br />
des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,<br />
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung<br />
und Bearbeitung in elektronischen Systemen. Auch die<br />
Rechte der Wiedergabe durch Vortrag, Funk- und Fernsehsendung,<br />
im Magnettonverfahren oder ähnlichem Wege bleiben vorbehalten.<br />
Jede im Bereich eines gewerblichen Unternehmens hergestellte<br />
oder benutzte Kopie dient gewerblichen Zwecken gem. § 54 (2)<br />
UrhG und verpflichtet zur Gebührenzahlung an die VG WORT, Abteilung<br />
Wissenschaft, Goethestraße 49, 80336 München, von der<br />
die einzelnen Zahlungsmodalitäten zu erfragen sind.<br />
ISSN 2191-9798<br />
Fachzeitschrift für sichere und<br />
effiziente Rohrleitungssysteme<br />
Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern<br />
Organschaften<br />
Fachbereich Rohrleitungen im Fachverband Dampfkessel-, Behälter- und<br />
Rohrleitungsbau e.V. (FDBR), Düsseldorf · Fachverband Kathodischer Korrosionsschutz<br />
e.V., Esslingen · Kunststoffrohrverband e.V., Köln · Rohrleitungsbauverband<br />
e.V., Köln · Rohrleitungssanierungsverband e.V., Essen ·<br />
Verband der Deutschen Hersteller von Gasdruck-Regelgeräten, Gasmeßund<br />
Gasregelanlagen e.V., Köln<br />
Herausgeber<br />
H. Fastje, EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg (Federführender Herausgeber)<br />
· Dr.-Ing. M. K. Gräf, Vorsitzender der Geschäftsführung der Europipe<br />
GmbH, Mülheim · Dipl.-Ing. R.-H. Klaer, Bayer AG, Krefeld, Vorsitzender des<br />
Fachausschusses „Rohrleitungstechnik“ der VDI-Gesellschaft Verfahrenstechnik<br />
und Chemie-Ingenieurwesen (GVC) · Dipl.-Ing. K. Küsel, Heinrich<br />
Scheven Anlagen-und Leitungsbau GmbH, Erkrath · Dipl.-Volksw. H. Zech,<br />
Geschäftsführer des Rohrleitungssanierungsverbandes e.V., Lingen (Ems)<br />
Schriftleiter<br />
Dipl.-Ing. M. Buschmann, Rohrleitungsbauverband e.V. (rbv), Köln · Rechtsanwalt<br />
C. Fürst, Erdgas Münster GmbH, Münster · Dipl.‐Ing. Th. Grage,<br />
Institutsleiter des Fernwärme-Forschungsinstituts, Hemmingen · Dr.-Ing.<br />
A. Hilgenstock, E.ON Ruhrgas AG, Technische Kooperationsprojekte, Kompetenzcenter<br />
Gastechnik und Energiesysteme /(Netztechnik), Essen · Dipl.-<br />
Ing. D. Homann, IKT Institut für Unterirdische Infrastruktur, Gelsenkirchen<br />
· Dipl.‐Ing. N. Hülsdau, Vulkan-Verlag, Essen · Dipl.-Ing. T. Laier, RWE –<br />
Westfalen-Weser-Ems – Netzservice GmbH, Dortmund · Dipl.-Ing.<br />
J. W. Mußmann, FDBR e.V., Düsseldorf · Dr.-Ing. O. Reepmeyer, Europipe<br />
GmbH, Mülheim · Dr. H.-C. Sorge, IWW Rheinisch-Westfälisches Institut<br />
für Wasser, Biebesheim · Dr. J. Wüst, SKZ - TeConA GmbH, Würzburg<br />
Beirat<br />
Dr.-Ing. W. Berger, Direktor des Forschungsinstitutes für Tief-und Rohrleitungsbau<br />
e.V., Weimar · Dr.-Ing. B. Bosseler, Wissenschaftlicher Leiter<br />
des IKT – Institut für Unterirdische Infra struktur, Gelsenkirchen · Dipl.-Ing.<br />
D. Bückemeyer, Vorstand der Stadtwerke Essen AG · W. Burchard, Geschäftsführer<br />
des Fachverbands Armaturen im VDMA, Frankfurt · Bauassessor<br />
Dipl.‐Ing. K.-H. Flick, Fachverband Steinzeugindustrie e.V., Köln ·<br />
Prof. Dr.-Ing. W. Firk, Vorstand des Wasserverbandes Eifel-Rur, Düren ·<br />
Dipl.-Wirt. D. Hesselmann, Geschäftsführer des Rohrleitungsbauverbandes<br />
e.V., Köln · Dipl.-Ing. H.-J. Huhn, BASF AG, Ludwigshafen · Dipl.-Ing.<br />
B. Lässer, ILF Beratende Ingenieure GmbH, München · Dr.-Ing. W. Lindner,<br />
Vorstand des Erftverbandes, Bergheim · Dr. rer. pol. E. Löckenhoff, Geschäftsführer<br />
des Kunststoffrohrverbands e.V., Bonn · Dr.-Ing. R. Maaß,<br />
Mitglied des Vorstandes, FDBR Fachverband Dampfkessel-, Behälter- und<br />
Rohrleitungsbau e.V., Düsseldorf · Dipl.-Ing. R. Middelhauve, TÜV NORD<br />
Systems GmbH & Co. KG, Essen · Dipl.-Ing. R. Moisa, Geschäftsführer der<br />
Fachgemeinschaft Guss-Rohrsysteme e.V., Griesheim · Dipl.‐Berging.<br />
H. W. Richter, GAWACON, Essen · Dipl.-Ing. T. Schamer, Prokurist der AR-<br />
KIL INPIPE GmbH, Bottrop · Prof. Dipl.-Ing. Th. Wegener, Institut für Rohrleitungsbau<br />
an der Fachhochschule Oldenburg · Prof. Dr.-Ing. B. Wielage,<br />
Lehrstuhl für Verbundwerkstoffe, Technische Universität Chemnitz-Zwickau<br />
· Dipl.-Ing. J. Winkels, Technischer Geschäftsführer der Salzgitter<br />
Mannesmann Line Pipe GmbH, Siegen
<strong>3R</strong><br />
als Heft<br />
oder<br />
als ePaper<br />
Sichere und effiziente<br />
Rohrleitungssysteme<br />
Nutzen Sie das Know-how der führenden Fachzeitschrift für die<br />
Entwicklung von Rohrleitungen, Komponenten und Verfahren im<br />
Bereich der Gas- und Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung,<br />
der Nah- und Fernwärmeversorgung, des Anlagenbaus<br />
und der Pipelinetechnik.<br />
Mit zwei englischsprachigen Specials pro Jahr.<br />
Gratis für Sie: Das Tabellenbuch für den Rohrleitungsbau<br />
Kompakt aufbereitete Daten und Kennwerte für Planer, Konstrukteure und Betreiber von Rohrleitungsanlagen.<br />
Dieses nützliche Nachschlagewerk beantwortet alle Fragen im Rohrleitungsbau. Es<br />
ist die ideale, praxisbezogene Ergänzung für Fach- und Lehrbücher der Rohrleitungstechnik.<br />
Hrsg.: MCE Energietechnik GmbH<br />
15. Aufl age 2006, 520 Seiten, Broschur<br />
<strong>3R</strong> erscheint in der Vulkan-Verlag GmbH, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen<br />
Vulkan-Verlag<br />
www.vulkan-verlag.de<br />
Vorteilsanforderung per Fax: +49 (0) 931 / 4170 - 492 oder im Fensterumschlag einsenden<br />
Ja, ich möchte <strong>3R</strong> regelmäßig lesen. Bitte schicken Sie mir die Fachpublikation<br />
□ als gedrucktes Heft für € 263,- zzgl. Versand (Deutschland: € 27,- / Ausland: € 31,50) pro Jahr<br />
□ als ePaper (PDF-Datei als Einzellizenz) für € 263,- pro Jahr<br />
Als Dankeschön erhalte ich das „Tabellenbuch für den Rohrleitungsbau“ gratis.<br />
Nur wenn ich nicht bis von 8 Wochen vor Bezugsjahresende kündige, verlängert sich der Bezug um<br />
ein Jahr.<br />
Die sichere, pünktliche und bequeme Bezahlung per Bankabbuchung wird mit einer Gutschrift von<br />
€ 20,- auf die erste Jahresrechung belohnt..<br />
Firma/Institution<br />
Vorname/Name des Empfängers<br />
Straße/Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Antwort<br />
Leserservice <strong>3R</strong><br />
Postfach 91 61<br />
97091 Würzburg<br />
E-Mail<br />
Branche/Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise □ Bankabbuchung □ Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Bankleitzahl<br />
✘<br />
Kontonummer<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, E-Mail) oder durch<br />
Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Datum, Unterschrift<br />
PA<strong>3R</strong>IN0311<br />
Absendung des Widerrufs oder der Sache an den Leserservice <strong>3R</strong>, Postfach 91 61, 97091 Würzburg.<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pfl ege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst, gespeichert und verarbeitet. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich vom<br />
Oldenbourg Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag □ per Post, □ per Telefon, □ per Telefax, □ per E-Mail, □ nicht über interessante Fachangebote informiert und beworben werde. Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.