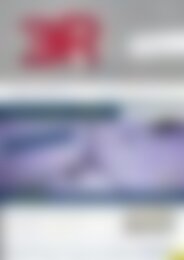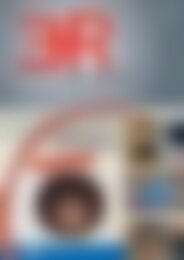3R Special: Rohrleitungsbau aktuell (Vorschau)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
04-05 | 2013<br />
ISSN 2191-9798<br />
23-26.04.2013<br />
Fachzeitschrift für sichere und<br />
effiziente Rohrleitungssysteme<br />
LESEN SIE IN DIESER AUSGABE:<br />
<strong>Special</strong>: <strong>Rohrleitungsbau</strong> <strong>aktuell</strong><br />
Halle 3.2 – Stand-Nr: 209<br />
Qualität auf den ersten Blick!<br />
Serie 18 Serie 19 Elektroschweißfittings<br />
Ventil-Anbohrarmaturen<br />
Die PLASSON Produkt-Familien – ausgereifte Programme, die durch ständige Qualitätskontrollen und<br />
innovative Weiterentwicklung auf höchstem technischen Niveau Ihre Anforderungen erfüllen.<br />
Service ist unser Markenzeichen, denn Zufriedenheit ist noch immer die beste Empfehlung.<br />
PLASSON GmbH<br />
Krudenburger Weg 29 • 46485 Wesel<br />
Telefon: (0281) 9 52 72-0 • E-Mail: info@plasson.de • Internet: www.plasson.de • www.serie19.de
7. Praxistag<br />
Korrosionsschutz<br />
am 19. Juni 2013 in Gelsenkirchen<br />
PROGRAMM<br />
Moderation: U. Bette, Technische Akademie Wuppertal<br />
• Beurteilung der Wechselstromkorrosionsgefährdung von<br />
Rohrleitungen anhand von Probeblechen: Relevante<br />
Einflussgrößen für die Bewertung der ermittelten<br />
Korrosionsgeschwindigkeit<br />
Dr. M. Büchler, SGK Schweizerische Gesellschaft für Korrosionsschutz, Zürich<br />
• Untersuchungen von verschiedenen Flüssigböden zur<br />
Verfüllung von Rohrgräben hinsichtlich ihres Einflusses<br />
auf den kathodischen Außenkorrosionsschutz von<br />
Stahlrohrleitungen<br />
n.n, TFH Bochum, Bochum; Ulrich Bette, Technische Akademie Wuppertal,<br />
Wuppertal<br />
• Smart KKS:<br />
Von der Fernüberwachung zur Online-Überwachung<br />
M. Müller, RBS Wave GmbH, Stuttgart<br />
• Fernüberwachung des KKS –<br />
Ein wesentlicher Beitrag zur Sicherheit von Rohrleitungen<br />
J. Maurmann, Maurmann GmbH, Sprockhövel<br />
• Umsetzung eines konsequenten LKS Konzeptes am<br />
Beispiel des Erdgaskavernenspeichers Jemgum<br />
n.n<br />
• Materialvielfalt und Anwendungsbereiche im passiven<br />
Korrosionsschutz – was sollte die zukünftige Ausbildung<br />
nach GW 15 leisten?<br />
H. Fuchs, RBV GmbH, Köln<br />
• Qualitätssicherung und Zustandserfassung<br />
in der Rohrleitungstrasse<br />
Dr. H.-J. Kocks, Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH, Siegen<br />
• Intelligente Molchungen aus KKS-Sicht<br />
Dr. M. Brecht, Open Grid Europe GmbH, Essen<br />
• Möglichkeiten bei der Ortung von erdverlegten<br />
Versorgungsleitungen über die Magnetfeldortung<br />
R. Klar, SebaKMT, Baunach<br />
Wann WAnn und Und Wo? WO?<br />
Veranstalter:<br />
<strong>3R</strong>, fkks<br />
Termin: Mittwoch, 19.06.2013,<br />
9:00 Uhr – 17:15 Uhr<br />
Ort:<br />
Zielgruppe:<br />
Veranstalter VERAnSTALTER<br />
Veltinsarena, Gelsenkirchen,<br />
www.veltins-arena.de<br />
Mitarbeiter von Stadtwerken,<br />
Energieversorgungs- und<br />
Korrosionsschutzfachunternehmen<br />
Teilnahmegebühr * :<br />
<strong>3R</strong>-Abonnenten<br />
und fkks-Mitglieder: 380,- €<br />
Nichtabonnenten: 410,- €<br />
Bei weiteren Anmeldungen aus einem Unternehmen wird<br />
ein Rabatt von 10 % auf den jeweiligen Preis gewährt.<br />
Im Preis enthalten sind die Tagungsunterlagen sowie<br />
das Catering (2 x Kaffee, 1 x Mittagessen).<br />
* Nach Eingang Ihrer schriftlichen Anmeldung (auch per Internet möglich) sind<br />
Sie als Teilnehmer registriert und erhalten eine schriftliche Bestätigung sowie<br />
die Rechnung, die vor Veranstaltungsbeginn zu begleichen ist. Bei Absagen<br />
nach dem 7. Juni 2013 oder Nichterscheinen wird ein Betrag von 100,- €<br />
für den Verwaltungsaufwand in Rechnung gestellt. Die Preise verstehen sich<br />
zzgl. MwSt.<br />
Mehr Information und Online-Anmeldung unter<br />
www.praxistag-korrosionsschutz.de<br />
Fax-Anmeldung: +49 201 82002-40 oder Online-Anmeldung: www.praxistag-korrosionsschutz.de<br />
Ich bin <strong>3R</strong>-Abonnent<br />
Ich bin fkks-Mitglied<br />
Ich bin Nichtabonnent/kein fkks-Mitglied<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Firma/Institution<br />
E-Mail<br />
Straße/Postfach<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Nummer<br />
✘<br />
Ort, Datum, Unterschrift
EDITORIAL<br />
Keine Zukunft ohne Netze<br />
Nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima wurden die<br />
energiepolitischen Weichen in Deutschland grundlegend<br />
neu gestellt. Laut Beschluss der Bundesregierung soll der<br />
Anteil der Erneuerbaren Energien am gesamten Endenergieverbrauch<br />
für Strom, Wärme/Kälte und Mobilität im<br />
Jahr 2020 rund 18 % betragen. Die 30 %-Hürde soll im<br />
Jahr 2030 genommen werden und 2050 soll der Anteil auf<br />
60 % angewachsen sein. Für den Verbrauch von Strom<br />
wurde die Messlatte ähnlich hoch gelegt: Bis 2020 sollen<br />
mindestens 35 % und bis 2050 mindestens 80 % erreicht<br />
werden. Diese Ziele sind im Erneuerbare-Energien-Gesetz<br />
(EEG) gesetzlich verankert.<br />
Die Umsetzung dieser Vorgaben erfordert die Bereitstellung<br />
der erforderlichen Kapazitäten – im Bereich der Netze<br />
ebenso wie bei den Kraftwerken und den Speichertechnologien.<br />
In gleichem Maße sind Unternehmen und Verbände<br />
gefordert: Wo stehen wir, was müssen wir tun, sind wir auf<br />
dem richtigen Weg? Auf diese Fragen gilt es Antworten zu<br />
finden. Auch und vor allem im Hinblick auf die wirtschaftliche<br />
Entwicklung. Wobei in diesem Zusammenhang auch die<br />
Frage erlaubt sein muss, warum sich die Diskussion in der<br />
Energiewende derartig auf das Medium Strom fokussiert und<br />
sinnvolle Alternativen wie etwa Power-to-Gas und das gut<br />
ausgebaute, als Speicher nutzbare Gasleitungssystem in eine<br />
Nebenrolle gedrängt werden. Immerhin handelt es sich bei<br />
dem Medium Gas um eine der umweltfreundlichen Energien.<br />
Fakt ist: Die Energiebranche ändert sich technisch grundlegend.<br />
Verschiedene Systeme prallen aufeinander. Die Dynamik<br />
beim Ausbau von Netzen wird sich weiter vergrößern.<br />
Hinzu kommt die Aufgabe, die Netze mit zentralen und<br />
dezentralen Erzeugungssystemen zu kombinieren. Auch<br />
hierbei spielen neue Technologien eine wichtige Rolle. Es<br />
gilt, hocheffiziente Netze mit digitaler Steuerung zu schaffen,<br />
um eine Symbiose zwischen den neuen Energiequellen<br />
und den infrastrukturellen Einrichtungen herzustellen.<br />
Für die Leitungsbauer wird es von größter Wichtigkeit sein,<br />
wie schnell und in welchem Maße sich der Netzentwicklungsplan<br />
bzw. Bundesbedarfsplan entwickeln und realisieren<br />
lassen. Das gilt insbesondere für die weitere strategische<br />
Ausrichtung der Investitions- und Personalplanung sowie<br />
der Aus- und Weiterbildung. Die Leitungsbauunternehmen<br />
müssen ihre Kapazitäten abstimmen. Deshalb brauchen sie<br />
entsprechende Signale; Signale, dass investiert wird und<br />
Aufträge ausgeschrieben werden.<br />
Hierauf können sich die Leitungsbauunternehmen einstellen<br />
und ihre Planungen entsprechend ausrichten. Unterstützung<br />
erfahren die Unternehmen dabei von einem starken Verband.<br />
Der <strong>Rohrleitungsbau</strong>verband ist mit großem Engagement<br />
am Ball, um die Interessen der Mitgliedsunternehmen<br />
zu vertreten und ihren Belangen Gehör zu verschaffen.<br />
Wichtiger Baustein hierbei ist die Pflege und Vergrößerung<br />
des für die Verbandsarbeit wichtigen Netzwerkes<br />
in Form von Kooperationen mit anderen Institutionen.<br />
Regelmäßige Gespräche mit dem Deutschen Verein des<br />
Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), dem Fachverband<br />
Anlagenbau e. V. (FDBR), der Deutschen Vereinigung für<br />
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) und<br />
der RAL-Gütegemeinschaft Güteschutz Kanalbau dienen<br />
der Vertiefung des Verständnisses füreinander und für die<br />
Belange der Leitungsbauer.<br />
Kontinuität herrscht auch in den Partnerschaften mit dem<br />
Verband Güteschutz Horizontalbohrungen e. V. (DCA),<br />
der Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V. (GLT), der<br />
German Society for Trenchless Technology e. V. (GSTT),<br />
dem Rohrleitungssanierungsverband e. V. (RSV) und dem<br />
Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e. V.<br />
(AGFW). Gemeinsam mit ihnen präsentiert sich der rbv<br />
auch im Rahmen der WASSER BERLIN INTERNATIONAL.<br />
Das Kompetenz-Zentrum Leitungsbau (Halle 1.2/Stand 208)<br />
stellt eine erstklassige Plattform dar, um über marktrelevante<br />
Themen und Entwicklungen zu diskutieren – egal, ob<br />
es um regionale Sachverhalte wie die Dichtheitsprüfung in<br />
Nordrhein-Westfalen oder übergeordnete Themen wie die<br />
Energiewende, den Umgang mit der Leitungsinfrastruktur,<br />
die Auswirkungen des demografischen Wandels oder die<br />
wichtigen Bereiche Qualifikation und Ausbildung geht.<br />
Die gemeinsame Diskussion und Auseinandersetzung ist ein<br />
hervorragender Nährboden für gute Ideen. Und die brauchen<br />
wir: Als Basis für die Umsetzung der Energiewende<br />
genauso wie als Rückgrat für die weitere<br />
Entwicklung und den langfristigen<br />
Erfolg der Mitgliedsunternehmen.<br />
Gudrun Lohr-Kapfer<br />
Präsidentin <strong>Rohrleitungsbau</strong>verband<br />
e. V., Köln<br />
04-05 / 2013 1
INHALT<br />
NEWS<br />
7<br />
SKZ hat ein neues Medien-Zeitstand-Prüfgerät im Einsatz<br />
20<br />
Die Mitglieder des RSV - Rohrleitungssanierungsverband e.V.<br />
wählten am 6. Februar einen neuen Vorstand<br />
INDUSTRIE & WIRTSCHAFT<br />
6 Marktanalyse der FH Münster: Megacities stehen vor Investitionsstaus<br />
6 Zehn Milliarden Euro Investitionsbedarf für Entwicklung des Wassersektors in<br />
Kroatien<br />
7 Zeitstandverhalten von Kunststoffen beschleunigt prüfen<br />
8 UNIHA holt Großaufträge in Afrika<br />
9 Geschäftsklima der Kunststoffrohr-Industrie bleibt angespannt<br />
10 Weltweite Water Services für Versorgungsunternehmen und Investoren<br />
EDITORIAL<br />
01 „ Keine Zukunft<br />
ohne Netze“<br />
Gudrun Lohr-Kapfer<br />
PERSONALIEN<br />
10 Neuer Geschäftsführer Technik bei Open Grid Europe: Hüwener folgt auf Watzka<br />
11 Vorstandsmitglied Gilbert Faul verlässt WILO SE auf eigenen Wunsch<br />
VERANSTALTUNGEN<br />
12 Rahmenprogramm der IE expo 2013 widmet sich globalen Netzwerken<br />
12 Effektive Vorbereitung auf die K 2013<br />
13 Zehnte DWA-Kanalbautage in Bad Soden<br />
13 Experten geben Überblick zum Umgang mit Regenwasser<br />
14 Nordafrika diskutiert über technische Infrastruktur<br />
14 ROHRBAU-Weimar am 18./19. November<br />
14 Zweite Flüssigbodentagung interessiert 150 Experten der Branche<br />
15 9. Pipelinetechnik-Symposium erwartet Fachbesucher in Köln<br />
16 fkks tagte Ende Januar in Esslingen<br />
18 20. Tagung <strong>Rohrleitungsbau</strong> in Berlin<br />
2 04-05 / 2013
26<br />
Die WASSER BERLIN INTERNATIONAL lädt zum diesjährigen<br />
Branchentreff der Wasserwirtschaft ein<br />
Gütesicherung<br />
Kanalbau ...<br />
VERBÄNDE<br />
20 RSV mit neuem Vorstand<br />
20 8. Erfahrungsaustausch der Auftraggeber und<br />
-nehmer in Baden-Württemberg<br />
23 Aktuelles aus dem IKT Institut für unterirdische<br />
Infrastruktur<br />
24 Güteschutz Grundstücksentwässerung:<br />
Mit definierten Schritten auf guten Wegen<br />
WASSER BERLIN VORSCHAU<br />
26 Treffpunkt Berlin: „Mehr Wasser geht nicht“<br />
29 Schaustelle Wasser Berlin International<br />
30 Automatisierte Geräuschpegelüberwachung und<br />
Vorortung von Leckagen in Trinkwassernetzen<br />
31 Flexible Abschlussmanschetten<br />
32 Neuer Schwenkantrieb<br />
32 Mechanisches Räderzeigerwerk mit elektrischer<br />
Stellungsanzeige<br />
33 Verbesserte Leitungsortung mit neuem Georadar<br />
34 Wasserleckortung per Korrelator mit Touchscreen<br />
35 Markteinführung „Water-Cloud“ und akustischer<br />
Molch<br />
36 Hygienischer Umgang mit Standrohren in der<br />
Trinkwasserversorgung<br />
36 Sichere Kanalsanierung mit HL-Vortriebsrohren<br />
... wir sind dabei!<br />
Ihr Partner bei<br />
der Bewertung der<br />
■ Fachkunde<br />
■ technischen<br />
Leistungsfähigkeit<br />
■ technischen<br />
Zuverlässigkeit<br />
der ausführenden<br />
Unternehmen<br />
neutral – fair –<br />
zuverlässig<br />
Gütesicherung Kanalbau<br />
steht für eine objektive<br />
Bewertung nach einheitlichem<br />
Maßstab<br />
Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961<br />
04-05 / 2013 3
INHALT<br />
FACHBERICHTE<br />
38<br />
60<br />
Die Gas- und Wasserleitungskreuzungsrichtlinie<br />
Die Produktivität beim Heizelementstumpfschweißen ist von<br />
verschiedenen Faktoren abhängig<br />
RECHT & REGELWERK<br />
38 Die Neuerungen im technischen Teil der Gas- und Wasserleitungskreuzungs richtlinie<br />
GWKR 2012<br />
43 E.ON und DVGW übernehmen leitende Funktionen in der neuen ISO-Arbeitsgruppe<br />
CO 2<br />
-Transport<br />
44 Zulassungsverfahren für Errichtung und Betrieb von Rohrfernleitungen –<br />
Teil 3: Anforderungen des Bundesberggesetzes (BBergG) und des Kohlendioxidspeichergesetzes<br />
(KSpG)<br />
SERVICES<br />
29 Messen | Tagungen<br />
129 Marktübersicht<br />
138 Inserentenverzeichnis<br />
140 Buchbesprechung<br />
141 Seminare<br />
145 Impressum<br />
SPECIAL ROHRLEITUNGSBAU AKTUELL<br />
50 Kabellose dezentrale Automatisierung erdverlegter Gasarmaturen in Sankt<br />
Petersburg<br />
54 Innovative Verbindungstechnik für Stahlrohre –<br />
Automatisiertes Laserstrahlschweißen und Prüfen von Rohrverbindungen<br />
60 Kalkulation von Installationsprojekten mit PE-Rohr –<br />
Teil 1: Produktivität beim Heizelementstumpfschweißen<br />
67 Integrale Langzeit-Prüfmethode für Heizelementstumpf- bzw.<br />
Heizwendel schweißungen an Rohren aus PE<br />
70 Punktlandung unter Zeitdruck – Dükerbau unter dem Rhein erfolgreich abgeschlossen<br />
72 HDD-Bohranlagen für Entgasungsbohrungen von Kohleflözen in Australien<br />
74 Rationalisierungsmöglichkeit im Leitungsbau: die Kombi-Trasse<br />
WASSERVERSORGUNG<br />
76 Mit einer integrierten Netzstrategie zum Zielnetz<br />
82 Modellierung und Kalibrierung der Pumpen in einer Berechnungssoftware<br />
88 Kombination von Ortungsverfahren für die Wasserlecksuche<br />
92 AQWA Academy: Nachhaltiges Capacity Development im Wassersektor<br />
4 04-05 / 2013
88<br />
Kombination von Ortungsverfahren für die Wasserlecksuche<br />
96 Grabenlose Sanierung von Druckrohrleitungen<br />
mithilfe des RS BlueLine ® -Verfahrens<br />
100 Reinigungsverfahren stellt im BMBF-Verbundprojekt<br />
seine Effizienz unter Beweis<br />
102 Trinkwasserbehälter mit 600 m³ Nutzinhalt in<br />
Rekordzeit errichtet<br />
103 Der „koordinierte“ Hausanschluss beim Wasserverband<br />
Peine<br />
ABWASSERENTSORGUNG<br />
104 Abwassersammler mit Close-fit am Tegernsee<br />
saniert<br />
106 Polnisches Kety saniert Abwasserkanäle großer<br />
Nennweiten mit Wickelrohren<br />
108 Neue Stahlbetonrohre und Schächte für die<br />
Mehlemer Kanalisation<br />
110 Sohlengleiche Anschlusssituation bei Kanaler<br />
neuerung in Ahlen<br />
114 Substratfilter reinigt Niederschlagswasser von<br />
Verkehrsflächen in drei Stufen<br />
117 Echtzeitsystem für Vorhersage von Kanalisationsüberläufen<br />
im Abwassernetz Lissabons<br />
Leistung auf Dauer präzise<br />
Kraftvoll, präzise, korrosionsgeschützt<br />
AUMA produziert Antriebe für Armaturen mit wenigen<br />
Zentimetern Durchmessern bis hin zu metergroßen Schützen<br />
an Wehren. Kombiniert mit den modernen AUMA Steuerungskonzepten<br />
und ideal eingebunden in leistungsfähige Feldbus-<br />
Leitsysteme.<br />
■Im modularen AUMA Konzept perfekt angepasst<br />
■Intelligente Antriebslösungen entlasten das Leitsystem<br />
■Perfekt angepasst an unterschiedlichste Armaturentypen<br />
und -größen<br />
■Weltweite Erfahrung, globaler Service<br />
Stellantriebe für die Wasserwirtschaft<br />
KORROSION<br />
120 KKS von Seewasseranlagen – Gegenüberstellung<br />
von Fremdstrom- und galvanischen Systemen<br />
126 Anforderungen an einen Kandidaten nach<br />
DIN EN 15257 Grad 3, Personenzertifizierung<br />
04-05 / 2013<br />
AUMA Riester GmbH & Co. KG<br />
Aumastrasse 1• 79379 Muellheim, Germany<br />
Tel. +49 7631 809-0 • riester@auma.com<br />
www.auma.com<br />
Besuchen Sie uns auf<br />
unserem Stand<br />
Halle 4.2/304
FACHBERICHT NACHRICHTEN RECHT INDUSTRIE & REGELWERK & WIRTSCHAFT<br />
Marktanalyse der FH Münster: Megacities stehen vor<br />
Investitionsstaus<br />
Die Projektgruppe der FH Münster wurde beim Rundgang von<br />
Dr.-Ing Thorsten Späth, Leiter strategisches Produktmanagement<br />
bei egeplast, betreut<br />
Master-Studenten der FH Münster führten unter der Leitung<br />
von Prof. Dr. Baaken eine weltweit ausgerichtete<br />
Marktanalyse von Megacities durch. Ausgangssituation<br />
war der Wunsch der egeplast international GmbH, ihre<br />
intelligenten Rohrlösungen verstärkt auch im Ausland zu<br />
vermarkten. Bereits mehrfach hatten die FH Münster und<br />
egeplast erfolgreich zusammengearbeitet.<br />
Die Projektgruppe aus 17 Studenten der Master-Studiengänge<br />
„International Marketing & Sales“ traf zunächst eine Auswahl<br />
an potenziell interessanten Megacities. In diesen Städten fallen<br />
aufgrund schnell wachsender Bevölkerung in naher Zukunft<br />
Investitionen in Infrastrukturprojekte an. Denn die existierende<br />
Infrastruktur ist in diesen Städten häufig überlastet und befindet<br />
sich in marodem Zustand. Es folgten tiefgreifende Recherchen<br />
bezüglich der Wasser-, Abwasser- und Gasrohrsysteme.<br />
Untersucht wurden zu Beginn 18 internationale Großstädte,<br />
darunter Shanghai, New York, Istanbul, Mumbai, Mexiko<br />
City, Ho Chi Minh City und São Paulo. Im zweiten Schritt<br />
wurden anhand relevanter Kriterien elf Megacities selektiert,<br />
der Status Quo der Rohrleitungssysteme analysiert und das<br />
Finanzierungspotenzial durch die Welt- und z. B. die Asian<br />
Bank bewertet. Des Weiteren wurden verantwortliche Institutionen<br />
sowie namentlich Ansprechpartner vor Ort ermittelt.<br />
Zum Abschluss wurden konkrete Handlungsempfehlungen<br />
für den jeweiligen Markt präsentiert.<br />
Positive Resonanz gab es nicht nur von egeplast, sondern<br />
auch von den International Distribution Partners, die die<br />
Übereinstimmung der akademischen Resultate zu 90 %<br />
mit persönlichen Erfahrungswerten bestätigten. egeplast-<br />
Geschäftsführer Dr. Ansgar Strumann freute sich über die<br />
neuen Informationen und plant nun auf Basis dieser Recherche<br />
die nächsten Schritte zur Erschließung des Geschäftspotenzials<br />
der Megacities im Hinblick auf die Rohrsanierung.<br />
Zehn Milliarden Euro Investitionsbedarf für<br />
Entwicklung des Wassersektors in Kroatien<br />
Anlässlich der Wirtschaftsgespräche am 11. und 12. März<br />
2013 in Zagreb mit Bundeswirtschaftsminister Dr. Philipp<br />
Rösler, hat Ivan Vrdoljak, Kroatiens Wirtschaftsminister, die<br />
Höhe des Investitionsbedarfes für die Entwicklung des Wassersektors<br />
seines Landes mit ca. zehn Milliarden Euro eingeschätzt.<br />
Die Mittel dafür sollen nach dem Beitritt Kroatiens<br />
in die EU hauptsächlich aus den EU-Strukturfonds finanziert<br />
werden. Rösler: „Für die vielfach mittelständisch ausgerichteten<br />
Unternehmen der deutschen Wasserwirtschaft ergeben<br />
sich künftig in Kroatien gute Chancen, ihre Kompetenz<br />
einzubringen und Partnerschaften vor Ort zu begründen.“<br />
German Water Partnership-Vorstandsmitglied Dieter Ernst,<br />
Teilnehmer der Wirtschaftsdelegation, die Bundeswirtschaftsminister<br />
Rösler nach Kroatien begleitet hat, erörterte in der<br />
Diskussion die vielfältigen Aktivitäten von German Water<br />
Partnership (GWP) in der Region. Hierbei stellte er insbesondere<br />
das erfolgreiche Projekt zur Entwicklung eines nationalen<br />
Trainings- und Kompetenzzentrums vor. „Wir sind sehr<br />
froh, dass durch die Reise von Bundesminister Rösler unser<br />
Projekt jetzt eine erhöhte Aufmerksamkeit bekommen und<br />
die kroatische Regierung die dafür notwendige politische<br />
Unterstützung angekündigt hat“, so Ernst.<br />
In Kroatien engagierte GWP-Mitglieder haben gemeinsam<br />
mit dem kommunalen Wasserversorgungsunternehmen<br />
Karlovac und der ansässigen Fachhochschule eine zweijährige<br />
Pilotphase für die Begründung des Trainings- und<br />
Kompetenzzentrums (Training and Competence Centre<br />
Karlovac – TCC Karlovac) zur Aus- und Weiterbildung für<br />
Personal des Wasser- und Abwassersektors in Kroatien<br />
abgeschlossen.<br />
GWP geht davon aus, dass nunmehr neben der deutschen<br />
Unterstützung auch in Kroatien die notwendigen institutionellen<br />
und finanziellen Voraussetzungen geschaffen<br />
werden, für das Trainingszentrum Karlovac ein nachhaltiges<br />
Geschäftsmodell zu entwickeln. German Water Partnership<br />
wird auch künftig bei der Problemlösung weiterer wasserwirtschaftlicher<br />
Herausforderungen als zentraler Ansprechpartner<br />
zur Verfügung stehen.<br />
6 04-05 / 2013
Zeitstandverhalten von<br />
Kunststoffen beschleunigt<br />
prüfen<br />
Die Medien- und Spannungsrissbeständigkeit von Kunststoffen<br />
entscheidet in besonderem Maße über die zulässigen Einsatzbereiche<br />
von Werkstoffen. Deshalb werden Prüfmethoden benötigt,<br />
die eine schnelle und verlässliche Bestimmung ermöglichen.<br />
Am SKZ steht nun ein neues Medien-Zeitstand-Prüfgerät zur<br />
Verfügung. In einem Forschungsvorhaben wird derzeit untersucht,<br />
inwieweit der Full Notched Creep-Test (FNCT) nach<br />
ISO 16770 durch den Einsatz eines alternativen Netzmittels in<br />
Kombination mit geeigneten Prüftemperaturen und Spannungen<br />
für den Bereich der Werkstoffprüfung optimiert werden kann.<br />
Ziel ist dabei eine möglichst weitgehende Verkürzung der Prüfzeiten.<br />
Das neue Medien-Zeitstand-Zugprüfgerät wurde von<br />
der Fa. IPT Institut für Prüftechnik Gerätebau GmbH & Co. KG,<br />
Todtenweiß, speziell für diesen Zweck modifiziert.<br />
INDUSTRIE RECHT && WIRTSCHAFT REGELWERK NACHRICHTEN<br />
FACHBERICHT<br />
RohRsysteme<br />
aus steinzeug<br />
staRk.<br />
nachhaltig.<br />
zukunftsweisend.<br />
Neues Medien-Zeitstand-Prüfgerät des SKZ<br />
Sechs Einzelstationen mit einem Fassungsvermögen von jeweils<br />
ca. 1 l ermöglichen einen Vergleich verschiedenster Medien bzw.<br />
Werkstoff-Medien-Kombinationen. Jede Station wird autark<br />
betrieben, so dass Kraft- und Dehnungsvorgaben sowie Temperaturen<br />
zwischen 40 und 95 °C individuell gewählt werden können.<br />
Neben klassischen Zeitstandversuchen mit konstanter Spannung<br />
lassen sich auch Prüfungen mit vorgegebenen konstanten<br />
Dehnungen (Relaxation) realisieren. Dank einer kontinuierlichen<br />
Erfassung der Kraft-, Weg- und Temperaturdaten während der<br />
gesamten Prüfdauer ist eine umfassende Werkstoffcharakterisierung<br />
möglich. Probenbrüche erkennt das Prüfgerät automatisch.<br />
Steinzeug-Keramo GmbH<br />
Alfred-Nobel-Straße 17 | 50226 Frechen<br />
Telefon +49 2234 507-0<br />
Telefax +49 2234 507-207<br />
E-Mail info@steinzeug-keramo.com<br />
Internet www.steinzeug-keramo.com<br />
04-05 / 2013 7
FACHBERICHT NACHRICHTEN RECHT INDUSTRIE & REGELWERK & WIRTSCHAFT<br />
UNIHA holt Großaufträge in Afrika<br />
Aufträge für die Errichtung von insgesamt sechs Wasserwerken<br />
in Afrika hat die UNIHA Wassertechnologie GmbH<br />
gewonnen. Dafür holt das Linzer Unternehmen die Lenzing<br />
Technik GmbH als Hauptlieferanten an Bord. Damit sichern<br />
die beiden die Versorgung von 150.000 Menschen mit täglich<br />
rund 23.000 m 3 Trinkwasser. Die Arbeiten für die vier<br />
Anlagen in Ghana laufen auf Hochtouren, in Kürze erfolgt<br />
der Spatenstich für die beiden Projekte in Ägypten. UNIHA<br />
Von UNIHA kommt die Verfahrenstechnik, Lenzing Technik steuert Detailengineering- und Montageleistungen,<br />
technische Schlüsselkomponenten und den Anlagenbau im Gesamtwert von knapp vier Millionen Euro bei<br />
hat für alle Wasserwerke die Verfahrenstechnik entwickelt,<br />
Lenzing Technik steuert Detailengineering- und Montageleistungen,<br />
technische Schlüsselkomponenten und den Anlagenbau<br />
im Gesamtwert von knapp vier Millionen Euro bei.<br />
Obwohl in allen sechs Anlagen Trinkwasser erzeugt wird,<br />
sind die eingesetzten Technologien völlig unterschiedlich.<br />
In Ägypten wird dieses in Umkehrosmose aus Meerwasser<br />
gewonnen, in Ghana durch Flockung und Sedimentation<br />
aus Flusswasser. Dennoch konnte sich UNIHA<br />
sowohl bei den Ausschreibungen in Ghana als auch in<br />
Ägypten gegen internationale Konkurrenz durchsetzen.<br />
„Bieten wir beispielsweise zu einem höheren Preis an als<br />
etwa asiatische Mitbewerber, muss dieser durch technologische<br />
Überlegenheit klar begründet sein“, betont<br />
Rudolf Ochsner, der geschäftsführende Gesellschafter<br />
von UNIHA.<br />
In Ägypten ist das etwa mit einer besonders effizienten<br />
Energierückgewinnungslösung bei der Umkehrosmose<br />
gelungen. Dabei wird das Salzwasser mit einem Druck<br />
von 70 bar durch eine<br />
Membrane gepresst.<br />
„Mit dem überschüssigen<br />
Druck betreiben<br />
wir wiederum eine<br />
Pumpe“, präzisiert<br />
Foto: © Uniha<br />
Ochsner. Damit die<br />
Versorgung von rund<br />
100.000 Menschen in<br />
Sidi Abdel Rahman und<br />
El Arish mit täglich rund<br />
17.000 m 3 Trinkwasser<br />
tatsächlich sichergestellt<br />
werden kann,<br />
braucht UNIHA neben<br />
zuverlässigen Projektpartnern<br />
auch eine<br />
sichere Finanzierung.<br />
Abgesichert werden die<br />
insgesamt 16 Millionen<br />
Euro schweren Aufträge<br />
von der Österreichischen<br />
Kontrollbank.<br />
Der Partner für Detailengineering<br />
und Anlagenbau<br />
ist die Lenzing<br />
Technik GmbH. Für<br />
die ägyptischen Wasserwerke<br />
fertigt diese<br />
die komplette Verrohrung<br />
der Osmoseanlage,<br />
sämtliche Tanks,<br />
Kerzenfilter, Armaturen<br />
sowie die gesamte<br />
Elektrotechnik und<br />
überwacht vor Ort die Montage der Anlage.<br />
Nicht Meer-, sondern Flusswasser wird in den vier Wasserwerken<br />
in Ghana aufbereitet. Weil dabei eine gänzlich<br />
andere Technologie zum Einsatz kommt, sieht sich<br />
Lenzing Technik mit einem umfangreichen Auftrag von<br />
UNIHA konfrontiert: Neben der Fertigung und Lieferung<br />
der Misch- und Rührwerktanks, der Lamellenabscheider<br />
und der Stahlbauhallen für die Betriebstechnik, zeichnen<br />
die Engineering-Experten auch für die Montage und Inbetriebnahme<br />
der Gesamtanlagen in Kibi, Apedwa, Kwabeng<br />
und Osenase verantwortlich.<br />
8 04-05 / 2013
INDUSTRIE RECHT && WIRTSCHAFT REGELWERK NACHRICHTEN<br />
FACHBERICHT<br />
Geschäftsklima der<br />
Kunststoffrohr-Industrie<br />
bleibt angespannt<br />
Nach dem starken Abrutschen des Geschäftsklimaindex der<br />
Kunststoffrohr-Industrie im zweiten und dritten Quartal 2012<br />
steigt dieser nach Ablauf des vierten Quartals erstmals wieder<br />
um 5 Punkte auf den Wert von -16,6 an. Zugleich verschlechterte<br />
sich die Geschäftslage gegenüber dem Vorquartal<br />
nochmals um 3,1 Punkte auf den Index von -24,7. Die leichte<br />
Verbesserung des Geschäftsklimaindex im abgelaufenen Quartal<br />
geht vornehmlich auf positive Geschäftserwartungen beim<br />
Absatz von Kunststoffrohrsystemen im Wohnungsbau zurück.<br />
Hier wirken sich die niedrigen Hypothekenzinsen und die ausgeprägte<br />
Präferenz der Anleger für Investitionen in Sachwerte<br />
offenbar belebend aus.<br />
Kanal-TV-Inspektion<br />
leicht gemacht<br />
Kamera- und Sondenortungssystem<br />
für Jedermann<br />
vCam und vLocCam2<br />
Inspektion, Kontrolle und Überprüfung<br />
Einfachste Bedienung mit intuitivem<br />
Menu-Interface<br />
Die Ertragslage veränderte sich im Vergleich zum Vorquartal<br />
nur leicht und liegt mit einem Index von -26,2 weiterhin im<br />
negativen Bereich. Eine Ursache dafür liegt in der Erhöhung<br />
der Herstellkosten, die insbesondere auf gestiegene Rohstoffpreise<br />
sowie Energie- und Lohnkosten zurückzuführen sind.<br />
Zum anderen sorgten geringe Investitionen in die Ver- und<br />
Entsorgungsnetze und damit weniger Ausschreibungen zu<br />
einer ruhigen Marktlage, einer Wettbewerbsintensivierung<br />
unter den Kunststoffrohrherstellern und damit zu einem<br />
spürbaren Druck auf die Margen. Die Geschäftserwartungen<br />
der Rohrhersteller für das erste Quartal dieses Jahres sind<br />
durchwachsen. 17 % der befragten Unternehmen erwarten<br />
ein Absatzanstieg, 44 % rechnen mit einer vergleichbaren<br />
Absatzsituation wie im Vorjahr und immerhin 39 % gehen<br />
von niedrigeren Absätzen aus. Seitens der Kunststofferzeuger<br />
werden die Geschäftserwartungen tendenziell noch etwas<br />
pessimistischer eingeschätzt. Im insgesamt durchwachsenen<br />
Geschäftsklima für Kunststoffrohre bleiben der Hoch- und<br />
Wohnungsbau in 2013 der Hoffnungsschimmer.<br />
Akkubetrieb bis 6 Stunden<br />
Integrierte Ortungssonden (kompatibel<br />
mit allen gängigen Ortungsgeräten)<br />
Robuster Kamerakopf<br />
mit aufrechtem Bild<br />
www.sebakmt.com/cctv<br />
SebaKMT<br />
Dr.-Herbert-Iann-Str. 6<br />
96148 Baunach<br />
T +49 (0) 95 44 - 6 80<br />
F +49 (0) 95 44 - 22 73<br />
sales@sebakmt.com<br />
www.sebakmt.com<br />
04-05 / 2013 9
FACHBERICHT NACHRICHTEN RECHT INDUSTRIE & REGELWERK & WIRTSCHAFT | PERSONALIEN<br />
Weltweite Water Services für Versorgungsunternehmen<br />
und Investoren<br />
Mit seinem neuen Bereich Water Services steigt TÜV SÜD in<br />
einen weltweiten Wachstumsmarkt ein. Auf der Hannover<br />
Messe präsentiert das Unternehmen zum ersten Mal seine<br />
Dienstleistungen für Bereiche wie Meerwasserentsalzung,<br />
Infrastruktur und Smart Water Grid Applications (Halle 1<br />
„Metropolitan Solutions“, Stand E16).<br />
„Vor dem Hintergrund der weiter wachsenden Weltbevölkerung,<br />
der fortschreitenden Urbanisierung und des<br />
Klimawandels ist die Wasserversorgung eines der zentralen<br />
Zukunftsthemen“, sagt Dr. Andreas Hauser, Leiter des<br />
neuen Bereichs Water Services von TÜV SÜD. Vor allem in<br />
den schnell wachsenden Städten und Megacities in China,<br />
Indien und im Nahen Osten, aber auch in entwickelten<br />
Regionen wie den USA müssen die Infrastrukturen für die<br />
Trinkwasserversorgung und die Abwasserentsorgung aufgebaut,<br />
ausgebaut oder modernisiert werden. „Dafür sind<br />
gewaltige Anstrengungen und Investitionen erforderlich“,<br />
so Dr. Hauser. „Mit unseren neuen Water Services schaffen<br />
wir durch Qualitätssicherung, Risikobewertung und das<br />
Aufzeigen von Optimierungsansätzen effiziente, sichere<br />
und nachhaltige Lösungen sowie belastungsfähige Entscheidungsgrundlagen<br />
für die Planung und Realisierung der entsprechenden<br />
Maßnahmen und Projekte.“ Davon profitieren<br />
Investoren, Versorgungsunternehmen, Generalunternehmer<br />
und Zulieferer sowie Entwickler und Anbieter, vor allem<br />
neuer Technologien wie Smart Water Grid Technologies.<br />
„Mit unseren Water Services übertragen wir die umfangreichen<br />
Kompetenzen und Erfahrungen von TÜV SÜD mit<br />
industriellen Anlagen und komplexen Infrastrukturen – beispielsweise<br />
im Energiebereich – auf ein neues Tätigkeitsfeld“,<br />
erklärt Stephan Hild, der für die Geschäftsentwicklung<br />
des neuen Bereichs verantwortlich ist. „Dabei konzentrieren<br />
wir uns zunächst auf vier große Schwerpunktthemen.“ Es<br />
handelt sich um die Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle<br />
bei der baulichen Umsetzung von Wasserinfrastrukturprojekten,<br />
um Beratungsleistungen für die Optimierung und<br />
Effizienzsteigerung von Wasser- und Abwasserinfrastrukturen,<br />
um Risikoanalysen sowie um Beratungsdienstleistungen<br />
für datengetriebene Wasserlösungen.<br />
KONTAKT: www.tuev-sued.de<br />
Neuer Geschäftsführer Technik bei Open Grid Europe:<br />
Hüwener folgt auf Watzka<br />
Am 1. März 2013 hat Dr. Thomas Hüwener (41) kommissarisch<br />
die technische Geschäftsführung von Open Grid<br />
Europe von Heinz Watzka (55) übernommen, der das Unternehmen<br />
aus persönlichen Gründen auf eigenen Wunsch<br />
zum 28. Februar 2013 verlassen hat.<br />
Hüwener studierte Maschinenbau in Bochum und College<br />
Station, USA und promovierte im Bereich Strömungsmaschinen<br />
an der Universität Essen. Von 2001 bis heute war<br />
Hüwener in verschiedenen technischen Führungsfunktionen<br />
bei der E.ON Ruhrgas und der Open Grid Europe<br />
tätig. Dort leitete er zuletzt den Bereich Leitungstechnik.<br />
Er ist Mitglied in verschiedenen Gremien der nationalen<br />
und internationalen Gaswirtschaft.<br />
Sein Vorgänger, Heinz Watzka, kam nach verschiedenen<br />
Stationen in der Ölindustrie Anfang 2002 als Regionalleiter<br />
Süd zur E.ON Ruhrgas, wo er nach verschiedenen weiteren<br />
Führungsaufgaben in 2010 in die Geschäftsführung der<br />
Open Grid Europe berufen wurde. In dieser Funktion war<br />
er maßgeblich an der Neuausrichtung und Strukturierung<br />
des Unternehmens hin zum Independent Transmission<br />
Operator (ITO) beteiligt.<br />
Dr. Thomas Hüwener<br />
Heinz Watzka<br />
„Mit Heinz Watzka verlieren wir einen herausragenden Ingenieur<br />
und Fachmann, einen in der Branche hoch geschätzten<br />
Kollegen sowie einen Botschafter für unser Unternehmen und<br />
einen Freund“, so Stephan Kamphues, Sprecher der Geschäftsführung<br />
Open Grid Europe. „Für die Zukunft wünschen wir<br />
ihm Gesundheit, beruflichen Erfolg und persönlich alles Gute.“<br />
10 04-05 / 2013
RECHT & PERSONALIEN REGELWERK NACHRICHTEN<br />
FACHBERICHT<br />
Vorstandsmitglied Gilbert Faul verlässt<br />
WILO SE auf eigenen Wunsch<br />
Nach langjähriger, erfolgreicher Arbeit für den Pumpenspezialisten<br />
sucht der 45-Jährige Gilbert Faul eine neue,<br />
berufliche Herausforderung. Faul hatte, zuletzt als Mitglied<br />
des Vorstands, einen wesentlichen Anteil daran, dass die<br />
Wilo-Gruppe ihre Geschäftsaktivitäten in China, Korea,<br />
Indien und im südostasiatischen Raum deutlich ausbauen<br />
konnte. Nun will sich der Franzose neuen Aufgaben widmen<br />
und legte sein Vorstandsmandat am 18. Februar 2013 mit<br />
sofortiger Wirkung nieder.<br />
Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Heinz-Gerd Stein dankte<br />
dem scheidenden Vorstandsmitglied für sein großes Engagement<br />
in den vergangenen, mehr als zehn Jahren. Bis auf<br />
Weiteres übernimmt der Vorstandsvorsitzende, Oliver Hermes,<br />
sämtliche Verantwortungsbereiche von Gilbert Faul.<br />
Hermes würdigte den Beitrag, den Gilbert Faul bei der<br />
Umsetzung der Wachstumsstrategie in den Emerging Markets<br />
geleistet hat und wünschte ihm für seine berufliche<br />
Zukunft viel Glück.<br />
Gilbert Faul<br />
Lösungen aus duktiLem guss<br />
informieren sie sich im internet unter www.duktus.com<br />
Besuchen sie uns auf der Wasser Berlin in Halle 3.2, stand 205!<br />
<strong>3R</strong>_April_13.indd 1 19.02.2013 11:04:29<br />
04-05 / 2013 11
FACHBERICHT NACHRICHTEN RECHT VERANSTALTUNGEN<br />
& REGELWERK<br />
Rahmenprogramm der IE expo 2013 widmet sich<br />
globalen Netzwerken<br />
Die IE expo 2013, die vom 13. bis zum 15. Mai in Shanghai<br />
stattfindet, hat sich zur wichtigsten Umwelttechnologiemesse<br />
Chinas und Asiens entwickelt. Der Bedeutung entsprechend<br />
haben sich erstmals drei Minister angekündigt,<br />
die Veranstaltung zu eröffnen: Zhou Shengxian, chinesischer<br />
Minister für Umweltschutz, Qiu Baoxing, Vizeminister des<br />
chinesischen Bauministeriums und der bayerische Staatsminister<br />
für Umwelt und Gesundheit, Dr. Marcel Huber.<br />
Darüber hinaus wird die Messe das größte Veranstaltungsprogramm<br />
präsentieren, das es bisher auf der IE expo gab.<br />
Mit Ausblick auf die Entwicklung von neuen Umwelttechnologien<br />
findet während der gesamten Messelaufzeit das<br />
Forum Development of Environmental Protection Industry<br />
statt, in Verbindung mit dem jährlich Treffen der Chinese<br />
Society of Environmental Science (CSES). Zahlreiche Vertreter<br />
aus der chinesischen Politik, u. a. Zhou Shengxian,<br />
Minister für Umweltschutz, Qiu Baoxing, Vizeminister des<br />
Bauministeriums, sowie Wang Yuqing, Vizedirektor des<br />
Umwelt- und Ressourcenschutz-Komitees des Volkskongress<br />
und Präsident der chinesischen Gesellschaft für Umweltschutz,<br />
nutzen die IE expo als Treffpunkt für fachlichen<br />
Austausch. Die Podiumsdiskussionen und Präsentation<br />
decken dabei speziell das Thema innovative Technologien,<br />
analytische Methoden und die neuesten Trends im Bereich<br />
Umwelt und Energie ab.<br />
Um die Ideen und Fortschritte rund um globale Umweltperspektiven<br />
auszuzeichnen, wird am 14. Mai im Rahmen<br />
der IE expo von Ringier Trade Media Ltd. Shanghai und<br />
MMI-ZM Trade Fairs der Innovationspreis 2013 im Bereich<br />
Pumpen- und Ventilindustrie verliehen.<br />
Darüber hinaus findet parallel das Forum Intelligent Urbanization<br />
statt, das sich eingehend mit den Chancen und<br />
Risiken der rapiden Urbanisierung in China und Asien auseinandersetzt.<br />
Neben Dr. Marcel Huber, dem bayerischen<br />
Staatsminister für Umwelt und Gesundheit (StMUG) nehmen<br />
u. a. auch Prof. Meng Wei, Präsident der Chinesischen<br />
Forschungsakademie für Umweltwissenschaft und Dr. h.c.<br />
Hans Huber, Mitglied der International Expert Group on<br />
Earth System Preservation (IESP), am Forum teil.<br />
ZUSATZPROGRAMM<br />
Zum Thema „Nachhaltige Urbanisierung“ organisiert IESP<br />
am 13. und 14. Mai einen Workshop, um in den drei Sektoren<br />
Wasserwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Ressourcenschutz<br />
über den Einsatz ökologischer Praktiken in<br />
Städten zu diskutieren. Zusätzlich finden vom 13. bis zum<br />
15. Mai die technisch wissenschaftlichen Veranstaltungen<br />
der DWA sowie die Gipfeltreffen zu den Themen „Zukünftige<br />
Energieerzeugung mit Hilfe von Abfall“ und „Internationale<br />
Wasser- und Abfallaufbereitungsverfahren“ statt. Mit<br />
Blick auf die Planung einer zukünftigen Investition in China,<br />
stellt das Österreichische Bundesministerium für Land- und<br />
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW)<br />
im Rahmen des „Austria Day“ die neuesten technologischen<br />
Fortschritte und Systemlösungen vor. Ebenfalls über die<br />
komplette Messelaufzeit zugänglich sind die Ausstellerpräsentationen,<br />
die gemeinsam von MMI-ZM und der Messe<br />
München veranstaltet werden.<br />
KONTAKT: www.ie-expo.com<br />
Effektive Vorbereitung auf die K 2013<br />
Im Oktober startet die K 2013 in Düsseldorf,<br />
doch unter www.k-online.de läuft die weltweit<br />
bedeutendste Messe für Kunststoff und<br />
Kautschuk bereits jetzt. Die neu gestaltete<br />
Website vereinfacht die effektive Vorbereitung<br />
und Planung des K-Besuchs. Schon<br />
im letzten K-Jahr 2010 wurde das Portal<br />
über elf Millionen Mal angeklickt. Auch<br />
das übersichtlich strukturierte Portal der<br />
K 2013 bietet wieder eine Fülle <strong>aktuell</strong>er<br />
Informationen rund um die Messe, News aus der Branche,<br />
Neuheiten aus der Wissenschaft und natürlich jede Menge<br />
praktische Tipps für den Messebesuch. Seit Kurzem ist das<br />
Herzstück des K-Portals online: die Ausstellerdatenbank<br />
– der virtuelle Katalog sozusagen. Seitdem sind die Visits<br />
sprunghaft auf rund 110.000 in den Monaten Januar und<br />
Februar angestiegen. Die User können im Bereich „Firmen<br />
und Produkte“ einzelne Firmen suchen, sie können sich<br />
aber auch eine Liste von Firmen spezieller Angebotsbereiche<br />
oder einzelner Nationen anzeigen lassen und anschließend<br />
downloaden. Zahlreiche personalisierte Services wie MyOrganizer,<br />
MyCalendar für Online-Terminvereinbarungen und<br />
MyCatalogue für die Zusammenstellung des individuellen<br />
Messekatalogs runden das Angebot ab. Besonders erfreulich:<br />
Mit der K-App sind alle wichtigen Informationen auch<br />
mobil verfügbar – und zwar sowohl für Android- als auch<br />
Apple-Systeme.<br />
Besonders nützlich ist die Matchmaking-Funktion. Diese<br />
Internet-Kontaktbörse bringt Aussteller und Besucher noch<br />
besser zusammen: Beide Seiten können ihre Fragen und<br />
Angebote – beispielsweise die Suche nach einem neuen<br />
Kooperationspartner – online einstellen und einsehen. So<br />
können sie bereits im Vorfeld der Messe Kontakte knüpfen<br />
und sich während der K zu konkreten Gesprächen treffen.<br />
12 04-05 / 2013
FRIAFIT ® -<br />
Abwassersystem:<br />
NEU!<br />
RECHT VERANSTALTUNGEN & REGELWERK NACHRICHTEN<br />
FACHBERICHT<br />
Zehnte DWA-Kanalbautage in<br />
Bad Soden<br />
Die <strong>aktuell</strong>en gesetzlichen, insbesondere vergaberechtlichen Entwicklungen<br />
im Kanal- und Leitungsbau sowie die geplanten Änderungen in<br />
der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) bilden zwei<br />
Schwerpunkte der zehnten DWA-Kanalbautage, die am 18. und 19. Juni<br />
2013 zeitgleich zu den DWA-Kläranlagentagen in Bad Soden stattfinden.<br />
Weitere Themen der Veranstaltung, die die Deutsche Vereinigung für<br />
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) 2013 gemeinsam<br />
mit dem Deutschen Städtetag und dem Deutschen Städte- und Gemeindebund<br />
sowie fünf Rohrverbänden ausrichtet, betreffen Anforderungen<br />
an die Qualitätssicherung in Planung, Ausschreibung und Ausführung<br />
von Kanalbauten. Anhand praktischer Beispiele werden neue Techniken<br />
im Kanalbau wie das Press-/Ziehverfahren oder der Pfahlbau vorgestellt.<br />
Vorträge zu erforderlichen Fertigkeiten in der Baudurchführung und zur<br />
Anwendung des Arbeitsblatts DWA-A 161 zum Rohrvortrieb runden<br />
das Tagungsprogramm ab.<br />
Die Kanalbautage richten sich an Kanalnetzbetreiber sowie an Personen<br />
und Firmen, die sich mit Entwässerungssystemen befassen. Parallel zu<br />
den Kanalbautagen können ohne Aufpreis die erstmalig angebotenen<br />
DWA-Kläranlagentage besucht werden.<br />
KONTAKT: DWA, Hennef, Renate Teichmann, Tel. +49 2242 872-118,<br />
E-Mail: teichmann@dwa.de<br />
Experten geben Überblick zum<br />
Umgang mit Regenwasser<br />
Die Entwicklungen und der derzeitige Stand im Umgang mit Regenwasser<br />
sind die zentralen Themen der 12. Regenwassertage, zu<br />
denen die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser<br />
und Abfall e. V. (DWA) Fachleute aus Wissenschaft, Wirtschaft,<br />
Verbänden und Kommunen für den 10. und 11. Juni 2013 nach<br />
Freiburg einlädt.<br />
Die Tagung der Entwässerungsexperten beleuchtet in mehreren<br />
Vorträgen u. a. die Themen Management, Behandlung und Entsorgung<br />
von Regenwasser. Ein besonderes Augenmerk legt die<br />
Veranstaltung auf die Behandlung der Abflüsse von Straßen sowie<br />
belasteten Abwässern und die Reinigung von Verkehrsflächen. Ein<br />
weiterer Schwerpunkt befasst sich mit der kommunalen Überflutungsvorsorge.<br />
Hier wird u. a. der Frage nachgegangen, wie sturzflutgefährdete<br />
Bereiche im urbanen Raum ermittelt und Risiken<br />
abgeschätzt werden können.<br />
Die DWA-Regenwassertage gelten als wichtiges Fachforum für den<br />
Umgang mit Niederschlägen im deutschsprachigen Raum. Sie werden<br />
regelmäßig von weit über 100 Teilnehmern besucht und durchgängig<br />
gut bewertet. Parallel zur Tagung präsentieren ausstellende Firmen<br />
die von ihnen angebotenen Techniken und Verfahren.<br />
Wirtschaftliche Erstellung<br />
von Hausanschlüssen und<br />
Straßenabläufen.<br />
FRIAFIT ® Abwassersattel<br />
ASA-VL<br />
Zur Anbindung von großvolumigen Anschlussleitungen<br />
d 225 mm an Hauptkanäle<br />
d 355 - d 630 mm aus PE-HD<br />
mit innovativer Vakuumspanntechnik<br />
FRIAFIT ® Anschluss-Stutzen<br />
ASA-MULTI<br />
Zum Anschluss von geschweißten,<br />
wurzelfesten PE-HD Anschlussleitungen<br />
d 160 mm an Hauptkanäle<br />
aus Steinzeug/Beton<br />
KONTAKT: DWA, Hennef, Sarah Heimann, E-Mail: heimann@dwa.de<br />
04-05 / 2013 www.friafit.de · info-friafit@friatec.de 13
FACHBERICHT NACHRICHTEN RECHT VERANSTALTUNGEN<br />
& REGELWERK<br />
Nordafrika diskutiert über technische Infrastruktur<br />
Der im Januar 2011 in Tunesien gestartete arabische Frühling<br />
hat zu weitreichenden Veränderungen in Nordafrika<br />
geführt. Die begonnenen Umbrüche in Politik und Verwaltung<br />
sind nicht abgeschlossen. Dennoch müssen ausstehende<br />
Infrastrukturprojekte dringend angegangen werden, um<br />
Anschluss am internationalen Wettbewerb zu halten und<br />
Investitionen ins Land zu holen.<br />
Die „Infrastructure North Africa“, INA (21./22. Januar 2013)<br />
wurde von dem in Deutschland ansässigen Euro Institute<br />
for Information and Technology Transfer, EITEP, und seinem<br />
tunesischen Partner Circina gemeinsam mit der tunesischen<br />
Regierung vorbereitet.<br />
Die Teilnahme aus den Führungsebenen von Politik und<br />
Wirtschaft der nordafrikanischen Staaten war mit rund 140<br />
Personen sehr gut. Westliche Industriestaaten waren mit 20<br />
Ausstellern und etwa 60 Teilnehmern vertreten.<br />
In der Eröffnungsveranstaltung und den beiden folgenden<br />
Plenary-Sessions haben insgesamt 18 Minister, Staatssekretäre,<br />
Deputy Minister und CEOs der großen Regiebetriebe<br />
über den Stand der Entwicklung und die Planungen<br />
aller Bereiche der Infrastruktur in den Ländern Tunesien<br />
(vornehmlich), Algerien, Marokko, Libyen und Mauretanien<br />
berichtet. In jeweils drei parallelen Sessions wurden in<br />
insgesamt 35 Vorträgen erprobte technische Lösungen für<br />
den Einsatz in Nordafrika vorgestellt und mit Teilnehmern<br />
aus 16 Nationen diskutiert.<br />
Während der Veranstaltung wurde eine Informationsplattform<br />
eingerichtet, auf der auch zwischen den Konferenzen<br />
Informationen zu neuen Projekten vermittelt werden und es<br />
wurde ein Vorvertrag zur Qualifizierung von libyschen Ingenieuren<br />
aus allen Bereichen der Infrastruktur unterzeichnet.<br />
Die Infrastructure North Africa 2013 fand in der überregionalen<br />
Presse große Beachtung und wird 2014 mit zusätzlichen<br />
Infrastrukturthemen weiter ausgebaut. Die nächste<br />
INA findet voraussichtlich in der Zeit vom 17. bis 19. Februar<br />
2014 wieder in Tunis statt.<br />
KONTAKT: www.infrastructurenorthafrica.com<br />
ROHRBAU-Weimar am 18./19. November<br />
Am 18./19. November findet in Weimar der 18. Technischwissenschaftliche<br />
ROHRBAU-Kongress statt.<br />
Unter dem Motto „Leitungssysteme - sicher und effektiv“<br />
bietet das ausrichtenden Forschungsinstitut für Tief- und<br />
<strong>Rohrleitungsbau</strong> Weimar e.V. (FITR) ein umfangreiches Vortragsprogramm<br />
und eine begleitende Fachausstellung an.<br />
Wie in den Jahren zuvor stehen der direkte Informationsfluss<br />
zwischen Entwicklern, Herstellern und Anwendern sowie die<br />
Erkundung weiterer Betätigungsfelder der Forschung und<br />
Entwicklung auf dem Gebiet des Tief- und <strong>Rohrleitungsbau</strong>s<br />
und darüber hinaus im Fokus.<br />
KONTAKT: Forschungsinstitut für Tief- und <strong>Rohrleitungsbau</strong> Weimar e.V.<br />
(FITR), Weimar, Tel. +49 3643 8268-0, E-Mail: rohrbau@fitr.de<br />
Zweite Flüssigbodentagung interessiert<br />
150 Experten der Branche<br />
Am 28. Februar und 1. März hat an der Fachhochschule<br />
Regensburg die zweite Flüssigbodentagung stattgefunden .<br />
Veranstalter waren die RAL Gütegemeinschaft Flüssigboden<br />
e. V. sowie das Forschungsinstitut für Flüssigboden GmbH<br />
privatwirtschaftliches Unternehmen (FiFB), Leipzig in Zusammenarbeit<br />
mit der Hochschule Regensburg.<br />
Die Themen der Tagung wurden auf die Interessen von<br />
Mitarbeitern in Planungsbüros, Baufirmen und Behörden<br />
abgestimmt. dabei wurde bei allen ausgewählten Fachvorträgen<br />
besonderer Wert auf deren Anwendungs- und<br />
Praxisorientierung gelegt.<br />
Zum diesjährigen Tagungsschwerpunkt „Bettung von fernwärme-<br />
und Stromrohren sowie Stromleitungen“ wurden<br />
in Grundsatzvorträgen die speziellen Anforderungen an<br />
Bettungsmaterialien dieser sich zyklisch aufwärmenden<br />
und abkühlenden Leitungen behandelt.<br />
Viele Vorträge beschäftigten sich mit der Umsetzung von<br />
Bauvorhaben und beleuchteten dabei auch die für Auftraggeber<br />
wichtigen Themen Ausschreibung, Vergabe und<br />
Qualitätssicherung. Zusätzlich wurden Potenziale für den<br />
Einsatz von Flüssigbodenverfahren und Themen aus der<br />
angewandten Forschung dargestellt.<br />
Mehr als 12 Jahre Erfahrung mit dem Einsatz von Flüssigboden,<br />
z. B. in Göttingen, und eine durch Vortragsthemen<br />
gespiegelte Ausweitung der Anwendung von Flüssigböden<br />
außerhalb des klassischen Kanalbaus konnten den Tagungsteilnehmern<br />
neue Erkenntnisse und Anregungen liefern.<br />
KONTAKT: RAL Gütegemeinschaft Flüssigboden e.V.,<br />
www.ral-gg-fluessigboden.de<br />
14 04-05 / 2013
RECHT VERANSTALTUNGEN & REGELWERK NACHRICHTEN<br />
FACHBERICHT<br />
9. Pipelinetechnik-Symposium erwartet Fachbesucher<br />
in Köln<br />
Am 18. und 19. September 2013 findet das 9. Internationale<br />
Symposium Pipelinetechnik beim TÜV Rheinland in Köln<br />
statt. Die Veranstaltung widmet sich traditionell seit dem<br />
Jahr 1973 den <strong>aktuell</strong>en Entwicklungen und Herausforderungen<br />
sowie Anwendungs- und Erfahrungsberichten aus<br />
Bau, Betrieb und Instandhaltung von Pipelines.<br />
Fachbesucher haben die Gelegenheit, das Symposium als<br />
Plattform für den Erfahrungsaustausch mit Unternehmen<br />
aus Betrieb, Herstellung und Planung sowie den Prüfstellen<br />
und Behörden zu nutzen. Begleitend zum Symposium<br />
findet eine Industrieausstellung statt.<br />
KONTAKT: TÜV Rheinland Industrie Service, Köln, Heiko Crysandt,<br />
Tel. +49 221 806-5086, E-Mail: pipelinetechnik@de.tuv.com<br />
Kunststoff-Schweißtechnik<br />
Vertrauen Sie auf Erfahrung die Ihresgleichen sucht!<br />
Moderne<br />
Kunststoffschweißmaschinen<br />
zum<br />
rationellen<br />
Verschweißen<br />
von Rohren bis<br />
DA 2500 mm,<br />
sowie Tafeln und<br />
Formteilen.<br />
Sonderschweißmaschinen<br />
für<br />
Serienteile aus<br />
Polyolefinen auf<br />
Kundenwunsch.<br />
Wir stellen aus<br />
Wasser Berlin<br />
Halle 3.2 Stand 113<br />
Qualität<br />
Innovation<br />
Service weltweit<br />
WIDOS<br />
Wilhelm Dommer Söhne GmbH<br />
Einsteinstraße 5<br />
D-71254 Ditzingen-Heimerdingen<br />
Telefon +49 (0) 71 52 / 99 39-0<br />
Telefax +49 (0) 71 52 / 99 39 40<br />
www.widos.de · info@widos.de<br />
04-05 / 2013 15
FACHBERICHT NACHRICHTEN RECHT VERANSTALTUNGEN<br />
& REGELWERK<br />
fkks tagte Ende Januar in Esslingen<br />
Der diesjährige fkks<br />
infotag zum Thema<br />
„Kathodischer Korrosionsschutz<br />
im<br />
Stahlbetonbau –<br />
Stand der Technik,<br />
Regelwerke und Praxis“<br />
am 29. Januar<br />
fand in der Fachwelt<br />
große Beachtung.<br />
Annähernd 100<br />
Fachleute aus dem<br />
In- und Ausland,<br />
unter ihnen Ingenieure,<br />
Planer, Ausführende<br />
und Materialhersteller, die sich auf dem Gebiet<br />
des kathodischen Korrosionsschutzes von Stahl in Beton<br />
über den <strong>aktuell</strong>en Stand der Normung und Praxis sowie<br />
zukunftsweisende Trends und Entwicklungen informieren<br />
wollten, fanden den Weg nach Esslingen.<br />
Der kathodische Korrosionsschutz von Stahl in Beton hat<br />
in den letzten zehn Jahren zunehmend an Bedeutung im<br />
Bereich der Instandsetzung korrosionsgefährdeter bzw.<br />
-geschädigter Bauwerke gewonnen. Die Komplexität der<br />
Ausführung sowie die bei der Ausführung von Projekten<br />
erforderliche interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener<br />
Gewerke erfordert ein hohes Maß an Fachkompetenz<br />
aller Beteiligten. Die Überführung der DIN EN 12696:2000<br />
in die DIN EN ISO 12696:2012 sowie die Zertifizierung von<br />
Fachpersonal nach DIN EN 15257:2007 ermöglichen hohe<br />
Ausführungsstandards sowie die sichere Anwendung des<br />
Verfahrens.<br />
Die Veranstaltung, durch die Prof. Dr.-Ing. Bernd Isecke<br />
(BAM Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin), Prof.<br />
Dr.-Ing. Michael Raupach (IBAC Institut für Bauforschung<br />
RWTH, Aachen), Dr.-Ing. Thorsten Eichler (CORR-LESS<br />
GmbH & Co. KG, Berlin), Dipl.-Ing. Susanne Gieler-Breßmer<br />
(IGF Gieler-Breßmer & Fahrenkamp GmbH, Süßen),<br />
Dipl.-Ing. Gregor Gerhard (Massenberg GmbH, Bürstadt)<br />
und Dr.-Ing. Dr. rer. nat Franz Pruckner (PP engineering,<br />
Euratsfeld) kompetent und kurzweilig durch die Materie<br />
führten, gab einen Überblick über die <strong>aktuell</strong>en Trends in<br />
Richtlinien und Normung sowie den Stand der Technik in<br />
Ausführung und Praxis.<br />
FKKS-JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG<br />
Am 30. Januar fand die Jahreshauptversammlung statt, zu<br />
der Hans Gaugler als erster Vorsitzender und Hans-Gerhard<br />
Köpf als Geschäftsführer die Teilnehmer begrüßten und die<br />
Sitzung eröffneten.<br />
Gaugler stellte in seinem Bericht die wichtigsten Projekte<br />
vor. Sie umfassen die regionale, nationale und internationale<br />
Präsenz mit dem Ziel der Einflussnahme auf die Regelsetzung<br />
durch den fkks, dem Erhalt bzw. die Steigerung der<br />
Qualifikation des Fachpersonals und um die Wahrnehmung<br />
des KKS bei den interessierten Fachkreisen und potenziellen<br />
Anwendern zu steigern. Er verwies darauf, dass der fkks in<br />
allen wesentlichen Gremien und Vereinigungen des In- und<br />
Auslandes, die sich mit dem KKS beschäftigen, vertreten<br />
sei, sich national wie international als fachlich kompetente<br />
Vertretung seiner Mitglieder etabliert habe, denn er sei bei<br />
seiner Arbeit und Beschlussfassung unabhängig, handele<br />
dabei nach technisch-wissenschaftlichen Notwendigkeiten<br />
und sei partnerschaftlich und kooperativ ausgerichtet.<br />
Er betonte die Notwendigkeit der fachlichen Führerschaft<br />
des fkks bei KKS-Themen, die insbesondere eine ausgeprägte<br />
Öffentlichkeitsarbeit bedürfe. Er verwies dabei auf<br />
die Angebote der Internetseite www.fkks.de, betonte aber<br />
auch die Notwendigkeit der Präsenz bei Fachtagungen, wie<br />
z. B. dem Rohrleitungsforum des iro, sowie der Präsentation<br />
des fkks durch Veröffentlichung von Fachartikeln in Fachzeitschriften,<br />
nicht zuletzt durch das forum kks mit fkks<br />
infotag und fkks workshop, das sich etabliert und konstant<br />
etwa 100 Personen anspreche. Hier sollten insbesondere auf<br />
die Vorzüge und Aufgaben des KKS hingewiesen werden.<br />
Wesentlich sei aber auch die Abstimmung der Ausbildungsinhalte,<br />
das Initiieren von Infoveranstaltungen und die Pflege<br />
der Kontakte mit Hochschulen, um einen ganzheitlichen<br />
Ansatz bei der Aus- und Weiterbildung anzustreben.<br />
Der Geschäftsführer konnte in seinem Rechenschaftsbericht<br />
wiederum eine positive Mitgliederentwicklung für das Jahr<br />
2012 berichten.<br />
Jürgen Barthel stellte den Fachbeirat vor. Dabei ging er auf<br />
Struktur und Aufgabenbereiche ein. Anschließend gaben die<br />
jeweiligen Leiter einen Tätigkeitsbericht ihrer Fachbereiche.<br />
Hans-Gerhard Köpf berichtete über Aktivitäten die fkks<br />
cert gmbh, der akkreditierten Zertifizierungsstelle des Verbandes.<br />
Er berichtete, dass diese fehlerfrei arbeite und ihr<br />
Angebot ausweite. Nunmehr werden Zertifikatsprüfungen<br />
auch in englischer Sprache angeboten und umgesetzt.<br />
Anschließend ging Köpf auf anstehende Überführung der<br />
DIN EN 15257 in eine ISO-Norm ein, womit das europäische<br />
System weltweit Verbreitung finde. Dann gab er Hinweise<br />
auf die anstehenden, aus Verbandssicht interessanten Veranstaltungen,<br />
namentlich die 3-Länder Korrosionsschutztagung<br />
am 25. und 26. April in Frankfurt, den Technischen<br />
Kongress der Ceocor vom 4. bis 7. Juni in Florenz, der Vollversammlung<br />
des ISO TC 156 vom 11. bis 13. Juni in Berlin<br />
sowie den 7. Praxistag Korrosionsschutz am 19. Juni in<br />
Gelsenkirchen.<br />
Die Mitgliederversammlung beschloss, dass die Jahreshauptversammlung<br />
2014, an dem der fkks sein 50-jähriges Bestehen<br />
feiere, am 21. und 22. Mai 2014 im Anschluss an den<br />
Technischen Kongress der Ceocor (19. bis 21. Mai 2014 in<br />
Weimar) stattfinden solle. In diesem würdigen Rahmen<br />
solle die Kuhn-Ehrenmedaille an Dr. rer. nat. Hanns-Georg<br />
Schöneich (Bild) verliehen werden. Die Mitgliederversammlung<br />
beschloss weiterhin die Stiftung der fkks-Ehrennadel.<br />
16 04-05 / 2013
RECHT VERANSTALTUNGEN & REGELWERK NACHRICHTEN<br />
FACHBERICHT<br />
MESSEN UND TAGUNGEN<br />
FKKS WORKSHOP 2013<br />
Der diesjährige fkks workshop am 30 Januar<br />
zum Thema „Zustands-Überwachung<br />
und -bewertung von erdverlegten Rohrleitungen<br />
aus Stahl“ richtete sich an Assetmanager,<br />
Rohrnetz- und Korrosionsschutzfachleute<br />
und technische Führungskräfte aus<br />
Versorgungsunternehmen.<br />
Das Konzept der Zustandsüberwachung und<br />
-bewertung basiert auf einer regelmäßigen<br />
Erfassung des Anlagenzustands durch Messung<br />
und Analyse aussagefähiger physikalischer<br />
Größen, wie elektrische Spannungen<br />
und Ströme. Die Herausforderungen dieses<br />
Konzeptes - was muss wann, wo, wie und<br />
womit überwacht werden - vermag bei erdverlegten<br />
Rohrleitungen der kathodische Korrosionsschutz<br />
(KKS) zu lösen. Die Vorteile sind<br />
keineswegs nur für Netze zugänglich, die mit<br />
dieser Technologie über Jahrzehnte gewachsen<br />
sind. In den meisten Fällen ist die nachträgliche<br />
Einrichtung des KKS für erdverlegte<br />
Bauteile technisch sinnvoll und wirtschaftlich<br />
zu realisieren.<br />
Auf Basis der messwertbasierten Zustandsbewertung<br />
durch die Messmethoden des<br />
KKS werden nur solche Anlagenteile rehabilitiert,<br />
die tatsächlich einer Rehabilitation<br />
bedürfen. Nutzungsdauerreserven können<br />
optimal ausgeschöpft werden, ein Vorteil der<br />
gerade heute im Zuge des durch die Netzregulierung<br />
zunehmenden Kostendrucks von<br />
größter Bedeutung ist.<br />
Ca. 60 Fachleute aus dem deutschsprachigen<br />
Raum verfolgten die Vorträge der Workshop-<br />
Leiter Dipl.-Phys. Rainer Deiss (RBSwave GmbH,<br />
EnBW Regional AG), Hans Gaugler (SWM Services<br />
GmbH), Dipl.-Ing. Thomas Laier (RWE<br />
Westfalen-Weser-Ems Netzservice GmbH)<br />
und Dipl.-Ing. Hans-Willy Theilmeier-Aldehoff<br />
(Open Grid Europe GmbH). Anhand von Beispielen<br />
wurden die Möglichkeiten zur Umsetzung<br />
solcher Zustandsüberwachungen und<br />
-bewertungen diskutiert und Erfahrungen bei<br />
der Anwendung ausgetauscht.<br />
KONTAKT: Fachverband Kathodischer Korrosionsschutz e.V.,<br />
Esslingen am Neckar,<br />
Tel. +49 711 919927-20,<br />
E-Mail: geschaeftsstelle@fkks.de,<br />
www.fkks.de<br />
Wiesbadener Kunststoffrohrtage<br />
18./19.04.2013 TÜV SÜD, Viktoria Wolter, Tel. 089/5791-2410,<br />
E-Mail: congress@tuev-sued.de<br />
WASSER BERLIN INTERNATIONAL<br />
23.-26.04.2013 Messe Berlin GmbH, Tel. 030/3038-0,<br />
Fax 030/3038-2325, E-Mail: central@messe-berlin.de,<br />
www.wasser-berlin.de<br />
NoDig-Berlin 2013<br />
23.-26.04.2013 GSTT e.V., Tel. 030/3038-0,<br />
Fax 030/3038-2325, E-Mail: info@gstt.de, www.gstt.de<br />
Jahreskongress CEOCOR<br />
05./06.06.2013 in Florenz, Italien; O.I.C. srl,<br />
Tel. +39.055.50.351,<br />
Fax +39.055.57.02.27,<br />
E-Mail: infoCEOCOR2013@oic.it, www.oic.it<br />
8. Forum Industriearmaturen<br />
16.05.2013 Vulkan-Verlag GmbH, Barbara Pflamm,<br />
Tel. 0201/82002-28, Fax 0201-82002-40,<br />
E-Mail: b.pflamm@vulkan-verlag.de,<br />
www.forum-industriearmaturen.de<br />
7. Praxistag Korrosionsschutz<br />
19.06.2013 Vulkan-Verlag GmbH, Barbara Pflamm,<br />
Tel. 0201/82002-28, Fax 0201-82002-40,<br />
E-Mail: b.pflamm@vulkan-verlag.de,<br />
www.praxistag-korrosionsschutz.de<br />
5. Europäische Rohrleitungstage 2013<br />
26./27.06.2013 in St. Veit an der Glan, Österreich; MTA Messtechnik<br />
GmbH, Tel: +43/ 4212/71491, Fax: +43/4212/72298,<br />
E-Mail: office@mta-messtechnik.at,<br />
www.mta-messtechnik.at<br />
Würzburger Kunststoffrohrtagung<br />
26./27.06.2013 mit Fachausstellung; rbv GmbH, Kurt Rhode,<br />
Tel. 0221/37668-20, Fax 0221/37668-62,<br />
E-Mail: rhode@brbv.de, www.brbv.de<br />
GAT 2013 & WAT 2013<br />
30.09. in Nürnberg; Dipl.-Ing. Rainer Jockenhöfer,<br />
-02.10.2013 Tel. 0228/9188-611, Fax 0228/9188-990,<br />
E-Mail: jockenhoefer@dvgw.de, www.dvgw.de<br />
K2013<br />
16.-23.10.2013 in Düsseldorf; Messe Düsseldorf GmbH,<br />
Tel. 0211/4560-01, Fax 0211/4560-668,<br />
E-Mail: info@messe-duesseldorf.de,<br />
www.messe-duesseldorf.de<br />
ROHRBAU Weimar<br />
18./19.11.2013 in Düsseldorf; Messe Düsseldorf GmbH,<br />
Tel. 0211/4560-01, Fax 0211/4560-668,<br />
E-Mail: info@messe-duesseldorf.de,<br />
www.messe-duesseldorf.de<br />
Tagung <strong>Rohrleitungsbau</strong><br />
21./22.01.2014 in Berlin; rbv GmbH, Gabriele Borkes,<br />
Tel. 0221/37668-46, Fax 0221/37668-63,<br />
E-Mail: borkes@rbv-gmbh.de, www.brbv.de<br />
04-05 / 2013 17
FACHBERICHT NACHRICHTEN RECHT VERANSTALTUNGEN<br />
& REGELWERK<br />
20. Tagung <strong>Rohrleitungsbau</strong> in Berlin<br />
Fotos: <strong>Rohrleitungsbau</strong>verband<br />
rbv-Präsidentin Dipl.-Volksw. Gudrun Lohr-Kapfer und<br />
rbv-Ehrenpräsident Dipl.-Ing. Klaus Küsel, der die Berliner<br />
Veranstaltung moderierte<br />
Viele Mitglieder des rbv folgten der Einladung nach Berlin,<br />
um mit Fachleuten der Branche über die Auswirkungen der<br />
Energiewende in Deutschland zu diskutieren<br />
„Energieinfrastruktur im Wandel“ lautete das Motto der<br />
20. Tagung <strong>Rohrleitungsbau</strong>, die von der Präsidentin des<br />
<strong>Rohrleitungsbau</strong>verbandes e. V. (rbv), Dipl.-Volksw. Gudrun<br />
Lohr-Kapfer (Bild 1) eröffnet wurde. Deutschland hat sich<br />
für eine grundlegende Veränderung seiner Energieinfrastruktur<br />
entschieden. Über den Ist-Zustand und über das,<br />
was in Zukunft sinnvoll und realisierbar scheint, haben rbv<br />
und der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V.<br />
(HDB) mit ihren Mitgliedern unter der Moderation von rbv-<br />
Ehrenpräsident Dipl.-Ing. Klaus Küsel (Bild 1) am 22. und<br />
23. Januar in Berlin diskutiert.<br />
Das Jahr 2 nach dem Start der Energiewende ist vorüber<br />
und die Branche stellt ernüchtert fest, dass die Herausforderungen<br />
viel größer und komplexer sind, als erwartet.<br />
Gesetze, Pläne und Zeithorizonte werden erlassen, aufgezeigt,<br />
verändert und neu geschrieben. Allerdings krankt<br />
die Umsetzung der gigantischen Aufgabe, die sich in die<br />
vier Arbeitsfelder Erzeugung, Verteilung, Speicherung und<br />
Verbrauch gliedert, nach Meinung von RA Michael Knipper,<br />
Hauptgeschäftsführer des HDB, vor allem daran, dass<br />
Deutschland bei der Erzeugung dem Sollplan um Jahre<br />
voraus ist, in allen anderen Bereichen wie z. B. dem Netzausbau,<br />
aber deutlich hinterherhinkt.<br />
Antworten auf die Frage, wie es mit der Energiewende<br />
weitergeht, versuchte Stefan Kapferer, Bundesministerium<br />
für Wirtschaft und Technologie, in seinem Vortrag zu<br />
geben. Für Dipl.-Kffr. Hildegard Müller, BDEW Bundesverband<br />
der Energie- und Wasserwirtschaft e. V., gibt<br />
es den allgemeingültigen Masterplan nicht. „Zentrale<br />
vs. dezentrale Energieversorgung – gegenläufige Trends<br />
oder gemeinsame Perspektive?“ lautete der Titel ihres<br />
Beitrages, in dem sie feststellte, dass beide Varianten für<br />
die Zukunft von Bedeutung sind.<br />
Dipl.-Ing. Heinrich Busch, Vorstandsmitglied beim DVGW<br />
Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., vertrat<br />
die Meinung, dass die Gasnetze nicht unbedingt noch<br />
intelligenter werden, sondern die vorhandenen Ressourcen<br />
an Technik und Netz im Zuge der Energiewende<br />
zunächst ausgeschöpft und genutzt werden müssten.<br />
Den Brückenschlag von der Forschung zur Praxis vollzog<br />
Dipl.-Ing. Gerrit Brunken, Geschäftsführer nPlan engineering<br />
GmbH, Celle, mit seinem Referat über „Biogas und<br />
Power to Gas – Chancen für den Leitungsbau?“.<br />
Komplettiert wurde das Programm durch Vorträge zu<br />
Themen, wie z. B. „Schiefergas in Deutschland“, „Fördermöglichkeiten<br />
des Netzausbaus durch das KWKG“,<br />
„Breitbandausbau – Markteinstieg für Leitungsbauunternehmen“<br />
und „Work-Life-Balance – Bewältigung<br />
zukünftiger Anforderungen in Beruf und Familie“ weiterer<br />
renommierter Referenten.<br />
In Ihrem Fazit richtete die rbv-Präsidentin den Blick nach<br />
vorn. „Die Energiewende kann nur gelingen, wenn alle<br />
beteiligten Akteure bereit und in der Lage sind, für das<br />
Gesamtsystem Verantwortung zu übernehmen“, erklärte<br />
Gudrun Lohr-Kapfer, für die vor allem Versorgungssicherheit<br />
als hohes Gut angesehen werden sollte. Deshalb ist<br />
es wichtig, dort, wo es vordringlich ist, die Verteilnetze<br />
auszubauen. Für die Leitungsbauer wird es von größter<br />
Wichtigkeit sein, wie schnell und in welchem Maße sich<br />
Netzentwicklungs- bzw. Bundesbedarfsplan entwickeln<br />
und realisiert werden, damit sie ihre Kapazitäten darauf<br />
abstimmen können. Dies gilt insbesondere für ihre<br />
weitere strategische Ausrichtung, der Investitions- und<br />
Personalplanung sowie der Aus- und Weiterbildung.<br />
18 04-05 / 2013
RECHT VERANSTALTUNGEN & REGELWERK NACHRICHTEN<br />
FACHBERICHT<br />
FACHAUSSTELLUNG<br />
F A C H V O R T R Ä G E<br />
PRAKTISCHE VORFÜHRUNGEN<br />
5. EUROPÄISCHE<br />
ROHRLEITUNGSTAGE<br />
St. Veit an der Glan AUSTRIA<br />
26. - 27. 06. 2013<br />
5th EUROPEAN PIPELINE DAYS<br />
TRADE EXHIBITION<br />
PRESENTATIONS<br />
PRACTICAL DEMONSTRATION<br />
EPC Partner / Veranstalter<br />
www.europeanpipelinecenter.eu<br />
04-05 / 2013 19
FACHBERICHT NACHRICHTEN RECHT VERBÄNDE & REGELWERK<br />
RSV mit neuem Vorstand<br />
(v.l.n.r.) Dipl.-Ing. Christian Waitz, Dipl.-Ing. Frederik Lipskoch<br />
und Wolfram Kopp<br />
Die Mitglieder des RSV - Rohrleitungssanierungsverband e.V.<br />
haben abgestimmt: Am 6. Februar 2013 wurde auf der Mitgliederversammlung<br />
in Oldenburg Dipl.-Ing. Christian Waitz<br />
zum Vorstandsvorsitzenden gewählt und Wolfram Kopp und<br />
Dipl.-Ing. Frederik Lipskoch zu seinen Stellvertretern.<br />
In einer ersten Stellungnahme bekennt sich der neue Vorstand<br />
zu den Zielen des Verbandes: Vor allem in Hinblick<br />
auf die Qualitätssicherung und die Förderung des Einsatzes<br />
von modernen und ausgereiften Sanierungsverfahren will<br />
man an einem Strang ziehen – sowohl im Druckrohr- als<br />
auch im Freispiegelbereich.<br />
Für Waitz, Kopp und Lipskoch stellt die Bestandserhaltung<br />
der Infrastruktureinrichtungen eine der größten und wichtigsten<br />
Zukunftsaufgaben der Kommunen bzw. Netzbetreiber<br />
dar. Eine wichtige Aufgabe wird sein, die Grundstücksentwässerung<br />
mit der entsprechenden Zertifizierung<br />
„DIN-geprüfter Fachbetrieb“ weiter zu etablieren. Die neue,<br />
erstmals 2012 in der Öffentlichkeit vorgestellte Zertifizierung<br />
schafft mit dem DIN-Zertifikat für alle Fachbetriebe<br />
der Sanierung von Grundstücksentwässerungsanlagen ein<br />
einheitliches, nachvollziehbares und dem Stand der Technik<br />
entsprechendes Qualitätsniveau.<br />
Darüber hinaus will sich der RSV in Zukunft verstärkt in<br />
Zusammenarbeit mit anderen Verbänden in das Thema<br />
„Schulung und Ausbildung“ einbringen.<br />
8. Erfahrungsaustausch der Auftraggeber und -nehmer<br />
in Baden-Württemberg<br />
Am 29. Januar 2013 fand in Stuttgart der 8. Erfahrungsaustausch<br />
der Fachkollegen aus Entwässerungsbetrieben, Ingenieurbüros<br />
sowie Bauunternehmen mit RAL-Gütezeichen<br />
Kanalbau statt. Bei der Veranstaltung lag der Fokus auf<br />
dem Austausch zur Qualität bei „Herstellung und Instandhaltung<br />
von Abwasserleitungen und -kanälen“. Maßnahmen<br />
zur fachgerechten Bauausführung und Fehlervermeidung<br />
standen im Mittelpunkt der Berichte der vom RAL-Güteausschuss<br />
beauftragten Prüfingenieure.<br />
Qualität und Funktion von Abwasserleitungen und -kanälen<br />
werden bestimmt durch die Bauausführung auf Grundlage<br />
einer fachgerechten Ausschreibung und Bauüberwachung.<br />
Ausführende Unternehmen belegen ihre Qualifikation mit<br />
einem Gütezeichen zu einer oder mehreren Beurteilungsgruppen<br />
in den Bereichen Offener Kanalbau (AK3, AK2,<br />
AK1), Vortrieb (VP, VM, VMD, VO, VOD), Sanierung (S), Inspektion<br />
(I), Reinigung (R) und Dichtheitsprüfung (D). Firmen,<br />
die diesen Nachweis führen, erfüllen die von Auftraggebern,<br />
Ingenieurbüros und Auftragnehmern gemeinsam definierten<br />
Anforderungen an die Bieter-Qualifikation „RAL-GZ 961“.<br />
Das Ziel, die Qualität zu verbessern, verfolgt die Gütegemeinschaft<br />
neben der Gütesicherung durch technische<br />
Information und Förderung des Austausches zwischen den<br />
Beteiligten, etwa mit der Organisation von Veranstaltungen<br />
wie dieser. Insbesondere haben die Veranstaltungen den<br />
Anspruch, die Diskussion zwischen Auftraggebern, Planern<br />
und Auftraggebern zum Thema Qualität und Qualifikation<br />
in Gang zu halten. Gleichzeitig werden die Mitglieder<br />
der Gütegemeinschaft über die Aktivitäten der Gütegemeinschaft<br />
informiert und Anregungen der Beteiligten<br />
zur Gütesicherung und zur Arbeit der Gütegemeinschaft<br />
gesammelt – eine Vorgehensweise, von der alle gleichermaßen<br />
profitieren.<br />
Im Auftrag der Mitglieder – zu denen derzeit u. a. fast 800<br />
Auftraggeber und Ingenieurbüros gehören – wirbt die Gütegemeinschaft<br />
dafür, dass bei der Vergabe die Bieter-Qualifikation<br />
berücksichtigt wird und so Grundlagen für Qualität<br />
und fairen Wettbewerb geschaffen werden. Was für die<br />
Ausführung zum Standard gehört, sollte auch auf Seiten<br />
der Ausschreibung und Bauüberwachung selbstverständlich<br />
sein – auch hierüber wurde in Stuttgart gesprochen. Es ist<br />
anspruchsvolle Aufgabe der Planer, dafür Sorge zu tragen,<br />
das geeignete Verfahren vor Ort nach den Regeln der Technik<br />
eingesetzt werden. Zur Realisierung einer technisch<br />
und wirtschaftlich erfolgreichen Maßnahme ist deshalb<br />
auch bei der Vergabe von Leistungen der Ausschreibung<br />
und Bauüberwachung die diesbezügliche Erfahrung und<br />
Fachkunde zu berücksichtigen. Deshalb ist es konsequent,<br />
20 04-05 / 2013
RECHT & REGELWERK VERBÄNDE NACHRICHTEN<br />
FACHBERICHT<br />
dass auch ausschreibende und bauüberwachende Stellen<br />
ihre Qualifikation nachweisen – eine sinnvolle Sache nach<br />
Meinung der Vielzahl der Teilnehmer.<br />
Folgerichtig hat der Güteausschuss der Gütegemeinschaft<br />
Kanalbau – als zentrales Organ zur Verwirklichung des Gütesicherungsgedankens<br />
– auf Initiative der Mitgliederversammlung<br />
sukzessive Gütezeichen für die fachtechnische Eignung<br />
von Organisationen geschaffen, die mit der Ausschreibung<br />
Referenten im Haus der Wirtschaft: Dr.-Ing. Marco Künster<br />
-(Geschäftsführer Güteschutz Kanalbau), Dipl.-Ing. Andreas Keck und Dipl.-<br />
Ing. Dieter Walter (vom RAL-Güteausschuss beauftragte Prüfingenieure).<br />
und Bauüberwachung von Maßnahmen beauftragt sind. Konsequent<br />
wurde die Ingenieurleistung im Bereich Ausschreibung<br />
(A) und Bauüberwachung (B) im offenen Kanalbau (AK),<br />
bei grabenlosem Einbau (V) und der grabenlosen Sanierung<br />
(S) von Abwasserleitungen und -kanälen als Beurteilungsgruppen<br />
ABAK, ABV und ABS in die Güte- und Prüfbestimmungen<br />
aufgenommen. Auftraggeber und Ingenieurbüros dokumentieren<br />
damit Erfahrung und Zuverlässigkeit der Organisation<br />
und des eingesetzten Personals.<br />
Weitere Informationen enthält die Broschüre „Gütegesicherte<br />
Ausschreibung und Bauüberwachung“. Diese Broschüre<br />
haben die Teilnehmer des Erfahrungsaustauschs zusammen<br />
mit den Broschüren „Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ<br />
961“, „Technische Regeln im Kanalbau“ sowie Beispielen zu<br />
den „Leitfäden für die Eigenüberwachung“ erhalten. Die<br />
Leitfäden der Gütegemeinschaft dienen den Anwendern als<br />
Hilfsmittel zur Dokumentation der Eigenüberwachung im<br />
Rahmen der „Ausschreibung und Bauüberwachung“ oder für<br />
Maßnahmen des offenen Kanalbaus, Vortriebs, Inspektion,<br />
Reinigung oder Dichtheitsprüfung. Diese Leitfäden wurden<br />
im Bereich der Ausschreibung und Bauüberwachung von<br />
der Gütegemeinschaft gemeinsam mit Vertretern der Ingenieurbüros<br />
erarbeitet und den Anwendern helfen diese, alle<br />
relevanten Randbedingungen einer Maßnahme systematisch<br />
zu berücksichtigen. Die Leitfäden stehen zum kostenlosen<br />
Download unter www.kanalbau.com zur Verfügung.<br />
Weitere Erfahrungsaustausche sind in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern,<br />
Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-<br />
Holstein und Hamburg sowie in Rheinland-Pfalz und im Saarland<br />
geplant.<br />
04-05 / 2013 21
FACHBERICHT NACHRICHTEN RECHT VERBÄNDE & REGELWERK<br />
The world’s leading trade event<br />
for process, drinking and waste water<br />
EXHIBITION 5 - 8 NOVEMBER<br />
AMSTERDAM • NL<br />
2013<br />
Treffen Sie in 4 Tagen<br />
über 21.500 Experten aus<br />
der Wasserwirtschaft<br />
Buchen Sie Ihren Stand noch heute!<br />
Anmeldungen auf www.amsterdam.aquatechtrade.com<br />
Organised by<br />
Supported by<br />
Part of<br />
22 04-05 / 2013
RECHT & REGELWERK VERBÄNDE NACHRICHTEN<br />
FACHBERICHT<br />
Aktuelles aus dem IKT Institut für unterirdische<br />
Infrastruktur<br />
Aktuelle Projekte<br />
In zahlreichen anwendungsorientierten Vorhaben arbeitet<br />
das Institut für Unterirdische Infrastruktur (IKT) an <strong>aktuell</strong>en<br />
Fragestellungen der unterirdischen Infrastruktur – im Sinne<br />
nachhaltig leistungsfähiger Leitungsnetze.<br />
Unter der Leitung des IKT werden in 2013 folgende Projekte<br />
bearbeitet:<br />
»»<br />
Entwicklung eines Prüfverfahrens zur Standsicherheitsbewertung<br />
von Kanal-Großprofilen im Bestand<br />
für ökologisch sinnvolle Kanalsanierungsstrategien<br />
»»<br />
Kommunale Öffentlichkeitsarbeit zu privaten Abwasseranlagen:<br />
Kommunikationskonzepte zur Öffentlichkeitsarbeit<br />
und Untersuchungen zur Schadensbewertung<br />
und Sanierungsberatung (Projektphase II)<br />
»»<br />
Entwicklungsunterstützende Untersuchungen zur<br />
„Infiltrationsdichtheit“ bei Werkstoffwechseln bzw.<br />
Übergängen, Phase II: Vergleichende Untersuchungen<br />
an Werkstoffwechseln und Übergängen<br />
»»<br />
Kanalabdichtungen – Auswirkungen auf die Reinigungsleistung<br />
der Kläranlagen und der Einfluss auf<br />
den örtlichen Wasserhaushalt<br />
»»<br />
Siebanlagen und Rechen an Mischwasserentlastungen<br />
»»<br />
Vergleichende Untersuchung von innovativen Inspektionssystemen<br />
für Grundstücksentwässerungsnetze<br />
und Handlungsempfehlungen zur Vorbereitung der<br />
Inspektion (Phase I: Zustandserfassung, Prüfprogramm<br />
und Handlungsempfehlungen)<br />
»»<br />
Umweltsicherer Kanalbau durch wurzelfeste Bettung<br />
der Rohre – Teil II: Anlage von Rehabilitationszonen<br />
an den verpflanzten Großbäumen mit unterirdischer<br />
Versuchsanlage (Wurzelgräben) am Standort<br />
Osnabrück<br />
Darüber hinaus ist das IKT <strong>aktuell</strong> auch an folgenden Kooperationsvorhaben<br />
beteiligt:<br />
»»<br />
Identifikation von Möglichkeiten und Grenzen<br />
des Einsatzes grabenloser Verlegetechniken im<br />
Fernwärmeleitungsbau<br />
»»<br />
Überwachung und Optimierung der Leistungsfähigkeit<br />
der Mischwasserbehandlung<br />
Einblick ins Labor: Materialprüfer Sebastiaan Luimes zeigt die Linerprüfungen,<br />
die am neuen Standort des IKT in Arnheim durchgeführt werden<br />
LinerReport: Hohe Linerqualität,<br />
Verbesserungsbedarf bei Wanddicke<br />
Zum neunten Mal in Folge präsentierte das IKT im Februar<br />
2013 mit dem LinerReport 2012 eine Jahresübersicht der<br />
Schlauchlinerqualitäten. Auch im vergangenen Jahr wurden<br />
zahlreichen Baustellenproben geprüft. Der LinerReport<br />
stellt deren Ergebnisse in einer Gesamtübersicht zusammen.<br />
Berücksichtigt werden die Ergebnisse derjenigen Sanierungsfirmen,<br />
von denen das IKT mindestens 25 Linerproben<br />
von fünf verschiedenen Baustellen geprüft hat. Diese<br />
Anforderung erfüllen 19 Unternehmen. Drei Sanierungsunternehmen<br />
waren ausschließlich in den Niederlanden tätig,<br />
eines arbeitete in der Schweiz.<br />
Untersucht wurden die Kennwerte E-Modul, Biegefestigkeit,<br />
Wanddicke und Wasserdichtheit der Schlauchliner-Proben<br />
von Baustellen. Die Ist-Werte werden mit den Soll-Werten<br />
aus den DIBt-Zulassungen resp. mit eventuell abweichenden<br />
Soll-Vorgaben des Auftraggebers verglichen. Die Soll-Werte<br />
für die Wanddicken werden anhand statischer Berechnungen<br />
festgelegt oder vom Auftraggeber vorgegeben.<br />
Die Prüfergebnisse der IKT-Prüfstelle für Schlauchliner im<br />
Jahr 2012 zeigen, dass die Qualität von Schlauchlinern insgesamt<br />
auf einem hohen Niveau liegt. Verglichen zum Vorjahr<br />
treten jedoch bei zwei der vier Prüfkriterien leicht schwächere<br />
Ergebnisse auf. Auftraggeber sollten dem Prüfkriterium<br />
Wanddicke gesonderte Aufmerksamkeit zuwenden. Den<br />
Sanierungsfirmen ist eine Ursachenforschung zu empfehlen.<br />
Sollte nämlich die Wanddicke des Liners in der Haltung zu<br />
gering sein, so können Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit<br />
des Liners beeinträchtigt werden.<br />
Der LinerReport 2012 steht online auf www.ikt.de zum<br />
Download bereit.<br />
Niederlassung in den Niederlanden<br />
Zudem hat das IKT kürzlich eine Zweigstelle im niederländischen<br />
Arnheim gegründet. IKT-Geschäftsführer Roland<br />
W. Waniek und Niederlassungsleiter Peter Brink eröffneten<br />
feierlich das neue IKT Nederland mit dem ersten Prüflabor<br />
für Schlauchliner in den Niederlanden.<br />
Im Fokus für das laufende Geschäftsjahr stehen u. a. die<br />
Akkreditierung und der Ausbau des ersten Prüflabors für<br />
Schlauchliner in den Niederlanden, sagte Peter Brink, Lei-<br />
04-05 / 2013 23
FACHBERICHT NACHRICHTEN RECHT VERBÄNDE & REGELWERK<br />
ter des IKT Nederland. Darüber<br />
hinaus soll ein intensiver Dialog<br />
mit den niederländischen und<br />
flämischen Gemeinden und mit<br />
der NSTT, dem niederländischen<br />
Gegenstück der GSTT (German<br />
Society for Trenchless Technology),<br />
aufgebaut werden. Auch<br />
ein attraktives Schulungsangebot<br />
soll das IKT Nederland demnächst<br />
anbieten können.<br />
Stefan Kötters, stellvertretender<br />
Leiter des IKT Nederland und<br />
stellvertretender Prüfstellenleiter<br />
Bild 1: Feierliche Eröffnung:<br />
im IKT in Gelsenkirchen, erläuterte<br />
das Dienstleistungsangebot<br />
Niederlassungsleiter Peter Brink<br />
erläutert, was man vom IKT Nederland am neuen Standort. Dazu gehört<br />
erwarten kann<br />
sowohl die Prüfung von Schlauchlinern<br />
auf Elastizität, Biegefestigkeit<br />
und Wasserdichtheit als auch die statische Berechnung von<br />
Schlauchlinern – neutral und unabhängig.<br />
PD Dr.-Ing. Bert Bosseler, Wissenschaftlicher Leiter des IKT in<br />
Gelsenkirchen, rief in seinem Vortrag bei der Eröffnung die<br />
europäischen Kanalnetzbetreiber zur grenzüberschreitenden<br />
Zusammenarbeit auf. Die Problemlagen ähneln sich häufig –<br />
mit hohen Grundwasserständen beispielsweise hätten Netzbetreiber<br />
in NRW genauso zu kämpfen wie in den Niederlanden<br />
und Belgien. Das IKT habe sich mit der neuen Niederlassung<br />
in Arnheim auf die Fahnen geschrieben, einen konstruktiven<br />
Erfahrungsaustausch über Ländergrenzen hinweg zu fördern.<br />
Auch hiervon können Netzbetreiber nur profitieren.<br />
Erik Laurentzen, Senior Rrioolbeheerder bei der Gemeinde<br />
Arnheim, berichtete vom Praxiseinsatz des in der Weiterentwicklung<br />
befindlichen MAC-Verfahrens in einem historischen<br />
Kanalabschnitt in Arnheims Untergrund. Mit diesem<br />
System kann die Standfestigkeit von Großprofilen anhand<br />
minimaler Verformungen des Kanals beurteilt werden. Auf<br />
der Grundlage der Messergebnisse lassen sich ökologisch<br />
und ökonomisch sinnvolle Kanalsanierungsstrategien erarbeitet.<br />
Das IKT entwickelt gegenwärtig das MAC-Verfahren<br />
technisch weiter, um eine effizientere halbautomatische<br />
Messung zu ermöglichen. Weitere Einsätze in Europa sind<br />
noch in diesem Jahr geplant.<br />
KONTAKT: IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur gemeinnützige<br />
gGmbH, Gelsenkirchen, www.ikt.de, www.ikt-nederland.nl<br />
Güteschutz Grundstücksentwässerung:<br />
Mit definierten Schritten auf guten Wegen<br />
Mitte Januar trafen sich unter der Leitung ihres Vorstandsvorsitzenden<br />
Karl-Heinz Flick die Mitglieder der „Gütegemeinschaft<br />
Herstellung, baulicher Unterhalt, Sanierung und<br />
Prüfung von Grundstücksentwässerungen e.V. – Güteschutz<br />
Grundstücksentwässerung“ zu ihrer diesjährigen Jahreshauptversammlung<br />
in Fulda.<br />
Flick stellte in seinem Bericht mit Rückblick auf 2012 fest,<br />
dass seit der Gründung der Gütegemeinschaft alle wichtigen<br />
organisatorischen Dinge und Gremien nun fest installiert<br />
seien und sich aufgrund der verstärkten Öffentlichkeitsarbeit<br />
auf verschiedenen Ebenen der Bekanntheitsgrad des<br />
neuen Gütezeichens RAL-GZ 968 erhöht hat. Dies gelte,<br />
so Flick, für verbandsübergreifende Erklärungen bis hin zu<br />
Entwürfen des Landeswassergesetzes im NRW-Landtag<br />
und v. a. überall dort, wo man sich fachtechnisch mit der<br />
Grundstücksentwässerung auseinandersetze. Neue Unterstützung<br />
erfahre man nun auch durch den Fachbeirat, der<br />
im Dezember 2012 getagt habe.<br />
Selbstverständlich stand auch das Thema Dichtheitsprüfung<br />
wieder auf der Agenda des Vorstandsberichts: Großer<br />
Handlungsbedarf besteht nach wie vor in Hinblick darauf,<br />
wie auch zuletzt der LANUV-Fachbericht 43 gezeigt hat,<br />
dass unser Grundwasser durch undichte Kanäle gefährdet<br />
ist. Auch die Veröffentlichungen in Fachzeitschriften machen<br />
immer wieder die Notwendigkeit zum Schutz von Boden<br />
und Grundwasser deutlich.<br />
Das System RAL-GZ 968 etablieren<br />
Für dieses Jahr hat die Gütegemeinschaft eine Kampagne<br />
geplant, mit der gezielt die Kommunen angesprochen werden<br />
sollen. Das hierfür überarbeitete DWA-M 190 „Eignung<br />
von Unternehmen für Herstellung, baulichen Unterhalt,<br />
Sanierung und Prüfung von Grundstücksentwässerungen“<br />
soll dabei als Arbeitshilfe dienen. Außerdem sollen die gütegesicherten<br />
Arbeiten als System RAL-GZ 968 vorgeschrieben<br />
werden. Flick richtete den Appell an die Kommunen,<br />
Inspektion und Sanierung voneinander getrennt zu behandeln.<br />
Es sei sinnvoll, nach der Inspektion den Ist-Zustand<br />
zu bewerten und eine mögliche Sanierung federführend zu<br />
begleiten. Mit dieser Vorgehensweise schiebe man unseriösen<br />
„Dienstleistern“ einen Riegel vor.<br />
Zum Abschluss seines Berichts gab er seinem Bedauern<br />
Ausdruck, dass die Hervorhebung positiver Beispiele in der<br />
Branche doch recht mager ausfalle. Mit Blick auf den vorangegangenen<br />
Gastvortrag von Dipl.-Ing. Joachim Adams, der das<br />
gelungene und umgesetzte Konzept des Abwasserverbandes<br />
Fulda vorstellte, sei auch einmal ein erfreuliches Beispiel für<br />
Auftraggeber gegeben, das ganzheitliches Denken zeige.<br />
24 04-05 / 2013
RECHT & REGELWERK VERBÄNDE NACHRICHTEN<br />
FACHBERICHT<br />
Foto: Güteschutz Grundstücksentwässerung e.V.<br />
Mitgliederversammlung der Gütegemeinschaft<br />
Grundstücksentwässerung Januar 2013 in Fulda<br />
Abschließend unterstrich Flick noch einmal ausdrücklich die<br />
bundesweite Tätigkeit des Güteschutzes und forderte die Mitgliedsverbände<br />
auf, weiterhin durch ihr Netzwerk „Landesverbände“<br />
die Ziele der Gütegemeinschaft mit zu unterstützen.<br />
Die Pflöcke sind eingeschlagen<br />
Den Bericht des Güteausschusses übernahm in Vertretung<br />
für den Obmann Karsten Selleng sein Stellvertreter Hans-<br />
Christian Möser. Aus den Sitzungen und Tagungen des<br />
vergangenen Jahres hatte er folgendes zu berichten:<br />
»»<br />
Gezielte Anforderungsprofile für Arbeiten an Grundstücksentwässerungsanlagen<br />
wurden definiert und in sogenannten<br />
„Checklisten“ durch die Prüfer bei den Firmen abgefragt.<br />
So wird auch bei der Erstprüfung ein besonderes<br />
Augenmerk auf Referenz-Objekte der Fachbetriebe gelegt.<br />
»»<br />
Einrichtung eines Login-Bereichs zur Daten-Erfassung<br />
der neuen Firmen zur Vorbereitung auf die folgende<br />
Prüftätigkeit bis hin zur Erstellung eines einheitlichen<br />
Prüfberichtes der Prüforganisationen.<br />
»»<br />
Änderungen und Ergänzungen zu den Güte- und Prüfbestimmungen.<br />
Schwerpunkt: neue Beurteilungsgruppe<br />
„Sanierung, S-GE“.<br />
»»<br />
Fortschreibung des DWA-M 190 als Leitfaden für satzungsgebende<br />
Stellen (Kommunen), da gütegesicherte Arbeiten<br />
an GEA‘s in Abwassersatzungen verankert werden müssen.<br />
Möser beendete seinen Bericht mit einem nochmaligen<br />
Hinweis auf den neuen Ausführungsbereich „S-GE“. Bereits<br />
aus vorhandenen Ausführungsbereichen, wie z.B. „ESP-<br />
ASG“, muss der Bereich Sanierung abgegrenzt werden. Er<br />
begründet diese Notwendigkeit damit, dass viele Firmen in<br />
der Praxis entweder nur den Einbau und die Prüfung oder<br />
nur die Sanierung vornehmen.<br />
Geschäftsführer Dirk Bellinghausen gab im Anschluss an den<br />
Bericht des Güteausschusses einen Überblick über die Aktivitäten<br />
und Geschehnisse des abgelaufenen Jahres. So war<br />
die Gütegemeinschaft auf fünf größeren Messen mit einem<br />
Stand vertreten und nutzte 12 Vortragsveranstaltungen zur<br />
kontinuierlichen Bekanntmachung des Gütezeichens. Der<br />
<strong>aktuell</strong>e Mitgliederstand ist: fünf Verbände, 43 Fachbetriebe,<br />
ein Fördermitglied und 90 Gütezeicheninhaber. Unabhängig<br />
von der landesgesetzlichen Situation in NRW und Hessen wird<br />
im Vergleich zu Januar 2012 eine Steigerung der Gütezeichenvergaben<br />
registriert: Die Anzahl der Fachbetriebe mit Gütezeichen<br />
ist auf bundesweit 139 Unternehmen gewachsen.<br />
Bellinghausen fügt abschließend seinem Bericht hinzu,<br />
dass die Pressearbeit dieses Jahr stark ausgebaut wird. Die<br />
Erwähnung RAL-GZ 968 in der DIN 1986-30 und u. a. in der<br />
bayerischen Musterentwässerungssatzung müssen werblich<br />
verbreitet werden. Ebenso ist die Gütegemeinschaft aufgefordert,<br />
selbst für positive Signale in der Branche zu sorgen.<br />
Beraten und beschlossen: „Sanierung S-GE“<br />
Hans-Christian Möser umriss anschließend den Stand der<br />
Beratungen zur Sanierungsgruppe S-GE, wobei er einleitend<br />
die Notwendigkeit eines eigenen Ausführungsbereiches<br />
Sanierung auf dem Grundstück klar betonte. „Eine Abgrenzung<br />
zu RAL-GZ 961 erfolgt über die in den Abwassersatzungen<br />
geregelten Grundstücksgrenzen sowie über die<br />
Nennweitenbeschränkung bis DN 250“, so Möser. Er wies<br />
auch noch einmal darauf hin, dass die Sanierung bereits in<br />
mehreren Ausführungsbereichen enthalten sei (z. B. ESP-<br />
ASG); das „S“ müsse hier entfernt und in einem gesonderten<br />
Bereich erfasst werden.<br />
Der Ausführungsbereich S-GE kann auf Antrag von Gütezeicheninhabern<br />
RAL-GZ 961 mit der Beurteilungsgruppe<br />
S gestellt werden. Über die Einzelheiten der Zulassung und<br />
Prüfung von „S-GE“ bzw. DIBt-Zulassungen für das Sanierungsverfahren<br />
werde der Güteausschuss beraten.<br />
Die neue Beurteilungsgruppe S-GE rundet nun das Bild<br />
„gütegesicherte Arbeiten an Grundstückentwässerungsanlagen“<br />
ab und öffnet neue Möglichkeiten, weitere Unternehmen<br />
für den Güteschutz zu gewinnen. Auch ist so eine<br />
Abgrenzung zu unseriösen Dienstleistern, den so genannten<br />
Kanalhaien, möglich.<br />
Nach den Ausführungen Mösers wird folgender Beschluss<br />
gefasst: Die Güte- und Prüfbestimmungen werden um<br />
den Ausführungsbereich S-GE und die Anforderungen an<br />
die Beurteilungsgruppe S-GE ergänzt. Die Annahme des<br />
Beschlusses erfolgte einstimmig.<br />
Wahl des Fachbeirats<br />
Auf der zweiten Mitgliederversammlung 2012 wurden die<br />
Kandidaten für die Wahl in den Fachbeirat bereits benannt<br />
und gewählt. Karl-Heinz Flick stellte noch ergänzend Dipl.-<br />
Ing. Frank Diederich als Vorsitzenden des VuSD, Verband der<br />
unabhängigen Sachkundigen für Dichtheitsprüfungen von<br />
Abwasseranlagen, vor, der als 15. Mitglied des Fachbeirats<br />
zur Wahl gestellt wurde. Die Mitgliederversammlung wählte<br />
Diederich einstimmig in den Fachbeirat.<br />
Dr. Dipl.-Ing. Bernhard Fischer wurde bereits 2012 als<br />
Obmann vorgeschlagen, eine Wahl fand aber nicht statt, da<br />
die personelle Besetzung noch nicht abgeschlossen war. Dr.<br />
Fischer wurde ebenfalls einstimmig zum Obmann des Fachbeirates<br />
Güteschutz Grundstücksentwässerung gewählt.<br />
Nach Verabschiedung des Jahresabschlusses 2012, der Entlastung<br />
des Vorstandes sowie weiterer notwendiger Formalia,<br />
wurden Termin und Ort der nächsten Mitgliederversammlung<br />
festgelegt: Dienstag, 8. Oktober 2013, in Bonn.<br />
04-05 / 2013 25
FACHBERICHT KURZ INFORMIERT RECHT WASSER & REGELWERK BERLIN<br />
Treffpunkt Berlin:<br />
„Mehr Wasser geht nicht“<br />
Vom 23. bis zum 26. April 2013 lädt die WASSER BERLIN INTERNATIONAL in die deutsche Hauptstadt zum diesjährigen<br />
Branchentreff der Wasserwirtschaft ein. Mit dem neuen strategischen 360°-Ansatz bildet die Messe wie kaum eine andere<br />
Veranstaltung die gesamte Wertschöpfungskette der Wasserwirtschaft ab. Entsprechend breit ist das Themenspektrum. Es<br />
reicht von der Trinkwassergewinnung und Wasserversorgung über den <strong>Rohrleitungsbau</strong> bis zur Abwasserentsorgung und<br />
-Abwasseraufbereitung. Besondere Beachtung finden dabei die einzelnen Komponenten sowie IT-Lösungen, die zur Steuerung<br />
moderner Anlagen immer wichtiger werden. Darüber hinaus wurden die Segmente der klassischen Wasserwirtschaft erstmals<br />
um die besonderen Anforderungen wasserintensiver Gewerbe- und Industriebetriebe ergänzt. Mit Blick auf die Fachbesucher<br />
setzt WASSER BERLIN INTERNATIONAL in diesem Jahr auf eine stärkere Systematisierung der Fachmesse mit fließenden<br />
Übergängen in thematisch verwandte Bereiche. So sind beispielweise als Teil dieses neuen Konzeptes Rohrleitungen, Pumpen<br />
und Aufbereitungssysteme in unmittelbarer räumlicher Nähe zueinander zu finden.<br />
NEUE KOMPETENZ-ZENTREN<br />
„Wir haben bei der Vorbreitung von WASSER BERLIN INTER-<br />
NATIONAL besonders den Mehrwert für die Fachbesucher<br />
im Auge gehabt.“, erläutert die verantwortliche Projektleiterin<br />
Cornelia Wolff von der Sahl. „Eine der Maßnahmen ist<br />
die Einführung von sechs Kompetenz-Zentren, die Aussteller<br />
und Fachbesucher themenspezifisch zusammenführen und<br />
die Schlüsselthemen der Messe hervorheben.“ Im Einzelnen<br />
handelt es sich dabei um das Kompetenz-Zentrum „Bildung<br />
und Forschung“ (Halle 3.2), auf dem der Austausch über<br />
wissenschaftliche Erkenntnisse und neue technologische<br />
Entwicklungen im Mittelpunkt steht. Das Kompetenz-Zentrum<br />
„Industriewasser“ (Halle 3.2) zeigt die Bedeutung von<br />
Wasser in den Prozessabläufen der verschiedenen Branchen<br />
und beschreibt neue, zukunftsträchtige Geschäftsfelder.<br />
Im Kompetenz-Zentrum „Innovation“ (Halle 2.2) berichten<br />
junge aufstrebende Unternehmen über ihre neuesten Entwicklungen.<br />
Große IT-Unternehmen und Dienstleister treffen<br />
sich im Kompetenz-Zentrum „IT in der Wasserwirtschaft“<br />
(Halle 4.2), um Perspektiven in Anwendungsgebieten wie<br />
dem Messwesen oder der elektronischen Datenverarbeitung<br />
zu diskutieren. Im Kompetenz-Zentrum „Brunnenbau<br />
und Bohrtechnik“ (Halle 4.2) geht es um Innovationen im<br />
Bereich der Wassergewinnung bis hin zur Geothermie. Um<br />
Weiterentwicklungen im Leitungsbau, die vom konventionellen<br />
Leitungsbau über das grabenlose Bauen bis zum<br />
Mikrotunnelbau und zur Kanalsanierung reichen geht es im<br />
Kompetenz-Zentrum „Leitungsbau“ (Halle 1.2).<br />
26 04-05 / 2013
RECHT WASSER & REGELWERK BERLIN KURZ FACHBERICHT<br />
INFORMIERT<br />
KOMPETENZ-ZENTRUM<br />
LEITUNGSBAU<br />
Wie in den Vorjahren ist der <strong>Rohrleitungsbau</strong>verband<br />
e. V. (rbv) mit großem Engagement<br />
dabei: Gemeinsam mit weiteren<br />
führenden Verbänden aus der Leitungsbaubranche<br />
– hierzu zählen der Energieeffizienzverband<br />
für Wärme, Kälte<br />
und KWK e. V. (AGFW), der Verband<br />
Güteschutz Horizontalbohrungen e. V.<br />
(DCA), die Gütegemeinschaft Leitungstiefbau<br />
e. V. (GLT), die German Society<br />
for Trenchless Technology e. V. (GSTT)<br />
und der Rohrleitungssanierungsverband<br />
e. V. (RSV) – wird der <strong>Rohrleitungsbau</strong>verband<br />
die gebündelte Fachkompetenz<br />
im Kompetenz-Zentrum Leitungsbau präsentieren.<br />
Mit dabei sind 20 Mitgliedsunternehmen<br />
der Verbände auf dem<br />
dazugehörigen Gemeinschaftsstand.<br />
„Messeauftritte wie der in Berlin dienen<br />
vor allem dazu, neue Kontakte in<br />
der Branche zu knüpfen und die Verbandsarbeit<br />
einem breiten Fachpublikum<br />
näher zu bringen“, erklärt rbv-Geschäftsführer Dipl.-<br />
Wirtsch-Ing. Dieter Hesselmann. „Darüber hinaus zeigen wir<br />
Flagge, um die Interessen unserer Mitgliedsunternehmen zu<br />
vertreten.“ Das wird von den Leitungsbauern unterstützt;<br />
alle ziehen spartenübergreifend an einem Strang. Im Rahmen<br />
der Messe hat der rbv vielfältige Aktionen geplant:<br />
Unter anderem zählt der sogenannte „Pipe Brunch“ hierzu,<br />
der in diesem Jahr am dritten Messetag stattfindet. Ebenso<br />
erwähnenswert sind der „Karrieretag“ am 26. April, an dem<br />
Schüler und Studierende von weiterführenden Schulen und<br />
Hochschulen Gelegenheit haben, sich mit den Personalverantwortlichen<br />
der teilnehmenden Unternehmen auszutauschen,<br />
sowie das 8. Internationale Leitungsbausymposium<br />
(ILBS), das am 24. April stattfindet. Das Symposium ist eine<br />
gemeinsame Veranstaltung der Berliner Wasserbetriebe, der<br />
NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG,<br />
der Vattenfall Europe AG & Co. KG, des Bauindustrieverbandes<br />
Berlin/ Brandenburg, der German Society for Trenchless<br />
Technology e. V., des <strong>Rohrleitungsbau</strong>verbandes und der<br />
DVGW-Landesgruppe Berlin/Brandenburg.<br />
UMFANGREICHES KONGRESSPROGRAMM<br />
Begleitet wird die Fachmesse von einem umfangreichen<br />
Fachkongress. Unter dem Titel „Innovative Konzepte,<br />
Maßnahmen und Technologien einer zukunftsweisenden<br />
Wasserwirtschaft“ wird er vom Verein Wasser Berlin e.V.<br />
organisiert. Dabei dreht sich in vier Diskussionsforen alles<br />
um den Kreislauf des Wassers. Hinzu kommt ein breites<br />
Programm an Foren und Symposien. So findet am 24. April<br />
das 8. Internationale Leitungsbausymposium statt. Als führende<br />
Veranstaltung ihrer Art behandelt sie in diesem Jahr<br />
die Themen „Netzmanagement und Instandhaltung“ sowie<br />
„Herausforderungen an Netze im Zuge der Energiewende“.<br />
Bild 2: Die führenden Verbände aus der Leitungsbaubranche und Mitgliedsunternehmen<br />
bündeln auf der WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2013 ihre Kräfte<br />
auf einem Gemeinschaftsstand. (Foto: rbv)<br />
Baustellenpraxis live<br />
Der Bezug zur Praxis wird einen Tag später, am 25. April,<br />
auf der Schaustelle WASSER BERLIN INTERNATIONAL hergestellt.<br />
Diese Veranstaltung - in der Fachwelt bislang bekannt<br />
als „Baustellentag“ - stellt <strong>Rohrleitungsbau</strong>verfahren sowie<br />
Verfahren der Trinkwasserversorgung und Abwasserreinigung<br />
vor. Die Teilnehmer erleben vor Ort, wie moderne<br />
und innovative Verfahren und Bauvorhaben in der Praxis<br />
umgesetzt werden. Dazu zählen beispielsweise die grabenlose<br />
Erneuerung und die Neuverlegung von Wasser-,<br />
Abwasser-, Fernwärme- und Gasleitungen sowie Verfahren<br />
für die weitergehende Abwasserreinigung. Eine Übersicht<br />
der Baustellen wird auf den folgenden Seiten gegeben.<br />
Grabenlose Technologien im Fokus<br />
Mit innovativen Bauverfahren befasst sich auch die erste NO<br />
DIG BERLIN. Sie besteht aus einem Kongress mit Ausstellung<br />
und informiert über die Anwendung grabenloser Technologien.<br />
Nachdem es 2011 gelungen war, die INTERNATIONAL<br />
NO DIG nach Berlin zu holen, wird die Fachveranstaltung<br />
unter dem Titel NO DIG BERLIN in einem neuen Format als<br />
Bestandteil der WASSER BERLIN INTERNATIONAL fortgesetzt.<br />
Das grabenlose Bauen steht seit über 30 Jahren für<br />
eine umweltschonende und wirtschaftliche Alternative bei<br />
der Installation und Sanierung von unterirdischen Ver- und<br />
Entsorgungsleitungen aller Art.<br />
Brunnenbausymposium<br />
Ein weiteres Highlight ist das vom DVGW und der figawa<br />
durchgeführte Brunnenbausymposium. Es ist der Treffpunkt<br />
für die Fachleute dieser Branche, um neueste Entwicklungen<br />
zu diskutieren – beispielsweise Anwendungen in der<br />
Geothermie oder Bohrungen mithilfe von Fracking.<br />
04-05 / 2013 27
FACHBERICHT KURZ INFORMIERT RECHT WASSER & REGELWERK BERLIN<br />
Regenwasserbewirtschaftung: Stormwater<br />
Management<br />
Ein Symposium zum nachhaltigen Umgang mit Regenwasser<br />
veranstalten der Beuth-Verlag in Kooperation mit dem BWK<br />
und der Fachzeitschrift gwf-Wasser/Abwasser am 25. und<br />
26. April. In dem umfangreichen Vortragsprogramm wird<br />
über die <strong>aktuell</strong>e Gesetzeslage, den Stand der Forschung<br />
und über in- und ausländische Projekte berichtet.<br />
Berlin<br />
NewYork<br />
London<br />
STARKE INTERNATIONALITÄT<br />
Wie stark der internationale Charakter von WASSER BER-<br />
LIN INTERNATIONAL ist, zeigt sich nicht nur an der hohen<br />
Zahl von Ausstellern und Fachbesuchern aus dem Ausland,<br />
sondern auch an den Veranstaltungen, die während<br />
der Wasserfachmesse stattfinden. In diesem Jahr liegt ein<br />
besonderer Akzent auf den Ländern der arabischen Region.<br />
Der Anlass: ACWUA, der Verband arabischer Wasserunternehmen<br />
aus 17 Ländern mit Sitz im Amman, ist offizieller<br />
Hallenübersicht Partner der Veranstaltung. Im Rahmen der Zusammenarbeit<br />
gibt es ein Arabisches Forum, das sich mit der Wasserwirtschaft<br />
in der Region befasst und eine interessante<br />
WASSER BERLIN Diskussionsplattform INTERNATIONAL zu brand<strong>aktuell</strong>en Themen im Nahen<br />
23. - 26. April Osten 2013 bietet. Darüber hinaus können täglich kostenlos die<br />
Internationalen Länderforen in den Hallen der Fachmesse<br />
besucht werden. Von der Deutschen Vereinigung für<br />
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., kurz DWA, in<br />
Kooperation mit German Water Partnership veranstaltet,<br />
dreht sich hier alles, ganz im Sinne des neuen Konzepts, um<br />
ausgesuchte internationale Wassermärkte, deren Probleme<br />
und das Aufzeigen von Lösungsansätzen.<br />
PLATTFORM FÜR DEN ERFAHRUNGSAUSTAUSCH<br />
Insgesamt werden in Berlin 30.000 Fachbesucher aus aller<br />
Welt erwartet, die sich bei rund 600 Ausstellen auf über<br />
40.000 Quadratmetern Hallenfläche über neueste Entwicklungen<br />
und Trends informieren. Aktuelle Wasserthemen wie<br />
Klimawandel, Bevölkerungswachstum, demographischer<br />
Wandel und Energieeffizienz gewinnen immer mehr an<br />
Bedeutung. Um die damit verbunden Herausforderungen<br />
zu bewältigen, sind der grenzüberschreitende Erfahrungsaustausch<br />
und der Einsatz modernster Technologien eine<br />
wesentliche Voraussetzung. Für beides bietet WASSER BER-<br />
LIN INTERNATIONAL eine ideale Plattform.<br />
Messe Berlin<br />
WASSER BERLIN<br />
INTERNATIONAL 2013<br />
Casino<br />
Paris<br />
NACHWUCHSFÖRDERUNG<br />
Gut ausgebildete Nachwuchskräfte sind in der Wasserwirtschaft<br />
sehr gefragt. Daher hat WASSER BERLIN INTER-<br />
NATIONAL das „Young Water Professionals Programme“<br />
zum festen Bestandteil der Veranstaltung<br />
gemacht. Als Austausch- und<br />
Bildungsprogramm richtet es sich an<br />
Nachwuchsingenieure, Wissenschaftler<br />
und Studenten aus dem In- und<br />
Ausland. Dabei haben die Teilnehmer<br />
die Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen<br />
und sich über eine eigens eingerichtete<br />
Stellenbörse über Jobangebote<br />
zu informieren. Außerdem findet am<br />
26. April ein Karrieretag statt, an dem<br />
sich Firmen präsentieren und Karrieremöglichkeiten<br />
in ihren Unternehmen<br />
vorstellen. Neu: Die Young Water Professionell<br />
Conference am 26. April im<br />
Internationalen Forum, Halle 3.2.<br />
Fertigstellung Ende 2013<br />
Eingang Süd<br />
KONTAKT: www.wasser-berlin.de<br />
<strong>Rohrleitungsbau</strong>, Kompetenz-Zentrum Leitungsbau<br />
NO DIG BERLIN<br />
Wasserver- & -entsorgung, Wasseraufbereitung<br />
Verbände, Kompetenz-Zentrum Innovation<br />
Rohre (Kunststoff, Guss, Steinzeug, Stahl, Beton)<br />
Verbände, Internationales Forum<br />
Kompetenz-Zentrum Bildung & Forschung<br />
Kompetenz-Zentrum Industriewasser<br />
Armaturen, Brunnenbau, Pumpen, Geothermie, Verbände<br />
Kompetenz-Zentrum Brunnenbau und Bohrtechnik<br />
Mess-, Regel- und Analysetechnik<br />
Kompetenz-Zentrum IT in der Wasserwirtschaft<br />
Stand: 24.01.2013<br />
Änderungen vorbehalten<br />
WASsERLEBEN Publikumsausstellung<br />
Kongress und Fachsymposien<br />
Fachbesucherregistrierung<br />
Kongressregistrierung<br />
Freigelände<br />
Messeleitung, Presse<br />
Young Water Professionals Lounge<br />
Offizieller Partner ACWUA<br />
(Arab Countries Water Utilities<br />
Association)<br />
WASSER BERLIN INTERNATIONAL<br />
auf einen Blick<br />
Termin: 23.-26. April 2013<br />
Öffnungszeiten:<br />
9.00 - 18.00 Uhr (Di – Do)<br />
9.00 - 17.00 Uhr (Fr)<br />
Kontakt:<br />
Messe Berlin GmbH<br />
Tel. +49 30 3038 2085<br />
www.wasser-berlin.de<br />
Nächster Termin: 24. - 27. März 2015<br />
Messe 28 Berlin GmbH · Messedamm 22 ·14055 Berlin · Germany<br />
04-05 / 2013<br />
Telefon + 49(0)30 / 3038-2148 · Fax +49(0)30 / 3038-2079<br />
www.wasser-berlin.de · wasser@messe-berlin.de
RECHT WASSER & REGELWERK BERLIN KURZ FACHBERICHT<br />
INFORMIERT<br />
Schaustelle Wasser Berlin International<br />
Am 25. April 2013 findet der erfolgreiche Baustellentag<br />
Schaustelle Wasser Berlin International statt. Der in der Fachwelt<br />
bekannte Baustellentag wurde um Verfahren der Trinkwasserund<br />
Abwasserreinigung erweitert. Deshalb wird aus dem<br />
Baustellentag die Schaustelle Wasser Berlin International.<br />
Die Teilnehmer erleben, wie moderne Verfahren und<br />
Bauvorhaben in der Praxis umgesetzt werden. Dazu<br />
zählen beispielsweise die grabenlose Erneuerung und<br />
die Neuverlegung von Wasser-, Abwasser-, Fernheiz- und<br />
Gasleitungen sowie Verfahren für die weitergehende<br />
Abwasserreinigung und sichere Trinkwasserversorgung.<br />
An zahlreichen Berliner Baustellen werden unterschiedliche<br />
Verfahren auf verschiedenen Bustouren vorgestellt.<br />
Regenüberlaufkanal, <strong>Rohrleitungsbau</strong> für Gas sowie<br />
Baulogistik für den Neubau einer U-Bahn.<br />
Tour 3: Sondertour Großflughafen BER<br />
Wassermanagement für den neuen Großflughafen BER,<br />
Entwässerungssysteme und Abwasserreinigung für<br />
Regenwasser und Schmutzwasser.<br />
Tour 4: Sondertour Klärwerk Schönerlinde<br />
Energieautarkes Großklärwerk dank innovativer<br />
umweltfreundlicher Maßnahmen wie Verstromung<br />
des Klärgases im Blockheiz kraftwerk und mit einer<br />
Mikrogasturbine sowie Einsatz von Windrädern.<br />
Mehr Informationen<br />
zur Schaustelle<br />
auf der Internetseite<br />
der Berliner<br />
Wasserbetriebe<br />
TOURANGEBOTE<br />
Tour 1: Anlagenbau<br />
Moderne und komplexe Verfahren und Anlagen für die Berliner<br />
Infrastruktur, z.B. Leitsystem für die Abwasserentsorgung<br />
und Anlagensteuerung sowie Innovationen für eine sichere<br />
Trinkwasserversorgung und Abwasserreinigung.<br />
Tour 2: <strong>Rohrleitungsbau</strong><br />
Innovative und umweltschonende <strong>Rohrleitungsbau</strong>verfahren,<br />
z.B. Neubau eines Stauraumkanals, Vortrieb für einen<br />
Die Schaustelle Wasser Berlin International wird maßgeblich durch die<br />
Berliner Wasserbetriebe gestaltet und umfasst auch Baustellen der NBB<br />
Netzgesellschaft Berlin/Brandenburg, Vattenfall Europe und der Berliner<br />
Verkehrsbetriebe (BVG).<br />
Die Teilnahme beträgt 80,- € pro Person.<br />
Das Gruppenticket ab 10 Personen kostet 50,- € pro Person.<br />
Die Touren werden ganztägig von 9:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr, inkl.<br />
Mittagsimbiss, durchgeführt<br />
Weitere Informationen über www.wasser-berlin.de „Kongresse & Events“.<br />
04-05 / 2013 29
FACHBERICHT PRODUKTE & VERFAHREN RECHT & REGELWERK WASSER BERLIN<br />
SebaKMT<br />
Automatisierte Geräuschpegelüberwachung und<br />
Vorortung von Leckagen in Trinkwassernetzen<br />
Automatisierte Überwachungssysteme werden allgemein<br />
als der Pfad zu einer modernen Trinkwasserversorgung<br />
angesehen. Dabei liegen die Hauptaufgaben eines Überwachungssystems<br />
nicht nur in einer Zeitersparnis, sondern auch<br />
in der Vermeidung unnötiger Kosten und dem effizienten<br />
Einsatz wertvoller Ressourcen.<br />
Eine der letzten großen Neuerungen im Bereich der Netzüberwachung<br />
bieten so genannte Geräuschpegellogger-<br />
Netzwerke (Logger-Netzwerke). Diese ersetzen das zeitaufwändige<br />
Patrouillieren der Logger durch einen selbstständigen<br />
Datentransfer in die Leitstelle. Neben der effizienten<br />
Datenübertragung bieten Logger-Netzwerke den Komfort,<br />
neue Leckagen nahezu ohne Zeitverlust zu identifizieren und<br />
vorhandene Leckagen einzugrenzen und zu lokalisieren.<br />
Somit bieten diese Netzwerke eine Möglichkeit Wasserverluste<br />
in dem Versorgungsnetz in dem sie installiert sind<br />
dauerhaft und nachhaltig zu senken.<br />
Logger-Netzwerke bestehen in der Regel aus einer größeren<br />
Anzahl Geräuschpegellogger, die per Kurzstreckenfunk mit<br />
einer Netzwerk-Zentrale verbunden sind. Diese Zentrale<br />
übermittelt die in der Nacht aufgezeichneten Messwerte<br />
(Geräuschpegel und Frequenz), täglich per GSM/GPRS zu<br />
einem FTP-Server. Von dort kann der Anwender die Daten<br />
analysieren, protokollieren und benutzen, um die nächsten<br />
Schritte zur Leckageortung einzuleiten. Auf diese Weise<br />
Bild 1: Darstellung einer Korrelation mit interaktiver Leitung<br />
bieten Logger-Netzwerke einen täglichen „Fingerabdruck“<br />
der Geräuschpegel im gesamten Versorgungsnetz.<br />
Obwohl diese täglich <strong>aktuell</strong>e Übersicht über den Netzzustand<br />
bereits recht eindrucksvoll das Potenzial eines Logger-<br />
Netzwerks darstellt, ist die neueste Generation dieser Systeme<br />
nicht mehr „nur“ auf die Übertragung der nächtlichen<br />
Daten von Geräuschpegel und Frequenz beschränkt. Sie<br />
bieten vielmehr die Möglichkeit anhand der vorhandenen<br />
Messdaten eine gezielte Vorortung mittels einer Korrelation<br />
vorzunehmen. Im Ergebnis muss eine Leckage vor Ort<br />
lediglich mit einer Punktortung bestätigt werden, was eine<br />
deutliche Verkürzung des Zeitaufwandes für eine Leckageortung<br />
darstellt.<br />
Möglich wird das, indem der Anwender sich echte Geräusche,<br />
die während der Messung aufgezeichnet wurden<br />
übermitteln lässt. Dank einer genauen Synchronisation<br />
dieser Daten, stehen sie dem Nutzer nicht einfach nur zum<br />
Anhören zur Verfügung, sondern lassen sich untereiander<br />
korrelieren, um eine exakte Lokalisierung einer Leckage<br />
vorzunehmen. Diese Form der Korrelation, die aus technischer<br />
Sicht eine „Offline-Korrelation“ darstellt (nachträgliche<br />
Korrelation), wird im allgemeinen Sprachgebrauch auch<br />
„Netzwerk-Korrelation“ genannt.<br />
Bemerkenswerterweise sind diese Korrelationen nicht nur<br />
vergleichbar mit der Genauigkeit eines Feld- oder Laptop-<br />
Korrelators, sondern<br />
in gewissen Situationen<br />
sogar noch<br />
genauer. Die Gründe<br />
dafür liegen in einigen<br />
der Vorteile, die<br />
bei herkömmlichen<br />
Feldgeräten wegen<br />
des erhöhten Aufwands<br />
entweder selten<br />
genutzt werden<br />
oder schilichtweg<br />
nicht gegeben sind.<br />
Einer der größten<br />
Vorteile eines<br />
Logger-Netzwerks<br />
besteht ohne Zweifel<br />
in der automatisierten<br />
und effizienten<br />
Übertragung der<br />
Messdaten, die ein<br />
manuelles Vororten<br />
nicht mehr notwendig<br />
macht. Allerdings<br />
30 04-05 / 2013
WASSER RECHT BERLIN & REGELWERK PRODUKTE & FACHBERICHT VERFAHREN<br />
stellt die Messzeit der Logger ebenfalls einen der deutlichsten<br />
Vorzüge dar. Die Geräuschpegellogger messen<br />
allgemein in der Nacht zu einer Zeit in der Wasserverbrauch<br />
und Umweltgeräusche ihr Tagesminimum erreichen. Auf<br />
diese Weise sind die Geräuschdaten, die zu einer Korrelation<br />
herangezogen werden, nahezu frei von störenden Umgebungsgeräuschen.<br />
Zwar wird auch mit Feldkorrelatoren<br />
nachts gemessen, wenn störende Einflüsse eine akkurate<br />
Messung bei Tag verhindern, allerdings bedeutet dies immer<br />
einen erhöhten Aufwand an Ressourcen.<br />
Ein weiterer Vorteil der Netzwerk-Korrelation liegt in der<br />
großen Anzahl der Messstellen, die für eine Vorortung<br />
herangezogen werden können. Während mit einem Feldkorrelator<br />
Schallaufnehmer und Sender umgesetzt werden<br />
müssen um etwa eine erste Korrelation zu bestätigen, wird<br />
in einem Netzwerk einfach ein weiterer Logger in die Analyse<br />
mit eingebunden.<br />
Die Vorteile eines Logger-Netzwerkes auf einen Blick:<br />
»»<br />
Tages<strong>aktuell</strong>e Ansicht des Netzzustandes<br />
»»<br />
Erkennen von Leckagen und deren Position ohne<br />
Zeitverlust<br />
»»<br />
Zeitersparnis durch wegfallendes Patrouillieren der<br />
Logger<br />
»»<br />
Dauerhafte Reduzierung der Wasserverluste<br />
»»<br />
Kosteneffiziente Datenübertragung<br />
»»<br />
Hochgenaue Vorortung durch Korrelation aufgezeichneter<br />
Geräusche<br />
Logger-Netzwerke mit integrierter Korrelationsfunktion<br />
zeichnen sich typischerweise durch ein äußerst benutzerfreundliches<br />
Softwarepaket aus, das selbst von Neulingen<br />
schnell erlernt und verwendet werden kann. Neben<br />
historischen Daten und Diagnosefunktionen stehen dem<br />
Anwender auch interaktive Karten des gesamten Netzwerkes<br />
zur Verfügung, die eine Einbindung von auf GPSbasierenden<br />
Netzwerkplänen (aus Auto-CAD oder GIS-<br />
Systemen) ermöglichen.<br />
Alles in Allem bieten automatisierte Überwachungssysteme<br />
wie ein „korrelierendes Logger-Netzwerk“ eine<br />
nie dagewesene Möglichkeit ein Versorgungsnetz dauerhaft<br />
zu überwachen und dafür zu sorgen, Wasserverluste<br />
nachhaltig zu reduzieren. Dass diese Systeme schon<br />
heute verfügbar sind und erfolgreich eingesetzt werden<br />
zeigt, dass diese moderne Technologie in einer zukunftsorientierten<br />
Wasserversorgung nicht mehr fehlen darf.<br />
KONTAKT:<br />
Halle 6.2, Stand 219<br />
SebaKMT, Baunach, Tel. +49 9544 68-0, E-Mail: sales@sebakmt.com,<br />
www.sebakmt.com<br />
4 pipes<br />
Flexible Abschlussmanschetten<br />
Bei Verlegung von Rohrleitungen z.B. unter Straßen oder<br />
Bahngleisen werden häufig aus Sicherheitsgründen Medienrohre<br />
in Schutzrohren verlegt. Hierbei ermöglichen Gleitkufen<br />
einen komfortablen Rohreinzug und die elastomeren<br />
Abschlussmanschetten ermöglichen die drucklose Abdichtung<br />
des Schutzrohres. Firma 4 pipes liefert sowohl Kunststoff-<br />
oder Stahlgleitkufen als auch Abschlussmanschetten<br />
in geschlossener Ausführung bei Neuverlegung oder geteilter<br />
Ausführung für nachträgliche Montage.<br />
Für die renommierten und hochwertigen Gleitkufen System<br />
raci hat 4 pipes die Vertretung in Deutschland. Kunststoffgleitkufenringe<br />
mit Kugelkopfstegen in schraubloser<br />
Steckverbindung sind besonders schnell montierbar, und<br />
die Flexibilität der Kufe ermöglicht extreme Biegungen. Die<br />
Raci-Gleitkufen sind hochbelastbar, aus hochwertigem Polyethylen<br />
hergestellt und ohne Verbindungsteile aus Metall.<br />
Die neuen AWM-Abschlussmanschetten ergänzen das<br />
Produktprogramm. Durch die besondere Wellenform ist<br />
diese Manschette besonders platzsparend bei der Lagerung<br />
und extrem flexibel einsetzbar bei großen Unterschieden<br />
zwischen Medien- und Schutzrohr. Auch extreme Exzentrizitäten<br />
lassen sich nun leicht ausgleichen. Nur vier Größen<br />
der AWM Manschette decken den großen Bereich von DN<br />
250 bis DN 800 ab. Die Endmanschette<br />
Typ AWM wird<br />
mit zwei Edelstahlspannbändern<br />
ausgeliefert. Die<br />
Spannbänder sind individuell<br />
anpassbar für den jeweils<br />
größt- und auch kleinstmöglichen<br />
Rohrdurchmesser. Für<br />
Schutzrohrgrößen DN 100<br />
bis DN 200 ist die bewährte<br />
AKT-Abschlussmanschette<br />
in konischer Form lieferbar.<br />
Mit den Gleitkufen (aus<br />
Kunststoff oder Stahl)<br />
und den Abschlussmanschetten (einfach, mehrfach,<br />
konisch, geteilt) liefert 4 pipes komplette und kompetente<br />
Lösungen für Standard Rohrkombinationen und für<br />
Sonderanwendungen.<br />
KONTAKT:<br />
Halle 4.2, Stand 312<br />
4 pipes GmbH, Nürnberg, Tel. +49 911 81006-0, E-Mail: info@4pipes.de<br />
04-05 / 2013 31
FACHBERICHT PRODUKTE & VERFAHREN RECHT & REGELWERK WASSER BERLIN<br />
AUMA Riester GmbH & Co. KG<br />
Neuer Schwenkantrieb<br />
AUMA präsentiert den neuen Schwenkantrieb SQ .2<br />
AUMA präsentiert auf der Fachmesse Wasser Berlin den<br />
neuen Schwenkantrieb SQ .2 zur Automatisierung von Klappen<br />
und Hähnen. Die Antriebe sind ab dem zweiten Quartal<br />
2013 lieferbar und ersetzen die Vorgängerbaureihe SG .1.<br />
Gegenüber dem Vorgänger wird beim SQ .2 eine zusätzliche<br />
Baugröße eingeführt. Dadurch erweitert sich der Drehmomentbereich<br />
um mehr als das Doppelte, der nun von 50 Nm<br />
bis 2.400 Nm reicht. Mit der neuen Baureihe lassen sich<br />
auch kürzere Stellzeiten erzielen. Die Version SQR für Regelbetrieb<br />
verfügt über bessere Regeleigenschaften als der<br />
Vorgänger SGR. Dies betrifft die Positioniergenauigkeit und<br />
die höhere zulässige Anzahl von Schaltspielen pro Stunde.<br />
Inbetriebnahme und Bedienung der SQ .2 Antriebe sind mit<br />
der 2010 eingeführten Drehantriebsbaureihe SA .2 identisch.<br />
Für das Personal vor Ort vereinfacht sich der Umgang,<br />
wenn in einer Anlage beide Antriebstypen eingebaut sind.<br />
Dazu gehört auch das identische Steuerungskonzept. Beide<br />
Baureihen sind mit den integrierten Steuerungen AM und<br />
AC lieferbar.<br />
Als weitere Schwerpunkte zeigt AUMA auf der Wasser Berlin<br />
Stellantriebslösungen für den Trinkwasser- und Abwasserbereich<br />
sowie Verbesserungen im Korrosionsschutz durch<br />
eine Zweischicht-Pulverbeschichtung.<br />
Halle 4.2, Stand 304<br />
KONTAKT: AUMA Riester GmbH & Co. KG, Müllheim, Heike Schmeding,<br />
Tel +49 7631 809-1545, E-Mail: heike.schmeding@auma.com<br />
Dalminex GmbH<br />
Mechanisches Räderzeigerwerk mit<br />
elektrischer Stellungsanzeige<br />
Dalminex produziert seit 1993 Einbaugarnituren für den Erdund<br />
Schachteinbau. Für einige Anwendungsfälle ist es erforderlich,<br />
diese Spindelverlängerungen mit einem Positionsanzeiger<br />
auszurüsten, damit die Schließposition der Armatur<br />
oben am Bedienvierkant für den Anwender ersichtlich<br />
wird. Dalminex hat für viele dieser Anwendungsfälle<br />
spezielle Lösungen entwickelt, z. B.<br />
ein Zeigerwerk für die Verlängerungen der<br />
PE-Kugelhähne, die eine zulässige maximale<br />
Umdrehung von 90° anzeigen.<br />
Das klassische, in vielen Einsätzen seit<br />
1994 bewährte Zeigerwerk besteht aus<br />
einem Getriebe in einem wasserdichten<br />
Aluminium-Druckguss-Gehäuse. Es ist in<br />
der Grundausführung mit folgenden maximalen<br />
Umdrehungen (360°) erhältlich: 13, 47,<br />
140, 470 und 1.390 U/Hub. Er funktioniert rein mechanisch,<br />
d.h. der Endanwender hat die Möglichkeit, die vorgegebene<br />
maximale Drehzahl der Armatur mittels der Stecker (rot,<br />
grün) selbst am Zeigerwerk einzustellen.<br />
Dieses Zeigerwerk, das aufgrund seiner Ausstattung und<br />
Konstruktion sehr betriebssicher ist, wurde nun als Basis<br />
für eine neue elektrische Variante genommen. Ziel dieser<br />
Ausführung ist die Weiterleitung des Stellungssignals an<br />
eine elektrische Schnittstelle. Anwendungsfälle gibt es auf<br />
Flughäfen, in Stadien oder abgelegenen Gebäuden. Hiermit<br />
können die Signale von einer zentralen Leitstelle erfasst und<br />
verwertet werden.<br />
Das Zeigerwerk in der mechanischen Grundausführung<br />
wird werkseitig durch Druckschalter und Kabelanschlüsse<br />
ergänzt. Das Zeigerwerk und alle Schalter sind wasserdicht<br />
gemäß IP67 gemäß DIN 40050. Es ist wartungsfrei in einem<br />
Temperaturbereich von - 40° bis +85 ° C und passend für<br />
eine Straßenkappe DIN 4056 Gr. 2. Wie alle Zeigerwerke<br />
von Dalminex sollte es vorzugsweise mit der Dalminex-<br />
Tragplatte eingebaut werden, um eine sichere und verdrehungsfreie<br />
Lagerung zu gewährleisten.<br />
Halle 4.2, Stand 201<br />
KONTAKT: DALMINEX GmbH, Schloss Holte-Stukenbrock, www.dalminex.de<br />
32 04-05 / 2013
WASSER RECHT BERLIN & REGELWERK PRODUKTE & FACHBERICHT VERFAHREN<br />
Allied Associates Geophysical Ltd. / GeoHiRes International GmbH<br />
Verbesserte Leitungsortung mit neuem Georadar<br />
Das neu in den USA entwickelte UtilityScan DF von GSSI<br />
bringt frischen Wind für die Leitungsortung. Das auf der<br />
Georadar-Technik basierende neue Ortungsgerät setzt neue<br />
Maßstäbe der Leistungsfähigkeit und Ergonomie in diesem<br />
Bereich. Die Ortung auch nicht-metallischer Leitungen wie<br />
z. B. PE-Rohre lässt sich aufgrund der intuitiven und übersichtlichen<br />
Bedieneroberfläche innerhalb kürzester Zeit erlernen.<br />
Zwei gleichzeitig betriebene digitale Antennen von 800<br />
MHz und 300 MHz sorgen für optimale Auflösung in jedem<br />
Tiefenbereich bis zu 5 m und sehr hohe Datenqualität.<br />
Beim robusten Design des 4-Rad Messwagens wurde bei<br />
GSSI auf folgende Kriterien besonders Wert gelegt:<br />
»»<br />
Der Robuste 4-Rad-Messwagen mit GPS-Stativ-Halterung<br />
erfüllt IP65-Standard. D.h., das Messgerät ist<br />
wetterfest und wasserdicht.<br />
»»<br />
Die exakte Distanzmessung wird durch einen auf die<br />
Achse montierten Distanz-Encoder erreicht.<br />
»»<br />
Das Messgerät ist einfach zu montieren und zu<br />
transportieren.<br />
»»<br />
Eine GPS-Stativhalterung erlaubt die Integration von<br />
GPS-Antennen<br />
Schnelle Ergebnisse Vorort werden von jedem geschätzt,<br />
der täglich unter den verschiedensten Einsatzbedingungen<br />
Leitungen ortet. Deshalb wurden gleich mehrere nützliche<br />
Hilfsmittel in das neue Messgerät integriert. Dank eines<br />
neuen zum Patent angemeldeten Verfahrens ist es dem<br />
Bediener erstmals möglich, im „Blend Mode“ das Ortungsergebnis<br />
beider Antennen gleichzeitig in einem gemeinsamen<br />
Bild zu betrachten. Hierbei entscheidet das Messgerät<br />
automatisch, für welchen Tiefenbereich welche Antenne<br />
optimale Ergebnisse liefert.<br />
Auch an den weniger erfahrenen Nutzer und Neu-Einsteiger<br />
wurde bei dieser Neuentwicklung gedacht. So zeigt das Gerät<br />
an, bis zu welcher Tiefe die gemessenen Informationen unter<br />
den vor Ort herrschenden Bodenverhältnissen verwertbar sind.<br />
Letztlich gilt für jede Messtechnik, dass physikalische Bedingungen<br />
zu erfüllen sind, um die Ortung zu ermöglichen.<br />
Genau diese komplexe Beurteilung wird dem Nutzer durch<br />
dieses nützliche Werkzeug erleichtert.<br />
Weiteres wichtiges Detail der Vorort-Auswertung ist das<br />
Fokussieren der Leitungsreflexionen. Vom Georadar geortete<br />
Leitungen stellen sich ohne weitere Bearbeitung als<br />
Reflexionshyperbeln dar. Mit dem nützlichen Fokus-Tool<br />
des UtilityScan DF lässt sich die Leitungshyperbel interaktiv<br />
auf einen runden Querschnitt bringen. Dies erhöht die Auflösung<br />
der Messergebnisse und wird besonders bei dicht<br />
nebeneinander verlegten Leitungen geschätzt.<br />
Zusätzlich kann mit dieser Methode die Tiefe der georteten<br />
Leitung zuverlässig bestimmt werden.<br />
Gleich drei verschiedene Methoden erlauben beim UtilityScan<br />
DF die Tiefenbestimmung von Leitungen. Zusam<br />
men mit dem sogenannten „Backup-Cursor“, der als<br />
Fadenkreuz beim Zurückfahren des Messwagens die<br />
geortete Leitungsreflexion markiert, bieten die genannten<br />
Merkmale dem Bediener einen Komfort, wie er bisher<br />
nicht bekannt war.<br />
Mit dem Touchscreen des Panasonic Toughbook lässt<br />
sich das Messgerät unkompliziert, robust und zuverlässig<br />
bedienen.<br />
„Fast wie ein Handy“ war der Kommentar von einem der<br />
eingeladenen Fachzuschauer, als das neue Ortungsgerät<br />
erfolgreich auf dem Schulungsgelände eines großen<br />
deutschen Energieversorgungsunternehmens getestet und<br />
vorgeführt wurde. Ab Mai sollen hier auch mit diesem<br />
neuen Gerät regelmäßig Schulungen zur Leitungsortung<br />
und Baugrunderkundung stattfinden.<br />
KONTAKT: Gerätevertrieb und Vermietung: Allied Associates Geophysical<br />
Ltd., Büro Deutschland, Borken, Tel. +49 2861 8085648,<br />
E-Mail: susanne@allied-germany.de<br />
Ausbildung, Schulung, Entwicklung: GeoHiRes International<br />
GmbH, Borken, Tel. +49 2861 602075, E-Mail: info@geohires.com<br />
04-05 / 2013 33
FACHBERICHT PRODUKTE & VERFAHREN RECHT & REGELWERK WASSER BERLIN<br />
Esders GmbH<br />
Wasserleckortung per Korrelator mit Touchscreen<br />
Für die Wasserlecksuche gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten,<br />
das entsprechende Leck zu finden. Ein neues<br />
Kompaktsystem zur Leckageortung, basierend auf der Korrelation<br />
von Leckgeräuschen bietet die Firma Esders.<br />
Das Eureka3-System besteht aus einer zentralen Bedieneinheit<br />
mit großem Touchscreen, zwei Funksendern mit integrierten<br />
Mikrofonen, einem Kopfhörer, sowie dem Netzteil.<br />
Alle Teile werden in einem robusten Transportkoffer mit<br />
eingebautem Ladegerät sicher transportiert. Im Vergleich<br />
zur Vorgängerversion bietet das System Eureka3 eine speziell<br />
für den rauhen Außeneinsatz entwickelte Plattform für<br />
die Software – das TouchME.<br />
Sparen von Akkukapazität. Die Funksender übertragen die<br />
Geräusche mit hoher Qualität zum TouchME.<br />
„Diese Daten werden im TouchME umgehend analysiert<br />
und die Leckposition angezeigt. Parallel dazu werden sie<br />
im Gerätespeicher abgelegt und können - wie die Messergebnisse<br />
und Kommentare - ebenfalls über einen USB-Stick<br />
an den PC übertragen werden“ erklärt Clemens Fentker,<br />
Produktmanager bei Esders. In besonders heiklen Fällen ist<br />
eine zusätzliche Analyse am PC somit möglich. Die von den<br />
korrelierenden Geräuschloggern Enigma bekannte, effektive<br />
Enigma-Software ist kompatibel und ist in jedem System<br />
enthalten. So lässt sich auch der im TouchME integrierte<br />
„Der entscheidende Vorteil ist die einfache Bedienung – es<br />
bedarf keiner großen Erklärungen und Schulungen“, so<br />
Bernd Esders. Die großen Tasten werden auf dem TouchME<br />
Bildschirm dargestellt und lassen eine Bedienung sogar<br />
mit Handschuhen zu. Das hoch auflösende Farbdisplay mit<br />
sich automatisch anpassender Hintergrundbeleuchtung ist<br />
unter allen Wetterbedingungen brilliant ablesbar. Die notwendigen<br />
Daten für Länge der Rohrleitung, sowie Material<br />
und Durchmesser können bildlich unterstützt eingegeben<br />
werden und die Berechnung der Leckposition erfolgt vollautomatisch.<br />
Dafür werden wirkungsvolle Algorithmen aus<br />
vielen Jahren Erfahrung in Verbindung mit neuesten Signalprozessoren<br />
verwendet.<br />
Die Funksender mit eingebauten Mikrofonen können ohne<br />
störende und verschleißträchtige Kabelverbindungen wie<br />
gewohnt an den Kontaktpunkten zur Leitung angesetzt<br />
werden. Der Funksender lässt sich auf zwei wählbare Funkleistungen<br />
einstellen: eine hohe Funkleistung für sehr große<br />
Funkdistanzen oder eine verminderte Funkleistung zum<br />
GPS-Empfänger weiter nutzen. Dieser speichert nämlich<br />
die Leckpositonsdaten auf Knopfdruck und ermöglicht die<br />
Darstellung auf Kartenmaterial auf dem PC.<br />
Ungenauigkeiten bei der Korrelation entstehen meist durch<br />
lokale Besonderheiten der Schallgeschwindigkeiten des Rohres.<br />
Diese Ungenauigkeiten können beim Eureka3 effektiv<br />
mit einer Korrekturmöglichkeit bis auf Null reduziert werden.<br />
Optional kann das System durch externe Mikrofone<br />
erweitert werden, so dass auch ein Einsatz an engen und<br />
unzugänglichen Stellen sichergestellt werden kann. Ebenfalls<br />
sind Hydrofone für die besonders empfindliche Leckortung<br />
bei nichtmetallischen Leitungen mit dem System Eureka3<br />
verfügbar.<br />
Halle 6.2, Stand 214<br />
KONTAKT: Esders GmbH, Haselünne<br />
Tel. +49 5961 95650, E-Mail: info@esders.de, www.esders.de<br />
34 04-05 / 2013
WASSER RECHT BERLIN & REGELWERK PRODUKTE & FACHBERICHT VERFAHREN<br />
F.A.S.T GmbH<br />
Markteinführung „Water-Cloud“ und akustischer Molch<br />
Bei der akustischen Rohrbruchsuche kamen in der Vergangenheit<br />
vermehrt Datenlogger, die Geräusche während verbrauchsarmen<br />
Nachtstunden aufzeichnen, zum Einsatz. Da<br />
das Abfahren, oder sogar ablaufen, des Rohrnetzsystems<br />
auf dem die Logger ausgesetzt werden mit einem hohen<br />
Zeitaufwand und damit hohen Personalkosten einhergeht,<br />
wurde die Übertragung der Loggerdaten mit Transreceivern<br />
und GPRS-Modulen auf die Water-Cloud-Software bei F.A.S.T<br />
entwickelt. Zusätzlich wird durch die neue Korrelationsfunktion<br />
der Logger die Rohrbrüche gleichzeitig eingemessen. Dies<br />
spart nicht nur Arbeitszeit, sondern lässt Rohrbrüche quasi in<br />
Echtzeit aufspüren und zeitnah reparieren.<br />
Die Datenlogger werden im gesamten Rohrnetzsystem ausgebracht.<br />
Sinnvoll ist hier ein Abstand zwischen 300 und<br />
400 m. Zur Visualisierung können bestehende Rohrnetzkarten<br />
oder auch, wie im Bild zu sehen, einfache Straßenkarten<br />
in die Watercloud (www.water-cloud.de) geladen und mit<br />
den ausgesetzten Loggern verknüpft werden. Zur Übertragung<br />
der Loggerdaten wird vom Logger mittels Funk aus<br />
dem Schieber heraus zu einem sogenannten „Transreceiver“<br />
gesendet. Von dieser Transreceiverstation werden die Daten<br />
Peer-to-Peer an eine weitere T/R-Station übermittelt, die<br />
wiederum die Daten in dieser Weise versendet. Am Ende der<br />
Kette steht eine Kollektorstation, die die Daten aufnimmt<br />
und via GPRS auf die Watercloud übermittelt. Fällt im System<br />
ein Logger oder eine T/R-Station aus, suchen diese Selbständig<br />
nach alternativen Übertragungswegen, mit Hinweis auf<br />
den defekten Logger oder die defekte T/R-Station.<br />
Sind die Daten auf dem Watercloud-Server angekommen,<br />
werden die jeweiligen Logger nach dem Ampelprinzip<br />
angezeigt. Grün bedeutet keine Auffälligkeit, gelb eventuelle<br />
Unregelmäßigkeiten und rot deutliche Abweichungen.<br />
Alle Loggerdaten können direkt per Mausklick angesehen<br />
werden, wie es in Bild 1 oben rechts für LOGGER 1499 zu<br />
sehen ist. Hier sieht man auch den deutlichen Pegelanstieg<br />
zwischen den Nächten vom 28.01 und 02.02 was ein Indiz<br />
für eine entstandene Leckage in der Nähe ist. Ist eine Leckage<br />
erkannt, führen die Logger eine Korrelation durch, womit<br />
die genaue Stelle der Leckage berechnet wird.<br />
Akustischer Molch<br />
Sind Wasserleitungen, wie hauptsächlich Hausanschlüsse,<br />
aus Kunststoff, werden Leckagegeräusche oft ungenügend<br />
übertragen. Dies stellt ein Problem für das gängige Verfahren<br />
der Korrelation dar. Hinzu kommt, dass der Leitungsverlauf<br />
durch die flexible Verlegung der Kunststoffrohre<br />
oft nicht genau bekannt ist und es deswegen häufig zu<br />
Fehlgrabungen kommt. Mit dem von F.A.S.T entwickelten<br />
akustischen Molch lassen sich Rohrbrüche auf Hausanschlussleitungen<br />
exzellent orten. Möglich macht dies eine<br />
spezielle Schleuse mit der die Sonde unter Druck (bis 16<br />
bar) in die Leitung eingeschoben wird. Die Möglichkeit der<br />
Längenmessung und Streckenortung der eingebrachten<br />
Glasfaser lässt den exakten Ort der Leckage bestimmen.<br />
In Bild 2 ist ein Prototyp der Schleuse zu sehen, die gleichzeitig<br />
zur Desinfektion der Glasfaser dient. Es wird dazu einfach<br />
das Desinfektionsmittel in den aufgeschraubten Behälter<br />
gefüllt und die Glasfaser wird beim Einschieben kontinuierlich<br />
desinfiziert, ohne dass dabei das Desinfektionsmittel in<br />
die Wasserleitung gelangt. Die Installation ist für Wasseruhren<br />
oder Freiflussventile<br />
gedacht, aber auch<br />
andere Anschlüsse, z.B.<br />
über Hydranten, sind<br />
denkbar. Der Molch<br />
selbst wird zurzeit noch<br />
optimiert. Geplant ist,<br />
dass er ohne Probleme<br />
durch zwei 90° Bögen<br />
bei DN 50-Leitungen<br />
geschoben werden<br />
kann. Die Glasfaser<br />
wird speziell für die<br />
Streckenortung ausgerüstet<br />
und kann somit<br />
mit handelsüblichen<br />
Ortungsgeräten betrieben<br />
werden.<br />
Halle 6.2, Stand 118<br />
KONTAKT: F.A.S.T. GmbH, Langenbrettach, Dipl. Ing Edmund Riehle,<br />
Tel. +49 7946 921000, www.fastgmbh.de<br />
04-05 / 2013 35
FACHBERICHT PRODUKTE & VERFAHREN RECHT & REGELWERK WASSER BERLIN<br />
Wilhelm Ewe<br />
Hygienischer Umgang mit Standrohren in der<br />
Trinkwasserversorgung<br />
Die hygienischen und sicherheitstechnischen<br />
Anforderungen an<br />
Standrohre und Entnahmestellen<br />
für Trink- und Bauwasser sind in<br />
den letzten Jahren durch Normen<br />
und Regelungen wie die DIN EN<br />
1717, die DIN 2001-2 „Trinkwasserversorgung<br />
aus Kleinanlagen und<br />
nicht ortsfesten Anlagen“ und nicht<br />
zuletzt durch die 2011 überarbeitete<br />
TrinkwV 2001 stetig gestiegen.<br />
So sind in der DIN 2001-2 und dem<br />
DVGW-Arbeitsblatt W 408 eindeutige<br />
Regeln für den Umgang,<br />
insbesondere für die Lagerung<br />
und Herausgabe von Standrohren<br />
beschrieben.<br />
Um diesen Regeln gerecht zu werden und einen keimfreien,<br />
hygienischen Umgang mit Trinkwasser-Standrohren zu<br />
gewährleisten, hat die Firma EWE Armaturen zusammen<br />
mit den Wasserversorgungsunternehmen bereits 2010 eine<br />
Prüfanlage zur Desinfektion von Standrohren oder ähnlichen<br />
Armaturen konzipiert. Mit der Standrohrprüfanlage ist<br />
neben Dichtheitsprüfung, Durchspülung und Desinfektion der<br />
Standrohre auch die Wartung der vorhandenen Sicherungseinrichtungen<br />
möglich. Somit kann das verantwortliche Versorgungsunternehmen<br />
auch der gesetzlich vorgeschriebenen<br />
Funktionsprüfung und Wartung von Sicherungseinrichtungen<br />
nach DIN EN 12729 und twin DVGW Systemtrenner (04/03)<br />
und twin DVGW Nr. 02 (09/08) gerecht werden.<br />
Die Standrohr-Prüfanlage wurde für den mobilen Einsatz<br />
vor Ort entwickelt und ist ausgelegt für den Transport mit<br />
einem Hubwagen.<br />
Zum Betrieb der Standrohr-Prüfanlage sind lediglich ein<br />
Anschluss an das Trinkwassernetz sowie ein Ablauf in die<br />
Kanalisation zur Entsorgung der Prüfflüssigkeit notwendig.<br />
Ausgestattet ist die Anlage mit einer durchflussgesteuerten<br />
Dosierpumpe die im Desinfektionsbetrieb zum Einsatz kommt.<br />
Die Auswahl des Desinfektions- oder Prüfbetriebs erfolgt über<br />
die Stellung der integrierten Absperrarmaturen. Alle Bauteile<br />
der Standrohr-Prüfanlage bestehen aus trinkwassergeeigneten,<br />
hochwertigen Materialien, wie Edelstahl und Messing.<br />
Halle 4.2, Stand 315<br />
KONTAKT: Wilhelm Ewe GmbH & Co. KG, Braunschweig,<br />
www.ewe-armaturen.de<br />
Karl Schöngen<br />
Sichere Kanalsanierung mit HL-Vortriebsrohren<br />
Mit den Concept-HL-Vortriebsrohren der Firma Karl Schöngen<br />
KG aus Salzgitter stehen dem Anwender seit Jahrzenten<br />
zuverlässige Rohrsysteme einschließlich Formteile für die<br />
unterschiedlichsten grabenlosen Einbauverfahren zur Verfügung.<br />
Durch eine breite Produktpalette können die passenden<br />
Rohrsysteme für grabenlose Erneuerungsverfahren und die<br />
grabenlose Neuverlegung angeboten werden.<br />
Je nach Einsatzbedingungen und Einbauverfahren werden<br />
Rohrsysteme aus mechanisch und thermisch äußerst robustem,<br />
hochsteifem Polypropylen (PP-HM), aus modernen<br />
PE 100-RC-Werkstoffen nach PAS 1075 und aus PVC-U<br />
angeboten.<br />
Seit 2003 bietet Karl Schöngen ein spezielles stoffschlüssiges<br />
Rohrsystem für die grabenlose Kanalsanierung angebotendie<br />
sogenannte Multi-Raster-Schweißverbindung (MRS). Bei<br />
dieser kombinierten Steck-/Schweißverbindung entstehen<br />
keine störenden Schweißwülste und lange Abkühlzeiten<br />
brauchen nicht eingehalten werden. Kurzrohre können<br />
direkt beim Rohreinzug stoffschlüssig miteinander verbunden<br />
werden. Mit diesem stoffschlüssigen System werden<br />
Probleme wie Wurzeleinwuchs oder Beständigkeit der Dichtringe<br />
vermieden. Regelmäßig wird die Einhaltung der speziellen<br />
Anforderungen an Kunststoffrohre für grabenlose<br />
Einbautechniken durch zugelassene Prüfinstitute kontrolliert.<br />
Dies geschieht beispielsweise im Rahmen entsprechender<br />
bauaufsichtlicher<br />
Zulassungen. Entsprechende<br />
Zulassungen<br />
liegen nicht nur vom<br />
deutschen Institut für<br />
Bautechnik (DIBt),<br />
sondern auch vom<br />
tschechischen und<br />
polnischen Institut für<br />
Bautechnik vor.<br />
Halle 1.2, Stand 208p<br />
KONTAKT: Karl Schöngen KG, Salzgitter, Tel. +49 5341 799-0,<br />
E-Mail: info@schoengen.de<br />
36 04-05 / 2013
8.<br />
WASSER RECHT BERLIN & REGELWERK PRODUKTE & FACHBERICHT VERFAHREN<br />
16. Mai 2013, Essen, Hotel Bredeney<br />
www.forum-industriearmaturen.de<br />
Programm<br />
Moderation: Ralph-Harry Klaer,<br />
Bayer Technology Services<br />
• Tendenzen bei Industriearmaturen aus Anwendersicht<br />
R.-H. Klaer, Bayer Technology Services<br />
• Electric meets hydraulics – intelligente elektrische Antriebe<br />
mit fluidischem Getriebe in der Prozessautomation<br />
Marcus Groedl, Gotthard Gawens, Babak Farrokhzad,<br />
HOERBIGER Automatisierungstechnik<br />
• Armaturendiagnose mittels Wirkleistungsmessung –<br />
Leistung, Kräfte, Momente<br />
P. Borsum, TÜV Süd Industrie Service GmbH; M. Beetz, AREVA NP GmbH<br />
• Erste Erfahrungen mit der Lebensdauervorhersage<br />
von Ventilen mit einem Reliability-Index<br />
A. Vogt, F.I.R.S.T. GmbH<br />
• Anforderungen an Armaturen in der Zukunft – eine<br />
Abschätzung aus Sicht eines Armaturenanwenders<br />
G. Spiegel, BASF SE<br />
• Risikoreduzierung durch funktionale Sicherheit<br />
bei Aktoren<br />
S. Peeg, AUMA Riester GmbH<br />
• Herausforderung Elastomerdichtungen: Schadensanalyse<br />
von O-Ringen in Industriearmaturen<br />
M. Krüger, C. Otto Gehrckens GmbH & Co.<br />
• Innovative Armaturensysteme – Schnittstelle<br />
zwischen Brennstoff und Sicherheit<br />
S. Simon, Kühme Armaturen GmbH<br />
Wann und Wo?<br />
Termin:<br />
Donnerstag, 16. Mai 2013<br />
Veranstaltung 09:30 - 17:00 Uhr<br />
Ort:<br />
Essen, Hotel Bredeney, www.hotel-bredeney.de<br />
Zielgruppe:<br />
Das Forum Industriearmaturen wendet sich an alle<br />
Fachleute aus dem Bereich Industriearmaturen:<br />
Anwender, Anlagenplaner und -bauer sowie<br />
Anbieter von Armaturen und Armaturenantrieben.<br />
Teilnahmegebühr:<br />
Abonnenten von Industriearmaturen/<br />
Mitglieder des VDMA FB Armaturen: 330,00 €<br />
regulärer Preis: 360,00 €<br />
Vortragende sind von den Tagungsgebühren<br />
befreit.<br />
Im Preis enthalten sind die Tagungsunterlagen,<br />
das Catering (2 x Kaffee/Snacks, 1 x Mittagessen)<br />
sowie die Parkgebühren am Hotel.<br />
Veranstalter<br />
Mehr Information und Online-Anmeldung unter<br />
www.forum-industriearmaturen.de<br />
Fax-Anmeldung: 0201 82002-40 oder Online-Anmeldung: www.forum-industriearmaturen.de<br />
Ich bin Abonnent von Industriearmaturen / Mitglied des VDMA FB Armaturen<br />
Ich zahle den regulären Preis<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Firma/Institution<br />
E-Mail<br />
Straße/Postfach<br />
Nummer<br />
?<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Ort, Datum, Unterschrift<br />
04-05 / 2013 37
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
Die Neuerungen im technischen Teil der<br />
Gas- und Wasserleitungskreuzungsrichtlinie<br />
GWKR 2012<br />
Im Laufe eines Jahres werden ca. 1.000 Kreuzungen zwischen Gas- und Wasserleitungen bzw. Abwasserleitungen<br />
und Grundstücken der Deutschen Bahn AG (DB) geplant, gebaut oder geändert sowie die vorhandenen Kreuzungen<br />
bestimmungsgemäß betrieben und instandgehalten. Somit ist die Aktualität der rechtlichen und technischen Bedingungen für<br />
alle Beteiligten seitens der Netzbetreiber, der Planer sowie der Deutschen Bahn AG von großem Interesse. Der folgende Beitrag<br />
erläutert die wesentlichen Änderungen der am 01.04.2012 in Kraft gesetzten Gas- und Wasserleitungskreuzungsrichtlinien<br />
(GWKR) gegenüber der bisher geltenden Richtlinie 2000 (bei der DB als Ril 180.01 eingeführt).<br />
EINLEITUNG<br />
Die alten Gas- und Wasserleitungskreuzungsrichtlinien 2000<br />
basierten auf dem Informationsstand aus den 1990er Jahren.<br />
Aufgrund der Weiterentwicklung beim Stand der Technik<br />
und der bei der Anwendung der Richtlinie gewonnenen<br />
Erfahrungen seitens der Antragsteller und der DB wurde<br />
von den Vertragsparteien eine Überarbeitung beschlossen.<br />
Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der DB und<br />
des DVGW, wurde mit der Überarbeitung der Richtlinie<br />
beauftragt.<br />
Ein wesentlicher Schwerpunkt wurde hierbei in der Vereinfachung<br />
für die Anwender der Richtlinie gesehen. Wichtig ist,<br />
dass die GWKR die häufig vorkommenden Fälle abdecken<br />
soll. Einzel- oder Sonderfälle wurden und werden auch in<br />
Zukunft außerhalb des Standardverfahrens bearbeitet. Auf<br />
Verweise sollte weitestgehend verzichtet werden, um die<br />
Lesbarkeit und Anwendung der Richtlinie zu vereinfachen.<br />
Durch eine transparentere Darstellung<br />
der qualitativen Anforderungen an eine<br />
Bahnkreuzung sowie ein besseres Verständnis<br />
für die Prozesse im Rahmen<br />
des Antragsverfahrens soll letztlich der<br />
Abstimmungsbedarf und Gesamtaufwand<br />
bei allen Beteiligten minimiert<br />
werden.<br />
Die neuen Gas- und Wasserleitungskreuzungsrichtlinien<br />
(GWKR) traten<br />
zum 01.04.2012 in Kraft (Bild 1) und<br />
treten an die Stelle der bisherigen Gasund<br />
Wasserkreuzungsrichtlinien 180.01<br />
Bild 1: Die neue GWKR (GWKR 2000).<br />
WESENTLICHE NEUERUNGEN DER GWKR 2012<br />
Bei der Überarbeitung der Richtlinie wurden im Wesentlichen<br />
die fünf folgenden Anpassungen durchgeführt:<br />
1. Neustrukturierung und Modularisierung<br />
Der technische Teil wurde bislang in der GWKR 2000 in den<br />
Paragraphen 19 bis 27 dargestellt und war nicht getrennt von<br />
den rechtlichen und vertraglichen Regelungen beschrieben.<br />
Diese Struktur wurde durch zwölf unabhängige Module, sechs<br />
Vordrucke sowie neun Anhänge ersetzt, wodurch die rechtlich/<br />
vertraglichen Regelungen von den technischen Regelungen klar<br />
getrennt wurden. Mit dem modularen Aufbau wird es ermöglicht,<br />
dass einzelne Teile der GWKR einfacher und schneller<br />
überarbeitet werden können. Hierbei müssen dann nur die<br />
von den Modulen betroffenen Fachdisziplinen eingebunden<br />
werden, was den Abstimmungsumfang und den damit verbundenen<br />
Zeitbedarf zur Revidierung zukünftig reduzieren sollte.<br />
2. Zusammenführung von Anforderungen bei Gas- und<br />
Wasserleitungen<br />
Die Regelungen im technischen Teil waren bisher zwischen<br />
den Fachgebieten Gas und Wasser grundsätzlich unterschieden<br />
worden. Dies führte zu Dopplungen im Text für gleichlautende<br />
Regelungen in der GWKR für Gas und Wasser.<br />
Durch Zusammenfassung dieser gleichlautenden Regelungen<br />
konnte hier der Umfang der Richtlinie reduziert werden.<br />
3. Aktualisierung von Bezugsnormen und Regelwerken<br />
Die seit der Veröffentlichung der Richtlinie 2000 stattgefundenen<br />
Änderungen in den Bezugsnormen und Regelwerken<br />
seitens der DB sowie des DVGW mussten entsprechende<br />
Berücksichtigung in der GWKR finden.<br />
Es erfolgte u. a. der Abgleich mit den bahninternen Regelwerken,<br />
die die Planung und Instandhaltung von Erdbauwerken<br />
und sonstigen geotechnische Bauwerken regeln<br />
(hier insbesondere Ril 836). Zudem sind in Bezug auf das<br />
Antragsverfahren relevante Grundsätze aus der „Verwaltungsvorschrift<br />
des Eisenbahn-Bundesamtes über die Bauaufsicht im<br />
Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau sowie maschinentechnische<br />
Anlagen“ (VVBAU) in die neue GWKR eingeflossen. Die<br />
„Eisenbahnspezifische Liste Technischer Baubestimmungen“<br />
(ELTB) als auch die „Eisenbahnspezifische Bauregelliste“ (EBRL)<br />
mussten entsprechend eingearbeitet werden.<br />
Die Änderungen bei den Normen der Rohrwerkstoffe und<br />
Umhüllungen wurden in der Überarbeitung der GWKR<br />
berücksichtigt. Dies tangiert u. a. die bisherigen Bemes-<br />
38 04-05 / 2013
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
sungstabellen der Richtlinie. Im Sinne einer einfachen Nutzbarkeit<br />
der Richtlinie sollten die bisherigen Bemessungstabellen,<br />
die sich in der Vergangenheit bewährt hatten, wieder<br />
eingearbeitet bzw. erweitert (Nennweite DN 1600, Vortriebslänge<br />
80 m) werden. Hierzu war eine grundsätzliche<br />
Überarbeitung bzw. Neurechnung der Tabellen erforderlich,<br />
bei der insbesondere die Einwirkungen aus dem Eisenbahnverkehr<br />
gemäß DIN-Fachbericht 101 Berücksichtigung<br />
gefunden haben. Ein Tabellenwerk für den dynamischen<br />
Rohrvortrieb wird zurzeit erarbeitet und soll später der<br />
GWKR beigefügt werden.<br />
4. Anpassungen aufgrund der Weiterentwicklungen,<br />
Stand der Technik<br />
Da seitens der DB die Gleisverlegung unter Verwendung<br />
der „Festen Fahrbahn“ (FF) vermehrt zum Einsatz kommt,<br />
insbesondere bei neuen ICE-Hochgeschwindigkeitsstrecken,<br />
mussten entsprechende Bedingungen an die Leitungsverlegung<br />
festgelegt werden.<br />
In Bild 2 und Bild 3 ist die Gleisverlegung mit Schotteroberbau<br />
und Fester Fahrbahn gegenübergestellt. Neben den Regelungsinhalten<br />
hinsichtlich der Anforderungen an die Rohrvortriebverfahren,<br />
die detailliert im Modul 877.2102 dargestellt sind,<br />
sind für die beiden Bauarten des Oberbaus folgende Punkte<br />
der GWKR, dargestellt in Tabelle 1, zu beachten:<br />
Seit der Veröffentlichung der alten GWKR hat sich das<br />
Steuerbare Horizontale Spülbohrverfahren (Horizontal-<br />
Directional-Drilling, HDD) als grabenloses Vortriebsverfahren<br />
in der Praxis als Stand der Technik bewährt. Somit mussten<br />
entsprechende Regelungen in der GWKR ergänzt werden,<br />
da hierzu bislang keine Anforderungen enthalten waren.<br />
5. Regelfall mantelrohrlose Kreuzung bei Gas-Stahlleitungen<br />
mit kathodischem Korrosionsschutz (KKS)<br />
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen wurde die mantelrohrlose<br />
Kreuzung bei Gas-Stahlleitungen als Regelfall in<br />
die neue GWKR aufgenommen.<br />
ÜBERBLICK ÜBER DIE REGELUNGSINHALTE DER<br />
TECHNISCHEN MODULE<br />
Technische Regelungsinhalte, die in der bisherigen GWKR<br />
in den Paragraphen 19 bis 27 aufgeführt waren, sind in der<br />
neuen Fassung nun in den folgenden Modulen dargestellt.<br />
Antragsunterlagen und Nutzungshinweise<br />
877.2002 Antrags- und Genehmigungsverfahren<br />
für eine Gas- bzw. Wasserleitung bzw.<br />
Längsführung<br />
Bild 2: Schotteroberbau<br />
Bild 3: Feste Fahrbahn<br />
877.2002A01 Antrags- und Genehmigungsverfahren<br />
- Arbeitsschritte<br />
877.2002V01 Antragsformular grundsätzliche<br />
Zustimmung<br />
877.2002V02 Antragsformular Zustimmung<br />
877.2002V03 Antragsformular Änderung<br />
877.2101 Allgemeine Technische Grundlagen<br />
877.2101A01 Gebrauch Modaler Hilfsverben<br />
877.2101A02 Verzeichnis der zitierten Regelwerke<br />
Planung und Verfahren<br />
877.2102 Anforderungen an den Einsatz von<br />
Rohrvortriebsverfahren<br />
877.2103 Bedingungen für den Einsatz von<br />
HDD-Verfahren<br />
877.2201 Bautechnische Planung von Gas- und<br />
Wasserleitungskreuzungen<br />
877.2201A01 Schutzmaßnahmen beim Bau von Gasund<br />
Wasserleitungskreuzungen und<br />
Längsführungen<br />
Tabelle 1: Unterscheidung zwischen zwei Bauarten des Oberbaus<br />
Schotter<br />
Mindestüberdeckung: min. 1,5 m bzw. 12 mal DA<br />
Baugrundgutachten/ Geotechn. Gutachten gemäß DIN<br />
4020 / DVGW GW 304 von einem vom EBA zugelassenen<br />
Sachverständigen<br />
HDD: ja<br />
Zusätzliche Anforderungen bei v > 160 km/h<br />
Feste Fahrbahn<br />
Mindestüberdeckung: min. 2,5 m<br />
Baugrundgutachten/ Geotechn. Gutachten gemäß DIN<br />
4020 / DVGW GW 304 von einem vom EBA zugelassenen<br />
Sachverständigen<br />
HDD: nein (bzw. mit UIG / ZIE)<br />
Keine Rammverfahren<br />
04-05 / 2013 39
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
Bild 4: Anwendung HDD<br />
877.2201A02 Zahlentafel für Mantelrohrdurchmesser<br />
bei Wasserleitungen<br />
877.2202 Elektro- und korrosionsschutztechnische<br />
Planung von Gas- und Wasserleitungen<br />
Bemessungstabellen<br />
877.2203 Bemessung von Produkten- und Mantelrohren<br />
unter Gleisanlagen<br />
877.2203A01 Bemessungstabellen für den statischen<br />
Vortrieb für Gasrohre<br />
877.2203A02 Bemessungstabellen für den statischen<br />
Vortrieb für Wasserrohre<br />
877.2203A03 Bemessungstabellen für den statischen<br />
Vortrieb für Mantelrohre<br />
877.2203A04 Zusammenstellung der Grundwerkstoffe<br />
Bauausführung<br />
877.2301 Bauausführung bei der Erstellung, Änderung<br />
und Beseitigung von Gas- und<br />
Wasserleitungskreuzungen<br />
877.2301V01 Einweisungsniederschrift<br />
877.2302 Ausführung von Korrosionsschutz- und<br />
Elektrotechnische Maßnahmen bei der<br />
Erstellung und Änderung von Gas- und<br />
Wasserleitungskreuzungen<br />
Abnahme und Inbetriebnahme<br />
877.2401 Abnahme und Dokumentation von Gasund<br />
Wasserleitungskreuzungen<br />
877.2401V01 Abnahmeniederschrift<br />
877.2401V02 Zustimmung zur Inbetriebnahme<br />
Betrieb<br />
877.2402 Betrieb und Instandhaltung von Gas- und<br />
Wasserleitungskreuzungen<br />
877.2501 Aufhebungen von Gas- und<br />
Wasserleitungskreuzungen<br />
BAHNQUERUNGEN MIT HORIZONTALEM<br />
SPÜLBOHRVERFAHREN (HDD)<br />
Das horizontale Spülbohrverfahren wurde mit Einsatzbeschränkungen<br />
in die GWKR aufgenommen.<br />
Eisenbahnstrecken oder sonstige Bauwerke dürfen durch<br />
den Einsatz des HDD-Verfahrens (Bild 4) bei der Realisierung<br />
einer Bahnkreuzung grundsätzlich nicht unzulässig in<br />
ihrer Lage verändert werden. Durch qualifizierte Planung<br />
und Bauausführung kann ausgeschlossen werden, dass<br />
durch unkontrollierte Austritte von Spülsuspension Schäden<br />
auftreten können. Ebenso ist Kavernenbildung entlang der<br />
gewählten Bohrlinie unbedingt zu vermeiden.<br />
Die Grundlagen für die Festlegungen in der GWKR basieren<br />
auf den Regelungen im DVGW-Arbeitsblatt GW 321<br />
und den technische Richtlinien des Verbandes Güteschutz<br />
Horizontalbohrungen e.V. (DCA).<br />
Die Planung eines horizontalen Spülbohrverfahrens beinhaltet<br />
grundsätzlich ein Baugrundgutachten nach DVGW-<br />
Arbeitsblatt GW 321 mit einer entsprechenden Beurteilung<br />
der Durchführbarkeit des Verfahrens und einer Risikoabschätzung.<br />
Dies setzt immer die Einbindung eines qualifizierten<br />
Planers mit den dazugehörigen Erfahrungen bei der technischen<br />
Planung eines horizontalen Spülbohrverfahrens voraus.<br />
In der GWKR 2012 sind für Standardkreuzungen Einsatzbeschränkungen<br />
für die Anwendung des horizontalen Spülbohrverfahrens<br />
festgelegt worden. Die Kreuzung unter<br />
Bahnstrecken mit Schotteroberbau ist nur bis zu einer Bahngeschwindigkeit<br />
≤ 160 km/h zulässig. Die Unterquerung<br />
von Bahnstrecken mit der Oberbauart „Feste Fahrbahn“<br />
ist nicht zulässig. Horizontale Spülbohrverfahren können<br />
bei Leitungskreuzungen aus Stahl mit einer Nennweite bis<br />
zu DN 200, bei Kunststoffrohren Außendurchmesser bis<br />
225 mm, durchgeführt werden. Kunststoffrohre als Mantelrohre<br />
für Gas- oder Wasserleitungen sind nicht zulässig.<br />
Bei Abweichungen von den Einsatzeinschränkungen ist<br />
eine Unternehmensinterne Genehmigung (UiG) durch die<br />
Zentrale des Infrastrukturbetreibers (DB Netz AG) und eine<br />
Zustimmung im Einzelfall (ZiE) durch die Zentrale des Eisenbahnbundesamtes<br />
(EBA) erforderlich.<br />
Einige grundlegende Auflagen sind in der neuen GWKR<br />
fixiert. Die Mindestüberdeckung unter den Gleisen beträgt<br />
5,0 m. Diese kann im Einzelfall auf 4,0 m reduziert werden,<br />
wenn in diesen Tiefen dies aufgrund des anstehenden<br />
Bodens gemäß des Bodengutachtens günstiger ist und von<br />
einem erfahrenen geotechnischen Sachverständigen Risiken<br />
für den Eisenbahnbetrieb ausgeschlossen werden können.<br />
Die Anwendung des horizontalen Spülbohrverfahrens ist<br />
ohne planmäßige Unterbrechungen umzusetzen, die Sofortverrohrung<br />
ist sicherzustellen. Zur Bohrkanalstützung erfolgt<br />
grundsätzlich die Ringraumverfüllung mit auf den Baugrund<br />
abgestimmter Bentonitsuspension. Nach Abschluss der Bohrung<br />
erfolgt der Ersatz der Bentonitsuspension zur Bohrkanalabstützung<br />
durch eine Suspension auf Zementbasis<br />
(Dämmer). Die Bündelung von Medienleitungen in einem<br />
Einziehvorgang oder der Einbau von mehreren Leitungen<br />
übereinander ist nicht zulässig. Das Mitführen eines Kabelschutzrohres<br />
für ein Betriebskabel zur eigentlichen Leitung<br />
ist zulässig bis zu einem maximalen Außendurchmesser<br />
DA = 63 mm, dieses ist nicht als eine Bündelung im herkömmlichen<br />
Sinne zu sehen. Es dürfen gleichzeitig keine<br />
parallelen Bohrungen durchgeführt werden.<br />
40 04-05 / 2013
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
Für die Ausführung des horizontalen Spülbohrverfahrens<br />
werden ausschließlich Unternehmen mit Zertifizierung nach<br />
DVGW-Arbeitsblatt GW 302 Gruppe GN 2 (Grabenlose<br />
Neuverlegung, Verfahren nach GW 321) akzeptiert.<br />
Risiken beim HDD-Verfahren sind durch sorgfältige und<br />
qualifizierte Vorplanung sowie gutes Fachpersonal und<br />
umfassende Qualitätssicherung bei der Bauausführung zu<br />
minimieren. Wird dies unter Berücksichtigung der Einsatzgrenzen<br />
beachtet, so ist das horizontale Spülbohrverfahren<br />
ein wirtschaftliches Verfahren, dass auch unter Eisenbahnstrecken<br />
sicher eingesetzt werden kann.<br />
NEUE BEMESSUNGSTABELLEN<br />
Das DVGW-Merkblatt GW 312 und die bislang darin enthaltenen<br />
Tabellenwerke für Stahlvortriebsrohre bildeten die Grundlage<br />
für die entsprechenden Tabellen im Anhang zur GWKR.<br />
Mit der umfangreichen Überarbeitung des DVGW-Merkblattes<br />
GW 312 sind die Tabellenwerke für Stahlvortriebsrohre entfallen.<br />
Da sich die Tabellenwerke für Stahlvortriebsrohre in der Praxis<br />
bewährt haben, mussten somit die bisherigen Tabellen<br />
im Rahmen der Überarbeitung der Technischen Regelungen<br />
in die GWKR integriert werden. Darüber hinaus soll zukünftig<br />
auch ein Tabellenwerk zum dynamischen Rohrvortrieb<br />
als Modul enthalten sein.<br />
Als Berechnungsgrundlage werden die folgenden Lastfälle unter<br />
Berücksichtigung des Abrostungszuschlages (AbR) betrachtet:<br />
» LF1: Eingebauter Zustand (DIN-Fachbericht 101 ist<br />
berücksichtigt) Zusammenführung von Anforderungen<br />
bei Gas- und Wasserleitungen<br />
» LF2: Statischer Vortrieb (Berechnungsverfahren nach<br />
Arbeitsblatt DWA-A 161 mit Stand 8/2012 (inhaltlich<br />
gleich mit DVGW-Merkblatt GW 312), noch nicht<br />
eingeführt)<br />
» LF3: Dynamischer Vortrieb (neues Berechnungsverfahren<br />
in Bearbeitung)<br />
Bei der vergleichenden Berechnung ist das Maximum aus den<br />
Berechnungen (LF1 + AbR), LF2 und LF3 sowie die maximal<br />
zulässige Verformung im gebetteten Zustand maßgeblich.<br />
Um weiterhin gültige Rohrtabellen nutzen zu können, wurden<br />
die bestehenden Tabellen mit den Einwirkungen gemäß<br />
DIN-Fachbericht 101 unter Berücksichtigung der neuen<br />
Werkstoffnormen für Rohrstähle überarbeitet.<br />
Zur Erarbeitung der technischen und wissenschaftlichen<br />
Grundlagen für die Berechnung von dynamischen Rohrvortrieben<br />
bei Gas- und Wasserleitungskreuzungen von<br />
Verkehrswegen hat der DVGW ein Forschungsvorhaben<br />
initiiert. Die Überprüfung der daraus resultierenden Ergebnisse<br />
durch einen EBA-zugelassenen Sachverständigen steht<br />
noch aus. In der jetzigen Version der GWKR sind zunächst<br />
die Tabellenwerke für den statischen Rohrvortrieb enthalten.<br />
Die Bemessungstabellen in der GWKR 2012 sind, wie in<br />
Tabelle 2 dargestellt, gegliedert.<br />
ANTRAGSVERFAHREN<br />
Der Verfahrensablauf zum Antragsverfahren ist im<br />
Modul 877.2002 beschrieben. Die einzelnen Verfahrensschritte,<br />
welche maßnahmenspezifisch und aufgrund<br />
der jeweiligen örtlichen und technischen Gegebenheiten<br />
erforderlich sind, werden in einem Ablaufschema im<br />
Modul 877.2002V01 dargestellt.<br />
Beteiligte im Verfahren sind:<br />
» Antragsteller (Netzbetreiber/ beauftragte Ing.-Büros)<br />
» DB Services Immobilien GmbH (vertragsschließende Stelle)<br />
» DB Netz AG (zuständige Stelle für die technische Prüfung<br />
und ggf. Experten der Zentrale)<br />
» ggf. weitere betroffene DB-Gesellschaften<br />
» ggf. Eisenbahn-Bundesamt (EBA)<br />
» Sonstige (z. B. Sachverständige)<br />
Federführende Stelle bei der DB und Eingangstor für Anfragen<br />
sowie Anträge auf Verlegung von Leitungen auf DB-Gelände<br />
ist die DB Services Immobilien GmbH. Die technische Prüfung<br />
des Antrags in Bezug auf eisenbahnspezifische Belange und<br />
Richtlinienkonformität erfolgt bei der DB Netz AG.<br />
Das Antragsverfahren gliedert sich in zwei wesentliche Teile<br />
(Tabelle 3):<br />
Die Verfahrensdauer beträgt je nach Komplexität der Maßnahme<br />
bei vollständigen und korrekten Antragsunterlagen<br />
zwischen zwölf und 16 Wochen, wobei die technische Prüfung<br />
bei der DB Netz AG in der Regel acht bis zehn Wochen<br />
in Anspruch nimmt. Bei besonders umfangreichen Vorgängen<br />
kann die Bearbeitungszeit auch darüber hinausgehen.<br />
Die Antragsunterlagen sind nach Unterscheidung zwischen<br />
grundsätzlichem Antrag und Zulassungsantrag grundsätzlich<br />
achtfach mit den folgenden Mindestinhalten einzureichen:<br />
» Antrag nach den neuen, nun interaktiven Vordrucken<br />
(insbesondere 887.2002V02)<br />
Tabelle 2: : Bemessungstabellen in der GWKR 2012<br />
Medium<br />
Gas und Wasser<br />
Werkstoff<br />
Stahl, S235JR - L555MB<br />
Vortriebslänge 25, 50, 80 m<br />
Vortrieb<br />
statisch, (dynamisch)<br />
Überdeckungshöhen 1,5 bis 6 m<br />
Bodenklassen Bodengruppen G1 bis G4 nach GW 312<br />
Grundwasser<br />
“0 bis GOK“<br />
Nennweite DN 100 bis DN 1600<br />
Druck<br />
0 bis 100 bar<br />
Tabelle 3: Prozessinhalte<br />
Verfahrensteile und Ansprechpartner<br />
Teil 1 Eingangsbearbeitung, Antragsprüfung, Vertragsabschluss,<br />
Vertragsdokumentation<br />
Ihre Ansprechpartner<br />
DB Services Immobilien GmbH<br />
Bereich Liegenschaftsmanagement<br />
(sieben regionale Niederlassungen)<br />
Teil 2 Technische Prüfung und Abstimmung der Maßnahme DB Netz AG<br />
Bereich Immobilienmanagement / Technisches Baurecht<br />
(sieben Regionalbereiche)<br />
04-05 / 2013 41
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
Wissensstand DB<br />
Bahnspezifisches Hintergrundwissen<br />
Bahnspezifische Regelwerk<br />
Fachspezifische Kenntnisse des Leitungsbaus sowie<br />
allgemeingültige Normen und Regelwerke<br />
Leitungsbauspezifisches Hintergrundwissen<br />
Bild 5: Wissensstand DB/Leitungsbetrieber<br />
» bahntypischer Lageplan mit Streckenkilometer im Maßstab<br />
1 : 1.000 oder 1 : 500 (immer erforderlich)<br />
» Längs- und Querschnittspläne (Maßstab 1 : 100)<br />
» Baubeschreibung bzw. Erläuterungsbericht zu der<br />
Kreuzung/Näherung<br />
» Angaben zum vorhandenen Baugrund (Baugrundgutachten);<br />
bei bergmännischen Bauverfahren immer<br />
erforderlich<br />
» Statische Nachweise (z. B. Standsicherheitsnachweis für<br />
Baugruben, Brücken- und sonst. Bauwerke; Einzelrohrstatik<br />
- sofern keine speziellen Bemessungstabellen oder<br />
sonstige Regelungen bestehen - bedürfen zusätzlich der<br />
Prüfung durch EBA-anerkannte Sachverständige)<br />
» bei technischen Besonderheiten können weitere Unterlagen<br />
erforderlich werden.<br />
In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass in<br />
der Regel die Wissensstände bei den Anwendern seitens<br />
der DB und den Leitungsbetreibern in Bezug auf die jeweils<br />
eigenen spezifischen Belange sehr unterschiedlich sind. Aus<br />
diesem Grunde ist eine intensive Abstimmung zu vertragsrechtlichen<br />
und technischen Besonderheiten zwischen den<br />
Vertragspartnern von großer Bedeutung (Bild 5).<br />
Die Qualität und Vollständigkeit der einzureichenden<br />
Antragsunterlagen hat direkten Einfluss auf den Bearbeitungszeitraum<br />
und den im Verfahrensablauf erforderlichen<br />
Abstimmungsbedarf zwischen DB und Antragssteller. Durch<br />
die Auswahl eines erfahrenen und qualifizierten Planers für<br />
die Erstellung der Antragsunterlagen kann der Zeitraum<br />
durch den Vorhabensträger unmittelbar minimiert werden.<br />
Es besteht die Möglichkeit, bei Streitigkeiten sowie bei deutlicher<br />
Überschreitung der vorgesehenen Bearbeitungszeiten<br />
die sog. DBAG-BDEW-Einigungsstelle einzuschalten, um<br />
eine grundsätzliche Einigung bzw. Lösung herbeizuführen.<br />
Die Geschäftsordnung der Einigungsstelle (Ansprechpartner,<br />
Durchführung etc.) ist im Modul 877.2001A03 hinterlegt.<br />
Wissensstand Leitungsbetreiber<br />
AUSBLICK<br />
Nach Abschluss des DVGW-Forschungsvorhabens zur Erarbeitung<br />
der technischen und wissenschaftlichen Grundlagen zur<br />
Berechnung von dynamischen Rohrvortrieben für Gas- und<br />
Wasserleitungen bei Kreuzungen von Verkehrswegen und der<br />
Überprüfung durch einen EBA-zugelassenen Sachverständigen/Prüfstatiker<br />
ist vorgesehen, die in dem Modul 877.2203<br />
der neuen GWKR enthaltenen Tabellenwerke entsprechend<br />
anzupassen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass grundsätzlich<br />
kürzere Prüfungs- und Überarbeitungsintervalle notwendig<br />
sind, um die Kreuzungsrichtlinien auf <strong>aktuell</strong>em Stand zu<br />
halten. Durch den modularen Aufbau der Kreuzungsrichtlinie<br />
ist eine einfachere und schnellere Anpassung von einzelnen<br />
Bausteinen möglich. Somit können in die Kreuzungsrichtlinie<br />
zukünftig aufwandsoptimiert und zeitnah die Änderungen in<br />
den Bezugsnormen und Regelwerken sowie neue Erkenntnisse<br />
seitens der Anwender in der Kreuzungsrichtlinie einfließen.<br />
Damit keine Themen bzw. Änderungswünsche zur Anpassung<br />
der GWKR in Vergessenheit geraten, hat die Arbeitsgruppe<br />
einen Themenspeicher angelegt. Erlangt dieser Speicher<br />
einen gewissen Füllungsgrad, wird ein Bearbeiten der<br />
gesammelten Themen angegangen. Aus diesem Grund wird<br />
sich die zur Überarbeitung der Kreuzungsrichtlinie initiierte<br />
Arbeitsgruppe auch zukünftig regelmäßig hinsichtlich der<br />
erforderlichen Anpassungen der Richtlinie zusammenfinden.<br />
Dipl.-Ing. HEIKO WEDUWEN<br />
enercity Netzgesellschaft mbH, Hannover<br />
Tel. +49 511-4304740<br />
E-Mail: heiko.weduwen@enercity-netz.de<br />
Dipl.-Geogr. ANJA FANGHÄNEL<br />
DB Netz AG, Frankfurt/ Main<br />
Tel. + 49 69-265-47476<br />
E-Mail: anja.fanghaenel@deutschebahn.com<br />
Dipl.-Ing. JOCHEN LAMPRECHT<br />
RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice<br />
GmbH, Dortmund<br />
Tel. +49 231-438-6722<br />
E-Mail: jochen.lamprecht@rwe.com<br />
Dipl.-Wirt. Ing. ANDRÉ GRASSMANN<br />
Open Grid Europe GmbH, Essen<br />
Tel. +49 201-3642-18173<br />
E-Mail: andre.grassmann@open-grideurope.com<br />
AUTOREN<br />
Dipl.-Ing. GEORG PADBERG<br />
DB Netz AG, München<br />
Tel.: +49 89-1308-6248<br />
E-Mail: georg.padberg@deutschebahn.com<br />
42 04-05 / 2013
RECHT & REGELWERK KURZ INFORMIERT<br />
E.ON und DVGW übernehmen leitende<br />
Funktionen in der neuen ISO-Arbeitsgruppe<br />
CO 2<br />
-Transport<br />
Das im August 2012 von der Bundesregierung erlassene Kohlendioxid-Speicherungsgesetz verweist auf das<br />
Energiewirtschaftsgesetz und somit auf das DVGW-Regelwerk. Der DVGW hat somit die Aufgabe, ein geeignetes Regelwerk<br />
für CO 2<br />
zu erarbeiten. Dazu hat der DVGW den Koordinierungskreis CCS (KK CCS), bestehend aus Industriepartnern und<br />
Forschungsinstituten, ins Leben gerufen. Dieser Koordinationskreis befasst sich mit der Erstellung von Standards und<br />
technischen Regeln zum leitungsgebundenen Transport von CO 2<br />
in Deutschland. Nach Regelwerken für Wasser (W-Reihe)<br />
und Gas (G-Reihe) entsteht somit ein neues Regelwerk für CO 2<br />
, die sogenannte C-Reihe. Als Leiter des Koordinationskreises<br />
wurde Dr. Achim Hilgenstock von der E.ON New Build & Technology GmbH gewählt. Das Sekretariat wird von Dr. Claudia<br />
Werner vom DVGW gestellt.<br />
2012 hat ISO das Technische Komitee ISO TC 265: „Carbon<br />
Dioxide Capture, Transportation and Geological Storage”<br />
(Kohlendioxid-Abscheidung, -Transport und geologische<br />
Speicherung) gegründet.<br />
National werden die Aktivitäten vom DIN begleitet, der auch<br />
das Spiegelgremium für die internationalen Aktivitäten im<br />
Rahmen der ISO darstellt. Durch die Übernahme wichtiger<br />
Leitungs- und Steuerungsfunktionen in ISO (International<br />
Standardization Organisation) werden die im DVGW<br />
geschaffenen Ansätze auch international etabliert.<br />
ISO TC 265 wird Standards erarbeiten, die die gesamte Prozesskette<br />
der CO 2<br />
-Abscheidung, -Transport und Speicherung<br />
abdecken, und darüber hinaus auch übergreifende Themen<br />
behandeln. Dafür wurden fünf Arbeitsgruppen (Working<br />
Groups – WGs) gegründet:<br />
» WG1 Capture (Abscheidung)<br />
» WG2 Transportation (Transport)<br />
» WG3 Storage (Speicherung)<br />
» WG4 Quantification and Verification (Quantifizierung<br />
und Verifizierung)<br />
» WG5 Cross-Cutting Issues (Übergeordnete Themen)<br />
Auf der zweiten ISO TC 265 Sitzung am 4. und 5. Februar<br />
2013 in Madrid wurden die Leiter für die Arbeitsgruppen<br />
offiziell per Resolution benannt. Deutschland wird mit<br />
Dr. Achim Hilgenstock die „WG2 Transportation” leiten.<br />
Das Sekretariat wird von Dr. Claudia Werner vom DVGW<br />
übernommen. Diese ISO-Aktivitäten für den CO 2<br />
-Transport<br />
werden von beiden auch auf die nationale Ebene in das<br />
DIN-Spiegelgremium kommuniziert. Somit ist sichergestellt,<br />
dass die in ISO und DVGW entwickelten Normen und Standards<br />
konsistent und national sowie international anerkannt<br />
werden.<br />
Demnächst wird ISO TC 265 die nationalen Normungsinstitute<br />
– für Deutschland also das Deutsche Institut für<br />
Normung e. V. (DIN) – auffordern, Experten für die Mitarbeit<br />
in den einzelnen Arbeitsgruppen zu benennen und zu<br />
einem ersten ISO TC 265 WG2-Treffen zum DVGW nach<br />
Bonn einladen.<br />
KONTAKT: DVGW, Dr. Claudia Werner, Tel. +49 30 30108291,<br />
E-Mail: werner@dvgw.de<br />
Lesen Sie den kompletten Fachbericht zum<br />
Thema CO 2<br />
-Transport auf www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
unter der Rubrik „Aktuelle <strong>3R</strong>“<br />
04-05 / 2013 43
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
Zulassungsverfahren für Errichtung<br />
und Betrieb von Rohrfernleitungen<br />
Teil 3: Anforderungen des Bundesberggesetzes<br />
(BBergG) und des Kohlendioxidspeichergesetzes<br />
(KSpG)<br />
In <strong>3R</strong>-Ausgaben 1-2/2013 und 3/2013 wurde das Zulassungsverfahren für Errichtung und Betrieb von Gasversorgungsleitungen<br />
i.S.d. § 43 S. 1 Nr. 2 EnWG und für Rohrfernleitungen i.S.d. § 20 UVPG erläutert. Zur Vervollständigung und zum Abschluss<br />
der das Zulassungsverfahren von Errichtung und Betrieb betreffenden Ausführungen sollen im Folgenden die speziellen<br />
Zulassungsverfahren für Rohrleitungen bergbaulicher Betriebe, für Transit-Rohrleitungen und für Kohlendioxidleitungen<br />
skizziert werden.<br />
1. ROHRLEITUNGEN ALS EINRICHTUNGEN EINES<br />
BERGBAUBETRIEBS<br />
Das Bundesberggesetz ist gem. § 2 Abs. 1 Nrn. 1 und 2<br />
BBergG das Spezialgesetz für das Aufsuchen, die Gewinnung<br />
und Aufbereitung von bergfreien 1 und grundeigenen 2<br />
Bodenschätzen sowie die anschließende Wiedernutzbarmachung<br />
der Oberfläche. Dem Gesetz unterliegen aber nicht<br />
nur Aufsuchen, Gewinnen und Aufbereiten sowie das Wiedernutzbarmachen,<br />
sondern gem. § 2 Abs. 1 Nr. 3 BBergG<br />
auch die zugehörigen Betriebsanlagen und -einrichtungen,<br />
die bergbaulichen Tätigkeiten überwiegend dienen oder zu<br />
dienen bestimmt sind. 3<br />
Anwendung des BBergG auf Rohrleitungen<br />
Das gilt auch für Rohrleitungen, die einem Bergbaubetrieb<br />
dienen und gewonnene Bodenschätze oder sonstige<br />
Massen befördern. Der Anwendungsbereich des Bundesberggesetzes<br />
endet gem. § 2 Abs. 4 Nr. 5 BBergG erst bei<br />
dem Befördern von Bodenschätzen oder sonstigen Massen<br />
„in Rohrleitungen ab Übergabestation, Einleitung in Sammelleitungen<br />
oder letzter Messstation für den Ausgang,<br />
soweit die Leitungen<br />
a. unmittelbar und ausschließlich der Abgabe an Dritte oder<br />
b. an andere Betriebe desselben Unternehmers dienen, die<br />
nicht zum Aufsuchen, Gewinnen oder Aufbereiten von bergfreien<br />
oder grundeigenen Bodenschätzen bestimmt sind.“<br />
Damit gilt das Bundesberggesetz für Rohrleitungen, die<br />
Einrichtungen eines Bergbaubetriebs sind, mindestens bis<br />
zur Übergabestation, Einleitung in Sammelleitungen oder<br />
letzte Messstation für den Ausgang; das Bundesberggesetz<br />
1 Die bergfreien Bodenschätze sind in § 3 Abs. 3 BBergG aufgelistet; an ihnen<br />
können vom Grundeigentum gesonderte Berechtigungen begründet werden.<br />
2 Die grundeigenen Bodenschätze sind in § 3 Abs. 4 BBergG aufgelistet; sie<br />
stehen im Eigentum des Grundeigentümers.<br />
3 Kriterium des überwiegenden Dienens ist eine Nutzung für einen Bergbaubetrieb<br />
zu mehr als 50 %: VG Aachen, Urteil vom 04.10.2011, 6 K 2332/09.<br />
erfasst damit die bergbautypischen Feldleitungen. Auch darüber<br />
hinaus gilt das Bundesberggesetz für Rohrleitungen als<br />
Einrichtungen eines Bergbaubetriebs, soweit sie der Abgabe<br />
an andere Endpunkte als an Dritte dienen (Buchstabe a) und<br />
soweit sie der Abgabe an andere bergbauliche Betriebe<br />
desselben Unternehmers dienen (Buchstabe b). Unter das<br />
Bundesberggesetz fallen damit längenunabhängig etwa<br />
Rohrleitungen als betriebliche Einrichtungen eines Bergbaubetriebs,<br />
die der Abgabe in einem Bergbaubetrieb anfallender<br />
Wässer nicht an Dritte, sondern an die Umwelt durch<br />
Einleitung in einen Vorfluter dienen. Ebenso fallen unter<br />
das Bundesberggesetz längenunabhängig Rohrleitungen,<br />
die Bergbaubetriebe desselben Unternehmers miteinander<br />
verbinden. Damit erfasst der Geltungsbereich des Bundesberggesetzes<br />
auch über das Betriebsgelände und auch<br />
über das Bergwerksfeld hinausgehende Rohrfernleitungen,<br />
sofern und solange diese entweder der Verbindung von<br />
Aufsuchungs-, Gewinnungs- oder Aufbereitungsbetrieben<br />
desselben Unternehmers oder der Abgabe von Stoffen an<br />
andere Umweltmedien, aber nicht an Dritte dienen. 4<br />
Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren mit<br />
Vorrangwirkung vor anderen Verfahren<br />
Anlagen, die dem Anwendungsbereich des Bundesberggesetzes<br />
unterfallen, sind gem. § 51 Abs. 1 S. 1 und 2 BBergG<br />
durch Betriebsplan zuzulassen. Damit werden jedoch andere<br />
Zulassungsverfahren in der Regel nicht verdrängt, so dass<br />
grundsätzlich parallel zum bergrechtlichen Betriebsplanverfahren<br />
auch andere – etwa rohrleitungsspezifische – Zulassungsverfahren<br />
einschlägig sein können.<br />
Anderes gilt dann, wenn eine bergbauliche Einrichtung eine<br />
Umweltverträglichkeitsprüfung erfordert, also UVP-pflichtig<br />
4 Keienburg in: Boldt/Weller/Kühne/von Mäßenhausen, BBergG-Kommentar,<br />
2. Auflage, Erscheinungsdatum voraussichtlich 2013, § 2 Rn. 40 ff.<br />
44 04-05 / 2013
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
ist. UVP-pflichtige bergbauliche Vorhaben erfordern gem.<br />
§ 52 Abs. 2a S. 1 BBergG eine Planfeststellung: „Die Aufstellung<br />
eines Rahmenbetriebsplanes ist zu verlangen und<br />
für dessen Zulassung ein Planfeststellungsverfahren nach<br />
Maßgabe der §§ 57a und 57b BBergG durchzuführen, wenn<br />
ein Vorhaben nach § 57c BBergG einer Umweltverträglichkeitsprüfung<br />
bedarf.“<br />
Der bergrechtlichen Planfeststellung kommt – ebenso wie<br />
den bereits behandelten Planfeststellungen gem. § 43 S. 1<br />
Nr. 2 EnWG und § 20 Abs. 1 UVPG – Konzentrationswirkung<br />
zu; d.h. die bergrechtliche Planfeststellung konzentriert alle<br />
sonstigen für ein Vorhaben erforderlichen Zulassungen. Dies<br />
gilt auch für etwaige zusätzlich zu einer bergrechtlichen Planfeststellung<br />
für eine Rohrleitung erforderliche Zulassungen<br />
nach § 20 Abs. 1 UVPG, da der bergrechtlichen Planfeststellung<br />
gem. § 57b Abs. 3 S. 1 BBergG Vorrangwirkung vor<br />
sonstigen Planfeststellungsverfahren zukommt. Das bedeutet:<br />
»»<br />
Wenn eine Rohrleitung eine UVP-pflichtige Einrichtung<br />
eines Bergbaubetriebs darstellt, ist das dann durchzuführende<br />
bergrechtliche Planfeststellungsverfahren<br />
vorrangig und konzentriert auch ggf. nach sonstigen<br />
Rechtsgebieten erforderliche Planfeststellungen.<br />
Voraussetzung der bergrechtlichen Planfeststellung:<br />
UVP-Pflicht des Vorhabens<br />
Welche bergbaulichen Vorhaben UVP-pflichtig sind, ergibt<br />
sich vorrangig aus § 1 Nrn. 1 bis 8 UVP-V Bergbau und<br />
nachrangig aus Anlage 1 des UVPG. Gem. § 1 Nr. 6 UVP-V<br />
Bergbau sind Wassertransportleitungen zum Fortleiten von<br />
Wässern aus der Tagebauentwässerung längenabhängig<br />
vorprüfpflichtig; diese Regelung ist vorrangig vor Ziffer 19.8<br />
der Anlage 1 des UVPG. Im Übrigen gelten über § 1 Nr. 9<br />
UVP-V Bergbau die rohrleitungsspezifischen Kriterien der<br />
Ziffern 19.2 bis 19.8 und 19.10 der Anlage 1 des UVPG auch<br />
für bergbauliche Vorhaben. Das bedeutet:<br />
»»<br />
Die einschlägigen Kriterien der UVP-Pflicht für Rohrleitungen<br />
in Ziffern 19.2 bis 19.8 und 19.10 der Anlage 1<br />
des UVPG sind auch auf Rohrleitungen anzuwenden,<br />
die Einrichtungen eines Bergbaubetriebs sind, soweit<br />
nicht die Regelungen in § 1 Nrn. 1 bis 8 UVP-V Bergbau<br />
vorrangig sind.<br />
Bei bergbaulichen Rohrleitungen zur Beförderung von<br />
Rohöl etwa handelt es sich um Rohrleitungen zum Befördern<br />
wassergefährdender Stoffe, 5 die unter den Voraussetzungen<br />
der Ziffer 19.3 der Anlage 1 des UVPG UVPpflichtig<br />
sind. Bergbauliche Rohrleitungen zur Beförderung<br />
von Erdgas dürften mangels unmittelbar auf die<br />
öffentliche Versorgung gerichteter Zwecksetzung kaum<br />
als Energieanlagen i.S.d. EnWG unter Ziffer 19.2 der Anlage<br />
1 des UVPG fallen, so dass sich ihre UVP-Pflicht dann,<br />
wenn das Erdgas im Einzelfall die Merkmale eines wassergefährdenden<br />
Stoffs i.S.d. § 2 Abs. 1 S. 2 RohrFLtgV<br />
erfüllt, nach Ziffer 19.3 und anderenfalls nach Ziffer 19.5<br />
der Anlage 1 des UVPG richtet.<br />
Zulassungsrechtliche Konsequenzen<br />
Erfordert eine bergrechtlich zuzulassende Rohrleitung eine<br />
UVP, ist diese gem. § 52 Abs. 2a S. 1 BBergG im bergrechtlichen<br />
Planfeststellungsverfahren durchzuführen, und das<br />
bergrechtliche Planfeststellungsverfahren verdrängt, wie<br />
dargelegt, andere Planfeststellungsverfahren.<br />
Bedarf eine bergrechtlich zuzulassende Rohrleitung dagegen<br />
keiner UVP, ist das bergrechtliche Planfeststellungsverfahren,<br />
das eine UVP voraussetzt, unanwendbar. Damit erfordert<br />
die Rohrleitung nach bergrechtlichen Vorgaben allein eine<br />
Betriebsplanzulassung im konventionellen Zulassungsverfahren,<br />
ohne Konzentrations- oder Verdrängungswirkung.<br />
In diesem Fall kann für die Rohrleitung trotz fehlender UVP-<br />
Pflicht zusätzlich ein Planfeststellungsverfahren nach § 4<br />
Abs. 1 S. 1 KSpG oder ein Plangenehmigungsverfahren<br />
nach § 20 Abs. 2 UVPG erforderlich sein. Dieses Planfeststellungs-<br />
oder Plangenehmigungsverfahren konzentriert dann<br />
die konventionelle bergrechtliche Betriebsplanzulassung.<br />
Bergbauliche Rohrleitungen, die weder UVP-pflichtig sind,<br />
noch eine Plangenehmigung i.S.d. § 20 Abs. 2 S. 1 UVPG<br />
oder eine Planfeststellung i.S.d. § 4 Abs. 1 S. 1 KSpG<br />
erfordern, d.h. Rohrleitungen, in denen keine Stoffe i.S.d.<br />
Ziffern 19.2 bis 19.8 und 19.10 der Anlage 1 des UVPG<br />
befördert werden, unterliegen allein dem konventionellen<br />
bergrechtlichen Betriebsplanzulassungsverfahren. Parallel<br />
dazu können weitere Zulassungserfordernisse, etwa baurechtlicher,<br />
wasserrechtlicher oder naturschutzrechtlicher<br />
Art einschlägig sein.<br />
»»<br />
Eine Rohrleitung, die Einrichtung eines Bergbaubetriebs<br />
ist und eine UVP erfordert, ist bergrechtlich planfestzustellen;<br />
andere Planfeststellungsverfahren werden gem.<br />
§ 57b Abs. 3 S. 1 BBergG durch das bergrechtliche<br />
Planfeststellungsverfahren verdrängt.<br />
»»<br />
Eine Rohrleitung, die Einrichtung eines Bergbaubetriebs<br />
ist und keine UVP erfordert, ist unter den Voraussetzungen<br />
des § 20 Abs. 2 S. 1 UVPG plangenehmigungspflichtig<br />
und unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 S. 1<br />
KSpG planfeststellungspflichtig. Plangenehmigung oder<br />
Planfeststellung konzentrieren dann die erforderliche<br />
konventionelle bergrechtliche Betriebsplanzulassung.<br />
»»<br />
Eine Rohrleitung, die Einrichtung eines Bergbaubetriebs ist<br />
und keine UVP und auch keine Plangenehmigung gem.<br />
§ 20 Abs. 2 S. 1 UVPG oder Planfeststellung gem.<br />
§ 4 Abs. 1 S. 1 KSpG erfordert, ist durch konventionelle<br />
Betriebsplanzulassung – ohne Planfeststellung<br />
– zuzulassen.<br />
2. TRANSIT-ROHRLEITUNGEN<br />
Um Transit-Rohrleitungen handelt es sich gem. § 4 Abs. 10<br />
BBergG bei Rohrleitungen, die vom Festlandsockel oder<br />
vom Gebiet eines anderen Staates in den Festlandsockel<br />
der Bundesrepublik Deutschland führen oder diesen durchqueren;<br />
erfasst werden damit nur im Festlandsockel der<br />
Bundesrepublik anlandende bzw. diesen durchquerende<br />
5 Rohöl ist mit dem Gefahrenmerkmal T gekennzeichnet und damit gem. § 2 Abs.<br />
1 S. 2 RohrFLtgV ein wassergefährdender Stoff.<br />
04-05 / 2013 45
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
Planung einer Rohrleitung, die einem<br />
Bergbaubetrieb dient, § 2 Abs. 1 Nr. 3 BBergG<br />
Abgabe<br />
an Dritte oder nicht<br />
bergbauliche Betriebe<br />
des Unternehmers?<br />
Nein<br />
UVP-pflichtig?<br />
Nein<br />
Planfeststellungs- oder<br />
Plangenehmigungserfordernis<br />
nach sonstigen<br />
Gesetzen?<br />
Nein<br />
Konventionelle Betriebsplanzulassung<br />
Ja<br />
Ja<br />
Bergrecht aufgrund § 2 Abs. 4 Nr. 5<br />
BBergG nicht einschlägig;<br />
Zulassungserfordernisse nach<br />
sonstigen Rechtsgebieten<br />
Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren,<br />
das andere Planfeststellungsverfahren<br />
gem. § 57b Abs. 3 S. 1 BBergG verdrängt<br />
Planfeststellung oder Plangenehmigung<br />
konzentriert bergrechtliche<br />
Betriebsplanzulassung<br />
Bild 1: Zulassungserfordernisse für bergbauliche Rohrleitungen<br />
Ja<br />
Leitungen, nicht auch vom Festland bzw. vom Festlandsockel<br />
der Bundesrepublik abgehende Leitungen. 6<br />
Der Festlandsockel stellt den äußersten Bereich staatlicher<br />
Hoheitsbefugnisse dar. Hoheitsbefugnisse hat jeder Staat im<br />
Bereich seines Staatsgebiets, welches das Festland und bei<br />
Küstenstaaten das sich daran anschließende Küstenmeer, die<br />
12-Meilen-Zone, umfasst. 7 Außerhalb der 12-Meilen-Zone<br />
schließt sich der Festlandsockel an. Dabei handelt es sich um<br />
den unter dem Meeresspiegel liegenden Meeresboden und<br />
-untergrund eines Küstenstaates jenseits des Küstenmeeres<br />
mit einer Entfernung von max. 350 Seemeilen. 8 Er gehört<br />
nicht zum Staatsgebiet der Küstenstaaten. Die Küstenstaaten<br />
üben aber über den Festlandsockel souveräne und<br />
ausschließliche Rechte und Hoheitsbefugnisse zum Zwecke<br />
seiner Erforschung und der Ausbeutung seiner natürlichen<br />
Ressourcen aus. 9 Die Küstenstaaten können Vorgaben bei<br />
der Verlegung von Rohrleitungen anordnen. 10<br />
Transit-Rohrleitungen unterliegen den in § 133 Abs. 1 S. 1<br />
BBergG geregelten Zulassungsverfahren. Die in § 133 Abs.<br />
1 S. 1 Nrn. 1 und 2 BBergG geregelten zwei Zulassungsverfahren<br />
sind nicht deshalb im Bundesberggesetz geregelt,<br />
weil es sich bei Transit-Rohrleitungen um bergbauliche<br />
Einrichtungen handelte. Die unter 1. behandelten spezi-<br />
6 Wolf, ZUR 2007, 24, 26 u. ZUR 2004, 65, 66; Keienburg in: Boldt/Weller/<br />
Kühne/von Mäßenhausen, BBergG-Kommentar, 2. Auflage, Erscheinungsdatum<br />
voraussichtlich 2013, § 4 Rn. 48 f.<br />
7 Die Bundesrepublik Deutschland beansprucht in Ausnutzung von Art. 3 des<br />
Seerechtsübereinkommens (SRÜ) aufgrund unilateraler Proklamation der<br />
Bundesregierung vom 19.10.1994 (BGBl I S. 3428) seit dem 01.01.1995 als<br />
Küstenmeer der Nordsee eine 12-Meilen-Zone als Hoheitsgebiet. Für die Ostsee<br />
bleibt die seewärtige Begrenzung des Küstenmeeres in der Proklamation<br />
teilweise unterhalb der 12-Meilen-Zone.<br />
8 Vgl. Art. 76 Abs. 1 und 6 SRÜ.<br />
9 Vgl. Art. 77 Abs. 1 und 2 SRÜ.<br />
10 Vgl. Art. 79 Abs. 2 u. 3 SRÜ.<br />
fisch bergrechtlichen Betriebsplanzulassungsverfahren für<br />
bergbauliche Betriebe und diesen dienende Einrichtungen,<br />
auch Rohrfernleitungen, sind für Transit-Rohrleitungen nicht<br />
einschlägig. Vielmehr unterliegen Transit-Rohrleitungen<br />
ganz unabhängig von einem Bezug zu einem Bergbaubetrieb<br />
dem Bundesberggesetz, um die der Bundesrepublik<br />
Deutschland im Bereich ihres Festlandsockels zustehenden<br />
Rechte und Hoheitsbefugnisse zum Zwecke der Erforschung<br />
und Ausbeutung der natürlichen Ressourcen des Festlandsockels<br />
zu wahren. 11<br />
Zwei parallele Genehmigungserfordernisse<br />
Gem. § 133 Abs. 1 S. 1 Nrn. 1 und 2 BBergG erfordern<br />
Errichtung und Betrieb einer Transit-Rohrleitung eine Genehmigung<br />
in bergbaulicher Hinsicht und eine Genehmigung<br />
hinsichtlich der Nutzung der Gewässer und des Luftraums<br />
über dem Festlandsockel: „Die Errichtung und der Betrieb<br />
einer Transit-Rohrleitung in oder auf dem Festlandsockel<br />
bedarf einer Genehmigung<br />
1. in bergbaulicher Hinsicht und<br />
2. hinsichtlich der Ordnung der Nutzung und Benutzung der<br />
Gewässer über dem Festlandsockel und des Luftraumes<br />
über diesen Gewässern.“<br />
Für das Genehmigungserfordernis irrelevant sind die Länge<br />
der Transit-Rohrleitung, ihr Durchmesser und der zu befördernde<br />
Stoff. Jede Rohrleitung, die die in § 4 Abs.10 BBergG<br />
definierten Voraussetzungen einer Transit-Rohrleitung<br />
erfüllt, bedarf im Bereich des Festlandsockels der in § 133<br />
Abs. 1 S. 1 Nrn. 1 und 2 BBergG normierten Genehmigungen,<br />
für deren Erteilung in bergbaulicher Hinsicht die<br />
für den Festlandsockel zuständige Landesbehörde 12 und<br />
in Bezug auf Gewässer und Luftraum das Bundesamt für<br />
Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) 13 zuständig ist.<br />
UVP im Genehmigungsverfahren des BSH<br />
Dem zu befördernden Stoff sowie Länge und Durchmesser<br />
einer Transit-Rohrleitung kommen aber – wie immer – Relevanz<br />
bei der Frage der UVP-Pflicht einer Transit-Rohrleitung<br />
zu. Transit-Rohrleitungen unterliegen gem. § 133 Abs. 2a<br />
S. 1 BBergG ebenso wie sonstige Rohrleitungen den Ziffern<br />
19.2 ff. der Anlage 1 der UVPG. Sie erfordern damit ggf.<br />
längen- und/oder durchmesserabhängig eine zwingende<br />
UVP oder eine Vorprüfung. Bei der Würdigung der Länge ist<br />
die Gesamtlänge der Leitung in die Betrachtung einzustellen<br />
und damit auch ein etwaiger weiterer Verlauf der Leitung<br />
im Küstenmeer oder auf dem Festland, 14 der, wie noch<br />
11 Das Bundesberggesetz ist gemäß § 2 Abs. 3 BBergG auf den Festlandsockel<br />
anwendbar. Die in § 2 Abs. 3 BBergG enthaltene sog. Erstreckungsregelung<br />
ist erforderlich, um die Anwendbarkeit des Gesetzes auf den Festlandsockel<br />
zu begründen; ohne Erstreckungsregelung sind nationale Gesetze im Bereich<br />
des Festlandsockels, der nicht zum staatlichen Hoheitsgebiet gehört, nicht<br />
anwendbar; dazu Wolf, ZUR 2007, 24, 28 f.<br />
12 § 133 Abs. 1 S. 2 BBergG: Zuständige Bergbehörde ist im Bereich der Nordsee<br />
das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie des Landes Niedersachsen<br />
(LBEG), das aufgrund Verwaltungsabkommens zuständige Bergbehörde in den<br />
Ländern Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein ist, bzw. im<br />
Bereich der Ostsee das Bergamt Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern.<br />
13 § 133 Abs. 1 S. 2 BBerg<br />
14 EuGH, NuR 2010, 405, 407; Wolf, ZUR 2007, 24, 30.<br />
46 04-05 / 2013
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
darzulegen ist, mit den Genehmigungen<br />
nach § 133 Abs. 1 S.<br />
1 BBergG nicht legitimiert wird.<br />
Ist eine UVP entweder aufgrund<br />
Erreichens der X-Schwellenwerte<br />
einer zwingenden UVP oder<br />
aufgrund einer Vorprüfung erforderlich,<br />
wird diese gem. § 133<br />
Abs. 2a S. 1 BBergG in das vom<br />
BSH gem. § 133 Abs. 1 S. 1 Nr. 2<br />
BBergG durchzuführende Genehmigungsverfahren<br />
integriert.<br />
Ein Planfeststellungsverfahren<br />
findet auch im Falle einer UVP-<br />
Pflicht einer Transit-Rohrleitung<br />
– anders als in § 43 S. 1 Nr. 2<br />
EnWG und § 20 Abs. 1 UVPG für<br />
UVP-pflichtige Gasversorgungsleitungen<br />
und Rohrfernleitungen<br />
geregelt – nicht statt. Die im Falle<br />
einer UVP gem. § 9 Abs. 1 UVPG<br />
erforderliche Öffentlichkeitsbeteiligung<br />
wird mit den in § 133<br />
Abs. 2a S. 2 und 3 BBergG geregelten<br />
Modifikationen im Genehmigungsverfahren<br />
des BSH durchgeführt.<br />
Rohrleitung, die vom Festlandsockel oder<br />
dem Gebiet eines anderen Staates in den<br />
Festlandsockel der Bundesrepublik führt<br />
oder diesen durchquert,<br />
§ 4 Abs. 10 BBergG<br />
Bei Fortführung der Leitung im Bereich<br />
des Küstenmeeres der Bundesrepublik<br />
Bei Fortführung der Leitung im Bereich des<br />
Festlands der Bundesrepublik<br />
Zusätzliche Genehmigungserfordernisse für Rohrleitungen<br />
außerhalb des Festlandsockels<br />
Die Genehmigungsverfahren gem. § 133 Abs. 1 S. 1 BBergG<br />
erfassen ausweislich des Wortlauts der Norm allein die<br />
„in oder auf dem Festlandsockel“ verlaufende Rohrleitung<br />
und damit regelmäßig nur ein Teilstück der gesamten<br />
Rohrleitung. Wird die Rohrleitung im Bereich des Küstenmeeres<br />
und/oder auf dem Festland fortgeführt, ist dafür<br />
das jeweils einschlägige Zulassungsverfahren durchzuführen,<br />
im Falle einer Gasversorgungsleitung i.S.d. § 43 S. 1<br />
Nr. 2 EnWG also das energiewirtschaftliche Planfeststellungsverfahren<br />
und im Falle einer Rohrfernleitung i.S.d. §<br />
20 UVPG das im UVPG geregelte Planfeststellungs- oder<br />
Plangenehmigungsverfahren.<br />
» Die für eine Transit-Rohrleitung in oder auf dem Festlandsockel<br />
erforderlichen Genehmigungen gem. § 133<br />
Abs. 1 S. 1 Nrn. 1 und 2 BBergG erfassen nur den<br />
Rohrleitungsteil im Bereich des Festlandsockels und nicht<br />
eine mögliche Fortführung der Rohrleitung im Bereich<br />
des Küstenmeeres oder auf dem Festland. Dafür bedarf<br />
es gesonderter Zulassungen, die sich abhängig von dem<br />
zu befördernden Stoff und der UVP-Pflicht aus § 43<br />
S. 1 Nr. 2 EnWG oder § 20 Abs. 1 und 2 UVPG ergeben<br />
können.<br />
3. KOHLENDIOXIDLEITUNGEN<br />
Am 24.08.2012 ist das Gesetz zur Demonstration der dauerhaften<br />
Speicherung von Kohlendioxid – Kohlendioxidspeichergesetz<br />
(KSpG) in Kraft getreten. Dieses verhält sich u.a.<br />
Bild 2: Zulassungserfordernisse für Transit-Rohrleitungen<br />
Bergbauliche Genehmigung gem.<br />
§ 133 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BBergG und<br />
zusätzliche Genehmigung zur<br />
Benutzung des Gewässers und des<br />
Luftraums gem. § 133 Abs. 1 S. 1<br />
Nr. 2 BBergG<br />
Zulassungsverfahren in Abhängigkeit<br />
von den Voraussetzungen des § 43<br />
S. 1 Nr. 2 EnWG oder des § 20<br />
Abs. 1, 2 UVPG<br />
Zulassungsverfahren in Abhängigkeit<br />
von den Voraussetzungen des § 43<br />
S. 1 Nr. 2 EnWG oder des § 20<br />
Abs. 1, 2 UVPG<br />
zu Kohlendioxidleitungen, um die es sich ausweislich der<br />
Legaldefinition in § 3 Nr. 6 KSpG nur bei Leitungen zum<br />
Transport des Kohlendioxidstroms zu einem Kohlendioxidspeicher<br />
einschließlich den erforderlichen Verdichter- und Druckerhöhungsstationen<br />
handelt. Sonstige Rohrleitungen zum<br />
Befördern von Kohlendioxid, die nicht dem Transport zu einem<br />
Kohlendioxidspeicher dienen, sondern eine Produktenleitung<br />
darstellen, unterliegen dem Kohlendioxidspeichergesetz nicht.<br />
Planfeststellungserfordernis<br />
§ 4 Abs. 1 S. 1 KSpG regelt das Erfordernis eines Planfeststellungsverfahrens<br />
für Errichtung und Betrieb sowie<br />
die wesentliche Änderung einer Kohlendioxidleitung i.S.d.<br />
Kohlendioxidspeichergesetzes: „Errichtung, Betrieb und<br />
wesentliche Änderung von Kohlendioxidleitungen bedürfen<br />
der vorherigen Planfeststellung durch die zuständige<br />
Behörde.“ Unter den Voraussetzungen der ebenfalls zum<br />
24.08.2012 in Kraft getretenen neuen Ziffer 19.10 der<br />
Anlage 1 des UVPG ist zudem eine Umweltverträglichkeitsprüfung<br />
erforderlich. Diese ist zwingend für Kohlendioxidleitungen<br />
mit einer Länge von mehr als 40 km und<br />
einem Durchmesser von mehr als 800 mm (Ziffer 19.10.1).<br />
Bei einer Länge ab 2 km und einem Durchmesser von mehr<br />
als 150 mm erfordert eine Kohlendioxidleitung, die nicht die<br />
kumulativen Voraussetzungen der Ziffer 19.10.1 erfüllt, eine<br />
allgemeine Vorprüfung (Ziffern 19.10.2. und 19.10.3). Eine<br />
Kohlendioxidleitung mit einer Länge von weniger als 2 km<br />
und einem Durchmesser von mehr als 150 mm unterliegt<br />
einer standortbezogenen Vorprüfung (Ziffer 19.10.4). Eine<br />
Kohlendioxidleitung mit einem Durchmesser von max. 150<br />
mm erfordert im Umkehrschluss keinesfalls eine UVP.<br />
Das Planfeststellungsverfahren gem. § 4 Abs. 1 S. 1 KSpG<br />
04-05 / 2013 47
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
Planung CO 2 -Leitung zum<br />
Transport von CO 2 zu einem<br />
CO 2 -Speicher<br />
UVP-<br />
Pflicht?<br />
Bedeutung<br />
Nein<br />
Wesentlich<br />
Planfeststellung gemäß<br />
§ 4 Abs. 1 S. 1 KSpG<br />
Ja<br />
Unwesentlich<br />
Planfeststellung gemäß<br />
§ 4 Abs. 1 S. 1 KSpG<br />
Planfeststellungspflicht entfällt<br />
gemäß § 74 Abs. 7 S. 1 VwVfG<br />
Bild 3: Zulassungserfordernisse für Kohlendioxidleitungen<br />
ist nur von den Voraussetzungen Errichtung, Betrieb oder<br />
wesentliche Änderung einer Kohlendioxidleitung abhängig<br />
und damit grundsätzlich unabhängig von Länge und Durchmesser<br />
der Kohlendioxidleitung und unabhängig von einer<br />
etwaigen UVP-Pflicht durchzuführen.<br />
» Kohlendioxidleitungen i.S.d. § 3 Nr. 6 KSpG sind gem.<br />
§ 4 Abs. 1 S. 1 KSpG grundsätzlich planfestzustellen.<br />
Plangenehmigung<br />
Gemäß § 4 Abs. 2 S. 2 KSpG gilt § 11 Abs. 2 KSpG und<br />
damit die Vorschrift, die die Voraussetzungen der Ersetzung<br />
des Planfeststellungsverfahrens für einen Kohlendioxidspeicher<br />
durch ein Plangenehmigungsverfahren normiert, für<br />
Kohlendioxidleitungen entsprechend.<br />
Voraussetzung eines Plangenehmigungsverfahrens anstelle<br />
eines Planfeststellungsverfahrens ist im Falle eines Kohlendioxidspeichers<br />
gem. § 11 Abs. 2 Nr. 1 KSpG zunächst,<br />
dass es sich bei dem zuzulassenden Vorhaben um eine<br />
wesentliche Änderung handelt; Errichtung und Betrieb<br />
eines Kohlendioxidspeichers sind im Umkehrschluss nicht<br />
durch Plangenehmigung, sondern nur durch Planfeststellung<br />
zulassungsfähig. Weitere Voraussetzungen sind<br />
gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 2 KSpG, dass Rechte anderer nicht<br />
beeinträchtigt werden oder die Betroffenen sich mit der<br />
Inanspruchnahme ihres Rechts schriftlich einverstanden<br />
erklärt haben und gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 3 KSpG, dass mit<br />
den Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich<br />
berührt wird, das Benehmen hergestellt worden ist. Diese<br />
Voraussetzungen entsprechen exakt den in § 74 Abs. 6<br />
S. 1 Nrn. 1 und 2 VwVfG geregelten Voraussetzungen<br />
einer Plangenehmigung, die auch im Rahmen des Zulassungsverfahrens<br />
von Gasversorgungsleitungen i.S.d. § 43<br />
S. 1 Nr. 2 EnWG anwendbar sind; auf die Ausführungen<br />
dazu in der <strong>3R</strong>-Ausgabe 1-2/2013 unter Punkt 3. kann<br />
verwiesen werden. Schließlich darf gem. § 11 Abs. 2 Nr. 4<br />
KSpG keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung<br />
bestehen. Auch dies ist eine generelle<br />
Voraussetzung der Plangenehmigung, da UVP-pflichtige<br />
Vorhaben eine Öffentlichkeitsbeteiligung erfordern, die<br />
in einem Planfeststellungsverfahren, aber nicht in einem<br />
Plangenehmigungsverfahren durchgeführt wird; auch dazu<br />
kann auf die Ausführungen in den <strong>3R</strong>-Ausgaben 1-2/2013<br />
und 3/2013, jeweils unter Punkt 3., verwiesen werden.<br />
Die Besonderheit des § 11 Abs. 2 KSpG liegt in der in Nr.<br />
1 enthaltenen Beschränkung des Plangenehmigungsverfahrens<br />
auf wesentliche Änderungen mit der Folge, dass<br />
Errichtung und Betrieb zwingend planfeststellungspflichtig<br />
sind. Diese Einschränkung ist für Kohlendioxidspeicher konsequent,<br />
da Errichtung und Betrieb von Kohlendioxidspeichern<br />
gemäß Ziffer 15.2 der Anlage 1 des UVPG zwingend UVPpflichtig<br />
sind und daher eine Zulassung in einem Verfahren<br />
mit Öffentlichkeitsbeteiligung erfordern, die ein Plangenehmigungsverfahren<br />
gerade nicht beinhaltet. Errichtung und<br />
Betrieb von Kohlendioxidleitungen erfordern dagegen nicht<br />
zwingend eine UVP, sondern nur in Abhängigkeit von den<br />
Schwellenwerten der Ziffer 19.10 der Anlage 1 des UVPG<br />
und einer ggf. durchzuführenden Vorprüfung. Daher besteht<br />
kein rechtliches Erfordernis, Errichtung und Betrieb von Kohlendioxidleitungen<br />
ebenso wie Errichtung und Betrieb von<br />
Kohlendioxidspeichern zwingend einer Planfeststellung ohne<br />
die Möglichkeit einer Ersetzung durch Plangenehmigung zu<br />
unterwerfen. Derartig enge Regelungen existieren auch für<br />
die in den <strong>3R</strong>-Ausgaben 1-2/2013 und 3/2013 behandelten<br />
Gasversorgungsleitungen i.S.d. § 43 S. 1 Nr. 2 EnWG und<br />
Rohrleitungen i.S.d. § 20 UVPG nicht, weshalb auch eine<br />
der Beförderung von Kohlendioxid als Produkt dienende<br />
Leitung dann, wenn sie nicht gemäß Ziffer 19.5 der Anlage<br />
1 des UVPG UVP-pflichtig ist, keine Planfeststellung, sondern<br />
allenfalls eine Plangenehmigung gemäß § 20 Abs. 2 UVPG<br />
erfordert. Aus welchem Grund für eine Kohlendioxidleitung<br />
i.S.d. § 3 Nr. 6 KSpG strengere Anforderungen gelten sollten,<br />
erschließt sich nicht. Aber die Inbezugnahme des gesamten<br />
§ 11 Abs. 2 in § 4 Abs. 2 S. 2 KSpG impliziert, dass alle Voraussetzungen<br />
des § 11 Abs. 2 KSpG für die Plangenehmigung<br />
einer Kohlendioxidleitung erfüllt sein müssen und damit nur<br />
wesentliche Änderungen plangenehmigungsfähig sind und<br />
umgekehrt Errichtung und Betrieb einer Kohlendioxidleitung<br />
zwingend planfeststellungspflichtig sind. 15<br />
» Eine Plangenehmigung von Errichtung und Betrieb<br />
einer Kohlendioxidleitung i.S.d. § 3 Nr. 6 KSpG dürfte<br />
aufgrund der Beschränkung der Plangenehmigung auf<br />
wesentliche Änderungen in § 11 Abs. 2 Nr. 1 KSpG, worauf<br />
§ 4 Abs. 2 S. 2 KSpG verweist, ausgeschlossen sein.<br />
15 In der amtlichen Gesetzesbegründung in BT-Drs. 17/6507, S. 11, ist zur<br />
Erläuterung des Verweises auf § 11 Abs. 2 in § 4 Abs. 2 S. 2 KSpG ausgeführt: „Mit<br />
dem Verweis auf § 11 Absatz 2 wird sichergestellt, dass bei Kohlendioxidspeichern<br />
und Kohlendioxidleitungen jeweils aus denselben Gründen anstelle eines<br />
Planfeststellungsbeschlusses eine Plangenehmigung erteilt werden kann.“<br />
48 04-05 / 2013
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
Themenübersicht 2013<br />
Entfall von Planfeststellung und Plangenehmigung<br />
Eine Ausnahme von dem Planfeststellungs- oder Plangenehmigungserfordernis<br />
gilt auch im Falle von Errichtung und<br />
Betrieb einer Kohlendioxidleitung dann, wenn es sich um<br />
einen Fall von unwesentlicher Bedeutung handelt. In Fällen<br />
unwesentlicher Bedeutung entfällt gemäß § 74 Abs. 7 S. 1<br />
VwVfG generell das Erfordernis von Planfeststellung und<br />
Plangenehmigung. Dies gilt bei Gasversorgungsleitungen<br />
i.S.d. § 43 S. 1 Nr. 2 EnWG, bei Rohrfernleitungen i.S.d. § 20<br />
UVPG und auch bei Kohlendioxidleitungen i.S.d. § 3 Nr. 6<br />
KSpG. Rechtssystematische Voraussetzung dafür ist, dass das<br />
jeweilige Vorhaben nicht UVP-pflichtig ist, da eine UVP eine<br />
Öffentlichkeitsbeteiligung und damit ein Planfeststellungsverfahren<br />
erfordert. Weitere Voraussetzung ist, dass die in § 74<br />
Abs. 7 S. 2 Nrn. 1 und 2 VwVfG geregelten Kriterien erfüllt<br />
sind, d.h. andere öffentliche Belange nicht berührt werden<br />
oder die erforderlichen behördlichen Entscheidungen vorliegen<br />
und dem Plan nicht entgegen stehen (§ 74 Abs. 7 S. 2<br />
Nr. 1 VwVfG) und Rechte anderer nicht beeinflusst werden<br />
oder mit den Betroffenen entsprechende Vereinbarungen<br />
getroffen worden sind (§ 74 Abs. 7 S. 2 Nr. 2 VwVfG). Zu<br />
bedenken ist im Falle der Entbehrlichkeit von Planfeststellung<br />
und Plangenehmigung, dass sich Zulassungserfordernisse<br />
aus anderen Gesetzen ergeben können. Auf die vorherigen<br />
Ausführungen in <strong>3R</strong>-Ausgaben 1-2/2013 und 3/2013, jeweils<br />
unter Punkt 4., kann verwiesen werden.<br />
4. ZUSAMMENFASSUNG<br />
Die in <strong>3R</strong>-Ausgabe 1-2/2013 behandelten Gasversorgungsleitungen<br />
mit einem Durchmesser von mehr als 300 mm<br />
erfordern grundsätzlich eine Planfeststellung gem. § 43 S. 1<br />
Nr. 2 EnWG, ggf. nur eine Plangenehmigung (§ 43b Nr. 2<br />
EnWG) und in Fällen unwesentlicher Bedeutung weder Planfeststellung<br />
noch Plangenehmigung (§ 74 Abs. 7 VwVfG).<br />
Die in <strong>3R</strong>-Ausgabe 3/2013 behandelten Rohrfernleitungen<br />
i.S.d. § 20 UVPG erfordern dann, wenn sie UVP-pflichtig sind,<br />
gemäß § 20 Abs. 1 UVPG eine Planfeststellung, anderenfalls<br />
nur eine Plangenehmigung (§ 20 Abs. 2 S. 1 UVPG) und in<br />
Fällen unwesentlicher Bedeutung – vorbehaltlich des Transports<br />
wassergefährdender Stoffe – weder eine Planfeststellung<br />
noch eine Plangenehmigung (§ 20 Abs. 2 S. 2 UVPG).<br />
Kohlendioxidleitungen i.S.d. § 3 Nr. 6 KSpG erfordern für<br />
Errichtung und Betrieb gemäß § 4 Abs. 1 S. 1 KSpG grundsätzlich<br />
eine Planfeststellung, die nur in Fällen unwesentlicher<br />
Bedeutung entfällt (§ 74 Abs. 7 VwVfG); das Plangenehmigungsverfahren<br />
scheint aufgrund des Verweises<br />
in § 4 Abs. 2 S. 2 auf § 11 Abs. 2 KSpG auf Fälle einer<br />
nachträglichen wesentlichen Änderung beschränkt zu sein.<br />
Handelt es sich bei einer der vorstehenden Rohrleitungen<br />
um eine einem Bergbaubetrieb dienende Einrichtung, die<br />
unter den Geltungsbereich des Bundesberggesetzes fällt<br />
und eine UVP erfordert, ist das dann durchzuführende bergrechtliche<br />
Planfeststellungsverfahren vorrangig vor anderen<br />
Planfeststellungsverfahren. Ist eine unter den Anwendungsbereich<br />
des BBergG fallende Rohrleitung nicht UVP-pflichtig,<br />
ist kein bergrechtliches Planfeststellungsverfahren durchzuführen.<br />
Dann ist zu prüfen, ob ein Planfeststellungs- oder<br />
Zulassungsverfahren für Errichtung und Betrieb von Rohrfernleitungen<br />
- Teil 1: Gasversorgungsleitungen im Sinne des EnWG<br />
<strong>3R</strong>, Ausgabe 1-2/2013, S. 36-41<br />
Zulassungsverfahren für Errichtung und Betrieb von Rohrfernleitungen -<br />
Teil 2: Rohrfernleitungen i.S.d. Ziffern 19.3 bis 19.8 der Anlage 1 des UVPG<br />
<strong>3R</strong>, Ausgabe 3/2013, S. 36-39<br />
Zulassungsverfahren für Errichtung und Betrieb von Rohrfernleitungen<br />
- Teil 3: Anforderungen des Bundesberggesetzes (BBergG) und des<br />
Kohlendioxidspeichergesetzes (KSpG)<br />
<strong>3R</strong>, Ausgabe 4-5/2013, S. 44-49<br />
Änderung von Rohrfernleitungen - Teil 1: Zulassungserfordernisse<br />
und Zulassungsverfahren<br />
<strong>3R</strong>, Ausgabe 6/2013, Erscheinungstermin 10. Juni 2013<br />
Änderung von Rohrfernleitungen - Teil 2: Die UVP-Relevanz von<br />
Änderungen<br />
<strong>3R</strong>, Ausgabe 7-8/2013, Erscheinungstermin 13. August 2013<br />
Änderung von Rohrfernleitungen - Teil 3: Die Änderung von<br />
Rohrfernleitungen zum Befördern wassergefährdender Stoffe, § 20<br />
Abs. 2 S. 4 UVPG<br />
<strong>3R</strong>, Ausgabe 9/2013, Erscheinungstermin 16. September 2013<br />
Konversion - Wo verläuft die Grenze zwischen Änderung und Aliud?<br />
<strong>3R</strong>, Ausgabe 10/2013, Erscheinungstermin 15. Oktober 2013<br />
Rechtliche Konsequenzen von Fehlern des Zulassungsverfahrens<br />
<strong>3R</strong>, Ausgabe 11-12/2013, Erscheinungstermin 12. November 2013<br />
Plangenehmigungsverfahren nach § 20 Abs. 1, 2 UVPG<br />
bzw. § 4 Abs. 1 S. 1 KSpG erforderlich ist und konzentriert<br />
dieses Verfahren die bergrechtlich erforderliche Zulassung.<br />
Eine Transit-Rohrleitung erfordert für die Anlandung auf<br />
dem Festlandsockel bzw. dessen Querung zwei parallele<br />
Zulassungen nach § 133 Abs. 1 S. 1 Nrn. 1 und 2 BBergG.<br />
Wird die Rohrleitung im Anschluss an den Festlandsockel<br />
im Küstenmeer oder auf dem Festland der Bundesrepublik<br />
fortgeführt, wird dies nicht über die Genehmigungen nach<br />
§ 133 Abs. 1 S. 1 Nrn. 1 und 2 BBergG legitimiert, sondern<br />
es sind Zulassungserfordernisse nach EnWG oder UVPG zu<br />
prüfen und es gilt für eine Transit-Rohrleitung Gleiches wie<br />
für sonstige Rohrleitungen.<br />
AUTOREN<br />
Dr. BETTINA KEIENBURG<br />
Kümmerlein Rechtsanwälte & Notare, Essen<br />
Tel. +49 201 1756-624<br />
E-Mail: bettina.keienburg@kuemmerlein.de<br />
Dr. MICHAEL NEUPERT<br />
Kümmerlein Rechtsanwälte & Notare, Essen<br />
Tel. +49 201 1756-624<br />
E-Mail: michael.neupert@kuemmerlein.de<br />
04-05 / 2013 49
FACHBERICHT RECHT SPECIAL & ROHRLEITUNGSBAU REGELWERK AKTUELL<br />
Kabellose dezentrale Automatisierung<br />
erdverlegter Gasarmaturen in Sankt<br />
Petersburg<br />
Ein Pilotprojekt zur kabellosen dezentralen Automatisierung von Gasarmaturen hat 3S Antriebe erfolgreich bei PetersburgGaz<br />
abgeschlossen. Die 3S-Energie Save Technology ermöglicht im Stellbetrieb eine Akkustromversorgung der 3S-Antriebe<br />
über ein Jahr ohne Nachladen bei ständiger Erreichbarkeit. Die Antriebe werden per GSM/GPRS angesteuert und sind<br />
über die verwendete x-active-Technologie des Partnerunternehmens ettex GmbH mittels einer OPC-Software-Schnittstelle<br />
direkt in den Leitstand von PetersburgGaz integriert. Der Ladezustand der Akkus wird neben anderen Betriebsdaten der<br />
Antriebe in den Leitstand übermittelt. Externe Steuerrechner (SPS) sind unnötig und Stromnetzanschlüsse kommen nur<br />
vereinzelt zum Einsatz. Für den Unterflur-Einsatz der Antriebe sind keine Schachtbauwerke erforderlich.<br />
PROJEKTANFORDERUNGEN<br />
Im Rahmen des Pilotprojektes sollten in zwei Schritten 13<br />
Armaturen mit Nennweiten zwischen DN 100 und DN 500<br />
teils im Nieder- teils im Hochdrucknetz von PetersburgGaz<br />
automatisiert und in den Leitstand eingebunden werden. Ziel<br />
der Maßnahme war zum einen, durch die Automatisierung<br />
der Armaturen vor allem aus Sicherheitserwägungen eine<br />
zentrale Kontrolle über das Netz zu erhalten. Dabei sollte<br />
aus Kostengründen auf das Verlegen von Strom- und<br />
Kommunikationsanschlüssen verzichtet werden; bevorzugt<br />
wurde eine Steuerung über GSM/GPRS. Zum anderen<br />
sollte der Rückbau der bestehenden, zum Teil dringend<br />
instandsetzungsbedürftigen Schächte durchgeführt werden.<br />
Bild 1: Schematische Darstellung der Einbindung<br />
der Antriebe über Mobilfunk<br />
Schließlich musste eine Diebstahlsicherung realisiert werden,<br />
die das unerlaubte Öffnen des Deckels über den Antrieben<br />
in den Leitstand meldet. Für zwei der 13 Antriebe standen<br />
Stromnetzanschlüsse zur Verfügung. Elf Antriebe sollten<br />
dezentral mit Akkus ohne lokale Energiewandler versorgt<br />
werden. Die beiden mit Netzstrom versorgten Antriebe<br />
sowie ein mit Akkuspannung versorgter Antrieb sollten<br />
oberirdisch direkt auf die Armatur geflanscht werden. Der<br />
Rest sollte ohne Schacht unterflur eingebaut werden.<br />
ENERGY SAFE TECHNOLOGIE<br />
Die genannten Projektanforderungen hinsichtlich der<br />
dezentralen Antriebe ließen sich hervorragend durch 3S-500<br />
D-Stellantriebe realisieren, die mit der neuen Energy Save<br />
Technology ausgerüstet sind. Diese Technologie ermöglicht<br />
bei akkustromversorgten 3S-Stellantrieben, die über x-active<br />
via GSM/GPRS angesteuert werden, einen extrem geringen<br />
Stand-by-Verbrauch bei ständiger Erreichbarkeit. Realisiert wird<br />
dies dadurch, dass im Stand-by-Betrieb alle Steuerungsteile<br />
des Antriebs spannungslos geschaltet werden, die für das<br />
Empfangen eines Stellbefehls nicht erforderlich sind.<br />
Die Stromversorgung erfolgt bei elf der 13 Antriebe durch<br />
einen Akkupack 1400. Hierbei handelt es sich um einen von der<br />
3S Antriebe GmbH selbst entwickelten Akku der Schutzklasse<br />
IP68 mit Li-Ionen-Zellen und einer Kapazität von 1.450 Wh.<br />
Der Akku verfügt über ein vollständiges Batteriemanagement,<br />
das neben der Ladung und Entladung der Li-Ionen-Zellen auch<br />
alle relevanten Zustandsdaten, insbesondere Ladezustand,<br />
Temperatur und Feuchtigkeit überwacht.<br />
Ein mit dieser Energy Save Technology ausgerüsteter<br />
Stellantrieb lässt sich mit diesem Akkupack deutlich über<br />
ein Jahr im Stand-By-Betrieb bei ständiger Erreichbarkeit<br />
und wöchentlicher Übermittlung der Zustandsdaten von<br />
Antrieb und Akku betreiben, selbst im Falle eines neuen<br />
Gas-Schieber DN 500 PN 16 im Stellbetrieb. Das bedeutet,<br />
dass im Falle von weniger als zehn jährlichen Stellungen ein<br />
Nachladen des Akkus oder dessen Austausch nicht häufiger<br />
als einmal im Jahr erforderlich ist.<br />
50 04-05 / 2013
SPECIAL ROHRLEITUNGSBAU RECHT & REGELWERK AKTUELL FACHBERICHT<br />
Mit einem selbst entwickelten Laderegler lässt sich der<br />
3S-Akkupack 1400 auch mit sehr geringen Ladeleistungen<br />
nachladen. Dadurch kann beim Einsatz von dezentralen<br />
Energiewandlern wie beispielsweise Solarpanels oder<br />
Thermogeneratoren in Fernwärmeschächten auf<br />
weiteres Nachladen völlig verzichtet werden. Dezentrale<br />
Energiewandler kamen beim Projekt in Sankt Petersburg<br />
vorerst nicht zum Einsatz.<br />
OPTIMIERTE MOBILFUNKTECHNOLOGIE<br />
Mobilfunktechnologien zur Einbindung von Antrieben,<br />
Sensor- und Zählerdaten in ein Feldbussystem existieren<br />
schon länger. Die Informationen einer SPS werden dabei<br />
mit Hilfe eines Modems an einen Empfänger übertragen.<br />
Problematisch ist, dass die SPS einen Stromnetzanschluss<br />
erfordert. Darüber hinaus werden relativ große Datenmengen<br />
beständig übertragen, da die verwendeten Protokolle nicht<br />
für eine Mobilfunkübertragung optimiert sind und eine<br />
Zwischenspeicherung der Daten meist nicht vorgesehen<br />
ist. Dadurch kann eine Verbindungsunterbrechung zu<br />
entsprechenden Problemen im System führen.<br />
Die x-active M2M-Technologie der ettex GmbH ist für<br />
das GSM-Netz optimiert, unterstützt aber auch andere<br />
TCP/IP-Verbindungen. Die Softwarelösung besteht aus<br />
dem x-active-Client, der auf dem Feldgerät - in diesem<br />
Fall dem GSM/GPRS-Modem des 3S Stellantriebs - läuft,<br />
und dem x-active-Server. Dieser kann beliebig viele<br />
Clients bidirektional verwalten und diese über Standard-<br />
Schnittstellen wie z. B. OPC oder SOAP in den Leitstand oder<br />
auch ein ERP-System des Anwenders einbinden (Bild 1).<br />
Das x-active-Protokoll ist extrem schlank, so dass nur sehr<br />
geringe Datenmengen für die Informationsübertragung<br />
und infolge dessen nur geringe Mobilfunkkosten anfallen.<br />
Besonders vorteilhaft für die Anbindung der 3S-Stellantriebe<br />
ist außerdem, dass das Protokoll extrem robust ist,<br />
wodurch die Daten auch bei sehr geringer Feldstärke des<br />
Mobilfunknetzes sicher übertragen werden.<br />
Daneben werden umfangreiche Überwachungs- und<br />
Sicherheitsfunktionen unterstützt. Alle Daten und<br />
Meldungen werden zwischengepuffert und erst nach<br />
bestätigter Verarbeitung gelöscht. Autorisierung, Logging<br />
und Priorisierung von Alarmmeldungen sind ebenso<br />
vorgesehen wie Auto discovery, Auto provisioning und<br />
Remote factory reset der Geräte. Eine aufwändige<br />
Sicherheitsarchitektur sorgt für die sichere Übertragung<br />
der Daten. Ausgerüstet mit einem x-active-Client sind<br />
3S-Antriebe kabellos über einen x-active-Server bidirektional<br />
direkt aus der Leitwarte zu steuern.<br />
Im Leitstand von PetersburgGaz sind alle 13 Stellantriebe<br />
eingebunden und können von dort zentral überwacht und<br />
bedient werden.<br />
PRAXISERFAHRUNGEN MIT DEM ENERGY SAVE<br />
MODUS<br />
Der Energieverbrauch im Energy Save Modus unterscheidet<br />
sich in der Praxis deutlich vom normalen Bereitschafts-<br />
Modus herkömmlicher Stellantriebe. Wird der Wechsel<br />
Bild 2: Entwicklung des Ladezustands eines Akkus im normalen<br />
Bereitschaftsmodus in KW 49/50<br />
Bild 3: Entwicklung des Ladezustands eines Akkus im Energy Save Modus<br />
in den Energy Save Modus verhindert, schlägt sich dies<br />
merklich auf den Energieverbrauch nieder.<br />
In folgenden Abbildungen ist die Entwicklung des<br />
Ladezustands des Akkus eines dezentralen Antriebs mit Energy<br />
Save-Technologie dargestellt. In den Wochen 49 und 50 war<br />
der Deckel, unter dem sich der Antrieb befindet, nicht ganz<br />
geschlossen, so dass der Antrieb nicht in den Energy Save<br />
Modus gewechselt ist (Bild 2). Die Steuerung des Antriebs<br />
wurde permanent mit Spannung versorgt und das GSM/GPRS-<br />
Modem blieb im Sendemodus. In weniger als einer Woche war<br />
die Akkuladung deshalb um über 40 % gesunken.<br />
Im Energy Save Modus hingegen waren es dagegen nicht<br />
mehr als 4 % Ladungsabnahme pro Monat. Die Entwicklung<br />
der Akkuladung über vier Wochen im energiesparenden<br />
Antriebsmodus bei wöchentlicher Kommunikation<br />
mit dem Antrieb war damit sehr gering (Bild 3). Auf<br />
ein Jahr gerechnet ist dies etwas weniger als die halbe<br />
Akkuladung, die im Energy Save Modus benötigt wird. Bei<br />
jährlicher Nachladung des Akkus steht somit die Hälfte der<br />
Akkuladung für Stellungen der Armatur zur Verfügung. Bei<br />
einem gängigem Schieber DN 300 mit ungefähr 50 Gängen<br />
können somit rund 24 Stellungen, also zwei Stellungen<br />
im Monat realisiert werden. Eine Stellung gilt hierbei als<br />
vollständiges Schließen und Öffnen der Armatur.<br />
04-05 / 2013 51
FACHBERICHT RECHT SPECIAL & ROHRLEITUNGSBAU REGELWERK AKTUELL<br />
Bild 4: 3S-Erdeinbau: Automatisierung ohne Schachtbauwerk<br />
Bild 5: Einbau eines Antriebs auf der Trageplatte des Systems Berliner Kappe ®<br />
KOSTENGÜNSTIGER ERDEINBAU UND<br />
NACHTRÄGLICHE AUSRÜSTUNG<br />
Ein weiterer Vorteil der 3S-Antriebe ist die Möglichkeit des<br />
Einbaus ohne Schachtbauwerk und auch die nachträgliche<br />
Ausrüstung von erdverlegten Armaturen mit geringen<br />
Tiefbaukosten und ohne Versorgungsunterbrechung<br />
(Bild 4). Über einen Normvierkant auf der Antriebsoberseite<br />
bleiben die Armaturen aus Sicherheitsgründen manuell zu<br />
betätigen. Im vorliegenden Projekt wurden zehn 500 D<br />
mit Akkupack 1400 unterflur eingebaut. Zwei der IP68<br />
2 m wasserdichten 500 D-Stellantriebe wurden nach<br />
der 3S-Einbauanordnung direkt ins verdichtete Erdreich<br />
auf der verdrehsicheren Trageplatte des Systems Berliner<br />
Kappe ® montiert (Bild 5). Fünf weitere Antriebe wurden<br />
mittels einer passend abgelängten Flanschverlängerung aus<br />
Edelstahl mit innenliegender Welle direkt an die Armatur<br />
geflanscht. Für Gashochdruckarmaturen oder bei Leitungen,<br />
die mit einem kathodischen Korrosionsschutz versehen<br />
sind, steht eine Variante mit elektrostatischer Entkopplung<br />
zur Verfügung.<br />
Alle zehn unterflur eingebauten Systeme wurden unter<br />
den ersten vollständig aus PE hergestellten Schachtdeckeln<br />
mit der höchsten Belastungsklasse D400 aus dem Hause<br />
ROMOLD eingebaut. Der Vorteil dieser Schachtdeckel<br />
besteht neben dem vergleichsweise geringen Gewicht<br />
zum einen in der Durchlässigkeit des Materials für<br />
elektromagnetische Wellen. Zum anderen schließen<br />
diese Deckel nahezu vollständig wasserdicht, was die<br />
Verschmutzung der Antriebe weitgehend verhindert<br />
(Bild 6).<br />
Der kostengünstige Einbau der Antriebe direkt ins Erdreich<br />
hat noch einen weiteren Vorteil. Der Temperaturbereich<br />
der Li-Ionen-Akkus sowie das verwendete GSM/GPRS-<br />
Modem endet bei -25 °C. Insofern wurde die Realisierung<br />
des Projektes erst durch den Erdeinbau möglich. Denn im<br />
Erdreich unter dem Deckel sanken in diesem Winter die in<br />
Antrieb und Akku gemessenen Temperaturen nicht unter<br />
-5 °C selbst bei Außentemperaturen von unter -30 °C.<br />
Zwei der 13 Antriebe werden mit Netzstrom versorgt und<br />
ebenfalls über x-active via GSM/GPRS angesteuert und in<br />
den Leitstand eingebunden. Hier verhindert eine Heizung,<br />
dass das verwendete GSM/GPRS-Modem zu kalt wird. Als<br />
eine besondere Herausforderung erwies sich der Antrieb, der<br />
überflur eingesetzt, aber mit Akkustrom versorgt werden<br />
musste. Hier wurde die gesamte Steuerungselektronik sowie<br />
der Akkupack neben dem Antrieb unterflur verbaut, um<br />
diese vor zu tiefen Temperaturen zu schützen.<br />
FAZIT<br />
Im Mai 2012 wurden die ersten komplett kabellosen<br />
3S-Armaturenstellantriebe in Sankt Petersburg in Betrieb<br />
genommen. Mit der eingesetzten Technologie konnten<br />
alle Projektanforderungen des Netzbetreibers erfüllt<br />
werden. Die Auswertung der Ladestände der Akkus lässt<br />
darauf schließen, dass diese wie geplant nur einmal pro<br />
Jahr nachgeladen oder gewechselt werden müssen. Die<br />
Konnektivität der Mobilfunkmodems ist ausreichend<br />
52 04-05 / 2013
SPECIAL ROHRLEITUNGSBAU RECHT & REGELWERK AKTUELL FACHBERICHT<br />
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
Jetzt bestellen!<br />
Sichere und effiziente<br />
Rohrleitungssysteme<br />
Nutzen Sie das Know-how der führenden Fachzeitschrift<br />
für die Entwicklung, den Einsatz und Betrieb von Rohrleitungen,<br />
Komponenten und Verfahren im Bereich der<br />
Gas- und Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung,<br />
der Nah- und Fernwärmeversorgung, des Anlagenbaus<br />
und der Pipelinetechnik.<br />
Wählen Sie einfach das Bezugsangebot, das Ihnen zusagt:<br />
als Heft, ePaper oder Heft + ePaper!<br />
Bild 6: Antrieb im verdichteten Erdreich unter einem<br />
Schachtdeckel<br />
gegeben, so dass die Antriebe aus der Leitwarte jederzeit<br />
zu erreichen sind. Die Projektkosten haben sich durch die<br />
Vermeidung von Schachtbauwerken und ohne das Verlegen<br />
von Daten- oder Stromkabeln in den anvisierten Grenzen<br />
gehalten.<br />
Neben dem Projekt in Sankt Petersburg sind weitere<br />
komplett dezentrale 3S-Antriebe in der Schweiz und in<br />
Australien erfolgreich im Einsatz. In Deutschland werden<br />
3S-Antriebe u. a. bei den Berliner Wasserbetrieben, den<br />
Stadtwerken München, bei Hamburg Wasser und bei<br />
DEW 21 eigesetzt.<br />
Halle 4.2., Stand 102<br />
M.A. HENRIK FRIEDEMANN<br />
3S Antriebe GmbH, Berlin<br />
Tel. +49 30 7007764 0<br />
E-Mail h.friedemann@3s-antriebe.de<br />
RA, Dipl.-Phys. FABIAN SACHAROWITZ<br />
3S Antriebe GmbH, Berlin<br />
Tel. +49 30 7007764 0<br />
E-Mail f.sacharowitz@3s-antriebe.de<br />
AUTOREN<br />
<strong>3R</strong> erscheint in der Vulkan-Verlag GmbH, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen<br />
04-05 / 2013 53
FACHBERICHT RECHT SPECIAL & ROHRLEITUNGSBAU REGELWERK AKTUELL<br />
Innovative Verbindungstechnik für<br />
Stahlrohre<br />
Automatisiertes Laserstrahlschweißen und Prüfen von<br />
Rohrverbindungen<br />
Das Schweißen von Rohren mit einem Orbitalverfahren hat sich im Pipelinebau insbesondere bei Großrohren seit vielen<br />
Jahren bewährt. Mit dem Laserstrahlschweißen steht heute eine Technologie zur Verfügung, die bei wesentlich geringerem<br />
Zeit- und Materialaufwand vergleichbare Ergebnisse erwarten lässt. So bietet dieses Verfahren inzwischen auch für kleinere<br />
Baumaßnahmen eine interessante Alternative zur manuellen Schweißung mit Elektroden. Die verfahrensbedingt sehr geringe<br />
Wärmeeinbringung im Schweißnahtbereich erlaubt darüber hinaus eine zeitnahe Prüfung des Schweißergebnisses, so dass<br />
im Falle eines kombinierten Prozesses ein nicht zu unterschätzender logistischer Vorteil im Baustellenablauf resultiert. Im<br />
Rahmen eines geförderten Verbundprojektes wurde ein Prototyp für diese Aufgabenstellung realisiert.<br />
1 EINLEITUNG<br />
Das Verschweißen von Stahlrohren im Pipelinebau hat eine<br />
lange Tradition und ist nach wie vor geprägt von der Fähigkeit<br />
der Schweißer im Umgang mit den Elektroden und<br />
daher überwiegend Handarbeit. Am Anfang eines Bauprojektes<br />
steht häufig eine auf das jeweilige Projekt abgestimmte<br />
Schweißanweisung, ggf. eine Verfahrensprüfung<br />
und Unterweisungen bei schwierigen Schweißaufgaben,<br />
die angesichts eines oft Monate umfassenden Bauablaufes<br />
vom Zeitaufwand her kaum ins Gewicht fallen. Während im<br />
Pipelinebau ein geregelter Ablauf von der Trassierung über<br />
die Endenvorbereitung und das Verschweißen bis hin zum<br />
Prüfen der Schweißnähte und die Nachumhüllung sichergestellt<br />
ist, sind derartige Abläufe bei kleineren Baumaßnahmen<br />
im Verteilungsbereich der Gas- und Wasserversorgung<br />
mit einem erheblichen zeitlichen und logistischen Aufwand<br />
verbunden. Während im Pipelinebau der Rohrstrang überwiegend<br />
auf große Längen vorgestreckt und später als<br />
Strang in den Rohrgraben eingelegt werden kann, sind bei<br />
kleineren Baumaßnahmen nicht nur begehbare Rohrgräben,<br />
sondern auch im Arbeitsbereich des Schweißers entsprechend<br />
Kopflöcher vorzusehen.<br />
Bild 1: Überwachungs- und Prüfstrategie<br />
Dieser Aufwand steht beispielsweise auch neuen Verlegetechniken<br />
wie dem Rohreinzugsverfahren entgegen.<br />
Gerade hier wird die realisierbare Zeitersparnis durch einen<br />
komplexen Schweißablauf vielfach zunichte gemacht. Im<br />
Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes wurde die Möglichkeit<br />
geprüft, diesen Aufwand mit den heute verfügbaren<br />
technischen Lösungen wie das Laserschweißen und neuen<br />
Prüftechniken zu reduzieren.<br />
2 STAND DER TECHNIK, MOTIVATION UND<br />
AUFGABENSTELLUNG<br />
Im Rahmen eines geförderten Forschungsvorhabens sollte<br />
der Prototyp einer Gerätetechnik zum Laserstrahlschweißen<br />
erarbeitet werden, der eine kombinierte Lösung zum<br />
Verschweißen und Prüfen von Stahlrohren mit Hilfe einer<br />
umlaufenden Verfahrenstechnik ermöglicht. Der Entwicklungsaufwand<br />
besteht dabei in der Kombination verschiedenster<br />
Prüftechniken, um letztlich eine dem Anwendungsbereich<br />
angemessene Aussagefähigkeit zu erzielen.<br />
Die Gerätetechnik sollte schon im Falle des Prototypen auf<br />
einer möglichst leicht zu handhabenden und platzsparenden<br />
Konstruktion basieren. Mit Blick auf die oben bereits<br />
beschriebenen Anwendungsbereiche wird dazu im ersten<br />
Schritt ein Nennwanddickenbereich der Stahlrohre von 3-5<br />
mm abgedeckt, der letztlich dem Anwendungsbereich von<br />
Rohraußendurchmessern von DN 100 bis etwa DN 400 entspricht<br />
[1, 2]. Die zulässigen Toleranzen für den Schweißspalt<br />
und die erfassbaren Fehlergrößen der Prüftechnik sind zu<br />
ermitteln.<br />
Der mit Prüf- und Schweißtechnik ausgestattete Aufsatz zur<br />
Herstellung der Rohrverbindung ist von den Gerätschaften<br />
zu trennen, die zur Erzeugung der erforderlichen Schweißenergie<br />
und Verarbeitung der Messsignale erforderlich sind.<br />
Die Verbindung soll durch eine entsprechend ausgelegte<br />
Versorgungsleitung realisiert werden. Auf diese Weise können<br />
auch größere Entfernungen zwischen der Gerätetechnik<br />
54 04-05 / 2013
SPECIAL ROHRLEITUNGSBAU RECHT & REGELWERK AKTUELL FACHBERICHT<br />
und dem eigentlichen Arbeitsaufsatz bewältigt werden. Die<br />
Gerätetechnik kann dann je nach Anwendungsbereich auf<br />
einem baustellentauglichen Fahrzeug installiert werden.<br />
3 VERSUCHSAUFBAUTEN UND -DURCHFÜHRUNG<br />
Zur Lösung der zugrundeliegenden Aufgabenstellung musste<br />
zunächst eine Vorrichtung zur Realisierung der umlaufenden<br />
Schweißbewegung der Laseroptik konzipiert werden.<br />
Weiterhin sollte die Vorrichtung ausreichend Platz für die<br />
Sensorik zur Prozessüberwachung (LWM) und zerstörungsfreien<br />
Prüfung bieten. Hierbei stellt die Erarbeitung einer<br />
ganzheitlichen Überwachungs- und Prüfstrategie, die direkt<br />
nach Beendigung des Schweißens eine Aussage über die<br />
erzielte Nahtqualität liefert, den Schwerpunkt der Untersuchungen<br />
dar. Die hierzu notwendigen Informationen<br />
können vor, während und nach dem Schweißprozess in<br />
Form von unterschiedlichen Signalen gewonnen werden.<br />
Bild 1 stellt diese Strategie und die notwendige Signalverarbeitung<br />
schematisch dar.<br />
Die Analyse von Unregelmäßigkeiten an laserstrahlgeschweißten<br />
Verbindungen zeigt, dass der überwiegende<br />
Teil auf Störungen im Prozessablauf zurückzuführen ist.<br />
Ursächlich hierfür wiederum ist die Qualität der Stoßvorbereitung<br />
hinsichtlich Geometrie (Vorhandensein von Spalt<br />
bzw. Kantenversatz) und Sauberkeit.<br />
3.1 Versuchsaufbau zum orbitalen Laserstrahlschweißen<br />
mit integrierter Messung der optischen<br />
Prozesswechselwirkungssignale<br />
Im ersten Arbeitsschritt wurde die Gestaltung und der Aufbau<br />
einer geeigneten Gerätetechnik zur Umsetzung der<br />
Umlaufbewegung der Laseroptik am stehenden Rohr einschließlich<br />
der zum Fügen und zur Fixierung der Rohrstöße<br />
notwendigen Spanntechnik für das Laserstrahlschweißen<br />
an Rohren im Durchmesserbereich DN 80 bis DN 150 mit<br />
Wandstärken von 2-5 mm entwickelt. Diese ist im Folgenden<br />
mit ihren grundlegenden Komponenten beschrieben.<br />
Die Trägerkonstruktion besteht aus vier ringförmigen Platten,<br />
die nach unten hin geöffnet sind, um sie auf die zu fügenden<br />
Rohre aufsetzen zu können. Die beiden äußeren Platten<br />
werden mit je einem der Rohre über eine Spannvorrichtung<br />
verbunden. An ihnen entlang werden die beiden inneren<br />
Ringe geführt, so dass diese eine Kreisbewegung um die<br />
Rohre ausführen können. Die beiden inneren Ringe sind starr<br />
miteinander verbunden. Zwischen diesen Ringen werden<br />
alle füge- und prüftechnischen Komponenten angeordnet.<br />
In dieses Trägersystem erfolgte im ersten Schritt die Integration<br />
einer miniaturisierten Schweißoptik, so dass zum<br />
weiteren Aufbau des Prototypen die in Bild 2 dargestellte<br />
Trägerkonstruktion zur Verfügung steht.<br />
Kernstück des Versuchsaufbaus ist eine transmissive Bearbeitungsoptik<br />
YW30 der Firma Precitec mit koaxial zum Strahlengang<br />
integrierter Sensorik zur photooptischen Erfassung<br />
relevanter Emissionen aus dem Laserstrahlschweißprozess.<br />
Diese Bearbeitungsoptik ist zur Versuchsdurchführung an<br />
das Trägersystem adaptiert worden. Die Gesamtanlage zur<br />
Versuchsdurchführung ist in Bild 3 dargestellt.<br />
Bild 2: Trägersystem mit eingesetzter Schweißoptik<br />
Bild 3: Abgewinkelte Laseroptik mit LWM-Sensor und Faserstecker<br />
Die Aufzeichnung der aus dem Prozess emittierten Strahlung<br />
erfolgt mit einem Industrie-PC. Hierbei wird zunächst<br />
die optische Strahlung in unterschiedlichen Wellenlängenbereichen<br />
über Photodioden gemessen und in analoge<br />
Spannungssignale umgewandelt. Nach einer Verstärkung<br />
der Signale findet die Verarbeitung der Messwerte als zeitabhängige<br />
Signalverläufe über unterschiedliche Messkanäle<br />
des Industrie-PC statt.<br />
3.2 Kamerasystem zur Stoß- und<br />
Nahtgeometrieermittlung<br />
Für die Erfassung des Schweißstoßes, insbesondere von Kantenversatz<br />
und Spalt, wird der von einem Linienlaser erzeugte<br />
Strich quer zum Stoß von einer Kamera aufgenommen.<br />
Die Kamera und der Linienlaser sind wie die Schweißoptik<br />
04-05 / 2013 55
FACHBERICHT RECHT SPECIAL & ROHRLEITUNGSBAU REGELWERK AKTUELL<br />
Bild 4: Prototypische Gesamtintegration der Gerätetechnik<br />
Bild 5: Ultraschallprüfköpfe mit Achsen<br />
Bild 6: Nahtausbildung in Makroschliffe relativ zum Rohrwinkel<br />
Bild 7: Härteverlauf über die Schweißnaht im Bereich des<br />
Rohrwinkels 180 (t = 5 mm)<br />
zentral zwischen den beiden inneren Platten des Trägersystems<br />
angebracht und werden mit der Umlaufbewegung um<br />
das Rohr geführt. Im Anschluss an den Schweißprozess wird<br />
mit gleicher Kamera die Topografie der Schweißnaht erfasst.<br />
Dabei wird auf Spalt und Kantenversatz in der Nahtvorbereitung<br />
sowie auf Nahtunregelmäßigkeiten (Unterwölbung<br />
oder Überhöhung) und nach außen geöffnete Schweißfehler<br />
geachtet. Beispielhafte Aufnahmen zu den überprüften<br />
Situationen sind in Tabelle 1 dargestellt. Die beim Umlauf<br />
registrierten Änderungen der Laserlinie können auch zur<br />
Positionsberechnung sowie zur Höhen- und Seitenregelung<br />
der Schweißoptik genutzt werden.<br />
3.3 Versuchsaufbau zur Qualifizierung der Ultraschalltechnik<br />
für die Prüfaufgabe<br />
Die bei den Untersuchungen verwendete Ultraschall-Hardware<br />
setzt sich zusammen aus dem eigentlichen Ultraschallgerät,<br />
dem USIP 40 und den Rollenwinkelprüfköpfen. Beim<br />
USIP 40 handelt es sich um ein mehrkanaliges Ultraschallsystem<br />
mit fünf Kanälen, die mit Hilfe eines Multiplexers<br />
voneinander getrennt werden. Zusätzlich zu den Prüfköpfen<br />
ist es möglich, externe Geräte an das USIP 40 anzuschließen.<br />
Dies können z. B. Winkelencoder zur Positionsbestimmung<br />
oder Geräte zur Prüfdatenfreigabe sein. Diese können über<br />
zwei I/O-Schnittstellen angeschlossen und über eine SYNC-<br />
Schnittstelle synchronisiert werden.<br />
Zusätzlich zum USIP 40 werden spezielle Rollenprüfköpfe<br />
zur Schrägeinschallung mit einem Winkel von 55 ° und einer<br />
Frequenz von 6 MHz verwendet. Diese Prüfköpfe zeichnen<br />
sich dadurch aus, dass die ordnungsgemäße Ankopplung<br />
nicht mit Hilfe eines Koppelmittels erfolgt, sondern durch<br />
einen Silikonreifen realisiert wird. Auf diesem Reifen wird<br />
der Prüfkopf über das Bauteil bewegt, wodurch nur eine<br />
Bewegung parallel zur Schweißnaht erfolgen kann.<br />
4 GERÄTETECHNISCHE INTEGRATION UND<br />
ERPROBUNG<br />
In der finalen Projektphase wurden die entwickelten Einzelsysteme<br />
bestehend aus Schweißoptik, der Kamera zur vorlaufenden<br />
Stoß- bzw. der Fugenlagedetektion und Prozesskontrolle<br />
sowie der Halterung für die Ultraschallprüfköpfe zu einer prototypischen<br />
Gesamtlösung zusammengeführt (Bild 4).<br />
Zur direkten Beurteilung von inneren Unregelmäßigkeiten<br />
werden die zwei Ultraschallprüfköpfe in definiertem Abstand<br />
links und rechts der Schweißnaht um das Rohr geführt.<br />
Bild 5 zeigt die Anbringung der Ultraschallprüfköpfe.<br />
Über Federspannung wird der Kontakt der Prüfköpfe zum<br />
Rohr gehalten. Für unterschiedliche Rohrdurchmesser ist<br />
eine Höheneinstellung möglich.<br />
5 DARSTELLUNG VON ERGEBNISSEN DER<br />
WERKSTOFFPRÜFUNG<br />
Im ersten Schritt erfolgte zur Herstellung einer Referenz<br />
für die Prozessüberwachung (LWM) und zur Ermittlung der<br />
mechanisch-technologischen Kennwerte der laserstrahlgeschweißten<br />
Rohrverbindungsnähte eine Versuchsreihe unter<br />
idealen Bedingungen der Stoßvorbereitung und ohne pro-<br />
56 04-05 / 2013
SPECIAL ROHRLEITUNGSBAU RECHT & REGELWERK AKTUELL FACHBERICHT<br />
vozierte Fehleinstellungen. Nach Herstellung<br />
dieser Referenzprobe wurden in Schritte von<br />
45 ° verteilt am Umfang Schliffproben entnommen.<br />
Diese sind bezogen zum jeweiligen<br />
Rohrwinkel in Bild 6 dargestellt.<br />
Wie deutlich sichtbar ist, gibt es für die<br />
gewählten Parameter keine Einflüsse aus der<br />
sich orbital stets verändernden Schweißposition,<br />
was den konstanten Signalpegel des<br />
Prozessüberwachungssystems unterstützt.<br />
Diese Aussage trifft sowohl auf die Nahtgeometrie<br />
hinsichtlich Ober- und Unterseite der<br />
Schweißnaht als auch auf das Auftreten innerer<br />
Unregelmäßigkeiten zu. Im Ergebnis kann<br />
eingeschätzt werden, dass unter den gewählten<br />
Bedingungen eine Bewertungsgruppe B<br />
nach DIN EN ISO 13919-1 erfüllt wird. In Bild<br />
7 ist der Härteverlauf für die Schweißposition<br />
180 ° dargestellt.<br />
Die Untersuchungen zur Bestimmung der<br />
statischen Nahtfestigkeit und der Zähigkeiten<br />
ergeben mit Bezug zum DVGW-Arbeitsblatt<br />
GW 350 [3] ebenfalls keine Auffälligkeiten.<br />
Die entsprechend im Zugversuch und der<br />
Kerbschlagbiegeprüfung (Untermaßproben)<br />
ermittelten Werte für den Werkstoff L360MB<br />
(t = 5 mm) sind in Tabelle 2, Tabelle3 und<br />
Tabelle 4 dargestellt.<br />
Tabelle 1:Aufnahmen von Stoß- und Nahtprofil bei unterschiedlichen<br />
Toleranzsituationen<br />
Stoß<br />
(ungeschweißt)<br />
Tabelle 2: Ergebnisse des Kerbschlagbiegeversuchs in der Nahtmitte bei<br />
0 °C – 2 Probensätze<br />
Probenlage<br />
Nahtmitte<br />
(Schweißgut)<br />
Prüftemperatur<br />
Probenbreite<br />
a<br />
Probenhöhe<br />
b<br />
Kerbschlagarbeit Av<br />
Mittelwert<br />
[°C] [mm] [mm] [J] [J]<br />
0<br />
3,4 8,0 59<br />
3,4 8,0 75<br />
3,4 8,0 53<br />
3,4 8,0 79<br />
3,4 8,0 66<br />
3,4 8,0 68<br />
62<br />
71<br />
Forderung<br />
GW 350 [J]<br />
27<br />
mind. 20<br />
5.1 Fehlersimulation zur Erprobung des<br />
Zusammenwirkens der Prüf- und<br />
Überwachungssysteme<br />
Im folgenden Abschnitt wird durch ein Beispiel<br />
das redundante Zusammenwirken der<br />
Prüf- und Überwachungssysteme dargestellt.<br />
Dazu sind in der Erprobung an definierten<br />
Stellen Parameterabweichungen programmiert<br />
bzw. Unregelmäßigkeiten in die Stoßvorbereitung<br />
eingebracht. Diese werden dann<br />
unter Verwendung der Prozessüberwachung<br />
(LWM) geschweißt und anschließend durch<br />
die integrierte Ultraschalltechnik geprüft.<br />
Durch vergleichende Betrachtung der Signale<br />
beider Systeme und unter Zuhilfenahme der<br />
Aufnahmen der CCD-Kamera lassen sich die<br />
erkennbaren Unregelmäßigkeiten zuordnen.<br />
Zur Absicherung der Aussagen wurden dann<br />
die entsprechenden Bereiche mittels Durchstrahlungsprüfung<br />
untersucht.<br />
Alle durch die Durchstrahlungsprüfung nachgewiesenen<br />
Unregelmäßigkeiten werden auch<br />
durch die Prozessüberwachung und Ultraschallprüfung<br />
detektiert. Durch die Auswertung der<br />
unterstützend wirkenden Stoß- und Nahtinspektion<br />
ist eine lokale Zuordnung der Unregelmäßigkeiten<br />
und teilweise auch der Ursachen<br />
dieser Unregelmäßigkeiten möglich.<br />
Tabelle 3: Ergebnisse des Kerbschlagbiegeversuchs in der<br />
Wärmeeinflusszone bei 0 °C – 2 Probensätze<br />
Probenlage<br />
Einzelwerte<br />
Prüftemperatur<br />
Probenbreite<br />
a<br />
Tabelle 4: : Ergebnisse des Querzugversuchs<br />
Probe<br />
Probenhöhe<br />
b<br />
Kerbschlagarbeit Av<br />
[°C] [mm] [mm] [J] [J]<br />
0<br />
Streckgrenze<br />
3,4 8,0 63<br />
3,4 8,0 56<br />
3,4 8,0 45<br />
3,4 8,0 40<br />
3,4 8,0 42<br />
3,4 8,0 41<br />
Einzelwerte<br />
Mittelwert<br />
Wärmeeinflusszone<br />
Zugfestigkeit<br />
Bruchdehnung<br />
Brucheinschnürung<br />
55<br />
41<br />
Bruchlage<br />
R p0,5<br />
[MPa] R m<br />
[MPa] A [%] Z [%] -<br />
1 448 487 20,1 70 GW<br />
2 418 467 24,5 70 GW<br />
3 416 466 21,6 67 GW<br />
4 413 463 25,8 62 GW<br />
Anmerkung: Mit der Bruchlage im Grundwerkstoff ist die Anforderung des<br />
DVGW-(A) GW 350 erfüllt<br />
Forderung<br />
GW 350 [J]<br />
27<br />
mind. 20<br />
04-05 / 2013 57
FACHBERICHT RECHT SPECIAL & ROHRLEITUNGSBAU REGELWERK AKTUELL<br />
Tabelle 5: Generierte Messdaten beim Schweißen und Prüfen gemäß InSitu-Prüf- und<br />
Überwachungsstrategie am Beispiel einer ungenügenden Durchschweißung und eines<br />
partiellen Strahlversatzes quer zum Schweißstoß<br />
p<br />
q<br />
LWM<br />
UT<br />
Anzeige-<br />
Nr.<br />
Interpretation<br />
CCD-<br />
Kamera<br />
1 2 3<br />
linienartige Anzeige;<br />
verringerte<br />
Laserleistung<br />
Bewertun<br />
g Nahtbreite gering,<br />
Kantenversatz; n.i.O.<br />
linienartige Anzeige,<br />
Ursache aus LWM-Signal nicht<br />
eindeutig erkennbar<br />
unverschweißte Kante<br />
erkennbar,<br />
Fehlpositionierung; n.i.O.<br />
kurze Anzeige UT, keine Anzeige<br />
LWM<br />
Nahtunterw<br />
ölbung durch<br />
Fehlstelle in der<br />
Nahtvorbereitung n.i.O.<br />
Tabelle 6: Ermittelte Mindestgrößen der detektierbaren Unregelmäßigkeiten<br />
durch UT-Prüfung für den untersuchten Wanddickenbereich<br />
Unregelmäßigkeit<br />
Poren<br />
(200)<br />
Porenzeilen<br />
(2015)<br />
Ungenügende Durchschweißung<br />
(402)<br />
(Unregelmäßigkeit für Bewertungsgruppe B und C unzulässig)<br />
Risse<br />
(100)<br />
(Unregelmäßigkeit für alle Bewertungsgruppen unzulässig)<br />
Kantenversatz<br />
(507)<br />
Bindefehler<br />
(401)<br />
(Unregelmäßigkeit für Bewertungsgruppe B und C unzulässig)<br />
Mindestgröße der Detektierbarkeit<br />
nach derzeitigem Entwicklungsstand<br />
t = 3 mm<br />
t = 5 mm<br />
5 mm x 0,5 mm 5 mm x 0,5 mm<br />
0,4 mm 0,6 mm<br />
0,4 mm 0,4 mm<br />
0,8 mm 0,8 mm<br />
0,4 mm 0,4 mm<br />
5.2 Nachweisbare Unregelmäßigkeiten<br />
durch das Prüf- und<br />
Überwachungssystem<br />
Im Ergebnis der vorgestellten Arbeiten zur<br />
Entwicklung einer In-Situ-Prüf- und Überwachungsstrategie<br />
zum laserbasierten<br />
Rohrschweißen wurden Funktion und Eignung<br />
auf Laborebene nachgewiesen. Im<br />
Einzelnen bedeutet das, dass die Prüfbarkeit<br />
laserstrahlgeschweißter Verbindungen<br />
mittels Ultraschalltechnik auch im Bereich<br />
von Wanddicken von 3-5 mm für kritische<br />
Unregelmäßigkeiten wie Bindefehler, Wurzeldefekte<br />
(ungenügende Durchschweißung),<br />
Porenzeilen und starke Nahtunterwölbungen<br />
in der <strong>aktuell</strong>en Entwicklungsphase bis zu den<br />
in Tabelle 6 angegebenen Größen der Unregelmäßigkeiten<br />
gegeben ist. Einschränkungen<br />
müssen für die Detektierbarkeit von Einzelporen<br />
gemacht werden, die aufgrund ihrer Geometrie<br />
ein sehr schlechtes Reflexionsverhalten<br />
gegenüber den Ultraschallwellen aufweisen.<br />
In der finalen gerätetechnischen Ausführung<br />
wurde gezeigt, dass das Zusammenwirken<br />
der Einzelsysteme Kamera, photooptische<br />
Prozessüberwachung und Ultraschallprüfung<br />
gegeben ist. Dieses wurde in der Fehlersimulationen<br />
nachgewiesen. Eine weitere Optimierung<br />
der erfassbaren Größen von Unregelmäßigkeiten<br />
in der Schweißnaht ist im weiteren<br />
Verlauf der Arbeiten vorgesehen.<br />
6 ZUSAMMENFASSUNG UND<br />
AUSBLICK<br />
Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens<br />
wurde ein Prototyp für das kombinierte<br />
Schweißen und Prüfen einer Rohrverbindung<br />
im Orbitalverfahren realisiert. Die durch das<br />
orbitale Laserstrahlschweißen hergestellten<br />
Verbindungen erfüllen hinsichtlich ihrer<br />
mechanisch-technologischen Kennwerte die<br />
Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes<br />
GW 350. In dem für den <strong>Rohrleitungsbau</strong><br />
relevanten Regelwerk sind derzeit weder das<br />
hier vorgestellte Schweiß- noch das Prüfverfahren<br />
erfasst. Die Anforderungen an die Ultraschallprüfung<br />
sind bisher für einen Wanddickenbereich<br />
von etwa 6-10 mm beschrieben<br />
[3].<br />
Die Optimierung des Prototypen, die Anwendung<br />
unter Baustellenbedingungen und die<br />
Klärung einer Akzeptanz der Schweiß- und<br />
Prüftechniken für die Anwendung in der<br />
Gas- und Wasserverteilung sowie in der<br />
Fernwärmeversorgung werden die nächsten<br />
Arbeitsschritte in der Weiterentwicklung der<br />
vorgestellten gerätetechnischen Lösung sein.<br />
58 04-05 / 2013
SPECIAL ROHRLEITUNGSBAU RECHT & REGELWERK AKTUELL FACHBERICHT<br />
7 DANKSAGUNG<br />
Die vorgestellten Arbeiten wurden durch das BMWi im<br />
Rahmen des Projektes „Entwicklung redundanter In-Situ-<br />
Überwachungs- und Prüfstrategien zum laserbasierten<br />
Rohrverbindungsschweißen“ (FKZ MF090208) unterstützt.<br />
Hierfür sei ausdrücklicher Dank gesagt.<br />
Weiterer Dank gilt den an dem Projekt beteiligten Industriepartnern<br />
Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH; Gelsenwasser<br />
AG und der Stadtwerke München Services GmbH für<br />
ihre Unterstützung bei der Umsetzung der Untersuchungen.<br />
LITERATUR<br />
[1] DIN 2460: Stahlrohre und Formstücke für Wasserleitungen;<br />
Ausgabe Juni 2006<br />
[2] DIN 2470-1: Gasleitungen aus Stahlrohren mit zulässigen<br />
Betriebsdrücken bis 16 bar; Ausgabe Dezember 1987<br />
[3] DVGW-Arbeitsblatt GW 350: Schweißverbindungen an<br />
Rohrleitungen aus Stahl in der Gas- und Wasserversorgung;<br />
Ausgabe Oktober 2006<br />
AUTOREN<br />
Dipl.-Ing. (FH) JAN NEUBERT<br />
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt<br />
Halle GmbH, Halle (Saale)<br />
Tel. +49 345 5246-428<br />
E-Mail: neubert@slv-halle.de<br />
Dr. rer. nat. HANS-JÜRGEN KOCKS<br />
Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH,<br />
Siegen<br />
Tel. +49 271 691-170<br />
E-Mail: hans-juergen.kocks@smlp.eu<br />
Dipl.-Ing. TONY KRÄKER<br />
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt<br />
Halle GmbH, Halle (Saale)<br />
Tel.: +49 345 5246-230<br />
E-Mail: kraeker@slv-halle.de<br />
Halle 3.2., Stand 204<br />
Pioniere im grabenlosen Leitungsbau seit 1962<br />
Erdraketen · Stahlrohrrammen · HHD-Spülbohrtechnik · Berstlining-Technik<br />
Die richtige Verlegetechnik für alle Rohre<br />
TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG · Postfach 4020 · D 57356 Lennestadt<br />
Tel.: +49 (0)2723 8080 · Email: vertrieb@tracto-technik.de · www.tracto-technik.de<br />
Wir stellen aus: BAUMA München, 15.-21.4.13, Freigelände FGN.N521/1<br />
04-05 / 2013 59
FACHBERICHT SPECIAL ROHRLEITUNGSBAU AKTUELL<br />
Kalkulation von Installationsprojekten<br />
mit PE-Rohr<br />
Teil 1: Produktivität beim Heizelementstumpfschweißen<br />
Teil 1 dieses Artikels erörtert die Komplexität und mögliche Herangehensweisen zur Bestimmung der Produktivität bzw.<br />
des Zeitaufwandes für ein Schweißprojekt. Anhand der Erfahrung des Schweißmaschinenherstellers WIDOS GmbH<br />
werden Richtwerte für typische Rohrdimensionen genannt. Außerdem werden dem Praktiker Tipps gegeben, wie er die<br />
Produktivität beim Schweißen erhöhen kann.<br />
Teil 2, in <strong>3R</strong>-Ausgabe XX/2013, beschreibt das web-basierte Tool www.webkalkulator24.de des Rohrherstellers egeplast<br />
international GmbH.<br />
Tabelle 1: Im Labor maximale Anzahl an Heizelementstumpfschweißungen<br />
von PE-Rohren pro Tag nach SKZ-Forschungsbericht [3]<br />
d 63 mm d 110 mm d 160 mm d 250 mm<br />
Eine Schweißmaschine 23 17 13 10<br />
Zwei Schweißmaschinen 45 34 25 19<br />
Tabelle 2: Maximale Anzahl an Schweißungen laut Umfrage des SKZ [3]<br />
d 63 mm d 110 mm d 160 mm d 250 mm<br />
Bandbreite 20 – 25 12 – 25 8 – 20 5 – 15<br />
Mittlere Anzahl möglicher<br />
Schweißungen<br />
22,5 17,3 12,2 10<br />
EINLEITUNG<br />
Bisherige Untersuchungen und Ergebnisse<br />
Eine kürzlich erschienene Forschungsarbeit des SKZ, Würzburg,<br />
stellt eine Methodik vor, mit der Schweißprozesse<br />
zeitlich erfasst werden können [2] [3]. Der Rahmen der<br />
Untersuchungen beschränkt sich auf Schweißungen im<br />
Labor, sowie nur wenigen Rohrdimensionen. Einflussfaktoren,<br />
wie sie auf der Baustelle auftreten, also aus der Praxis,<br />
wurden in die Arbeit nicht einbezogen.<br />
Aus den Untersuchungen des SKZ-Forschungsberichtes<br />
werden hier die für das Heizelementstumpfschweißen von<br />
PE-Rohren relevanten Informationen aufgegriffen. Als erstes<br />
wichtiges Ergebnis wurde festgestellt, dass sich beim Einsatz<br />
von zwei Schweißmaschinen die Produktivität verdoppelt<br />
bzw. überproportional ansteigt, siehe Tabelle 1.<br />
Einerseits handelt es sich beim Heizelementstumpfschweißen<br />
von PE-Rohren um ein standardisiertes Verfahren mit<br />
genauen Prozesszeiten, andererseits sind in der Praxis auf<br />
der Baustelle sehr unterschiedliche Zeitbedarfe festzustellen.<br />
Ein Beispiel: Zusätzlicher Zeitbedarf für den Aufbau eines<br />
Schweißzeltes bei ungünstiger Witterung.<br />
Bekannt ist auch, dass die Abkühlzeit einen besonders<br />
großen Anteil an der Gesamtschweißdauer ausmacht.<br />
Die Stumpfschweißmaschine drückt in dieser Phase die<br />
Rohre gegeneinander, während das zugehörige Heizelement<br />
und Planhobel ungenutzt bleiben; man könnte sagen<br />
auf die nächste Schweißung warten. Je größer die Wanddicken<br />
der PE-Rohre, umso länger ist auch die Abkühlzeit<br />
und umso größer ihr Einfluss auf die Produktivität.<br />
Ein weiterer Teil der SKZ-Forschungsarbeit befasst sich mit<br />
einer Umfrage bei Personen aus der Praxis, z. B. Verantwortlichen<br />
aus der Gas- und Wasserversorgung. In einem<br />
Fragebogen wurde nach der maximalen Anzahl von Schweißungen<br />
pro Tag mit einer Stumpfschweißmaschine gefragt.<br />
Das Ergebnis der Mittelwerte ähnelt der Anzahl der im Labor<br />
gefertigten Schweißungen. Allerdings ist die Bandbreite sehr<br />
hoch, siehe Tabelle 2.<br />
Was das Thema noch komplexer macht, ist die Tatsache,<br />
dass es auf der Welt unterschiedliche Schweißparametervorgaben<br />
für das Heizelementstumpfschweißen von PE-Rohren<br />
gibt, Beispiele siehe Tabelle 3. Diese unterscheiden sich in<br />
den Schweiß-, Abkühlzeiten und Fügedrücken.<br />
Allein durch das Vorhandensein von unterschiedlichen klimatischen<br />
Zonen (hohe oder niedrige Außentemperaturen) lässt<br />
sich diese Tatsache technisch generell nicht nachvollziehen.<br />
Bei fast identischen Polyethylenarten sollte es eigentlich nur<br />
einen Parametersatz (Temperatur, Druck und Zeit) geben, der<br />
die beste bzw. optimale Schweißnahtqualität, d. h. möglichst<br />
hohe Langzeitfestigkeit der Verbindung, ergibt.<br />
Heute geht man von einer Mindestnutzungsdauer bei PE-<br />
Rohren (PE 100 oder PE 80) von 100 Jahren aus [11]. Diese<br />
Nutzungsdauer soll selbstverständlich auch für die Schweißverbindungen<br />
gelten. Zumindest für die Schweißparameter<br />
nach DVS 2207-1 ist diese Nutzungsdauer schon überprüft<br />
worden [8]. Ziel der Bemühungen um die Steigerung der Produktivität<br />
der Schweißungen muss die Erhaltung der hohen<br />
Nutzungsdauer des gesamten Leitungssystems sein [7].<br />
Eine Harmonisierung, d. h. Schaffung einer weltweit gültigen<br />
Schweißparametervorgabe, wird zu erwarten sein,<br />
wenn man generell hohe Schweißnahtfestigkeit auf Langzeit<br />
als Ziel setzt. Voraussetzung dafür wäre ein technischer<br />
Vergleich der Schweißnähte von den unterschiedlichen Parametervorgaben<br />
und der Auswahl des Optimums.<br />
Tabelle 4 zeigt ein Beispiel für Produktivitätsangaben eines<br />
Rohrherstellers aus den USA. Im Vergleich zu Forschungsergebnissen<br />
des SKZ sind dort deutlich mehr Schweißungen<br />
pro Tag möglich.<br />
60 04-05 / 2013
IN DER PRAXIS / AUF DER BAUSTELLE<br />
Ein Prozess mit vielen Einflussfaktoren<br />
In Bild 1 werden wesentliche Einflussfaktoren als Fischgrätendiagramm<br />
dargestellt. Manche der Einflussfaktoren sind<br />
quantifizierbar (z. B. standardisierte Prozesszeiten), andere<br />
nur teilweise quantifizierbar (z. B. stationäre oder mobile<br />
Schweißung) oder nicht quantifizierbar (z. B. Handfertigkeit,<br />
Sorgfalt). Zusätzlich muss man berücksichtigen, dass diese<br />
Faktoren sich auch gegenseitig beeinflussen.<br />
Neben der bereits genannten Abkühlzeit spielen auch<br />
die heutzutage unterschiedlichen zur Verfügung stehenden<br />
Schweißmaschinenkonzepte eine große Rolle. Kleine<br />
Schweißmaschinen, geeignet für Rohre bis ca. d 250 mm,<br />
können ohne Hilfsmittel bewegt werden, wenn sie nicht<br />
gerade in schwierigen Baustellensituationen, z. B. tiefe und<br />
schmale Baugrube, eingesetzt werden. Bei mittelgroßen und<br />
großen Maschinen werden oft unterschiedliche Methoden<br />
eingesetzt, um von Schweißplatz „A“ zu Schweißplatz „B“<br />
zu gelangen. Bei großen Strecken oder Arbeiten auf freiem<br />
Feld werden Schweißmaschinen mit Chassis und Rädern<br />
oder Raupen immer beliebter. Durch Integration von allem<br />
notwendigen Zubehör in eine Maschine bis hin zum autarken<br />
Betrieb kann die Produktivität erhöht werden. Jedoch<br />
erhöhen sich jeweils auch die Maschinenkosten.<br />
In Tabelle 5 werden die wichtigsten heute verfügbaren,<br />
unterschiedlichen Schweißmaschinenkonzepte gezeigt. Das<br />
für den Anwendungsfall geeignetste Maschinenkonzept<br />
kann daraus ausgewählt werden.<br />
Projektbezogen werden in Sonderfällen auch maßgeschneiderte<br />
Lösungen gebaut. Bild 2 zeigt als Beispiel Schweißcontainer<br />
mit angebauten Rädern im mobilen Einsatz.<br />
Erfahrungen von den Baustellen zeigen, dass die Produktivität<br />
im Laufe der Baumaßnahme steigt. Begründet werden<br />
kann dies eigentlich nur mit der Optimierung von Prozesswegen<br />
auf der Baustelle. Die Schweißparameter verstehen<br />
sich als konstanter Abschnitt, dessen Zeitbedarf sich nicht<br />
verkürzen lässt. Bei komplexen Großbaustellen ist eine Aufstellungsplanung<br />
der Baustelleninfrastruktur unumgänglich.<br />
Nur so kann sichergestellt werden, dass das Räderwerk<br />
zur Umsetzung der Maßnahme auch ineinandergreift. Die<br />
Aufstellungsplanung für die komplexe Maßnahme „Stumpf-<br />
Bild 1: Wesentliche Einflussfaktoren auf die Zeitdauer zur Stumpfschweißung<br />
einer PE-Rohrleitung im Fischgrätendiagramm<br />
Bild 2: Mobile Schweißcontainer projektbezogen gebaut<br />
Tabelle 4 Maximale Anzahl an Heizelementstumpfschweißungen von<br />
PE-Rohren pro Tag (8-10h) nach Angaben eines Rohrhersteller aus den USA [4]<br />
d 20 mm -<br />
d 90 mm<br />
d 110mm -<br />
d 200 mm<br />
d 250mm -<br />
d 450 mm<br />
Bandbreite 30 – 60 24 – 48 12 – 24<br />
Tabelle 3: Beispiele für unterschiedliche Vorgaben bzw. Standards für das Heizelementstumpfschweißen von PE-Rohren [1], [5], [6]<br />
Kurzbezeichnung Land / Verbreitung Besondere Parameter Bemerkung<br />
DVS 2207-Teil 1<br />
0,15 N/mm² Fügedruck<br />
(September 2005)<br />
ASTM F2620 – 06<br />
ISO 21307:2009<br />
Deutschland<br />
wird auch weitverbreitet in vielen europäischen<br />
Länder, in Südamerika, in Asien eingesetzt<br />
USA<br />
wird vor allem in den USA eingesetzt, aber auch<br />
in Südamerika und anderen Ländern<br />
International<br />
gilt als ISO-Norm natürlich international, wird<br />
jedoch bei weitem nicht im Umfang wie obige<br />
DVS-Richtlinie oder ASTM-Norm eingesetzt<br />
Heizelementtemperatur<br />
220 °C für PE 100<br />
60 - 90 PSI Fügedruck<br />
(0,41 - 0,62 N/mm²)<br />
Heizelementtemperatur<br />
400 - 450 °F (204 - 232 °C)<br />
Drei Verfahren zur Auswahl.<br />
0,17 N/mm² - 0,52 N/mm²<br />
Fügedruck<br />
Heizelementtemperatur<br />
200 - 245 °C<br />
Umfangreiche Untersuchungen<br />
zur Langzeitfestigkeit wurden<br />
durchgeführt [8], [9], [10]<br />
04-05 / 2013 61
FACHBERICHT SPECIAL ROHRLEITUNGSBAU AKTUELL<br />
Tabelle 5: Übersicht unterschiedlicher Konzepte moderner Stumpfschweißmaschinen<br />
» manuelle Bedienung<br />
» leichtes Grundgestell, Heizelement und Planhobel<br />
» Dimensionen klein und handlich. Bei Bedarf kann der vierte<br />
Spannring entfernt werden, um die Maschine noch kleiner zu<br />
machen<br />
» Zubehör oder Hilfsmittel für das Handling sind in einfachen<br />
Baustellensituationen nicht erforderlich<br />
» manuelle Sondermaschine für beengte Platzverhältnisse,<br />
wie z.B. schmale Gräben<br />
» nur zwei Spannringe<br />
» kleine Hydraulikzylinder und daher eher für dünnwandige<br />
Rohre geeignet<br />
» Winkelschweißung bis 15° möglich<br />
» halbautomatisch (CNC gesteuert)<br />
» sonst wie manuelle Maschine<br />
» Grundgestell, Heizelement und Planhobel werden mit externer<br />
Hebevorrichtung (z.B. Baggerschaufel) bewegt<br />
» der integrierte Kran erleichtert das Handling beim Schweißen<br />
Sonstige Bilder: egeplast international GmbH und WIDOS GmbH<br />
» Heizelement und Hobel sind an das Grundgestell fest angebaut<br />
und werden je nach System geschwenkt oder linear bewegt<br />
» die gesamte Maschine wird auf Rädern mit einer Zugmaschine<br />
zu ihrem Einsatzort gezogen<br />
» geländegängig<br />
» die Schweißmaschine kann vom Chassis mit Raupen abgebaut<br />
werden<br />
» Heizelement und Hobel sind an das Grundgestell fest angebaut<br />
und werden je nach System geschwenkt oder linear bewegt<br />
» autarker Betrieb, da Stromgenerator angebaut ist<br />
62 04-05 / 2013
SPECIAL ROHRLEITUNGSBAU AKTUELL FACHBERICHT<br />
schweißung“ erfolgt in der Regel durch den Schweißer<br />
„vor Ort“, spontan und bei dem ersten Eintreffen auf der<br />
Baustelle. Damit ist der Prozessoptimierung auch ein ausreichend<br />
großer Spielraum eingeräumt. Aufgabe des für die<br />
Baustelle Verantwortlichen sollte sein, die Abläufe für den<br />
Schweißprozess im Vorfeld zu planen und wenigstens in<br />
einer Skizze zu Papier zu bringen (Bild 3). Die Erfahrungen<br />
aus vorangegangenen Maßnahmen fließen in die Planungen<br />
selbstverständlich ein.<br />
dass ein geeignetes Transportmittel bereitgestellt ist, ggf.<br />
mit einer weiteren Person, z. B. ein Helfer beim Tragen oder<br />
ein Baggerfahrer. Anfahrten, Transport der Maschinen zur<br />
Baustelle, Einrichtung der Baustelle (Schutzzelt etc.), Graben-<br />
oder Rohrbettungsarbeiten, Abbau oder Sicherung der<br />
Baustelle über Nacht und andere erforderliche Aktivitäten<br />
Ein oder zwei Bediener?<br />
Die Produktivität beim Stumpfschweißen wird auch durch<br />
die Anzahl der Bediener beeinflusst, da viele Verfahrensschritte<br />
manuell sind. Häufig wird die Frage gestellt, ob ein<br />
oder zwei Bediener für eine Stumpfschweißmaschine benötigt<br />
wird bzw. werden? Aus Gründen der Arbeitssicherheit<br />
setzt man in der Praxis auf Baustellen meist ein eingespieltes<br />
Team aus zwei Bedienern ein. Je nach Land ist dies gesetzlich<br />
auch vorgeschrieben. Nach Erfahrungen von WIDOS ist<br />
folgender genereller Bedienerbedarf festzustellen:<br />
a) Ein Bediener<br />
» Manuelle Schweißmaschinen für Rohre bis ca.<br />
d 160 mm.<br />
» Halbautomatische (CNC-) Schweißmaschinen für Rohre<br />
bis ca. d 250 mm.<br />
» Alle Schweißmaschinen mit Planhobel und Heizelement<br />
fest angebaut/integriert sowie vollhydraulischer Betätigung<br />
über ein Bedienpult.<br />
Bild 3: Handskizze Schweißplatz<br />
b) Zwei Bediener<br />
» Schweißmaschinen für Rohre von ca. d 315 mm bis ca.<br />
d 500 mm.<br />
» Schweißmaschinen mit integrierten Kran (Hydraulikkran<br />
oder Hebelift) für Rohre ca. ≥ d 630 mm.<br />
VORGEHENSWEISE<br />
Summe aus definierten Schweißzeiten und dem<br />
Handling<br />
Produktivität des Stumpfschweißens =<br />
Anzahl Schweißungen<br />
8h (Arbeitstag)<br />
Die Produktivität des Stumpfschweißens in diesem Fachbericht<br />
wird mit der Anzahl Schweißungen/8h (Arbeitstag)<br />
festgelegt. Dies erfolgt in Übereinstimmung mit der Methodologie<br />
der Forschungsarbeit des SKZ.<br />
Für den Schweißablauf und die Schweißparameter wird<br />
die DVS-Richtlinie 2207 Teil 1 (September 2005) zugrunde<br />
gelegt. Um den Zeitbedarf für eine Schweißung zu bestimmen,<br />
wird der Ablauf in Teilprozesse untergliedert. Zu den<br />
definierten Schweißzeiten nach DVS 2207-1 werden die<br />
Aufheizdauer des Heizelementes zu Arbeitsbeginn und die<br />
jeweilige Zeitdauer des Handling addiert. Dazu gehören die<br />
Schweißnahtvorbereitung, das Einspannen und Ausrichten<br />
der Rohre, das Ausspannen der Rohre, der Transport zur<br />
nächsten Schweißung; von Rohrende zu Rohrende. Diese<br />
Zeiten basieren auf Erfahrungswerten. Es wird unterstellt,<br />
Bild 4.1 und 4.2: Beispiele für gute Bedingungen auf der Baustelle<br />
Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH & Co. KG)<br />
04-05 / 2013 63
FACHBERICHT SPECIAL ROHRLEITUNGSBAU AKTUELL<br />
werden nicht berücksichtigt und müssen individuell im Einzelfall<br />
zur Schweißdauer addiert werden.<br />
Tabelle 6 zeigt die Vorgehensweise exemplarisch an einem<br />
PE-Rohr da 110 mm, SDR 11.<br />
Beispielhaft werden in diesem Artikel einige oft verwendete<br />
Rohrdimensionen und SDR-Stufen ausgewählt. Die<br />
Produktivität für andere SDR-Stufen kann davon relativ<br />
leicht abgeleitet werden, da der wesentliche Einflussfaktor<br />
in Bezug auf die Rohrwanddicke die Abkühlzeit<br />
darstellt.<br />
ERGEBNISSE<br />
Bild 5: Zwei Schweißer-Teams für größeren Bedarf an Schweißungen<br />
Tabelle 6: Untergliederung der Stumpfschweißungen in Teilprozesse<br />
(Beispiel)<br />
Zeit in min, Beispiel da<br />
Start<br />
110 mm, SDR 11, siehe auch<br />
SKZ-Forschungsbericht [3]<br />
Schweißmaschine am Ort der<br />
Schweißung, Heizelement noch kalt.<br />
Aufheizen 20<br />
↓<br />
Handling (Einspannen, Hobeln, Reinigen) 6,5<br />
↓<br />
Angleichen 1<br />
↓<br />
Anwärmen 1,58<br />
↓<br />
Umstellen 0,12<br />
↓<br />
Fügedruckaufbau 0,12<br />
↓<br />
Abkühlen 13<br />
↓<br />
Rohr ausspannen, Maschine zur<br />
4<br />
nächsten Schweißung tragen<br />
Ende erste Schweißung<br />
Zwischensumme 46,32 min<br />
↓<br />
Handling (Einspannen, Hobeln, Reinigen) 6,5<br />
↓<br />
…<br />
…<br />
Ende zweite Schweißung<br />
Zwischensumme 72,64 min<br />
↓<br />
…<br />
…<br />
↓<br />
Ende letzte Schweißung ≤ 480 min (= 8h)<br />
Kennzahlen für gute Baustellenbedingungen<br />
Sonderfälle oder erschwerte Bedingungen auf der Baustelle<br />
sind weder kalkulierbar noch zufriedenstellend genau<br />
einzuschätzen. Daher wird hier eine gute Baustellenbedingung<br />
vorausgesetzt, die sich insbesondere für Schweißarbeiten<br />
in einigen wesentlichen Punkten kennzeichnet.<br />
Die Schweißer sind geschult und besitzen Praxiserfahrung.<br />
Das Gelände oder der Graben sind leicht zugänglich. Die<br />
Rohre in Stangenware besitzen gute Qualität. Außerdem<br />
wird schönes Wetter für Schweißarbeiten unterstellt, d. h.<br />
trocken, ca. 20 °C Umgebungstemperatur und Windstille<br />
oder leichter Wind. Bild 4.1 und Bild 4.2 zeigen zwei Beispiele<br />
für gute Bedingungen auf der Baustelle.<br />
Die Ergebnisse, siehe Tabelle 7, gelten für Stumpfschweißmaschinen<br />
von WIDOS in einfacher Ausführung, d.h. ohne<br />
Räder oder eigenen Antrieb. Bei Verwendung von mobilen<br />
WIDOS Schweißmaschinen kann die Anzahl der Schweißungen<br />
erhöht werden.<br />
Wie im Kapitel „Vorgehensweise“ beschrieben, handelt es<br />
sich um eine Kombination von Berechnung, dem Aufsummieren<br />
von Prozesszeiten und Erfahrungen aus der Praxis.<br />
Eine Validierung der Einzelfälle auf der Baustelle wurde<br />
noch nicht durchgeführt. Dennoch können die Angaben<br />
dem Schweißunternehmen einen Anhaltspunkt für die<br />
Beurteilung der eigenen Produktivität geben. Bei großen<br />
Abweichungen kann der Schweißablauf intern auditiert und<br />
ggf. können Arbeitsschritte optimiert werden. Im Sinne von<br />
Lean-Prozessverbesserungen können u. U. Ineffizienzen<br />
aufgespürt werden.<br />
Als deutlichstes Ergebnis im Zusammenhang mit Produktivitätssteigerung<br />
bestätigt sich, wie bereits durch<br />
das SKZ festgestellt, dass der Einsatz von zwei Schweißmaschinen<br />
mindestens eine Verdoppelung der Schweißungen<br />
pro Tag bringt, bei gleicher Bedienerzahl; Ausnahme<br />
bilden hier nur die kleinen Rohrdurchmesser,<br />
z. B. da 50 mm.<br />
Bei Einsatz von drei Schweißmaschinen lässt sich feststellen:<br />
Ab etwa da 630 mm findet keine signifikante Produktivitätssteigerung<br />
statt; der Aufwand für die Bereitstellung<br />
einer dritten Schweißmaschine rechtfertigt nicht mehr<br />
den Mehrwert durch höhere Produktivität. Daher sollte<br />
bei einem größeren Bedarf an Schweißungen pro Tag ein<br />
weiteres Schweißer-Team (zwei Bediener) mit ein oder zwei<br />
Maschinen eingesetzt werden (Bild 5).<br />
64 04-05 / 2013
SPECIAL ROHRLEITUNGSBAU AKTUELL FACHBERICHT<br />
Tabelle 7: Produktivität unter guten Baustellenbedingungen (Beispiele)<br />
Rohre<br />
aus PE 100<br />
Anzahl Schweißungen / 8 h (Arbeitstag) bei guten Baustellenbedingungen und gutem Wetter<br />
d<br />
in mm<br />
SDR Stufe Eine Schweißmaschine Zwei Schweißmaschinen Drei Schweißmaschinen Bediener<br />
50 11 30 49<br />
*<br />
1<br />
110 11 17 34<br />
*<br />
1<br />
200 11 11 24 31 1<br />
315 11 7 18 23 2<br />
500 11 5 12 16 2<br />
630 17 5 11 13 2<br />
1.000 17 4 10 12 2<br />
1.200 21 4 10 11 2<br />
1.600 26 3 7<br />
**<br />
2<br />
***<br />
2.000 26 3 7<br />
**<br />
2<br />
*<br />
Eine dritte Schweißmaschine für einen Bediener macht normalerweise keinen<br />
Sinn, da die Abkühlzeit nicht ausreicht, um während dieser zwei Schweißungen<br />
(Vorbereitung bis zum Beginn des Abkühlens) durchzuführen.<br />
**<br />
Die Abkühlzeit entspricht in vielen Fällen der Zeit einer Schweißung (Vorbereitung<br />
bis zum Beginn des Abkühlens), so dass hier, sozusagen in flüssiger<br />
Folge, an einer Schweißmaschine und dann an der zweiten Schweißmaschine<br />
gearbeitet wird. Eine dritte Schweißmaschine kann von zwei Bedienern<br />
nicht mehr bedient werden.<br />
***<br />
In Anlehnung an die DVS-Richtlinie geschweißt, da die Wanddicke > 70 mm<br />
beträgt.<br />
Tipps zur Produktivitätssteigerung<br />
» Tipp 1: Der Einsatz von zwei Schweißmaschinen erhöht<br />
deutlich die Produktivität.<br />
» Tipp 2: Auf freiem Feld sind Schweißmaschinen auf<br />
Rädern oder Raupen für den Transport von Vorteil.<br />
» Tipp 3: Es wird ein der Baustellensituation geeignetes<br />
Schweißmaschinenkonzept eingesetzt, beispielsweise<br />
ist bei WIDOS Standard-Schweißmaschinen der vierte<br />
Spannring abnehmbar, was die Maschine für enge Situationen<br />
noch kleiner, leichter und handlicher macht.<br />
» Tipp 4: Da das Grundgestell der Schweißmaschine in<br />
der Abkühlphase „wartet“ (die Rohre zusammendrückt)<br />
kann mit einem Heizelement / Planhobel ein weiteres<br />
Grundgestell bedient werden. Neben der Einsparung<br />
von Maschinenteilen liegt ein weiterer Vorteil darin, dass<br />
der Stromverbrauch annähernd halbiert wird.<br />
» Tipp 5: Durch den Einsatz qualitativ hochwertiger Schweißmaschinen<br />
erspart man sich Pannen auf der Baustelle.<br />
» Tipp 6: Qualitativ hochwertige Rohre erleichtern den<br />
Versatzausgleich und können so Zeit sparen. Insbesondere<br />
bei Schutzmantelrohren sind Ovalität und konischer<br />
Einfall der Rohrenden generell geringer, im Vergleich<br />
zu Standard PE-Rohren. Ein zusätzliches Schneiden der<br />
Rohrenden auf der Baustelle vor der Schweißung ist<br />
daher nicht notwendig.<br />
» Tipp 7: Verwendung von professionellen Werkzeugen und<br />
Zubehör, wie z. B. höhenverstellbaren Rollenböcken. Diese<br />
verringern nicht nur die Bewegungskraft für das Rohr, sondern<br />
machen es oft erst möglich, dass auch sehr lange<br />
Rohrleitungsteile geschweißt werden können. Sie erleichtern<br />
auch den Versatzausgleich und steigern durch minimalen<br />
Versatz die Qualität der Rohrverbindung. Spezielle<br />
Kunststoffrohr-Sägen, wie z. B. kettengeführte Umlaufkreissägen<br />
oder Kappsägen, verkürzen die Vorbereitungsdauer.<br />
FAZIT UND AUSBLICK<br />
Um das Potenzial zur Produktionssteigerung auszunutzen,<br />
gibt es viele praktische Möglichkeiten für den Anwender.<br />
Allerdings gibt es auch die definierten Abkühlzeiten nach<br />
DVS-Richtlinie. Diese sind so ausgelegt, dass sie universell<br />
funktionieren bzw. ausreichend sind, d. h. bei niedrigen und<br />
auch bei hohen Umgebungstemperaturen. Der Tatsache,<br />
dass eine Schweißnaht bei niedrigen Umgebungstemperaturen<br />
schneller abkühlt, wird dabei nicht Rechnung getragen.<br />
Im Sonderfall Schweißungen, die unter Werkstattbedingungen<br />
hergestellt werden, ist nach der DVS-Richtlinie 2207-1<br />
die Verringerung der Abkühlzeit bis zu 50 % erlaubt, wenn<br />
04-05 / 2013 65
FACHBERICHT SPECIAL ROHRLEITUNGSBAU AKTUELL<br />
die Wanddicke ≥ 15 mm ist und nach dem Schweißen nur<br />
geringfügige Belastungen auf die Fügeverbindung einwirken.<br />
Die Verkürzung der Abkühlzeit auf der Baustelle ist<br />
nicht zulässig, aber häufig ein Thema für Diskussionen.<br />
Untersuchungen für Einzelfälle wurden bereits durchgeführt<br />
[7]. Insbesondere im Zusammenhang mit unterschiedlichen<br />
Schweißstandards auf der Welt und der Globalisierung wird<br />
ein Bedarf für genauere Untersuchungen entstehen.<br />
Weiterhin sind die Hersteller von Stumpfschweißmaschinen<br />
gefordert durch innovative Technik bzw. Automatisierung die<br />
Handling-Zeiten weiter zu verkürzen, selbstverständlich bei<br />
gleichbleibender Schweißnahtqualität. Die neuen Schweißmaschinenentwicklungen<br />
werden ein spannendes Thema bleiben.<br />
Teil 2 dieses Fachartikels beschreibt die kalkulatorische Erfassung<br />
der Verbindungstechnik in dem Onlinetool www.webkalkulator24.de<br />
und wird in <strong>3R</strong>-Ausgabe 7-8 | 2013 erscheinen.<br />
LITERATUR<br />
[1] DVS-Taschenbuch „Fachbuchreihe Schweißtechnik, Band 68/IV,<br />
14. Auflage, 2011, Verlag für Schweißen und verwandte Verfahren<br />
DVS Media GmbH, Düsseldorf DVS pamphlet, DVS Technical<br />
Codes on Plastics Joining Technologies: English Edition Volume 3,<br />
2nd edition, 2011, Verlag für Schweißen und verwandte Verfahren<br />
DVS-Verlag GmbH, Düsseldorf<br />
[2] Dipl.-Ing. Markus Hoffmann, Dr. rer. nat. Benjamin Baudrit,<br />
Dipl.-Volksw. Oliver Stübs, Dr.-Ing. Peter Heidemeyer, Prof. Dr.-<br />
Ing. Martin Bastian, SKZ – Das Kunststoff-Zentrum, Würzburg:<br />
Ökonomische und ökologische Bewertungen beim Schweißen<br />
von Kunststoffrohren, Economic and ecological assessments with<br />
regard to the welding of plastic pipes, Joining Plastics 3-4/2012,<br />
DVS Media GmbH, Düsseldorf<br />
[3] Dr. Benjamin Baudrit, Dipl.-Volksw. Oliver Stübs, Ökologischökonomische<br />
Bewertung und Verfahrensoptimierung von<br />
Fügeverfahren am Beispiel von Kunststoffrohrsystemen.<br />
Abschlussbericht über ein Forschungsprojekt, gefördert unter dem Az:<br />
27249/2 – 21/2 von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. SKZ – Das<br />
Kunststoff-Zentrum, SKZ - KFE gGmbH. Würzburg, Dezember 2012<br />
[4] ISCO Fusion Manual, 2007, ISCO Industries LLC, USA, http://www.<br />
isco-pipe.com/media/7814/fusion%20manual%202007%20<br />
metric.pdf, (Internet download 19.11.2012)<br />
[5] American National Standard ASTM F2620 – 06, Standard Practice<br />
for Heat Fusion Joining of Polyethylene Pipe and Fittings, ASTM<br />
International, www.astm.org, West Conshohocken (USA), 2006<br />
[6] INTERNATIONAL STANDARD ISO 21307:2009(E), Plastics pipes<br />
and fittings – Butt fusion jointing procedures for polyethylene<br />
(PE) pipes and fittings used in the construction of gas and water<br />
distribution systems, www.iso.org, Genf (Schweiz), 2009<br />
[7] Holger Hesse, egeplast, Werner Strumann GmbH & Co.KG,<br />
Greven; Johannes Grieser, Hessel Ingenieurtechnik GmbH,<br />
Roetgen; Dr. Uwe Egen, Rothenberger Werkzeuge Produktions<br />
GmbH, Kelkheim, Wirtschaftliches Optimierungspotential beim<br />
Heizelementstumpfschweißen von Schutzmantelrohren aus<br />
spannungsrissbeständigem Polyethylen, Economic Optimisation<br />
Potential of Pipes with a Crack Resistant Polyethylene and<br />
Protective Outer Layer during Heated Element Butt Welding,<br />
JOINING PLASTICS 2/07, DVS Media GmbH, Düsseldorf<br />
[8] Johannes Grieser, HESSEL Ingenieurtechnik GmbH, Überprüfung<br />
des geforderten Zeitstandzug-Schweißfaktors und der<br />
Mindestlebensdauer von Schweißverbindungen aus Polyethylen,<br />
Checking of the required long-term tensile welding factor and the<br />
minimum time of welded joints made of polyethylene, JOINING<br />
PLASTICS 1 / 2007, DVS Media GmbH, Düsseldorf<br />
[9] Dr.-Ing. Joachim Hessel, HESSEL Ingenieurtechnik GmbH,<br />
Langzeitverhalten von Schweißverbindungen an Großrohren aus<br />
Polyethylen, 4-5/2011, <strong>3R</strong> international, Vulkan-Verlag GmbH<br />
Essen<br />
[10] Dr.-Ing. Joachim Hessel, HESSEL Ingenieurtechnik GmbH Das<br />
Langzeitverhalten von Schweißverbindungen an Halbzeugen<br />
aus Polyethylen– Eine Frage der Kerbempfindlichkeit, The creep<br />
fracture behaviour of welded semi-finished products made from<br />
polyethylene – A matter of notch sensitivity, JOINING PLASTICS<br />
2 / 2007, DVS Media GmbH, Düsseldorf<br />
[11] Dr.-Ing. Joachim Hessel, HESSEL Ingenieurtechnik GmbH, 100<br />
Jahre Nutzungsdauer für Rohre aus Polyethylen, Rückblick und<br />
Perspektive. 100-years service-life for polyethylen pipes, review and<br />
prospects, 4/2007, <strong>3R</strong> international, Vulkan-Verlag GmbH Essen<br />
Halle 3.2., Stand 113<br />
AUTOREN<br />
Dipl.-Ing. (FH) HOLGER HESSE<br />
egeplast Werner Strumann GmbH & Co.<br />
KG, Greven<br />
Tel. +49 2575 9710-252<br />
E-Mail: holger.hesse@egeplast.de<br />
Dipl.-Ing. (FH) BERND KLEMM<br />
WIDOS Wilhelm Dommer Soehne GmbH,<br />
Ditzingen<br />
Tel. +49 171 4234466<br />
E-Mail: bernd.klemm@widos.de<br />
Besuchen Sie uns im Internet:<br />
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
66 04-05 / 2013
SPECIAL ROHRLEITUNGSBAU AKTUELL FACHBERICHT<br />
Integrale Langzeit-Prüfmethode für<br />
Heizelementstumpf- bzw. Heizwendelschweißungen<br />
an Rohren aus PE<br />
Zur Beschreibung des langzeitigen Bruchverhaltens von Heizelement-Stumpfschweißen bzw. Heizwendelschweißungen<br />
wird eine neue integrale Prüfmethode, d. h. die Prüfung am gesamten Rohr, vorgestellt, die gegenüber der Prüfung<br />
nach DVS 2203-3 an Proben, die aus den Schweißungen herauspräpariert sind, den Vorteil aufweist, dass ein Einfluss der<br />
Probenpräparation ausgeschlossen ist und die „schwächste Stelle“ mit Sicherheit erfasst wird. Bei Heizwendelschweißungen<br />
wird darüber hinaus mit der integralen Prüfmethode die in der Praxis auftretende Spannung in Axialrichtung und deren<br />
Auswirkung auf das Langzeitverhalten von Rohrleitungssystemen beschrieben. Bei den mit der integralen Prüfmethode<br />
untersuchten Heizelement-Stumpfschweißungen wird die Gültigkeit der Festlegungen in DVS 2207-1 hinsichtlich<br />
der Schmelzindexgruppen betrachtet. Derzeit sind bei der HESSEL Ingenieurtechnik mit der integralen Prüfmethode<br />
Zeitstandzugprüfungen an Heizelementstumpf- bzw. Heizwendelschweißungen an Rohren bis zu einem Außendurchmesser<br />
von 160 mm möglich.<br />
PRÜFUNG DES LANGZEITVERHALTENS VON<br />
SCHWEISSVERBINDUNGEN<br />
Zur Prüfung des Langzeitverhaltens von Schweißverbindungen<br />
aus PE-Rohren stehen die Richtlinien des Deutschen<br />
Verbandes für Schweißtechnik e.V. (DVS) [1] bzw. Europäische<br />
Normen [2] zur Verfügung.<br />
In der Richtlinie DVS 2203-4 bzw. in EN 12814-3 sind die<br />
grundlegenden Bedingungen für den Zeitstandzugversuch<br />
festgelegt. Im Beiblatt 3 zu DVS 2203-4 ist darüber hinaus<br />
ein Verfahren beschrieben, das es erlaubt, die Mindestlebensdauer<br />
einer Schweißverbindung prüftechnisch abzusichern.<br />
Im <strong>aktuell</strong>en Entwurf des „Anhang B“ der prEN 12814-3:<br />
2012“ wird der „Zeitstand-Zugversuch am ganzen Rohr“<br />
beschrieben. Die Abstimmung der europäischen Mitgliedstaaten<br />
hatte ein zustimmendes Ergebnis, so dass die Herausgabe<br />
der Norm in Kürze zu erwarten ist.<br />
Um in vertretbaren Zeiten zu Endergebnissen (Brüchen)<br />
bei der Verwendung moderner Rohstoffe (PE 100; PE 100-<br />
RC) zu gelangen, ist eine Beschleunigung des Langzeit-<br />
Bruchmechanismus sowohl durch die Prüfung bei höheren<br />
Temperaturen, als auch die Verwendung von geeigneten<br />
Netzmitteln zwingend notwendig.<br />
In Bild 1 sind die Prüfkörper nach der Langzeitprüfung<br />
von aus der Schweißung präparierten Einzelproben und<br />
der Prüfkörper nach der integralen Prüfmethode gezeigt.<br />
PRÜFAUFBAU FÜR DIE INTEGRALE PRÜFMETHODE<br />
Der Prüfaufbau für Zeitstandzugprüfungen nach der integralen<br />
Prüfmethode ist in Bild 2 gezeigt. Der gezeigte Prüfaufbau<br />
erlaubt Prüflasten von bis zu 200 kN (ca. 20 Tonnen)<br />
bei Prüftemperaturen von -20 °C bis +90 °C.<br />
Bei Versuchstemperaturen unter 0 °C bieten sich wässrige<br />
Glykollösungen als Temperiermedium an. Zur Beschleunigung<br />
des Bruchverhaltens bei Belastungen unterhalb der<br />
Streckspannung („Zeitstandbrüche, Sprödbrüche) durch<br />
langsamen Rissfortschritt werden wässrige Netzmittellösungen<br />
angewandt.<br />
Die Prüfkräfte können auf ±1 N konstant gehalten werden.<br />
Die Temperatur-Regelgenauigkeit der Prüfflüssigkeit<br />
beträgt ±0,5 K. Das Kriechverhalten der Probe<br />
kann mit einer Auflösung von 1 µm verfolgt werden<br />
(Bild 3).<br />
Die Auswertung der Probenverlängerung über<br />
der Zeit mit der o.g. Auflösung erlaubt die Unterscheidung<br />
zwischen reinem Kriechverhalten und<br />
dessen Überlagerung aufgrund beginnender Rissbildung<br />
durch die Berechnung des Wendepunktes<br />
im Kurvenverlauf.<br />
Bild 1: Prüfkörper nach der Langzeitprüfung (links: Prüfung von Einzelproben,<br />
rechts: Prüfung mit der integralen Prüfmethode; Rohre Da110 mm SDR 11)<br />
VERSUCHSPROGRAMM<br />
Es wurden Rohre aus Polyethylen (Da 110 mm<br />
SDR 11 bzw. Da 160 mm SDR 11) nach Richtlinie<br />
DVS 2207-1 heizelementstumpf geschweißt. Die<br />
Schweißpartner hatten einen max. Unterschied<br />
04-05 / 2013 67
FACHBERICHT SPECIAL ROHRLEITUNGSBAU AKTUELL<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
Bild 2: Prüfeinrichtung für die Zeitstandprüfung nach der<br />
integralen Prüfmethode (1. Universal-Prüfmaschine, 2. Steuerung,<br />
3. Datenspeicher, 4. Thermoelement, 5. Isoliertes Bad, 6. Heizung)<br />
Bild 3: Verlängerung der Probe während der Prüfzeit<br />
Bild 4: Ergebnisse von Zeitstandzugversuchen an gekerbten Proben<br />
bei 2 verschiedenen Prüfbedingungen<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
in der Schmelzeflussrate (MFR; 190/5) von 0,18 bis 1,75<br />
und liegen damit außerhalb des Bereichs in dem von einer<br />
Schweißbarkeit ausgegangen wird.<br />
Die Zeitstandzugprüfungen erfolgten bei einer Zugspannung<br />
von 3 N/mm² und der Versuchstemperatur 90 °C<br />
unter Verwendung einer wässrigen Netzmittellösung.<br />
Das Versuchsprogramm im Einzelnen ist in Tabelle 1<br />
zusammengefasst.<br />
Im Hinblick auf die Interpretation der Versuchsergebnisse an<br />
den Rohrschweißungen wurden begleitende Untersuchungen<br />
zum Widerstand der Rohre gegenüber Spannungsrissbildung<br />
durchgeführt.<br />
Hierzu wurden FNCT-Proben [4] aus den Rohren in Längsrichtung<br />
herausgearbeitet und im Zeitstandzugversuch bei<br />
einer Zugspannung von 4 N/mm² bei der Versuchstemperatur<br />
90 °C unter Verwendung der o. g. wässrigen Netzmittellösung<br />
geprüft (ACT-Prüfbedingungen) [5].<br />
Zur Einordnung der Standzeiten im ACT sind in Bild 4<br />
die korrespondierenden Mindestwerte nach DVS 2205-<br />
1 Beiblatt 1 für PE 63, PE 80, PE 100 bzw. PE 100-RC<br />
eingezeichnet.<br />
VERSUCHSERGEBNISSE<br />
Da sämtliche Brüche außerhalb der Fügeebene erfolgten,<br />
ist bei allen untersuchten Schweißkombinationen die<br />
Schweißbarkeit gegeben. Dieses Ergebnis wurde ebenfalls<br />
an gepressten Tafeln mit Schmelzeflussraten zwischen 0,2<br />
und 29 (190/5) gefunden [3].<br />
Bestätigt werden diese Ergebnisse auch durch Untersuchungen<br />
des SKZ [4].<br />
Aufgrund des typischen Bruchverhaltens von Schweißverbindungen<br />
nach DVS 2207-1 durch Bruch außerhalb der<br />
Fügeebene kann die Frage der „Schweißbarkeit“ auch mit<br />
der integralen Prüfmethode mit einem reduzierten Aufwand<br />
ermittelt werden. Es genügt demnach an einer genügenden<br />
Anzahl von Rohrschweißungen festzustellen, ob der Zeitstandbruch<br />
in der Fügeebene verläuft oder von der Wulstkerbe<br />
ausgehend durch das Grundmaterial fortschreitet.<br />
Wird ausnahmslos festgestellt, dass der Bruch von der<br />
Wulstkerbe ausgehend durch das Grundmaterial verläuft,<br />
ist die „Schweißbarkeit“ gegeben.<br />
Die Quantifizierung der Mindestlebensdauer ist danach<br />
durch Prüfungen nach der Richtlinie DVS 2203-4 Beiblatt 3<br />
möglich und hängt nur noch von der Kerbempfindlichkeit<br />
(„Spannungsrissbeständigkeit“) des Grundwerkstoffs bzw.<br />
dessen Veränderung bei der Rohrextrusion ab. Mit steigender<br />
„Spannungsrissbeständigkeit“ des Grundwerkstoffs<br />
verlängert sich im Allgemeinen die Mindestlebensdauer der<br />
Schweißverbindungen aus diesen Werkstoffen [5].<br />
AUSBLICK<br />
Zeitstandzugprüfungen an Muffen-Schweißverbindungen<br />
mit der integralen Prüfmethode erlauben die Beurteilung<br />
des Zeitstanderhaltens der Muffen bei Belastung in axialer<br />
Richtung.<br />
Erste Ergebnisse derartiger Versuche zeigen sowohl einen<br />
Einfluss des Heizwendeldrahtes auf die axiale Haltbarkeit von<br />
68 04-05 / 2013
SPECIAL ROHRLEITUNGSBAU AKTUELL FACHBERICHT<br />
Tabelle 1: Versuchsprogramm der Zeitstandzugversuche an<br />
geschweißten Rohren<br />
Versuch<br />
Nr.<br />
MFR der<br />
Schweißpartner<br />
Farbe der<br />
Schweißpartner<br />
Bemerkung<br />
I 0,18 .. 1,75 schwarz - natur PE 100 – PE-HD<br />
II 0,18 .. 0,9 schwarz- gelb PE 100 – PE-MD<br />
III 1 ,0 .. 1,75 gelb - natur PE-MD – PE-HD<br />
IV 0,18 .. 0,18 schwarz PE 100 – PE 100<br />
V 0,9 .. 0,9 gelb PE-MD – PE-MD<br />
VI 0,79 .. 0,48 gelb - blau PE-MD – PE 100<br />
VII 0,48 .. 0,48 blau-blau PE-100 – PE 100<br />
VIII 0,79 .. 0,79 gelb-gelb PE-MD – PE-MD<br />
[3] J. Hessel, Vortrag, Erfahrungsaustausch auf der Plenarsitzung<br />
DVS AGW4, 16. Mai 2012<br />
[4] Baudrit, B.; Kraft, D.; Hack, U.; Heidemeyer, P. und Bastian, M.:<br />
Schweißen gleichartiger Kunststoffe mit stark unterschiedlichen<br />
reologischen Eigenschaften, Joining Plastics 2/2012 und<br />
Heizelementstumpfschweißen reologisch unterschiedlicher<br />
Materialien, Joining Plastics 1/2013<br />
[5] Hessel, J.: Das Langzeitverhalten von Schweißverbindungen an<br />
Halbzeugen aus Polyethylen – Eine Frage der Kerbempfindlichkeit<br />
– Joining Plastics 2/2007, S. 161-163<br />
AUTOREN<br />
eingeschweißten Rohren (Schweißfaktor!) als auch einen<br />
zeitstandverkürzenden Einfluss von Heizwendelmuffen bei<br />
Kontakt mit spannungsrissauslösenden Betriebsmedien.<br />
Hier bietet sich die integrale Prüfmethode zur Kennwertermittlung<br />
an.<br />
Dr.-Ing. JOACHIM HESSEL<br />
HESSEL Ingenieurtechnik GmbH, Roetgen<br />
Tel. +49 2471 / 920 2211<br />
E-Mail: joachim.hessel@hessel-ingtech.de<br />
LITERATUR:<br />
[1] DVS-Taschenbuch „Fachbuchreihe Schweißtechnik, Band 68/IV,<br />
14. Auflage, 2012, Verlag für Schweißen und verwandte Verfahren<br />
DVS-Verlag GmbH, Düsseldorf<br />
[2] EN 12814-3 „Prüfen von Schweißverbindungen aus<br />
thermoplastischen Kunststoffen – Teil 3: Zeitstandzugversuch“<br />
2013-03-19 Anzeige_182x125_Wasser.qxp 19.03.2013 10:44 Seite 1<br />
Dr.-Ing. HOLGER WARNECKE<br />
HESSEL Ingenieurtechnik GmbH, Roetgen<br />
Tel. +49 2471 / 920 2222<br />
E-Mail: holger.warnecke@hessel-ingtech.de<br />
Sicherer Schutz für alle Bedingungen<br />
MAPEC ®<br />
Polyethylen<br />
Epoxidharzprimer<br />
Zementmörtel<br />
Stahlrohr<br />
Haftvermittler<br />
MAPEC ® Mehrschichtsystem<br />
Polypropylen oder Polyamid<br />
MAPEC ® mit FZM-N<br />
Faserzementmörtel<br />
MAPEC ® mit T-Rippe und FZM-S<br />
T-Rippe<br />
Salzgitter Mannesmann Line Pipe, mit Werken in Siegen und Hamm, ist<br />
ein weltweit aktiver, technologisch führender Partner für HFI (hochfrequenz-induktiv)-längsnahtgeschweißte<br />
Stahlrohre. Dazu gehören zementmörtelausgekleidete<br />
Trinkwasser- und Abwasserleitungsrohre, Rohre für<br />
Gas- und Ölpipelines, Rohre für den Maschinen- und Anlagenbau sowie<br />
Ölfeldrohre, Fernwärmerohre und Konstruktionsrohre.<br />
Produktionsprogramm für Trinkwasser- und Abwasserleitungsrohre:<br />
• Außendurchmesser von 114,3 mm (4 ½'') bis 610,0 mm (24'')<br />
• Wanddicken von 3,2 mm (0,126'') bis 25,4 mm (1'')<br />
• Rohrlängen bis 16 m<br />
• Schweiß- und Klemmverbindungen<br />
• Zementmörtel-Auskleidung<br />
• MAPEC ® PE oder PP Umhüllung, Faserzementmörtel-Ummantelung<br />
• Abhängig von der Verlegung steht eine Bandbreite spezieller Umhüllungen<br />
zur Verfügung: Längsrippe, Rough Coating, T-Profil mit FZM-S etc.<br />
Zertifizierung nach DVGW/ÖVGW, des Weiteren nach DIN EN ISO 9001:2008,<br />
DIN EN ISO 14001:2009 und OHSAS 18001:2007; zugelassener Lieferant bei<br />
allen bedeutenden national und international tätigen Versorgungsunternehmen.<br />
Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH<br />
In der Steinwiese 31 · 57074 Siegen, Germany<br />
Tel: +49 271 691-0 · Fax: +49 271 691-299<br />
info@smlp.eu · www.smlp.eu
FACHBERICHT PROJEKT KURZ RECHT BELEUCHTET & REGELWERK SPECIAL ROHRLEITUNGSBAU AKTUELL<br />
Punktlandung unter Zeitdruck<br />
Dükerbau unter dem Rhein erfolgreich abgeschlossen<br />
Mit der Erstellung eines rund 430 m langen Doppeldükers bei Rheinkilometer 740,7 hat eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE)<br />
aus den Unternehmen Friedrich Vorwerk KG (GmbH & Co.) und Hülskens Wasserbau GmbH & Co. KG die linke Rheinseite<br />
an das Düsseldorfer Fernwärmenetz angeschlossen. Trotz teilweise widriger Umstände wie Bombenfunden, schwierigem<br />
Baugrund und Hochwasserständen konnten sämtliche Arbeiten in nur dreimonatiger Bauzeit zur Zufriedenheit der<br />
Stadtwerke Düsseldorf Netz GmbH durchgeführt werden. Der neue Düker, der etwa 3 m unter der Rheinsohle verläuft,<br />
ist das Herzstück einer insgesamt 965 m langen Fernwärmetrasse, die seit dem Jahreswechsel Fernwärme vom Kraftwerk<br />
Lausward in den Stadtteil Heerdt transportiert. Sie ist für eine Leistung von 100 Megawatt ausgelegt.<br />
Seit rund 50 Jahren versorgen die Stadtwerke Düsseldorf<br />
die rechtsrheinischen Stadtteile der Landeshauptstadt mit<br />
Fernwärme. Nach dem Bau des Dükers können nun auch<br />
die Bewohner auf der linken Rheinseite eine Energieversorgung<br />
nutzen, bei der Fernwärme in Kraft-Wärme-Kopplung<br />
(KWK) erzeugt wird. „Vom erdgasbetriebenen Kraftwerk<br />
im Düsseldorfer Hafen, in dem die gleichzeitige Produktion<br />
von Strom und Wärme stattfindet, wird Fernwärme<br />
über Leitungen zu den Verbrauchern geschickt“, erklärt<br />
ein Sprecher der Stadtwerke Düsseldorf Netz GmbH das<br />
Verfahren. Gerade in Zeiten der Energiewende gilt es als<br />
kostengünstige und umweltfreundliche Alternative, um in<br />
urbanen Versorgungsstrukturen Abwärme aus Kraftwerken<br />
und Industrieanlagen zu nutzen. So zählen der verringerte<br />
Brennstoffbedarf für die Strom- und Wärmebereitstellung<br />
und die damit verbundenen stark reduzierten Schadstoffemissionen<br />
zu den Vorteilen der KWK, deren Ausbau durch<br />
das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) und das Erneuerbare-Energien-Gesetz<br />
(EEG) beschleunigt werden soll.<br />
UMFANGREICHES PAKET<br />
In der ersten Juliwoche 2012 begannen die Arbeiten an der<br />
neuen Fernwärmeleitung. „Zum Leistungsumfang gehörten<br />
neben der Verlegung der 965 m langen Fernwärmetrasse<br />
inklusive Düker – hierbei handelt es sich um Stahlmantelrohre<br />
im Nennweitenbereich DN 300 mit Mantelrohren<br />
DN 500 bis 700 – ihre landseitige Anbindung einschließlich<br />
Pressungen und Erdarbeiten“, erklärt Bauleiter Dipl.-Ing.<br />
(FH) Jens Annuschat, Friedrich Vorwerk KG (GmbH & Co.).<br />
Hinzu kam die Verlegung von 507 m Kunststoffverbundmantelrohr<br />
in den Nennweiten DN 300 (Produktenrohr)<br />
Fotos: Friedrich Vorwerk<br />
Bild 1: Mit einer rund 965 m langen Fernwärmetrasse hat eine ARGE aus den Unternehmen Friedrich Vorwerk KG (GmbH & Co.) und Hülskens<br />
Wasserbau GmbH & Co. KG bei Rheinkilometer 740,7 die linke Rheinseite an das Düsseldorfer Fernwärmenetz angeschlossen<br />
70 04-05 / 2013
SPECIAL ROHRLEITUNGSBAU AKTUELL RECHT & PROJEKT REGELWERK KURZ FACHBERICHT<br />
BELEUCHTET<br />
und DN 450 (Mantelrohr). Im Auftragsumfang enthalten<br />
waren ebenfalls zwei geschlossene Querungen DN 1400<br />
auf links- und rechtsrheinischer Seite, die mittels Horizontal-<br />
Pressbohrverfahren ausgeführt wurden.<br />
MIT HELIUM GEPRÜFT<br />
Die Dükerkonstruktion selbst erhielt zum Schutz gegen<br />
Beschädigungen und als Auftriebssicherung zusätzlich eine<br />
Betonummantelung. Vor der Verlegung wurde die Dükerrinne<br />
mit einem auf einem Lastkahn befindlichen Bagger<br />
quer zur Fließrichtung des Rheins etwa 4 m tief ausgehoben.<br />
Währenddessen wurden die Dükerrohre auf der<br />
rechten Rheinseite zu einem Strang zusammengeschweißt<br />
und mit dem Betonmantel versehen. Zeitgleich stellten die<br />
Leitungsbauer die spätere Verbindung des Dükers mit dem<br />
Kraftwerk her. Ende September – rechtzeitig vor dem Einsetzen<br />
des Rheinhochwassers – konnte der fertige Düker<br />
dann mittels Seilwinde von der rechten Rheinseite zum<br />
linksrheinischen Ufer gezogen und mit den landseitig verlegten<br />
Leitungen verbunden werden. Weiterhin erwähnenswert<br />
ist der Umstand, dass die Stahlmantelrohre der<br />
neuen Fernwärmeleitung auf einer Länge von 820 m elektrothermisch<br />
vorgespannt wurden. „Hierbei wird das Produktenrohr<br />
elektrisch erwärmt und dann über Festpunkte<br />
mit dem Mantelrohr verbunden“, erklärt Annuschat. „Auf<br />
diese Weise werden die auftretenden Längungen aus dem<br />
Betrieb mit Fernwärme vermindert und somit die Krafteintragung<br />
kontrolliert abgeführt.“ Außerdem wurde der Düker<br />
vor der Ummantelung einem Heliumtest unterzogen. „Auch<br />
das war eine besondere Anforderung des Auftraggebers“,<br />
so Annuschat. „Dabei wird Helium zwischen Mantel und<br />
Produktenrohr gepresst und jede Schweißnaht vor dem<br />
Ummanteln geprüft.“<br />
ENORMER ZEITDRUCK<br />
Dass das Projekt trotz teilweise widriger Rahmenbedingungen<br />
innerhalb des knapp bemessenen Zeitfensters termingerecht<br />
und zur Zufriedenheit des Auftraggebers ausgeführt<br />
werden konnte, ist ein gutes Beispiel für die Leistungsfähigkeit<br />
und das Know-how mittelständischer Bauunternehmen<br />
– hierin sind sich Projektleiter Dipl.-Ing. Holger Neuhaus,<br />
Hülskens Wasserbau GmbH & Co. KG, und sein Kollege Jens<br />
Annuschat von Vorwerk einig. Unvorhergesehene Ereignisse<br />
wie Bombenfunde, das Beseitigen von Findlingen oder die<br />
Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem Wasserstand<br />
des Rheins haben immer wieder dafür gesorgt, dass sich der<br />
Adrenalinspiegel der beteiligten Baupartner zeitweilig stark<br />
erhöhte. Doch um praktikable und zielführende Lösungen<br />
waren die Verantwortlichen nie verlegen. So verfügen die<br />
ARGE-Partner über jahrelange Erfahrungen – Hülskens im<br />
Wasserbau und Friedrich Vorwerk im erdverlegten <strong>Rohrleitungsbau</strong>.<br />
Das Leistungsspektrum der Friedrich Vorwerk<br />
KG (GmbH & Co.), die seit 1972 Mitglied im <strong>Rohrleitungsbau</strong>verband<br />
e. V. (rbv) ist, umfasst den Bau von Ver- und<br />
Entsorgungsnetzen für Gas, Wasser, Abwasser, Fernwärme<br />
und alle anderen Medien. Grundlage für die Ausführung<br />
auch anspruchsvoller Großprojekte wie der Auftrag der<br />
Bild 2: Mit einer Seilwinde wurde der fertige Düker von der<br />
rechten Rheinseite zum linksrheinischen Ufer gezogen<br />
Bild 3: Zeitgleich zur Verlegung des Dükers stellten die Leitungsbauer<br />
die landseitige Verbindung mit dem Kraftwerk her<br />
Düsseldorfer Stadtwerke sind qualifizierte Mitarbeiter und<br />
ein moderner Geräte- und Maschinenpark, der eine hohe<br />
Qualität der Ausführung sicherstellt. Hiervon zeugen auch<br />
verschiedene Zertifikate: Friedrich Vorwerk ist u. a. im Besitz<br />
der DVGW GW 301 mit den Gruppen G1 ge,st,pe / W1<br />
ge,st,az,ku,pe,gfk (<strong>Rohrleitungsbau</strong>), AGFW FW 601 mit<br />
der Gruppe FW1: ku-st (Fernwärme) sowie RAL-GZ: 961<br />
Ausführungsgruppe AK1 (Kanalbau).<br />
Bereits im Dezember 2012 konnten die ersten Haushalte<br />
über die neue Fernwärmeleitung versorgt werden. In diesem<br />
Jahr sollen noch weitere 2.000 m Fernwärmeleitungen für<br />
den Ausbau des Netzes in den Düsseldorfer Stadtteilen<br />
Heerdt und Oberkassel verlegt werden.<br />
04-05 / 2013 71
FACHBERICHT PROJEKT KURZ RECHT BELEUCHTET & REGELWERK SPECIAL ROHRLEITUNGSBAU AKTUELL<br />
HDD-Bohranlagen für Entgasungsbohrungen<br />
von Kohleflözen in Australien<br />
Die Prime Drilling GmbH hat sich auf den Bau von HDD-Spülbohranlagen bis 6.000 kN Zugkraft spezialisiert, mehr<br />
als 150 davon sind weltweit im Einsatz. Zwei Bohranlagen, entwickelt als Spezialversion auf Basis des bestehenden<br />
Bohranlagentyps PD 100/80 RPC 45 mit einer maximalen Zug- und Druckkraft von 100 Tonnen, sind seit Sommer 2012<br />
in Australien im Einsatz.<br />
Australien ist eines der größten Bergbauländer der Welt,<br />
10 % aller Kohlevorräte befinden sich dort. Im Rechnungsjahr<br />
2008/2009 wurden laut Wikipedia 487 Millionen<br />
Tonnen Kohle gefördert und davon 261 Millionen Tonnen<br />
exportiert. In New South Wales und Queensland gibt es<br />
große oberflächennahe Lagervorkommen der hochwertigen<br />
Steinkohle, die im Tagebau abgebaut werden sollen. Bei<br />
der Erschließung dieser Kohlelagerstätten fällt Flözgas, ein<br />
auf Methan basierendes Gas, an, das in Europa unter dem<br />
Namen Grubengas bekannt ist und in seiner Zusammensetzung<br />
dem Erdgas sehr ähnelt. Kohleflözgas entsteht bei<br />
der Zersetzung organischen Materials in Kohlevorkommen.<br />
In der Vergangenheit wurde es nutzlos abgefackelt, in den<br />
letzten zehn Jahren jedoch verstärkt zur Erzeugung von<br />
Elektrizität verwendet. Um das Gas fördern zu können,<br />
muss zunächst das Wasser aus dem Kohleflöz abgepumpt<br />
werden. Dadurch fällt der Druck und das Gas lässt sich<br />
extrahieren.<br />
Gefördert wird es in der Regel mittels vertikaler Bohrungen,<br />
die in diesem Fall bis 350 m in das Kohleflöz hineinreichen<br />
und dann durch horizontale Bohrungen in der Deckschicht<br />
des Kohleflözes miteinander verbunden werden. Durch das<br />
so geschaffene Leitungssystem kann nahezu die gesamte<br />
Lagerstätte entgast werden. Ziel ist einerseits die Nutzung<br />
des Kohleflözgases zur Stromerzeugung und andererseits,<br />
Bild 1: Verfahrensskizze zur Entgasung von Kohleflözen<br />
den Gasgehalt in der Kohlelagerstätte soweit zu reduzieren,<br />
dass die Kohleförderung ohne Sicherheitsrisiken ausgeführt<br />
werden kann. Die Zeit für die Entgasung variiert je nach<br />
Größe der Lagerstätte. Im vorliegenden Projekt ist die Gasförderung<br />
von mehr als zwei Jahren geplant.<br />
Die Horizontalbohrungen sind eine Herausforderung und<br />
erfordern Spezialistenwissen. Ralf Kiesow, der verantwortliche<br />
Vertriebs- und Serviceleiter bei Prime Drilling, stand<br />
mit dem Betreiber der Lagerstätte schon längere Zeit in<br />
Kontakt, bis er Kiesow schließlich anrief und einlud. Die<br />
Vorgespräche hatten sich gelohnt; denn der Kunde war<br />
überzeugt, den richtigen Partner gefunden zu haben. Mit<br />
einem 30 Seiten umfassenden „Pflichtenheft“ an speziellen<br />
Kundenwünschen im Gepäck flog Ralf Kiesow nach Hause.<br />
„Nachdem unser Konstruktionsteam die Kundenanforderungen<br />
mit den strengen Sicherheitsauflagen geprüft hatte<br />
und für umsetzbar hielt, bekamen wir im Dezember 2011<br />
grünes Licht für den Auftrag von zwei Bohranlagen und entwickelten<br />
eine Spezialversion auf der Basis des bestehenden<br />
Bohranlagentyps PD 100/80 RPC 45 mit einer maximalen<br />
Zug- und Druckkraft von 100 Tonnen”, so Kiesow.<br />
Bei der Konstruktion war u. a. Folgendes zu beachten:<br />
Der Einstichwinkel musste zwischen 6° und 45° betragen,<br />
eine minimale Bohrgeschwindigkeit von 25 mm/min realisiert<br />
sowie eine Klemm- und Brechvorrichtung mit einem<br />
Klemmbereich von 105 mm bis 405 mm verbaut werden.<br />
Verlangt wurde zudem ein selbstzentrierendes Pipehandling-System<br />
ohne Nachjustierung der Bohrgestänge und<br />
Casingrohre. Gefordert war des Weiteren ein explosionsgeschützter<br />
Arbeitsbereich im Radius von 3 m um die Bohrwelle.<br />
Sämtliche tragende Schweißkonstruktionen wurden<br />
mittels einer zerstörungsfreien Werkstoffprüfung getestet<br />
und dokumentiert. Der Bohrmast für zwei unterschiedliche<br />
Bohrgestängelängen, misst eine Länge von 18 m. In einigen<br />
sicherheitsrelevanten Optionen konnte das Team von Prime<br />
Drilling die strengen australischen Sicherheitsbedingungen<br />
sogar übertreffen. So wurde z. B. eine spezielle Federspeicher-Parkbremse<br />
entwickelt, die selbst bei Totalausfall<br />
der Hydraulik, ein Heruntergleiten des mehreren Tonnen<br />
schweren Kraftdrehkopfes verhindert.<br />
Im Sommer 2012 konnten die beiden Bohranlagen ab Hamburg<br />
verschifft werden. 45 Tage dauerte die Seereise bis<br />
nach Brisbane. Seither sind die Bohranlagen im Einsatz.<br />
Bei den Bohrungen handelt es sich um horizontale Sack-<br />
72 04-05 / 2013
SPECIAL ROHRLEITUNGSBAU AKTUELL RECHT & PROJEKT REGELWERK KURZ FACHBERICHT<br />
BELEUCHTET<br />
lochbohrungen mit einem Durchmesser von 3½“, einer<br />
Bohrlänge bis zu 1.800 m und einer Bohrtiefe bis 350 m.<br />
Die zuvor erstellten Vertikalbohrungen müssen mit der<br />
Horizontalbohrung verbunden werden und sind deshalb<br />
mit Referenzsendern ausgestattet, damit die Signale von<br />
der Horizontalbohranlage erfasst und angesteuert werden<br />
können. Um eine Vertikalbohrung in z. B. 200 m Tiefe zu<br />
erreichen, muss der Einstich unter 45° in 200 m Entfernung<br />
von der Vertikalbohrung erfolgen. Ist die Verlegetiefe in der<br />
Deckschicht des Kohleflözes erreicht, bohrt man sich von<br />
Vertikalbohrung zu Vertikalbohrung bis zum Ziel. Danach<br />
wird ein Überwaschgestänge bis zum Bohrkopf eingeschoben.<br />
Anschließend erfolgt zum Schutze des Überwaschgestänges<br />
die Bergung des Bohrgestänges mit dem Bohrkopf.<br />
Nun werden Filterrohre in das leere Überwaschgestänge eingefahren.<br />
Dies geschieht mit speziellen Rollen, die am ersten<br />
Rohr montiert und hydraulisch angetrieben werden. Mit<br />
dem Herausziehen des Überwaschgestänges ist die Bohrung<br />
fertiggestellt. Die geschlitzten Filterrohre nehmen zunächst<br />
das Wasser auf und „transportieren“ es zu den Vertikalbohrungen,<br />
wo es abgepumpt wird. Nach der Entwässerung<br />
werden die Rohre für die Entgasung genutzt und das Gas<br />
der Stromerzeugung zugeführt. Ralf Kiesow: „Wenn nichts<br />
dazwischen kommt, dauert der gesamte Bohrprozess bei<br />
Bild 2: Entgasungsbohrung mit Prime Drilling-Bohranlage<br />
einer Bohrlänge von 1.800 m ohne Arbeitsunterbrechungen<br />
im Tag- und Nachtbetrieb anderthalb Wochen.”<br />
Kontakt: Prime Drilling GmbH, Wenden-Gerlingen, Ralf Kiesow, E-Mail: kiesow@<br />
prime-drilling.de<br />
THE REGION’S LEADING<br />
SHOWCASE FOR THE<br />
POWER AND WATER<br />
SECTORS<br />
SUPPLYING DEMAND: GENERATING BUSINESS<br />
Abu Dhabi plans to invest<br />
US$90 billion in capital projects<br />
over the next 5 years.<br />
Be part of the action - secure<br />
your space at Power + Water<br />
Middle East.<br />
T: + 971 4 336 5161<br />
E: sales@powerandwaterme.com<br />
www.powerandwaterme.com<br />
23 - 25 SEPTEMBER 2013<br />
ABU DHABI NATIONAL EXHIBITION CENTRE | UAE<br />
Organised By<br />
Partner Events<br />
04-05 / 2013 73
FACHBERICHT PROJEKT KURZ RECHT BELEUCHTET & REGELWERK SPECIAL ROHRLEITUNGSBAU AKTUELL<br />
Rationalisierungsmöglichkeit im<br />
Leitungsbau: die Kombi-Trasse<br />
Das Nervensystem einer Stadt liegt im Verborgenen:<br />
Tausende Kilometer an Rohren, Kabeln und Leitungen<br />
verbergen sich unter den Straßen und Wegen. Die<br />
komplexen Leitungssysteme sind aufgrund ihrer Alterung<br />
in Teilen instand zu setzen und zu erneuern. Hierfür<br />
müssen Städte, Kommunen bzw. Versorgungsunternehmen<br />
entsprechende Budgets vorsehen. Aufgrund finanzieller<br />
Engpässe wird dabei oft nur das Nötigste umgesetzt und<br />
Instandhaltungsaufwendungen in die Zukunft verschoben.<br />
Ein anderes Problemfeld bei der Instandhaltung und<br />
beim Ausbau der Netzte sind historisch gewachsene<br />
Altstadtkerne: Denkmalgeschützte Gebäudesubstanz und<br />
meist enge Bauraumverhältnisse erschweren den Einsatz<br />
konventioneller Einbauverfahren mit breiten Gräben,<br />
schweren Einbaugeräten oder mechanischer Verdichtung<br />
bei der Grabenverfüllung.<br />
BAURAUM UND KOSTEN SPAREN<br />
Eine neue Form einer Kombi-Trasse, wie sie die Entwicklung<br />
des RSS-Systems bietet, kann hier Abhilfe schaffen. Dahinter<br />
verbirgt sich ein Kombi-Schacht, der in seiner einfachsten<br />
Form Regen- (R) und Schmutzwasser (S) in einem Schacht<br />
vereint. Verlegt wird nicht mehr in der Fläche, sondern es<br />
wird alles in die Tiefe „gestapelt“ (Bild 1). Für die komplexe<br />
Medienverlegung (Gas, Trinkwasser, Telefon, TV, Energie<br />
usw.) ist das RSS-System mit dem Vorteil ausgerüstet, zu<br />
jeder Zeit einen Zugriff auf alle verlegten Leitungen zu haben.<br />
Bild 1: Komplex, platzsparend und anpassungsfähig – der<br />
Kombischacht des RSS-Systems als High-Tech-Variante<br />
Die Bauzeit mit dem RSS-System ist deutlich kürzer,<br />
verglichen mit der bisher üblichen Bauweise, bei der<br />
jedes Rohr und jedes Kabel eine eigene Trasse erhielt, die<br />
wiederum oft genug auch mit eigenen Wartungsschächten<br />
ausgestattet war. Die Schadensanfälligkeit des Kombi-<br />
Schachtes verringert sich infolge günstigerer Platzierung<br />
in der Straße z.B. zwischen den Radspuren der Fahrzeuge.<br />
Dabei bietet das RSS-System weiterhin die Möglichkeit<br />
der späteren flexiblen Einbindung zusätzlicher Medien im<br />
gleichen Straßenraum oder des Austausches bestehender<br />
Leitungen und dies ohne ein erneutes Öffnen der<br />
Straße. Dafür können zum Beispiel – schon beim Bau<br />
der Trasse – Leerrohre zwischen den Kombi-Schächten<br />
eingebaut werden. Aber auch der nachträgliche Zugriff<br />
auf die Leitungen ist dann problemlos möglich, wenn mit<br />
Flüssigboden und damit verbundenen neuen Technologien<br />
gebaut wird. Das Problem der Verdichtung des Bodens im<br />
Falle der hier übereinander liegenden Leitung ist mit dem<br />
Einsatz von Flüssigboden ideal gelöst.<br />
FLÜSSIGBODEN<br />
Hinter dem Wort „Flüssigboden“ verbirgt sich ein Verfahren,<br />
mit dessen Hilfe jede Art von Bodenaushub zeitweise in<br />
fließfähigen Zustand versetzt werden kann, wobei die<br />
bautechnisch wichtigen Eigenschaften des Ausgangsbodens<br />
weitgehend erhalten bleiben. Die Aufbereitung des<br />
Bodenaushubes zu Flüssigboden kann in zentralen<br />
Anlagen oder mit kompakten<br />
Anlagen unterschiedlicher Größe<br />
direkt auf der Baustelle erfolgen<br />
(Bild 2). Das Ziel ist dabei immer,<br />
dass der Flüssigboden nach<br />
seiner Rückverfestigung wieder<br />
Eigen schaften erreicht, die<br />
denen des Umgebungsbodens<br />
auf der Baustelle weitestgehend<br />
gleichen. So werden Fremdkörper<br />
unter der Straße vermieden<br />
und es ist keine mechanische<br />
Rückverfestigung des Bodens<br />
mehr nötig. Zudem bietet das<br />
Flüssigbodenverfahren allen Baufirmen<br />
beste Voraus setzungen,<br />
den Anforderungen des im<br />
Februar 2012 neu beschlossenen<br />
Kreislaufwirtschaftsgesetzes<br />
Rechnung zu tragen. Denn die<br />
Wiederverwendung des Aushubs<br />
wird aus einer bisherigen KANN-<br />
74 04-05 / 2013
SPECIAL ROHRLEITUNGSBAU AKTUELL RECHT & PROJEKT REGELWERK KURZ FACHBERICHT<br />
BELEUCHTET<br />
Bestimmung zu einer MUSS-Forderung<br />
des Gesetzgebers.<br />
UMSETZUNG IN DER PRAXIS<br />
Die Kombination von Kombi-Schächten<br />
und Flüssigboden bezeichnet man in<br />
Fachkreisen als so genannte Kombi-<br />
Trasse. Interessant sind diese beim Bau von<br />
Ortsdurchfahrten bis hin zu engen Straßen<br />
und Gassen, wo meist aus Platzgründen<br />
mit der Kombi-Trasse im Schmutz- und<br />
Regenwasser begonnen wird und infolge<br />
der besonderen Form der RSS-Schächte<br />
dann auch noch Versorgungsleitungen<br />
– selbst zu einem späteren Zeitpunkt –<br />
mit verlegt werden können. Als ideal hat<br />
sich vielerorts schon die Neuerschließung<br />
mittels Kombi-Trassen erwiesen, bei der<br />
alle Medien von Anbeginn an in einer<br />
gemeinsamen Trasse verlegt werden. Diese<br />
Bauweise wird beispielsweise gegenwärtig<br />
im Ferienpark Bostalsee praktiziert<br />
(Bild 3). Lange vor dem ersten Spatenstich<br />
im Ferienpark am Bostalsee suchte die<br />
Landesentwicklungsgesellschaft Saarland<br />
mbH (LEG Saar) nach Möglichkeiten, den<br />
Einsatz der Ressourcen und finanziellen<br />
Mitteln sowohl bei den Bauarbeiten selbst<br />
als auch vor allem während des Betriebes<br />
zu reduzieren.<br />
Der Kombi-Schacht ermöglichte es auf<br />
dieser Baustelle, Regenwasser, Abwasser<br />
und weitere Medien an einer Stelle<br />
zu konzentrieren und der Einsatz des<br />
Flüssigbodens minderte die Kosten sowie<br />
den Transportaufwand von ca. 8.000 LKW-<br />
Ladungen an Erde und Kies. Außerdem, so<br />
stellten die Planer vor Ort fest, profitiert<br />
die Umwelt von dieser Methode, da<br />
die Deponie-Kapazitäten nicht weiter<br />
strapaziert werden. Zudem fallen während<br />
der gesamten Bauphase nur sehr geringe<br />
Staub- und Lärmbelästigungen an.<br />
Hinzu kommt, dass sich die Lebensdauer<br />
aller Leitungen – eingebettet in RSS-<br />
Flüssigbodens ® – wesentlich erhöht und<br />
spätere Nachverlegungen möglich sind,<br />
ohne die Straßen wieder aufreißen zu<br />
müssen.<br />
Interessant ist generell die Tatsache, dass<br />
das Kombitrassen-Prinzip auch zu einer<br />
Reihe neuer städteplanerischer Ansätze<br />
und Lösungen geführt hat, die für Städte<br />
und Kommunen weitere Vorteile bei Betrieb und Nutzung<br />
beinhalten. Die Standortvorteile werden somit deutlich<br />
verbessert, was die Gewinnung von Investoren oder den<br />
Verkauf von Grundstücken um ein Wesentliches vereinfacht.<br />
Bild 2: Die Einsatzmöglichkeiten von Flüssigboden sind in vielen Baubereichen möglich. Da der<br />
Bodenaushub wiederverwendet wird, erfüllt diese Bauweise schon heute die neuen Vorgaben<br />
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes von Februar 2012<br />
Bild 3: Am Bostalsee entsteht ein großer Ferienpark. Auftrageber und Planer suchten<br />
ein innovatives Konzept zur Erstellung der Infrastruktur. Die Kombi-Trasse erfüllte alle<br />
Anforderungen. Vor Ort wird der Flüssigboden hergestellt. Mit diesem werden dann die<br />
Kombi-Schächte und alle Leitungen hohlraumfrei eingebettet und umhüllt.<br />
KONTAKT: Ingenieurbüro LOGIC Logistic Engineering GmbH, Leipzig,<br />
Dr.-Ing. Steffen Weber, Tel. +49 341-244 69 0,<br />
E-Mail: info@logic-engineering.de, www.logic-engineering.de<br />
04-05 / 2013 75
FACHBERICHT WASSERVERSORGUNG<br />
RECHT & REGELWERK<br />
Mit einer integrierten Netzstrategie<br />
zum Zielnetz<br />
Eine Netzstrategie erfordert die integrierte Betrachtung von betrieblichen, hydraulischen und instandhaltungsrelevanten<br />
Gesichtspunkten vor dem Hintergrund künftiger Verbrauchsentwicklungen. Ausgehend vom Ist-Netz wird ein<br />
Migrationspfad zum Zielnetz erstellt mit Betrachtung von Zustands- und Risikoentwicklung, Kosten sowie Qualitätsfaktoren.<br />
Für die ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH wurden durch die 3S Consult GmbH (3S) Zielnetzstudien für das<br />
Wasserversorgungsnetz und das Gasversorgungsnetz erarbeitet. Im folgenden Fachbeitrag werden die Ergebnisse der<br />
Studie für das Wasserversorgungsnetz exemplarisch vorgestellt.<br />
AUFGABENSTELLUNG<br />
Im Rahmen einer Zielnetzplanung sollte ein kostenminimales,<br />
migrationsfähiges Zielnetz objektscharf für jeden<br />
einzelnen Leitungsabschnitt ermittelt werden, d.h. ein DNoptimales<br />
Netz auf Ist-Trassenmenge unter Einhaltung aller<br />
hydraulischen Restriktionen unter Volllast mit Beibehaltung<br />
der Ist-Stationen und der Ist-Fahrweise. Das Optimierungspotenzial<br />
im Ist-Netz und die Sensitivität des Zielnetzes<br />
bezüglich Veränderungen bei ausgewählten Rand- und<br />
Rahmenbedingungen wurden ermittelt.<br />
Begleitend dazu sollten verschiedene Erneuerungsstrategien<br />
leitungsgruppenscharf simuliert werden und zwar auf Basis<br />
einer Nutzungsdauermodellierung, einer Schadensprognose<br />
und verschiedener, vorgegebener Randbedingungen (u.a.<br />
Budget halten, Schadensraten halten).<br />
Zur Erstellung des Migrationspfads vom Ist-Netz zum Zielnetz<br />
sollten die Erneuerungsvorgaben in geeignete objektscharfe<br />
Maßnahmenpläne umgesetzt werden. Die Reihenbzw.<br />
Rangfolge der Erneuerungen ergibt sich dabei aus<br />
Zielnetz- und Erneuerungssicht durch ein strikt am Risiko<br />
(hydraulisches Schadensausmaß x Eintrittswahrscheinlichkeit)<br />
orientiertes Kriterium.<br />
ANALYSERAHMEN FÜR DIE UNTERSUCHUNGEN<br />
Der Rahmen für die Erstellung einer integrierten Netzstrategie<br />
besteht im Wesentlichen aus vier Teilbereichen (Bild 1),<br />
die mit entsprechenden Analyse-Werkzeugen bearbeitet<br />
werden können:<br />
Grafiken im Fachbeitrag <br />
HE<br />
Hydraulik<br />
ARP<br />
Maßnahmen<br />
IKOS<br />
Integrierte<br />
Netzstrategie<br />
Bild 1: Analyserahmen für eine integrierte Netzstrategie <br />
RE<br />
Zuverlässigkeit<br />
ASP<br />
Strategie<br />
Bild 1: Analyserahmen für eine integrierte Netzstrategie<br />
» Hydraulik – HE (hydraulic engineering): Hydraulische<br />
Modellierung des Netzes inkl. Stationen als Basis für<br />
Variantenuntersuchungen zur Zielnetzermittlung<br />
» Zuverlässigkeit – RE (reliability engineering): Zuverlässigkeitslogische<br />
Modellierung zur Ermittlung der Versorgungssicherheit<br />
in Abhängigkeit von Zustandsentwicklung<br />
und struktureller Lage im Netz<br />
» Strategie – ASP (asset strategy planning): Simulation von<br />
langfristigen Investitions- bzw. Erneuerungsstrategien<br />
auf Leitungsgruppen- und Netzebene<br />
» Maßnahmen – ARP (asset rehabilitation planning):<br />
Objektkonkrete Umsetzung von leitungsgruppenscharfen<br />
Erneuerungsvorgaben in Maßnahmenpläne.<br />
In der Vergangenheit wurden diese Teilbereiche oft<br />
getrennt voneinander betrachtet. In Wirklichkeit bestehen<br />
aber Interaktionen und Abhängigkeiten, die bei einer<br />
integrierten Betrachtung vollumfänglich berücksichtigt<br />
werden. Exemplarisch sei hier das Ergebnis einer Dimensionierungsrechnung<br />
genannt, das einerseits bei der<br />
Simulation von Investitionsstrategien und andererseits<br />
bei der Umsetzung in Maßnahmenpläne berücksichtigt<br />
werden sollte. Auf der anderen Seite geht die Ermittlung<br />
einer Zustandsentwicklung in die zuverlässigkeitslogische<br />
Modellierung ein.<br />
Die vorgenannten vier Teilbereiche können mit den beiden<br />
Software-Planungswerkzeugen SIR 3S ® und KANEW der<br />
3S Consult in idealer Weise kombiniert bearbeitet werden.<br />
ZUSTANDSANALYSE<br />
Das Trinkwassernetz der ENNI im Bestand ist vergleichbar<br />
jung für ein städtisches Leitungsnetz. Für die Zustandsanalyse<br />
und Alterungsmodellierung wurde das Netz in Leitungsgruppen<br />
nach eingesetzten Werkstoffen unterteilt. Eine weitere<br />
Untergliederung nach Werkstoffgenerationen wurde nicht<br />
vorgenommen, da die Mehrzahl von Leitungen meist einer<br />
einzigen Generation zugeordnet werden konnte. Bei einigen<br />
Leitungsabschnitten war das Baujahr unbekannt, so dass für<br />
diese eine plausible Schätzung vorgenommen wurde (Bild 2).<br />
Tabelle 1 enthält eine qualitative Bewertung des Durchschnittsalters<br />
und der Schadensraten. Die Schadensraten im<br />
Netz sind insgesamt niedrig (Orientierungswert für niedrige<br />
76 04-05 / 2013
Schadensraten lt. DVGW < 0,1 Schäden/km a) [1]. Lediglich<br />
Stahlleitungen weisen bereits mittlere Schadensraten auf.<br />
Der Zustand der Leitungsgruppen im Wassernetz der ENNI<br />
wurde mit den zum Zeitpunkt der Studie veröffentlichten<br />
Schadensraten der DVGW-Schadensstatistik verglichen<br />
[2]. Für die Festlegung von Nutzungsdauern und künftiger<br />
Schadensentwicklung für jede Leitungsgruppe wurden die<br />
Schäden bezogen auf das Alter zum Zeitpunkt des Schadens<br />
sowie bezogen auf die Baujahre ausgewertet. Um den<br />
Unschärfen von Prognosen Rechnung zu tragen, wurden<br />
die Nutzungsdauern in Bandbreiten definiert (kurze/pessimistische,<br />
mittlere und lange/optimistische Nutzungsdauern)<br />
sowie für die Schadensprognose ein Referenzszenario und<br />
ein weiteres pessimistisches Szenario mit einem stärkeren<br />
Anstieg der Schadensrate definiert.<br />
Bild 3 stellt die jährlich erforderlichen Netzerneuerungsraten<br />
im Zeitraum 2011-2030 auf Basis von kurzen, mittleren und<br />
langen Nutzungsdauern dar.<br />
SIMULATION VON ERNEUERUNGSSTRATEGIEN<br />
Für die Zielnetzplanung wurden im Anschluss verschiedene<br />
langfristige Szenarien der Erneuerung mit unterschiedlichen<br />
Randbedingungen für einen Strategiezeitraum bis 2019 mit<br />
KANEW modelliert und simuliert, um die Auswirkungen<br />
einer bestimmten Netzstrategie zu ermitteln:<br />
» „Nichts tun“ - Keine Erneuerungen<br />
» Erneuerungen gemäß Bedarf (Bedarf gem.<br />
Nutzungsdaueranalyse)<br />
» Erneuerungen gemäß Ist-Budget der Investitionen<br />
» Erneuerungen gemäß Schadensrate halten<br />
Netzglobal und leitungsgruppenscharf wurden die folgenden<br />
Kennzahlen für jedes Szenario ausgegeben:<br />
» Verlauf der Reparaturkosten (Opex)<br />
» Verlauf der Investitionskosten (Capex)<br />
» Verlauf von Alter, Restnutzungsdauer, Substanz,<br />
Schäden<br />
Im Szenario „Nichts tun“ wird besonders deutlich, wie sich<br />
fehlende Investitionen in die Rohrnetzerneuerung aufstauen<br />
und dann in der Zukunft zu erheblichen Mehrinvestitionen<br />
führen. Das Erneuerungsprogramm im Szenario „Gemäß<br />
Erneuerungsbedarf“ orientiert sich an den Vorgaben der<br />
Bedarfsprognose. Im Szenario „Budget halten“ wurde ein<br />
Erneuerungsprogramm auf Basis eines konstanten Budgets<br />
unter Berücksichtigung einer jährlichen Inflation aufgestellt.<br />
Beide Szenarien unterscheiden sich im Ergebnis (Entwicklung<br />
von Alter, Restnutzungsdauer, Substanz, Schäden,<br />
Investitions- und Reparaturkosten) nur minimal voneinander.<br />
Mit den eingesetzten Budgets ist es in jedem Fall möglich,<br />
die Schadensrate im pessimistischen Szenario über die<br />
nächsten zehn Jahre stabil zu halten. Im letzten Szenario<br />
wurde ein Erneuerungsprogramm aufgestellt, mit dem für<br />
das Referenzszenario der Schadensprognose die Entwicklung<br />
der Schadensrate in den nächsten zehn Jahren konstant<br />
bleibt. Erneuerungen an den „jungen“, bisher kaum<br />
schadhaften Leitungsgruppen wurden nicht vorgenommen.<br />
Der Schwerpunkt der Erneuerung lag bei AZ und Stahl. Im<br />
Ergebnis konnte der jährlich erforderliche Erneuerungs-<br />
Bild 2: Verteilung der Baujahre im Wassernetz der ENNI<br />
Bild 3: Bedarfsprognose – Netzerneuerungsraten<br />
Tabelle 1: Qualitative Bewertung von Durchschnittsalter und Schadensraten<br />
Leitungsgruppe Durchschnittsalter Schadensrate<br />
AZ mittel niedrig<br />
GG mittel niedrig<br />
GGG niedrig niedrig<br />
PE niedrig niedrig<br />
PVC niedrig niedrig<br />
STAHL Mittel mittel<br />
STDROHR mittel niedrig<br />
Gesamt niedrig niedrig<br />
04-05 / 2013 77
FACHBERICHT WASSERVERSORGUNG<br />
RECHT & REGELWERK<br />
umfang leicht reduziert werden verglichen mit<br />
den Erneuerungsvolumina im Szenario „Budget<br />
halten“.<br />
Bild 4: Ergebnis der DN-Optimierung<br />
Bild 5: Druckverteilung Ist-Netz / ZNQLoe<br />
Bild 6: Wasseralter Ist-Netz / ZNQLoe<br />
HYDRAULISCHES NETZMODELLIERUNG –<br />
ERMITTLUNG DES ZIELNETZES<br />
Ausgangsmodell für die objektscharfe Zielnetzplanung<br />
war ein aktualisiertes SIR 3S ® -Modell,<br />
das bei der ENNI für hydraulische Modellierungen<br />
im Einsatz ist und die Basis für die Ermittlung<br />
des DN-optimalen Zielnetzes (Bild 4) bildete. Im<br />
Vergleich zum Ist-Netz wurden drei Zielnetzvarianten<br />
berechnet:<br />
» ZNQIst: Zielnetz bei Ist-Abnahme Volllast<br />
ohne Löschwasser<br />
» ZNQLoe: Zielnetz bei Ist-Abnahme Volllast<br />
mit Löschwasser<br />
» ZNQred.10%: Zielnetz bei rückläufiger<br />
Abnahme Volllast mit Löschwasser<br />
Die kalkulierten Wiederbeschaffungswerte der<br />
ermittelten Zielnetze (ZN) sind in Tabelle 2<br />
dargestellt.<br />
Die ermittelte potenzielle Kostenersparnis in<br />
der Größenordnung von rund 5 % zeigt, dass<br />
das Netz der ENNI unter Aufrechterhaltung der<br />
Löschwasserversorgung nur moderat überbemessen<br />
ist. Berücksichtigt man, dass das Netz<br />
historisch gewachsen ist und sich auch die Einspeiserandbedingungen<br />
im Verlauf der Netzhistorie<br />
geändert haben, dann kann man aus<br />
Zielnetzsicht den Ist-Zustand in den Aspekten<br />
Topologie und DN auf einer Schulnotenskala mit<br />
Gut einstufen.<br />
Die berechneten Kostenersparnisse sind im Rahmen<br />
einer längerfristigen Migration im Zuge von<br />
kontinuerlichen Netzerneuerungs- und -anpassungsmaßnahmen<br />
nahezu vollständig realisierbar.<br />
Es wurde nachgewiesen, dass diese Zielnetze in<br />
Punkto Löschwasserversorgung keine Verschlechterung<br />
gegenüber dem Ist-Netz darstellen.<br />
Eine theoretische Kostenersparnis in der Größenordnung<br />
von 30 % ergäbe sich, wenn man<br />
die Lage der Hauptversorgungsleitungen bei<br />
der Optimierung frei gibt und zugleich auf alle<br />
Redundanzen verzichtet. Allein durch Aufgabe<br />
der Redundanzen würde man bereits 17 % der<br />
Netzlänge komplett einsparen. Auf dieses Zielnetz<br />
kann man allerdings nicht migrieren, da man<br />
gleich zu Beginn der Migration gezwungen wäre<br />
nicht zustandsorientiert einen viel zu großen Teil<br />
des Netzes im DN aufzuweiten. Die hierfür erforderlichen<br />
Ressourcen (Budget, <strong>Rohrleitungsbau</strong>kapazität)<br />
sind praktisch nicht darstellbar und<br />
realisierbar. Die Zielnetzvarianten wurden ausführlich<br />
anhand von Diagrammen, tabellarischen<br />
Ergebnissen und Schaubildern u.a. auch hinsichtlich<br />
der Druckverteilung (für Variante ZNQLoe in Bild 5),<br />
78 04-05 / 2013
WASSERVERSORGUNG RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
Wasserqualität (Wasseralter, für Variante ZNQLoe in Bild 6)<br />
und Strömungsgeschwindigkeiten analysiert. Im Rahmen der<br />
Analyse wurde herausgestellt, dass sich die geringeren Nennweiten<br />
der Zielnetze positiv auf die Wasserqualität auswirken.<br />
Die Analyse des längengemittelten Netzdrucks ergab,<br />
dass für das Zielnetz ZNQLoe der längengemittelte Netzdruck<br />
unter dem des Ist-Netzes liegt. Aufgrund der proportionalen<br />
Abhängigkeit der Wasserverluste vom Netzdruck sinken unter<br />
Zielnetzbedingungen die so induzierten Wasserverluste [3].<br />
Eine Untersuchung von drei Teilgebieten ergab, dass die prozentualen<br />
Kosteneinsparungen für die einzelnen Teilgebiete<br />
gleichverteilt sind. Keines der Teilgebiete war daher verglichen<br />
mit den übrigen Teilgebieten als deutlich über- oder<br />
unterbemessen zu bewerten. Die Bewertung von Stationen<br />
aus Zielnetzsicht konzentrierte sich auf die hydraulische<br />
Notwendigkeit der Druckerhöhungsanlage (DEA) Krefelder<br />
Straße. Um die Notwendigkeit dieser DEA unter dem Zielnetzaspekt<br />
bewerten zu können, wurde das fiktive Zielnetz<br />
bestimmt, in dem die DEA Krefelder Straße außer Betrieb ist<br />
und die Netztrennungen, die ihr Gebiet abtrennen, geöffnet<br />
sind. Der kalkulierte Wiederbeschaffungswert für dieses<br />
Zielnetz unter Berücksichtigung der Löschwasserversorgung<br />
lag über dem für ZNQLoe. Die Verteuerung wäre bei einer<br />
Grüne-Wiese-Neuplanung den Kosten für die Errichtung<br />
der DEA und ihren Betriebskosten im Abschreibungszeitraum<br />
gegenüberzustellen. Eine Migration auf ein Zielnetz<br />
ohne DEA Krefelder Straße war nicht zu empfehlen, da<br />
eine solche Migration mit einer nicht zustandsbedingten<br />
Aufweitung von unterbemessenen Netzbereichen verbunden<br />
mit entsprechenden Kosten einhergeht. Die fiktive<br />
Ersparnis der Variante ohne DEA gegenüber dem Ist-Netz<br />
zeigt, dass das Ist-Netz im Mittel auch ohne die DEA noch<br />
überbemessen ist.<br />
MIGRATIONSPFAD ZUM ZIELNETZ – UMSETZUNG<br />
IN MASSNAHMENPLÄNE<br />
Durch eine (m-1)-Berechnung wurde objektscharf die<br />
Importanz (=Wichtigkeit) für jede Rohrleitung bestimmt.<br />
Wiederbeschaffungswert<br />
Variante<br />
(relativ zum<br />
Ist-Netz)<br />
Ist-Netz 100%<br />
ZNQIst 84,5% Zielnetz bei Ist-Abnahme<br />
Volllast ohne Löschwasser<br />
ZNQLoe 94,6% Zielnetz bei Ist-Abnahme<br />
Volllast mit Löschwasser<br />
ZNQred.10% 93,9% Zielnetz bei rückläufiger Abnahme<br />
Volllast mit Löschwasser<br />
Die Importanzen und die leitungsgruppenabhängigen Schadensraten<br />
wurden verwendet, um eine Risikobewertung<br />
der einzelnen Rohrleitungen vorzunehmen. Das Risiko ist<br />
definiert als die Schadenseintrittswahrscheinlichkeit × Schadensausmaß<br />
(entspricht hier Schadensrate × Importanz). Der<br />
Risikowert wurde als Kriterium zur Ermittlung der objektscharfen<br />
Reha-Rangfolge verwendet (hohe Risiken zuerst).<br />
Entsprechende Maßnahmenpläne bis zum Planungshorizont<br />
2030 wurden erzeugt unter Berücksichtigung von Zielnetzhauptstruktur<br />
und Risiko. Die Maßnahmenpläne stellen den<br />
unter strikter Risikopriorisierung optimalen Migrationspfad<br />
zum Zielnetz ZNQLoe dar - unter Einhaltung der Erneuerungslängen<br />
(und damit des Budgets) aus dem Szenario<br />
„Erneuerung gemäß Bedarf“.<br />
Zur Überprüfung der Maßnahmenpläne wurden Zuverlässigkeitsberechnungen<br />
für das Basisjahr 2010 sowie für den Planungshorizont<br />
2030 durchgeführt (Bild 7). Es konnte gezeigt<br />
werden, dass und in welchem Ausmaß sich die Zuverlässigkeit<br />
im Szenario „Gar keine Erneuerung“ bis 2030 verschlechtert<br />
und in welchen Gebieten sich das Unterlassen von Erneuerungsmaßnahmen<br />
besonders negativ auf die Versorgungssicherheit<br />
der Wasserkunden auswirken würde. Bei Umsetzung<br />
der vorbereiteten objektscharfen Maßnahmenpläne hingegen<br />
ergibt sich im Jahr 2030 eine deutliche Verbesserung der<br />
Versorgungszuverlässigkeit für die ENNI-Wasserkunden.<br />
Comprex_Anz_Komm_90x170_RZ:Comprex_Anz_1-4quer_RZ 17.02.2010 16:00 Uhr Seite 1<br />
Tabelle 2:<br />
Wiederbeschaffungswerte<br />
der Zielnetzvarianten relativ<br />
zum Ist-Netz<br />
Wasser ist unser Element:<br />
Das Impuls-Spül-Verfahren Comprex ®<br />
von Hammann.<br />
www.hammann-gmbh.de<br />
Wir übernehmen die Leitung für sauberes Wasser. Mit unserem Comprex ® -<br />
Verfahren reinigen wir Rohrnetze gründlich, schonend und nachhaltig.<br />
Ob kommunale Trinkwassernetze, Rohwasserleitungen oder Abwasser-Druckleitungen:<br />
mehr Hygiene und Betriebssicherheit ganz ohne Chemie, nur mit Wasser und Luft.<br />
Fordern Sie Informationsmaterial an oder besuchen Sie uns im Internet.<br />
■ Hammann GmbH<br />
Zweibrücker Straße 13<br />
D-76855 Annweiler am Trifels<br />
Tel. +49(0)63 46/30 04-0<br />
info@hammann-gmbh.de<br />
04-05 / 2013 79
FACHBERICHT WASSERVERSORGUNG<br />
RECHT & REGELWERK<br />
Bild 7: Entwicklung der Versorgungszuverlässigkeit<br />
ZUSAMMENFASSUNG<br />
Die Verknüpfung von hydraulischen, zuverlässigkeitslogischen<br />
sowie Zustands- und Risikoaspekten ermöglicht<br />
eine ganzheitliche Betrachtung von Netzbetrieb und Asset<br />
Management. Basierend auf den Ergebnissen der Zielnetzplanung<br />
wurden die Erneuerungsraten für die nächsten<br />
Jahre festgelegt.<br />
Eine langfristige Migration auf ein Zielnetz im Zuge der<br />
kontinuierlichen Investitionen in Erneuerung und Umbau<br />
ist möglich. Die Zielnetzplanung sollte in regelmäßigen<br />
Abständen überprüft werden, da sich auch die Randbedingungen<br />
für ein (neues) Zielnetz ändern.<br />
Vergleicht man - rückblickend - das ausgewiesene und<br />
realisierbare Optimierungspotenzial des Zielnetzes mit den<br />
Kosten für die Studie, so liegen letztere unter 1 % des<br />
Optimierungspotenzials.<br />
AUTOREN<br />
Dipl.-Ing. INGO KROPP<br />
3S Consult GmbH, Dresden<br />
Tel. +49 351 48245-31<br />
E-Mail: kropp@3sconsult.de<br />
Dipl.-Wirtsch.-Ing. HEIKO DINNESSEN<br />
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH,<br />
Moers<br />
Tel. +49 2841 104-210<br />
E-Mail: hdinnessen@enni.de<br />
LITERATUR<br />
[1] DVGW W 400-3 „Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen<br />
(TRWV); Teil 3: Betrieb und Instandhaltung“ (2006)<br />
[2] Niehues, B.: DVGW-Schadenstatistik Wasser–Ergebnisse aus den<br />
Jahren 1997–2004. energie|wasser-praxis (2006) Nr. 10<br />
[3] DVGW W 392 „Rohrinspektion und Wasserverluste – Maßnahmen,<br />
Verfahren und Bewertung“ (2003)<br />
Dipl.-Ing. INGO BLANK<br />
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH,<br />
Moers<br />
Tel. +49 2841 104-222<br />
E-Mail: iblank@enni.de<br />
Dipl.-Ing. GEORG KÄSER<br />
3S Consult GmbH, München<br />
Tel. +49 89 5404146-52<br />
E-Mail: kaeser@3sconsult.de<br />
80 04-05 / 2013
sichere und effiziente<br />
Rohrleitungssysteme<br />
RECHT & REGELWERK www.<strong>3R</strong>-Rohre.de FACHBERICHT<br />
Jetzt bestellen!<br />
Nutzen Sie das Know-how der führenden fachzeitschrift<br />
für die entwicklung, den einsatz und Betrieb von Rohrleitungen,<br />
Komponenten und Verfahren im Bereich der<br />
Gas- und Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung,<br />
der Nah- und fernwärmeversorgung, des Anlagenbaus<br />
und der Pipelinetechnik.<br />
Wählen Sie einfach das Bezugsangebot, das Ihnen zusagt:<br />
als Heft, ePaper oder Heft + ePaper!<br />
<strong>3R</strong> erscheint in der Vulkan-Verlag GmbH, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen<br />
Wissen füR DIe<br />
Zukunft<br />
Vorteilsanforderung per fax: +49 Deutscher 931 Industrieverlag / 4170-494 GmbH | Arnulfstr. oder 124 abtrennen | 80636 München und im fensterumschlag einsenden<br />
Ja, ich möchte <strong>3R</strong> regelmäßig lesen.<br />
Bitte schicken Sie mir das Fachmagazin für zunächst ein Jahr (8 Ausgaben)<br />
als Heft für € 275,- zzgl. Versand<br />
(Deutschland: € 24,- / Ausland: € 28,-).<br />
als ePaper (Einzellizenz) für € 275,-<br />
als Heft + ePaper für € 381,50<br />
(Deutschland) / € 385,50 (Ausland).<br />
Für Schüler / Studenten (gegen Nachweis) zum Vorzugspreis<br />
als Heft für € 137,50 zzgl. Versand<br />
(Deutschland: € 24,- / Ausland: € 28,-).<br />
als ePaper (Einzellizenz) für € 137,50<br />
als Heft + ePaper für € 202,75<br />
(Deutschland) / € 206,75 (Ausland).<br />
Nur wenn ich nicht bis 8 Wochen vor Bezugsjahresende kündige, verlängert sich der Bezug um ein<br />
Jahr. Die sichere, pünktliche und bequeme Bezahlung per Bankabbuchung wird mit einer Gutschrift<br />
von € 20,- auf die erste Rechnung belohnt.<br />
firma/Institution<br />
Vorname, Name des empfängers<br />
Straße / Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Antwort<br />
Leserservice <strong>3R</strong><br />
Postfach 91 61<br />
97091 Würzburg<br />
e-Mail<br />
Branche / Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise Bankabbuchung Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B.<br />
Brief, fax, e-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die frist beginnt nach erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur<br />
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an den Leserservice <strong>3R</strong>, Postfach<br />
9161, 97091 Würzburg.<br />
Bankleitzahl<br />
nutzung personenbezogener Daten: für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich<br />
vom DIV Deutscher 04-05 Industrieverlag / 2013 oder vom Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per e-Mail, nicht über interessante, fachspezifische Medien und Informationsangebote informiert und beworben werde. 81<br />
Diese erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.<br />
✘<br />
Ort, Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer<br />
PA<strong>3R</strong>IN0313
FACHBERICHT WASSERVERSORGUNG<br />
RECHT & REGELWERK<br />
Modellierung und Kalibrierung der<br />
Pumpen in einer Berechnungssoftware<br />
Eine aussagekräftige numerische Modellierung basiert vorher auf einer Modellkalibrierung. Genauso ist es auch im<br />
Bereich Rohrnetzmodellierung. Die Ergebnisse einer Rohrnetzberechnung ohne Netzkalibrierung basiert auf theoretischen<br />
Randbedingungen. Für die Simulation verschiedener Betriebssituationen und Lastfälle benötigt man praktische/reale<br />
Randbedingungen im Netz/System. Dabei stellt sich insbesondere die Frage, wie man Druckerhöhungsanlagen,<br />
Druckminderer, Wasserzähler usw. in einer Berechnungssoftware modellieren und kalibrieren kann? Dieser Artikel befasst<br />
sich mit dem Verhalten von Förderanlagen hinsichtlich Pumpenkennlinien und auftretenden Druckverlusten innerhalb<br />
solcher Anlagen/Systeme. In der zugrunde liegenden Bachelorarbeit wurden die von den Herstellern angegebenen Daten<br />
mit denen aus der Praxis ermittelten verglichen.<br />
EINLEITUNG<br />
Durch die Druck- und Durchflussmessungen werden<br />
Erkenntnisse gewonnen, mit denen die Pumpen<br />
bzw. die Druckerhöhungsanlagen an die realen<br />
Verhältnisse angepasst werden. Das Ziel ist letztlich<br />
für die Messung, Modellierung und Simulation<br />
dieser Anlagen in Wasserversorgungssystemen eine<br />
geeignete Vorgehensweise festzulegen. Die verwendete<br />
Berechnungssoftware ist STANET ® (stationäre und quasi<br />
dynamische Berechnung von Rohrnetzen). Mit dieser können<br />
die genannten Druckerhöhungs- bzw. Pumpenanlagen<br />
realitätsnah simuliert werden.<br />
Als Grundlage aller Ergebnisse wurden die Druckund<br />
Durchflussmessungen an Pumpen- bzw.<br />
Druckerhöhungsanlagen durchgeführt.<br />
Im Folgenden werden Maßnahmen empfohlen, die<br />
den Umgang mit Förderanlagen vor der Messung, zum<br />
Zeitpunkt der Messung und bei der Modellierung und<br />
Kalibrierung erleichtern. Die Aussagen basieren auf<br />
den Erkenntnissen und Daten der folgenden sieben<br />
untersuchten Förderanlagen bei sechs Versorgern:<br />
»»<br />
Hersteller Grundfos (Anlagebezeichnung<br />
Hydromulti - E 3 CRE 10-6),<br />
»»<br />
Hersteller Ritz (Typ 4912/3, drei Pumpen),<br />
»»<br />
Hersteller Ritz (Typ 4620, fünf Pumpen),<br />
»»<br />
Hersteller Grundfos<br />
(Anlagebezeichnung Hydro 2000 ME, PMU 2000;<br />
Pumpe 1 und 2: CRE 45-2-2 A-F-A-V-EUBV,<br />
Pumpe 3 bis 5: CRE 45-2 A-F-A-V-EUBV),<br />
»»<br />
Hersteller KSB<br />
(Pumpe 1: MTC V 65/2X-6.1-10.63,<br />
Pumpe 2: MTC V50/4A-4.1-10.63,<br />
Pumpen 3 und 4: MTC V65/3B-6.1-10.63),<br />
»»<br />
Hersteller Ritz (Pumpe 1 und 2: HP 32 - 135 1/4/S,<br />
Pumpen 3 bis 5: 4565/2/S 18.5/2 (alte Bezeichnung)<br />
HP 65 – 205 2/S (neue Bezeichnung)),<br />
»»<br />
Hersteller Grundfos<br />
(Anlagebezeichnung Hydro MPC-E 4 CRE 32-3).<br />
VORBEREITUNGEN DER DRUCK- UND<br />
DURCHFLUSSMESSUNGEN<br />
Art der untersuchten Druckerhöhungsanlagen<br />
Die untersuchten Förderanlagen wurden durch<br />
Kreiselpumpen realisiert und kommen generell in zwei<br />
Ausführen vor:<br />
»»<br />
Eine Variante ist die Kombination von Pumpen<br />
kleiner Leistung mit Pumpen größerer Leistung<br />
(Parallelschaltung). Diese Anlagen werden nach den<br />
individuellen Anforderungen zusammengestellt.<br />
Durch eine intelligente Steuerung kann bei größerem<br />
Förderstrom eine Pumpe großer Leistung eingeschaltet<br />
werden und die kleinen Pumpen abgeschaltet werden.<br />
Manchmal lassen die örtlichen Umstände oder die<br />
Gesamtsituation keine andere Lösung zu, als einzelne<br />
Pumpen separat zu installieren und gegebenenfalls<br />
eine zusätzliche Löschwasserpumpe für den Brandfall<br />
bereitzustellen.<br />
»»<br />
Die zweite Möglichkeit besteht in einer<br />
Kompaktdruckerhöhungsanlage. Diese setzt sich in der<br />
Regel aus mehreren parallel geschalteten baugleichen<br />
Einzelpumpen zusammen. Kompaktanlagen benötigen<br />
weniger Platz und sind in der Planung einfacher<br />
umzusetzen, da die Anschlussmaße einheitlich sind.<br />
Das Gesamtverhalten der Anlage ist hierbei auch<br />
unkompliziert. Es sind Ausführungen von einer Pumpe<br />
bis zu acht Einzelpumpen üblich.<br />
Zum Ausgleich von Druckstößen und zum Schutz der<br />
Pumpen werden Druckbehälter (Druckwindkessel oder<br />
MAG) parallel zu den Pumpenanlagen betrieben. Diese<br />
liefern auch den Förderstrom bei sehr geringem Verbrauch<br />
im Netz.<br />
Förderanlagen sind meist drehzahlgeregelt (vgl. Bild 1)<br />
und auf einen bestimmten Sollwert eingestellt, den sie<br />
möglichst konstant halten sollen. Bei modernen sowie auch<br />
älteren Anlagen ist ein Regelvorgang innerhalb kürzester<br />
Zeit abgeschlossen. Selbst wenn eine Pumpe größerer<br />
Leistung (ab 20 kW) angefahren wird, wirkt diese in<br />
Sekundenschnelle druckstabilisierend.<br />
82 03 / 2013
WASSERVERSORGUNG RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
Rahmenbedingungen der Messungen<br />
Um einzelne Pumpen oder Druckerhöhungsanlagen im<br />
Gesamten mit einer ausreichend hohen Genauigkeit zu<br />
messen, müssen vorher die passenden Parameter für die<br />
Messung festgelegt werden. Die Drucklogger sind auf<br />
verschiedene Messparameter programmierbar. Technisch<br />
bedingt muss man die Einstellungen dem Messablauf<br />
anpassen, d.h., dass die Auflösung der gemessenen<br />
Druckkurven ausreichend hoch sein sollte. Um sehr genaue<br />
Daten zu bekommen, ist ein hoher Messtakt erforderlich. So<br />
wurden bei den untersuchten Druckerhöhungsanlagen ein<br />
Messtakt von 1 s und ein Mittelwertfaktor von 2 gewählt,<br />
was einer Messwertablage alle zwei Sekunden entspricht. Es<br />
sind durch diese Einstellung einzelne Spitzenwerte deutlicher<br />
erkennbar und auch die genauen Regelzeiten werden<br />
sichtbar. Bei einer großzügigen Einstellung, beispielsweise<br />
von einer 30 Sekunden-Ablage, werden auftretende Spitzen<br />
gemittelt und sind dadurch nicht mehr zu erkennen. Wenn<br />
ein Ortsnetz mehrere Tage gemessen wird, ist bei dieser<br />
Einstellung allerdings der Speicher schnell voll.<br />
Eine Druckerhöhungsanlage bzw. ein Pumpwerk bekommt<br />
das Wasser entweder durch einen vorgelagerten Behälter<br />
(mittelbarer Anschluss), dessen Versorgung für die<br />
Modellierung der Pumpen nicht weiter interessiert, oder<br />
durch direktes „Saugen“ aus dem Netz (unmittelbarer<br />
Anschluss). Dieser Sachverhalt hat entscheidenden Einfluss<br />
auf den Vordruck einer Pumpe. Während der Vordruck<br />
bei Förderung aus einem Behälter fast konstant bleibt<br />
(sinkt minimal mit dem Behälterfüllstand), ändert sich der<br />
Vordruck beim „Saugen“ aus dem Netz mit dem Verhalten<br />
der jeweiligen Pumpe. Bei der Vorberechnung einer<br />
Messung ist entsprechend zu berücksichtigen, dass sich<br />
die Druckerhöhungsanlage und das vorgelagerte System<br />
gegenseitig hydraulisch beeinflussen. Es kann auch vor<br />
einer Druckerhöhungsanlage zu einer Druckunterschreitung<br />
im Netz unter den geforderten Mindestversorgungsdruck<br />
von 1,5 bar kommen. Des Weiteren muss beachtet werden,<br />
dass der NPSH-Wert der Pumpe (Net Positive Suction Head<br />
oder Haltedruckhöhe) nicht unterschritten wird, weil es<br />
sonst durch Kavitation 1 zu einer Leistungsverminderung<br />
der Pumpe/Anlage kommen kann.<br />
Der NPSH-Wert der Anlage muss mit dem vorgegebenen<br />
NPSH-Wert der Pumpe (Herstellerangabe; wird mit den<br />
Kennlinien geliefert) verglichen werden.<br />
Der NPSH-Wert der Anlage muss mindestens 0,5 m höher<br />
sein als der NPSH-Wert der Pumpe. Für einen sicheren,<br />
kavitationsfreien Betrieb gilt:<br />
NPSH Anlage<br />
+ 0,5 m > NPSH Pumpe<br />
Entnahmemenge während der Druck- und<br />
Durchflussmessung<br />
Nach einer Planungsphase werden die Messungen an den<br />
Förderanlagen durchgeführt. Hierzu werden Drucklogger<br />
an den vorher bestimmten Stellen der Anlage eingebaut.<br />
1 Am Laufradeingang können durch örtliche Druckabsenkung Dampfblasen und<br />
später durch deren Zerfall Druckspitzen von mehreren tausend bar auftreten.<br />
Bild 1: Funktionsweise der Drehzahlregelung [8]<br />
Als Referenzpunkt wird vor der Entnahmestelle im Netz<br />
ebenfalls ein Drucklogger gesetzt, um den Druck zu<br />
überwachen. Meist wird auch die höchste Stelle im Netz<br />
überwacht, dort darf kein Unterdruck erzeugt werden!<br />
Die Messung wird dann zu vorher festgelegten Lastfällen<br />
(verschiedene Volumenströme) durchgeführt. Dabei<br />
wird am Hydrant im Netz eine bestimmte Menge an<br />
Wasser entnommen und der Druck von den Messgeräten<br />
aufgezeichnet (vgl. Bild 2).<br />
Vor einer Messung sollte beachtet werden, wie viel Wasser<br />
das Pumpwerk oder die Druckerhöhungsanlage bei einem<br />
bestimmten Druck liefern kann. Um bei drehzahlgeregelten<br />
Pumpen einen Rückgang der Förderhöhe messen und daraus<br />
Daten für eine Kennlinie ableiten zu können, sollte man<br />
möglichst über den Nennwert der Fördermenge gelangen.<br />
Hierbei muss man aber abwägen, ob dies überhaupt möglich<br />
und sinnvoll ist. Wenn ein Pumpwerk eine viel größere Leistung<br />
hat, als bei Stundenspitzenwerten benötigt wird, dann kann<br />
im Normalfall der Solldruck immer gehalten werden. Dieses<br />
Pumpwerk kann man also nicht in dem Maße belasten, dass<br />
man einen Rückgang der Förderhöhe messen kann.<br />
Eine aufwändige Methode, die Kennlinie einer Pumpe<br />
in einer Anlage großer Leistung (P > 50 kW) zu messen,<br />
wäre die sukzessive Abschaltung bis auf eine Pumpe. Der<br />
03 / 2013 83
Bild 6: Berechnungsvarianten einer<br />
Kompaktdruckerhöhungsanlage<br />
Bild 7: Unterschied der Kennlinie von Hersteller und der Messung<br />
p soll<br />
= Solldruck am Knoten nach der Anlage (vorgegeben)<br />
h = Höhe des Knotens nach der Anlage (liegt vor)<br />
Die Berechnung erfolgt so lange, bis der Solldruck annähernd<br />
genau erreicht ist. Bricht der Rechenvorgang ab, obwohl der<br />
Druck noch stark vom Solldruck abweicht, muss in STANET<br />
unter „Datei“ – „Netzparameter“ – „Rechenparameter“<br />
– „Maximale Anzahl Iterationen“ die Anzahl der<br />
Iterationen erhöht werden. In der Standardeinstellung<br />
wird eine Steuerung maximal fünfmal wiederholt. Dies<br />
reicht in der Regel nicht aus. Deshalb muss auch hier eine<br />
erweiterte Einstellung getroffen werden. Unter „Datei“ –<br />
„Netzparameter“ – „Erweitert“ – „Simulationsvorgaben“ –<br />
Seite 2 unter „Max Wiederholung für Steuerungen“ können<br />
Werte bis 99 eingetragen werden. Der Rechenvorgang<br />
dauert dann dementsprechend länger.<br />
In der Steuerung selbst kann man einen Toleranzwert<br />
bestimmen. Dieser sollte aber bei „0%“ belassen werden,<br />
da sonst die Abweichung vom Solldruck zu groß wird.<br />
Die Steuerung soll auf der Pumpe / Anlage platziert werden.<br />
In schriftlicher Form ausgedrückt sieht die Bedingung für<br />
eine Drehzahlsteuerung folgendermaßen aus:<br />
Wenn der berechnete Druck eines Knotens über dem<br />
eingegebenen Solldruck liegt („Nur ausführen, wenn<br />
Bedingung zutreffend“), dann wird das Feld Solldrehzahl<br />
um eine Differenz verändert (siehe obige Formel).<br />
Diese Steuerung funktioniert auch, wenn der berechnete<br />
Druck unter dem Solldruck liegt. Dann wird die Drehzahl<br />
erhöht, bis der Solldruck erreicht wird. Diese Art kann man<br />
noch mit einer Bedingung für den Durchfluss ergänzen,<br />
damit der Druck nur innerhalb bestimmter Grenzen für den<br />
Durchfluss geregelt wird.<br />
Zu beachten ist, dass es zu Endlosschleifen kommen<br />
kann, wenn die Grenzwerte der Bedingungen von zwei<br />
Steuerungen auf einer Pumpe sich überlagern. Hier wird bis<br />
zur maximalen eingestellten Anzahl von Wiederholungen<br />
gerechnet (maximal 99).<br />
Bei der Berechnung von Rohrnetzen werden sämtliche<br />
hydraulische Druckverluste, die durch Leitungseinbindungen,<br />
Muffen, Krümmer, Armaturen und Nennweitenänderungen<br />
erzeugt werden, mit einer so genannten betrieblichen<br />
Rauigkeit [k b<br />
] berücksichtigt. Die Rauigkeit [k b<br />
] kennzeichnet<br />
nicht die messbare Höhe der Rauheitserhebung, sondern<br />
ist als Maß für das hydraulische Verhalten der gesamten<br />
Rohrleitung bzw. des jeweiligen Netzes zu verstehen.<br />
Bei der Modellierung einer Kompaktdruckerhöhungsanlage<br />
gibt es zwei Möglichkeiten (vgl. Bild 6). Die erste Variante<br />
stellt die Modellierung jeder einzelnen Pumpe dar. Bei dieser<br />
Art von Anlagen ist aber eine Modellierung von nur einer<br />
Pumpe notwendig, wenn die Gesamtanlage aus mehreren<br />
baugleichen Einzelpumpen besteht. Dies erspart Zeit und<br />
minimiert Fehlerquellen.<br />
Bei großen Anlagen, deren mögliche Fördermenge<br />
bei konstantem Druck die Stundenspitzenwerte eines<br />
Versorgungsgebietes überschreitet, ist die Simulation durch<br />
einen Druckknoten oder einen Behälter mit entsprechender<br />
Wasserspiegellage ausreichend. Es muss dann kein<br />
zusätzlicher Aufwand durch die Modellierung von Pumpen<br />
bzw. von Förderanlagen und Kennlinien betrieben werden.<br />
Ist in einer Anlage eine Grundlastpumpe in Betrieb<br />
und kann im Brandfall eine zusätzliche Pumpe für den<br />
Feuerlöschbedarf zugeschaltet werden, müssen diese<br />
Pumpen separat modelliert werden und dürfen nicht zu<br />
einer Anlage zusammengefasst werden. Das Verhalten<br />
des Systems im Brandfall kann man entsprechend mit<br />
Steuerungen nachbilden. Der Netzdruck wird somit<br />
überwacht, und bei Unterschreitung eines festgelegten<br />
Sollwertes fördert die Zusatzpumpe ins Netz.<br />
Pumpenkennlinien/Anlagenkennlinien<br />
Typische Kennlinien einer Pumpe stellen die Förderhöhe,<br />
Leistungsaufnahme, Wirkungsgrad und den NPSH-Wert als<br />
Funktion des Förderstroms dar. Pumpenkennlinien werden<br />
vom Hersteller erstellt und dort auf dem Prüfstand ermittelt.<br />
Die Bedingungen sind dort ideal. Im realen Betriebszustand<br />
sind aber die Voraussetzungen anders. Wenn eine<br />
Kennlinie ermittelt werden soll, müssen verschiedene<br />
Betriebszustände abgefahren werden. Es kommt dann<br />
immer darauf an, an welchem Punkt der Druck gemessen<br />
wird und ob sich zwischen Messpunkt und Pumpenausgang<br />
noch Armaturen, wie zum Beispiel Rückschlagklappen,<br />
befinden. Diese Einbauten verursachen eine Abweichung<br />
der gemessenen Kennlinie der Anlagen zur Kennlinie der<br />
Pumpen der Hersteller (vgl. Bild 7). Des Weiteren kann die<br />
Leistung einer Pumpe auf Dauer geringer sein, wenn sie<br />
unter Kavitationsbedingungen betrieben wird.<br />
86 03 / 2013
WASSERVERSORGUNG RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
Wenn es eine Differenz von mehr als 0,1 bar von gemessener<br />
Kennlinie zur Herstellerkennlinie gibt, müssen die Ursachen<br />
begründet werden (z.B.: Armaturen oder möglicherweise<br />
altersbedingter Leistungsrückgang, eventuell durch Kavitation).<br />
ZUSAMMENFASSUNG<br />
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem<br />
Thema Modellierung und Kalibrierung von Pumpen<br />
und Druckerhöhungsanlagen in einer entsprechenden<br />
Berechnungssoftware. Die hier verwendete Software ist<br />
STANET. Im Folgenden werden Maßnahmen empfohlen, die<br />
den Umgang mit Druckerhöhungsanlagen vor der Messung,<br />
zum Zeitpunkt der Messung und bei der Modellierung und<br />
Kalibrierung erleichtern. Die Aussagen basieren auf den<br />
Erkenntnissen und Daten der insgesamt sieben untersuchten<br />
Anlagen:<br />
» Vorbereitung von Messungen über Pumpenanlagen (Bild 8)<br />
» Wichtige Punkte, an denen Druckverluste innerhalb<br />
der Anlagen auftreten (Verluste hängen immer von<br />
der Nennweite und dem Durchfluss ab; hier: Mess- und<br />
Erfahrungswerte), (Bild 9)<br />
» Durch die gesammelten Erfahrungen und Ergebnisse der<br />
Bachelorarbeit schlagen wir die in Bild 10 dargestellte<br />
Vorgehensweise bei der Modellierung und Kalibrierung<br />
von Pumpen / Druckerhöhungsanlagen in einer<br />
Berechnungssoftware vor.<br />
LITERATUR UND QUELLENVERZEICHNIS<br />
[1] DVGW W 400-1 „Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen<br />
(TRWV) - Teil 1: Planung“, Abschn. 10.1<br />
[2] DVGW W 400-1 „Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen<br />
(TRWV) - Teil 1: Planung“, Abschn. 10.2<br />
[3] DVGW-Arbeitsblatt W 610 „Pumpensysteme in der<br />
Trinkwasserversorgung“ (2010-03)<br />
[4] DVGW-Arbeitsblatt W 617 „Druckerhöhungsanlagen in der<br />
Trinkwasserversorgung“ (2006-11)<br />
[5] Fachbericht Wasserversorgung, Artikel: Hydraulische<br />
Rohrnetzberechnung von Esad Osmancevic und Tobias Kuhn<br />
[6] Grundfos Pumpenhandbuch<br />
[7] WebCAPS Grundfos<br />
[8] http://net.grundfos.com/doc/webnet/in-line/de/download/<br />
speedcontrol_germany.pdf<br />
[9] http://net.grundfos.com/doc/webnet/in-line/de/download/<br />
speedcontrol_germany.pdf<br />
[10] Betriebsanleitung ESS elektronischer Speicherschreiber Kapitel 7<br />
[11] Betriebsanleitung EsapPro-Software<br />
[12] Ritz Datenheft Baureihe 45<br />
[13] Sulzer Pumpen - Kreiselpumpen Handbuch<br />
[14] www.allmess.de/fileadmin/multimedia/PDFs/Produkte/ Wasserzaehler/Grosswasserzaehler/WP_Woltex/P0302<br />
_Woltex_TS0911_<br />
NEU_KL.pdf<br />
[15] Grundlagen für die Projektierung und den Betrieb von EDUR-<br />
Kreiselpumpenanlagen - Abschnitt 3<br />
[16] www.korros.de/Bilder-Kreiselpumpen<br />
Bild 8: Vorbereitung der Messungen<br />
Bild 9: Druckverluste der Anlagen<br />
Bild 10: Vorgehensweise bei der Modellierung und<br />
Kalibrierung von Pumpen<br />
Dr.-Ing. ESAD OSMANCEVIC<br />
RBS wave GmbH, Stuttgart<br />
Teamleiter Netzmanagement<br />
Tel. +49 711 289513-20<br />
E-Mail: e.osmancevic@rbs-wave.de<br />
FABIAN JANOTTE<br />
Student – Hochschule<br />
Ravensburg-Weingarten<br />
RBS wave GmbH, Stuttgart<br />
Tel. +49711/ 289 513-54<br />
E-Mail: f.janotte@rbs-wave.de<br />
AUTOREN<br />
03 / 2013 87
FACHBERICHT RECHT WASSERVERSORGUNG<br />
& REGELWERK<br />
Kombination von Ortungsverfahren<br />
für die Wasserlecksuche<br />
Die Bedeutung von Trinkwasser als unverzichtbares Lebensmittel nimmt seit Jahren stetig zu und sowohl Wasserversorger<br />
als auch deren Kunden gehen immer sorgfältiger mit dieser nicht unerschöpflich vorhandenen Ressource um. Genau wie<br />
jeder Verbraucher sich stets fragen sollte, ob er im täglichen Gebrauch noch mehr Wasser sparen kann, sind auch die<br />
Wasserversorgungsunternehmen (WVU) ständig bemüht, Einsparpotentiale zu erkennen. Deren Überlegungen betreffen<br />
vor allem das Wasserverteilungsnetz, in dem es aus unterschiedlichen Gründen immer wieder zu Leckagen kommt, durch<br />
die – im Zeitraum zwischen Entstehung und Beseitigung des Schadens – große Mengen Wasser verloren gehen können.<br />
Daher ist jedes WVU bestrebt, die Anzahl von Leckstellen zu minimieren und dafür Sorge zu tragen, dass erkannte Lecks<br />
unverzüglich beseitigt werden.<br />
Im einfachsten Fall läuft die Leckbeseitigung heute noch wie<br />
schon seit Jahrzehnten ab: Unbeteiligte (Passanten) oder<br />
von Überschwemmung Betroffene melden dem WVU einen<br />
sichtbaren Wasseraustritt, das WVU lokalisiert den Schaden<br />
und lässt ihn anschließend beheben (reaktives Verfahren).<br />
Nun ist es zum einen leider so, dass Lecks an einer Wasserleitung<br />
nicht immer zu sichtbaren Spuren oder einem Wasseraustritt<br />
an der Oberfläche führen. Zum anderen trifft die<br />
nach wie vor verbreitete Meinung, dass Lecks immer an die<br />
Oberfläche kämen – oft sei es nur eine Frage der Zeit – mit<br />
gewissen Einschränkungen tatsächlich zu, denn in Abhängigkeit<br />
von Bodenart und Netzstruktur kann ein Großteil<br />
des austretenden Wassers irgendwann an der Oberfläche<br />
sichtbar werden. Allerdings bleibt dabei unberücksichtigt,<br />
Bild 1: Momentane Zuflussmessung – Aufbau am Straßenrand<br />
dass das Alter von Leckagen einen erheblichen Einfluss auf<br />
die Gesamtmenge der Wasserverluste hat. Wenn also das<br />
Wasser sichtbar an der Oberfläche ankommt, ist unklar, wie<br />
lange das Leck schon existiert. Reaktive, optische Verfahren<br />
können folglich nur einen Teilaspekt der Lecksuche im<br />
Wasserrohrnetz darstellen und sind als alleinige Methode<br />
niemals geeignet, Wasserverluste dauerhaft zu reduzieren.<br />
PROAKTIVE VERFAHREN ZUR FRÜHZEITIGEN<br />
ERKENNUNG<br />
Ein grundsätzlich anderer Lösungsansatz als die alleinige<br />
Reaktion auf sichtbare Rohrbrüche ist mittlerweile viel<br />
weiter verbreitet. Die Mehrzahl der Wasserversorger hat<br />
die Suche nach Wasserverlusten systematisiert und nutzt<br />
proaktive Verfahren zur frühzeitigen Erkennung von Verlusten<br />
im Rohrnetz. Das Arbeitsblatt W 392 des DVGW<br />
bildet die Grundlage aller Maßnahmen, die der Senkung<br />
von Wasserverlusten dienen. Das Kapitel 6 empfiehlt die<br />
Einführung einer Strategie zur Überwachung, Reduzierung<br />
und Niedrighaltung von Wasserverlusten und definiert drei<br />
entscheidende Schritte: Die Dichtheitsmessung, die Ermittlung<br />
der Wasserverluste durch Zuflussmessung und den<br />
Einsatz von Leckortungsverfahren.<br />
Dichtheitsmessung und quantitative Bestimmung der Wasserverluste<br />
können in einem Arbeitsgang erfolgen. Die dabei<br />
gewonnenen Erkenntnisse lassen bereits auf kleine Leckstellen<br />
und geringe Verlustmengen schließen. Für eine möglichst<br />
genaue und zuverlässige Erkennung der Verluste ist die Einteilung<br />
des Rohrnetzes in Überwachungsbezirke unbedingt<br />
erforderlich. Diese Bezirke müssen sich vom verbleibenden<br />
Netz durch Schieber dicht abtrennen und über eine definierte,<br />
volumetrisch erfassbare Einspeisung versorgen lassen. Denkbar<br />
ist, solche Rohrnetzbezirke mit einem fest installierten<br />
Zähler auszustatten. Wenn dann alle Zu- und Abflüsse des<br />
Rohrnetzbezirks ermittelt werden, spricht das Arbeitsblatt W<br />
392 von einer kontinuierlichen Zuflussmessung.<br />
Die Übertragung und Auswertung der Messwerte sollte<br />
zeitnah erfolgen. Als stationäre Rohrnetzbezirke eignen sich<br />
Abschnitte von etwa 4 bis 30 km Netzlänge. Die Messzeit sollte<br />
in der Nacht liegen und ein bis zwei Stunden betragen. Der<br />
88 04-05 / 2013
WASSERVERSORGUNG RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
während der Messzeiten ermittelte Nachtmindestverbrauch<br />
enthält immer auch eine gewisse Restverbrauchsmenge, die<br />
in definierten stationären Zonen als Referenzwert vorliegen<br />
muss. Nachtmindestverbrauchswerte ändern sich nicht signifikant,<br />
solange die Betriebsbedingungen des Netzabschnitts<br />
nicht geändert werden. Im Normalfall werden daher in jeder<br />
Nacht in etwa die gleichen Minimalwerte gemessen. Treten<br />
im Messgebiet Leckagen auf, steigen die nachts gemessenen<br />
Werte merklich an und bleiben dauerhaft erhöht. Weil bei der<br />
kontinuierlichen Zuflussmessung die reale Leckmenge direkt<br />
messbar ist, kann auf Veränderungen sofort reagiert werden.<br />
Die erforderlichen Maßnahmen zur Eingrenzung des Schadens<br />
können umgehend eingeleitet werden, wie z. B. die Verkleinerung<br />
des Messgebiets durch Schließen von Schiebern.<br />
Diese Art der kontinuierlichen Zuflussmessung ist mit erheblichem<br />
finanziellem Aufwand für die Installation und den<br />
Betrieb verbunden. Sie setzt außerdem detaillierte Kenntnisse<br />
des Rohrnetzes im Hinblick auf die vorhandene Hydraulik<br />
voraus, um Messpunkte sinnvoll auszuwählen. Dies<br />
gelingt in der Regel nur durch eine fundierte und verifizierte<br />
Rohrnetzberechnung.<br />
Eine Alternative zur kontinuierlichen Zuflussmessung mit<br />
fest installierten Messpunkten besteht in der momentanen<br />
Zuflussmessung. Dafür wird das Netz in Abhängigkeit von<br />
den Wasserverlusten zyklisch geprüft. Die Rohrnetzbezirke<br />
sollten etwas kleiner sein als bei kontinuierlichen Messungen.<br />
Empfehlenswert sind Netzlängen zwischen 1 und 10 km,<br />
damit die zu erwartende Restverbrauchsmenge und eventuelle<br />
Dauerabnehmer, wie Industriebetriebe, die Messungen<br />
nicht übermäßig stark beeinflussen. Zur Prüfung wird der<br />
zu untersuchende Teil des Rohrnetzes vom verbleibenden<br />
dicht abgetrennt. Über zwei Hydranten, einen innerhalb<br />
und einen außerhalb des Messgebiets, wird der abgetrennte<br />
Rohrnetzbezirk durch eine Schlauchbrücke versorgt. In diese<br />
Schlauchverbindung wird eine mobile Messeinrichtung eingebunden<br />
(siehe Bild 1), die die Druck- und Durchflussmesswerte<br />
an einen PC überträgt. So lässt sich der Minimaldurchfluss<br />
ermitteln. Die Restverbrauchsmenge muss möglichst genau<br />
abgeschätzt werden. Sind im gemessenen Rohrnetzbezirk<br />
nur wenige Verbraucher angeschlossen oder ist die Gleichzeitigkeit<br />
der Wasserentnahme sehr gering, wird in der Praxis<br />
häufig auch eine Nullverbrauchsmessung gelingen, in der<br />
kein Wasser in das untersuchte Gebiet fließt.<br />
TEMPORÄRER EINSATZ VON GERÄUSCHLOGGERN<br />
Wenn die Überprüfung eines Rohrnetzabschnitts auf Dichtheit<br />
ein Ergebnis geliefert hat, das die Existenz von Leckagen<br />
nachweist, sind weitere Schritte erforderlich, um das<br />
erkannte Leck genauer einzugrenzen und schließlich möglichst<br />
präzise zu lokalisieren. Eine bewährte Möglichkeit der<br />
Vorortung der Leckstelle in untersuchten Rohrnetzabschnitten<br />
ist der temporäre Einsatz von Geräuschloggern. Diese<br />
werden für ein oder zwei Messnächte in einen Hydranten<br />
im Netzabschnitt eingebaut; die leisesten Momente während<br />
der Messzeit werden registriert. Befindet sich der<br />
Logger in der Nähe eines Lecks, ist in der Nacht selbst im<br />
leisesten Moment die Lautstärke deutlich größer als Null.<br />
Bild 2: Verwendung eines Teststabs zur Vorortung<br />
Bild 3: Lokalisation des Lecks mit einem Korrelator<br />
Durch systematisches Umsetzen der Logger im untersuchten<br />
Gebiet lassen sich die Hydranten, an denen laute Geräusche<br />
gemessen werden können, schnell und zuverlässig ermitteln.<br />
Bereits etwa 20 solcher Logger reichen aus, um nach<br />
wenigen Nächten die möglichen Leckstellen im untersuchten<br />
Gebiet auf einige hundert Metern genau einzukreisen.<br />
04-05 / 2013 89
FACHBERICHT RECHT WASSERVERSORGUNG<br />
& REGELWERK<br />
VORORTUNG MIT DEM TESTSTAB<br />
Bei diesem Verfahren geht ein Lecksucher das Netz mit<br />
einem Teststab systematisch ab. Dabei öffnet er alle Straßenkappen<br />
und bewertet die Geräusche an sämtlichen<br />
Armaturen, wie Schiebern, Ventilanbohrschellen oder<br />
Hydranten (siehe Bild 2). Sind deutliche Leckgeräusche<br />
an den Armaturen hörbar, werden diese Stellen markiert.<br />
Die Vorortung ist damit abgeschlossen. Da die Aussagekraft<br />
aller elektroakustischen Verfahren sehr stark von den<br />
Umgebungsgeräuschen und der Erfahrung des Anwenders<br />
abhängen, finden derartige Prüfungen oft in den<br />
Nachtstunden statt. In diesen Zeiten ist es am ruhigsten<br />
und störender Verkehr oder Verbrauch im Netz sind minimal.<br />
Der große Vorteil dieser Art der Vorortung besteht<br />
darin, dass sie in allen Netzstrukturen einsetzbar ist.<br />
Abhängig von der Art der Rohrleitung, deren Material und<br />
Durchmesser kann ein gehörtes Geräusch vollkommen einzigartig<br />
sein. Kaum ein Leck klingt wie ein anderes. Aber<br />
in jedem Fall ist ein Leck durch ein deutliches Geräusch<br />
gekennzeichnet, das nicht mit normalen Fließgeräuschen<br />
im Wasserrohrnetz zu verwechseln ist.<br />
Bild 4: Tracergas zur Lokalisation von Lecks in Wasserleitungen<br />
Ist die Leckmenge im untersuchten Gebiet jedoch sehr groß<br />
und besteht die Gefahr, dass austretendes Wasser durch<br />
Unterspülungen in kürzester Zeit Schäden an Gebäuden<br />
oder Straßen oder anderen Bauwerken hervorruft, ist es<br />
erforderlich, schnellere Wege zur Vorortung der Schadensstelle<br />
zu beschreiten. Dann kommen mobile elektroakustische<br />
Verfahren zum Einsatz.<br />
LOKALISATION MIT KORRELATOREN<br />
Eine punktgenaue Bestimmung des Lecks, wie es zur Aufgrabung<br />
einer Schadensstelle erforderlich ist, lässt sich durch<br />
alleiniges Prüfen der Armaturen nicht leisten. Dafür kommt<br />
dann – seit vielen Jahren erfolgreich – das Verfahren der<br />
Korrelation zur Anwendung. Bei diesem Lokalisationsverfahren<br />
werden an zwei Messstellen (Armaturen im Rohrnetz)<br />
Mikrofone installiert. Über Funk gelangen die Signale der<br />
Mikrofone zu einem Empfänger und werden dort rechnerisch<br />
ausgewertet (siehe Bild 3). Als Ergebnis zeigt der<br />
Korrelator die Position des Lecks als Abstand von einer der<br />
beiden Messpunkte an. Korrelationsverfahren sind weitgehend<br />
unabhängig vom Erfahrungsschatz des Anwenders<br />
und über die Genauigkeit der Messung entscheiden objektive<br />
Faktoren; die Rohrleitungslänge zwischen den beiden<br />
als Messpunkte genutzten Armaturen sowie Material und<br />
Durchmesser der Korrelationsstrecke.<br />
Besonders auf Kunststoffleitungen ist die Lokalisation<br />
eines Lecks oft recht schwierig, da sich das Leckgeräusch<br />
nicht so weit ausbreitet wie dies auf metallischen Rohren<br />
der Fall ist. Oft ist es daher in nichtmetallischen Rohrnetzen<br />
nur schwer möglich ein Leck zu korrelieren, zudem<br />
wenn der Abstand zwischen benachbarten Armaturen<br />
sehr groß ist. Die Leckgeräusche erreichen die Kontaktstellen<br />
dann möglicherweise gar nicht erst. Um dennoch<br />
erfolgreich korrelieren zu können, kommt eine andere Art<br />
von Mikrofonen zum Einsatz: Hydrofone. Diese werden<br />
direkt in die Wassersäule eingebracht. Da die Schallausbreitung<br />
im Wasser wesentlich besser ist als über den Körperschall<br />
einer Rohrleitung, kann mittels Hydrofone auch<br />
über lange Messstrecken erfolgreich korreliert werden.<br />
Im praktischen Einsatz hängt die Genauigkeit der Leckortung<br />
von der Qualität der verfügbaren Leitungsdaten ab.<br />
Nach einer erfolgreichen Korrelation hat es sich bewährt,<br />
das errechnete Ergebnis und die so gefundene Leckstelle<br />
durch ein elektroakustisches Verfahren zu bestätigen.<br />
Dazu wird ein Empfänger mit einem Bodenmikrofon verbunden,<br />
das für die Oberfläche an der zu prüfenden Stelle<br />
geeignet sein sollte. Dann wird direkt über der geprüften Leitung,<br />
und zwar an der korrelierten Position, mit der Prüfung<br />
begonnen. Die durch den Boden an die Oberfläche gelangenden<br />
Geräusche werden vom Lecksucher analysiert. Ein<br />
Geräusch ist in der Regel unmittelbar über der Leckage am<br />
lautesten. Wenn Umweltgeräusche, wie Regen, Wind oder<br />
auch Störungen durch Verkehr an der Leckstelle, die Ortung<br />
erschweren, oder wenn das Leckgeräusch nicht eindeutig<br />
hörbar ist, bieten Filtereinstellungen am Empfänger sinnvolle<br />
Hilfe zur verbesserten Wahrnehmung des Geräuschs.<br />
90 04-05 / 2013
WASSERVERSORGUNG RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
Nach Abschluss aller Schritte zur Lokalisation und der akustischen<br />
Bestätigung des Ergebnisses wird die Position des<br />
Lecks auf der Bodenoberfläche markiert und eine Dokumentation<br />
angefertigt. Danach kann die Beseitigung des<br />
Schadens eingeleitet werden.<br />
Alle bisher genannten Verfahren zur Vorortung und Lokalisation<br />
eines Wasserlecks – Einsatz von Geräuschloggern, Vorortung<br />
mit dem Teststab, Lokalisation mit dem Korrelator und<br />
auch die elektroakustische Bestätigung des Lecks mit dem<br />
Bodenmikrofon – sind von der Entstehung eines Geräuschs<br />
beim Austritt des Wassers aus der Schadensstelle abhängig.<br />
Die bei der Überprüfung des Rohrnetzabschnitts quantitativ<br />
ermittelte Leckmenge muss aber nicht unbedingt aus einem<br />
Leck stammen, das so groß ist, ein hörbares Geräusch zu<br />
erzeugen. Stattdessen kann es sich auch um mehrere kleine<br />
Lecks handeln, die – jedes für sich – keine mess- oder<br />
hörbaren Geräusche generieren.<br />
Die bislang genannten Leckortungsverfahren können auch<br />
anderweitig an ihre Grenzen stoßen. Fehlen Kontaktpunkte<br />
(Schieber, Hydranten etc.) oder haben diese einen ungeeigneten<br />
Abstand, wird der Einsatz von Verfahren auf akustischer<br />
Basis erschwert. Ein typischer Fall in der Ortungspraxis<br />
ist die Untersuchung von großen, langen Transportleitungen.<br />
GASPRÜFMETHODE MIT TRACERGAS<br />
Solche Teilstrecken des Rohrnetzes können sehr gut durch<br />
eine momentane Zuflussmessung auf Dichtheit geprüft werden,<br />
aber eine auf Leckgeräuschen basierende Vorortung<br />
und Lokalisation des Schadens ist oft nicht erfolgreich. Dafür<br />
bietet sich stattdessen die Gasprüfmethode an.<br />
Bei der Gasprüfmethode wird ein leicht flüchtiges, geruchloses,<br />
geschmackloses und nicht brennbares Gas in die zu<br />
untersuchende Leitung eingespeist. Bewährt haben sich<br />
für diesen Zweck Wasserstoffgemische mit Stickstoff. Auch<br />
Helium kommt in der Praxis zum Einsatz, allerdings nur sehr<br />
selten im Bereich der Trinkwasserversorgung. Wasserstoff in<br />
Stickstoff hat gegenüber Helium den Vorteil, dass Wasserstoff<br />
an der Erdoberfläche bereits in Spuren von wenigen<br />
ppm gut detektierbar ist. Die Gemische sind bekannt unter<br />
den Bezeichnungen Tracergas bzw. Formiergas. Es handelt<br />
sich um technische Gase, die leicht zu beschaffen sind und<br />
in den meisten Fällen 5 % Wasserstoff in Stickstoff enthalten.<br />
Auch Mischungen mit 10 % Wasserstoff werden<br />
verwendet, jedoch seltener.<br />
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Tracergas zur Leckortung<br />
in Wasserleitungen zu nutzen. Zum einen kann das<br />
Gas während des Betriebs der Leitung beigemengt werden.<br />
Da die Löslichkeit von Wasserstoff und auch Stickstoff in<br />
Wasser sehr stark begrenzt ist, fließt das Gas in Form von<br />
Blasen unterhalb des Rohrscheitels entlang, sofern keine<br />
starken Turbulenzen im Rohr auftreten, die für eine ständige<br />
Durchmischung sorgen. Blasen undefinierter Größe in der<br />
Leitung haben jedoch verschiedene Nachteile. Einer davon<br />
ist, dass sensible Armaturen im Netz, wie z. B. automatische<br />
Entlüfter an einer Transportleitung, ständig das Gas<br />
ablassen, was bei der Detektion an der Erdoberfläche zu<br />
einer Leckanzeige führt. Ein anderer ist, dass die Blasen<br />
beim Verbraucher an den Zapfstellen zusammen mit dem<br />
Wasser austreten. Das kann unter Umständen zu Beschädigungen<br />
an Haushaltsgeräten führen. Der größte Nachteil<br />
der unvollständigen Lösung des Gases in Wasser und der<br />
deshalb entstehenden Blasen unter dem Rohrscheitel ist<br />
aber sicherlich die Tatsache, dass keine Lecks nachweisbar<br />
sind, die an der Rohrsohle liegen, weil aus denen dann kein<br />
wasserstoffhaltiges Wasser austritt.<br />
In der Praxis sollten die betreffenden Wasserleitungen daher<br />
außer Betrieb genommen und anschließend entleert werden.<br />
Das eingeführte Gas kann dann das gesamte Leitungsvolumen<br />
einnehmen. Damit ist sichergestellt, dass das Gas<br />
an allen möglichen Leckagen auf dem vollen Umfang der<br />
Leitung in den Boden entweichen kann. Der sehr leichte<br />
Wasserstoff diffundiert dann sehr schnell an die Oberfläche<br />
und kann dort mit einem hochempfindlichen Gasspürgerät<br />
nachgewiesen werden (siehe Bild 4).<br />
Das DVGW-Arbeitsblatt W 392 empfiehlt, dass Inspektionen<br />
auf Dichtheit in Abhängigkeit von der Höhe der Wasserverluste<br />
im Rohrnetz erfolgen sollten. Vorgeschlagen werden jährliche<br />
Inspektionen bei hohen Verlusten, Inspektionen alle drei Jahre<br />
bei mittleren Wasserverlusten und spätestens alle sechs Jahre<br />
bei geringen Wasserverlusten. Die für die Inspektionen erforderliche<br />
Einteilung des Rohrnetzes in Überwachungsbezirke,<br />
die quantitative Ermittlung der Leckmenge im Rohrnetz sowie<br />
Auswahl und Kombination der unterschiedlichen Verfahren<br />
bis zur aufgrabungsreifen Lokalisation eines Lecks sind die<br />
entscheidenden Bausteine jeder möglichen Strategie. Welches<br />
Verfahren in welcher Kombination zum Einsatz kommt,<br />
hängt ebenso von den Gegebenheiten der Netze wie von der<br />
verfügbaren Messtechnik ab. Ein einzelnes Verfahren oder<br />
eine Methode allein führen jedoch nicht zum Erfolg. Erst die<br />
Kombination von Ortungsverfahren für die Wasserlecksuche<br />
ist ein Garant für die Reduzierung und Niedrighaltung von<br />
Wasserverlusten in Rohrnetzen.<br />
Halle 6.2., Stand 116 | Halle 5.2., Stand 302<br />
Dipl.-Ing. DIRK BECKER<br />
Hermann Sewerin GmbH Gütersloh<br />
Tel. +49 5241 934220<br />
E-Mail: dirk.becker@sewerin.com<br />
AUTOR<br />
04-05 / 2013 91
FACHBERICHT WASSERVERSORGUNG<br />
RECHT & REGELWERK<br />
AQWA Academy: Nachhaltiges<br />
Capacity Development im Wassersektor<br />
Wasser als lebensnotwendiges Element bezieht seine besondere Bedeutung<br />
aus der engen Verwobenheit mit Gesundheit, Ernährungssicherheit,<br />
Energieversorgung, Umwelt und Wirtschaft. Der Zugang zu Wasser und<br />
Basissanitärversorgung ist gemäß der Resolution der UN-Vollversammlung<br />
2010 ein essentielles Menschenrecht. Dieses Grundrecht ist aber für einen<br />
großen Teil der Weltbevölkerung nicht verwirklicht. Nachhaltige Lösungen<br />
zur effizienten und ressourcenschonenden Bewirtschaftung sind daher<br />
gefragt. Ein zentraler Faktor ist dabei die Qualifizierung von Fachkräften. AQWA Academy bietet ein Ausbildungsprogramm<br />
für Wasserexperten an und will damit einen Beitrag zur Verbesserung der Wassersituation in der wasserärmsten Region<br />
der Welt leisten.<br />
Die Länder Nordafrikas und des Nahen Ostens (MENA-<br />
Region) leiden unter der schwerwiegendsten Wasserknappheit<br />
weltweit. Die besonderen Herausforderungen für den<br />
Wassersektor der Länder liegen darin, dem durch Klimawandel,<br />
hohes Bevölkerungswachstum und zunehmende<br />
Urbanisierung stetig steigenden Wasserverbrauch qualitativ<br />
zu begegnen. Zwar sind Investitionen in Infrastrukturen<br />
Fakten zur Wassersituation in der<br />
MENA-Region<br />
Die Vorkommen an Grund- und Oberflächenwasser liegen für die meisten<br />
der MENA-Länder schon heute teilweise drastisch unterhalb der kritischen<br />
Grenze zur Wassersicherheit von 1.000 m³/pro Kopf (UN-Water Report<br />
2012). Unzureichend gesicherte Wasserversorgung und marode oder<br />
inexistente Entsorgungssysteme, Wasserverschmutzung, Verschwendung<br />
und Nutzungskonflikte verschärfen das Problem.<br />
Es kann davon ausgegangen werden, dass die Bevölkerungszahl von über<br />
359 Mio. Menschen im Jahr 2010 auf 461 Mio. in 2025 anwächst (ESCWA<br />
2012). In weiten Teilen wird eine Überausbeutung praktiziert: Beispielsweise<br />
nutzen die arabischen Golfstaaten über 100 % ihrer erneuerbaren<br />
Wasserressourcen. Über 70 % der verfügbaren Mengen entfallen auf die<br />
Landwirtschaft. Die intensive Nutzung landwirtschaftlicher Flächen und<br />
die Einträge von Pestiziden führen zu einer Abnahme der Wasserqualität<br />
und zu einer Erhöhung des Wasserstress (FAO 2012).<br />
Die zunehmende Degradation der Böden gefährdet die Ernährungssicherheit<br />
und hat weitreichende ökologische Konsequenzen Die klimatisch<br />
ohnehin aride Region leidet unter den Folgen des Klimawandels,<br />
insbesondere der Zunahme von Extremphänomenen wie Dürren und<br />
der anwachsenden Wüstenbildung. Durch die Notwendigkeit immer<br />
weiterführender technischer Maßnahmen verursacht die Wasserversorgung<br />
bereits heute große volkswirtschaftliche Kosten von bis zu 3,5 % des<br />
Bruttoninlandsprodukt (UNESCO 2013).<br />
Darüber hinaus gilt die MENA-Region als eine der Schlüsselregionen für<br />
die internationale Sicherheit. Die extreme Wasserknappheit ist somit auch<br />
ein entscheidender Faktor für die Bedrohung der sozialen und politischen<br />
Stabilität. Das dringend benötigte Wasserangebot kann jedoch nicht<br />
oder nur kaum weiter gesteigert werden, sondern droht infolge des<br />
Klimawandels sogar noch zu sinken. Umfassende Krisen scheinen hier<br />
quasi unausweichlich. Dringender Handlungsbedarf ist geboten.<br />
und Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungstechnologien<br />
dabei unabdingbar. Es geht aber auch um die<br />
Verbesserung der institutionellen Rahmenbedingungen.<br />
Ganzheitliche Lösungen, die über rein technologische<br />
Ansätze hinausreichen, sind somit gefragt.<br />
Ein Grundpfeiler nachhaltigen Wassermanagements ist die<br />
Qualifizierung von Fachkräften. Diese sollten allerdings nicht<br />
nur über technologisches und wirtschaftliches Know-how<br />
zum Betrieb effizienter Leitungsnetze und über angepasste<br />
Verfahren zur Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung<br />
verfügen. Insbesondere das Bewusstsein für Qualitätsstandards<br />
und die Werterhaltung der investitionsintensiven<br />
Anlagen wird benötigt, um deren Langlebigkeit, einen verlustarmen<br />
Betrieb und letztlich eine hohe Wassergüte zu<br />
garantieren. Diese zentralen Kompetenzen basieren auf<br />
entsprechenden Kenntnissen und Fertigkeiten sowie der<br />
Befähigung zum verantwortungsbewussten Handeln.<br />
TRANSFER VON GEBÜNDELTEM KNOW-HOW<br />
An diesem Punkt möchte AQWA Academy ansetzen: als<br />
eine vom deutschen Bundesministerium für Bildung und<br />
Forschung (BMBF) geförderte Initiative mit dem Ziel, nachhaltige<br />
Ausbildungsprogramme für den Wasserssektor der<br />
MENA-Länder zu entwickeln. Gemäß dem Partnerschaftskonzept<br />
wirken dabei privatwirtschaftliche Unternehmen in<br />
Zusammenarbeit mit Hochschuleinrichtungen zusammen,<br />
um ein praxisnahes, qualitätsgesichertes und zertifiziertes<br />
Qualifizierungsangebot zu schaffen.<br />
Bei AQWA Academy ergänzen sich die Kompetenzen verschiedener<br />
Partner: Die Prof. Dr.-Ing. Stein und Partner<br />
GmbH (Bochum) stellt mithilfe eines individuell zugeschnittenen<br />
Online-Portals nicht nur die technische Grundlage für<br />
die internetbasierte Vermittlung von Fachinhalten zur Verfügung,<br />
sondern liefert auch das benötigte Expertenwissen in<br />
Bezug auf den <strong>Rohrleitungsbau</strong>, die Leitungsinstandhaltung<br />
sowie das Hintergrundwissen zum Netzwerkmanagement.<br />
Dieses Fachwissen wird verbunden mit dem Know-how<br />
des Forschungsinstituts für Wasser- und Abfallwirtschaft<br />
92 04-05 / 2013
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
04-05 / 2013 93
FACHBERICHT WASSERVERSORGUNG<br />
RECHT & REGELWERK<br />
Zu jedem der fünf Themenfelder wird das relevante Fachwissen<br />
für Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt sowie Management<br />
vermittelt. In ihrer Gesamtheit liefert das Programm<br />
die wesentlichen Wissensinhalte für ein ganzheitliches<br />
Wassermanagement in der MENA-Region. Das Programm<br />
richtet sich als modulares Weiterbildungsangebot sowohl<br />
an akademische (Studierende, Ingenieure und mittleres<br />
Management) als auch an nichtakademische Fachkräfte<br />
(„water operators“) vor Ort.<br />
Bild 1: Praxisnah: Das FiW schult seine Gäste durch fachkundige<br />
Experten direkt vor Ort<br />
Bild 2: Die RWTH International Academy besitzt jahrelange<br />
Erfahrung in der Durchführung praxisorintierter Weiterbildung<br />
der RWTH Aachen e. V. (FiW), das seine weitreichenden<br />
Erfahrungen im Sektor der Wasserversorgung, der Wasserreinigungstechnik<br />
und des damit zusammenhängenden<br />
Qualitätsmanagements einfließen lässt. Schließlich wird<br />
durch einen von der RWTH International Academy entwickelten<br />
didaktischen Qualitätsrahmen gewährleistet, dass<br />
die komplexen Sachverhalte verständlich und erfolgreich<br />
vermittelt werden.<br />
Im Zentrum von AQWA Academy steht ein umfassendes Curriculum<br />
in Form des AQWA Academy-Modulhandbuchs. Dieses<br />
stellt ein detailliert aufbereitetes Lehrkonzept dar, das den<br />
gesamten siedlungswasserwirtschaftlichen Kreislauf abbildet:<br />
1. Wasserressourcenmanagement<br />
2. Wassergewinnung und -aufbereitung<br />
3. Wasserversorgungssysteme<br />
4. Entwässerungssysteme<br />
5. Abwasserbehandlung<br />
BRING THE CONTENT TO THE STUDENTS<br />
Fachlich hochwertige Inhalte zu haben, ist eine Sache. Diese<br />
müssen aber auch vermittelt und verstanden werden. Unter<br />
Berücksichtigung des fachlichen Bedarfs in der MENA-<br />
Region und der in den einzelnen Ländern bereits etablierten<br />
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen stützt sich AQWA<br />
Academy auf ein didaktisches Grundkonzept, das an die<br />
Anforderungen vor Ort anknüpft: Das Lernprogramm ist<br />
dank eines modularen Aufbaus ausreichend flexibel, um<br />
individuell auf die im jeweiligen Land vorherrschende Situation<br />
angepasst zu werden.<br />
Damit verschiedene Lerngewohnheiten und unterschiedliche<br />
Lernertypen sinnvoll bedient werden können, wurde ein<br />
„Blended Learning“-Szenario entwickelt, um dadurch den<br />
anvisierten Transfer von theoretischem Wissen in praktisches<br />
Handeln zu ermöglichen. Blended Learning basiert auf der<br />
Kombination von Präsenzphasen mit E-Learning-Modulen<br />
und praktischen Trainingseinheiten. Diese gezielte Verbindung<br />
der Lernformate bietet den entscheidenden Vorteil,<br />
dass sich so komplementäre Effekte erzielen lassen, die ein<br />
möglichst ganzheitliches Lernen ermöglichen und individuelle<br />
Bedürfnisse angemessen berücksichtigen.<br />
Zugänge zum Lernstoff werden hier über eine klare, lernförderliche<br />
Struktur mit definierten Lernzielen erreicht. Das<br />
betrifft sowohl die E-Learning-Angebote als auch den Präsenzunterricht<br />
im Seminarraum. Lernschrittweise aufbereitete,<br />
an unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden ausgerichtete<br />
Inhalte in Kombination mit anwendungsorientierten<br />
Übungen und ein durchgängig hoher Praxisbezug bilden<br />
die Grundlage für eine hohe Lernmotivation – ein wichtiger<br />
Erfolgsfaktor. Über einen gezielten und abwechslungsreichen<br />
Einsatz unterschiedlicher Medien können unterschiedlichste<br />
Lernpräferenzen bedient und Lernerfolge nachweislich<br />
gesteigert werden. Hier profitiert AQWA Academy klar von<br />
der Expertise der beteiligten Partner: Die Prof. Dr.-Ing. Stein<br />
und Partner GmbH besitzt jahrelange Erfahrungen in der<br />
Erstellung von und der Schulung mit interaktiven Medien im<br />
Bereich der Ingenieurwissenschaften. Das FiW ist hingegen<br />
Experte für die Verbindung von theoretischer und praktischer<br />
Ausbildung. Die RWTH International Academy verbindet diese<br />
Kompetenzen durch ihr spezielles Wissen in Gestaltung und<br />
Organisation zertifizierter Bildungsformate, um ein passgenaues<br />
und effizientes Ausbildungsprogramm zu realisieren.<br />
Die übergeordnete Zielstellung von AQWA Academy ist<br />
der Aufbau eines offenen Bildungsnetzwerkes. Das heißt,<br />
die Mitwirkung weiterer Partner, die das Curriculum mit<br />
ihren speziellen fachlichen Schwerpunkten bereichern, ist<br />
94 04-05 / 2013
WASSERVERSORGUNG RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
ausdrücklich erwünscht.<br />
Die Entwicklung und Evaluierung von AQWA Academy<br />
laufen derzeit auf Hochtouren. Start des Programms ist in<br />
der zweiten Hälfte dieses Jahres.<br />
KONTAKT: www.aqwa-academy.net<br />
AUTOR<br />
MARTIN BEHR, M.A.<br />
RWTH International Academy, Aachen<br />
Tel. +49 241 80-27735<br />
E-Mail: M.Behr@academy.rwth-aachen.de<br />
Bild 3: Die Prof. Dr.-Ing. Stein und Partner GmbH hat ihre Blended Learning-<br />
Inhalte bereits erfolgreich in Nahost vermittelt<br />
www.fachverband-steinzeug.de<br />
Steinzeugrohre –<br />
Qualität für Generationen<br />
Steinzeugrohre –<br />
aus biologischem Anbau<br />
04-05 / 2013 95
FACHBERICHT WASSERVERSORGUNG<br />
RECHT & REGELWERK<br />
Grabenlose Sanierung von<br />
Druckrohrleitungen mithilfe des<br />
RS BlueLine ® -Verfahrens<br />
Den Möglichkeiten zur Verlängerung der Nutzungsdauer von Trinkwassernetzen wird ein weiteres Verfahren hinzugefügt.<br />
Mit bereits 15 km sanierten Leitungen hat RS BlueLine® Marktreife erreicht und bringt die Vorteile der grabenlosen<br />
Sanierung in unsere Trinkwasserleitungen. Mit minimalem Tiefbauaufwand für den Netzzugang und schnellster Bauzeit<br />
wird zukünftig im innerstädtischen Bereich die Versorgung mit Trinkwasser sichergestellt.<br />
EINLEITUNG<br />
Stadtwerke und Netzbetreiber stehen vor immensen baulichen<br />
und planerischen Herausforderungen. Neben ganzheitlichen<br />
Sanierungsstrategien sind vor allem moderne<br />
Sanierungsverfahren gefragt, die schnelle und kostengünstige<br />
Lösungen bieten. Dabei spielen grabenlose Verfahren<br />
zunehmend ihre Vorteile aus. Hierzu zählen wirtschaftliche<br />
Aspekte wie etwa die geringeren Kosten, die im Gegensatz<br />
zu einer Neuverlegung für eine Sanierungsmaßnahme aufzubringen<br />
sind. Zudem können die notwendigen Arbeiten in<br />
kurzer Bauzeit ausgeführt werden; ein Umstand, der nicht<br />
zuletzt aufgrund der entspannteren Verkehrssituation zu<br />
einem deutlich reduzierten CO 2<br />
-Ausstoß beiträgt. Hinzu<br />
kommt: Die Unterbrechung der Versorgung ist in der Regel<br />
innerhalb von Tagen erledigt. Selbstverständlich wird dieser<br />
– wenn auch kurze Zeitraum – mit einer Notversorgung<br />
überbrückt. Auch die Beeinträchtigungen für den Fußgänger-<br />
und Straßenverkehr halten sich in akzeptablen Grenzen.<br />
Nicht zuletzt verfügt der sanierte Leitungsabschnitt<br />
wieder über eine Lebensdauer, die mit einer Neuverlegung<br />
vergleichbar ist. Diese Vorteile haben wesentlich zum Siegeszug<br />
der so genannten Reliningverfahren beigetragen.<br />
Sie machen heute den Großteil der angewendeten Renovierungsverfahren<br />
in Trinkwassernetzen aus. Entsprechend<br />
ihrer marktwirtschaftlichen Bedeutung werden<br />
die Produkte von den Herstellern unter material- und<br />
verfahrenstechnischen Gesichtspunkten ständig weiterentwickelt.<br />
Das RS BlueLine ® -Verfahren der RS Technik<br />
Aqua GmbH macht deutlich, welche Entwicklungspotenziale<br />
nach wie vor in der Linertechnologie vorhanden<br />
sind. Mit BlueLine ® entstand ein leistungsstarkes Paket<br />
aus modernster Sanierungstechnik und hochwertigen<br />
Harzsystemen, von dem Versorger, Netzbetreiber und<br />
Anwender gleichermaßen profitieren können. Es eignet<br />
sich für eine Anwendung im Trinkwasserbereich ebenso<br />
wie für industrielle Anwendungen und sorgt für technisch<br />
ausgereifte, langlebige und wirtschaftliche Sanierungsergebnisse<br />
bei Druckrohrleitungen. Dabei ergeben<br />
sich nicht nur Einsparpotenziale in punkto Kosten und<br />
Zeit. Aufgrund der Materialeigenschaften des verwendeten<br />
Epoxidharzes finden auch umweltschutztechnische<br />
Gesichtspunkte Berücksichtigung.<br />
DAS VERFAHREN<br />
Bei RS BlueLine ® handelt es sich um ein Verfahren, bei<br />
dem ein flexibler Schlauchträger mit einem Zweikomponenten-Epoxidharz<br />
imprägniert, in die zu sanierende<br />
Leitung eingebracht und anschließend durch Wärmezufuhr<br />
mit Warmwasser oder Dampf zu einem neuen<br />
Rohr ausgehärtet wird. Die Rohr-im-Rohr-Lösung ist<br />
unabhängig und alleine tragfähig und übernimmt ohne<br />
Unterstützung des Altrohres alle statischen Außen- und<br />
Innenlasten.<br />
Das System ist für die grabenlose Sanierung von Trinkwasserleitungen<br />
und anderen Druckrohrsystemen wie<br />
Abwasser-Druckleitungen, Kühlleitungen oder Feuerlöschleitungen<br />
geeignet. RS BlueLine ® ist im Nennweitenbereich<br />
von DN 100 bis DN 1000 mm (4” bis 40”) einsetzbar,<br />
wobei Rohre mit größeren Nennweiten auf Anfrage lieferbar<br />
sind. Aufgrund der für das Verfahren charakteristischen<br />
Vor-Ort-Imprägnierung mit mobilen Tränkanlagen<br />
bietet RS BlueLine ® ein Höchstmaß an Flexibilität an der<br />
Einbaustelle. Das Trägermaterial des Rohres besteht aus<br />
einem Gemisch aus Advantex-Glas und Polyesterfasern.<br />
Der querelastische Glas-Filz-Verbund ist auf der Innenseite<br />
mit Polyolefin beschichtet. Die Dosierung und luftfreie<br />
Mischung der Harzkomponenten sowie die Imprägnierung<br />
des Liners erfolgen klimatisiert direkt vor Ort in einer<br />
mobilen Misch- und Tränkanlage. Dabei wird der Liner<br />
unter Vakuum gesetzt, gleichmäßig mit dem Harzsystem<br />
getränkt und kalibriert. Eine so genannte speicherprogrammierbare<br />
Steuerung (SPS) sorgt dabei für einen<br />
kontrollierten Dosier- und Mischprozess und konstante<br />
Sanierungsergebnisse.<br />
Darüber hinaus verfügt die Anlage über eine umfangreiche<br />
Mess- und Dokumentationstechnik. Das fertige<br />
Kunststoffrohr erfüllt die Bestimmungen des DVGW-<br />
Arbeitsblattes W 270 sowie der „Leitlinie des Umweltbundesamtes<br />
zur hygienischen Beurteilung von organischen<br />
Materialien im Kontakt mit Trinkwasser“ (KTW-<br />
Beschichtungsleitlinie). Das eingesetzte Harz entspricht<br />
der DIN 16946 Teil 2 und der EU-Chemikalienverordnung<br />
(1907/2006). Es ist gemäß der Registration, Evaluation<br />
and Authorisation of Chemicals (REACH) registriert.<br />
96 04-05 / 2013
WASSERVERSORGUNG RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
ZWEI VERFAHRENSVARIANTEN<br />
Grundsätzlich stehen mit dem BlueLiner Inversion und dem<br />
BlueLiner Pull-In zwei verschiedene Schlauchträger-Typen<br />
zur Verfügung. Der BlueLiner Pull-In wird mit einer Winde<br />
eingezogen und anschließend durch die Inversion eines<br />
Kalibrierschlauches aufgestellt. Der im Verbund gefertigte<br />
elastische Glas-Filz-Schlauch besteht zu je 50 % aus Advantex<br />
Glas und Polyesterfasern. Eine auf das Trägermaterial<br />
laminierte Außenfolie aus Polyethylen (PE) dient als Einbauhilfe.<br />
Der Schlauch kann in Wandstärken von 5 mm bis<br />
15 mm hergestellt werden. Das Untermaß beträgt 3 %. Die<br />
Bogengängigkeit des Produktes ermöglicht den Einsatz in<br />
Bögen bis 45 °, bei Radien > 3 D bis 90 °. Der dazugehörige<br />
Kalibrierschlauch besteht aus einem querelastischen Polyesterfilzschlauch.<br />
Er verfügt über eine im Extrusionsverfahren<br />
aufgetragene Polyolifin-Beschichtung, die permanent<br />
mit dem Trägermaterial verbunden ist. In unverarbeitetem<br />
Zustand beträgt die Wandstärke 3 mm. Der Kalibierschlauch<br />
wird in den BlueLiner Pull-In inversiert und stellt diesen in<br />
der zu sanierenden Haltung auf.<br />
Beim so genannten BlueLiner Inversion erfolgt die Inversion<br />
mittels hydrostatischer Wassersäule oder mit Druckluft.<br />
Bei dem Trägermaterial handelt es sich um ein Polyolefinbeschichtetes<br />
Polyesterfaser-Glasfaser-System. Die sonstigen<br />
Daten entsprechen dem Blueliner Pull-in.<br />
DAS HARZ<br />
Sowohl beim BlueLiner Inversion- als auch beim BlueLiner<br />
Pull-In-Verfahren kommen ausschließlich Epoxidharze (EP)<br />
gemäß DIN 16946 Teil 2, Typ 1021-0 zum Einsatz. Das<br />
füllstoff- und lösemittelfreie Produkt setzt sich aus Harz<br />
und Härter zusammen. Bei einer Anwendung im Trinkwasserbereich<br />
erhalten die Harz- und Härterkomponenten<br />
eine zusätzliche Kennung mit dem Buchstaben D. Bei Max<br />
Pox ® 15 D (Harz) und Max Pox ® 180 D (Härter) beträgt die<br />
Topfzeit des Systems bei einer Mischungstemperatur von<br />
20 °C rund 180 Minuten, bei Max Pox ® 8 D und Max Pox ®<br />
480 D etwa 480 Minuten. Ein statischer Nachweis nach<br />
ASTM 1216-09 (Standard Practice for Rehabilitation of Existing<br />
Pipelines and Conduits by the Inversion and Curing of<br />
a Resin-Impregnated Tube) kann bei jedem Liner erbracht<br />
werden. Hierbei werden alle möglichen statischen Lastfälle<br />
wie Erd-, Verkehrs- und hydrostatische Lasten und die<br />
Innendruckbeständigkeit berechnet. Optional kann zusätzlich<br />
eine Druckstoßberechnung durchgeführt werden, die<br />
die maximale dynamische Druckänderung mit Hilfe der<br />
Joukowsky-Formel bestimmt.<br />
Die hydraulische Leistungsfähigkeit der sanierten Rohrleitung<br />
wird i.d.R. nicht beeinträchtigt, da die minimale<br />
Querschnittsreduzierung (hohe Festigkeiten = minimale<br />
Wandstärken) über die glatte Oberfläche des RS BlueLine ®<br />
wieder ausgeglichen wird. Da es sich bei den Verfahren<br />
um eine Methode zur Sanierung von Trinkwasserleitungen<br />
handelt, ist bei der Lagerung der Materialien größte Sorgfalt<br />
aufzuwenden. Eine Überlagerung ist auszuschließen, ebenso<br />
extrem niedrige Temperaturen. Temperaturschwankungen<br />
sind ebenfalls zu vermeiden. Die Harze sollten zwischen 17<br />
Bild 1: Einziehen des BlueLiner-Pull-In in die Leitung<br />
Bild 2: Inversion des BlueLiner mittels<br />
Drucktrommel (Luftdruck)<br />
Bild 3: Imprägnierung und gleichzeitige Inversion<br />
des Liners mit Wasserdruck<br />
Quelle: RS Technik Aqua GmbH<br />
04-05 / 2013 97
FACHBERICHT WASSERVERSORGUNG<br />
RECHT & REGELWERK<br />
auch die Anzahl der möglicherweise benötigten Baugruben<br />
bestimmt, sind bei der Planung eines Projektes das innere<br />
Volumen bzw. die Dimensionierung der Trommeln unbedingt<br />
zu berücksichtigen. Ausführliche Informationen hierzu<br />
enthält das produktspezifische Installationshandbuch, dass<br />
der Hersteller zur Verfügung stellt.<br />
Tabelle 1: Klassifizierung des RS Blueline ® gemäß EN ISO 11295<br />
und 22 °C Eigentemperatur eingebaut werden. Ebenfalls<br />
dürfen beim Einsatz in Trinkwassernetzen nur zugelassene,<br />
gemäß Herstellerangaben genehmigte Gleitmittel zur<br />
Inversion eingesetzt werden.<br />
DIE AUSWAHL DES VERFAHRENS<br />
Beim Einsatz der RS BlueLine ® -Technik kann der Anwender<br />
zwischen der Pull-In- und der Inversionsvariante wählen.<br />
Allerdings ist der Sanierungserfolg von den Rahmenbedingungen<br />
der Baumaßnahme und damit von der Auswahl<br />
des richtigen Produktes abhängig. Das BlueLiner Pull-In-<br />
Verfahren erfordert zwei Arbeitsgänge. Es verfügt über<br />
hervorragende mechanische Eigenschaften und kann bei<br />
den meisten Rohrgrößen angewendet werden. Beim Einbau<br />
des Blue-Liner Inversion mit einer Inversionstrommel wird<br />
der Liner imprägniert und in einem Arbeitsgang inversiert.<br />
Das Aushärten erfolgt mit Dampf. Das Einsatzspektrum ist<br />
auf Nennweiten ≥ 200 mm begrenzt. Ebenso muss berücksichtigt<br />
werden, dass die Trommel nur eine bestimmte<br />
Schlauchlänge aufnehmen kann. Der Einsatz eines BlueLiner<br />
Inversion, der mit Wasserdruck inversiert und mit Heißwasser<br />
ausgehärtet wird, ist nur bei Nennweiten ≥ 600 mm<br />
möglich. Grundsätzlich gilt: Während der Planungsphase<br />
müssen die technischen Parameter der für die Installation<br />
zur Verfügung stehenden Ausrüstungen – hierzu zählen<br />
Inversionstrommeln, Wassersäulen, Heizkessel, Dampfeinrichtungen<br />
und Winden – sorgfältig analysiert werden.<br />
Inversionstrommeln werden in unterschiedlichen Größen<br />
und Konfigurationen hergestellt. Da das Trommelvolumen<br />
die maximal zu installierende Länge des Liners und damit<br />
DER EINBAU<br />
RS-BlueLine ® -Systeme werden über vorhandene Zugangspunkte<br />
(z.B. Schieberkreuze) oder über Baugruben eingebaut.<br />
Aufgrund des geringen Platzbedarfs halten sich die<br />
hierfür nötigen Erdarbeiten in unproblematischen Grenzen.<br />
Vor der Installation des Liners ist eine Reinigung der Altleitung<br />
zwingend erforderlich, jedoch ist bei dem „stand<br />
alone-Produkt“ keine metallisch blanke Oberfläche erforderlich,<br />
was die Aufwendungen erheblich reduziert. Das<br />
Ergebnis wird mit einer TV-Inspektion bestätigt und dokumentiert.<br />
Der weitere Einbau erfolgt über eine ausgereifte<br />
Anlagentechnik, die vollständig auf einem Fahrzeug untergebracht<br />
ist. Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um eine<br />
mobile Tränk- und Mischanlage, auf der die automatische<br />
Dosierung und luftfreie Mischung der Harzkomponenten<br />
sowie die Imprägnierung des Liners direkt vor Ort an der<br />
Einbaustelle erfolgen. Dabei wird der Liner unter Vakuum<br />
gesetzt, gleichmäßig mit dem Harzsystem getränkt<br />
und kalibriert. Eine so genannte speicherprogrammierbare<br />
Steuerung (SPS) sorgt dann für einen kontrollierten Einbauprozess.<br />
Zusätzlich zur vollautomatischen Steuerung des<br />
Mischgerätes bietet die Technik eine vollständige Erfassung<br />
aller prozessrelevanten Daten – Datum, Zeit, Komponententemperatur,<br />
Volumenstrom, Mischungsverhältnis – und<br />
die Kalibrierparameter wie Rollenabstand, Antriebsgeschwindigkeit<br />
und Vakuumdruck des Liners. Die Eingabe<br />
von projektspezifischen Daten wie zum Beispiel Auftraggeber,<br />
Ort, Materialeigenschaften usw. ist ebenfalls möglich.<br />
Nach der Installation des Liners erfolgt die vorgeschriebene<br />
Druckprüfung. Hierbei ist zu beachten, dass die Bestimmungen<br />
für die Prüfungen von Land zu Land voneinander abweichen<br />
können. Danach wird die sanierte Haltung gereinigt.<br />
Besondere Desinfektionen sind nicht erforderlich. Danach<br />
kann die sanierte Haltung wieder an das bestehende Lei-<br />
Tabelle 2: Eigenschaften des Liners gemäß Klassifizierung nach EN ISO 11295<br />
Schadensbilder und Eigenschaften der Liner Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D<br />
Übersteht Bersten des Altrohres X - - -<br />
Langzeit - Druckbeständigkeit ≥ maximal zulässiger Betriebsdruck (MAOP –<br />
X - - -<br />
Maximum allowable operating pressure)<br />
Inhärente Ringfestigkeit (1) X X - (2) - (2)<br />
Langzeit - Loch- und Spaltenüberbrückung bei MAOP X X (3) X -<br />
Interne Barrierenschicht vorhanden (4) X X X X<br />
Anmerkungen:<br />
(1) Die Mindestanforderung an den Liner ist die Selbsttragfähigkeit bei drucklosem<br />
Rohr.<br />
(2) Der Liner ist im drucklosen Zustand durch die Klebeverbindung mit dem Altrohr.<br />
(3) Der Liner ist ausreichend sitzest bei radialem Transfer interner Druckbelastungen<br />
an das Altrohr, und dies entweder bei der Installation oder innerhalb einer kurzen<br />
Zeit ab Erstbeaufschlagung des Betriebsdrucks.<br />
(4) Der Liner dient als Schutz vor Korrosion, Abrieb und/oder Verkrustung des Altrohrs<br />
und vor Verschmutzung des Rohrinhaltes durch das Altrohr. Die Oberflächenrauheit<br />
wird reduziert und die Durchflussmenge erhöht.<br />
98 04-05 / 2013
WASSERVERSORGUNG RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
tungsnetz angeschlossen und eventuelle Notversorgungen<br />
und Absperrmittel entfernt werden.<br />
VERBINDUNGSTECHNIKEN<br />
Die zur Verfügung stehenden Verbindungstechniken können<br />
den Anforderungen des Auftraggebers (z.B. Wasserwerk)<br />
angepasst werden. Für Nennweiten ≤ DN 200 werden in<br />
der Regel so genannte Multi/Joint ® -Kupplungen verwendet.<br />
Sie sind für Druckstufen bis 16 bar anwendbar. Bei<br />
größeren Dimensionen werden Abdichtmanschetten auf<br />
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk-Basis (EPDM) verwendet.<br />
Die Manschetten werden entweder im Altrohr installiert<br />
oder in einen vorgefertigten neuen Flansch gesetzt um eine<br />
komplett unabhängige Lösung vom Altrohr sicherzustellen.<br />
Hausanschlüsse müssen manuell von außen installiert werden,<br />
zum Beispiel mit einer Hawle-Anbohrschelle.<br />
FAZIT<br />
Bei dem RS BlueLine ® -System handelt es sich um ein Kunststoffrohr<br />
für die grabenlose Sanierung von Trinkwasserleitungen<br />
und anderen Druckleitungssystemen wie zum<br />
Beispiel Hauptsteigleitungen, Kühlleitungen und Industrieanwendungen.<br />
Ein flexibler Schlauchliner, der mit einem<br />
Zweikomponenten-Epoxidharzsystem imprägniert wird,<br />
wird in eine defekten Leitung installiert und härtet zu einem<br />
neuen Rohr aus (Rohr-in-Rohr-Sanierung). Das System verfügt<br />
mit dem BlueLiner Inversion – dieser wird entweder mit<br />
hydrostatischer Wassersäule oder mit Druckluft inversiert<br />
bzw. eingestülpt – und dem BlueLiner Pull-In – dieser wird<br />
mit einer Winde ins Rohr eingezogen und anschließend mit<br />
einem Kalibrierschlauch aufgestellt – über zwei verschiedene<br />
Verfahrensvarianten. Der Kalibrierschlauch wird dabei<br />
mittels Wassersäule oder Druckluft inversiert. Der installierte<br />
Liner wird mit Heißwasser oder Dampf ausgehärtet.<br />
Die Dosierung und Mischung der Komponenten sowie die<br />
Vakuumimprägnierung des Liners erfolgen direkt vor Ort<br />
in einer mobilen Misch- und Tränkanlage.<br />
Allgemeines<br />
Harztyp<br />
Füllstofftyp<br />
Aushärtsystem<br />
Trägermaterial<br />
Innenbeschichtung<br />
Tabelle 3: Eingesetzte Werkstoffe<br />
EP - Epoxidharz<br />
Ohne Füllstoff<br />
Heißwasser oder Dampf<br />
Glasfaser / Polyesterfaser<br />
Polyolefin (OF)<br />
Das Ergebnis der Sanierung einer Druckrohrleitung mit<br />
dem RS BlueLine ® -System ist ein tragfähiges Rohr im Rohr,<br />
bei dem der Liner alle statischen Innen- und Außenlasten<br />
übernimmt. Das Verfahren stellt eine mittragende oder<br />
komplett tragfähige Lösung dar und ist in Klasse 3 und 4<br />
nach AWWA M28 (American Water Works Association)<br />
klassifiziert (Klassifizierung ähnlich Gelbdruck EN ISO 11259<br />
Klasse A bis C). Alternativ kann der BlueLiner Inversion auch<br />
als Klasse 2 angewendet werden.<br />
Das Verfahren ist aufgrund der Vor-Ort-Imprägnierung mit<br />
dem Epoxidharzsystem MaxPox ® und der Verarbeitung in<br />
einer automatisierten Dosier- und Mischanlage flexibel einsetzbar.<br />
Die speicherprogrammierbare Steuerung und die<br />
umfangreiche Mess- und Dokumentationstechnik sorgen<br />
für einen kontrollierten Einbauprozess und für konstante<br />
Sanierungsergebnisse.<br />
Dipl.-Ing. (FH) JOCHEN BÄRREIS<br />
RS Technik Aqua GmbH<br />
Tel. +49 911 99919688<br />
E-Mail: jochen@baerreis.de<br />
www.rstechnik.com<br />
AUTOR<br />
GFK-Trinkwasserbehälter<br />
bis DN 3600 l mit und ohne Schieber- und Bedienerkammer<br />
Besuchen Sie uns<br />
auf der Wasser Berlin<br />
23.-26.4.2013<br />
Stand 415 Halle 1.2<br />
E Rohre GmbH l Gewerbepark 1/Hellfeld l 17034 Neubrandenburg l T +49.395.45 28 0 l F +49.395.45 28 100 l www.hobas.de<br />
04-05 / 2013 99
FORSCHUNGSPROJEKT RECHT WASSERVERSORGUNG<br />
& REGELWERK<br />
Reinigungsverfahren stellt im BMBF-<br />
Verbundprojekt seine Effizienz unter<br />
Beweis<br />
Die Wirksamkeit des Comprex-Verfahrens zum Entfernen von Verockerungen aus Rohwasser- und Brunnenleitungen sowie<br />
Steigleitungen ist der Titel des Teilprojekts 8 im BMBF-Verbundprojekt „Mikrobielle Verockerung in technischen Systemen“.<br />
Fa. Hammann GmbH konnte mit Hilfe des BMBF an einer Versuchsanlage mit transparenten Rohren und magnetisch<br />
gehaltenen Prüfkörpern - zur Simulation von Ablagerungen oder Verockerungen unterschiedlich starker Haftung an der<br />
Rohrwand - die Effizienz der Reinigung dieses rein mechanisch wirkenden Verfahrens zeigen und aufgrund der neuen<br />
Erkenntnisse die Reinigungsleistung messbar steigern. Ziel ist, verockerte Anlagen zur ertüchtigen, um Ressourcen zu<br />
schonen: sparsamer Wasserbedarf zur Reinigung, Energieeinsparung durch regelmäßig gereinigte Anlagen.<br />
Im Februar 2011 startete das vom Bundesministerium<br />
für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Projekt<br />
„Mikrobielle Verockerung in technischen Systemen“. Dieses<br />
BMBF-Verbundprojekt besteht aus acht Teilprojekten<br />
[1]. Firma Hammann bearbeitet als Forschungspartner das<br />
Teilprojekt 8 zur Wirksamkeit des Comprex-Verfahrens zum<br />
Entfernen von Verockerungen. Für die Forschungsarbeiten<br />
war zunächst notwendig, die bestehende Versuchsanlage<br />
zu erweitern.<br />
Die Versuchsanlage besteht aus transparenten Rohren. Sie<br />
enthält Komponenten, um Reinigungsverfahren in verschiedenen<br />
Rohrleitungslängen und -führungen zu prüfen.<br />
Eine Teststrecke (Bild 1) ermöglicht, mit diesen Verfahren<br />
verockerte Rohrstücke zu reinigen oder auch modellhaft<br />
magnetisch haftende Stahlprüfkörper aus transparenten<br />
Rohrstücken zu entfernen.<br />
Dieses Modell zur Haftung von Ablagerungen an der Rohrwand<br />
führt weiterhin zur Abschätzung, welche Scherkräfte<br />
erforderlich sind, um unterschiedlich haftende Ablagerungen<br />
zu mobilisieren. Dazu lassen sich Magnete mit unterschiedlicher<br />
Kraft an einem Rohrstück anbringen (Bild 2).<br />
Die Scherkräfte zum Mobilisieren beispielsweise von Stahlwürfeln<br />
können über eine Federwaage mit Schleppzeiger<br />
gemessen werden. Daraus lässt sich die Schleppspannung<br />
berechnen.<br />
Bei den Versuchen kam eine Abziehvorrichtung mit einer<br />
Fläche von 1 cm 2 zum Einsatz (Bild 3). Bei Verwendung<br />
von Stahlwürfeln hängt die Fläche von der Kantenlänge<br />
ab. Die gemessenen Werte werden auf 1 cm 2 umgerechnet.<br />
Dabei erfordern die bisher zur Prüfung verwendeten<br />
Magnete Scherkräfte bis 400 g. Zum Mobilisieren der gut<br />
haftenden Prüfkörper muss die Schleppspannung mehr als<br />
60.000 N/m 2 betragen.<br />
Das Modell mit der magnetischen Haftung erlaubt, Ablagerungen<br />
nach ihrer Haftung an der Rohrwand zu klassieren.<br />
So wie die Stahlprüfkörper lassen sich mit derselben Vorrichtung<br />
auch reelle Ablagerungen wie Verockerung prüfen.<br />
In die Teststrecke eingebaut können die Bedingungen zum<br />
Entfernen der Ablagerungen und der magnetisch gehaltenen<br />
Stahlprüfkörper mit verschiedenen Reinigungsverfahren<br />
getestet und optimiert werden.<br />
Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass Stahlprüfkörper durch<br />
Wasserspülung mit Fließgeschwindigkeiten von 3,5 m/s nur<br />
von den schwachen Magneten mobilisierbar sind. Fließ-<br />
Bild 1: Teststrecke an der Versuchsanlage<br />
Bild 2: Haltevorrichtung mit Magneten unterschiedlicher Kraft<br />
100 04-05 / 2013
WASSERVERSORGUNG RECHT & REGELWERK FORSCHUNGSPROJEKT<br />
FACHBERICHT<br />
Bild 3: Abziehvorrichtung zum Ermitteln der Scherkräfte mit Stahlwürfel<br />
Bild 4: Exponat „Comprex zum Anfassen“<br />
geschwindigkeiten von 2-3 m/s sind in den Regelwerken<br />
beispielsweise DVGW W 291 und DVGW W 557 zum Spülen<br />
von Rohrleitungen beschrieben. Die Untersuchungen an der<br />
Versuchsanlage ergaben, dass Fließgeschwindigkeiten von<br />
etwa 2 m/s nur zum Entfernen von Stahlprüfkörpern führten,<br />
die auf der Federwaage der Vorrichtung Werte von maximal<br />
15 g anzeigten. Bei Fließgeschwindigkeiten von etwa 3 m/s<br />
lagen die gemessenen Werte unter 40 g. Diese Versuche<br />
zeigen die Grenzen der Wasserspülung deutlich auf.<br />
Vorteilhaft ist die Spülung mit Wasser-Luft-Gemischen. Aber<br />
auch hier zeigen sich die Grenzen, wenn die Einstellungen<br />
nicht optimiert sind. Das daraus entwickelte Impulsspülverfahren<br />
Comprex kann Ablagerungen noch besser ablösen.<br />
Im Vergleich zur Wasserspülung war es möglich, die<br />
Stahlprüfkörper von allen zur Prüfung vorhandenen Magneten<br />
zu entfernen. Die gemessene Fließgeschwindigkeit<br />
der erzeugten Wasserblöcke beträgt dabei über 15 m/s.<br />
Aber auch hier sind noch Optimierungen möglich. Optimal<br />
auf die Reinigungsstrecke eingestellte Prozessführung<br />
reduziert den Wasserbedarf und erhöht auch bei längeren<br />
Rohrleitungsabschnitten die Effizienz der Reinigung. Dank<br />
der Versuchsanlage erschlossen sich aufgrund zahlreicher<br />
Versuchsserien neue Erkenntnisse und Zusammenhänge.<br />
Die Demonstrationsanlage „Comprex zum Anfassen“ der Fa.<br />
Hammann visualisiert die Reinigungseffizienz des Comprex-<br />
Verfahrens im Vergleich zur klassischen Wasserspülung<br />
(Bild 4). Das Exponat ist auf dem BMBF-Stand auf der<br />
Wasser Berlin International zu sehen.<br />
LITERATUR<br />
[1] http://www.anti-ocker.de/de<br />
Halle 3.2, Stand 400<br />
KLINGER Anzeigen_<strong>3R</strong>_182-62:Layout 1 08.02.2013 9:20 Uhr Seite 1<br />
KONTAKT: Hammann GmbH, Annweiler am Trifels, Tel. +49 6346 3004-0,<br />
E-Mail: info@hammann-gmbh.de, www.hammann-gmbh.de
FACHBERICHT PROJEKT KURZ RECHT BELEUCHTET & REGELWERK WASSERVERSORGUNG<br />
Trinkwasserbehälter mit 600 m³<br />
Nutzinhalt in Rekordzeit errichtet<br />
Um die Trinkwasserversorgung auch bei steigendem Wasserbedarf für die nächsten Jahrzehnte abzusichern, ließ die 1.100<br />
Einwohner zählende Marktgemeinde Ottenschlag (Niederösterreich) einen neuen Hochbehälter errichten. Erforderlich<br />
wurde der Ausbau vor allem durch das 2008 eröffnete Lebens-Ressort Ottenschlag. Solch ein Wasserspeicher dient der<br />
Sicherstellung der Versorgung mit Trinkwasser während Spitzenlasten z.B. im Sommer, zur Überbrückung von Störzeiten,<br />
Betriebsreserve und als Löschwasserreserve. Er wurde in nur elf Stunden errichtet.<br />
Bild 1: In nur elf Stunden konnte der HOBAS-Trinkwasserbehälter<br />
mit 600 m³ Nutzinhalt installiert werden<br />
Mit der Planung und Bauaufsicht wurde das Büro Hydro<br />
Ingenieure Umwelttechnik GmbH aus Krems-Stein beauftragt.<br />
Die Gesamtinvestitionskosten für die Errichtung des<br />
Hochbehälters beliefen sich dabei auf 765.000 € netto und<br />
wurden mit Mitteln des Bundesministeriums für Land- und<br />
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, des Niederösterreichischen<br />
Wasserwirtschaftsfonds sowie durch<br />
Eigenmittel der MG Ottenschag finanziert.<br />
Man entschied sich für ein Trinkwasserspeichersystem der<br />
Firma HOBAS aus Kärnten. Das Unternehmen besitzt jahrzehntelange<br />
Erfahrung in der Herstellung von GFK-Rohrsystemen.<br />
Diese Trinkwasserbehälter werden den jeweiligen<br />
örtlichen Gegebenheiten und Anforderungen angepasst<br />
und kundenspezifisch produziert. Zur Montage werden sie<br />
in Modulen auf die Baustelle geliefert und dort zusammengesetzt.<br />
Aufgrund des relativ geringen Gewichts sind der<br />
Transport und die Installation unkompliziert, kostengünstig<br />
und schnell. Falls mit der Zeit ein höherer Bedarf an Speicherkapazität<br />
entsteht, kann der Behälter mit geringem<br />
Aufwand nachträglich erweitert werden.<br />
Die Erd- und Baumeisterarbeiten sowie die Materiallieferungen<br />
für die Errichtung des Trinkwasserbehälters der<br />
Gemeinde Ottenschlag übernahm die Firma Swietelsky<br />
Baugesellschaft mbH aus Zwettl (Österreich). Der Wasserspeicherbereich<br />
des Hochbehälters besteht aus vier 36 m<br />
langen Kammern (Außendurchmesser 2.555 mm), die je<br />
150 m³ Fassungsvermögen haben. Quer dazu liegt eine<br />
12 m lange Schieberkammer mit der technischen Ausstattung.<br />
Dazu gehören die Armaturen für den Zulauf, die<br />
Entnahme und die Entleerung sowie die Überlaufleitung,<br />
Schieber, Rückstauklappen und Wasserzähler. Um zur Bedienung<br />
der Armaturen den Zugang in die Schieberkammer zu<br />
ermöglichen, sind mit Luftschlitzen versehene Edelstahltüren<br />
mit einer lichten Weite von 1 m eingebaut. Außerdem<br />
gibt es Schnellrevisionseinstiege für die Wartung, die mit<br />
Schaugläsern für Sichtkontrollen ausgestattet sind.<br />
Neben der Schieberkammer befindet sich ein angebauter<br />
GFK-Schacht mit einem enormen Außendurchmesser von<br />
3.000 mm, der eine Drucksteigerungsanlage enthält. Diese<br />
Anlage dient zur Versorgung der Hochzone und besteht aus<br />
drei drehzahlgeregelten Pumpen (Fabrikat der Firma Wilo).<br />
Im Regelfall dient eine Pumpe als Betriebspumpe, die anderen<br />
als Reserve. Im Maximalfall (Spitzenverbrauch) schaltet<br />
sich eine zweite Pumpe automatisch ein. Zum Feuerlöschen<br />
bei einem Brand können alle drei Pumpen gleichzeitig in<br />
Betrieb genommen werden.<br />
Alle GFK-Module wurden vor Ort zusammengesetzt und<br />
in einem vorbereiteten Kiesbett in einer 1,20 m hohen<br />
Überdeckungsschicht, die somit eine natürliche Isolierung<br />
darstellt, aufgebaut. Aus diesem Grund waren keinerlei<br />
Betonier-Arbeiten erforderlich. Der gesamte Versetzvorgang<br />
dauerte lediglich elf Stunden. Einmal im Einsatz, verhindert<br />
der dichte und korrosionsresistente Trinkwasserbehälter<br />
sowohl ein Austreten des gespeicherten Trinkwassers als<br />
auch die Verunreinigung des Behälters durch Grund- oder<br />
Umgebungswasser. Er ist vor allem ablagerungs- und verschleißfrei,<br />
gewährleistet eine lange Lebensdauer sowie<br />
einen störungsfreien Betrieb mit sehr geringem Wartungsaufwand.<br />
Somit trägt er einen wichtigen Teil zur sicheren<br />
Trinkwasserversorgung der Marktgemeinde Ottenschlag bei.<br />
Halle 1.2., Stand 415<br />
KONTAKT: HOBAS Rohre GmbH, Neubrandenburg, Wilfried Sieweke,<br />
Tel. +49 395 4528-0, E-Mail: wilfried.sieweke@hobas.com<br />
102 04-05 / 2013
WASSERVERSORGUNG RECHT & PROJEKT REGELWERK KURZ FACHBERICHT<br />
BELEUCHTET<br />
Der „koordinierte“ Hausanschluss<br />
beim Wasserverband Peine<br />
Der Wasserverband Peine ist seit 1952 als Trinkwasserversorger für den Großraum Peine zuständig. Der Verband versorgt<br />
derzeit ca. 284.000 Einwohner mit ca. 71.300 Hausanschlüssen in einer Fläche von 1.436 km 2 und ist somit ein Versorger<br />
im ländlichen Raum. Die jährlich gelieferte Trinkwassermenge liegt bei ca. 13 Mio. m 3 . Als weiteres wichtiges Geschäftsfeld<br />
ist seit 1996 die Abwasserentsorgung zu nennen, die der Verband für mittlerweile 16 Städte und Gemeinden wahrnimmt.<br />
Bereits seit Mitte der 1990er Jahre wird beim Verband<br />
die mit anderen Versorgern abgestimmte Erstellung des<br />
Trinkwasserhausanschlusses praktiziert. Hierbei handelt es<br />
sich nicht um die sog. Mehrsparteneinführung, sondern um<br />
ein mit den für Gas und Strom zuständigen Versorgungsunternehmen<br />
abgestimmtes Verfahren zur gemeinsamen<br />
Verlegung von Anschlussleitungen.<br />
Triebfeder hierfür war zum einen der sich daraus ergebene<br />
wirtschaftliche Vorteil durch die Kostenteilung bei den Erdarbeiten,<br />
zum anderem eine höhere Kundenzufriedenheit.<br />
Beide Ziele wurden dadurch erreicht, dass sich alle beteiligten<br />
Versorger auf einen gemeinsamen Bauablauf sowie die<br />
gemeinsame Beauftragung der Tiefbauarbeiten verständigt<br />
haben. Im Rahmen eines vorgeschalteten Wettbewerbs<br />
wurde bzw. wird ein fachlich für alle drei Sparten qualifiziertes<br />
Tiefbauunternehmen (Trinkwasser: mindestens W 3 nach<br />
DVGW-Arbeitsblatt 301) ermittelt. Jeder Versorger schließt<br />
mit dem Tiefbauunternehmen einen Rahmenvertrag, in dem<br />
die Leistungsbeschreibung enthalten ist, ab und beauftragt<br />
gemäß dieser Vereinbarung die Tiefbaufirma.<br />
Die Erstellung des Hausanschlusses folgt folgendem Schema:<br />
Daraus ergeben sich für den Kunden folgende Vorteile:<br />
Die Arbeiten auf dem Grundstück werden nur von einer<br />
Tiefbaufirma durchgeführt, diese ist direkter Ansprechpartner<br />
für die Terminabstimmung der auszuführenden<br />
Arbeiten. Ist der Kunde für die Erdarbeiten auf dem Grundstück<br />
zuständig, so reduzieren sich auch hier die Kosten für<br />
den Kunden. Die Gewährleistung der Erdarbeiten liegt bei<br />
einem Unternehmen.<br />
Für die Versorgungsunternehmen ist vorteilhaft, dass das<br />
Tiefbauunternehmen die Koordination übernimmt und die<br />
Kosten für den Tiefbau reduziert werden. Zudem ist die<br />
Gewährleistung eindeutig und die Kunden zufriedener.<br />
FAZIT<br />
Alle Partner profitieren von der vereinbarten Verfahrensweise,<br />
auch das Tiefbauunternehmen hat logistische Vorteile,<br />
die sich kostenreduzierend auswirken.<br />
KONTAKT: Wasserverband Peine, Peine, Michael Wittemann,<br />
Tel. +49 5171 956-271, E-Mail: wittemann@wasserverband.de<br />
»»<br />
Der Kunde beantragt den Anschluss beim<br />
Versorgungsunternehmen.<br />
»»<br />
Das Versorgungsunternehmen beauftragt das Tiefbauunternehmen<br />
gemäß Rahmenvertrag.<br />
»»<br />
Das Tiefbauunternehmen nimmt Kontakt zu den<br />
anderen Versorgern auf und klärt, ob auch dort ein<br />
Antrag gestellt wurde.<br />
»»<br />
Das Tiefbauunternehmen nimmt Kontakt mit dem<br />
Kunden auf und klärt ab, welche Medienleitungen<br />
verlegt werden sollen.<br />
»»<br />
Das Tiefbauunternehmen stimmt den Herstellungstermin<br />
mit dem Kunden ab und informiert hierüber die<br />
Versorgungsunternehmen.<br />
»»<br />
Das Tiefbauunternehmen erstellt die Anschlussleitungen,<br />
Bauüberwachung, Aufmaß, Abrechnung durch<br />
den jeweiligen Versorger.<br />
Kombirohrgraben, Leitungen von links nach rechts:<br />
Gas, Wasser im Schutzrohr, Strom<br />
04-05 / 2013 103
FACHBERICHT PROJEKT KURZ RECHT BELEUCHTET & REGELWERK ABWASSERENTSORGUNG<br />
Abwassersammler mit Close-fit am<br />
Tegernsee saniert<br />
Vor allem aufgrund der besonders hohen Schadensdichte und dem daraus resultierenden Handlungsbedarf hatte der<br />
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung am Tegernsee (AZV) das Kanalsystem in der Adrian-Stoop-Straße in Bad Wiessee<br />
als Sanierungsschwerpunkt für das Jahr 2012 festgelegt. Während der Regenwassersammler im Berstlining-Verfahren<br />
erneuert wurde, setzte der Auftraggeber bei der Sanierung des Abwassersammlers aus bautechnischen und wirtschaftlichen<br />
Erwägungen auf eine Auskleidung im Close-fit-Lining-Verfahren. Zur Anwendung kam das Compact-Pipe-System, das von<br />
der DIRINGER&SCHEIDEL ROHRSANIERUNG GmbH & Co. KG, Niederlassung München, eingebaut wurde. Dabei wird ein<br />
werkseitig C-förmig vorverformtes HDPE-Rohr in die gereinigte Haltung eingezogen. Druck und Wärme sorgen dann beim<br />
weiteren Arbeitsablauf dafür, dass der Inliner sich durch den so genannten Memory-Effekt close-fit an die Innenwandung<br />
des alten Rohres legt. Das Ergebnis ist ein statisch eigenständiges und belastbares Rohr, das in Bezug auf die Qualität mit<br />
einer Neuverlegung vergleichbar ist. Zu den weiteren Vorteilen zählt neben der kurzen Einbauzeit der Umstand, dass sich die<br />
Beeinträchtigungen für die Anwohner sowie den Fußgänger- und Straßenverkehr in akzeptablen Grenzen halten – ein Aspekt,<br />
der vor allem in Hinblick auf den Fremdenverkehrscharakter des Kur- und Urlaubsortes Bad Wiessee eine wichtige Rolle spielte.<br />
Ideales Verfahren in einem sensiblen Bauumfeld: In Bad Wiessee<br />
wurden 25 Haltungen des Abwasserkanals in der Adrian-Stoop-<br />
Straße mit Compact Pipe ausgekleidet.<br />
Der Tegernsee liegt rund 50 km südlich von München in den<br />
Bayerischen Alpen und zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen<br />
der Region. Bereits in den 1960er Jahren erhielt der<br />
See eine durchgängige Ringkanalisation, die entscheidend<br />
dazu beigetragen hat, dass der Tegernsee zu den saubersten<br />
Gewässern in Bayern zählt. Für seine Reinhaltung zeichnet<br />
der Zweckverband zur Abwasserbeseitigung am Tegernsee<br />
(AZV) verantwortlich. Der Zweckverband reinigt und<br />
beseitigt die Abwässer von rund 25.300 Einwohnern und<br />
von fast 300.000 Touristen, die im Jahresdurchschnitt die<br />
Region besuchen. Hierzu betreibt der Verband ein ca. 260<br />
km langes Kanalnetz im Trennsystem, in das nur häusliches<br />
Abwasser und Industrieabwasser eingeleitet werden dürfen.<br />
„Die anfallende Jahresschmutzwassermenge beträgt etwa<br />
3,6 Mio. m 3 “, erläutert Dipl.-Ing. (Univ.) Markus Strohschneider,<br />
Techn. Betriebsleiter beim AZV. „Niederschlagswasser<br />
von Dachflächen und befestigten Flächen ist entweder vor<br />
Ort zu versickern oder kann in Teilbereichen über Regenwasserkanäle<br />
dem Tegernsee oder anderen Gewässern<br />
zugeleitet werden.“ Entsprechend der Eigenüberwachungsverordnung<br />
(EÜV) wird das öffentliche Kanalnetz seit 1991<br />
regelmäßig mit einer Kamera befahren und etwaige Schäden<br />
dokumentiert. Die Ergebnisse fließen in ein so genanntes<br />
digitales Geografisches-Informations-System (GIS) ein<br />
und werden dort verwaltet. Gleichzeitig stellt das System<br />
die Grundlage für die Erstellung des Sanierungskonzeptes<br />
dar, nach dem die schadhaften öffentlichen Kanäle<br />
im Verbandsgebiet seit 1998 saniert werden. „Damit die<br />
Anstrengungen des Zweckverbandes wirklich Sinn machen,<br />
müssen auch die gesamten privaten Leitungen und Schächte<br />
der Grundstücksentwässerung vom jeweiligen Eigentümer<br />
untersucht und geprüft werden“, so Strohschneider weiter.<br />
Gegebenenfalls ist dann eine Sanierung erforderlich.“<br />
Wie in diesem Jahr in Bad Wiessee: „Entlang der Adrian-<br />
Stoop-Straße verläuft der Schmutzwasserkanal in der Nennweite<br />
DN 400, der aufgrund seiner Tiefenlage, der Seenähe<br />
und des verbauten Werkstoffes eine Vielzahl an undichten<br />
Rohrverbindungen aufwies“, erklärt der verantwortliche<br />
Planer Dipl.-Ing. (FH) Andreas Böhm, ing München West<br />
GmbH. Bei der Sanierung der insgesamt 25 Haltungen des<br />
rund 950 m langen Abschnittes des Ringkanals haben sich<br />
Auftraggeber und Planer für den Einsatz eines Close-fit-<br />
Lining-Verfahrens entschieden. Ausschlaggebend waren<br />
hierfür neben bautechnischen und wirtschaftlichen Gründen<br />
in erster Linie die Ansprüche in Bezug auf einen nachhaltigen<br />
Kanalbetrieb. „Für den Zweckverband und uns kam<br />
deshalb nur ein langlebiges und qualitativ hochwertiges<br />
Renovationsverfahren in Frage“, so Böhm weiter. Und das ist<br />
nicht unbedingt das billigste, sondern das wirtschaftlichste<br />
– ist er sich mit Betriebsleiter Strohschneider einig. Konsequent<br />
fiel die Entscheidung auf das so genannte Compact<br />
Pipe-System, bei dem ein werkseitig vorverformtes Rohr mit<br />
hoher Werkstoffqualität eingezogen und mittels Druck und<br />
Dampf rückverformt wird.<br />
104 04-05 / 2013
ABWASSERENTSORGUNG RECHT & PROJEKT REGELWERK KURZ FACHBERICHT<br />
BELEUCHTET<br />
Compact Pipe wird als Standardrohr in Anlehnung an die<br />
Norm DIN 8074 mit entsprechenden Wanddicken gefertigt.<br />
Bereits bei der Herstellung im Werk erhält das Produkt<br />
die verfahrenstypische Verformung. „Dazu wird das<br />
HDPE-Rohr unter definierten Bedingungen axial C-förmig<br />
gefaltet“, beschreibt Dipl.-Ing. (FH) Stephan Oeder,<br />
DIRINGER&SCHEIDEL ROHRSANIERUNG GmbH & Co. KG,<br />
den Herstellungsprozess. Aus wicklungs- und einbautechnischen<br />
Gründen liegt die Falte an der Seite des Rohres.<br />
„Die daraus resultierende Reduzierung des Querschnittes<br />
ermöglicht das Einziehen über vorhandene Schächte in die<br />
zu sanierende Leitung“, so Oeder weiter. In Abhängigkeit<br />
von der Nennweite können mehrere hundert Meter auf eine<br />
Trommel gewickelt und eingezogen werden.“<br />
Bereits beim Herstellungs- und Einbauprozess wird die Qualität<br />
von PE-Compact Pipe werkseitig durch Eigen- und Fremdüberwachung<br />
gesichert. „Darum weist das fertige Rohr in den<br />
gewünschten Materialeigenschaften keine messbaren Schwankungen<br />
auf und die Qualität der mit diesem Verfahren eingebauten<br />
PE-Rohre entspricht neu verlegten PE-Standardrohren“,<br />
stellt Dipl.-Ing. (Univ.) Martin Schuster, Niederlassungsleiter NL<br />
München, DIRINGER&SCHEIDEL ROHRSANIERUNG GmbH &<br />
Co. KG, fest. Zudem erfolgt der Einbau relativ schnell und die<br />
bei offenen Sanierungsmaßnahmen üblichen Beeinträchtigungen<br />
des Bauumfeldes halten sich in Grenzen.<br />
Im Vorlauf der Sanierung wird eine TV-Untersuchung<br />
durchgeführt, vorhandene Zuläufe eingemessen und das<br />
zu sanierende Rohr auf seinen Zustand überprüft. Hierbei<br />
festgestellte Hindernisse wie z. B. Ablagerungen oder einragende<br />
Stutzen werden mit einem Roboter bündig mit der<br />
Innenwandung des Altrohres zurückgefräst. Auch die am<br />
Kanal angeschlossenen Grundstücksanschlüsse wurden vor<br />
der Sanierung des Hauptkanals mittels Schlauchliner saniert.<br />
Unmittelbar vor dem Liner-Einzug wird das Altrohr unter<br />
Einsatz eines HD-Spülfahrzeuges rückstandslos gereinigt.<br />
Danach wird ein Zugkopf an den PE-Rohrstrang geschweißt,<br />
das Compact Pipe in den vorhandenen Einstiegsschacht<br />
eingeführt und in die zu sanierenden Haltungen eingezogen.<br />
Nachdem beide Rohrenden druckfest verschlossen<br />
sind, wird die Haltung mit heißem Dampf beschickt. Der<br />
Druck ist abhängig von Dimension und Wandstärke des<br />
verwendeten Rohres. Am Compact Pipe angebrachte Fühler<br />
messen während der Einbauphase permanent Innen- und<br />
Außentemperatur. Die Erwärmung löst den so genannten<br />
Memory-Effekt aus, durch den das eingezogene Rohr<br />
den Außendurchmesser des extrudierten Rohres erreicht.<br />
Die Dauer der Erwärmungsphase ist ebenfalls von Parametern<br />
wie Wandstärke, Nennweite und Länge des Rohres<br />
abhängig. Das Ergebnis: Während der Erwärmungsphase<br />
wird es „close-fit“ an die Wandung des zu sanierenden<br />
Rohres gedrückt und durch die spätere Abkühlung in seiner<br />
ursprünglichen kreisrunden Form fixiert. Nachdem ein<br />
Roboter die Zuläufe aufgefräst hat, werden abschließend<br />
Hutprofile vom Typ CP-ZA 2012 gesetzt und verschweißt.<br />
Dabei handelt es sich um ein Hutprofil mit einer 5 mm<br />
starken PE-Krempe mit integriertem Dichtungsgummi und<br />
Heizwendeln zum Verschweißen mit dem PE-Rohr. Der<br />
Ein C-förmig vorverformtes HDPE-Rohr wird in die gereinigte Haltung<br />
eingezogen. Druck und Wärme sorgen dann beim weiteren<br />
Arbeits ablauf dafür, dass der Inliner sich durch den Memory-Effekt<br />
close-fit an die Innenwandung des alten Rohres legt<br />
Übergang zu den in den Anschlusskanal gestülpten 25 cm<br />
langem Gewebeschlauch ist vulkanisiert. Zudem schützt ein<br />
Stützschlauch den Gewebeschlauch gegen Überdehnung.<br />
„Das Compact Pipe-Verfahren ist ausgereift und steht für<br />
wirtschaftliche und nachhaltige Kanalsanierung“, fasst<br />
Niederlassungsleiter Schuster zusammen. „Compact Pipe<br />
eignet sich für die Sanierung von Wasserleitungen, Industrierohrleitungen,<br />
Gasleitungen und Kanalrohrleitungen aus<br />
Werkstoffen wie Stahl, Guss, Steinzeug oder Beton und ist<br />
in einem Nennweitenbereich von DN 100 bis DN 500 einsetzbar.“<br />
Laut Schuster setzt der D&S-Standort München<br />
seit geraumer Zeit auf das Sanierungsverfahren, für das<br />
sich zunehmend mehr Kunden entscheiden. Zufriedenheit<br />
herrscht jedenfalls auch beim Zweckverband zur Abwasserbeseitigung<br />
am Tegernsee. Die Sanierungsarbeiten konnten<br />
trotz eines straffen Zeitplans – u. a. musste aufgrund der<br />
Lage der Baustelle im Kurviertel in den Mittagsstunden<br />
Baulärm vollständig vermieden werden – termingerecht<br />
und in der gewünschten Qualität abgeschlossen werden.<br />
Halle 1.2., Stand 208f<br />
KONTAKT: Diringer & SCHEIDEL Rohrsanierung GmbH & Co. KG, Mannheim,<br />
Tel. +49 621 8607-440, E-Mail: zentrale.rohrsan@dus.de,<br />
www.dus-rohrsanierung.de<br />
04-05 / 2013 105
FACHBERICHT PROJEKT KURZ RECHT BELEUCHTET & REGELWERK ABWASSERENTSORGUNG<br />
Polnisches Kety saniert Abwasserkanäle<br />
großer Nennweiten mit Wickelrohren<br />
SPR Europe konnte im Spätsommer 2012 mit ihrem Wickelrohrverfahren der polnischen Stadt Kety die passende Lösung<br />
bieten, als Abschnitte von zwei Eiprofil-Abwasserkanälen mit großen Nennweiten zu sanieren waren. Unter vorab<br />
geregelter Vorflut wurden innerhalb von zehn Wochen 425 m des DN1000/1720 und 93 m des DN1400/2100 Betonrohres<br />
mit dem SPR -Liner verkleidet.<br />
nächsten Jahrzehnte sicherstellen und Versickerungen vorbeugen.<br />
Aufgrund der beiden Eiprofile fiel die Entscheidung<br />
schnell auf das SPR -Wickelrohrverfahren. Der Hauptabwassersammler<br />
in der Wzdluz-Torow-Straße, der direkt in die<br />
Kläranlage der Stadt Kety führt sowie der Abwasserkanal<br />
in der Slowackiego-Straße inmitten eines Wohngebiets<br />
erreichen über den Tag verteilt sehr hohe Abwasserspitzen,<br />
so dass die Kanäle für eine Sanierung nicht außer Betrieb<br />
genommen werden konnten. Die Betonrohre mit diversen<br />
Zuläufen und Bögen wären grundsätzlich auch durch<br />
Schlauchlining sanierbar gewesen, doch nicht in diesen<br />
Dimensionen und im Sondermaß eines Eiprofils. SPR Europe<br />
übernahm bei diesem Projekt die Installation des Liners in<br />
die beiden Eiprofil-Rohre mit Nennweiten von 1000/1720<br />
mm und einer Länge von 420 m und 1400/2100 mm mit<br />
93 m.<br />
Die Wickelrohrmaschine wird durch einen<br />
Begehungsschacht in das Altrohr eingeführt<br />
Wenn Kanäle mit sehr großer Nennweite inmitten des städtischen<br />
Lebens saniert werden müssen, ist die Wickelrohr-<br />
Technologie eine zeitsparende und kostengünstige Lösung<br />
ohne große Beeinträchtigung der Bewohner und des Verkehrs.<br />
So beauftragte im Spätsommer 2012 die Stadt Kety,<br />
Polen, die grabenlose Sanierung von Abschnitten zweier<br />
Beton-Abwasserkanäle mit der Wickelrohrvariante SPR .<br />
Die Stadt will so eine gute hydraulische Funktion für die<br />
DER SANIERUNGSPROZESS<br />
Bei dem seit 1978 bewährten SPR -Wickelrohrverfahren<br />
wird mehrere hundert Meter lang und bis zu einer Nennweite<br />
von 5.500 mm ein Endlos-Profilstreifen aus PVC im<br />
Kanal zu einem Rohr gewickelt. Dabei ist ein normaler<br />
Begehungsschacht ausreichend, um die Wickelmaschine<br />
und die PVC-Profilstreifen in den Kanal einzuführen. Oberirdisch<br />
verlangt das Sanierungs-Equipment, wie Trommeln<br />
mit den Endlos-Profilstreifen und das Sanierungsfahrzeug,<br />
deutlich weniger Platz, verglichen mit der offenen Bauweise.<br />
Dies kam dem Installationsteam zugute, da sich<br />
der DN1000-Kanal inmitten eines Wohngebietes und der<br />
DN1700-Kanal als Hauptsammler 500 m vor der Kläranlage<br />
in einer engen Straße befand. Die stahlverstärkten PVC-<br />
Endlosstreifen mit Nut-Feder-Verbindung wurden innerhalb<br />
von zehn Wochen bei kontrollierter Vorflut im Altkanal zu<br />
einem neuen wasserdichten Rohr gewickelt. Die im Altrohr<br />
installierte Wickelmaschine wandert dabei kontinuierlich mit<br />
den zusammengeführten Profilstreifen mit und verriegelt<br />
kraftschlüssig mit jeder Wicklung die Profilkanten, was die<br />
Wasserundurchlässigkeit gewährleistet. War eine Trommel<br />
aufgebraucht, wurde die Verbindung zum nächsten Profilstreifen<br />
durch Verschweißen in einer mobilen Heizelement-<br />
Stumpfschweiß-Anlage hergestellt. Da die Wickelmaschine<br />
mit einem fest definierten Untermaß dem Profil des Altrohres<br />
angepasst wurde, stellten auch die Bögen in den beiden<br />
Abwasserkanälen kein Problem dar.<br />
106 04-05 / 2013
ABWASSERENTSORGUNG RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
Kanalsanierung mit der Wickelrohr-Technologie ist bei<br />
Vorflut kein Problem<br />
RINGRAUM MIT MÖRTEL VERFÜLLT<br />
Die Aussteifung, Ringraumverfüllung sowie die abschließende<br />
Einbindung der Anschlüsse von mehreren Zuläufen<br />
mit 200/300 mm Durchmesser wurde von dem polnischen<br />
Partnerunternehmen INFRA durchgeführt. Diese mauerte<br />
die Endabschlüsse des Wickelrohres bis zur Betonwand ab<br />
und dichtete die Kanten zwischen Wickelrohr und Zulauf<br />
mit Glasfaserlaminat ab. Der bewusst gewollte Ringraum<br />
Nach dem Wickelvorgang werden in das neue SPR -Rohr Stützrahmen<br />
eingebaut, die dem Liner während der Ringraumverfüllung<br />
mit dem Spezialmörtel Stabilität verleihen<br />
zwischen neuem Wickelrohr und Altrohr wurde mit einem<br />
Hochleistungsmörtel verfüllt, der die statische Eigenschaft<br />
des Wickelrohres sicherstellt. Die Strabag AG beendete nach<br />
weiteren Tiefbauarbeiten das komplette Sanierungsprojekt<br />
zur vollsten Zufriedenheit der Stadt Kety.<br />
KONTAKT: SEKISUI SPR Europe GmbH, Schieder-Schwalenberg, E-Mail:<br />
info@sekisuispr.com
FACHBERICHT PROJEKT KURZ RECHT BELEUCHTET & REGELWERK ABWASSERENTSORGUNG<br />
Neue Stahlbetonrohre und Schächte<br />
für die Mehlemer Kanalisation<br />
Die Tiefbaumaßnahme im Bonner Stadtteil Mehlem ist Bestandteil großräumiger Kanalsanierungsarbeiten im Rahmen<br />
der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadt und war nötig geworden, da der alte Sammler Eiprofil<br />
DN 500/750 sowohl unter baulichen als auch hydraulischen Gesichtspunkten nicht mehr den Anforderungen entsprach.<br />
Der neue Sammler wird parallel zur alten Leitung verlegt.<br />
Am 4. Oktober 2012 war es soweit: Pünktlich wurde das<br />
Schachtbauwerk Nr. 16 von der BERDING BETON GmbH aus<br />
dem Werk Kinderhaus bei Münster mit einem Tieflader zur<br />
Einbaustelle in die Mainzer Straße in Bonn-Mehlem geliefert.<br />
Dort, im südlichsten Ortsteil des Bonner Stadtbezirkes Bad<br />
Godesberg, werden im Auftrag des Tiefbauamtes der Stadt<br />
Bonn Teile des Mischwasserkanalsystems von der Bauunternehmung<br />
Bonner Kanalbau erneuert. Ein Mobilkran hob das<br />
rund 25 t schwere Bauwerk in die vorbereitete Baugrube,<br />
die im Einmündungsbereich des steilabfallenden Schützengrabens<br />
liegt. Bei dem Schacht handelt es sich um ein so<br />
genanntes Absturzbauwerk, das mit einem innenliegenden<br />
Absturz ausgestattet ist. Der Schacht wurde – ebenso wie<br />
zwei weitere Schachtbauwerke und die Stahlbeton-Eiprofile<br />
DN 600/900 für den neuen 420 m langen Mischwassersammler<br />
– nach den Qualitätsrichtlinien der FBS - Fachvereinigung<br />
Betonrohre und Stahlbetonrohre e.V. gefertigt.<br />
Das Absturzbauwerk dient zur Überbrückung der Höhendifferenz<br />
bei der Einleitung des Schmutzwassers aus dem<br />
Mischwassersammler des Schützengrabens in den Sammler<br />
in der Mainzer Straße. Bei der Ausführung entschied sich der<br />
Bauherr, das Bonner Tiefbauamt, für eine Ausführung mit<br />
innenliegendem Absturz, da diese Variante im Gegensatz zu<br />
Schächten mit außenliegenden Abstürzen wesentlich besser<br />
zugänglich ist, etwa bei Wartung, Reinigung oder Inspektion.<br />
Gleichzeitig bietet der Trichter einen Schutz – etwa bei<br />
erhöhten Wasserfrachten infolge von Starkregenereignissen<br />
und sorgt für einen sicheren Abfluss. Ein Aufstauen in der<br />
Leitung ist deshalb nicht zu befürchten.<br />
Bei dem viereckigen Stahlbeton-Sonderschacht handelt<br />
es sich um ein Bauwerk, das bei BERDING BETON in Segmentbauweise<br />
hergestellt und werkseitig zusammengebaut<br />
wurde. Es besteht aus wasserundurchlässigem Stahlbeton<br />
C40/50 (WU) und entspricht den Expositionsklassen XA2 und<br />
XC4. Die lichte Abmessung des Stahlbetonrohlings (L/B/H)<br />
beträgt 1,63 m x 2,12 m x 1,70 m x 2,00 m x 2,95 m, die<br />
Wandstärke 300 mm und die Dicke der Bodenplatte 250 mm.<br />
Das Bauwerk ist mit verschiedenen Einbauteilen ausgestattet.<br />
Hierzu gehören ein Anschluss im Eiprofil 600/900 bei 0 °<br />
und ein Anschluss im Eiprofil 600/900 bei 184°, eine 65 cm<br />
x 55 cm große Öffnung für den Zulauf DN 300 bei 284 °,<br />
ein Betongerinne, eine Betonberme sowie der innenliegende<br />
Untersturz DN 200, dessen Sichtfläche geklinkert ist.<br />
LÜCKENLOSE QUALITÄTSKONTROLLE<br />
„Die Teile des Schachtbauwerkes sind in der Form erhärtet<br />
und entsprechen den erhöhten Anforderungen der FBS-<br />
Qualitätsrichtlinie, Teil 2-1“ weist Hakan Güldür, Fachberater<br />
Außendienst, BERDING BETON GmbH, Werk DW Nievenheim,<br />
auf ein besonderes Qualitätsmerkmal hin. Sie gilt für<br />
FBS-Schachtfertigteile Typ 2 aus Beton und Stahlbeton nach<br />
DIN EN 1917 und DIN V 4034-1, die von FBS-Mitgliedsfirmen<br />
hergestellt werden und das FBS-Qualitätszeichen tragen. Diese<br />
Qualitätsrichtlinien sind Bestandteil eines umfassenden Qua-<br />
Bild 1: Ein Tieflader brachte den rund 25 t schweren Stahlbeton-<br />
Sonderschacht zur Einbaustelle in die Mainzer Straße in Bonn-Mehlem<br />
Bild 2: Passgenaues Einheben des Schachtbauwerks<br />
108 04-05 / 2013
FBS-Betonbauteile.<br />
Kurze Wege<br />
für nachhaltigen Erfolg.<br />
Rohstoffe aus der Region<br />
Kies<br />
Sand<br />
Zement<br />
Wasser<br />
Bild 3: Das Bauwerk ist mit zwei Anschlüssen im Eiprofil 600/900, einer 65 cm<br />
x 55 cm großen Öffnung für den Zulauf DN 300, einem Betongerinne, einer<br />
Betonberme sowie einem innenliegende Untersturz DN 200 ausgestattet<br />
litätssicherungssystems, das im Bereich der Abwassertechnik seinesgleichen<br />
sucht. Eine umfangreiche werkseigene Produktionskontrolle (WPK) stellt eine<br />
für Rohrwerkstoffe einmalige und lückenlose Qualitätskontrolle von den Ausgangsstoffen<br />
über die Herstellung bis zu den Endprodukten sicher. Im Rahmen<br />
der halbjährlichen Fremdüberwachung durch bauaufsichtlich anerkannte Güteschutzgemeinschaften<br />
oder Prüfinstitute, wird die Erfüllung der Norm- und<br />
FBS-Anforderungen kontrolliert und bewertet. „Diese Qualität wird mit dem<br />
FBS Qualitätszeichen bestätigt“, so Güldür weiter.<br />
MILLIMETERARBEIT MIT DEM MOBILKRAN<br />
Ein Mobilkran hat das Schachtbauteil vor Ort an der Einbaustelle vom Tieflader<br />
gehoben und in die vorbereitete Baugrube gesetzt. Das passgenaue<br />
Arbeiten mit dem tonnenschweren Bauteil, das von allen Beteiligten ein<br />
Höchstmaß an Fingerspitzengefühl erforderte, hat Jörg Graumann, Inhaber<br />
und Geschäftsführer des Bauunternehmens Bonner Kanalbau und seinen<br />
Polier Frank Basten nicht aus der Ruhe bringen können. „Für einen erfahrenen<br />
Tiefbauer gehört das zum Alltag“, erklärt Graumann. Wichtig für ein gutes<br />
Bau-Ergebnis sei eine eingespielte Kolonne und ein Kranführer, der mit dem<br />
Gerät umgehen kann. In diesem Zusammenhang hebt Graumann auch die<br />
Termintreue des Schacht- und Rohrherstellers hervor, ebenso wie die Qualität<br />
der gelieferten Produkte.<br />
Die Tiefbaumaßnahme ist Bestandteil großräumiger Kanalsanierungsarbeiten<br />
im Rahmen der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes<br />
der Stadt Bonn und war nötig geworden, da der alte Sammler Eiprofil<br />
DN 500/750 sowohl unter baulichen als auch hydraulischen Gesichtspunkten<br />
nicht mehr den Anforderungen entsprach. Der neue Sammler wird<br />
parallel zur alten Leitung verlegt. Nach Inbetriebnahme des neu gebauten<br />
Abschnittes werden die alten Rohre nach Aussage von Bauleiter Waßmann<br />
verdämmt. Die komplette Erneuerung des Mischwassersammlers in der<br />
Mainzer Straße soll Ende 2013 planmäßig abgeschlossen sein.<br />
FBS-Betonbauteile bestehen aus<br />
natürlichen, überall verfügbaren<br />
heimischen Rohstoffen. Auch<br />
nach ihrer langen Nutzungsdauer<br />
können sie als Baustoffe zeitgemäß<br />
mit wenig Energieaufwand<br />
weiterverarbeitet und wieder<br />
verwendet werden. Klarer Fall:<br />
FBS setzt auf eine ökologisch<br />
lückenlose Lieferkette.<br />
KONTAKT: FBS - Fachvereinigung Betonrohre und Stahlbetonrohre e.V., Bonn, Tel. 228 95456-54,<br />
E-Mail: info@fbsrohre.de, www.fbsrohre.de<br />
Wir freuen uns auf Sie in Halle 3.2.<br />
04-05 / 2013 109
FACHBERICHT PROJEKT KURZ RECHT BELEUCHTET & REGELWERK ABWASSERENTSORGUNG<br />
Sohlengleiche Anschlusssituation bei<br />
Kanalerneuerung in Ahlen<br />
Normalerweise werden in Ahlen Betonrohre für die Ableitung von Regenwasser und Steinzeugleitungen für die Entsorgung<br />
von Schmutzwasser verbaut. Für die Hausanschlussleitungen kommen Kunststoffrohre zum Einsatz. Dass das Abwasserwerk<br />
der münsterländischen Stadt im Landkreis Warendorf bei einer Kanalbaumaßnahme in der Fritz-Husemann-Straße auf<br />
einem gut 80 m langen Teilstück von dieser Regel abgewichen ist, lag an den baulichen Rahmenbedingungen vor Ort,<br />
u. a. an der geringen Sohlentiefe von nur 1,50 m im Sanierungsgebiet. Diese verhinderte ein einfaches Einbinden von<br />
tieferliegenden Hausanschlussleitungen, da die vorgesehenen Kanalrohrsysteme in Bezug auf ihre bautechnischen und<br />
hydraulischen Eigenschaften hierbei an ihre Grenzen stoßen.<br />
Eine bautechnisch flexible und zudem wirtschaftliche Lösung<br />
bot der Einsatz des HS ® -Kanalrohrsystem von der Funke Kunststoffe<br />
GmbH. Im Gegensatz zu den meisten Rohrsystemen<br />
aus anderen Werkstoffen verfügt das Kanalrohrsystem über<br />
umfangreiches Zubehör und Formteile, mit denen sich nahezu<br />
jede Situation vor Ort im Leitungsgraben meistern lässt. So<br />
war es der bauausführenden Altefrohne Tiefbau GmbH & Co.<br />
KG dank HS ® -VARIO-Abzweig mit sohlengleichem Anschluss<br />
und weiteren Produkten wie der VPC ® -Rohrkupplung trotzdem<br />
möglich, die Hausanschlussleitungen ohne größeren<br />
baulichen Aufwand, wie z. B. dem Setzen eines Schachtes,<br />
sohlengleich an den neuen Sammler anzubinden.<br />
Bild 1: Der HS ® -VARIO-Abzweig sohlengleich ermöglicht in der<br />
Fritz-Husemann-Straße in Ahlen den fachgerechten Anschluss<br />
der Hausanschlussleitungen<br />
Nach Abschluss der Kanalbauarbeiten in der Fritz-Husemann-Straße<br />
in Ahlen herrschte bei allen Beteiligten Zufriedenheit.<br />
Dabei war die Erneuerung der Schmutz- und<br />
Regenwassersammler keine gewöhnliche Baumaßnahme,<br />
wie sie das Abwasserwerk der Stadt häufiger durchführen<br />
lässt. Notwendig geworden war die Erneuerung des Abwassersammlers,<br />
da eine Untersuchung des Kanals altersbedingte<br />
Schäden aufgezeigt hatte. Im Rahmen einer Bestandsaufnahme<br />
waren im Vorfeld auch die Hausanschlüsse unter die<br />
Lupe genommen worden. Dort, wo die Leitungen defekt<br />
waren, sind die Hausanschlüsse gleich miterneuert worden.<br />
Gleichzeitig wurde der Regenwasserkanal im Zuge<br />
der Tiefbauarbeiten hydraulisch erweitert. „Für gewöhnlich<br />
nutzen wir Beton für die Regenwasserleitung und Steinzeug<br />
für die Schmutzwasserrohre. Kunststoff wird sonst nur bei<br />
den Hausanschlüssen eingesetzt“, erzählt Dipl.-Ing. Gerrit<br />
Hegemann, Gruppenleiter des Abwasserwerks der Stadt<br />
Ahlen. Bei den jüngsten Arbeiten aber brachte gerade das<br />
HS ® -Kanalrohrsystem von Funke eine Lösung, wo man mit<br />
den anderen Werkstoffen nicht weiterkam: „Das Besondere<br />
in der Fritz-Husemann-Straße ist die geringe Sohlentiefe<br />
von nur 1,50 m. Einige ältere Häuser in dem Bereich – 15<br />
an der Zahl – entwässerten aber unter dieser Sohlentiefe.<br />
Um die Hausanschlussleitungen einzubinden, die bei uns in<br />
Ahlen bis zum Sammler als privat gelten, mussten wir auf<br />
einer Länge von gut 80 m nach einer Alternative suchen“,<br />
erinnert sich Dipl.-Ing. Dieter Sievers von der Projektabwicklung<br />
beim Abwasserwerk.<br />
Vorteile überzeugen die Tiefbauer<br />
Dementsprechend wurden die Sammler in diesem Bereich<br />
mit blauen HS ® -Kanalrohren DN/OD 500 (Regenwasser)<br />
und braunen HS ® -Kanalrohren DN/OD 250 (Schmutzwasser)<br />
erstellt. Bauleiter Torsten Havers von der Altefrohne Tiefbau<br />
GmbH & Co. KG ist von den Vorteilen des Produkts überzeugt:<br />
„PVC hat ein geringes Eigengewicht und ist deshalb<br />
leicht zu handeln. Auch bei einer Rohrbaulänge von 3 m<br />
benötigt man kein schweres Hubgerät. Rohre und Formteile<br />
können von Hand zusammengeschoben werden. Durch<br />
das Anschlaggeräusch des Spitzendes auf den Muffensteg<br />
kann man sicher sein, dass die Montage korrekt ist. Was<br />
110 04-05 / 2013
ABWASSERENTSORGUNG RECHT & PROJEKT REGELWERK KURZ FACHBERICHT<br />
BELEUCHTET<br />
Bild 2: Trotz verschiedener Werkstoffe: Die VPC ® -Rohrkupplung<br />
verbindet Kunststoff und Steinzeug dauerhaft dicht. Die<br />
Dichtmanschette und der Fixierkorb bilden zusammen mit<br />
den beiden Spannbändern eine kompakte, formstabile und<br />
dennoch flexible Einheit<br />
die Arbeit darüber hinaus enorm erleichtert, sind die fest<br />
integrierte FE ® -Dichtung und die vielen Formteile, die genau<br />
wie die Rohre alle wandverstärkt und somit äußerst stabil<br />
sind.“ In der Fritz-Husemann-Straße konnte das System aber<br />
vor allem dank seiner Flexibilität beim Einbinden der Hausanschlussleitungen<br />
in den Abwassersammler punkten – so<br />
u. a. mit dem HS ® -VARIO-Abzweig sohlengleich.<br />
Anfertigungen auf Kundenwunsch<br />
Das Formteil, das produktionstechnisch eigens auf die<br />
besonderen Bedingungen auf der Baustelle in der Fritz-<br />
Husemann-Straße abgestimmt und nach den Anforderungen<br />
des Auftraggebers gefertigt wurde, ist mit einer<br />
VARIO-Muffe ausgestattet. Mit dem integrierten Kugelgelenk,<br />
das Rohrverbindungen in einem Bereich bis 11 °<br />
schwenkbar macht, war die Einbindung der tiefer liegenden<br />
Hausanschlussleitungen an den Sammler ein Kinderspiel.<br />
Gleiches galt für die Fälle, wo Leitungen aus Steinzeug oder<br />
Beton an den neuen Sammler aus Kunststoff angebunden<br />
werden sollten: Hier kam die Funke VPC ® -Rohrkupplung<br />
zum Einsatz. „Sie besteht aus einer Dichtmanschette aus<br />
Elastomergummi, einem Fixierkorb aus Kunststoff und zwei<br />
Edelstahlbändern und verbindet Rohre aus unterschiedlichen<br />
Werkstoffen bei gleicher Nennweite optimal und sicher miteinander<br />
– und das trotz der bauartbedingt unterschiedlichen<br />
Außendurchmesser“, beschreibt Funke-Fachberater Ralf<br />
Erpenbeck die Vorteile der Rohrkupplung, die mittlerweile bei<br />
vielen Tiefbauarbeiten erfolgreich eingesetzt wird.<br />
Am Ende der Tiefbauarbeiten herrschte allseits Zufriedenheit<br />
mit der Entscheidung für die Kunststoffrohre und -formteile.<br />
Bild 3: Das HS ® -Kanalrohrsystem ist in den Farben braun für<br />
Schmutzwasser und in blau für Regenwasser erhältlich. So lässt<br />
sich die Nutzung auch nach Jahren noch zweifelsfrei feststellen<br />
„Das HS ® -Kanalrohrsystem“, da bestand Einigkeit, „bot eine<br />
Lösung, wo die Werkstoffe Beton und Steinzeug an ihre Grenzen<br />
gestoßen sind.“ Nicht nur, dass das HS ® -Kanalrohrsystem<br />
die sohlengleiche Einbindung der Hausanschlussleitungen<br />
möglich machte, der Auftraggeber lobt auch den Service<br />
des Herstellers. Dipl.-Ing. Gerrit Hegemann: „Die Lieferung<br />
erfolgte trotz Sonderanfertigungen schnell und reibungslos;<br />
so gingen die Arbeiten zügig voran. Die technische Beratung<br />
durch Ralf Erpenbeck war ebenfalls sehr gut. Auch die<br />
Anwohner an der Fritz-Husemann-Straße haben aufgeatmet.<br />
Denn so, wie die Baumaßnahme durchgeführt wurde, mussten<br />
die Vorgärten nicht extra aufgerissen werden.“<br />
KONTAKT: Funke Kunststoffe GmbH, Hamm-Uentrop, Tel.+49 2388 3071-0,<br />
E-Mail: info@funkegruppe.de, www.funkegruppe.de<br />
04-05 / 2013 111
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
SYMPOSIUM 25. und 26. April 2013<br />
Regenwasserbewirtschaftung:<br />
Stormwater Management<br />
auf der WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2013<br />
TOP-THEMA<br />
IN BERLIN:<br />
Nachhaltiger<br />
Umgang mit<br />
Regenwasser<br />
In Kooperation mit dem Beuth-Verlag und dem Bund<br />
der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft<br />
und Kulturbau e.V. (BWK) veranstaltet die technischwissenschaftliche<br />
Fachzeitschrift gwf-<br />
Wasser|Abwasser am 25. und 26. April<br />
2013 ein Symposium zum nachhaltigen<br />
Umgang mit Regenwasser im Rahmen der<br />
WASSER BERLIN INTERNATIONAL. Hochkarätige<br />
Referenten werden zum Stand der<br />
Forschung, über die <strong>aktuell</strong>e Gesetzeslage<br />
sowie über Projekte im In- und Ausland<br />
berichten. Auf einer Fachexkursion zur<br />
Rummelsburger Bucht im Osten Berlins<br />
lassen sich Grundlagen und Ausführung<br />
dezentraler Regenwasserbewirtschaftung<br />
aus der Nähe in Augenschein<br />
nehmen.<br />
Anmeldung bei:<br />
WASSER BERLIN INTERNATIONAL<br />
Sandra Jerat<br />
jerat@messe-berlin.de<br />
Tel.: +49 (0)30 / 3038-2341<br />
Fax: +49 (0)30 / 3038-2079<br />
Anmeldung für die Exkursion/<br />
Abendveranstaltung bei:<br />
DIN-Akademie<br />
Sarah Mareike Sternheim<br />
sarah_mareike.sternheim@beuth.de<br />
Tel.: +49 (0)30 / 2601-2868<br />
Fax: +49 (0)30 / 2601-42868<br />
Die Kosten für die Exkursion betragen<br />
25,00 EUR inkl. Bus-Shuttle zur Rummelsburger<br />
Bucht.<br />
112 04-05 / 2013
Eine Veranstaltung von<br />
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
Unsere Themen und Referenten:<br />
Donnerstag, 25. April 2013, Vormittags Exkursion<br />
13:00 Uhr Begrüßung, Dr.-Ing. Heiko Sieker,<br />
Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH, Berlin<br />
13:35 Uhr Bestandsaufnahme und Ausblick für<br />
die Regenwasserbewirtschaftung<br />
Prof. Dr. Friedhelm Sieker,<br />
Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH, Berlin<br />
14:05 Uhr Regenwasserbewirtschaftung in den<br />
Niederlanden<br />
Dr. Govert Geldof, Ingenieurbüro Geldof, Niederlande<br />
14:35 Uhr Stromwater Management in Scotland<br />
Brian D‘Arcy, Environmental Consultant, Scotland<br />
15:05 Uhr Regenwassermanagement in Berlin<br />
Matthias Rehfeld-Klein, Senatsverwaltung für<br />
Stadtentwicklung und Umwelt, Berlin<br />
15:30 Uhr Pause<br />
16:00 Uhr Regenwassermanagement bei<br />
großflächigen Gewerbe- und<br />
Logistikansiedlungen<br />
Dr. Mathias Kaiser, KaiserIngenieure, Dortmund<br />
16:30 Uhr Regenwassermanagement –<br />
Erfahrungen aus der Emscherregion<br />
Michael Becker, Abt.-Ltr. Wasserwirtschaft,<br />
Emschergenossenschaft/Lippeverband<br />
17:00 Uhr Zusammenfassung der Vorträge<br />
Dr.-Ing. Heiko Sieker,<br />
Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH, Berlin<br />
17:15 Uhr Firmenpräsentationen<br />
17:45 Uhr Übergang zum Get-Together/Messehalle<br />
Ca. 21:00 Uhr Ende Get-Together<br />
Freitag, 26. April 2013<br />
9:00 Uhr Begrüßung, Dr.-Ing. Heiko Sieker,<br />
Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH, Berlin<br />
09:15 Uhr Aktuelle Entwicklungen im technischen<br />
Regelwerk für Regenwetterabflüsse<br />
Prof. Dr. Theo Schmitt, TU Kaiserslautern, DWA<br />
09:45 Uhr Immissionsorientierte Misch- und Niederschlagswasserbehandlung<br />
nach BWK-<br />
M3/M7: Erfahrungen und Perspektiven<br />
aus einem Jahrzehnt Anwendungspraxis<br />
Prof. Dr. Dietrich Borchardt, TU Dresden, Department<br />
Aquatische Ökosystemanalyse und Management,<br />
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ<br />
10:15 Uhr Regenwassernutzung – nationale und<br />
internationale Normung<br />
Prof. Dr.-Ing. Martin Oldenburg, Hochschule Ostwestfalen-Lippe,<br />
FB Umweltingenieurwesen und<br />
Angewandte Informatik<br />
10:45 Uhr Pause<br />
11:15 Uhr Bauaufsichtliche Zulassungen von<br />
dezentralen Niederschlagswasserbehandlungsanlagen<br />
Prof. Dr.-Ing. habil. Antje Welker,<br />
FH Frankfurt, FG Siedlungswasserwirtschaft<br />
11:45 Uhr Zukunftsaufgabe Multicodierung: urbane<br />
Stadträume und Flächen für die Regenwasserbewirtschaftung<br />
– Herausforderungen,<br />
Stolpersteine und Strategien<br />
Prof. Dr. Carlo W. Becker, bgmr Landschaftsarchitekten<br />
Berlin/Leipzig / BTU Cottbus<br />
12:15 Uhr Podiumsdiskussion<br />
12:45 Uhr Ende des Symposiums<br />
WEITERE PROGRAMMPUNKTE Unternehmenspräsentationen, Podiumsdiskussionen,<br />
Abendveranstaltung und Exkursion „Dezentrale Regenwasserbewirtschaftung im<br />
Wohngebiet Rummelsburger Bucht in Berlin“<br />
04-05 / 2013 113
FACHBERICHT PROJEKT KURZ RECHT BELEUCHTET & REGELWERK ABWASSERENTSORGUNG<br />
Substratfilter reinigt Niederschlagswasser<br />
von Verkehrsflächen in drei<br />
Stufen<br />
Überall dort, wo Abwasser von Verkehrsflächen in Gewässer oder Grundwasser eingeleitet wird und rechtliche<br />
Anforderungen an die Eigenschaften dieses Abwassers bestehen, kommen Behandlungsanlagen wie z. B. Substratfilter zum<br />
Einsatz. Mit Bauartzulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) sind solche Anlagen geeignet, das Grundwasser<br />
vor Eintrag schädlicher Stoffe zu schützen. Auch ohne derzeit vorhandene Rechtsgrundlage lässt sich dieser Sachverhalt<br />
sinngemäß und auf die Einleitung in Oberflächengewässer anwenden. Das Niederschlagswasser wird dazu durch ein<br />
speziell entwickeltes Filtersubstrat von Schwermetallen, abfiltrierbaren Stoffen und mineralischen Kohlenwasserstoffen<br />
befreit. Wie das geschieht, wird an Referenzobjekten in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg gezeigt.<br />
Metalldächer<br />
Verkehrsflächen<br />
Sedimentation<br />
Filtration<br />
Adsorption<br />
Schwermetalle<br />
Abfiltrierbare Stoffe<br />
Absetzbare Stoffe<br />
Gewässer<br />
Grundwasser<br />
Grafik: Mall<br />
Bild 1: Behandlungsbedarf für abfließendes Niederschlagswasser mit Hilfe von Sedimentation, Filtration und Adsorption;<br />
insbesondere, wenn in ein schutzwürdiges Oberflächengewässer eingeleitet oder punktuell Richtung Grundwasser versickert wird<br />
Regenwasser wird immer mehr zum Kostenfaktor. Früher<br />
war der Anschluss der Regenwasserleitung an den Kanal<br />
der Kommune vorgeschrieben und ohne zusätzliche Kosten.<br />
Heute gilt das Gegenteil: Regenwasser soll auf den Grundstücken<br />
bewirtschaftet werden. Falls dies nicht gelingt,<br />
muss pro Quadratmeter in den Kanal entwässerte Fläche<br />
Jahr für Jahr eine separate Gebühr bezahlt werden. In Berlin<br />
wird sie als Niederschlagswasserentgelt in Höhe von<br />
1,90 €/m 2 und Jahr erhoben. Selbst der Abfluss belasteter<br />
Verkehrsflächen im Zentrum von Städten wie Berlin kann<br />
mittlerweile so behandelt werden, dass er unter Einhaltung<br />
der technischen Regeln ins Grundwasser versickert werden<br />
darf. Damit entfällt die Ableitungsgebühr, die Betriebskosten<br />
der Immobilien sinken.<br />
REFERENZ BMU IN BERLIN-MITTE<br />
Das Bundesumweltministerium (BMU), unmittelbar nach<br />
der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 neu geschaffen,<br />
hat die korrekte Bezeichnung Bundesministerium für<br />
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Der erste<br />
Dienstsitz ist noch immer Bonn, der zweite Berlin. Für den<br />
Neubau seines Berliner Gebäudes in der Nähe des Potsdamer<br />
Platzes (Bild 2) hat das BMU angrenzende Flächen<br />
saniert. Das anfallende Regenwasser von Zufahrten, Wegen<br />
und Platzflächen wird über eine unterirdische Rigolenversickerung<br />
dem Grundwasser zugeführt.<br />
Die Forderung des Auftraggebers (Bundesamt für Bauwesen<br />
und Raumordnung in Berlin) an die Planer war eine<br />
vorhergehende Behandlung des Regenwassers nach dem<br />
<strong>aktuell</strong>en Stand der Technik. Das Ministerium geht hier<br />
mit gutem Beispiel voran und macht den „Vorreiter“ bei<br />
der Einhaltung des von ihm vor wenigen Jahren auf den<br />
Weg gebrachten Wasserhaushaltsgesetzes WHG. Darin<br />
bestimmt der Gesetzgeber seit 1. März 2010 laut § 57 (1):<br />
„Eine Erlaubnis für das Einleiten von Abwasser in Gewässer<br />
(Direkteinleitung) darf nur erteilt werden, wenn die Menge<br />
und Schädlichkeit des Abwassers so gering gehalten wird,<br />
wie dies bei Einhaltung der jeweils in Betracht kommenden<br />
Verfahren nach dem Stand der Technik möglich ist“.<br />
Konstante Schmutzfracht, variable Wassermenge<br />
Besteht bei der Entwässerung von Verkehrsflächen die<br />
Gefahr, durch Schadstoffe das Grundwasser zu beeinträchtigen,<br />
ist eine geeignete Behandlung erforderlich. Stephan<br />
Klemens von Mall GmbH aus Donaueschingen, maßgeblich<br />
beteiligt an der Entwicklung des in Berlin eingebauten<br />
114 04-05 / 2013
ABWASSERENTSORGUNG RECHT & PROJEKT REGELWERK KURZ FACHBERICHT<br />
BELEUCHTET<br />
neuen Substratfilters, weiß um die doppelte Anforderung<br />
nach einerseits optimalem hydraulischem Durchsatz und<br />
andererseits bestmöglicher Reinigungsleistung. Daher hat<br />
er großen Wert auf ein sehr gutes Verhältnis von Oberfläche<br />
zu Volumen des Filters gelegt und erklärt: „Die Schmutzfracht<br />
bleibt konstant, unabhängig von der Menge des<br />
Regenwassers. Das ist das Besondere bei Niederschlagsabflüssen.<br />
Durch unsere patentierte Konstruktion entstehen<br />
je nach Intensität eines Regenereignisses unterschiedliche,<br />
aber in jedem Fall passende hydraulische Verhältnisse.“ Bei<br />
geringer Niederschlagsintensität wirkt der Schwanenhals im<br />
Ablauf wie ein Stauwehr. Der Wasserspiegel steigt bis zum<br />
oberen Krümmer an, so dass der ganze Filter benetzt ist.<br />
Bei weiter anhaltendem Zufluss erfolgt langsam ein Stau<br />
in den Krümmer hinein. Der höchstmögliche Wasserstand<br />
verursacht durch das dann vollständig gefüllte Fallrohr einen<br />
Sog, der die maximale Wassermenge durch den Filter saugt.<br />
Recycling der gefilterten Schwermetalle<br />
In jedem Fall durchläuft das zu reinigende Wasser drei<br />
Stufen.<br />
» Stufe 1: Rückhaltung absetzbarer Stoffe bis zu einer<br />
Korngröße von ca. 50 µm (0,05 mm) durch tangentiale<br />
Einleitung in ein Trichterbecken (Hydrozyklon)<br />
» Stufe 2: Trennung der abfiltrierbaren Stoffe bis zu<br />
einer Größe von 0,45 µm (0,00045 mm) durch die<br />
Filterstufe aus Porenbeton. Gleichzeitig ergibt sich ein<br />
Koaleszenzeffekt für die eingetragenen mineralischen<br />
Kohlenwasserstoffe<br />
» Stufe 3: Entfernung der gelösten und emulgierten<br />
Stoffe wie Schwermetalle, mineralische Kohlenwasserstoffe<br />
und organische Stoffe durch Adsorption<br />
Bild 2: Baustelle der neu angelegten Verkehrsfläche, angrenzend an den<br />
Neubau des Bundesumweltministeriums in Berlin. Niederschlagswasser wird<br />
durch den dreistufigen Substratfilter ViaPlus vor der Versickerung gereinigt<br />
Klemens ist stolz auf die lange Standzeit von vier Jahren,<br />
die im September 2011 vom DIBt in der Zulassung Z-84.2-8<br />
bescheinigt wurde, und ergänzt:„Die Wartung ist unkompliziert,<br />
denn bei unserem Filter ist der Schlammraum allseitig<br />
gut zugänglich.“ Für ihn schon selbstverständlich ist die<br />
Tatsache, dass Schwermetalle aus dem Filter nach Ablauf<br />
dieser Zeit im Zuge von Wartung und Austausch resorbiert,<br />
also zurückgewonnen werden können.<br />
Die Reinigungsleistung ist zudem besser als erforderlich. Das<br />
ergab die Prüfung des TÜV Rheinland, durchgeführt an der<br />
Landesgewerbeanstalt (LGA) Bayern, Außenstelle Würzburg.<br />
Für die Parameter AFS (Feststoffe) liegt der Wirkungsgrad<br />
bei 93 statt 92%, für MKW (Öl) bei 99 statt 80 %, für<br />
die Schwermetalle Kupfer bei 90 statt 80 % und für Zink<br />
wurden 89 statt der geforderten 70 % erreicht.<br />
Nachfolgend ein Auszug aus der Einbauanweisung für<br />
Via-Plus Schachtanlagen: Das Grundelement besteht aus<br />
einem monolithischen Stahlbetonfertigteil-Behälter, der im<br />
„Über-Kopf-Verfahren“ hergestellt wurde. Die Produktionsweise<br />
macht es möglich, einen fugenlosen vollständig<br />
stahlbewehrten Behälter ohne Arbeitsfuge im kritischen<br />
Anschnitt Wand-Sohle herzustellen. Die Anlage kann Verkehrsbelastungen<br />
der gängigen Lastbilder ohne zusätzliche<br />
Maßnahmen aufnehmen. Der lichte Durchmesser dieses<br />
Bild 3: Neubau Mehrzweckhalle Kressbronn. Substratfilter ViaPlus<br />
mit vorgeschaltetem Trennbauwerk für die Entwässerung von<br />
Verkehrsflächen. Ablauf über den Vorfluter Nonnenbach in den<br />
Bodensee, gedrosselt auf maximal 5 l/s.<br />
zylindrischen Rundbehälters beträgt 1.200 mm. Sämtliche<br />
Filterelemente sind werkseitig vormontiert und müssen beim<br />
Einbau vor Verschmutzungen geschützt werden.<br />
REFERENZ MEHRZWECKHALLE IN KRESSBRONN /<br />
BADEN-WÜRTTEMBERG<br />
Am Ufer des Bodensees ist die Notwendigkeit zur Vorreinigung<br />
von Oberflächenwasser leicht nachvollziehbar. Europas<br />
größter Trinkwasserspeicher hat ein hohes Schutzbedürfnis,<br />
wenn wie in Kressbronn (siehe Bild 3, Bild 4, Bild 5) das<br />
Grafik: Mall<br />
04-05 / 2013 115
FACHBERICHT PROJEKT KURZ RECHT BELEUCHTET & REGELWERK ABWASSERENTSORGUNG<br />
Foto: König<br />
Foto: Mall<br />
Foto: König<br />
Bild 4: Neubau Mehrzweckhalle Kressbronn.<br />
Unterirdisch eingebauter Substratfilter ViaPlus<br />
mit DIBt-Zulassung für die Entwässerung von<br />
Verkehrsflächen<br />
Bild 5: Neubau Mehrzweckhalle Kressbronn.<br />
Durch den Substratfilter ViaPlus gereinigtes<br />
Oberflächenwasser wird gedrosselt über den<br />
Vorfluter Nonnenbach dem Bodensee zugeführt<br />
Bild 6: Erweiterung der Firma febi bilstein<br />
in Ennepetal. Unterirdisch eingebauter<br />
Substratfilter ViaPlus mit DIBt-Zulassung für<br />
die Entwässerung von Parkplatzflächen<br />
Wasser des als Vorflut dienenden Nonnenbachs schon nach<br />
kurzer Fließstrecke den Bodensee erreicht. Mit dem Bau<br />
der Mehrzweckhalle, Fertigstellung Mai 2013, wurde im<br />
Jahr 2012 die Entwässerung der Verkehrsflächen (Zufahrt<br />
und Parkplätze) aufgeteilt in fünf Teilströme. Einer führt<br />
zur Kanalisation, zwei münden direkt in Sickermulden und<br />
zwei weitere werden über je eine kombinierte Rückhaltung /<br />
Reinigung in die Vorflut geführt. Der größere Volumenstrom<br />
aus ca. 1.000 m² Fläche erreicht den Substratfilter ViaPlus<br />
über einen Drosselschacht, der maximal 5 l/s durchlässt. Der<br />
kleinere Zufluss aus ca. 300 m² Sammelfläche ist unmittelbar<br />
am Substratfilter angeschlossen. Diese Lösung ist<br />
kostengünstig und entspricht den Forderungen der Unteren<br />
Wasserbehörde im Landratsamt Bodenseekreis.<br />
REFERENZ INDUSTRIEBETRIEB BILSTEIN IN<br />
ENNEPETAL / NRW<br />
In der Stadt Ennepetal am südlichen Rand des Ruhrgebiets<br />
hat der Fahrzeugzulieferer febi bilstein die Zahl seiner Mitarbeiter<br />
erhöht und deshalb 2012 einen weiteren Parkplatz<br />
für die Belegschaft angelegt. Das Oberflächenwasser von<br />
162 gepflasterten PKW-Stellplätzen wird gesammelt, in<br />
einer kombinierten unterirdischen Anlage zurückgehalten<br />
und gereinigt (Bild 6). Dem Substratfilter ViaPlus sind ein<br />
Drosselbauwerk und ein Schlammfang vorgeschaltet. Vor<br />
dem Abfluss passiert das gereinigte Wasser noch einen<br />
Probenahmeschacht, bevor es in einen verrohrten Bachlauf<br />
eingeleitet wird. Dieser geht nach ca. 1.500 m in ein offenes<br />
Gewässer über. Zur Art und Weise der Oberflächenbehandlung<br />
hatte die Untere Wasserbehörde des Ennepe-Ruhr-<br />
Kreises Vorgaben gemacht, u. a. dass die Behandlungsanalyse<br />
den Ablauf ins Gewässer auf maximal 5 l/s drosselt<br />
und dass die Anlage eine Bauartzulassung des DIBt haben<br />
soll. Um die Erschließung so wirtschaftlich wie möglich zu<br />
bauen, wurde vorsorglich das benachbarte Grundstück<br />
mit einbezogen. Auf diesem will febi bilstein künftig einen<br />
KFZ-Lackierbetrieb mit KFZ-Waschplatz errichten.<br />
ZUSAMMENFASSUNG<br />
In Berlin, Kressbronn und Ennepetal wird belastetes Oberflächenwasser<br />
von Verkehrsflächen mit Hilfe des unterirdisch<br />
eingebauten Substratfilters ViaPlus so gereinigt, dass es in<br />
Grund- und Oberflächenwasser ohne Bedenken eingeleitet<br />
werden kann. In Folge sinken die Betriebskosten der Immobilien.<br />
Der Regenwasseranteil auf der Kläranlage verringert<br />
sich, der natürliche Wasserhaushalt profitiert.<br />
LITERATUR<br />
[1] Lienhard, Martin: Bauprodukte im Richtlinien-Dschungel<br />
„brauchbar“ oder „zugelassen“? In: Ratgeber Regenwasser.<br />
Für Kommunen und Planungsbüros. Rückhalten, Nutzen und<br />
Versickern von Regenwasser im Siedlungsgebiet. (Hrsg.:) Mall<br />
GmbH, Donaueschingen, 4. Auflage, 2012.<br />
[2] Regenwasserbewirtschaftung und Niederschlagswasserbehandlung,<br />
Planerhandbuch. (Hrsg.:) Mall GmbH, Donaueschingen,<br />
2012. 71 Seiten, DIN A 4, kostenlos<br />
KONTAKT: Klaus W. König, Architektur- und Fachpressebüro, Überlingen,<br />
E-Mail: kwkoenig@koenig-regenwasser.de<br />
116 04-05 / 2013
ABWASSERENTSORGUNG RECHT & PROJEKT REGELWERK KURZ FACHBERICHT<br />
BELEUCHTET<br />
Echtzeitsystem für Vorhersage von<br />
Kanalisationsüberläufen im Abwassernetz<br />
Lissabons<br />
Die Kanalisation von Portugals Hauptstadt, zu der unterschiedliche Schmutz- und Mischwassersysteme sowie teilweise<br />
getrennte Systeme gehören, wird von SimTejo (Saneamento Integrado dos Municípios do Tejo e Trancão) verwaltet. Die<br />
Integration von Bentleys WaterObjects.NET-Technologie in AQUASAFE ermöglicht die automatische Ausführung der<br />
SewerGEMS-Lösung und die Herstellung einer Echtzeitverbindung zu Daten und Wettervorhersagen.<br />
HÄUFIGE ÜBERFLUTUNGEN ERFORDERN BESSERE<br />
VORHERSAGEN<br />
Wie die meisten Länder im Mittelmeerraum erlebt auch<br />
Lissabon kurze niederschlagsreiche Regenperioden, in<br />
denen es immer wieder zu flutartigen Überschwemmungen<br />
kommt, wenn das Netzwerk gleichzeitig durch einen<br />
hohen Tidenhub überlastet wird. SimTejo hatte in der Vergangenheit<br />
zwar Zugang zu umfassenden Infrastruktur- und<br />
Betriebsdaten über das Wassernetzwerk, benötigte aber<br />
darüber hinaus eine Lösung zur Konsolidierung und Integration<br />
der in großen Mengen vorliegenden Informationen<br />
in Form von zweckdienlichen und verwertbaren Daten.<br />
Als es um die Frage der Bereitstellung von Echtzeitdaten<br />
zum Modellieren von Notfall- und Planungsszenarien sowie<br />
Echtzeitbetriebssituationen ging, hat sich SimTejo für den<br />
Bentley-Partner Hidromod entschieden, der an der Entwicklung<br />
einer Lösung zur Verwaltung des Abflusses und der<br />
Aufbereitung von Abwassern mitwirken sollte.<br />
Die von SimTejo verwalteten Kanalisationen wurden alle mit<br />
unterschiedlichen Materialien und Bauteilen konstruiert. Diese<br />
Bauteile wurden in unterschiedlichen Zeiträumen installiert<br />
Bild 2: Überflutetes Lissabon<br />
und dementsprechend befindet sich das Abwassersystems in<br />
einem unterschiedlich guten Zustand. Es kam immer wieder<br />
zu unkontrollierten Zuflüssen von Regenwasser, die enorme<br />
Mengen von Grob- und Feststoffen in das System schwemmten<br />
und in den Kanalisationen, den Pumpstationen und den<br />
Abwasseraufbereitungsanlagen gewaltige Überschwemmungen<br />
verursachten. Aufgrund der topografischen und geografischen<br />
Lage Lissabons ist das Flussufer in der Innenstadt<br />
dem Tidenhub ausgesetzt, so dass dauerhaft Tidenschleusen<br />
gebaut werden mussten, um Überschwemmungen zu verhindern,<br />
die durch heftige Regenfälle bei gleichzeitig starkem<br />
Tidenhub verursacht wurden.<br />
WECHSEL VON REAKTIVER ZU PROAKTIVER<br />
BETRIEBSVERWALTUNG<br />
SimTejo erkannte die Notwendigkeit einer Konsolidierung<br />
der in großen Mengen vorliegenden Informationen,<br />
darunter SCADA-Daten, Probenahmedaten, Daten von<br />
Qualitätsproben sowie Daten aus anderen Quellen, wie<br />
z. B. die mithilfe von SewerGEMS ermittelten Ergebnisse<br />
aus Hydraulikmodellen. Zwar verwendete SimTejo bereits<br />
Modellierwerkzeuge, wie z. B. SewerGEMS für Planungsaufgaben,<br />
doch das Unternehmen suchte darüber hinaus<br />
nach Mitteln und Wegen, um mit diesen Werkzeugen<br />
drohende Überschwemmungen, unkontrollierte Zuflüsse<br />
sowie Zuflussmengen in Richtung der Abwasseraufbereitungsanlagen<br />
in Echtzeit vorhersagen zu können.<br />
Zur Erhöhung und Verbesserung der Planungseffizienz<br />
benötigte SimTejo ein System für die Verarbeitung aller<br />
verfügbaren Informationen und die Bereitstellung von<br />
einfachen und für fachfremde Mitarbeiter verständlichen<br />
Berichten, die an die Bedürfnissen und Kompetenzen der<br />
Nutzer angepasst werden konnten.<br />
SimTejo und Hidro mod, ein Mitglied im Bentley Developer<br />
Network, haben gemeinsam an der Entwicklung<br />
von AQUASAFE gearbeitet und dabei die Bedürfnisse und<br />
Anforderungen von SimTejo in Hinblick auf die integrierte<br />
Verwaltung von Abflussystemen, Abwasseraufbereitungsanlagen<br />
und Abwasserdaten berücksichtigt. AQUASAFE<br />
versorgt SimTejo mit integrierten Modellen und Echtzeitdaten<br />
für eine proaktive Verwaltung, einschließlich der<br />
04-05 / 2013 117
FACHBERICHT PROJEKT KURZ RECHT BELEUCHTET & REGELWERK ABWASSERENTSORGUNG<br />
Bild 3: Von SewerGEMS ermittelte Abwassermengen werden von<br />
AQUASAFE automatisiert<br />
Vorhersage und der kurzfristigen Planung, und ermöglicht<br />
eine vereinfachte Darstellung von Ergebnissen für fachfremdes<br />
Personal und Betriebsmitarbeiter.<br />
AQUASAFE wurde zunächst für ein Pilotsystem in Beirolas,<br />
einem Gebiet im Norden Lissabons mit ungefähr 204.000<br />
Einwohnern, verwendet. Zu diesem System gehörten eine<br />
Abwasseraufbereitungsanlage, acht Pumpstationen und<br />
eine 18 km lange Abwasserhauptleitung.<br />
ECHTZEITDATEN<br />
Mit AQUASAFE wurde die Ausführung der SewerGEMS-<br />
Lösung von Bentley automatisiert und eine Verbindung<br />
zu Echtzeitdaten und Wettervorhersagen hergestellt. Die<br />
SewerGEMS-Lösung, die bereits für die Analyse des Kanalisationssystems,<br />
einschließlich der Einzugsgebiete, sowie für<br />
Offline-Untersuchungen zur Verbesserung der Betriebs- und<br />
Energieeffizienz des Pumpsystems verwendet wurde, ließ<br />
sich mithilfe der WaterObjects.NET-Technologie nahtlos<br />
integrieren.<br />
Das Kanalisationsmodell wird alle 15 Minuten mit <strong>aktuell</strong><br />
gemessenen Niederschlägen und Niederschlagsvorhersagen<br />
unter Verwendung eines operationellen meteorologischen<br />
Prognosemodells ausgeführt (MM5 wird vom Instituto<br />
Superior Técnico bereitgestellt). Auf diese Weise kann die<br />
SewerGEMS-Lösung eine 24-Stunden-Vorhersage von Niederschlagsmengen,<br />
Fließgeschwindigkeiten, Wasserständen<br />
und von Überläufen und Zuflussmengen in Abwasseraufbereitungsanlagen<br />
liefern. Die von SewerGEMS ermittelten<br />
Abflüsse werden in dem vom Instituto Superior Técnico<br />
bereitgestellten MOHID-Modell für Strömungen und<br />
Wasserstände im Mündungsgebiet als Randbedingungen<br />
verwendet.<br />
Darüber hinaus stellt AQUASAFE eine Verbindung zu weiteren<br />
Daten her, die von Niederschlagsmessern, Durchflussmessern,<br />
Pumpstationen, Wasserqualitätsproben sowie Radar- und<br />
Satellitenbildern geliefert werden. Durch eine umfassende<br />
Automatisierung kann das Programm einfach und schnell<br />
integrierte Echtzeitdaten bereitstellen.<br />
CLIENT/SERVER-ARCHITEKTUR<br />
Um den unterschiedlichen Anforderungen der für SimTejo<br />
tätigen Nutzer von der Unternehmensleitung bis hin<br />
zu den Betriebsmitarbeitern gerecht werden zu können,<br />
mussten die generierten Ergebnisse in eine einfache, für<br />
fachfremdes Personal verständliche Form gebracht und<br />
an die unterschiedlichen Kompetenzen und Bedürfnisse<br />
der Nutzer angepasst werden. Hierzu wurde eine Client/<br />
Server-Architektur entwickelt. Ein einziger Server sorgt für<br />
die Bündelung aller Datenquellen und die Verwaltung der<br />
Bild 4: AQUASAFE liefert Ergebnisse in einer übersichtlichen Darstellung<br />
118 04-05 / 2013
www.gwf-gas-erdgas.de<br />
Kanalisationsmodelle. An diesen Server werden mehrere<br />
konfigurierbare Clients angeschlossen, die Daten in Form<br />
von Karten, Tabellen, Graphen, Diagrammen und Warnungen<br />
anzeigen. Alle Datenquellen lassen sich mit nutzerspezifischen<br />
Vorlagen in Excel-Berichten kombinieren.<br />
BEREITSTELLUNG VON MODELLEN FÜR BETREIBER<br />
Nach der Implementierung von AQUASAFE konnte SimTejo<br />
die Hydraulik- und Abwasseraufbereitungsmodelle liefern,<br />
die von Ingenieuren für Betreiber verwendet werden, und<br />
die Verwendung dieser Modelle von Planungsanwendungen<br />
auf Entscheidungsfindungslösungen ausweiten, die in<br />
tagtägliche Abläufe integriert sind. Letztlich unterstützt das<br />
Programm die Mitarbeiter von SimTejo bei der Vermeidung,<br />
Erkennung und Bewältigung unterschiedlicher Situationen.<br />
Dazu gehört der Normalbetrieb ebenso wie Notfälle und<br />
Kundenbeschwerden.<br />
BEOBACHTETE VERBESSERUNGEN<br />
Nach der Einführung des neuen Systems gingen die Funktionsstörungen<br />
in Pumpstationen um 61 % zurück, so dass<br />
pro Jahr 100.000 € an Wartungskosten und 30.000 € an<br />
Strafzahlungen gespart werden konnten. Dank einer verbesserten<br />
Effizienz der 90 Pumpstationen soll das System<br />
zusätzlich eine zweiprozentige Senkung des Energiebedarfs<br />
bringen. 2011 beliefen sich die Energiekosten in den Pumpstationen<br />
auf nahezu 8 Millionen €. SimTejo erwartet weitere<br />
Energieeinsparungen in Höhe von rund 180.000 € bei den<br />
Abwasseraufbereitungsanlagen.<br />
Pedro Povoa, R&D-Projektmanager bei SimTejo, erklärte:<br />
„Das System wurde im Februar 2011 in Betrieb genommen<br />
und liefert den Verwaltungs- und Betriebsteams bei SimTejo<br />
seitdem regelmäßig genaue Vorhersagen.<br />
Bei der Wasserversorgung der Kommunen werden anormale<br />
Zustände an den Durchflussmessern durch einen Vergleich der<br />
gemessenen Mengen mit den modellierten Mengen innerhalb<br />
von max. 15 Minuten erkannt und angezeigt. Genaue Berichte<br />
über Mischwasserüberläufe sowie Mündungswasserabflüsse<br />
für Umweltbehörden können innerhalb von fünf Sekunden<br />
generiert werden. Indem wir den Zusammenbruch von Infrastrukturen<br />
und Überschwemmungen vermeiden, erhöhen<br />
wir die öffentliche Sicherheit und leisten einen Beitrag zum<br />
Schutz von Lissabons Wasserwegen vor Schadstoffen.“<br />
„Weitere Einsparungen wurden durch verbesserte Betriebsund<br />
Wartungsabläufe erreicht, die zu einer Reduzierung der<br />
Mannstunden für Wartungsarbeiten geführt haben“, fuhr<br />
Povoa fort. „Ferner ist der Bedarf an spezialisierten Ingenieuren<br />
für die Ausführung von Modellen und die Integration<br />
von Daten aus unterschiedlichen Quellen zurückgegangen.<br />
Daraus ergaben sich jährliche Einsparungen in Höhe von<br />
120.000 € für die Dienste spezialisierter Ingenieure und<br />
Berater sowie weitere Einsparungen von 200.000 € für die<br />
Integration von Modellen und Datenbanken.“<br />
KONTAKT: www.bentley.com/contact<br />
gwf Gas/Erdgas erscheint in der DIV Deutscher Industrieverlag GmbH, Arnulfstr. 124, 80636 München<br />
Die Fachzeitschrift<br />
für Gasversorgung<br />
und Gaswirtschaft<br />
Jetzt bestellen!<br />
Sichern Sie sich regelmäßig diese führende Publikation.<br />
Lassen Sie sich Antworten geben auf alle Fragen zur<br />
Gewinnung, Erzeugung, Verteilung und Verwendung<br />
von Gas und Erdgas.<br />
Jedes zweite Heft mit Sonderteil R+S - Recht und Steuern<br />
im Gas und Wasserfach.<br />
Wählen Sie einfach das Bezugsangebot, das Ihnen zusagt:<br />
als Heft, ePaper oder Heft + ePaper!<br />
04-05 / 2013 119
FACHBERICHT KORROSIONSSCHUTZ<br />
KKS von Seewasseranlagen<br />
Gegenüberstellung von Fremdstrom- und<br />
galvanischen Systemen<br />
Fachinformation aus<br />
dem Fachverband<br />
Kathodischer<br />
Korrosionsschutz e.V.<br />
Kathodische Korrosionsschutzsysteme sind im Kontext der Langlebigkeit, Werterhaltung und Betriebssicherheit von<br />
Seewasseranlagen, wie Hafenanlagen, Öl- und Gasplattformen, Windkraftanlagen, Schleusen, Brücken, usw. nicht mehr<br />
wegzudenken. Eingesetzt werden zwei prinzipiell verschiedene KKS-Systeme: Fremdstromsysteme und galvanische Systeme.<br />
Dabei muss im Rahmen der Planung des Korrosionsschutzkonzeptes natürlich auf Grundlage von Technik, Betriebssicherheit,<br />
Investitionskosten, Reinvestitionskosten und Betriebskosten die für diese Aufgabe und geplante Lebensdauer beste Lösung<br />
gefunden werden. Der Bericht stellt beide Systeme in Technik und Wirtschaftlichkeit gegenüber und soll wesentliche<br />
Parameter aufzeigen, die zur Entscheidung des auszuführenden Systems nützlich sind.<br />
KATHODISCHE KORROSIONSSCHUTZSYSTEME<br />
Der für den Kathodischen Korrosionsschutz benötigte<br />
Schutzstrom wird durch kathodische Korrosionsschutzanlagen<br />
geliefert und möglichst gleichmäßig über das Bauwerk<br />
verteilt. Dabei ist es unerheblich, auf welche Weise er<br />
erzeugt wird. Er kann dem Wechselstromnetz entnommen<br />
(Fremdstromanlagen) oder galvanisch erzeugt werden (Anlagen<br />
mit galvanischen Anoden, so genannten Opferanoden).<br />
Im Folgenden werden beide Systeme kurz beschrieben.<br />
Fremdstromsystem<br />
Das Wechselstromnetz liefert einer Kathodischen Schutzanlage<br />
mit Fremdstrom die benötigten Elektronen (siehe<br />
Bild 1). Dabei ist es erforderlich die Netzspannung mit<br />
Hilfe eines Schutzstromgeräts auf eine niedrige Gleichspannung<br />
von ≤ 50 Volt DC umzuwandeln. Am Minuspol des<br />
Schutzstromgeräts stehen dann die benötigten Elektronen<br />
zur Verfügung und werden von da aus in das Bauwerk<br />
geleitet. Das entspricht der technischen Stromrichtung aus<br />
dem Elektrolyten in das Bauwerk.<br />
In technischer Stromrichtung muss dem Elektrolyten aus dem<br />
Pluspol zudem Gleichstrom zugeführt werden. Das geschieht<br />
über metallisch leitende Elektroden, die als Fremdstromanoden<br />
bezeichnet werden und in den Elektrolyten eintauchen.<br />
Galvanisches Korrosionsschutzsystem<br />
Durch die leitende Verbindung von Metallen mit unterschiedlichen<br />
elektrochemischen Eigenschaften im Elektrolyten<br />
kann, ähnlich einer Taschenlampenbatterie, ein<br />
Stromfluss aufgrund des Potentialunterschiedes erzeugt<br />
werden. Dabei wird das unedlere Metall zur Anode und<br />
löst sich unter Elektronenlieferung auf:<br />
Me o → Me z+ + z ⋅ e -<br />
Die frei werdenden Elektronen fließen über die elektrisch<br />
leitende Verbindung in das edlere Metall, d. h. in das Bauwerk<br />
(siehe Bild 2).<br />
Das in dieser galvanischen Kette edlere Metall gibt, unter<br />
gleichen elektrolytischen Bedingungen, wesentlich weniger<br />
Elektronen ab als das unedlere Metall und wird zur Kathode.<br />
Dabei übernimmt es den für seinen kathodischen Schutz<br />
erforderlichen Überschuss an Elektronen. Das zu schützende<br />
Bauwerk wird gezielt zur Kathode gemacht und die<br />
Korrosion wird auf die (austauschbare) Anode verlagert.<br />
Als unedlere Reaktionspartner für Eisen und niedriglegierte<br />
Stähle (Baustähle) können Zink (Zn), Aluminium (Al) und<br />
Magnesium (Mg) verwendet werden.<br />
Technische Vor- und Nachteile beider<br />
Schutzsysteme<br />
Obwohl die kathodische Schutzwirkung auf den gleichen<br />
elektrochemischen Vorgängen beruht und grundsätzlich<br />
sowohl mit galvanischen Anoden als auch mit Fremdstrom<br />
gleich gut erzielt werden kann, sind einige charakteristische<br />
Eigenarten und Unterschiede zu berücksichtigen:<br />
a) Fremdstromanlagen<br />
»»<br />
Anodenspannung stufenlos einstellbar, damit Schutzstrom<br />
und Potential regulierbar<br />
»»<br />
Ein- und Ausschaltpotentiale messbar, genauere Messung<br />
des Schutzzustandes<br />
»»<br />
Generell wesentlich größere Schutzströme möglich<br />
»»<br />
Kann durch einen breiten Einstellbereich auch bei großem<br />
Strombedarf durch Beschichtungsalterung und<br />
-fehlern die Anlage wirksam schützen<br />
»»<br />
Verschiedene Schutzbereiche können separat geregelt<br />
werden<br />
»»<br />
Automatische Regelung ermöglicht eine optimale<br />
Anpassung an veränderte Betriebsbedingungen, wie<br />
z.B. Tide<br />
»»<br />
Meist höhere Lebensdauer der Anoden möglich<br />
»»<br />
Wegen größerer Stromabgabe pro Anode sind viel geringere<br />
Anzahl von Anoden notwendig<br />
»»<br />
Externe Stromversorgung notwendig<br />
b) Anlagen mit galvanischen Anoden<br />
»»<br />
Durch geringe Treibspannung und dadurch begrenzte<br />
Stromabgabe nur für Flächen mit relativ geringem<br />
Schutzstrombedarf wirtschaftlich einsetzbar<br />
»»<br />
Werden meist direkt mit dem Bauwerk durch Schweißoder<br />
Schraubverbindungen unter Wasser befestigt<br />
120 04-05 / 2013
KORROSIONSSCHUTZ FACHBERICHT<br />
» Durch permanenten Kontakt können keine Ausschaltpotentiale<br />
gemessen werden<br />
» Schwankungen der Umgebungsbedingungen (Leitfähigkeit<br />
des Wassers, Temperaturschwankungen) können<br />
nicht ausgeglichen werden. Dadurch evtl. temporärer<br />
Unterschutz oder Überschutz (bei Magnesiumanoden)<br />
» Schichtbildung oder Passivierung der Anodenoberfläche<br />
können die Funktion beeinträchtigen<br />
» Keine externe Stromversorgung notwendig<br />
BESCHICHTUNG ALS FAKTOR FÜR DAS KKS-SYSTEM<br />
Der Schutz von Stahlwasserbauteilen mit einer Beschichtung,<br />
die die Metalloberflächen von dem Elektrolyten<br />
trennt, wird als passiver Korrosionsschutz bezeichnet.<br />
Da eine Beschichtung den kathodischen Schutzstrombedarf<br />
vermindert und die Stromverteilung am Schutzobjekt<br />
verbessert, ist eine Kombination von kathodischem Schutz<br />
und Beschichtung des Schutzobjektes sinnvoll.<br />
Die Kombination von kathodischem Schutz mit Beschichtungen<br />
bietet den Vorteil, dass einerseits an den unvermeidlichen<br />
Fehlstellen und an nachträglichen Verletzungen durch Überlagerung<br />
mit Schutzstrom die Korrosionsschäden unterbunden<br />
werden. Andererseits ist der insgesamt benötigte Schutzstrom<br />
bedeutend geringer als bei blanken Flächen. Es ist jedoch<br />
darauf zu achten, dass das gewählte Beschichtungssystem für<br />
den Einsatz eines KKS-Systems geeignet sein muss. 1<br />
Die Beschichtung, insbesondere die durch die Alterung der<br />
Beschichtung hervorgerufenen Veränderung der benötigten<br />
Schutzstromdichte zum Erhalt des Schutzpotentials, ist ein<br />
wichtiger Parameter bei der Auslegung und Lebensdauerberechnung<br />
von benötigten KKS-Anlagen.<br />
Generell ist zu sagen, dass der Schutzstrombedarf bei<br />
guter Beschichtung sehr viel geringer ist als bei alter oder<br />
beschädigter Beschichtung, wodurch auch die Belastung der<br />
KKS-Komponenten wie Anoden mit der Zeit ansteigt oder<br />
eventuell sogar die Dimensionierung der Komponenten zur<br />
Aufrechterhaltung des kathodischen Schutzes nicht mehr<br />
ausreichend ist. Dieser Umstand ist daher bei der Planung<br />
und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu berücksichtigen!<br />
Zur Bewertung des Alters auf die Wirkung der Beschichtung<br />
gibt es einige Normen und Empfehlungen, von denen hier<br />
zwei beschrieben werden:<br />
Bewertung des Alters auf die Wirkung der<br />
Beschichtung<br />
a) Nach DIN EN 13174:2001<br />
DIN EN 13174:2001 sagt zur Beschichtungsalterung<br />
(Beschichtungsreduktion) im Anhang A.3 „Werte von<br />
Beschichtungsreduktionsfaktoren üblicher Anstrichsysteme<br />
beim Entwurf von kathodischen Korrosionsschutzsystemen“:<br />
» Anfängliche Beschichtungsreduktion: 1 % bis 2 % in<br />
ein getauchten Bereichen, 25 % bis 50 % in erdbedeckten<br />
Bereichen<br />
1 Eine Auswahl der zugelassenen Systeme und geprüften Beschichtungssysteme<br />
der BAW ist unter der Adresse http://www.baw.de/de/die_baw/<br />
publikationen/qualitaetsbewertung/ zu finden.<br />
» Abnahmerate: 1 % bis 3 % pro Jahr<br />
» ANMERKUNG: Gebräuchliche Beschichtungssysteme<br />
beinhalten mindestens zwei Schichten einer bei Umgebungstemperatur<br />
ausgehärteten Beschichtung (Kohlenteer-Epoxid,<br />
Epoxid usw.) mit Trockenschichtdicken<br />
zwischen 250 und 500 µm.<br />
Die Anmerkung ist m.E. sehr vage formuliert, da insbesondere<br />
die Abnahmerate eine Bandbreite von 300 % (1 %<br />
bis 3 % pro Jahr) zulässt!<br />
Dieser Ansatz führt bei einer Worst-Case-Betrachtung zu<br />
einem angenommenen kompletten Ausfall der Beschichtungsfunktion<br />
nach nur ca. 33 Jahren!<br />
Zudem wird keine direkte Unterscheidung zwischen verschiedenen<br />
Beschichtungsklassen gemacht. Die Entscheidung<br />
welcher Reduktionsfaktor als Grundlage der Auslegung<br />
des Korrosionsschutzsystems genommen wird, ist<br />
damit abhängig von der Position des Betrachters.<br />
Bild 1:<br />
Fremdstrom<br />
Schutzanlage<br />
Bild 2:<br />
Funktionsweise<br />
einer galvanischen<br />
Schutzanlage<br />
04-05 / 2013 121
FACHBERICHT KORROSIONSSCHUTZ<br />
Tabelle 1: Beschichtungskonstanten<br />
Depth [m]<br />
Recommended a and b values for Coating Categories I, II and III 1<br />
I (a = 0.10) II (a = 0.05) III (a = 0.02)<br />
0 - 30 b = 0.10 b = 0.025 b = 0.012<br />
> 30 b = 0.05 b = 0.015 b = 0.008<br />
1<br />
Category I: One layer of epoxy paint coating, min. 20 μm nominal DFT<br />
Category II: One or more layers of marine paint coating (epoxy, polyurethane or<br />
vinyl based), total nominal DFT min. 250 μm<br />
Category III: Two or more layers of marine paint coating (epoxy, polyurethane or<br />
vinyl based), total nominal DFT min. 350 μm<br />
Bild 3: Beschichtungsfaktoren nach Alter (Jahren)<br />
Bild 4: Schematische Ansicht einer Beispiel-KKS-Anlage<br />
b) Nach DNV-RP-B401:2007<br />
Eine weitere Möglichkeit, die Alterung von Beschichtungen<br />
für die Auslegung und Berechnung von Korrosionsschutzsystemen<br />
greifbar zu machen, bietet die DNV in ihrer Norm<br />
DNV-RP-B401:2007.<br />
Der dort beschriebene Ansatz des Reduktionsfaktors (Coating<br />
Breakdown Factor), der die Wirksamkeit der Beschichtung<br />
beschreibt (f c<br />
= 0 für perfekte Beschichtung, f c<br />
= 1 für<br />
keine wirksame Beschichtung) bietet eine Möglichkeit der<br />
Berechnung der Beschichtungseinflüsse auf den Schutzstrombedarf<br />
in Abhängigkeit der Lebensdauer. Dabei stellt<br />
der Faktor f c<br />
den <strong>aktuell</strong>en Reduktionsfaktor zur Bestimmung<br />
des <strong>aktuell</strong>en Schutzstrombedarfs dar und der Faktor<br />
f cm<br />
den zur Auslegung von Anodenmasse zu bestimmenden<br />
mittleren Schutzstrombedarf. Die Konstante a ist abhängig<br />
von der Art und Dicke der Beschichtung und die Konstante<br />
b zudem noch von der Eintauchtiefe (Tabelle 1):<br />
» Coating Breakdown Factor: f c<br />
= a + b ⋅ t<br />
» Mittlerer Coating Breakdown Factor: f cm<br />
= a + b ⋅ t/2<br />
Bild 3 zeigt die entsprechenden Abhängigkeiten der Reduktionsfaktoren<br />
von Alter und Beschichtungsart. Interessant<br />
ist, dass Beschichtungskategorie II nach dieser Norm nach<br />
ca. 37 Jahren keine Funktion mehr gewährt (f c<br />
= 1), während<br />
bei Kategorie III dieser Zustand erst nach ca. 81 Jahren eintritt.<br />
Man erkennt deutlich den Einfluss der Beschichtungsgüte<br />
auf die Lebensdauer der Beschichtung und damit auf<br />
die Auslegung der notwendigen KKS-Systeme.<br />
BEISPIELRECHNUNG FÜR EINE SPUNDWAND<br />
Kathodisches Korrosionsschutzsystem<br />
Die folgende Beispielrechnung eines Kathodischen Korrosionsschutzsystems<br />
für die Seeseite einer Spundwandkonstruktion<br />
soll exemplarisch einige wesentliche Parameter<br />
zur Gesamtkostenbetrachtung bei der Gegenüberstellung<br />
von galvanischen und Fremdstromsystemen aufzeigen. Die<br />
genannten Werte entstammen Erfahrungswerten aus realen<br />
Anlagen. Es muss jedoch erwähnt werden, dass die<br />
genannten Werte je nach Ort, Betreiber und technischen<br />
Anforderungen variieren können und sicherlich nicht für<br />
alle Spundwandprojekte 1:1 übertragen werden können.<br />
Für die Beispielrechnung werden folgende Basisdaten<br />
zugrunde gelegt:<br />
» Spundwandlänge: 200 m<br />
» Spundwandfaktor: 1,5<br />
» Rammtiefe: 15 m<br />
» Wassertiefe: 10 m<br />
» Beschichtung (wasserseitig): 2-lagige Beschichtung,<br />
400 µm Gesamtdicke<br />
» Ort: Nordsee<br />
» Temperatur: 7 °C - 11 °C<br />
» Lebensdauer: 80 Jahre<br />
Bild 4 zeigt die schematische Ansicht der<br />
Beispiel -KKS-Anlage.<br />
Nach DNV-RP-B401 (Table 10-1 und Table 10-2) ergeben<br />
sich für das beschriebene Beispiel für blanken Stahl folgende<br />
Werte für die spezifischen Schutzstromdichten:<br />
» Polarisationsstromdichte (Anfang): 200 mA/m 2<br />
» Polarisationsstromdichte (Ende): 130 mA/m 2<br />
» Mittlere Stromdichte: 100 mA/m 2<br />
Aus der Stromberechnung für die Spundwand ergibt sich ein<br />
Gesamtstrombedarf von 480 A für blanke Stahloberfläche<br />
(nach 80 Jahren). Dieser Wert dient als Grundlage der Dimensionierung<br />
der Komponenten für die Fremdstromanlage und<br />
die Berechnung der benötigten Anodenmassen, -größen und<br />
122 04-05 / 2013
KORROSIONSSCHUTZ FACHBERICHT<br />
-anzahl für die galvanischen Anoden. Es ergeben sich für das<br />
vorliegende Beispiel folgende Hauptkomponenten:<br />
» drei SSG je 12 V/160 A mit jeweils 25<br />
Anodenanschlüssen<br />
» 75 Anoden<br />
» sechs Referenzelektroden<br />
Galvanisches Korrosionsschutzsystem<br />
Eine Übersicht der benötigten galvanischen Anoden für das<br />
oben beschriebene Beispiel über die Lebensdauer von 80<br />
Jahren gibt Tabelle 2. Dabei fällt auf, dass nach Verbrauch<br />
der galvanischen Anoden nach 30 Jahren sich die Anzahl für<br />
die nächsten 30 Jahre von 150 Stück auf 250 Stück erhöht, da<br />
die Beschichtungsreduktionsfaktoren nach 30 bis 60 Jahren<br />
deutlich größer sind als in den ersten 30 Jahren und sich<br />
damit auch der Schutzstrombedarf (sowohl mittlerer Schutzstrom<br />
als auch absoluter Schutzstrom der von den Anoden in<br />
diesem Zeitraum abgegeben werden muss) deutlich erhöht.<br />
Für die restlichen 20 Jahre reicht es dann die 250 Anoden<br />
noch einmal in gleicher Anzahl auszutauschen, da zwar die<br />
absoluten Ströme noch einmal ansteigen, aber der Masseverlust<br />
der Anoden nur für 20 Jahre berücksichtigt werden muss.<br />
Kostenvergleich<br />
In Tabelle 3 sind die Investitionskosten beider Varianten<br />
dargestellt. Dabei ist von Investitionskosten (Material +<br />
Montage) einer Aluminiumanode von 1.150,00 Euro ausgegangen<br />
worden.<br />
Für die Reinvestitionskosten nach jeweils 30 Jahren wurden bei<br />
den galvanischen Anoden (nur) die gleichen Investitionskosten<br />
wie bei der Neuinstallation berechnet und beim Fremdstromsystem<br />
der Austausch von 75 Fremdstromanoden (ohne Taucher,<br />
Austausch durch Elektriker an der Kaje ohne großen Installationsaufwand)<br />
mit pauschal 35.000,00 Euro veranschlagt.<br />
Für die Unterhalts-, Reparatur- und Stromkosten (Betriebskosten)<br />
sind folgende Werte als Berechnungsgrundlage<br />
genommen worden:<br />
» Unterhalt: 10.000,- € (Fremdstrom) bzw. 10.000,- €<br />
(Galv. Anoden)<br />
» Reparatur (1 % Anodenkosten pro Jahr): 500,- € (Fremdstrom)<br />
bzw. 1.725,- € (Galv. Anoden)<br />
» Stromkosten (angenommener Strompreis: 0,15 €/kWh):<br />
abhängig vom Strombedarf und dies wiederum vom<br />
Alter (Fremdstrom) bzw. 0,00 € (Galv. Anoden)<br />
Die daraus resultierenden Kostenvergleiche beider Systeme<br />
über die gesamte Lebensdauer von 80 Jahren sind in den<br />
folgenden Bildern graphisch dargestellt. Dabei stellt Bild 5 die<br />
Energiekosten pro Jahr und die akkumulierten Energiekosten<br />
des Fremdstomsystems dar, die sich über 80 Jahre auf ca.<br />
250.000 € belaufen. Bild 6 zeigt die Betriebskosten (Unterhaltskosten)<br />
der Fremdtrom- und Galvanischen KKS-Anlage.<br />
Dabei beträgt die Differenz in diesem Beispiel ca. 230.000 €<br />
nach 80 Betriebsjahren. Bild 7 zeigt die Gesamtkosten eines<br />
Fremdstromsystems über die Betriebsjahre inklusive Investitions-<br />
und Reinvestitionskosten und endet bei ca. 1.400.000<br />
€ nach 80 Jahren. Bild 8 zeigt die Gesamtkosten eines Galva-<br />
Tabelle 2: Übersicht Galvanische Anoden für 80 Jahre<br />
Fläche [m 2 ] 0-30 Jahre 30-60 Jahre 60-80 Jahre<br />
30 60 80<br />
f cm<br />
0,200 0,480 0,740<br />
f cf<br />
0,380 0,740 0,980<br />
a m<br />
[mA/m 2 ] 0,020 0,048 0,074<br />
a f<br />
[mA/m 2 ] 0,049 0,096 0,127<br />
I w m<br />
[A] (Wasser) 3000 60 144 222<br />
I w f<br />
[A] (Wasser) 3000 148,2 288,6 382,2<br />
I g<br />
[A] (Grund) 4500 90 90 90<br />
Anodenzahl (à 167 kg) 150 250 250<br />
f cm<br />
: Mittlere Coating Breakdown Faktor; f cf<br />
: Finaler Coating Breakdown Faktor;<br />
a m<br />
: Mittlere spez. Schutzstromdichte; a f<br />
: Finale spez. Schutzstromdichte; I w m<br />
:<br />
Mittlerer Schutzstrom Wasser; I w f<br />
: Finaler Schutzstrom Wasser; I g<br />
: Schutzstrom Grund<br />
Tabelle 3: Investitionskostenübersicht<br />
Fremdstromsystem Galvanisches System<br />
Anzahl Einzelpreis Gesamt<br />
Anfangsinvestitionen 225.000 € 150 1.150 € 172.500 €<br />
Nach 30 Jahren 35.000 € 250 1.150 € 287.500 €<br />
Nach 60 Jahren 35.000 € 1.150 € 287.500 €<br />
Summe 295.000 € 747.500 €<br />
Bild 5: Energiekosten Fremdstromsystem<br />
Bild 6: Betriebskostenvergleich Fremdstrom / Galvanisch<br />
04-05 / 2013 123
FACHBERICHT KORROSIONSSCHUTZ<br />
Bild 7: Gesamtkosten Fremdstromsystem<br />
Bild 8: Gesamtkosten Galvanisches System<br />
nischen Systems über die Betriebsjahre inklusive Investitionsund<br />
Reinvestitionskosten und endet bei ca. 1.700.000 € nach<br />
80 Jahren. Bild 9 zeigt, dass die Kosten für ein Galvanisches<br />
System zum Zeitpunkt der Installation bei einer guten Beschichtung<br />
(CIII) in diesem Fall geringer sind als die eines Fremdstromsystems<br />
(ca. 52.000 €). Dieser Kostenvorteil ändert sich<br />
jedoch nach 30 Jahren, wenn die Anoden ausgetauscht (und<br />
bei den Galvanischen sogar ergänzt werden müssen) erheblich.<br />
Dann ergibt sich ein Vorteil von ca. 200.000 € zugunsten des<br />
Fremdstromsystems und sogar von 380.000 € nach weiteren<br />
30 Jahren. Es ist weiterhin erkennbar, dass die Energiekosten<br />
in Form von Stromkosten nur unwesentlichen Einfluss in der<br />
Gesamtkostenbetrachtung haben. Dieses Szenario ist noch<br />
ausgeprägter, wenn die Beschichtung von der Qualität geringer<br />
ist als im Beispiel angenommen (CII anstelle CIII), dann ergibt<br />
sich, wie in Bild 10 dargestellt, eine noch größere Differenz<br />
beider Systeme (ca. 1.100.000 €).<br />
In allen Kostenbetrachtungen sind keine Inflations- oder Zinsfaktoren<br />
mit eingerechnet, die natürlich die absoluten Werte<br />
in der Zukunft beeinflussen können. Die Tendenzen bei der<br />
Gegenüberstellung für das konkrete Beispiel bleiben aber<br />
auch ohne die Einbeziehung dieser Faktoren erhalten, weshalb<br />
auf diese wirtschaftsmathematische Betrachtung bewusst<br />
verzichtet wurde.<br />
UMWELTASPEKTE<br />
Elektrochemische Korrosion verursacht durch die anodische<br />
Auflösung von Metall einen Eintrag von Metallionen<br />
in das Seewasser. Beim Kathodischen Korrosionsschutz<br />
reagiert bestenfalls nicht mehr der Stahl anodisch, sondern<br />
die eingebrachten Anoden, Fremdstrom- oder galvanische<br />
Anoden. Das bedeutet jedoch auch, dass vor allem bei dem<br />
Einsatz von galvanischen Anoden, die ja gerade die freien<br />
Elektronen durch die anodische Reaktion und die damit<br />
verbundene Materialauflösung liefern, eine zusätzliche<br />
Belastung der Umgebung mit (Schwer-)Metallen darstellt.<br />
Tabelle 4 zeigt exemplarisch die aufgelöste Gesamtanodenmasse<br />
und die Anteile an Zink bzw. Indium bei Nutzung<br />
einer typischen Anodenzusammensetzung für die obige<br />
Beispielrechnung.<br />
Zinkverbindungen gehören zu den toxischen Verbindungen<br />
und Indium zu den seltenen Erden, deren Vorrat und<br />
Kapazität weltweit begrenzt ist und deren Wirkung auf die<br />
Umwelt noch nicht ausreichend erforscht ist. Bei immer<br />
mehr Offshore-Installationen (z.B. Windparks) ist davon<br />
auszugehen, dass in Zukunft im Rahmen der Genehmigungsverfahren<br />
auch auf diese umweltrelevanten Aspekte<br />
eingegangen wird.<br />
Tabelle 4: Umweltbelastung durch Anodenmetalle<br />
Jahre<br />
Anzahl<br />
Masse<br />
[kg]<br />
Gesamtmasse<br />
[kg]<br />
Rest [%]<br />
Verbrauchte<br />
Masse [kg]<br />
Anteil<br />
Zink [%]<br />
Masse<br />
Zink [kg]<br />
Anteil<br />
Indium [%]<br />
Masse<br />
Indium [kg]<br />
0-30 150 167 25.050 15,7 21.117 5,75 1.214 0,04 8,4<br />
30-60 250 167 41.750 16,9 34.694 5,75 1.995 0,04 13,9<br />
60-80 250 167 41.750 21,9 32.607 5,75 1.875 0,04 13,0<br />
Summe 88.418 5.084 35,4<br />
124 04-05 / 2013
KORROSIONSSCHUTZ FACHBERICHT<br />
Bild 9: Gesamtkostenübersicht Fremdstrom / Galvanisch für<br />
Beschichtungstyp CIII<br />
Bild 10: Gesamtkostenübersicht Fremdstrom / Galvanisch für<br />
Beschichtungstyp CI<br />
FAZIT<br />
Für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung verschiedener KKS-<br />
Systeme sind die geplante Lebensdauer, die Art und Güte<br />
der Beschichtung, die erwarteten Betriebs- und Wartungskosten,<br />
sowie notwendige Reinvestitionskosten maßgeblich.<br />
Die Energiekosten haben nur eine untergeordnete Bedeutung<br />
bei der Gesamtkostenbetrachtung von Fremdstromsystemen,<br />
sind jedoch sehr von dem tatsächlichen Schutzstrombedarf<br />
und damit von dem Beschichtungszustand<br />
und der Beschichtungsalterung abhängig. Dabei sind die<br />
Stromkosten gerade nach der Installation bei sehr gutem<br />
Beschichtungszustand vergleichsweise sehr gering.<br />
Ein in der Anschaffung „günstigeres“ System kann in der<br />
Gesamtlebensdauerbetrachtung deutlich teurer werden.<br />
Die Kostengegenüberstellung ist wesentlich abhängig von<br />
der Beschichtungsgüte. Galvanische Systeme sind sehr kostenintensiv<br />
bei schlechter oder keiner Beschichtung und<br />
langer geplanter Objektlebensdauer.<br />
In der Betrachtung von Umweltaspekten und -einflüssen<br />
darf auch die (Schwer-)Metallemission nicht außer Acht<br />
gelassen werden (Haftung für noch wenig bekannte Langzeiteinflüsse<br />
und -schäden).<br />
In der heutigen Zeit wird häufig die Entscheidung welche<br />
Anlage eingesetzt wird primär von den Investitionskosten<br />
abhängig gemacht. Es erscheint jedoch als sehr sinnvoll,<br />
gerade bei längeren geplanten Lebensdauern, oder<br />
bei Anlagen, bei denen ein Weiterbetrieb auch über die<br />
geplante Lebensdauer wahrscheinlich ist, eine detaillierte<br />
Gesamtkostenbetrachtung anzustellen, um die insgesamt<br />
preisgünstigste Lösung, die nur selten die „billigste“ Lösung<br />
zum Installationszeitpunkt ist, bestimmen zu können.<br />
LITERATUR<br />
[1] HTG: Kathodischer Korrosionsschutz im Wasserbau, 3. Auflage 2009<br />
[2] DIN EN 13174:2001 „Kathodischer Korrosionsschutz für<br />
Hafenbauten“<br />
[3] DNV-RP-B401:2007 „Cathodic Protection Design“<br />
[4] GCP: Korrosion und Korrosionsschutz von Seewasserbauwerken, 2007<br />
AUTOR<br />
Dipl.-Ing. TORSTEN KREBS<br />
GCP German Cathodic Protection GmbH &<br />
Co.KG, Essen<br />
Tel. +49 201 615187-0<br />
E-Mail: krebs@gcp.de<br />
Besuchen Sie uns im Internet:<br />
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
04-05 / 2013 125
FACHBERICHT RECHT KORROSIONSSCHUTZ<br />
& REGELWERK<br />
Fachinformation aus<br />
dem Fachverband<br />
Kathodischer<br />
Korrosionsschutz e.V.<br />
Anforderungen an einen Kandidaten<br />
nach DIN EN 15257 Grad 3, Personenzertifizierung<br />
Seit einiger Zeit ist eine Diskussion über den in DIN EN 15257 (KKS-Personenzertifizierung) definierten Experten nach<br />
Grad 3 entbrannt. Diese Diskussion hat einen nennenswerten Informationsbedarf im Kreise der interessierten Öffentlichkeit<br />
offenbart, dem mit diesem Artikel Rechnung getragen werden soll.<br />
EINLEITUNG<br />
Die Zertifizierungsprüfung für die im März 2007 in Deutschland<br />
erschienene DIN EN 15257 „Kathodischer Korrosionsschutz<br />
– Qualifikationsgrade und Zertifizierung von für den<br />
kathodischen Korrosionsschutz geschultem Personal“ [1]<br />
wird in Deutschland in einem akkreditierten Verfahren von<br />
der fkks cert gmbh mit Sitz in Esslingen angeboten. Außer<br />
in Deutschland wird eine Zertifizierung nach dieser Norm<br />
im Rahmen eines akkreditierten Verfahrens nur noch in der<br />
Schweiz angeboten.<br />
Die bisher durchgeführten Zertifizierungsprüfungen bezogen<br />
sich vor allem auf die Grade 1 und 2. Seit einiger Zeit<br />
zeichnet sich jedoch ab, dass im Hinblick auf die Definition<br />
des in o.g. Norm ebenfalls definierten Grad 3-Experten ein<br />
erheblicher Mangel an Informationen vor allem im Hinblick<br />
auf die diesbezügliche Intention des Regelwerks und auf die<br />
genaue Abgrenzung zwischen Grad 2 und Grad 3 besteht.<br />
Diese Veröffentlichung soll dazu dienen, hier Klarheit zu<br />
schaffen.<br />
ANFORDERUNGEN AN EINEN<br />
GRAD-3-EXPERTEN<br />
Setzt man die grundsätzlichen Anforderungen, die ein<br />
Grad-3-Experte erfüllen muss, in Beziehung zu den<br />
grundsätzlichen Anforderungen, deren Erfüllung von<br />
Personal nach Grad 2 verlangt wird, so ergibt sich ein<br />
Bild gemäß Tabelle 1:<br />
Darüber hinaus muss gem. der Norm Personal nach Grad 2<br />
bzw. ein Grad-3 Fähigkeiten aufweisen, wie sie in Tabelle 2<br />
dargestellt sind.<br />
Tabelle 1: Zusammenfassung grundsätzliche Anforderungen an Grad 2 und 3<br />
Grad 2 Grad 3<br />
Allgemeine Grundlagen der Korrosion und des KKS sowie<br />
die Bedeutung von Beschichtungen und deren Einfluss auf<br />
den KKS<br />
Grundlagen der Elektrik<br />
Detaillierte Kenntnisse der KKS-Prüfverfahren und<br />
Sicherheitsmaßnahmen<br />
Industrieerfahrung:<br />
» Spezialausbildung auf dem Fachgebiet Korrosion +<br />
2 Jahre Erfahrung im KKS oder<br />
» technische Ausbildung + 3 Jahre Erfahrung auf dem<br />
Gebiet des KKS oder<br />
» 4 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet des KKS<br />
Detaillierte Kenntnisse der Grundlagen der Korrosion und ausreichende<br />
theoretische Kenntnisse und praktische Erfahrungen zum KKS.<br />
Grundlagen der Elektrik<br />
Grundlagen der KKS-Planung, Installation, Inbetriebnahme, Prüfung<br />
und Wirksamkeitsüberprüfung inklusive Sicherheit in mindestens einem<br />
Anwendungsbereich<br />
Fähigkeit zur Durchführung der Planung von KKS-Systemen in mindestens<br />
einem Anwendungsbereich ohne Aufsicht<br />
Fähigkeit zur Auswahl von KKS-Prüfverfahren und Prüfkriterien im Hinblick<br />
auf den Nachweis der Wirksamkeit des KKS .<br />
Qualifikation zur Auswertung und Interpretation der Ergebnisse im Hinblick<br />
auf die Wirksamkeit des KKS entsprechend bestehender Regeln, Normen<br />
und Festlegungen<br />
Qualifikation, um bei der Errichtung von Prüf- und Funktionskriterien zu<br />
unterstützen<br />
Allgemeines Vertrautsein mit dem KKS in anderen Anwendungsbereichen<br />
Industrieerfahrung:<br />
» Spezialausbildung auf dem Fachgebiet Korrosion + mind. 3 Jahre Erfahrung<br />
im KKS oder<br />
» technische Ausbildung + mindestens 5 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet<br />
des KKS oder<br />
» mindestens 8 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet des KKS<br />
126 04-05 / 2013
RECHT KORROSIONSSCHUTZ & REGELWERK FACHBERICHT<br />
Tabelle 2: Fähigkeiten gem. DIN EN 15257 für Grad 2 und 3<br />
Grad 2 Grad 3<br />
Ausführung von KKS-Planungen unter Anleitung eines Grad-3-Experten,<br />
einfache Planungen können auch ohne Anleitung durchge-<br />
Planung des KKS-Systems<br />
führt werden<br />
Definieren der Anwendungsgrenzen des Prüfverfahrens im Rahmen<br />
bestehender Abläufe<br />
Auswählen der für den gewählten Fall geeigneten KKS-Mess- und<br />
Prüfverfahren<br />
Interpretieren und Auswerten der Ergebnisse nach zutreffenden<br />
Normen, Regeln oder Festlegungen<br />
Festlegen von routinemäßigen Mängelbeseitigungsmaßnahmen<br />
Durchführen und Beaufsichtigen aller Grad-1-Tätigkeiten<br />
Erstellen und Überprüfen von KKS-Prüfabläufen<br />
Festlegen der einzelnen zu verwendenden KKS-Prüfverfahren<br />
Interpretieren der Normen, Regeln, Festlegungen und Abläufe<br />
Interpretieren von berichteten Ergebnissen der KKS-Prüfung und<br />
Verwendung dieser Ergebnisse zur Funktionsüberprüfung<br />
Festlegung jeglicher Reparaturmaßnahmen<br />
Durchführen und Beaufsichtigen aller Grad-1- und<br />
Grad-2-Tätigkeiten<br />
Übernehmen der vollen technischen Verantwortung für ein Weiterbildungs-<br />
und Prüfungszentrum und dessen Personal<br />
Nutzen von gesammelter Erfahrung für die Entwicklung von<br />
Neuerungen für die KKS-Planung, die Wirksamkeitsprüfung und<br />
Wartungsverfahren<br />
UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEN ANFORDERUNGEN<br />
NACH GRAD 3 UND GRAD 2<br />
Oberflächlich betrachtet scheinen die Anforderungen nach<br />
Grad 3 nur eine Steigerung der Anforderungen nach Grad 2<br />
zu sein. Ob diese erste Einschätzung einer fundierteren<br />
Beurteilung standhält, soll in den folgenden Abschnitten<br />
untersucht werden.<br />
Grundlagen der Korrosion und des KKS<br />
Im Unterschied zum Grad 2, der nur allgemeine Kenntnisse<br />
der Grundlagen der Korrosion und des KKS auf-weisen<br />
muss, werden vom Grad-3-Experten detaillierte Kenntnisse<br />
der Korrosion und ausreichende theoretische Kenntnisse<br />
zum KKS gefordert. Dies ist eine ungleich höhere<br />
Anforderung, da hierfür eine fundierte wissenschaftliche<br />
Durchdringung der chemischen und elektrochemischen<br />
Grundlagen von Korrosionsvor-gängen und der Funktionsweise<br />
des KKS und damit auch eine entsprechende<br />
Anwendung von Methoden der höheren Mathematik<br />
vorausgesetzt werden.<br />
Durchführung von KKS-Planungen<br />
Im Unterschied zum Grad 2, der ohne Aufsicht eines Grad 3<br />
nur einfache KKS-Planungen durchführen kann, muss ein<br />
Grad 3 in der Lage sein, zumindest in einem Anwendungsbereich<br />
KKS-Planungen grundsätzlich ohne Aufsicht durchführen<br />
zu können.<br />
Umfang des Wissens auf dem Gebiet des KKS<br />
Im Unterschied zum Grad 2 wird vom Grad 3 ein allgemeines<br />
Vertrautsein mit dem KKS anderer Anwendungsbereichen<br />
verlangt. Gemeint ist damit, dass der Grad 3 auf jeden<br />
Fall die Grundlagen des KKS aus anderen Anwendungsbereichen<br />
kennen muss.<br />
Wissensvermittlung<br />
Mit der Forderung, dass der Grad 3 in der Lage sein soll,<br />
die technische Verantwortung für ein Weiterbildungsund<br />
Prüfzentrum sowie dessen Personal zu übernehmen,<br />
wird definitiv Neuland betreten. Dies impliziert zum einen<br />
umfassende Erfahrung im Bereich der Wissensvermittlung<br />
an Dritte (Lehrgangsleitung, Vorträge, Veröffentlichung<br />
etc.). Dies alleine jedoch genügt nicht. Denn diese<br />
Anforderung kann nur dann wirklich erfüllt werden,<br />
wenn der Grad 3 auch über ausgeprägte Erfahrung als<br />
Führungskraft z. B. auf einer Geschäftführer- oder Leitungsposition<br />
verfügt.<br />
Entwicklung von Neuerungen<br />
Der Grad 3 soll auf Grund seines Wissens und seiner Erfahrung<br />
in der Lage sein, Neuerungen auf dem Fachgebiet<br />
des KKS zu initiieren bzw. anzustoßen. Eine entsprechende<br />
ausgeprägte Erfahrung auf dem Gebiet der technischen<br />
Regelwerkserstellung in den entsprechend einschlägigen<br />
Gremien wäre hierfür z. B. ein Nachweis. Aber auch Innovationen<br />
auf dem Fachgebiet des KKS, die z. B. im Rahmen<br />
von Fachveröffentlichungen und/oder Fachvorträgen dem<br />
einschlägigen Fachpublikum vorgetragen werden, können<br />
hierfür ein Nachweis sein.<br />
CHARAKTERISTIKUM DES GRAD-3-EXPERTEN<br />
Aus den Ausführungen der letzten beiden Kapitel lässt<br />
sich schlussfolgern, dass sich der Grad-3-Experte aus drei<br />
unterschiedlichen Kompetenzebenen zusammensetzt:<br />
1. Basiskompetenz: entspricht Grad 2<br />
→ KKS-Sachkundiger<br />
2. Expertenkompetenz: umfasst sämtliche<br />
KKS-Fach- und Entscheidungskompetenz<br />
→ Verantwortlicher Fachmann<br />
04-05 / 2013 127
FACHBERICHT RECHT KORROSIONSSCHUTZ<br />
& REGELWERK<br />
3. Wissenschaftskompetenz : umfasst Forschung und<br />
Entwicklung sowie Wissensvermittlung an Dritte<br />
→ KKS-Wissenschaftler<br />
Im Rahmen der Zertifizierung nach DIN EN 15257 kann<br />
jedoch nur die Basiskompetenz im Rahmen einer Grad-<br />
2-Prüfung hieraus extrahiert werden, während eine erfolgreiche<br />
Zertifizierung nach Grad 3 die Erfüllung aller drei<br />
Kompetenzstufen erforderlich macht. Da jedoch speziell<br />
die Wissenschaftskompetenz nur von wenigen potentiellen<br />
Kandidaten erfüllt wird, wird es selbst in Deutschland nur<br />
relativ wenige Grad-3-Experten geben. Welche Auswirkungen<br />
dies auf das nationale technische Regelwerk in Sachen<br />
KKS hat, wird das nächste Kapitel beschreiben.<br />
NATIONALES REGELWERK<br />
Für das technische Regelwerk der öffentlichen Gas- und<br />
Wasserversorgung ist der Deutsche Verein des Gas- und<br />
Wasserfaches e.V. (DVGW) zuständig. Da die wünschenswerte<br />
Trennung zwischen der Experten-kompetenz und<br />
der Wissenschaftskompetenz in der DIN EN 15257 leider<br />
nicht vollzogen worden ist, musste dies nun im nationalen<br />
Regelwerk des DVGW nachgeholt werden. Mit dem<br />
Arbeitsblattentwurf E-G W 11, Qualifikationsanforderungen<br />
für Fachunternehmen des kathodischen Korrosionsschutz<br />
[2] (textgleich mit der fkks-Richtlinie Güteüberwachung),<br />
die im Laufe dieses Jahres erscheinen wird, soll die Fachfirmenzertifizierung<br />
mit der Personenzertifizierung nach DIN<br />
EN 15257 zusammengeführt werden.<br />
Für die Durchführung, Überwachung und Verantwortung<br />
sämtlicher Arbeiten auf dem Fachgebiet des KKS wird dabei<br />
von jeder Fachfirma mindestens ein sogenannter „Verantwortlicher<br />
Fachmann“ gefordert. Dieser soll über die Basis- und<br />
Expertenkompetenz, jedoch nicht über die Wissenschaftskompetenz<br />
verfügen. Um verantwortlicher Fachmann nach<br />
GW 11 zu werden, ist es deshalb nicht erforderlich, über eine<br />
gültige Zertifizierung nach DIN EN 15257 Grad 3 zu verfügen.<br />
Unabhängig von diesem Punkt ist das Charakteristikum der<br />
neuen GW 11, dass sie gut auf die DIN EN 15257 abgestimmt<br />
ist. So fordert GW 11 von jeder Fachfirma in Abhängigkeit<br />
von Ihrer Größe eine bestimmte Anzahl an Mitarbeitern vorzuhalten,<br />
die über eine Qualifikation entsprechend Grad 1<br />
bzw. Grad 2 verfügen. Weiterhin sind dort auch zum ersten<br />
Mal die KKS-Fachkraft und der KKS-Sachkundige definiert,<br />
wobei man sich hierbei eng an DIN EN 15257 angelehnt hat.<br />
FAZIT<br />
Für die Durchführung der fachlichen Tätigkeiten, so wie sie<br />
beispielsweise eine KKS-Fachfirma nach GW 11 oder eine<br />
KKS-Fachabteilung eines Versorgungsunternehmens leistet,<br />
ist es nicht erforderlich, einen Grad-3-Experten vorzuweisen.<br />
Die sinnvolle Trennung zwischen der Wissenschaftskompetenz<br />
einerseits und der Expertenkompetenz andererseits<br />
wurde in DIN EN 15257 leider nicht vollzogen. Deshalb<br />
musste dies auf nationaler Ebene im Rahmen der Erstellung<br />
der E-GW 11 durchgeführt werden. Die Veröffentlichung der<br />
E-GW 11 wird sicher weitere Klarheit bringen.<br />
Bis dahin jedoch ist es wichtig, einige Auswüchse der <strong>aktuell</strong>en<br />
Grad-3-Diskussion einzudämmen. So ist es z. B. nicht<br />
nachvollziehbar, wenn im Rahmen von Ausschreibungen<br />
von Fachfirmen das Vorhalten eines Grad-3-Experten verlangt<br />
wird. Obwohl es hierfür keinerlei sachlich vertretbare<br />
Gründe gibt, entsteht dadurch ein Wettbewerbsnachteil<br />
für Fachfirmen, die über keinen Grad-3-Experten verfügen.<br />
Auch als werbewirksamer „Bannerträger“ einer KKS-Fachfirma<br />
ist der Grad 3 nicht wirklich geeignet, muss er doch, um<br />
seine Wissenschaftskompetenz weiter aufrechtzuerhalten,<br />
Mittel und Zeit zur Verfügung gestellt bekommen, um auch<br />
weiterhin Lehrgänge zu leiten, Vorträge zu halten, Veröffentlichungen<br />
zu machen und in einschlägigen Gremien<br />
Regelwerksarbeit zu leisten. Dies sind sicherlich keine unerheblichen<br />
Kosten, die dabei berücksichtigt werden müssen.<br />
LITERATUR<br />
[1] DIN EN 15257: Kathodischer Korrosionsschutz - Qualifikationsgrade<br />
und Zertifizierung von für den kathodischen Korrosionsschutz<br />
geschultem Personal. Hrsg. vom Deutschen Institut für Normung<br />
e.V. Ausg. März 2007.<br />
[2] E-DVGW-GW 11: Qualitätsanforderungen für Fachunternehmen des<br />
kathodischen Korrosionsschutzes (KKS) - Entwurf. Hrsg. vom DVGW<br />
Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. Ausg. Januar 2012.<br />
Dipl.-Ing. NORBERT TENZER<br />
TZ-International Corrosion Con.<br />
Tel. +49 2331 591032<br />
E-Mail: N.Tenzer@tz-icc.eu<br />
Dipl.-Phys. RAINER DEISS<br />
EnBW Regional AG<br />
Tel.: +49 711 289-47414<br />
E-Mail: R.Deiss@enbw.com<br />
AUTOREN<br />
128 04-05 / 2013
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
Marktübersicht<br />
2013<br />
Rohre + Komponenten<br />
Maschinen + Geräte<br />
Korrosionsschutz<br />
Dienstleistungen<br />
Sanierung<br />
Institute + Verbände<br />
Fordern Sie weitere Informationen an unter<br />
Tel. 0201/82002-35 oder E-Mail: h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
www.3r-marktuebersicht.de<br />
03 / 2013 129
2013<br />
FACHBERICHT RohRe RECHT + & Komponenten<br />
REGELWERK<br />
Marktübersicht<br />
Armaturen<br />
Armaturen + Zubehör<br />
Anbohrarmaturen<br />
Rohre<br />
Formstücke<br />
Schutzmantelrohre<br />
Kunststoff<br />
130 03 / 2013
RohRe + Komponenten<br />
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
2013<br />
Rohrdurchführungen<br />
Marktübersicht<br />
Dichtungen<br />
Ihr „Draht“ zur Anzeigenabteilung von<br />
Helga Pelzer<br />
Tel. 0201 82002-35<br />
Fax 0201 82002-40<br />
h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
03 / 2013 131
2013<br />
mAschInen + GeRäte<br />
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
Marktübersicht<br />
Kunststoffschweißmaschinen<br />
horizontalbohrtechnik<br />
Leckageortung<br />
132 03 / 2013
KoRRosIonsschutZ<br />
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
2013<br />
Kathodischer Korrosionsschutz<br />
Marktübersicht<br />
03 / 2013 133
2013<br />
KoRRosIonsschutZ<br />
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
Marktübersicht<br />
Kathodischer Korrosionsschutz<br />
134 03 / 2013
KoRRosIonsschutZ<br />
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
2013<br />
Korrosionsschutz<br />
Marktübersicht<br />
Ihr „Draht“ zur Anzeigenabteilung von<br />
Helga Pelzer<br />
Tel. 0201 82002-35<br />
Fax 0201 82002-40<br />
h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
03 / 2013 135
2013<br />
DIenstLeIstunGen / sAnIeRunG<br />
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
Marktübersicht<br />
sanierung<br />
InstItute + VeRbänDe<br />
Institute<br />
136 03 / 2013
InstItute + VeRbänDe<br />
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
2013<br />
Verbände<br />
Marktübersicht<br />
03 / 2013 137
2013<br />
InstItute + VeRbänDe<br />
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
Marktübersicht<br />
Verbände<br />
INSERENTENVERZEICHNIS<br />
Firma<br />
1. Deutscher Kanalnetzbewirtschaftungstag 2013, Geisingen Beilage<br />
3S Consult GmbH, Garbsen 85<br />
5. Europäische Rohrleitungstage, St. Veit an der Glan, Österreich 19<br />
AQUATECH AMSTERDAM 2013, Amsterdam, Niederlande 22<br />
AUMA Riester GmbH & Co. KG, Müllheim 5<br />
Diringer & Scheidel Rohrsanierung GmbH & Co. KG, Mannheim 65<br />
DUKTUS Rohrsysteme Wetzlar GmbH, Wetzlar 11<br />
Fachverband Steinzeugindustrie, Frechen 95<br />
FBS Fachvereinigung Betonrohre und Stahlbetonrohre e.V., Bonn 109<br />
FRIATEC AG, Mannheim 13<br />
Güteschutz Kanalbau e.V., Bad Honnef 3<br />
Hammann GmbH, Annweiler am Trifels 79<br />
HOBAS Rohre GmbH, Neubrandenburg 99<br />
IFAT India 2013, Mumbai, Indien 21<br />
KLINGER GmbH, Idstein 101<br />
Plasson GmbH, Wesel am Rhein<br />
Titelseite<br />
POWER + WATER MIDDLE EAST 2013, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate 73<br />
Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH, Siegen 69<br />
SebaKMT, Baunach 9<br />
Hermann Sewerin GmbH, Gütersloh 93<br />
Steinzeug Keramo GmbH, Frechen 7<br />
TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG, Lennestadt 59<br />
WIDOS Wilhelm Dommer Söhne GmbH, Ditzingen-Heimerdingen 15<br />
Marktübersicht 129-138<br />
138 03 / 2013
RsV-Regelwerke<br />
RSV Merkblatt 1<br />
renovierung von entwässerungskanälen und -leitungen<br />
mit vor Ort härtendem Schlauchlining<br />
2011, 48 Seiten, DIN A4, broschiert, € 35,-<br />
RSV Merkblatt 2<br />
renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit<br />
rohren aus thermoplastischen Kunststoffen durch<br />
Liningverfahren ohne ringraum<br />
2009, 38 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RsV Merkblatt 2.2<br />
renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit<br />
vorgefertigten rohren durch TIP-Verfahren<br />
2011, 32 Seiten DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RsV Merkblatt 3<br />
renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen durch<br />
Liningverfahren mit ringraum<br />
2008, 40 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RsV Merkblatt 4<br />
reparatur von drucklosen Abwässerkanälen und<br />
rohrleitungen durch vor Ort härtende Kurzliner (partielle Inliner)<br />
2009, 20 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RsV Merkblatt 5<br />
reparatur von entwässerungsleitungen und Kanälen<br />
durch roboterverfahren<br />
2007, 22 Seiten, DIN A4, broschiert, € 27,-<br />
RsV Merkblatt 6<br />
Sanierung von begehbaren entwässerungsleitungen und<br />
-kanälen sowie Schachtbauwerken - Montageverfahren<br />
2007, 23 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RECHT & REGELWERK www.vulkan-verlag.de FACHBERICHT<br />
RsV Merkblatt 6.2<br />
Sanierung von Bauwerken und Schächten<br />
in entwässerungssystemen<br />
2012, 41 Seiten, DIN A4, broschiert, € 35,-<br />
RsV Merkblatt 7.1<br />
renovierung von drucklosen Leitungen /<br />
Anschlussleitungen mit vor Ort härtendem Schlauchlining<br />
2009, 30 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RsV Merkblatt 7.2<br />
Hutprofiltechnik zur einbindung von Anschlussleitungen –<br />
reparatur / renovierung<br />
2009, 31 Seiten, DIN A4, broschiert, € 30,-<br />
RsV Merkblatt 8<br />
erneuerung von entwässerungskanälen und -anschlussleitungen<br />
mit dem Berstliningverfahren<br />
2006, 27 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RsV Merkblatt 10,<br />
Kunststoffrohre für grabenlose Bauweisen<br />
2008, 55 Seiten, DIN A4, broschiert, € 37,-<br />
RsV information 11<br />
Vorteile grabenloser Bauverfahren für die erhaltung und<br />
erneuerung von Wasser-, Gas- und Abwasserleitungen<br />
2012, 42 Seiten DIN A4, broschiert, € 9,-<br />
Auch als<br />
eBook<br />
erhältlich!<br />
Jetzt bestellen!<br />
Wissen für DIe<br />
Zukunft<br />
faxbestellschein an: +49 201 / 82002-34 Deutscher Industrieverlag oder GmbH abtrennen | Arnulfstr. und 124 im | fensterumschlag 80636 München einsenden<br />
Ja, ich / wir bestelle(n) gegen rechnung:<br />
___ ex. rSV-M 1 € 35,-<br />
___ ex. rSV-M 2 € 29,-<br />
___ ex. rSV-M 2.2 € 29,-<br />
___ ex. rSV-M 3 € 29,-<br />
___ ex. rSV-M 4 € 29,-<br />
___ ex. rSV-M 5 € 27,-<br />
___ ex. rSV-M 6 € 29,-<br />
Ich bin rSV-Mitglied und erhalte 20 % rabatt<br />
auf die gedruckte Version (Nachweis erforderlich!)<br />
___ ex. rSV-M 6.2 € 35,-<br />
___ ex. rSV-M 7.1 € 29,-<br />
___ ex. rSV-M 7.2 € 30,-<br />
___ ex. rSV-M 8 € 29,-<br />
___ ex. rSV-M 10 € 37,-<br />
___ ex. rSV-I 11 € 9,-<br />
zzgl. Versandkosten<br />
firma/Institution<br />
Vorname, Name des empfängers<br />
Straße / Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Antwort<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
Versandbuchhandlung<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
e-Mail<br />
Branche / Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise Bankabbuchung rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B.<br />
Brief, fax, e-Mail) oder durch rücksendung der Sache widerrufen. Die frist beginnt nach erhalt dieser Belehrung in Textform.<br />
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an die Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Versandbuchhandlung, Huyssenallee 52-56, 45128 essen.<br />
Bankleitzahl<br />
Ort, Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer<br />
nutzung personenbezogener Daten: für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich<br />
von DIV Deutscher 03 / 2013 Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per e-Mail, nicht über interessante, fachspezifische Medien und Informationsangebote informiert und beworben werde. 139<br />
Diese erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.<br />
✘<br />
XfrSVM1212
SERVICES BUCHBESPRECHUNG<br />
HANDKOMMENTAR ZUR VOB<br />
VOB Teile A und B, SektVo, VSVgV, Rechtsschutz im Vergabeverfahren<br />
INFOS:<br />
Autoren: W. Heiermann, R. Riedl: 13. Auflage 2012, 2496<br />
Seiten, Hardcover, 129,99 EURO (Vorbestellpreis gültig bis<br />
31. Mai 2013, ab 1. Juni 2013 149,99 EUR), 978-3-8348-<br />
1380-0<br />
Die VOB 2012 bringt wichtige Neuerungen für<br />
die Baupraxis. Der 2. Abschnitt der VOB/A wurde<br />
vollständig neu gefasst und die Vorgaben der EG-<br />
Richtlinie „Verteidigung und Sicherheit“ in einem<br />
neuen 3. Abschnitt der VOB/A umgesetzt. Im<br />
Hinblick hierauf wurde die Kommentierung im Teil<br />
A – unter Berücksichtigung der <strong>aktuell</strong>en Richtlinien<br />
und Formblättern des Vergabehandbuchs des<br />
Bundes – umfassend neu bearbeitet. Auch die Teile<br />
B und GWB sind den Änderungen entsprechend<br />
<strong>aktuell</strong> kommentiert. Kompetenz und Praxisnähe<br />
– die Vorzüge der vorherigen Auflagen, die den<br />
Erfolg des Werkes ausmachen, zeichnen auch<br />
diese Neubearbeitung aus. Die lange Erfahrung<br />
der Autoren auf dem Gebiet des Bauvertragsrechts<br />
stellt eine fundierte Kommentierung sicher.<br />
WASSERVERSORGUNG<br />
Gewinnung - Aufbereitung - Speicherung - Verteilung<br />
INFOS:<br />
Autoren: Rosemarie Karger und Frank Hoffmann; Springer<br />
Vieweg, 14. vollständig aktualisierte Auflage 2012, 340<br />
Seiten, Softcover, 34,95 EUR, 978-3-8348-1380-0<br />
Das Buch gibt einen Überblick über die Bereiche der<br />
Wasserversorgungstechnik, von der Gewinnung,<br />
Aufbereitung, Förderung, Speicherung, Verteilung<br />
bis hin zur rationellen Verwendung unter<br />
Berücksichtigung der allgemein anerkannten Regeln<br />
der Technik. Alle Kapitel wurden auf den neuesten<br />
Stand der gesetzlichen Grundlagen und Regelwerke<br />
gebracht. Der Bereich der Wassermengenmessung<br />
wurde der europäischen Messgeräterichtlinie<br />
angepasst und der Abschnitt Membranverfahren<br />
zur Wasseraufbereitung inhaltlich ausgeweitet.<br />
Das Kapitel Rechtsnormen und Regelwerke wurde<br />
weitgehend neu gefasst und die Vorschriften<br />
der Trinkwasserverordnung in der Fassung von<br />
2011 eingearbeitet. Zum Inhalt: Grundlagen einer<br />
Wasserversorgung, Wasserverbrauch, Wasservor -<br />
kommen und Wassergewinnung, Chemische,<br />
physikalische und biologische Beschaffenheit<br />
des Wassers, Aufbereitungsverfahren in der<br />
Trinkwasserversorgung, Wasserförderung und<br />
Mengen messung, Wasserspeicherung, Wasserverteilung,<br />
Rechtsnormen und technische Regelwerke.<br />
VOB IM BILD – TIEFBAU- UND ERDARBEITEN<br />
Abrechnung nach der VOB 2012<br />
INFOS:<br />
Autoren: Hans von der Damerau und August Tauterat,<br />
Hrsg.: Dipl.-Ing. Hinrich Poppinga, Verlagsgesellschaft<br />
Rudolf Müller GmbH & Co. KG, 20. aktualisierte und<br />
erweiterte Auflage 2013, 220 Seiten, 335 Abb., DIN A4,<br />
gebunden, 59,00 EUR, ISBN 978-3-481-02994-4<br />
Die „VOB im Bild“ ist das Standardwerk zur<br />
einfachen und sicheren Abrechnung nach<br />
der <strong>aktuell</strong>en Vergabe- und Vertragsordnung<br />
für Bauleistungen (VOB). Das Buch erläutert<br />
praxisnah und leicht verständlich die geltenden<br />
Abrechnungsregeln in Text und Bild. So hilft die<br />
„VOB im Bild“ Streitigkeiten im Vorfeld zu vermeiden<br />
und bietet Unterstützung bei Konfliktlösungen<br />
im Rahmen der Abrechnung von Bauleistungen.<br />
Grundlage der <strong>aktuell</strong>en 20. Auflage der „VOB<br />
im Bild – Tiefbau- und Erdarbeiten“ bildet die<br />
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen<br />
(VOB) – Ausgabe 2012. Von den insgesamt 64<br />
Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen<br />
(ATV) der VOB erläutert die Neuauflage 32<br />
tiefbauspezifische ATV.<br />
Bezüglich der Abrechnungsregelungen in Wort<br />
bzw. Bild wurden neu aufgenommen die ATV: DIN<br />
18323 Kampfmittelräumarbeiten und DIN 18326<br />
Renovierungsarbeiten an Entwässerungskanälen.<br />
Fortgeschrieben wurden die fachtechnisch<br />
überarbeiteten ATV: DIN 18299 Allgemeine<br />
Regelungen für Bauarbeiten jeder Art, DIN 18303<br />
Verbauarbeiten, DIN 18304 Ramm-, Rüttelund<br />
Pressarbeiten, DIN 18309 Einpressarbeiten,<br />
DIN 18313 Schlitzwandarbeiten mit stützenden<br />
Flüssigkeiten, DIN 18317 Verkehrswegebauarbeiten<br />
– Oberbauschichten aus Asphalt. Überarbeitet<br />
wurden – wegen der neuen DIN 4124, Ausgabe<br />
Januar 2012 – die DIN 18300 Erdarbeiten.<br />
Die 20. Auflage der „VOB im Bild – Tiefbauund<br />
Erdarbeiten“ bietet den <strong>aktuell</strong>en Stand der<br />
tiefbaurelevanten Regelungen zur Abrechnung<br />
nach der VOB 2012 und ermöglicht eine einfache,<br />
praxisgerechte und sichere Abrechnung von<br />
Bauleistungen.<br />
140 1-2 | 2013
AKTUELLE TERMINE SERVICES<br />
brbv<br />
SPARTENÜBERGREIFEND<br />
GRUNDLAGENSCHULUNGEN<br />
Praxis der Tiefbauarbeiten bei<br />
Leitungsverlegungen – DIN 4124/ZTV<br />
A-StB, 2012<br />
24./25.04.2013 Berlin<br />
GFK-Rohrleger nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
W 324 – Grundkurs<br />
13./14.06.2013 Gera<br />
GFK-Rohrleger nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
W 324 – Nachschulung<br />
21.05.2013 Gera<br />
Schweißaufsicht nach DVGW-Merkblatt<br />
GW 331<br />
7 Termine ab 22.04.2013 bundesweit<br />
PE-HD Schweißer nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
GW 330 – Grundkurs<br />
32 Termine ab 15.04.2013 bundesweit<br />
PE-HD Schweißer nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
GW 330 – Verlängerung<br />
67 Termine ab 15.04.2013 bundesweit<br />
Nachumhüllen von Rohren, Armaturen,<br />
und Formteilen nach DVGW-Merkblatt<br />
GW 15 – Grundkurs<br />
11 Termine ab 15.04.2013 bundesweit<br />
Sachkunde GW 301 - Bau von<br />
Wasserrohrleitungen<br />
20./21.11.2013 Mannheim<br />
Sachkunde GW 301 - Bau von<br />
Gasrohrnetzen bis 16 bar<br />
05/06.11.2013 Weimar<br />
Sachkunde GW 301 - Bau von<br />
Gasrohrnetzen über 16 bar<br />
03./04.12.2013 Berlin<br />
Sachkundiger Gas bis 5 bar<br />
16.04.2013 Berlin<br />
24.10.2013 Kerpen<br />
20.11.2013 Hannover<br />
Baustellenabsicherung und<br />
Verkehrssicherung RSA/ZTV-SA - 2 Tage<br />
22./23.05.2013 Dresden<br />
INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN<br />
Praxis der Tiefbauarbeiten bei<br />
Leitungsverlegungen – DIN 4124/ZTV<br />
A-StB, 2012<br />
24./25.04.2013 Berlin<br />
Nachumhüllen von Rohren, Armaturen,<br />
und Formteilen nach DVGW-Merkblatt<br />
GW 15 – Nachschulung<br />
13 Termine ab 15.04.2013 bundesweit<br />
Fachkraft für Muffentechnik metallischer<br />
Rohrsysteme – DVGW-Arbeitsblatt W 339<br />
22.-24.04.2013 Leipzig<br />
10.-12.06.2013 Gera<br />
Sachkundiger Wasser – Wasserverteilung<br />
17.04.2013 Berlin<br />
25.10.2013 Kerpen<br />
21.11.2013 München<br />
Reinigung und Desinfektion von<br />
Wasserverteilungsanlagen<br />
26.09.2013 Kerpen<br />
19.11.2013 Magdeburg<br />
Arbeitsvorbereitung und Kostenkontrolle<br />
im <strong>Rohrleitungsbau</strong> – Arbeitskalkulation<br />
16.05.2013 Dortmund<br />
Gussrohrverlegung – <strong>aktuell</strong>e<br />
Entwicklungen und Einbauverfahren<br />
26.11.2013 München<br />
Einbau und Abdichtung von Netz- und<br />
Hausanschlüssen bei Neubau und<br />
Sanierung<br />
27.11.2013 Kassel<br />
19.12.2013 Potsdam<br />
Steuerbare horizontale Spülbohrverfahren -<br />
Weiterbildungsveranstaltung nach GW 329<br />
10.12.2013 Kassel<br />
GAS/WASSER<br />
GRUNDLAGENSCHULUNGEN<br />
Geprüfter Netzmeister Gas/Wasser –<br />
Vollzeitlehrgang<br />
02.09.2013 - 28.03.2014 Berlin, Kerpen<br />
Sicherheit bei Arbeiten im Bereich von<br />
Versorgungsleitungen – Schulung nach<br />
Hinweis GW 129<br />
16 Termine ab 16.04.2013 bundesweit<br />
Kunststoffrohrleger Schwerpunkt PVC<br />
15.-17.04.2013 Gera<br />
06.-08.05.2013 Hamburg<br />
26.-28.06.2013 Gera<br />
Fachkraft für die Instandsetzung<br />
von Trinkwasserbehältern – DVGW-<br />
Arbeitsblätter W 316-2<br />
15.-17.04.2013 Gera<br />
06.-08.05.2013 Hamburg<br />
26.-28.06.2013 Gera<br />
INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN<br />
Arbeiten an Gasleitungen - BGR 500 Kap. 2.31<br />
30.10.2013 Nürnberg<br />
12.11.2013 Bad Zwischenahn<br />
28.11.2013 Gütersloh<br />
18.12.2013 Berlin<br />
Kunststoffrohre in der Gas- und Wasserversorgung<br />
- Verlängerung zur GW 331<br />
07.05.2013 Berlin<br />
19.09.2013 Nürnberg<br />
09.10.2013 Hamburg<br />
Sachkunde GW 301 - Bau von Gas- und<br />
Wasserrohrleitungen<br />
16.- 17.10.2013 Frankfurt/Main<br />
DVGW-Arbeitsblatt GW 301<br />
- Qualitätsanforderungen für<br />
<strong>Rohrleitungsbau</strong>unternehmen<br />
14.05.2013 Berlin<br />
24.09.2013 Bremen<br />
26.11.2013 Nürnberg<br />
Erneuerbare Energien – Biogas I –<br />
Grundlagen<br />
14.05.2013 Hamburg<br />
PRAXISSEMINARE<br />
Arbeiten an Gasleitungen – BGR 500, Kap.<br />
2.31 – Fachaufsicht<br />
22.-26.04.2013 Gera<br />
13.-17.05.2013 Gera<br />
17.-21.06.2013 Gera<br />
16.-20.09.2013 Gera<br />
Druckprüfung von Gas- und<br />
Wasserleitungen<br />
15./16.10.2013 Leipzig<br />
05./06.11.2013 Dortmund<br />
Fachwissen für Schweißaufsichten nach<br />
DVGW-Merkblatt GW 331 incl. DVS-<br />
Abschluss 2212-1<br />
24.-25.10.2013 Dortmund<br />
14.-15.11.2013 Dortmund<br />
12.-13.12.2013 Dortmund<br />
1-2 | 2013 141
SERVICES AKTUELLE TERMINE<br />
Druckprüfung von Gas- und<br />
Wasserleitungen<br />
29.10.2013 Leipzig<br />
Qualitätssicherung bei PE-<br />
Rohrleitungen - Beurteilung von<br />
Kunststoffschweißverbindungen HS – HM<br />
nach DVS 2202/1<br />
29.10.2013 Stuttgart<br />
12.11.2013 Bad Zwischenahn<br />
05.12.2013 Berlin<br />
Fachaufsicht Korrosionsschutz für<br />
Nachumhüllungsarbeiten gemäß DVGW-<br />
Merkblatt GW 15<br />
19.11.2013 Nürnberg<br />
04.12.2013 Brandenburg<br />
Druckprüfung von Wasserrohrleitungen<br />
20.11.2013 Nürnberg<br />
FERNWÄRME<br />
INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN<br />
Technische Grundlagen der Nah- und<br />
Fernwärme<br />
02.-07.06.2013 Wermelskirchen<br />
03.-08.11.2013 Bad Dürkheim<br />
Bau und Sanierung von Nah- und<br />
Fernwärmeleitungen<br />
08./09.10.2013 Dresden<br />
Mantelrohrsysteme im<br />
Fernwärmeleitungsbau<br />
24./25.09.2013 Hamburg<br />
Aufbaulehrgang Fernwärme<br />
12.11.2013 Kerpen<br />
Rohrstatische Auslegung von<br />
Kunststoffmantelrohren<br />
12./13.11.2013 Kerpen<br />
Qualifikationen im Fernwärmeleitungsbau<br />
19.11.2013 Hannover<br />
Schweißen und Prüfen von<br />
Fernwärmeleitungen – FW 446<br />
20.11.2013 Hannover<br />
Aktuelle Themen im<br />
Fernwärmeleitungsbau<br />
03./04.12.2013 Fulda<br />
INDUSTRIEROHRLEITUNGSBAU<br />
GRUNDLAGENSCHULUNGEN<br />
Kunststoffschweißer nach DVS 2281 mit<br />
Prüfung nach DVS 2212-1<br />
25 Termine ab 15.04.2013 bundesweit<br />
Wiederholungsprüfungen nach DVS 2212-1<br />
48 Termine ab 15.04.2013 bundesweit<br />
Kunststoffschweißer nach DVS 2282 mit<br />
Prüfung nach DVS 2212-1<br />
48 Termine ab 15.04.2013 bundesweit<br />
DVGW<br />
SCHULUNGEN<br />
Instandhaltungsstrategien für<br />
Gasverteilungsnetze<br />
23.04.2013 Würzburg<br />
Aufbau und Betrieb von Gas-Druckregelund<br />
Messanlagen<br />
11./12.06.2013 Hamburg<br />
GWI Essen<br />
SEMINARE<br />
Sicherheitstraining bei Bauarbeiten im<br />
Bereich von Versorgungsleitungen -<br />
BALSibau - DVGW GW 129<br />
19.04.2013 Essen<br />
12.07.2013 Essen<br />
27.09.2013 Essen<br />
22.11.2013 Essen<br />
Sachkundigenschulung Gas-Druckregelund<br />
-Messanlagen im Netzbetrieb und in<br />
der Industrie<br />
24.-26.06.2013 Essen<br />
16.-18.09.2013 Essen<br />
09.-11.12.2013 Essen<br />
Gasspüren und<br />
Gaskonzentrationsmessungen<br />
18./19.06.2013 Essen<br />
07./08.10.2013 Essen<br />
Grundlagen, Praxis und Fachkunde von<br />
Gas-Druckregelanlagen nach DVGW G 491,<br />
G 495 und G459-2<br />
10.-11.07.2013 Essen<br />
20.-21.11.2013 Essen<br />
Die DVGW-TRGI 2008 - Technische Regeln<br />
für Gasinstallationen<br />
18.07.2013 Essen<br />
Wirtschaftliche Instandhaltung von<br />
Gasnetzen und –anlagen<br />
18.12.2013 Essen<br />
Gas-Hausanschlüsse – Planung, Betrieb,<br />
Instandhaltung<br />
10./11.04.2013 Essen<br />
12./13.12.2013 Essen<br />
Auslegung und Dimensionierung von Gas-<br />
Druckregelanlagen<br />
10./11.04.2013 Essen<br />
09./10.10.2013 Essen<br />
Sicheres Arbeiten und Sicherheitstechnik<br />
in der Gas-Hausinstallation<br />
17./18.04.2013 Essen<br />
25./26.09.2013 Essen<br />
Sachkundige für Odorieranlagen - DVGW<br />
G 280<br />
24./25.04.2013 Essen<br />
12./13.11.2013 Essen<br />
Prüfungen, Dokumentationen und<br />
Abnahmen von Gas-Druckregelanlagen bis<br />
5 bar durch Sachkundige<br />
14./15.05.2013 Essen<br />
Weiterbildung von Sachkundigen und<br />
technischen Führungskräften im Bereich<br />
von Gas-Druckregel- und -Messanlagen<br />
03./04.06.2013 Essen<br />
16./17.09.2013 Essen<br />
Stahlmantelrohre im<br />
Fernwärmeleitungsbau<br />
21.11.2013 Hannover<br />
Planung und Bau von<br />
Fernwärmeversorgung mit Dampf<br />
22.11.2013 Hannover<br />
Arbeiten an freiverlegten<br />
Gasrohrleitungen auf Werksgelände und<br />
im Bereich betrieblicher Gasverwendung<br />
gemäß DVGW G 614Praxis der<br />
Ortsgasverteilung<br />
06.09.2013 Essen<br />
18./19.06.2013 Organisation und<br />
Logistik der Gasrohrnetzüberprüfung<br />
17.06.2013 Essen<br />
142 1-2 | 2013
AKTUELLE TERMINE SERVICES<br />
Weiterbildung von Sachkundigen und<br />
technischem Personal für<br />
Klärgas- und Biogasanlagen in der<br />
Abwasserbehandlung<br />
26./27.09.2013 Essen<br />
Grundlagen der Gas-Druckregelung<br />
15./16.10.2013 Essen<br />
SEMINARE<br />
HDT<br />
Druckstöße, Dampfschläge und<br />
Pulsationen in Rohrleitungen<br />
22./23.04.2013 München<br />
23./24.09.2013 Kochel<br />
Festigkeitsmäßige Auslegung von<br />
Druckbehältern<br />
02./03.12.2013 Essen<br />
Prüfungen von Druckbehälteranlagen<br />
und Rohrleitungen nach der<br />
Betriebssicherheitsverordnung<br />
15.04.2013 Berlin<br />
Dichtverbindungen an Rohrleitungen<br />
25.09.2013 Berlin<br />
Flanschverbindungen<br />
26.06.2013 Essen<br />
26.09.2013 Berlin<br />
Prüfungen von Druckbehälteranlagen<br />
und Rohrleitungen nach der<br />
Betriebssicherheitsverordnung<br />
15.04.2013 Essen<br />
ASME-Kenntnisse für die Anfrage<br />
zu Druckgeräten, Rohrleitungen mit<br />
Zubehör und Schweißkonstruktionen im<br />
Maschinenbau<br />
03.06.2013 Essen<br />
Schweißen von Rohrleitungen im Energieund<br />
Chemieanlagenbau<br />
05./06.06.2013 Essen<br />
Rohrleitungen nach EN 13480 - Allgemeine<br />
Anforderungen, Werkstoffe, Fertigung und<br />
Prüfung<br />
25.06.2013 München<br />
Sicherheitsventile und Berstscheiben<br />
24.10.2013 Essen<br />
RSV<br />
ZKS-BERATER-LEHRGÄNGE<br />
Blockschulung 2013<br />
Modulare Schulung 2013<br />
Dresden<br />
22.04.-26.04.2013<br />
27.05.-01.06.2013<br />
Feuchtwangen<br />
08.04.-12.04.2013<br />
22.04.-27.04.2013<br />
Kerpen<br />
09.09.-14.09.2013<br />
23.09.-28.09.2013<br />
07.10.-11.10.2013<br />
11.11.-16.11.2013<br />
Hamburg/Kiel<br />
16.09.-21.09.2013<br />
21.10.-26.10.2013<br />
18.11.-22.11.2013<br />
02.12.-07.12.2013<br />
Feuchtwangen<br />
23.09.-28.09.2013<br />
14.10.-19.10.2013<br />
04.11.-08.11.2013<br />
25.11.-30.11.2013<br />
SEMINARE<br />
SAG<br />
Grundlagen der Inspektion von Kanälen<br />
und Grundstücksentwässerungsleitungen<br />
in Theorie und Praxis auf Grundlage der<br />
Europäischen Norm DIN EN 13508-2, des<br />
nationalen Regelwerks DWA-M 149, Teil 2<br />
und 5 sowie ISYBAU 2006<br />
22.04.2013 Darmstadt<br />
03.06.2013 Kiel<br />
10.06.2013 Lauingen<br />
01.07.2013 Darmstadt<br />
15.07.2013 Lünen<br />
14.10.2013 Lünen<br />
04.11.2013 Darmstadt<br />
18.11.2013 Kiel<br />
Grundlagen der Inspektion von Grundstücksentwässerungsleitungen<br />
nach<br />
Europäischer Norm DIN EN 13508-2 und<br />
nationalem Regelwerk DWA-M 149, Teil 2<br />
und 5<br />
03.06.2013 Kiel<br />
03.07.2013 Darmstadt<br />
14.10.2013 Lünen<br />
Bewertung von Schadensbildern,<br />
Zustandsklassifizierung nach DWA-M 149-3,<br />
ISYBAU sowie DIN 1986-30 (02/2012),<br />
Zustandsbewertung nach DWA-M 149-3<br />
(mit Sanierungskennzahlen) und Auswahl<br />
des geeigneten Sanierungsverfahrens sowie<br />
Übersicht von Sanierungsverfahren im<br />
Bereich Grundstücksentwässerung (GEA)<br />
27.05.2013 Darmstadt<br />
07.10.2013 Darmstadt<br />
25.11.2013 Lünen<br />
Grundlagen der Kanalsanierung privater<br />
Abwasserleitungen, Bewertung von<br />
Schadensbildern mit Zustandsklassifizierung<br />
nach DWA-M 149-3, ISYBAU 2006 und DIN<br />
1986-30 (02/2012)<br />
27.05.2013 Darmstadt<br />
07.10.2013 Darmstadt<br />
25.11.2013 Lünen<br />
Inspektion von sanierten Kanälen und<br />
zur Abnahme von Bauleistungen (VOB/<br />
Gewährleistung)<br />
21.05.2013 Lünen<br />
07.08.2013 Kiel<br />
21.08.2013 Darmstadt<br />
Sachkundelehrgang Muffendruckprüfung<br />
und Dichtheitsprüfung von Druckrohrleitungen,<br />
Abwassersammelgruben,<br />
Pumpenschächte und Kleinkläranlagen<br />
(Luft/Wasser)<br />
25.04.2013 Lünen<br />
13.06.2013 Darmstadt<br />
10.10.2013 Lünen<br />
Planung und Bau von<br />
Grundstücksentwässerungsanlagen<br />
01.07.2013 Lünen<br />
1-2 | 2013 143
SERVICES AKTUELLE TERMINE<br />
Grundlagen und Anwendung der<br />
Sanierung mittels Berstliningverfahren<br />
17./18.06.2013 Darmstadt<br />
TAE<br />
SEMINARE<br />
Messtechnik beim kathodischen<br />
Korrosionsschutz (KKS)<br />
13.-15.05.2013 Ostfildern<br />
TAH<br />
SEMINARE<br />
Zertifizierter Kanalsanierungs-Berater<br />
2013<br />
16.-21.09.2013 Heidelberg<br />
14.-19.10.2013 Weimar<br />
TAW<br />
SEMINARE<br />
Verfahrenstechnische Erfahrungsregeln<br />
bei der Auslegung von Apparaten und<br />
Anlagen<br />
03./04.06.2013 Wuppertal<br />
Rohrleitungen in verfahrenstechnischen<br />
Anlagen planen und auslegen<br />
16./17.04.2013 Wuppertal<br />
ZfW<br />
WORKSHOP<br />
Kathodischer Korrosionsschutz für<br />
Wasserrohrleitungen aus Stahl<br />
16./17.04.2013 Würzburg<br />
SEMINAR<br />
Qualitätsprodukt Kanalsanierung mit<br />
Schlauchlining<br />
28./29.05.2013 Hamburg<br />
KONTAKTADRESSEN<br />
BAU-Akademie Nord<br />
Claudia Mack, Tel. 0421/20349-119,<br />
Fax 0421/20349-6119,<br />
E-Mail: Mack@bauindustrie-nord.de,<br />
www.bauakademie-nord.de<br />
brbv<br />
Kurt Rhode, Tel. 0221/37668-44,<br />
Fax 0221/37668-62, E-Mail: rhode@brbv.de,<br />
www.brbv.de<br />
DVGW<br />
Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches<br />
e.V.,<br />
Tel. 0228/9188-607, Fax 0228/9188-997,<br />
E-Mail: splittgerber@dvgw.de, www.dvgw.de<br />
GWI Gas- und Wärmeinstitut Essen e.V.,<br />
Frau B. Hohnhorst, Tel. 0201/3618-143,<br />
Fax 0201/3618-146,<br />
E-Mail: hohnhorst@gwi-essen.de,<br />
www.gwi-essen.de<br />
HdT<br />
Haus der Technik Essen,<br />
Tel. 0201/1803-1,<br />
E-Mail: hdt@hdt-essen.de,<br />
www.hdt-essen.de<br />
SAG-Akademie<br />
Anja Kratt, Tel. 06151/10155-111,<br />
Fax 06151/10155-155,<br />
E-Mail: Kratt@SAG-Akademie.de,<br />
www.SAG-Akademie.de<br />
SKZ<br />
SKZ - ToP gGmbH, Astrid Pratsch,<br />
Tel. 0345/53045-11, Fax 0345/53045-22,<br />
E-Mail: halle@skz.de, www.skz.de<br />
TAE<br />
Technische Akademie Esslingen,<br />
Manfred Schuster, Tel. 0711/3400829,<br />
Fax 0711/3400830,<br />
E-Mail: manfred.schuster@tae.de, www.tae.de<br />
TAH<br />
Technische Akademie Hannover e.V.,<br />
Dr. Igor Borovsky, Tel. 0511/39433-30,<br />
Fax 0511/39433-40,<br />
E-Mail: borovsky@ta-hannover.de,<br />
www.ta-hannover.de<br />
TAW<br />
Technische Akademie Wuppertal e.V.,<br />
Tel. 0202/7495-207, Fax 0202/7495-228,<br />
E-Mail: taw@taw.de, www.taw.de<br />
ZfW<br />
Zentrum für Weiterbildung, Dipl.-Päd. Anke<br />
Lüken, Tel. 0441/361039-20,<br />
Fax 0441/361039-30, E-Mail: anke.lueken@<br />
jade-hs.de, www.jade-hs.de/zfw/<br />
ZKS<br />
RSV - Rohrleitungssanierungsverband e.V.,<br />
Tel.: 05963/9810877, Fax 05963/9810878,<br />
E-Mail: rsv-ev@t-online.de, www.rsv-ev.de<br />
144 1-2 | 2013
IMPRESSUM<br />
IMPRESSUM<br />
Verlag<br />
© 1974 Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Postfach 10 39 62, 45039 Essen,<br />
Telefon +49 201-82002-0, Fax -40<br />
Geschäftsführer: Carsten Augsburger, Jürgen Franke<br />
Redaktion<br />
Dipl.-Ing. N. Hülsdau, Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Huyssenallee 52-56, 45128 Essen,<br />
Telefon +49 201-82002-33, Fax +49 201-82002-40,<br />
E-Mail: n.huelsdau@vulkan-verlag.de<br />
Kathrin Lange, Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Telefon +49 201-82002-32, Fax +49 201-82002-40,<br />
E-Mail: k.lange@vulkan-verlag.de<br />
Barbara Pflamm, Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Telefon +49 201-82002-28, Fax +49 201-82002-40,<br />
E-Mail: b.pflamm@vulkan-verlag.de<br />
Anzeigenverkauf<br />
Helga Pelzer, Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Telefon +49 201-82002-66, Fax +49 201-82002-40,<br />
E-Mail: h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
Anzeigenverwaltung<br />
Martina Mittermayer,<br />
Vulkan-Verlag/DIV Deutscher Industrieverlag GmbH,<br />
Telefon +49 89-203 53 66-16, Fax +49 89-203 53 66-66,<br />
E-Mail: mittermayer@di-verlag.de<br />
Abonnements/Einzelheftbestellungen<br />
Leserservice <strong>3R</strong> INTERNATIONAL,<br />
Postfach 91 61, 97091 Würzburg,<br />
Telefon +49 931-4170-1616, Fax +49 931-4170-492,<br />
E-Mail: leserservice@vulkan-verlag.de<br />
Layout und Satz<br />
Dipl. Des. Nilofar Mokhtarzada, Vulkan-Verlag GmbH<br />
E-Mail: n.mokhtarzada@vulkan-verlag.de<br />
Druck<br />
Druckerei Chmielorz, Ostring 13,<br />
65205 Wiesbaden-Nordenstadt<br />
Bezugsbedingungen<br />
<strong>3R</strong> erscheint monatlich mit Doppelausgaben im Januar/Februar,<br />
März/April und August/September · Bezugspreise: Abonnement<br />
(Deutschland): € 275,- + € 24,- Versand; Abonnement (Ausland):<br />
€ 275,- + € 28 Versand; Einzelheft (Deutschland): € 39,- + € 3,-<br />
Versand; Einzelheft (Ausland): € 39,- + € 3,50 Versand; Einzelheft<br />
als ePaper (PDF): € 39,-; Studenten: 50 % Ermäßigung auf<br />
den Heftbezugspreis gegen Nachweis · Die Preise enthalten bei<br />
Lieferung in EU-Staaten die Mehrwertsteuer, für alle übrigen<br />
Länder sind es Nettopreise.<br />
Bestellungen sind jederzeit über den Leserservice oder jede<br />
Buchhandlung möglich. Die Kündigungsfrist für Abonnementaufträge<br />
beträgt 8 Wochen zum Bezugsjahresende.<br />
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen<br />
sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb<br />
der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung<br />
des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere<br />
für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen<br />
und die Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen.<br />
Auch die Rechte der Wiedergabe durch Vortrag, Funkund<br />
Fernsehsendung, im Magnettonverfahren oder ähnlichem<br />
Wege bleiben vorbehalten.<br />
Jede im Bereich eines gewerblichen Unternehmens hergestellte<br />
oder benutzte Kopie dient gewerblichen Zwecken gem. § 54 (2)<br />
UrhG und verpflichtet zur Gebührenzahlung an die VG WORT,<br />
Abteilung Wissenschaft, Goethestraße 49, 80336 München, von<br />
der die einzelnen Zahlungsmodalitäten zu erfragen sind.<br />
ISSN 2191-9798<br />
Informationsgemeinschaft zur Feststellung<br />
der Verbreitung von Werbeträgern<br />
Organschaften<br />
Fachbereich Rohrleitungen im Fachverband Dampfkessel-, Behälterund<br />
<strong>Rohrleitungsbau</strong> e.V. (FDBR), Düsseldorf · Fachverband Kathodischer<br />
Korrosionsschutz e.V., Esslingen · Kunststoffrohrverband e.V.,<br />
Köln · <strong>Rohrleitungsbau</strong>verband e.V., Köln · Rohrleitungssanierungsverband<br />
e.V., Essen · Verband der Deutschen Hersteller von Gasdruck-Regelgeräten,<br />
Gasmeß- und Gasregelanlagen e.V., Köln<br />
Herausgeber<br />
H. Fastje, EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg (Federführender Herausgeber)<br />
· Dr.-Ing. M. K. Gräf, Vorsitzender der Geschäftsführung<br />
der Europipe GmbH, Mülheim · Dipl.-Ing. R.-H. Klaer, Bayer AG, Krefeld,<br />
Vorsitzender des Fachausschusses „Rohrleitungstechnik“ der VDI-<br />
Gesellschaft Verfahrenstechnik und Chemie-Ingenieurwesen (GVC)<br />
Dipl.-Volksw. H. Zech, Geschäftsführer des Rohrleitungssanierungsverbandes<br />
e.V., Lingen (Ems)<br />
Schriftleiter<br />
Dipl.-Ing. M. Buschmann, <strong>Rohrleitungsbau</strong>verband e.V. (rbv), Köln<br />
Rechtsanwalt C. Fürst, Erdgas Münster GmbH, Münster · Dipl.-Ing.<br />
Th. Grage, Institutsleiter des Fernwärme-Forschungsinstituts, Hemmingen<br />
· Dr.-Ing. A. Hilgenstock, E.ON New Build & Technology<br />
GmbH, Gelsenkirchen (Gastechnologie und Handelsunterstützung)<br />
Dipl.-Ing. D. Homann, IKT Institut für Unterirdische Infrastruktur, Gelsenkirchen<br />
· Dipl.-Ing. N. Hülsdau, Vulkan-Verlag, Essen · Dipl.-Ing.<br />
T. Laier, RWE – Westfalen-Weser-Ems – Netzservice GmbH, Dortmund<br />
Dipl.-Ing. J. W. Mußmann, FDBR e.V., Düsseldorf · Dr.-Ing. O. Reepmeyer,<br />
Europipe GmbH, Mülheim Dr. H.-C. Sorge, IWW Rheinisch-<br />
Westfälisches Institut für Wasser, Biebesheim · Dr. J. Wüst, SKZ -<br />
TeConA GmbH, Würzburg<br />
Beirat<br />
Dr.-Ing. W. Berger, Direktor des Forschungsinstitutes für Tief-und<br />
<strong>Rohrleitungsbau</strong> e.V., Weimar · Dr.-Ing. B. Bosseler, Wissenschaftlicher<br />
Leiter des IKT – Institut für Unterirdische Infra struktur, Gelsenkirchen<br />
· Dipl.-Ing. D. Bückemeyer, Vorstand der Stadtwerke Essen AG<br />
W. Burchard, Geschäftsführer des Fachverbands Armaturen im VD-<br />
MA, Frankfurt · Bauassessor Dipl.-Ing. K.-H. Flick, Fachverband Steinzeugindustrie<br />
e.V., Köln · Prof. Dr.-Ing. W. Firk, Vorstand des Wasserverbandes<br />
Eifel-Rur, Düren · Dipl.-Wirt. D. Hesselmann, Geschäftsführer<br />
des <strong>Rohrleitungsbau</strong>verbandes e.V., Köln · Dipl.-Ing. H.-J. Huhn,<br />
BASF AG, Ludwigshafen · Dipl.-Ing. B. Lässer, ILF Beratende Ingenieure<br />
GmbH, München · Dr.-Ing. W. Lindner, Vorstand des Erftverbandes,<br />
Bergheim · Dr. rer. pol. E. Löckenhoff, Geschäftsführer des Kunststoffrohrverbands<br />
e.V., Bonn · Dr.-Ing. R. Maaß, Mitglied des Vorstandes,<br />
FDBR Fachverband Dampfkessel-, Behälter- und <strong>Rohrleitungsbau</strong><br />
e.V., Düsseldorf · Dipl.-Ing. R. Middelhauve, TÜV NORD Systems<br />
GmbH & Co. KG, Essen · Dipl.-Ing. R. Moisa, Geschäftsführer der Fachgemeinschaft<br />
Guss-Rohrsysteme e.V., Griesheim · Dipl.-Berging.<br />
H. W. Richter, GAWACON, Essen · Dipl.-Ing. T. Schamer, Geschäftsführer<br />
der ARKIL INPIPE GmbH, Bottrop · Prof. Dipl.-Ing. Th. Wegener,<br />
Institut für <strong>Rohrleitungsbau</strong> an der Fachhochschule Oldenburg<br />
Prof. Dr.-Ing. B. Wielage, Lehrstuhl für Verbundwerkstoffe, Technische<br />
Universität Chemnitz-Zwickau · Dipl.-Ing. J. Winkels, Technischer<br />
Geschäftsführer der Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH, Siegen<br />
und<br />
sind Unternehmen der
7. Praxistag<br />
Korrosionsschutz<br />
am 19. Juni 2013 in Gelsenkirchen<br />
PROGRAMM<br />
Moderation: U. Bette, Technische Akademie Wuppertal<br />
• Beurteilung der Wechselstromkorrosionsgefährdung von<br />
Rohrleitungen anhand von Probeblechen: Relevante<br />
Einflussgrößen für die Bewertung der ermittelten<br />
Korrosionsgeschwindigkeit<br />
Dr. M. Büchler, SGK Schweizerische Gesellschaft für Korrosionsschutz, Zürich<br />
• Untersuchungen von verschiedenen Flüssigböden zur<br />
Verfüllung von Rohrgräben hinsichtlich ihres Einflusses<br />
auf den kathodischen Außenkorrosionsschutz von<br />
Stahlrohrleitungen<br />
n.n, TFH Bochum, Bochum; Ulrich Bette, Technische Akademie Wuppertal,<br />
Wuppertal<br />
• Smart KKS:<br />
Von der Fernüberwachung zur Online-Überwachung<br />
M. Müller, RBS Wave GmbH, Stuttgart<br />
• Fernüberwachung des KKS –<br />
Ein wesentlicher Beitrag zur Sicherheit von Rohrleitungen<br />
J. Maurmann, Maurmann GmbH, Sprockhövel<br />
• Umsetzung eines konsequenten LKS Konzeptes am<br />
Beispiel des Erdgaskavernenspeichers Jemgum<br />
n.n<br />
• Materialvielfalt und Anwendungsbereiche im passiven<br />
Korrosionsschutz – was sollte die zukünftige Ausbildung<br />
nach GW 15 leisten?<br />
H. Fuchs, RBV GmbH, Köln<br />
• Qualitätssicherung und Zustandserfassung<br />
in der Rohrleitungstrasse<br />
Dr. H.-J. Kocks, Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH, Siegen<br />
• Intelligente Molchungen aus KKS-Sicht<br />
Dr. M. Brecht, Open Grid Europe GmbH, Essen<br />
• Möglichkeiten bei der Ortung von erdverlegten<br />
Versorgungsleitungen über die Magnetfeldortung<br />
R. Klar, SebaKMT, Baunach<br />
Wann WAnn und Und Wo? WO?<br />
Veranstalter:<br />
<strong>3R</strong>, fkks<br />
Termin: Mittwoch, 19.06.2013,<br />
9:00 Uhr – 17:15 Uhr<br />
Ort:<br />
Zielgruppe:<br />
Veranstalter VERAnSTALTER<br />
Veltinsarena, Gelsenkirchen,<br />
www.veltins-arena.de<br />
Mitarbeiter von Stadtwerken,<br />
Energieversorgungs- und<br />
Korrosionsschutzfachunternehmen<br />
Teilnahmegebühr * :<br />
<strong>3R</strong>-Abonnenten<br />
und fkks-Mitglieder: 380,- €<br />
Nichtabonnenten: 410,- €<br />
Bei weiteren Anmeldungen aus einem Unternehmen wird<br />
ein Rabatt von 10 % auf den jeweiligen Preis gewährt.<br />
Im Preis enthalten sind die Tagungsunterlagen sowie<br />
das Catering (2 x Kaffee, 1 x Mittagessen).<br />
* Nach Eingang Ihrer schriftlichen Anmeldung (auch per Internet möglich) sind<br />
Sie als Teilnehmer registriert und erhalten eine schriftliche Bestätigung sowie<br />
die Rechnung, die vor Veranstaltungsbeginn zu begleichen ist. Bei Absagen<br />
nach dem 7. Juni 2013 oder Nichterscheinen wird ein Betrag von 100,- €<br />
für den Verwaltungsaufwand in Rechnung gestellt. Die Preise verstehen sich<br />
zzgl. MwSt.<br />
Mehr Information und Online-Anmeldung unter<br />
www.praxistag-korrosionsschutz.de<br />
Fax-Anmeldung: +49 201 82002-40 oder Online-Anmeldung: www.praxistag-korrosionsschutz.de<br />
Ich bin <strong>3R</strong>-Abonnent<br />
Ich bin fkks-Mitglied<br />
Ich bin Nichtabonnent/kein fkks-Mitglied<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Firma/Institution<br />
E-Mail<br />
Straße/Postfach<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Nummer<br />
✘<br />
Ort, Datum, Unterschrift