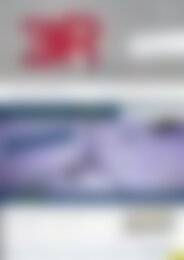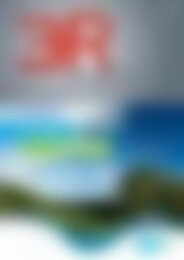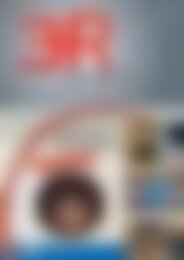3R Rohrleitungssicherung in Nordwestdeutschland (Vorschau)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
11-12 | 2013<br />
ISSN 2191-9798<br />
Fachzeitschrift für sichere und<br />
effiziente Rohrleitungssysteme<br />
LESEN SIE IN DIESER AUSGABE:<br />
iro-<strong>Vorschau</strong><br />
Abwasserentsorgung | Sanierung<br />
Interview mit Gernot Schöbitz<br />
„E<strong>in</strong> Label für die Umwelt“<br />
DAS VOLLE<br />
PROGRAMM:<br />
Für Druck- und Kanalrohrleitungen.<br />
Grabenlose Verlegung mit Compact Pipe ®<br />
• Vollwandrohr PE 80 (RT), PE 100<br />
• DN 100 – DN 500; SDR 17, 26, 32, werkseitig vorverformt<br />
• DVGW zugelassen für PN 6, PN 10<br />
• Mit der Qualität und Nutzungsdauer e<strong>in</strong>er Neuverlegung<br />
• Mit der Zulaufanb<strong>in</strong>dung Wav<strong>in</strong> CP ZA 2012 ®<br />
Deutsche<br />
Verleger:<br />
Wav<strong>in</strong> GmbH • Tel. 05936 12-0 • www.wav<strong>in</strong>.de
sichere und effiziente<br />
Rohrleitungssysteme<br />
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
Jetzt zwei Ausgaben gratis!<br />
Nutzen Sie das Know-how der führenden fachzeitschrift<br />
für die entwicklung, den e<strong>in</strong>satz und Betrieb von Rohrleitungen,<br />
Komponenten und Verfahren im Bereich der<br />
Gas- und Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung,<br />
der Nah- und fernwärmeversorgung, des Anlagenbaus<br />
und der Pipel<strong>in</strong>etechnik.<br />
Wählen Sie e<strong>in</strong>fach das Bezugsangebot, das Ihnen zusagt:<br />
• Heft<br />
• ePaper<br />
• Heft + ePaper<br />
<strong>3R</strong> ersche<strong>in</strong>t <strong>in</strong> der Vulkan-Verlag GmbH, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen<br />
Wissen füR DIe<br />
Zukunft<br />
Vorteilsanforderung per fax: +49 Deutscher 931 Industrieverlag / 4170-494 GmbH | Arnulfstr. oder 124 abtrennen | 80636 München und im fensterumschlag e<strong>in</strong>senden<br />
Ja, schicken Sie mir die nächsten beiden Ausgaben des Fachmagaz<strong>in</strong>s <strong>3R</strong> gratis zu.<br />
Nur wenn ich überzeugt b<strong>in</strong> und nicht <strong>in</strong>nerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der zweiten<br />
Folge schriftlich absage, bekomme ich <strong>3R</strong> für zunächst e<strong>in</strong> Jahr (8 Ausgaben)<br />
als Heft für € 275,- zzgl. Versand<br />
(Deutschland: € 24,- / Ausland: € 28,-).<br />
als ePaper (E<strong>in</strong>zellizenz) für € 275,-<br />
als Heft + ePaper für € 381,50<br />
(Deutschland) / € 385,50 (Ausland).<br />
Für Schüler / Studenten (gegen Nachweis) zum Vorzugspreis<br />
als Heft für € 137,50 zzgl. Versand<br />
(Deutschland: € 24,- / Ausland: € 28,-).<br />
als ePaper (E<strong>in</strong>zellizenz) für € 137,50<br />
als Heft + ePaper für € 202,75<br />
(Deutschland) / € 206,75 (Ausland).<br />
Nur wenn ich nicht bis 8 Wochen vor Bezugsjahresende kündige, verlängert sich der Bezug um e<strong>in</strong><br />
Jahr. Die sichere, pünktliche und bequeme Bezahlung per Bankabbuchung wird mit e<strong>in</strong>er Gutschrift<br />
von € 20,- auf die erste Rechnung belohnt.<br />
firma/Institution<br />
Vorname, Name des empfängers<br />
Straße / Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Antwort<br />
Leserservice <strong>3R</strong><br />
Postfach 91 61<br />
97091 Würzburg<br />
e-Mail<br />
Branche / Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise Bankabbuchung Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung <strong>in</strong>nerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen <strong>in</strong> Textform (z.B.<br />
Brief, fax, e-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die frist beg<strong>in</strong>nt nach erhalt dieser Belehrung <strong>in</strong> Textform. Zur<br />
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an den Leserservice <strong>3R</strong>, Postfach<br />
9161, 97091 Würzburg.<br />
Bankleitzahl<br />
✘<br />
Ort, Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer<br />
PA<strong>3R</strong>IN1212<br />
nutzung personenbezogener Daten: für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit e<strong>in</strong>verstanden, dass ich<br />
vom DIV Deutscher Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per e-Mail, nicht über <strong>in</strong>teressante, fachspezifische Medien und Informationsangebote <strong>in</strong>formiert und beworben werde.<br />
Diese erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
Ist denn schon wieder Weihnachten?<br />
Man mag es kaum glauben, aber das Jahr 2013 neigt sich<br />
bereits dem Ende. Für den Tiefbau begann es zunächst mit<br />
e<strong>in</strong>er sehr langen Wartezeit aufgrund des W<strong>in</strong>ters mit tiefen<br />
Temperaturen bis weit <strong>in</strong> den April h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>. Andere Ereignisse<br />
trugen ebenfalls nicht zu e<strong>in</strong>er Aufhellung der unternehmerischen<br />
Stimmungslage bei, wie die wirtschaftliche Lage <strong>in</strong><br />
Teilen Europas, der Verlauf der Energiewende, die regulatorischen<br />
Vorgaben bei der Entwicklung der Netzpläne im<br />
Gasbereich oder der Wahlkampf zur Bundestagswahl. Letztere<br />
liegt nun schon e<strong>in</strong>ige Monate zurück, aber wie man<br />
weiß: gut D<strong>in</strong>g will Weile haben. Vor Drucklegung dieser<br />
<strong>3R</strong>-Ausgabe lag zwar noch nicht die „basisdemokratische“<br />
Abstimmung der SPD-Mitglieder vor, dennoch wage ich die<br />
Behauptung, dass die große Koalition kommen wird. Und<br />
dann kann sich die neue Regierung endlich mit den wichtigen<br />
wirtschaftlichen Fragestellungen ause<strong>in</strong>andersetzen,<br />
um Voraussetzungen für e<strong>in</strong>e Investitionsbereitschaft und<br />
e<strong>in</strong>e positive ökonomische und ökologische Entwicklung zu<br />
geben - dazu gehört me<strong>in</strong>es Erachtens übrigens nicht das<br />
Thema Maut. Lassen wir uns überraschen.<br />
ab Seite 33. Die Ste<strong>in</strong>zeug-Keramo GmbH hat <strong>in</strong> diesem<br />
Jahr e<strong>in</strong>e Cradle to Cradle ® -Zertifizierung aller Produkte<br />
an ihren vier Standorten erhalten. Mit der Zertifizierung<br />
dokumentiert das Unternehmen se<strong>in</strong> Bekenntnis zu e<strong>in</strong>er<br />
nachhaltigen Wertschöpfung.<br />
Zum Abschluss des Jahres wünsche ich Ihnen und Ihren<br />
Familien e<strong>in</strong> frohes Weihnachtsfest, bes<strong>in</strong>nliche und ruhige<br />
Tage und e<strong>in</strong> gesundes und erfolgreiches Neues Jahr 2014.<br />
Nico Hülsdau<br />
<strong>3R</strong>, Vulkan-Verlag GmbH<br />
Unabhängig vom wirtschaftlichen und politischen Rahmen<br />
gab es etliche fachliche Themen, die die Rohrleitungsbranche<br />
<strong>in</strong> 2013 beschäftigten, so u. a. die neue HOAI 2013, die<br />
Änderungen <strong>in</strong> der Rohrfernleitungsverordnung oder die<br />
neue Gesetzes- und Verordnungslage <strong>in</strong> NRW zur Überprüfung<br />
der Zustands- und Funktionsfähigkeit privater Abwasserleitungen,<br />
um nur e<strong>in</strong>ige zu nennen.<br />
Absehbar ist, dass sich die Rohrleitungsbranche im Zuge<br />
der Energiewende ändern wird. Dies ist für das Institut<br />
für Rohrleitungsbau Oldenburg Anlass, diesem Thema auf<br />
dem kommenden 28. Oldenburger Rohrleitungsforum e<strong>in</strong>e<br />
Plattforum zu geben. So lautet das Motto am 6. und 7.<br />
Februar 2014 „Rohrleitungen als Teil von Hybridnetzen -<br />
unverzichtbar im Energiemix der Zukunft“. E<strong>in</strong>e <strong>Vorschau</strong><br />
auf das erste Branchen-Highlight 2014 f<strong>in</strong>den Sie <strong>in</strong> dieser<br />
Ausgabe ab Seite 28.<br />
Dass der Impuls e<strong>in</strong>er technischen Weiterentwicklung von<br />
Produkten und Verfahren nicht ausschließlich wirtschaftlich<br />
begründet se<strong>in</strong> muss, zeigt das Interview mit Gernot<br />
Schöbitz, Geschäftsführer der Ste<strong>in</strong>zeug-Keramo GmbH,<br />
11-12 | 2013 1
INHALT<br />
NACHRICHTEN<br />
09<br />
15<br />
Grundste<strong>in</strong>legung bei AUMA<br />
Neuer FBS-Vorstand gewählt<br />
INDUSTRIE & WIRTSCHAFT<br />
6 Grüne Energie aus schwarzem Abwasser: Spatenstich zum Bau „HAMBURG<br />
WATER Cycle“<br />
7 TÜV SÜD und ILF vere<strong>in</strong>baren Zusammenarbeit bei Energieeffizienz<br />
8 Herrenknecht erhält erneut Auszeichnung für PIPE EXPRESS ®<br />
9 Grundste<strong>in</strong>legung bei AUMA<br />
PERSONALIEN<br />
EDITORIAL<br />
1 „Ist denn schon<br />
wieder Weihnachten?“<br />
Nico Hülsdau<br />
10 Friedrich Barth übernimmt GWP-Geschäftsführung<br />
10 VNG besetzt Position im Gase<strong>in</strong>kauf West neu<br />
10 Fritz Brickwedde übernimmt BEE-Vorsitz von Dietmar Schütz<br />
11 Fritz Kuhn zum neuen Vorsitzenden der Bodensee-Wasserversorgung gewählt<br />
IRO VORSCHAU<br />
28 28. Oldenburger<br />
Rohrleitungsforum hat<br />
den Energiemix im Blick<br />
INTERVIEW<br />
36 „E<strong>in</strong> Label für die<br />
Umwelt“<br />
Gernot Schöbitz<br />
VERBÄNDE<br />
11 brbv-Jahresprogramm 2014 erschienen<br />
12 DVGW verleiht Studienpreise Gas und Wasser<br />
13 KRV: Geschäftsklima<strong>in</strong>dex für Kunststoffrohrsysteme im dritten Quartal verbessert<br />
14 Grundstücksentwässerungsanlagen-Experten trafen sich zum ersten GEA-Gipfel <strong>in</strong><br />
Vellmar<br />
15 Neuer FBS-Vorstand gewählt<br />
16 German Water Partnership weitet Aktivitäten nach Nordamerika aus<br />
16 Delegiertenversammlung der BFA Leitungsbau<br />
17 Nachhaltiges Bauen und Nachwuchsförderung: FBS-Bildungspaket für Studierende<br />
VERANSTALTUNGEN<br />
18 wire 2014 und Tube 2014 als globaler Treffpunkt e<strong>in</strong>er gesamten Branche<br />
2 11-12 | 2013
RohRsysteme<br />
aus ste<strong>in</strong>zeug<br />
48<br />
staRk.<br />
nachhaltig.<br />
zukunftsweisend.<br />
Schnellere Lokalisierung gefährlicher Leckagen<br />
18 1. DWA-Grundstücksentwässerungstage<br />
19 Intensivlehrgänge der TU Kaiserslautern zur<br />
qualifizierten Schachtsanierung<br />
20 1. Sanierungsplanungskongress: Schlechte<br />
Planung kostet richtig viel Geld<br />
22 8. SgL zeigt praxisnah Vorteile der grabenlosen<br />
Techniken auf<br />
22 Sem<strong>in</strong>ar zu Sicherheit und Betrieb hochspannungsbee<strong>in</strong>flusster<br />
Pipel<strong>in</strong>e-Netze<br />
23 Tiefbaumesse InfraTech<br />
24 RSV-Praxistag „Schachtsanierung“ <strong>in</strong> Geradstetten<br />
erfolgreich gestartet<br />
24 Call for Papers: RSV-Sem<strong>in</strong>ar zur „Rehabilitation<br />
von Tr<strong>in</strong>kwasserleitungen“<br />
25 280 Teilnehmer und 40 Aussteller bei Nürnberger<br />
Kolloquien zur Kanalsanierung<br />
26 Offenes Kolloquium anlässlich des 65. Geburtstags<br />
von Prof. Dr.-Ing. Bernd Isecke<br />
27 iro-Treffpunkt Gasverteilleitungen<br />
PRODUKTE & NEUHEITEN<br />
48 Schnellere Lokalisierung und E<strong>in</strong>schätzung<br />
gefährlicher Leckagen<br />
49 E<strong>in</strong>e App macht verborgene Infrastruktur sichtbar<br />
50 Qualitätssicherung beim E<strong>in</strong>bau von Harz8<br />
51 Plattenschweißmasch<strong>in</strong>en für Stumpfschweißverb<strong>in</strong>dungen<br />
51 Flexibler Anschluss an große Betonrohre<br />
Ste<strong>in</strong>zeug-Keramo GmbH<br />
Alfred-Nobel-Straße 17 | 50226 Frechen<br />
Telefon +49 2234 507-0<br />
Telefax +49 2234 507-207<br />
E-Mail <strong>in</strong>fo@ste<strong>in</strong>zeug-keramo.com<br />
Internet www.ste<strong>in</strong>zeug-keramo.com<br />
11-12 | 2013
INHALT<br />
FACHBERICHTE<br />
52<br />
66<br />
<strong>Rohrleitungssicherung</strong> <strong>in</strong> <strong>Nordwestdeutschland</strong>: Moor und<br />
Sumpf clever bewältigt<br />
Interdiszipl<strong>in</strong>äre Planung von Netzspülungen unter<br />
Berücksichtigung der biologischen Tr<strong>in</strong>kwasserqualität<br />
RECHT & REGELWERK<br />
39 Konversion – wo verläuft die Grenze zwischen Änderung und vollständig anderem<br />
Vorhaben?<br />
von Dr. Bett<strong>in</strong>a Keienburg, Dr. Michael Neupert<br />
45 DWA-Regelwerk<br />
45 DVGW-Regelwerk<br />
47 DIN-Normen<br />
PIPELINEBAU<br />
52 <strong>Rohrleitungssicherung</strong> <strong>in</strong> <strong>Nordwestdeutschland</strong>: Moor und Sumpf clever bewältigt<br />
von Dr. Frank Krögel, Dipl. Ing. Frank Gehlenborg, Arde Rosendahl, Dipl. Ing. Friedhelm Engbert<br />
SERVICES<br />
23 Messen | Tagungen<br />
98 Marktübersicht<br />
108 Inserentenverzeichnis<br />
109 Buchbesprechung<br />
110 Sem<strong>in</strong>are<br />
113 Impressum<br />
58 Hochdruckleitung für Erdgaskavernenspeicher <strong>in</strong> Rekordzeit verlegt<br />
KORROSIONSSCHUTZ<br />
60 Erhöhter Korrosionsschutz bei Stellantrieben<br />
von Dipl.-Ing. Michael Herbstritt, Dipl.-Ing. Gert Wetzel, Andreas Baumgart, Dipl.-Ing. Dietmar Isele<br />
63 Korrosion gummierter Bauteile mit thermischer Isolierung verzögern<br />
von Helmut Zimmermann<br />
WASSERVERSORGUNG<br />
66 Interdiszipl<strong>in</strong>äre Planung von Netzspülungen unter Berücksichtigung der biologischen<br />
Tr<strong>in</strong>kwasserqualität<br />
von Dipl.-Ing.(FH) Michael Scheideler<br />
4 11-12 | 2013
Kompetenz, die<br />
verb<strong>in</strong>det<br />
90<br />
Leitungsbündel grabenlos mit der Felsbohranlage 18 ACS <strong>in</strong><br />
Jurakalk und bei Gefälle verlegt<br />
ABWASSERENTSORGUNG /<br />
SANIERUNG<br />
74 Altrohr-Zustand III und Grundwasser: Nachweiskonzept<br />
für L<strong>in</strong>er <strong>in</strong> nicht dauerhaft standsicheren<br />
Kanälen<br />
von Dr.-Ing. Dietmar Beckmann, Jacques Kohler<br />
78 Schlauchl<strong>in</strong>erprüfungen – Teil 1: Überblick<br />
von Dr. rer. nat. Jörg Sebastian<br />
Wir suchen Sie!<br />
Als Ingenieur für Anlagenbau<br />
und Pipel<strong>in</strong>es w/m<br />
oder für unser Duales Studium<br />
www.tuev-nord.de/karriere<br />
82 Sanierung e<strong>in</strong>er Druckrohrleitung DN 300 im<br />
V<strong>in</strong>schgau/Südtirol<br />
84 Licht-L<strong>in</strong>er <strong>in</strong> Landau: Grabenlose Sanierung e<strong>in</strong>es<br />
Eiprofils 1350/900<br />
86 Tipp für Bauunternehmer und Handwerker: Erst die<br />
Abwasserleitungen prüfen<br />
von Gerhard Treutle<strong>in</strong><br />
88 Erfurter Eigentümergeme<strong>in</strong>schaft baut Rückstausicherung<br />
GiWA ® -Stop e<strong>in</strong><br />
ENERGIEVERSORGUNG<br />
90 Leitungsbündel grabenlos mit der Felsbohranlage<br />
18 ACS <strong>in</strong> Jurakalk und bei Gefälle verlegt<br />
92 Thermoplastische Großrohre für den Kühlwassertransport<br />
von Maik Brettschneider, Ronald Zierau, Andreas Kunz<br />
TÜV NORD begleitet Sie<br />
über den gesamten Lebenszyklus<br />
Ihrer Pipel<strong>in</strong>es<br />
Planung und Konstruktion<br />
Fertigung, Montage und Inbetriebnahme<br />
Betriebsbegleitung<br />
Rückbau und Stilllegung<br />
Ihr Nutzen:<br />
E<strong>in</strong>haltung hoher Sicherheitsstandards<br />
Reduzierung von Betriebsstörungen<br />
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit<br />
Reduzierung der Ausfall- und<br />
Reparaturkosten<br />
Kontakt: pipel<strong>in</strong>e@tuev-nord.de<br />
96 Kelag Wärme verbessert tech nische Genauigkeit<br />
und unternehmensweite Produktivität mit Bentley<br />
sisNET<br />
www.tuev-nord.de<br />
11-12 | 2013
NACHRICHTEN INDUSTRIE & WIRTSCHAFT<br />
Grüne Energie aus schwarzem Abwasser:<br />
Spatenstich zum Bau „HAMBURG WATER Cycle“<br />
Umweltsenator<strong>in</strong> Jutta Blankau und HAMBURG WASSER-<br />
Geschäftsführer Michael Beckereit haben am 14. Oktober<br />
2013 den symbolischen ersten Spatenstich für den Bau des<br />
neuartigen Abwassersystems HAMBURG WATER Cycle im<br />
Neubaugebiet „Jenfelder Au“ vollzogen. Mit dem HAM-<br />
BURG WATER Cycle erhält die Jenfelder Au, die derzeit auf<br />
dem Gelände der ehemaligen Lettow-Vorbeck-Kaserne<br />
entsteht, e<strong>in</strong> echtes Alle<strong>in</strong>stellungsmerkmal: Sie wird mit<br />
über 600 angeschlossenen Wohne<strong>in</strong>heiten Europas größtes<br />
Wohnquartier, das Abwasserbeseitigung und Energieerzeugung<br />
mite<strong>in</strong>ander komb<strong>in</strong>iert.<br />
Ausgangspunkt für die alternative Energieerzeugung wird<br />
das Toilettenabwasser, das sogenannte Schwarzwasser.<br />
Dieses erfasst der HAMBURG WATER Cycle <strong>in</strong> der Jenfelder<br />
Au separat und führt es e<strong>in</strong>er Aufbereitungsanlage am<br />
Rande des Quartiers zu. Dort vergärt es, wodurch Biogas<br />
entsteht. Das entstehende Biogas wird mithilfe von Kraft-<br />
Wärme-Kopplung vor Ort zu Elektrizität und Wärme umgewandelt.<br />
„Auf diese Weise kann jede zweite Wohnung <strong>in</strong><br />
der Jenfelder Au mit Strom versorgt werden. Außerdem<br />
werden rund 40 Prozent des Wärmebedarfs gedeckt“, hob<br />
HAMBURG WASSER-Geschäftsführer Michael Beckereit die<br />
Vorzüge des neuen Entwässerungssystems hervor.<br />
Anerkennende Worte fand Senator<strong>in</strong> Jutta Blankau: „Ich<br />
b<strong>in</strong> überzeugt: diese Pionieranlage setzt Maßstäbe für die<br />
ökologische Nachhaltigkeit <strong>in</strong> der Stadtentwicklung und<br />
wird das Quartier Jenfelder Au enorm bereichern.“<br />
Zusätzlich zur Biogasproduktion aus Abwasser bietet der<br />
HAMBURG WATER Cycle weiteres Potenzial, um die Abwasseraufbereitung<br />
zu optimieren. Die separate Ableitung des<br />
Toilettenabwassers eröffnet neue Wege, dar<strong>in</strong> enthaltene<br />
Nähr- und Schadstoffe gezielter zurückzugew<strong>in</strong>nen bzw.<br />
zu behandeln. Zu diesem Zweck wird das Projekt wissenschaftlich<br />
begleitet. Die EU-Kommission und das Bundesm<strong>in</strong>isterium<br />
für Bildung und Forschung fördern die bauliche<br />
Umsetzung und wissenschaftliche Begleitung.<br />
Für se<strong>in</strong>e Antwort auf die Frage, wie <strong>in</strong> Wohngegenden<br />
anfallendes Abwasser nachhaltig aufbereitet und zur<br />
Wärme- und Energiegew<strong>in</strong>nung genutzt werden kann,<br />
wurde der HAMBURG WATER Cycle <strong>in</strong> der Jenfelder Au<br />
im Anschluss an den ersten Spatenstich von der Initiative<br />
„Deutschland - Land der Ideen“ ausgezeichnet. Damit ist<br />
das Projekt e<strong>in</strong>er von 100 Preisträgern, die unter dem Motto<br />
„Ideen f<strong>in</strong>den Stadt“ gewürdigt werden. Prämiert werden<br />
Ideen und Projekte, die Lösungen für die Herausforderungen<br />
der Städte und Regionen von morgen bereithalten.<br />
Der HAMBURG WATER Cycle (HWC) ist wegweisend für die<br />
Weiterentwicklung der Siedlungswasserwirtschaft <strong>in</strong> Richtung<br />
e<strong>in</strong>er gesteigerten energetischen und stofflichen Effizienz<br />
und ist mit se<strong>in</strong>er Umsetzung <strong>in</strong> der Jenfelder Au e<strong>in</strong>malig<br />
<strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Größenordnung. Der Bau des HWC wird <strong>in</strong> drei<br />
Bauabschnitten realisiert. Im ersten Bauabschnitt werden die<br />
Grau- und Schwarzwassernetze mit Grauwasserpumpwerk<br />
und Vakuumstation gebaut. Im zweiten Bauabschnitt wird<br />
die Schwarzwasserbehandlungsanlage gebaut. Im dritten<br />
Bauabschnitt werden die Arbeiten mit dem Endausbau der<br />
Grauwasserbehandlungsanlage abgeschlossen.<br />
KONTAKT: HAMBURG WASSER, Ole Braukmann, Tel. +49 40-7888-88222,<br />
E-Mail: ole.braukmann@hamburgwasser.de<br />
Erster Spatenstich für den HAMBURG WATER Cycle <strong>in</strong> der Jenfelder Au<br />
Preisverleihung: HAMBURG WASSER Geschäftsführer Michael<br />
Beckereit (Mitte) nimmt die Auszeichnung der Initiative Land<br />
der Ideen entgegen<br />
6 11-12 | 2013
TÜV SÜD und ILF vere<strong>in</strong>baren<br />
Zusammenarbeit<br />
bei Energieeffizienz<br />
TÜV SÜD und ILF Beratende Ingenieure bieten <strong>in</strong> Zukunft<br />
e<strong>in</strong> komplettes Leistungspaket zur Optimierung der Energieeffizienz<br />
von Anlagen, Gebäuden und technischen<br />
E<strong>in</strong>richtungen an. Die beiden Partner haben e<strong>in</strong> entsprechendes<br />
Memorandum of Understand<strong>in</strong>g (MoU)<br />
unterzeichnet. Vor allem mittelständische Unternehmen<br />
profitieren von der umfassenden Unterstützung bei der<br />
Realisierung von Energieeffizienz-Projekten.<br />
Viele Unternehmen haben e<strong>in</strong>en hohen Informationsund<br />
Qualifikationsbedarf, um Energiee<strong>in</strong>sparpotenziale<br />
zu erkennen und die Energieeffizienz ihres Betriebs zu<br />
verbessern. Dabei stehen zunehmend auch wirtschaftliche<br />
Überlegungen im Vordergrund. TÜV SÜD und ILF<br />
setzen deshalb bei der Umsetzung von Energieeffizienz-<br />
Projekten auf e<strong>in</strong> klar strukturiertes 4-stufiges Vorgehen,<br />
das aus e<strong>in</strong>em Potenzial-Check und der Entwicklung e<strong>in</strong>es<br />
Energiekonzeptes sowie der Projektrealisierung und der<br />
Erfolgskontrolle besteht. In diesem 4-stufigen Vorgehen<br />
ergänzen sich die Beratungskompetenzen von TÜV SÜD<br />
und das zertifizierte Projektmanagement von ILF Beratende<br />
Ingenieure <strong>in</strong> idealer Weise.<br />
„Durch diese Komb<strong>in</strong>ation können wir mittelständische<br />
Unternehmen bei der Umsetzung von Energieeffizienz-<br />
Projekten umfassend begleiten, ohne dass zwischen<br />
Beratung und Umsetzung der Maßnahmen e<strong>in</strong>e Lücke<br />
entsteht“, sagt Dr. Gerd Streubel, Bus<strong>in</strong>ess L<strong>in</strong>e Manager<br />
Industrielle Energieeffizienz von TÜV SÜD. „Gerade bei<br />
Energieeffizienz-Themen ist es wichtig, dass Unternehmen<br />
gesamtenergetisch betrachtet und wirtschaftlich s<strong>in</strong>nvolle<br />
Optimierungsmaßnahmen entwickelt und implementiert<br />
werden“, ergänzt Dipl.-Ing. Thomas Eisebraun, Executive<br />
Consultant – IEE Industrielle Energieeffizienz der ILF Beratende<br />
Ingenieure GmbH. „Durch unsere Zusammenarbeit<br />
und die damit verbundene vollumfängliche Begleitung<br />
stellen wir sicher, dass sich Energieeffizienz-Projekte für<br />
unsere Kunden auch wirklich bezahlt machen.“<br />
Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz unterstützen TÜV SÜD<br />
und ILF Beratende Ingenieure mittelständische Unternehmen<br />
bei der E<strong>in</strong>führung e<strong>in</strong>es Energiemanagementsystems<br />
nach DIN EN ISO 50001, bei der Durchführung<br />
von Energieaudits nach DIN EN ISO 16247-1 sowie bei<br />
der Erstellung von Energiekonzepten und der Realisierung<br />
und F<strong>in</strong>anzierungsunterstützung von Energieeffizienz-<br />
Projekten. Zur Unterstützung gehört auch – soweit das<br />
relevant ist – die Beratung über Fördermittel, EEG-Begrenzung<br />
und den Stromsteuerspitzenausgleich sowie die<br />
Zertifizierung e<strong>in</strong>es Corporate Carbon Footpr<strong>in</strong>t nach<br />
ISO 14064-1.<br />
Das Limit zum Standard machen<br />
Sicher, schnell, explosionsgeschützt<br />
AUMA bietet e<strong>in</strong>e umfangreiche Palette unter schiedlicher<br />
Stell antriebs- und Getriebebaureihen mit entsprechenden Steuerungen,<br />
die weltweit für den E<strong>in</strong>satz <strong>in</strong> explosions -<br />
und feuergefährdeten Bereichen zugelassen s<strong>in</strong>d.<br />
■Im modularen AUMA Konzept perfekt angepasst<br />
■Korrosionsgeschützt und maximal belastbar<br />
■Passend zu allen gängigen Feldbus-Systemen<br />
■Weltweit von führenden Ölgesellschaften zugelassen<br />
Stellantriebe für die Öl- und Gas<strong>in</strong>dustrie<br />
AUMA Riester GmbH & Co. KG<br />
Aumastraße 1 • 79379 Müllheim, Germany<br />
11-12 | 2013<br />
Tel. +49 7631 809-0 • riester@auma.com<br />
www.auma.com<br />
7
NACHRICHTEN INDUSTRIE & WIRTSCHAFT<br />
Herrenknecht erhält erneut Auszeichnung<br />
für PIPE EXPRESS ®<br />
Herrenknecht Pipe Express ® mit dem „IPLOCA New Technologies Award<br />
2013“ ausgezeichnet: Doug Evans, IPLOCA-Präsident und CEO von Gulf<br />
Interstate Eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g, Ulrich Schaffhauser, Vorsitzender der Geschäftsleitung<br />
der Bus<strong>in</strong>ess Unit Utility Tunnell<strong>in</strong>g bei Herrenknecht, John Attrill, Project<br />
General Manager von BP (v. l. n. r.) bei der Preisverleihung<br />
Am 27. September 2013 konnte Herrenknecht <strong>in</strong> Wash<strong>in</strong>gton<br />
(DC) den „IPLOCA New Technologies Award“ für das<br />
neu entwickelte halboffene Verfahren Pipe Express ® entgegennehmen.<br />
Mit Pipe Express ® können oberflächennahe<br />
Pipel<strong>in</strong>es kostengünstig und umweltschonend verlegt<br />
werden. Die IPLOCA (International Pipel<strong>in</strong>e & Offshore<br />
Contractors Association) mit Sitz <strong>in</strong> Genf, Schweiz, repräsentiert<br />
weltweit bedeutende Unternehmen <strong>in</strong> der On- und<br />
Offshore-Pipel<strong>in</strong>ebranche. Alle zwei Jahre, im Rahmen ihrer<br />
Jahreshauptversammlung, verleiht die IPLOCA den von BP<br />
gesponserten IPLOCA-Award für bedeutende Innovationen<br />
<strong>in</strong> der Pipel<strong>in</strong>e-Industrie.<br />
Doug Evans, Präsident der IPLOCA und CEO von Gulf<br />
Interstate Eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g, hob <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Laudatio hervor, dass<br />
Herrenknecht Pipe Express ® bei Pipel<strong>in</strong>eprojekten e<strong>in</strong>en<br />
zentralen Beitrag zur Schonung der Umwelt leisten kann. Da<br />
bei der Entwicklung von Großprojekten der Umweltschutz<br />
e<strong>in</strong>e hohe Bedeutung hat, sei dieser Aspekt für die Jury<br />
ausschlaggebend gewesen. Den Preis nahm Ulrich Schaffhauser,<br />
Vorsitzender der Geschäftsleitung der Bus<strong>in</strong>ess Unit<br />
Utility Tunnell<strong>in</strong>g, während der Veranstaltung entgegen.<br />
Er bedankte sich beim IPLOCA-Präsidenten Doug Evans,<br />
bei John Attrill, Project General Manager von BP und den<br />
<strong>in</strong>ternationalen Fachexperten.<br />
Pipe Express ® ist e<strong>in</strong> neues masch<strong>in</strong>elles Verfahren zur oberflächennahen<br />
Verlegung von Pipel<strong>in</strong>es. Bis zu 2.000 m lange<br />
Pipel<strong>in</strong>es mit e<strong>in</strong>em Durchmesser von 900-1.500 mm (36“-<br />
60“) können damit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em e<strong>in</strong>stufigen Verfahren verlegt<br />
werden. E<strong>in</strong>e Tunnelbohrmasch<strong>in</strong>e löst den Boden, der über<br />
e<strong>in</strong>e mitgeführte Fräse<strong>in</strong>heit direkt zutage gefördert wird.<br />
Gleichzeitig wird die Pipel<strong>in</strong>e unterirdisch verlegt. Da bei<br />
e<strong>in</strong>er deutlich ger<strong>in</strong>geren Trassenbreite die Erdaushubarbeiten<br />
auf e<strong>in</strong> M<strong>in</strong>imum reduziert werden und Grundwasserabsenkungen<br />
nicht notwendig s<strong>in</strong>d, greift Pipe Express ®<br />
<strong>in</strong> deutlich ger<strong>in</strong>gerem Maße <strong>in</strong> die Umwelt e<strong>in</strong> als die<br />
konventionelle offene Bauweise. Der Herrenknecht Pipe<br />
Express ® erhielt damit <strong>in</strong> kurzer Zeit e<strong>in</strong>e zweite Auszeichnung<br />
von hoher Bedeutung. Vor e<strong>in</strong>em halben Jahr wurde<br />
er während der bauma 2013 <strong>in</strong> München mit dem „bauma<br />
Innovationspreis“ ausgezeichnet. Die Entwicklung von Pipe<br />
Express ® wurde vom Bundesumweltm<strong>in</strong>isterium gefördert<br />
mit dem Ziel, e<strong>in</strong> besonders umweltverträgliches und kostengünstiges<br />
Verfahren zur Pipel<strong>in</strong>everlegung zu erarbeiten.<br />
Die neue Technologie zeigt se<strong>in</strong>e Nützlichkeit bereits <strong>in</strong><br />
ersten Projekten. Als erstes Referenzprojekt demonstrierte<br />
das Verfahren beim Bau der „North-South Gas Pipel<strong>in</strong>e“ <strong>in</strong><br />
den Niederlanden se<strong>in</strong>e Leistungsfähigkeit. Dabei erreichte<br />
die Technik Vortriebsspitzenwerte von bis zu 1,20 Metern<br />
pro M<strong>in</strong>ute. Derzeit ist die Anlage <strong>in</strong> Thailand nahe Bangkok<br />
für die „Fourth Transmission Pipel<strong>in</strong>e“ im E<strong>in</strong>satz. Trotz der<br />
Monsunzeit soll die 42“-Gaspipel<strong>in</strong>e auf mehreren Teilabschnitten<br />
bei Überdeckungen von 1,20-2,30 m <strong>in</strong>stalliert<br />
werden. Bei den starken Regenfällen wäre dies im konventionellen<br />
Verfahren mit langen und breiten offenen<br />
Baugruben nicht effizient durchführbar.<br />
INFO<br />
Der neue Newsletter –<br />
alle 14 Tage im Postfach<br />
GAS | WASSER | ABWASSER | PIPELINEBAU | SANIERUNG | KORROSIONSSCHUTZ | FERNWÄRME | ANLAGENBAU<br />
8 11-12 | 2013
INDUSTRIE & WIRTSCHAFT NACHRICHTEN<br />
Grundste<strong>in</strong>legung bei AUMA<br />
Matthias D<strong>in</strong>se, kaufmännischer Geschäftsführer, mauert<br />
die Zeitkapsel e<strong>in</strong>. Dah<strong>in</strong>ter v.l.n.r. der 1. Landesbeamte<br />
Dr. Mart<strong>in</strong> Barth, der technische Geschäftsführer Henrik<br />
Newerla, Bürgermeister<strong>in</strong> Astrid Siemes-Knoblich und<br />
Firmenmitbegründer Werner Riester<br />
Mit der Grundste<strong>in</strong>legung für e<strong>in</strong> Verwaltungsgebäude<br />
am 17. Oktober am Hauptsitz <strong>in</strong> Müllheim hat die AUMA<br />
Riester GmbH & Co. KG die Weichen für weiteres Wachstum<br />
gestellt. AUMA ist e<strong>in</strong> weltweit führender Hersteller elektrischer<br />
Stellantriebe zur Automatisierung von Industriearmaturen.<br />
In den Grundste<strong>in</strong> wurden Bauteile der aktuellen<br />
AUMA-Stellantriebsbaureihen, e<strong>in</strong> Exemplar des Firmenmagaz<strong>in</strong>s,<br />
e<strong>in</strong>e Flasche regionalen We<strong>in</strong>s sowie aktuelle<br />
Tageszeitungen e<strong>in</strong>gelegt.<br />
Nach der Fertigstellung des Baus 2016 werden von hier<br />
aus die <strong>in</strong>ternationalen AUMA-Aktivitäten koord<strong>in</strong>iert.<br />
Die komplexer werdenden Prozesse <strong>in</strong> den prozesstechnischen<br />
Anlagen aller Branchen erfordern immer speziellere<br />
Stellantriebe, sagte der kaufmännische Geschäftsführer<br />
Matthias D<strong>in</strong>se. Um dem damit verbundenen steigenden<br />
Informations- und Schulungsbedarf bei Mitarbeitern und<br />
Kunden gerecht zu werden, enthält der Neubau auf 4.200<br />
m 2 e<strong>in</strong>en Sem<strong>in</strong>arbereich <strong>in</strong>klusive Betriebsrestaurant. Insgesamt<br />
schafft AUMA Raum für ca. 220 Arbeitsplätze auf<br />
7.350 m 2 Bruttogrundfläche. Die Investitionssumme beträgt<br />
20 Mio. Euro.<br />
Pioniere im grabenlosen Leitungsbau seit 1962<br />
Erdraketen · Stahlrohrrammen · HHD-Spülbohrtechnik · Berstl<strong>in</strong><strong>in</strong>g-Technik<br />
Die richtige Verlegetechnik für alle Rohre<br />
TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG · Postfach 4020 · D 57356 Lennestadt<br />
Tel.: +49 (0)2723 8080 · Email: vertrieb@tracto-technik.de · www.tracto-technik.de<br />
11-12 | 2013 9
NACHRICHTEN PERSONALIEN<br />
Friedrich Barth übernimmt GWP-Geschäftsführung<br />
Friedrich<br />
Barth<br />
Zum 1. November 2013<br />
hat Friedrich Barth die<br />
Geschäftsführung der<br />
German Water Partnership<br />
übernommen.<br />
Barth br<strong>in</strong>gt mehr als<br />
20 Jahre Management-<br />
Erfahrung im öffentlichen<br />
und privaten<br />
Sektor <strong>in</strong> der Wasser-,<br />
Umwelt-, Energie- und<br />
Klimapolitik mit. In<br />
der Wasserwirtschaft<br />
bekannt ist Barth vor allem aufgrund se<strong>in</strong>er Mitwirkung an<br />
der Entwicklung der EU-Wasserrahmenrichtl<strong>in</strong>ie <strong>in</strong> der EU-<br />
Kommission. Barth war zudem <strong>in</strong> der deutschen Entwicklungszusammenarbeit<br />
bei der GIZ IS sowie als Mitglied der<br />
Geschäftsleitung bei der IFOK GmbH, e<strong>in</strong>er Strategie- und<br />
Kommunikationsberatung <strong>in</strong> den Bereichen Nachhaltigkeit,<br />
Beteiligung und Dialog, tätig.<br />
Zuletzt war Barth als Senior Adviser Vertreter der Environment<br />
and Energy Group des United Nations Development<br />
Programms <strong>in</strong> Europa. Als Mitbegründer und stellvertretender<br />
Vorstandsvorsitzender der European Water Partnership<br />
(EWP) verfügt Barth zudem über vielfältige Kenntnisse im<br />
Bereich des <strong>in</strong>ternationalen Verbandswesens.<br />
VNG besetzt Position im Gase<strong>in</strong>kauf West neu<br />
Mit Wirkung zum 1. November 2013 übernahm Thomas<br />
Witt für die VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft<br />
(VNG) die Leitung des Bereichs Gase<strong>in</strong>kauf West. Damit<br />
verantwortet er die Gasbeschaffung der VNG von norwegischen<br />
und westeuropäischen Lieferanten. Seit 1. Juli 2013<br />
leitete er den Bereich bereits kommissarisch. Er folgt auf<br />
Mike Diekmann, der im Juli dieses Jahres <strong>in</strong> den Bereich<br />
Strategie und Konzernplanung wechselte.<br />
Thomas Witt hat <strong>in</strong> den vergangenen 21 Jahren bei der<br />
VNG sowohl im Gasverkauf als auch im Gase<strong>in</strong>kauf gearbeitet<br />
und verfügt daher über langjährige Erfahrung <strong>in</strong><br />
der Energiebranche. Er leitete unter anderem den Bereich<br />
Gase<strong>in</strong>kauf LNG/ Sonderprojekte bei der VNG.<br />
Witt wird an Prof. Dr. Klaus-Dieter Barbknecht, Vorstand<br />
Handel, berichten.<br />
Fritz Brickwedde übernimmt BEE-Vorsitz<br />
von Dietmar Schütz<br />
Dr.-Ing. E.h. Fritz Brickwedde wurde am 29. Oktober von<br />
der Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Erneuerbare<br />
Energie (BEE) zum neuen Präsidenten gewählt. Brickwedde<br />
ist Nachfolger von Dietmar Schütz und trat se<strong>in</strong> Amt<br />
am 1. November an.<br />
Schütz, der dem BEE seit Februar 2008 vorgestanden hatte,<br />
wünschte se<strong>in</strong>em Nachfolger viel Erfolg bei se<strong>in</strong>er neuen<br />
Aufgabe und sagte: „Fritz Brickwedde hat große Erfahrung<br />
im Umweltbereich und ist der richtige Mann, um e<strong>in</strong>e CO 2-<br />
freie Zukunft zu schaffen. Dabei wird ihm sicher helfen,<br />
dass er politisch hervorragend vernetzt ist.“<br />
Brickwedde war mehr als 22 Jahre Generalsekretär der<br />
Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), der mit mehr als<br />
2 Mrd. Euro Stiftungsvermögen größten Umweltstiftung der<br />
Welt. Über se<strong>in</strong>e neue Herausforderung beim Spitzenverband<br />
der Erneuerbaren Energien sagt Brickwedde: „Ich habe<br />
mich schon <strong>in</strong> den vergangenen Jahren für das Gel<strong>in</strong>gen der<br />
Energiewende engagiert. Deshalb b<strong>in</strong> ich sehr motiviert, als<br />
Präsident des BEE diesem Ziel zu dienen.“<br />
Brickwedde verweist darauf, dass Erneuerbare Energien<br />
und Energieeffizienz zu den Schwerpunkten der Arbeit<br />
der DBU gehören. Seit ihrer Gründung 1991 habe die DBU<br />
3.800 Projekte auf den Gebieten Energie und Klimaschutz<br />
mit mehr als 530 Mio. Euro gefördert.<br />
Brickwedde: „Auf den kurzfristigen Ausstieg aus der Kernenergie<br />
muss der mittelfristige Ausstieg aus der Kohle folgen.<br />
Und die Erneuerbaren Energien müssen kont<strong>in</strong>uierlich<br />
ausgebaut werden.“<br />
Schütz, der als SPD-Bundestagsabgeordneter e<strong>in</strong>er der<br />
Väter des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) war,<br />
sprach zum Abschied e<strong>in</strong>e Warnung aus: „Das EEG ist<br />
e<strong>in</strong> sehr erfolgreiches Instrument, das behutsam weiterentwickelt<br />
werden sollte. Die neue Koalition darf die Erneuerbaren<br />
Energien nicht ausbremsen. Die Energiewende<br />
wird Deutschlands Stromerzeugung CO 2<br />
-frei machen und<br />
Deutschlands Wirtschaft letztlich noch wettbewerbsfähiger<br />
machen. Wenn wir das geschafft haben, liegen wir<br />
weltweit vorn.“<br />
10 11-12 | 2013
PERSONALIEN / VERBÄNDE NACHRICHTEN<br />
Fritz Kuhn zum neuen Vorsitzenden der Bodensee-<br />
Wasserversorgung gewählt<br />
Bei der Verbandsversammlung der Bodensee-Wasserversorgung<br />
am 12. November 2013 <strong>in</strong> Reutl<strong>in</strong>gen wählten<br />
die Delegierten der 181 Verbandsmitglieder Fritz Kuhn<br />
(Grüne), Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart, zum neuen<br />
Verbandsvorsitzenden.<br />
Gleichzeitig verabschiedeten sie den bisherigen Verbandsvorsitzenden<br />
und ehemaligen Oberbürgermeister der Landeshauptstadt,<br />
Prof. Dr. Wolfgang Schuster und dankten<br />
ihm für die 16-jährige Führung des Verbands.<br />
Die Bodensee-Wasserversorgung ist nach eigenen Angaben<br />
der größte Wasserversorgungszweckverband <strong>in</strong><br />
Deutschland.<br />
Fritz Kuhn (m.) mit den Geschäftsführern der<br />
Bodensee-Wasserversorgung<br />
brbv-Jahresprogramm 2014 erschienen<br />
Das brbv-Jahresprogramm 2014 ist da. Die vom brbv –<br />
Berufsförderungswerk des Rohrleitungsbauverbandes und<br />
der rbv GmbH neu gestaltete Broschüre gibt e<strong>in</strong>en umfassenden<br />
Überblick über die bundesweiten Bildungsangebote<br />
<strong>in</strong> den breitgefächerten Berufsfeldern des modernen<br />
Leitungsbaus – von wichtigen Kernkompetenzen <strong>in</strong> den<br />
Grundlagen- und Praxisschulungen über Informationsveranstaltungen<br />
bis h<strong>in</strong> zu branchenübergreifenden Inhalten.<br />
Zu den Bauste<strong>in</strong>en zählen zahlreiche bewährte Gas/Wasser-<br />
Veranstaltungen, aber auch Zukunftsthemen wie Datennetze,<br />
Angebote zur Personalentwicklung, Nachwuchsförderung<br />
und vieles mehr. Das moderne Layout erleichtert die<br />
Navigation und ermöglicht e<strong>in</strong>e schnelle und zielgerichtete<br />
Auswahl von <strong>in</strong>dividuell zugeschnittenen Angeboten <strong>in</strong><br />
den Sparten Gas/Wasser, Fernwärme, Abwasser, Kabelbau<br />
– Strom, Telekommunikation, Industrie-Rohrleitungsbau<br />
sowie Organisation, Recht und BWL. E<strong>in</strong> entsprechendes<br />
Stichwortverzeichnis sowie e<strong>in</strong>e farbliche Kodierung der<br />
Zielgruppen machen die Orientierung e<strong>in</strong>fach; zudem werden<br />
Ansprechpartner für die jeweiligen Bereiche genannt.<br />
(Foto: rbv)<br />
Das neue brbv-Jahresprogramm 2014 gibt e<strong>in</strong>en umfassenden<br />
Überblick über die Bildungsangebote <strong>in</strong> den spartenübergreifenden<br />
Berufsfeldern des modernen Leitungsbaus<br />
Enorme Angebotsvielfalt<br />
Verb<strong>in</strong>den, vernetzen, versorgen – lautet e<strong>in</strong> Leitsatz des<br />
Rohrleitungsbauverbandes. Er macht die Spannweite des<br />
umfassenden und modernen Weiterbildungsprogramms<br />
deutlich. Moderner Leitungsbau bedeutet, dass die Anforderungen<br />
an Mitarbeiter, die sich mit dem Bau von Leitungen<br />
und Kanälen für Strom, Gas, Wasser, Fernwärme oder Fernmeldee<strong>in</strong>richtungen<br />
beschäftigen, immer anspruchsvoller<br />
und vielfältiger werden. Hightech hat auf den Baustellen<br />
längst E<strong>in</strong>zug gehalten, modernste Verfahren und Masch<strong>in</strong>en<br />
gehören zum Alltag. Deshalb ist branchengerechtes<br />
und lebenslanges Lernen e<strong>in</strong>e Grundvoraussetzung, um<br />
den wachsenden Herausforderungen Rechnung zu tragen.<br />
Die hierfür notwendigen Qualifikationen s<strong>in</strong>d im neuen<br />
Jahresprogramm <strong>in</strong> ihrer gesamten Vielfalt aufgeführt. Die<br />
Inhalte wurden im Austausch mit Kunden, rbv-Mitgliedern,<br />
Kursstätten und bundesweiten Bildungspartnern weiterentwickelt<br />
und angepasst und stellen e<strong>in</strong>en wichtigen Beitrag<br />
zur Verbesserung und zum Erhalt der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit<br />
und damit zum Erfolg der Leitungsbau-<br />
Unternehmen dar.<br />
KONTAKT: brbv - Berufsförderungswerk des Rohrleitungsbauverbandes GmbH,<br />
Köln, Tel. +49 221 37668-20, www.brbv.de<br />
11-12 | 2013 11
NACHRICHTEN VERBÄNDE<br />
DVGW verleiht Studienpreise Gas und Wasser<br />
Der DVGW Deutscher Vere<strong>in</strong> des Gas- und Wasserfaches,<br />
Bonn, hat im Rahmen der gat 2013 drei herausragende<br />
akademische Arbeiten mit dem Studienpreis Gas ausgezeichnet.<br />
Die sieben Nachwuchs<strong>in</strong>genieure wurden bei der<br />
Eröffnungsveranstaltung der gat von DVGW-Vizepräsident<br />
Dr. Jürgen Lenz geehrt. Zudem wurden zwei Nachwuchs<strong>in</strong>genieur<strong>in</strong>nen<br />
bei der Eröffnungsveranstaltung der wat von<br />
DVGW-Präsident Dr. Karl Roth geehrt.<br />
Studienpreis Gas<br />
Sebastian Milter beschäftigt sich <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er an der Ostfalia<br />
Hochschule für angewandte Wissenschaften angefertigten<br />
Bachelorarbeit mit e<strong>in</strong>em Thema, das für alle Netzbetreiber<br />
hohe praktische Bedeutung hat. Er entwickelt<br />
e<strong>in</strong> Assetmanagement-Tool zur Optimierung der Gasnetzsanierung<br />
und wendet es auf den Betrieb der Stadtwerke<br />
Salzgitter an. Die Arbeit von Milter zeigt sehr deutlich, wie<br />
wichtig die technisch-wirtschaftliche Nutzung der vorhandenen<br />
Netze ist. Gerade kle<strong>in</strong>en Netzbetreibern steht mit<br />
diesem Berechnungstool e<strong>in</strong>e geeignete Anwendung zur<br />
Verfügung, Sanierungsfragen mit ger<strong>in</strong>gem f<strong>in</strong>anziellem<br />
Aufwand zu lösen.<br />
Christoph Weber untersucht <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er an der Technischen<br />
Universität Bergakademie Freiberg e<strong>in</strong>gereichten Diplomarbeit<br />
e<strong>in</strong>e komplexe Messtechnik mit großer praktischer<br />
Relevanz für den Bereich der Verbrennungsforschung und<br />
Methodenentwicklung. Weber evaluiert den E<strong>in</strong>satz der<br />
Laser-<strong>in</strong>duzierten Fluoreszenz (LIF) zur berührungslosen<br />
Messung von Temperaturen und Konzentrationsfeldern<br />
fluoreszierender Intermediate <strong>in</strong> Hochtemperaturprozessen.<br />
Die Kohlevergasung wird als Kohleveredelungsprozess<br />
angeführt, die e<strong>in</strong>e effizientere und umweltschonendere<br />
Verwendung von großen Braunkohlevorkommen<br />
ermöglicht.<br />
Jan W<strong>in</strong>kler, Pascal Öhler, Bilal Özkan Lafci, Andreas Krättli<br />
und Rob<strong>in</strong> Mutschler von der Eidgenössischen Technischen<br />
Hochschule Zürich verfolgen <strong>in</strong> ihrer fünfteiligen Bachelorarbeit<br />
geme<strong>in</strong>sam das Ziel, die hoch komplexe Technologie<br />
des Carbon Capture and Storage (CCS) e<strong>in</strong>em breiteren<br />
Interessentenkreis zugänglich zu machen. Dazu wurde das<br />
Projekt „Carbon Storage Showcase“ realisiert. Anhand des<br />
Ausstellungsmodells wird die unterirdische CO 2<br />
-Speicherung<br />
leicht verständlich und anschaulich dargestellt und<br />
erklärt. Das Modell be<strong>in</strong>haltet die Prozessschritte Injektion<br />
des überkritischen CO 2<br />
, Aufstieg und Ausbreitung unter<br />
dem undurchlässigen Deckgeste<strong>in</strong> sowie das „Residual<br />
Trapp<strong>in</strong>g“ vor dem H<strong>in</strong>tergrund der auch <strong>in</strong> der Schweiz<br />
kontrovers geführten Debatte zur CO 2<br />
-Speicherung. Das<br />
Modell wird von Forschern weltweit <strong>in</strong> Laboren und auf<br />
Konferenzen verwendet, um das Verfahren zu diskutieren<br />
und neue Forschungsergebnisse zu präsentieren.<br />
Studienpreis Wasser<br />
Sarah Willach hat sich <strong>in</strong> ihrer an der Universität Duisburg-<br />
Essen e<strong>in</strong>gereichten Masterarbeit mit e<strong>in</strong>em <strong>in</strong> der Wasseranalytik<br />
aktuellen Thema beschäftigt: Der summarischen<br />
Bestimmung von Organofluorverb<strong>in</strong>dungen (AOF), besser<br />
bekannt als Fluorkohlenwasserstoffe, <strong>in</strong> wässrigen Proben.<br />
Frühere Ansätze für e<strong>in</strong>e zusammenfassende Beschreibung<br />
<strong>in</strong> genormten Verfahren waren gescheitert. Neue Geräteentwicklungen<br />
und e<strong>in</strong> durch die Diskussion um derartige<br />
Tenside <strong>in</strong> der Umwelt erzeugter Druck haben die<br />
Forschungssituation verändert. So konnte Sarah Willach<br />
<strong>in</strong> Zusammenarbeit mit dem DVGW-Technologiezentrum<br />
Wasser TZW die AOF-Bestimmung optimieren und auf zahlreiche<br />
kontam<strong>in</strong>ierte und diffus belastete Umweltproben<br />
anwenden. Mit ihrer umfassenden experimentellen Arbeit<br />
leistet Willlach e<strong>in</strong>en wichtigen Beitrag zur Erhaltung unserer<br />
Tr<strong>in</strong>kwasserqualität.<br />
Ludwika Nieradzik hat ihren Abschluss ebenfalls an der Universität<br />
Duisburg-Essen und am Advanced Water Management<br />
Centre <strong>in</strong> Brisbane, Australien, erworben. In ihrer<br />
Masterarbeit konnte sie den Betrieb e<strong>in</strong>er Umkehrosmoseanlage<br />
im Labormaßstab etablieren.<br />
Dabei hat sie neue Analysemethoden für den Membranbelag<br />
entwickelt, die Re<strong>in</strong>igungswirkung von salpetriger<br />
Säure untersucht und e<strong>in</strong> umfangreiches Re<strong>in</strong>igungsprotokoll<br />
ausgearbeitet. Das Thema der Arbeit von Nieradzik<br />
ist vor dem H<strong>in</strong>tergrund der zunehmenden Schließung von<br />
Wasserkreisläufen, der Aufbereitung, Re<strong>in</strong>igung und Wiederverwendung<br />
von Abwasser hochaktuell und von großer<br />
praktischer Bedeutung.<br />
Besuchen Sie uns im Internet:<br />
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
12 11-12 | 2013
VERBÄNDE NACHRICHTEN<br />
KRV: Geschäftsklima<strong>in</strong>dex für<br />
Kunststoffrohrsysteme im dritten<br />
Quartal verbessert<br />
Nachdem der Geschäftsklima<strong>in</strong>dex im 1. Quartal 2013 se<strong>in</strong>en bisherigen Tiefpunkt erreichte<br />
und sich im 2. Quartal spürbar erholte, verbessert sich dieser im 3. Quartal um weitere<br />
10,5 Punkte auf e<strong>in</strong>en Wert von 5,5. Ursächlich ist dabei <strong>in</strong>sbesondere die Verbesserung<br />
der Geschäftslage, deren Index im 3. Quartal 2013 um mehr als 17 Punkte auf e<strong>in</strong>en Wert<br />
von 5,1 gestiegen ist. Am stärksten fielen die Zuwächse bei den Industrierohren und der<br />
Haustechnik aus, deren Absatzniveau im 3. Quartal im Vergleich zu der Ver- und Entsorgung<br />
deutlicher über Vorjahresniveau liegen. Die Bereiche Industrie und Haustechnik profitieren<br />
damit von allgeme<strong>in</strong> verbesserten Marktvoraussetzungen und e<strong>in</strong>er seitens der Rohrhersteller<br />
wahrgenommenen Marktbelebung. Die Geschäftserwartungen deuten für das 4. Quartal<br />
2013 e<strong>in</strong>e voraussichtliche Überschreitung des Absatzniveaus des Vorjahres an. Dies äußert<br />
sich im Index von 5,9, der <strong>in</strong> etwa dem Niveau der aktuellen Geschäftslage entspricht. Die<br />
Bereiche und Industrierohre schneiden auch hier etwas besser ab als die Anwendungsbereiche<br />
der Ver- und Entsorgung. Aber auch <strong>in</strong> diesen Bereichen rechnet die Mehrheit der Unternehmen<br />
aufgrund hoher Anfragetätigkeiten für das 4. Quartal 2013 mit Absatzzahlen über den<br />
des Vorjahres. Dennoch bewegt sich die Ertragslage mit e<strong>in</strong>em Index von -17,6 weiterh<strong>in</strong> im<br />
„negativen“ Bereich. Ursächlich s<strong>in</strong>d im Vergleich zum Vorjahresquartal gestiegene Energie-<br />
und Personalkosten, die<br />
sich <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit Überkapazitäten<br />
und e<strong>in</strong>er hohen<br />
Wettbewerbs<strong>in</strong>tensität bei<br />
den sogenannten Commodities<br />
negativ auf die Verkaufsbzw.<br />
Marktpreise und somit<br />
auf die erzielenden Margen<br />
der Unternehmen auswirken.<br />
Der KRV-Geschäftsklima<strong>in</strong>dex<br />
wird seit Ende 2008<br />
vom Kunststoffrohrverband<br />
erhoben.<br />
Jahrestagung des KRV<br />
Auf der diesjährigen Jahrestagung des Kunststoffrohrverbandes (KRV) am 1. und 2. Oktober<br />
<strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> wurde der Jahresbericht 2013 vorgestellt. Er <strong>in</strong>formiert über die aktuelle Branchenkonjunktur,<br />
die derzeitigen Herausforderungen der Branche sowie die wesentlichen<br />
Ergebnisse der produkt- und herstellerübergreifenden Verbandsaktivitäten. Veränderungen<br />
gab es auch beim Vorstand des KRV.<br />
Claus Brückner, Geschäftsführer der Westfälische Kunststoff Technik GmbH, hatte die<br />
Geschicke des KRV im Verbandsvorstand mehr als 18 Jahre wesentlich mitgestaltet. Infolge<br />
se<strong>in</strong>es bevorstehenden E<strong>in</strong>tritts <strong>in</strong> den Ruhestand gab er den Weg für die Kandidatur<br />
se<strong>in</strong>es designierten Nachfolgers, Dipl.-Ing. Oliver Denz, frei. Mit der Verabschiedung von<br />
Claus Brückner wählte die Mitgliederversammlung anschließend Oliver Denz e<strong>in</strong>stimmig<br />
auf die Dauer von zwei Jahren <strong>in</strong> den KRV-Vorstand. Dieser setzt sich demnach wie folgt<br />
zusammen: Vorsitzender ist Michael Bodmann, Geschäftsführer der Pipelife Deutschland<br />
GmbH & Co. KG, stellv. Vorsitzender ist Thomas Fehl<strong>in</strong>gs, Geschäftsführer der TECE GmbH,<br />
sowie Michael Schuster, Geschäftsführer der Wav<strong>in</strong> GmbH, und Klaus Wolf, Geschäftsführer<br />
der Friatec AG. Auch kann der Verband drei weitere Mitglieder begrüßen. Mit Evonik<br />
Industries AG als Vollmitglied und den Firmen Plasson GmbH und Kuro-Kunststoffe<br />
GmbH als Fördermitglieder hat der Verband Zuwachs erhalten und zählt nun <strong>in</strong>sgesamt<br />
37 Industrieunternehmen zu se<strong>in</strong>en Mitgliedern.<br />
Rohrsysteme<br />
aus GFK<br />
von Amitech<br />
Flowtite-Rohre bestehen aus glasfaserverstärktem<br />
Polyesterharz,<br />
kurz GFK.<br />
GFK ist extrem leicht, enorm fest<br />
und erstaunlich flexibel. Aus GFK<br />
bauen Ingenieure rund um den<br />
Globus Flugzeuge, Schiffe, hoch<br />
beanspruchte Teile im Fahrzeugbau,<br />
und wir bauen daraus Rohre<br />
für Ihre Ansprüche.<br />
Flowtite-Rohre eignen sich für alle<br />
Druck- und drucklosen Anwendungen,<br />
<strong>in</strong> denen traditionell<br />
Guss-, Stahl-, Stahlbeton oder<br />
Ste<strong>in</strong>zeugrohre e<strong>in</strong>gesetzt werden.<br />
Amitech Germany GmbH · Am Fuchsloch 19 ·<br />
04720 Mochau · Tel.: + 49 34 31 71 82 - 0 ·<br />
Fax: + 49 34 31 70 23 24 · <strong>in</strong>fo@amitech-germany.de ·<br />
www.amitech-germany.de<br />
A Member of the<br />
Group<br />
Weitere Informationen unter www.amiantit.com<br />
11-12 | 2013 13
NACHRICHTEN VERBÄNDE<br />
Grundstücksentwässerungsanlagen-Experten trafen<br />
sich zum ersten GEA-Gipfel <strong>in</strong> Vellmar<br />
Für außerhalb von Wasserschutzgebieten gelegene private<br />
Abwasserleitungen werden ke<strong>in</strong>e landesrechtlichen Prüfterm<strong>in</strong>e<br />
mehr vorgegeben, jedoch die Pflicht zur Überwachung<br />
aller privaten Abwasserleitungen bleibt bestehen. Hier hat<br />
der Grundstückseigentümer die Regeln der DIN 1986-30<br />
zu beachten. Nun können die Kommunen per Satzung<br />
entsprechende Regelungen beschließen.<br />
Hervorzuheben ist weiter, dass Kommunen Kraft der neuen<br />
Verordnung künftig zur Beratung der Eigentümer bebauter<br />
Grundstücke verpflichtet s<strong>in</strong>d.<br />
Am 12. November 2013 hat sich <strong>in</strong> Vellmar nun erstmals e<strong>in</strong><br />
Grundstücksentwässerungsanlagen-Expertenkreis bestehend<br />
aus sieben Fachleuten getroffen. Der Expertenkreis ist<br />
sich darüber e<strong>in</strong>ig, dass nicht nur mit der Beratungsverpflichtung<br />
enorme Aufgaben auf die Kommunen zukommen, die<br />
zielgerichtet auszugestalten und umzusetzen s<strong>in</strong>d.<br />
In e<strong>in</strong>em nächsten Schritt wird der Expertenkreis e<strong>in</strong>en<br />
Fachbericht über den gesetzeskonformen Umgang mit<br />
Grundstücksentwässerungsanlagen <strong>in</strong> NRW erarbeiten.<br />
Teilnehmer des 1. GEA-Gipfel <strong>in</strong> Vellmar: Claus Externbr<strong>in</strong>k,<br />
Dr. Michael Scheffler, Horst Zech, Dr. Marco Künster,<br />
Dirk Bell<strong>in</strong>ghausen, Mario Brenner, Marco Schlüter (v.l.n.r.)<br />
Aus der neuen Gesetzes- und Verordnungslage <strong>in</strong> NRW zur<br />
Überprüfung der Zustands- und Funktionsfähigkeit privater<br />
Abwasserleitungen haben sich neue Anforderungen<br />
ergeben. Danach s<strong>in</strong>d Abwasserleitungen <strong>in</strong>dustriell und<br />
gewerblich genutzter Grundstücke <strong>in</strong> Wasserschutzgebieten<br />
bis zum 31. Dezember 2015 erstmalig auf Zustand und<br />
Funktion zu prüfen, soweit die Leitungen vor 1990 errichtet<br />
worden s<strong>in</strong>d. Außerhalb von Wasserschutzgebieten gilt der<br />
31. Dezember 2020 als spätester Prüfterm<strong>in</strong>.<br />
Auch Eigentümer bebauter Grundstücke s<strong>in</strong>d betroffen. Die<br />
neuen Regelungen verpflichten Grundstückseigentümer<br />
<strong>in</strong> Wasserschutzgebieten dazu, ihre Abwasseranlagen bis<br />
Ende 2020 erstmals prüfen zu lassen, soweit nur häusliches<br />
Abwasser abgeleitet wird und diese Anlagen nach 1965<br />
errichtet worden s<strong>in</strong>d. Ältere Abwasserleitungen s<strong>in</strong>d erstmalig<br />
bis zum 31. Dezember 2015 zu prüfen.<br />
Zum Expertenkreis GEA-Gipfel gehören:<br />
»»<br />
Dipl.-Ing. Dirk Bell<strong>in</strong>ghausen, Güteschutz Grundstücksentwässerung,<br />
Hennef<br />
»»<br />
Dipl.-Ing. Mario Brenner, Ingenieurbüro Brenner,<br />
Hennef<br />
»»<br />
Dipl.-Ing. Claus Externbr<strong>in</strong>k, SAL-Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung<br />
Lünen AöR, Lünen<br />
»»<br />
Dr.-Ing. Marco Künster, Güteschutz Kanalbau, Bad<br />
Honnef<br />
»»<br />
Dr.-Ing. Michael Scheffler, Sachverständigen- und<br />
Ingenieurbüro für Gebäude- und Grundstücksentwässerung,<br />
Kassel<br />
»»<br />
Dipl.-Ing. Marco Schlüter, IKT-Institut für Unterirdische<br />
Infrastruktur, Gelsenkirchen<br />
»»<br />
Dipl.-Volkswirt Horst Zech, RSV-Rohrleitungssanierungsverband,<br />
L<strong>in</strong>gen (Ems)<br />
KONTAKT / INFORMATIONEN: www.rsv-ev.de<br />
INFO<br />
Der neue Newsletter –<br />
immer aktuell, immer gut <strong>in</strong>formiert<br />
GAS | WASSER | ABWASSER | PIPELINEBAU | SANIERUNG | KORROSIONSSCHUTZ | FERNWÄRME | ANLAGENBAU<br />
14 11-12 | 2013
Neuer FBS-Vorstand gewählt<br />
Am 13. November fand <strong>in</strong> Frankfurt am Ma<strong>in</strong> die diesjährige Ordentliche Mitgliederversammlung<br />
der FBS - Fachvere<strong>in</strong>igung Betonrohre und Stahlbetonrohre<br />
e.V. statt. Nach der Begrüßung durch die 1. Vorsitzende, Tanja Pöthmann, stand<br />
neben den Berichten von Vorstand, Geschäftsführung, Fachberatung, Technischem<br />
Ausschuss und Market<strong>in</strong>g Ausschuss vor allem die Wahl e<strong>in</strong>es neuen Vorstandes<br />
im Mittelpunkt der Veranstaltung. Hierbei wurde Dipl.-Ing. Erich Valtwies,<br />
Vertriebsleiter der B+F Dorsten GmbH, e<strong>in</strong>stimmig zum neuen 1. Vorsitzenden<br />
gewählt. Neben der neuen Funktion wird Valtwies auch se<strong>in</strong> Amt als Obmann des<br />
Technischen Ausschuss weiterführen. Während Tanja Pöthmann nach dreijähriger<br />
Amtszeit als 1. Vorsitzende und zehnjähriger Tätigkeit im Market<strong>in</strong>g Ausschuss,<br />
Nachhaltig<br />
bauen<br />
Vermögen<br />
erhalten<br />
Foto: FBS<br />
Neuer FBS-Vorstand gewählt: (von l<strong>in</strong>ks) Dipl.-Ing. Hans-Georg Müller (2. Vorsitzender),<br />
Dipl.-Wirtschafts<strong>in</strong>g. Jürgen Röser (Beisitzer), Tanja Pöthmann (ausscheidende 1.<br />
Vorsitzende, Dipl.-Ing. Erich Valtwies (neuer 1. Vorsitzender) und Josef Mayerhofer<br />
(Beisitzer). Nicht auf dem Bild: Cornelia Reiff (Beisitzer<strong>in</strong>)<br />
davon fünf Jahre als Obfrau, aus persönlichen Gründen ausscheidet, wurde Dipl.-<br />
Ing. Hans-Georg Müller, Niederlassungsleiter Werk Nievenheim, BERDING BETON<br />
GmbH, als 2. Vorsitzender bestätigt, ebenso wie Cornelia Reiff, Geschäftsführer<strong>in</strong><br />
Reiff-Beton GmbH & Co.KG als Beisitzer<strong>in</strong>. Weiterh<strong>in</strong> als Beisitzer gewählt wurden<br />
Josef Mayerhofer, Vertriebsleiter HABA-BETON Johann Bartlechner KG und Dipl.-<br />
Wirtschafts<strong>in</strong>genieur Jürgen Röser, Geschäftsführer Zementrohr- und Betonwerke<br />
Karl Röser & Sohn GmbH. Als neuer Obmann des Market<strong>in</strong>g-Ausschusses wurde<br />
Dipl.-Ing. Peter Wolfstädter, Niederlassungsleiter Werk Möhnesee, BERDING<br />
BETON GmbH im Amt bestätigt.<br />
Seit über zweie<strong>in</strong>halb Jahrzehnten setzt sich die FBS für e<strong>in</strong>en hohen Qualitätsstandard<br />
von Rohren und Schächten aus Beton und Stahlbeton e<strong>in</strong>. Dabei ist es<br />
der FBS und ihren Mitgliedern gelungen, den FBS-Qualitätsgedanken <strong>in</strong> den Markt<br />
e<strong>in</strong>zuführen: Das FBS-Qualitätszeichen hat sich bei Planern und Auftraggebern <strong>in</strong><br />
hohem Maße etabliert. Anlass genug, <strong>in</strong> Frankfurt wieder e<strong>in</strong>e positive Bilanz zu<br />
ziehen. Gleichzeitig richteten Mitglieder und Fachvere<strong>in</strong>igung den Blick nach vorn.<br />
Der neue 1. Vorsitzende Erich Valtwies macht sich <strong>in</strong>sbesondere für das Thema<br />
„Qualität“ stark. Hierzu müssen alle an e<strong>in</strong>em Strang ziehen, um den bisherigen<br />
Standard aufrecht zu erhalten und weiter auszubauen. Um die Kenntnisse über<br />
FBS-Betonbauteile auch an die junge Generation weiter zu geben, unterstützt<br />
Erich Valtwies im besonderen Maße die FBS-Hochschulen<strong>in</strong>itiative.<br />
Die nächste FBS-Mitgliederversammlung f<strong>in</strong>det am 12. November 2014 statt.<br />
Ihr Partner bei<br />
der Bewertung<br />
der<br />
Fachkunde,<br />
technischen<br />
Leistungsfähigkeit,<br />
technischen<br />
Zuverlässigkeit<br />
der ausführenden<br />
Unternehmen.<br />
Gütesicherung Kanalbau<br />
RAL-GZ 961<br />
www.kanalbau.com<br />
11-12 | 2013 15
NACHRICHTEN VERBÄNDE<br />
German Water Partnership weitet Aktivitäten nach<br />
Nordamerika aus<br />
GWP-Länderforen (Stand 11/2013)<br />
Mit Neugründung des Länderforums Nordamerika und dem<br />
Zusammenschluss mit dem Länderforum Mexiko treibt German<br />
Water Partnership (GWP) die Geschäftsanbahnungen<br />
<strong>in</strong> der Region zielgerichtet voran. USA und Kanada rücken<br />
zunehmend <strong>in</strong> den Fokus der <strong>in</strong>ternationalen Aktivitäten von<br />
GWP. Ziel der Gründung des Länderforums Nordamerika<br />
(Kanada, USA) ist die Identifizierung der wasserwirtschaftlichen<br />
Herausforderungen <strong>in</strong> der Region durch Zusammenführung<br />
und Intensivierung von Mitglieder-Aktivitäten, um<br />
das Netzwerk <strong>in</strong> der Region sowohl im Industrie- als auch im<br />
Forschungsbereich auszubauen, u. a. sollen die Potenziale<br />
und möglichen Vertriebswege <strong>in</strong> den Märkten ermittelt<br />
sowie Service- und Market<strong>in</strong>gkonzepte für die Zielregionen<br />
identifiziert werden. Durch den Zusammenschluss mit<br />
dem Länderforum Mexiko werden die Kompetenzen und<br />
Erfahrungen noch stärker gebündelt.<br />
„Die Gründung des Länderforums Nordamerika stärkt<br />
die Präsenz von GWP auf dem amerikanischen Kont<strong>in</strong>ent<br />
und trägt der Bedeutung dieses großen Wassermarktes<br />
Rechnung. Durch die Integration des Länderforums Mexiko<br />
ergeben sich Synergien und neue Impulse für die aktiven<br />
Mitglieder von GWP, die <strong>in</strong> dem geme<strong>in</strong>samen Wirtschaftsraum<br />
NAFTA bereits tätig s<strong>in</strong>d oder tätig werden wollen.“,<br />
so Arm<strong>in</strong> Müller (Festo AG), zuständiger Leiter für Mexiko.<br />
Zum Leiter des Länderforums wurde Dirk Ruppert (KSB AG)<br />
mit Fokus auf Kanada gewählt. Die stellvertretenden Länderforenleiter<br />
s<strong>in</strong>d Stefan Peikert (AHP International GmbH<br />
& Co.KG), zuständig für USA und Arm<strong>in</strong> Müller (Festo AG),<br />
zuständig für Mexiko.<br />
Seit 2012 knüpft GWP spezifische Kontakte und führt verschiedene<br />
Aktivitäten durch: Im Herbst 2012 rief die German<br />
American Chamber of Commerce of the Midwest (AHK<br />
USA-Chicago) die German American Water Technology<br />
Initiative <strong>in</strong>s Leben. Mit dieser Initiative wurde e<strong>in</strong>e Plattform<br />
für Know-how-, Technologie- und wirtschaftlichen<br />
Austausch zwischen den USA und Deutschland im Bereich<br />
Wasser etabliert.<br />
Delegiertenversammlung der BFA Leitungsbau<br />
Quelle: GWP<br />
Delegierte aus den Landesfachabteilungen trafen sich am<br />
3. September 2013 <strong>in</strong> Frankfurt/Ma<strong>in</strong> unter Leitung des<br />
Vorsitzenden Dipl.-Ing. Andreas Burger zur Mitgliederversammlung<br />
der Bundesfachabteilung Leitungsbau (BFA<br />
LTB). Das Leitungsbaugremium des Hauptverbandes der<br />
Deutschen Bau<strong>in</strong>dustrie e.V. (HDB) ist das Sprachrohr der<br />
Leitungsbauunternehmen gegenüber Bundesorganisationen<br />
und Bundespolitik. Dementsprechend vielfältig waren die<br />
Themen, die diskutiert wurden. Zur Tagesordnung zählten<br />
Punkte wie Kommunikation, Gremienarbeit und Energiewende.<br />
Neben der Debatte zu aktuellen Entwicklungen<br />
des Marktes nahm der Bericht der Geschäftsführung e<strong>in</strong>en<br />
wichtigen Teil der Versammlung e<strong>in</strong>.<br />
In se<strong>in</strong>em Bericht ließ BFA LTB-Geschäftsführer Dipl.-<br />
Wirtsch.-Ing. Dieter Hesselmann die Aktivitäten der BFA<br />
Revue passieren. Traditionsgemäß nimmt die BFA LTB Stellung<br />
zu aktuellen politischen Entwicklungen. Das erfolgt<br />
u. a. über <strong>in</strong>terne Rundschreiben oder externe Stellungnahmen<br />
und Pressemitteilungen. Themen gab es viele, wie z. B.<br />
das geme<strong>in</strong>sam von BFA LTB, rbv und GLT (Gütegeme<strong>in</strong>schaft<br />
Leitungstiefbau e. V) herausgegebene Positionspapier<br />
zum Breitbandausbau <strong>in</strong> Deutschland, den Zustandsbericht<br />
von BFA LTB und rbv zum Netzentwicklungsplan Gas, die<br />
Zusammenfassung zum Netzentwicklungsplan Strom 2012<br />
sowie Stellungnahmen zu marktrelevanten Themen wie<br />
Micro-/M<strong>in</strong>i-Trench<strong>in</strong>g, dem neuen Landeswassergesetz<br />
zur Dichtheitsprüfung <strong>in</strong> NRW oder der EU-Verordnung<br />
Breitbandausbau.<br />
„Darüber h<strong>in</strong>aus gehört die Gremienarbeit zu den schlagkräftigen<br />
Instrumenten, mit der die wirtschaftlichen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
für die Leitungsbauunternehmen stetig verbessert<br />
werden sollen“, erläuterte Burger. In zahlreichen <strong>in</strong>ternen<br />
und externen Gremien br<strong>in</strong>gen die Vertreter der Leitungsbauunternehmen<br />
die Me<strong>in</strong>ung und Expertise der Branche<br />
e<strong>in</strong>. Hesselmann g<strong>in</strong>g außerdem auf die Arbeit der Landesfachabteilungen<br />
e<strong>in</strong>, „<strong>in</strong> denen die anstehenden Marktthemen<br />
konstruktiv fortgeführt werden und deren Zusammenarbeit<br />
mit der Bundesfachabteilung sich immer mehr e<strong>in</strong>spielt.“<br />
16 11-12 | 2013
VERBÄNDE NACHRICHTEN<br />
Nachhaltiges Bauen und Nachwuchsförderung:<br />
FBS-Bildungspaket für Studierende<br />
Foto: HS-OWL, Heike Witte<br />
In der Mitte von rechts: Prof. Dr.-Ing. Ute Austermann-Haun (HS-OWL), Bett<strong>in</strong>a Friedrichs (FBS), Dipl.-Ing. Daniela Fiege (Stadtwerke<br />
Osnabrück) und Studenten des 5. Semesters Bau<strong>in</strong>genieurwesen, Vertiefung Wasserwesen, an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe<br />
<strong>in</strong> Detmold am 10. Oktober 2013 während der Vorlesung „Rohrleitungen und Kanalnetzplanung“ im W<strong>in</strong>tersemester 2013<br />
Das Planen, Bauen und Betreiben von Abwasserkanälen<br />
und -leitungen wird <strong>in</strong> der universitären Ausbildung nur<br />
untergeordnet gelehrt, obwohl die Kanalisation e<strong>in</strong>e der<br />
größten kommunalen Anlagevermögenpositionen ist sowie<br />
e<strong>in</strong> <strong>in</strong>teressantes Betätigungsfeld für Bau<strong>in</strong>genieure darstellt.<br />
Der Fachkräftemangel <strong>in</strong> der Baubranche ist jetzt schon e<strong>in</strong><br />
großes Problem, das sich <strong>in</strong> Zukunft noch verschärfen wird.<br />
Viele Unternehmen klagen über nicht gut vorbereiteten<br />
Nachwuchs, s<strong>in</strong>d aber bereit, dieses Manko bei persönlicher<br />
guter Eignung der Bewerber auszugleichen und <strong>in</strong>vestieren<br />
Zeit und Wissen <strong>in</strong> deren Ausbildung. Eigentlich müsste es<br />
leicht se<strong>in</strong>, junge Menschen für den Beruf des Tiefbau<strong>in</strong>genieurs<br />
zu begeistern, da der Ingenieur maßgeblich am<br />
Erfolg e<strong>in</strong>es Projektes beteiligt ist.<br />
Die Fachvere<strong>in</strong>igung Betonrohre und Stahlbetonrohre e.V.<br />
als Vertretung aller namhaften Hersteller von Rohren und<br />
Schächten aus Beton und Stahlbeton <strong>in</strong> FBS-Qualität hat<br />
es sich im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit zur Aufgabe<br />
gemacht, Studierenden e<strong>in</strong>e breit aufgestellte und fundierte<br />
Wissensbasis über die „Planung, Bauausführung und den<br />
Betrieb von Abwasserkanälen und -leitungen“ zu vermitteln.<br />
Dafür wurde mit Fachleuten e<strong>in</strong> umfangreiches Bildungspaket<br />
für Studierende entwickelt. Dies ist auf CD-ROM<br />
kostenfrei <strong>in</strong> der FBS-Geschäftsstelle erhältlich.<br />
können. Das Bildungspaket setzt sich aus Vorträgen, Lehrfilmen<br />
und Schriften zusammen.<br />
E<strong>in</strong>ladungen zum „FBS-Hochschulentag“ z. B. auf der „IFAT-<br />
Weltmesse für Wasser, Abwasser, Abfall- und Rohstoffwirtschaft“<br />
und der „Wasser Berl<strong>in</strong> International-Fachmesse<br />
und Kongress Wasser und Abwasser“, bei dem Studierende<br />
von bautechnisch und siedlungswasserwirtschaftlich ausgerichteten<br />
Studiengängen Informationen zu Planung, Bau<br />
und Betrieb von Abwasserleitungen und -kanälen erhalten,<br />
runden die Hochschulen<strong>in</strong>itiative ab.<br />
Angebot für Hochschulen und Universitäten<br />
Die FBS richtet sich mit dem Bildungspaket vorrangig an<br />
Hochschullehrer und -professoren, die auf Wunsch mit<br />
Gastvorträgen im laufenden Semester unterstützt werden<br />
11-12 | 2013 17
NACHRICHTEN VERANSTALTUNGEN<br />
wire 2014 und Tube 2014 als globaler Treffpunkt e<strong>in</strong>er<br />
gesamten Branche<br />
Bereits zum 14. Mal präsentieren sich die beiden globalen<br />
Leitmessen wire und Tube vom 7. bis zum 11. April 2014<br />
auf dem Düsseldorfer Messegelände. Sie zeigen geballte<br />
Technologiepower aus den Bereichen der Draht- und<br />
Kabelver- und bearbeitung, der Rohrverarbeitung und der<br />
Bearbeitung von Rohren auf e<strong>in</strong>er Gesamtfläche von mehr<br />
als 100.000 Nettoquadratmetern. Insgesamt werden rund<br />
2.500 Aussteller erwartet.<br />
Das Angebot der wire 2014 reicht von Masch<strong>in</strong>en zur<br />
Drahtherstellung und Veredelung, Gitterschweißmasch<strong>in</strong>en,<br />
Werkzeugen und Hilfsmaterialien zur Verfahrenstechnik<br />
bis h<strong>in</strong> zu Werkstoffen und Spezialdrähten. Innovationen<br />
aus den Bereichen Kabel-, Mess-, Steuer- und Regeltechnik<br />
sowie Prüftechnik ergänzen das Angebot. Spezialgebiete<br />
wie Logistik, Fördersysteme und Verpackungen werden<br />
außerdem gezeigt.<br />
Die wire erstreckt sich über die Hallen 9 bis 12 und 15 bis<br />
17. Die Bereiche Draht-, Kabel- und Glasfasermasch<strong>in</strong>en,<br />
Draht- und Kabelproduktion sowie der Handel mit Drähten<br />
und Kabeln bef<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> den Hallen 9 bis 12, 16 und<br />
17. Die Umformtechnik (Fastener Technology) ist <strong>in</strong> Halle<br />
15 zu f<strong>in</strong>den, die Federfertigungstechnik (Spr<strong>in</strong>g Mak<strong>in</strong>g)<br />
und die Gitterschweißmasch<strong>in</strong>en (Mesh Weld<strong>in</strong>g Mach<strong>in</strong>ery)<br />
bef<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> der Halle 16. Zum ersten Mal ist der Bereich<br />
der Gitterschweißmasch<strong>in</strong>en kompakt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Halle als<br />
Sonderschau vere<strong>in</strong>t.<br />
Die Tube präsentiert ihr Angebot 2014 <strong>in</strong> den Hallen 1 bis<br />
7.0 und der Halle 7a. Gezeigt wird die gesamte Palette von<br />
der Rohrherstellung über die Rohrbearbeitung bis h<strong>in</strong> zur<br />
Rohrverarbeitung.<br />
Zum ersten Mal gibt es die Sonderschau Plastic Tube Forum<br />
<strong>in</strong> der Halle 7.1. Das weitere Angebot reicht von Rohmaterialien,<br />
Rohren und Zubehör, Masch<strong>in</strong>en zur Herstellung<br />
von Rohren und Gebrauchtmasch<strong>in</strong>en über Werkzeuge<br />
zur Verfahrenstechnik und Hilfsmittel bis h<strong>in</strong> zu Mess-,<br />
Steuer- und Regeltechnik. Prüftechnik und Spezialgebiete<br />
wie Lagerautomatisierung sowie Steuerungs- und Kontrollanlagen<br />
ergänzen die umfangreiche Angebotspalette.<br />
Rohrzubehör bef<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> den Halle 1 und 2, der Handel<br />
mit Rohren und die Rohrherstellung schließt sich <strong>in</strong> den<br />
Hallen 2 bis 4 und der Halle 7.0/7.1 an.<br />
Die Umformtechnik ist <strong>in</strong> Halle 5 zu f<strong>in</strong>den, Rohrbearbeitungsmasch<strong>in</strong>en<br />
bef<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> den Hallen 6 und 7a.<br />
Masch<strong>in</strong>en und Anlagen werden <strong>in</strong> Halle 7a präsentiert,<br />
das neue Plastic Tube Forum wird <strong>in</strong> der Halle 7.1 se<strong>in</strong> und<br />
Profile bef<strong>in</strong>den sich flächendeckend <strong>in</strong> den Hallen 1 bis 7.0.<br />
KONTAKT: www.wire.de, www.Tube.de<br />
1. DWA-Grundstücksentwässerungstage<br />
Mit der Instandhaltung von Grundstücksentwässerungsanlagen<br />
und dem Umgang mit Niederschlagswasser befassen<br />
sich am 21. und 22. Januar 2014 die ersten DWA-Grundstücksentwässerungstage<br />
<strong>in</strong> Fulda.<br />
Die Deutsche Vere<strong>in</strong>igung für Wasserwirtschaft, Abwasser<br />
und Abfall e. V. (DWA) organisiert die bisherige „Geme<strong>in</strong>schaftstagung<br />
Gebäude- und Grundstücksentwässerung“<br />
unter neuem Namen, da sich neben dem bisherigen Mitveranstalter<br />
Zentralverband Sanitär und Heizung (ZVSHK) nun<br />
auch der Verband der Rohr- und Kanal-Technik-Unternehmen<br />
e. V. (VDRK) und die Gütegeme<strong>in</strong>schaft Grundstücksentwässerung<br />
mit ihren Mitgliedern Güteschutz Kanalbau,<br />
GFA und GET als Träger beteiligt.<br />
Der erste Tag der Tagung widmet sich den aktualisierten<br />
Güte- und Prüfbestimmungen zum Erhalt des Gütezeichens<br />
Grundstücksentwässerung und stellt das neugefasste Merkblatt<br />
DWA-M 190 vor. Außerdem werden die vorgesehenen<br />
Regelungen zur Zustandsprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen<br />
für Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen und Baden-Württemberg<br />
erläutert und aus kommunaler Sicht kommentiert.<br />
Praktische Beispiele zeigen, welche Verfahren sich für die<br />
Sanierung von Schäden <strong>in</strong> Grundstücksentwässerungsanlagen<br />
bewährt haben und wo ihre Grenzen liegen. Auswahlund<br />
Anwendungsfehler kommen ebenfalls zur Sprache.<br />
Am zweiten Tag wird das Thema Niederschlagswasser<br />
unter dem Aspekt der Auswirkungen auf Planung und<br />
Bau von Grundstücksentwässerungsanlagen beleuchtet.<br />
Über die hydraulische Berechnung von bereits vorhandenen<br />
Anlagen wird ebenso berichtet wie über<br />
Möglichkeiten der Versickerung, der Rückhaltung und<br />
der Drosselung von Niederschlagswasser, wenn die<br />
Ableitung <strong>in</strong> Abwasseranlagen begrenzt ist. E<strong>in</strong> weiteres<br />
Feld ist der qualitative Umgang mit Niederschlagswasser<br />
<strong>in</strong> Behandlungsanlagen sowie die Normentwürfe<br />
für Leichtflüssigkeits- und Fettabscheideranlagen.<br />
KONTAKT: Deutsche Vere<strong>in</strong>igung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall<br />
e. V., Sarah Heimann, Tel. +49 2242 872-192, E-Mail: heimann@<br />
dwa.de<br />
18 11-12 | 2013
VERANSTALTUNGEN NACHRICHTEN<br />
Intensivlehrgänge der TU Kaiserslautern zur<br />
qualifizierten Schachtsanierung<br />
Die TU Kaiserslautern führt 2014 wieder <strong>in</strong> Kooperation mit<br />
dem Fachbereich ombran der MC-Bauchemie die Lehrgangsreihe<br />
„CROM – Zertifizierte Schachtsanierung“ (Certified<br />
Rehabilitation of Manholes) durch. Die Intensivlehrgänge<br />
richten sich an ausführende Unternehmen und erstmalig<br />
auch an planende Ingenieure und Kanalnetzbetreiber. Sie<br />
f<strong>in</strong>den vom 17. bis zum 20. Februar 2014 <strong>in</strong> Bottrop statt.<br />
In den vergangenen Jahren s<strong>in</strong>d große Anstrengungen zur<br />
Sanierung der Entwässerungsnetze unternommen worden,<br />
allerd<strong>in</strong>gs konzentrierten sich diese überwiegend auf<br />
die Kanalhaltungen. Dabei treten auch bei Schächten und<br />
anderen begehbaren Kanalbauwerken vielfältige Schäden<br />
auf, deren Behebung fachspezifisches Wissen sowie Knowhow<br />
erfordert und hohe Anforderungen an Planer sowie<br />
Verarbeiter stellt. Vor diesem H<strong>in</strong>tergrund hat Prof. Dr.-<br />
Ing. Karsten Körkemeyer, Lehrstuhl für Baubetrieb und<br />
Bauwirtschaft der TU Kaiserslautern, zusammen mit dem<br />
Fachbereich ombran der MC-Bauchemie die Lehrgangsreihe<br />
„CROM – Zertifizierte Schachtsanierung“ entwickelt, bei der<br />
Experten aus Forschung und Praxis ihr fundiertes Wissen<br />
zur Sanierung weitergeben. Während sich das Angebot<br />
bisher nur an bauausführende Sanierungsunternehmen<br />
richtete, wird 2014 erstmalig auch e<strong>in</strong> Lehrgang für Planer<br />
und planende Kanalnetzbetreiber angeboten.<br />
Alle Lehrgangs<strong>in</strong>halte werden zunächst theoretisch vermittelt<br />
und anschließend <strong>in</strong> mehreren praktischen Teilen vertieft.<br />
Jeder Kursteilnehmer erhält damit Gelegenheit, alle wesentlichen<br />
Sanierungsschritte praktisch zu üben – angefangen<br />
bei der Untergrundvorbehandlung über Abdichtungsmaßnahmen<br />
bis h<strong>in</strong> zur Applikation von Sanierungsmaterialien<br />
und Qualitätsprüfung des Sanierungsergebnisses.<br />
KONTAKT: TU Kaiserslautern, FG Baubetrieb und Bauwirtschaft, Kaiserslautern,<br />
Prof. Dr.-Ing. Karsten Körkemeyer, Tel. +49 631 205-3467,<br />
E-Mail: karsten.koerkemeyer@bau<strong>in</strong>g.uni-kl.de<br />
MC-Bauchemie, Fachbereich ombran, Bottrop, Gunter Kaltenhäuser<br />
Tel. +49 2041 101-192, gunter.kaltenhaeuser@mcbauchemie.de<br />
Tiefbaumesse InfraTech<br />
15. - 17. Januar 2014<br />
Messe Essen, Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
adv-IFTDuitsland_182x125mm_bezoekers-DUI-drukklaar.<strong>in</strong>dd 1<br />
10/21/2013 9:37:26 AM<br />
11-12 | 2013 19
NACHRICHTEN VERANSTALTUNGEN<br />
1. Sanierungsplanungskongress: Schlechte Planung<br />
kostet richtig viel Geld<br />
Die unzureichende Konzeption und Unterhaltung von<br />
Kanalnetzen führt zu schlechten technischen und wirtschaftlichen<br />
Ergebnissen. Die Netzbetreiber müssen mit<br />
höheren Betriebskosten rechnen und die Bürger zahlen die<br />
Zeche <strong>in</strong> Form von steigenden Gebühren. Damit entsteht e<strong>in</strong><br />
volkswirtschaftlicher Schaden, der bei e<strong>in</strong>er systematischen<br />
Bedarfsplanung als Grundlage wirtschaftlicher und nachhaltiger<br />
Maßnahmen zur Kanalnetzunterhaltung durchaus<br />
vermeidbar ist. Wie lassen sich Kanalnetze fit machen für<br />
die Zukunft? Um diese Frage geht es beim Sanierungsplanungskongress<br />
2014, zu dem der Verband Zertifizierter<br />
Sanierungsberater für Entwässerungssysteme e. V. (VSB)<br />
geme<strong>in</strong>sam mit der DWA Deutsche Vere<strong>in</strong>igung für Wasserwirtschaft,<br />
Abwasser und Abfall e.V. die politisch und<br />
technisch Verantwortlichen der Kanalnetzbetreiber, Mitarbeiter<br />
von Fachbehörden sowie planende Ingenieure am 12.<br />
und 13. Februar 2014 nach Kassel e<strong>in</strong>lädt. Der Kongress mit<br />
begleitender Fachausstellung stellt die Herausforderungen<br />
für Kanalnetzbetreiber <strong>in</strong> den Fokus. Die Beiträge verdeutlichen<br />
die Wichtigkeit der Substanzerhaltung im S<strong>in</strong>ne des<br />
Vermögensschutzes, die Auswirkungen kommunalpolitisch<br />
bee<strong>in</strong>flusster adm<strong>in</strong>istrativer und organisatorischer Aspekte<br />
bis h<strong>in</strong> zu neuen normativen Vorgaben für die Sanierungsplanungen<br />
für Kanalnetze.<br />
Komplexe strategische Aufgabe<br />
Modernes Kanalnetzmanagement ist e<strong>in</strong>e komplexe strategische<br />
Aufgabe, bei deren Umsetzung vieles beachtet<br />
werden muss. Das fängt beim Kanalnetzmanagement an,<br />
auf dessen politische und adm<strong>in</strong>istrative Aspekte der erste<br />
Vortragsblock e<strong>in</strong>geht. Moderne Netzstrategie berücksichtigt<br />
zunehmend Parameter wie Starkregenereignisse und die<br />
daraus resultierenden oberflächlichen Abflüsse, aus deren<br />
Volumen sich durchaus Rückschlüsse auf die Dimensionierung<br />
von Kanalnetzen wenn nicht gar der Stadtgestaltung<br />
ziehen lassen. Alles ist irgendwie vone<strong>in</strong>ander abhängig,<br />
nichts e<strong>in</strong>zeln zu betrachten. Wie gehe ich als Kommune mit<br />
dem mir zur Verfügung stehenden Raum überhaupt um?<br />
Stadtentwicklung hat sich längst zu e<strong>in</strong>er Herausforderung<br />
für die Wasserwirtschaft entwickelt. Wie diese <strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelnen<br />
Kommunen gehandhabt wird, und welche Entscheidungsprozesse<br />
zur Festlegung notwendiger Projekte erforderlich<br />
s<strong>in</strong>d, machen die Referenten exemplarisch deutlich.<br />
Selber machen oder delegieren<br />
Um die Aufgaben stemmen zu können, braucht man<br />
geeignete Mitarbeiter <strong>in</strong> ausreichender Zahl. Das greift<br />
folgerichtig die Überschrift e<strong>in</strong>es Themenblocks auf, der<br />
sich mit „Organisation kommunaler Aufgaben“ bzw. „Aufgabenfülle<br />
versus Personalabbau“ befasst. Die Aufgaben<br />
des Netzbetreibers h<strong>in</strong>sichtlich Planung und Organisation<br />
haben weichenstellenden Charakter. Ob man Lösungen<br />
alle<strong>in</strong>e erarbeitet, oder im Verbund mit anderen? Mitarbeiter<br />
von Entsorgungsbetrieben und kommunalen Behörden<br />
nehmen hierzu Stellung. „Der Netzbetreiber muss nicht<br />
alles selbst machen, aber er muss sagen, was er will und<br />
se<strong>in</strong>e Bauherrenaufgaben wahrnehmen“, erklärt Dipl.-Ing.<br />
(FH) Markus Vogel, Initiator des Kongresses auf Seiten des<br />
VSB. Wie stelle ich mich personell auf, um me<strong>in</strong>e Aufgaben<br />
zu erfüllen, lautet e<strong>in</strong>e entscheidende Frage. Wenn der<br />
eigene Personalstamm nicht ausreicht, können sich Kommunen<br />
zusammenschließen und die Aufgaben geme<strong>in</strong>sam<br />
lösen oder Betreiberfunktionen delegieren. Auch dies ist e<strong>in</strong><br />
Thema des Kongresses.<br />
Fotos: VSB<br />
Das geht uns alle an: Die unterirdische Infrastruktur zählt zu den größten<br />
Werten unserer Gesellschaft. Fundierte und vorausschauende Planung ist<br />
Substanzerhaltung im S<strong>in</strong>ne des Vermögensschutzes<br />
Vorteile strategischer Planung<br />
Werden die Aufgaben vernachlässigt, die sich aus der Verantwortung<br />
für das Leitungsnetz ergeben, hat das negative<br />
Auswirkungen. Was dabei auf der Strecke bleibt, ist allerd<strong>in</strong>gs<br />
nicht nur die Infrastruktur. Kanalnetzunterhaltung<br />
muss letztlich als Generationenaufgabe verstanden werden,<br />
für die wir alle Verantwortung tragen. Deshalb gilt es bei<br />
allen Planungen schon heute den Blick <strong>in</strong> die Zukunft zu<br />
richten. Unter den Stichworten „Entwicklung des Kanalnetzes“<br />
und „Technik versus kurzfristigem Politikerdenken“<br />
werden <strong>in</strong> Vortragsblock 2 die Vorteile strategischer<br />
Planung deutlich. Anhand des Spannungsfeldes zwischen<br />
Kämmerer und politischen Instanzen wird geschildert, wie<br />
Auftraggeber die technischen, betriebswirtschaftlichen und<br />
baulichen Parameter optimieren können. Dass diese nicht<br />
nur <strong>in</strong> größeren, sondern auch <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>eren Kommunen zum<br />
Tragen kommen, wird bei e<strong>in</strong>em Vergleich der nordrhe<strong>in</strong>westfälischen<br />
Landeshauptstadt Düsseldorf mit der badenwürttembergischen<br />
Geme<strong>in</strong>de Kappelrodeck erkennbar.<br />
20 11-12 | 2013
VERANSTALTUNGEN NACHRICHTEN<br />
Delegieren an den richtigen Partner<br />
Netzbetreiber die sich auf die wesentlichen Aufgaben<br />
beschränken wollen, vergeben regelmäßig Ingenieurleistungen.<br />
War es früher üblich den Planer des Vertrauens zu<br />
beauftragen, me<strong>in</strong>en heute Verwaltungen zunehmend,<br />
auch Planerleistungen auf Angebotsbasis vergeben zu müssen.<br />
Die Durchführung von „Leistungs“-Wettbewerben tragen<br />
<strong>in</strong> solchen Fällen dazu bei, dass leistungsfähige und für<br />
die jeweilige Planungsaufgabe qualifizierte Ingenieurbüros<br />
e<strong>in</strong>en Auftrag erhalten. Nur e<strong>in</strong> Wettbewerb auf dieser Basis<br />
kann für unser aller Geme<strong>in</strong>wesen wertvoll se<strong>in</strong>. Deshalb<br />
gilt es, das Bewusstse<strong>in</strong> bei Auftraggebern und Planern zu<br />
schärfen. „Wie f<strong>in</strong>de ich den Planer, der die bestmögliche<br />
Leistung erwarten lässt?“ so das Thema das den ersten Tag<br />
beschließt, bevor es zum Tagesausklang im Rahmen e<strong>in</strong>er<br />
geme<strong>in</strong>samen Abendveranstaltung kommt.<br />
E<strong>in</strong>zelaspekte im Fokus<br />
Nachdem sich am ersten Tag vieles um das so genannte<br />
große Ganze dreht, stehen am zweiten Kongresstag ausgewählte<br />
E<strong>in</strong>zelaspekte im Fokus, u. a. haben Klimawandel<br />
und Bevölkerungsveränderungen E<strong>in</strong>fluss auf die Entwässerungsplanung.<br />
In Themenblock 4 beschäftigt sich e<strong>in</strong> Vortrag<br />
mit dem Titel „Es regnet stärker, wir werden weniger“ mit<br />
diesen Entwicklungen. Darüber h<strong>in</strong>aus werden die Auswirkungen<br />
des Regelwerkes auf e<strong>in</strong>e ganzheitliche Sanierungsplanung<br />
beleuchtet. Beispielhaft wird auf die DIN EN 14654<br />
– Management und Überwachung von betrieblichen Maßnahmen<br />
<strong>in</strong> Abwasserleitungen und -kanälen - Teil 2: Sanierung;<br />
Deutsche Fassung EN 14654-2:2013 e<strong>in</strong>gegangen. Sie<br />
stellt künftig die e<strong>in</strong>schlägige Planungsnorm dar. Sie lässt<br />
neben den konkreten Planungsvorgaben Ingenieurleistungen<br />
für Auftraggeber künftig mess- und bewertbar werden. Für<br />
Markus Vogel war die Norm Auslöser der Veranstaltung.<br />
„Sanierungsplanung wurde <strong>in</strong> der Vergangenheit selten<br />
losgelöst betrachtet. Sie wurde meistens nur <strong>in</strong> Zusammenhang<br />
mit Technik, sei es <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit der Herstellung<br />
von Kanälen, dem Schlauchl<strong>in</strong>ertag oder dem Reparaturtag<br />
thematisiert“, so Vogel. „Nun ist es an der Zeit, die Komplexität<br />
der Planung und dieses Regelwerk bekannt zu machen<br />
sowie die Abhängigkeiten darzustellen – e<strong>in</strong> Anspruch, den<br />
der Sanierungsplanungskongress leisten will und kann.“<br />
Starkregenereignisse machen die Leistungsgrenzen der<br />
Kanalisation deutlich. Vorausschauendes, ganzheitliches<br />
Kanalnetzmanagement berücksichtigt deshalb zunehmend<br />
stadtplanerische Aspekte<br />
Zukunftsweisende Lösungen<br />
E<strong>in</strong> weiterer Vortragsblock weist die Entwässerungsnetze als<br />
Hauptschlagadern funktionierender Lebensräume aus. Dass<br />
Abwasserleitungen nicht immer rund se<strong>in</strong> müssen, ist dabei<br />
weniger e<strong>in</strong>e blasphemische Äußerung als vielmehr der H<strong>in</strong>weis<br />
darauf, dass es heute – etwa mit der E<strong>in</strong>beziehung von<br />
Verkehrsflächen – bereits zukunftsweisende Lösungen für die<br />
Ableitung von Starkniederschlägen gibt. Ansätze gibt es also<br />
genug, doch wie f<strong>in</strong>de ich die richtige Sanierungstechnik?<br />
E<strong>in</strong>e Antwort auf diese Frage lässt sich ebenfalls aus e<strong>in</strong>er<br />
fundierten Bedarfsplanung ableiten. Es gilt, die Bedürfnisse,<br />
Ziele und e<strong>in</strong>schränkenden Rahmenbed<strong>in</strong>gungen des Bauherren<br />
zu ermitteln und zu analysieren. S<strong>in</strong>d diese Grundlasten<br />
dann e<strong>in</strong>mal def<strong>in</strong>iert, ergibt sich die Auswahl e<strong>in</strong>es geeigneten<br />
Verfahrens – selbst unter E<strong>in</strong>beziehung wirtschaftlicher<br />
Aspekte – fast schon zwangsläufig. Wie man dann vom Planen<br />
zum Bauen kommt, stellt Themenblock 6 mit Beispielen aus<br />
Nürnberg, Dortmund und Sol<strong>in</strong>gen anschaulich vor.<br />
Die strategischen Ziele im Visier, heißt konsequent die<br />
Aufforderung aus dem letzten Vortragsblock, bevor die<br />
Frage nach der erforderlichen Öffentlichkeitsarbeit den<br />
Themenkreis des Sanierungsplanungskongresses <strong>in</strong>haltlich<br />
schließt. Für die Umsetzung muss e<strong>in</strong>e solide Basis geschaffen<br />
werden. Das endet nicht mit der Bereitstellung von<br />
ausreichendem und qualifiziertem Personal. Es gilt, den<br />
Menschen mitzunehmen und die Öffentlichkeit <strong>in</strong> die Baumaßnahme<br />
mit e<strong>in</strong>zubeziehen. Erst dann hat die Umsetzung<br />
e<strong>in</strong>es Projektes Aussicht auf Erfolg.<br />
Deshalb mahnt Markus Vogel e<strong>in</strong> Um- bzw. Weiterdenken an.<br />
Erste Impulse wird der Sanierungsplanungskongress geben.<br />
In Kassel sollen Planungsaspekte unterschiedlichster Arten<br />
diskutiert werden. Auftraggeber schildern praxisnah, wie sie<br />
die Herausforderungen zum Erhalt der Funktionsfähigkeit<br />
und des Wertes der Leitungs<strong>in</strong>frastruktur meistern wollen.<br />
E<strong>in</strong>e fundierte umfassende Bedarfsermittlung ist hierfür der<br />
erste, wenn nicht gar der bedeutendste Bauste<strong>in</strong>. Mit e<strong>in</strong>er<br />
vernünftigen Bedarfsentwicklung wird der Auftraggeber <strong>in</strong><br />
die Lage versetzt, die richtigen Entscheidungen für e<strong>in</strong>en<br />
dauerhaften und langfristigen Kanalnetzbetrieb zu treffen.<br />
KONTAKT: www.sanierungsplanungskongress.de<br />
11-12 | 2013 21
NACHRICHTEN VERANSTALTUNGEN<br />
8. SgL zeigt praxisnah Vorteile der grabenlosen<br />
Techniken auf<br />
Das 8. Deutsche Symposium für die grabenlose Leitungserneuerung<br />
(SgL) fand dieses Mal am 5.und 6. November 2013<br />
<strong>in</strong> dem zum Universitätsgelände Siegen gehörenden Artur-<br />
Woll-Haus statt. Den über 200 Teilnehmern aus Kommunen,<br />
Planungsbüros und ausführenden Unternehmen wurde e<strong>in</strong><br />
abwechslungsreiches und <strong>in</strong>teressantes Programm geboten.<br />
Dass unterirdisches Bauen mit grabenlosen Techniken sichtund<br />
spürbare Vorteile br<strong>in</strong>gt, unterstrich das E<strong>in</strong>gangsreferat<br />
von Tagungsorganisator Professor Dr.-Ing. Horst Görg von<br />
der Universität Siegen. Neben dem öffentlichen Bereich ist<br />
auch der private Grundstücksbereich betroffen.<br />
Nach den strittigen Diskussionen der vergangenen Monate<br />
um die private Grundstücksentwässerung <strong>in</strong> NRW wurden<br />
die Teilnehmer auf den zukünftigen rechtlichen Stand<br />
gebracht. Durch die Verpflichtung der Kommunen zur<br />
Unterrichtung und weitergehenden Beratung wird hier auch<br />
mehr Bürgernähe und Akzeptanz für die erforderlichen<br />
Sanierungsmaßnahmen erwartet. E<strong>in</strong>e Sanierung selbst<br />
kann man nicht mal so nebenbei machen. Die Komplexität<br />
e<strong>in</strong>er Sanierung erfordert neben e<strong>in</strong>er sorgfältigen Planung<br />
auch e<strong>in</strong>e kostengünstige und qualitativ hochwertige Ausführung<br />
durch die Sanierungsfirma.<br />
In aufschlussreichen Impulsvorträgen zeigten Experten typische<br />
Fallstricke auf, die bei Planung und Bauausführung von<br />
Leitungssanierungen auftreten können. Mehr professionelle<br />
Qualität von der Planung bis zur Abnahme vermeidet<br />
unnötige Risiken und führt bei nicht zwangsläufig höheren<br />
Kosten zu mehr Nachhaltigkeit und Effizienz.<br />
Den Abschluss des ersten Tages bildete der „Dialogabend“<br />
im Sudhaus der Brauerei Irle. Für die Teilnehmer war es<br />
e<strong>in</strong>e gute Gelegenheit, sich näher kennenzulernen, ihre<br />
Erfahrungen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.<br />
Am nächsten Morgen referierte zunächst Prof. Schmidtke,<br />
der „Papst“ der Kostenvergleichsrechnung, und zeigte sehr<br />
sachkundig die Unterschiede und Bedeutung der technischen<br />
und wirtschaftlichen Nutzungsdauern der unterschiedlichen<br />
Sanierungsverfahren auf.<br />
In den zwei folgenden Referaten wurden die Auswirkungen<br />
der Demografie und des Klimawandels auf die Tr<strong>in</strong>kwasserversorgung<br />
und der Netze behandelt.<br />
Spannend war der Praxisbericht der bds GmbH aus Neufahrn,<br />
die auf Deponien Sickerwasserleitungen mittels des<br />
dynamischen Berstl<strong>in</strong><strong>in</strong>gs neu verlegt. Dabei mussten <strong>in</strong><br />
25 m Tiefe Sickerwasserleitungen aus AZ-Beton DN 200<br />
durch das E<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen von PE100-Rohren da 280 SDR 7,4<br />
auf <strong>in</strong>sgesamt 401 m erneuert werden.<br />
Die E.ON, Gelsenkirchen, berichtete über die Erstellung grabenloser<br />
Gas-Hausanschlüsse mit der Keyhole-Bohrtechnik<br />
<strong>in</strong> Erlau an der Donau nach der Flut im Juni 2013 und leitete<br />
zum abschließenden Höhepunkt der Tagung über.<br />
Mit e<strong>in</strong>er praxisnahen Baustellenvorführung auf dem Universitätsgelände<br />
demonstrierte TRACTO-TECHNIK die e<strong>in</strong>zelnen<br />
Schritte der Keyhole-Technik, wie Hausanschlüsse <strong>in</strong><br />
Serie m<strong>in</strong>imal<strong>in</strong>vasiv erstellt werden können.<br />
Mit dem diesjährigen und mittlerweile 8. Symposium der<br />
grabenlosen Leitungserneuerung wurde den Teilnehmern<br />
nicht nur e<strong>in</strong> fundierter, praxisnaher und auch <strong>in</strong> die Tiefe<br />
gehender Überblick über Techniken und Verfahren geboten,<br />
sondern auch aufgezeigt, welche Anforderungen<br />
und Möglichkeiten bei Recht, Planung, Technik, Ausführung<br />
sowie Qualität der grabenlosen Leitungssanierung<br />
zu erwarten s<strong>in</strong>d.<br />
Sem<strong>in</strong>ar zu Sicherheit und Betrieb hochspannungsbee<strong>in</strong>flusster<br />
Pipel<strong>in</strong>e-Netze<br />
Neue Hochspannungstrassen werden aktuell geplant, um die<br />
elektrische Energie <strong>in</strong> Deutschland zukünftig sicher und zuverlässig<br />
zu verteilen. Im Rahmen der Bündelung von Energietrassen<br />
wird angestrebt, Hochspannungs- und Rohrleitungstrassen<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em relativ ger<strong>in</strong>gen Abstand zue<strong>in</strong>ander zu verlegen. Die<br />
relative Nähe hat Auswirkungen auf die Systeme. Die Folgen<br />
können erhöhte Korrosion und Gefahren bei der Berührung<br />
der Systeme se<strong>in</strong>. Denn aus der Näherung dieser Trassenverläufe<br />
resultiert e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>duktive Wechselspannungsbee<strong>in</strong>flussung<br />
zu erdverlegten metallenen Installationen (z. B. Rohrleitungen<br />
und Kabel). Um den Berührungsschutz an diesen Anlagen zu<br />
gewährleisten, s<strong>in</strong>d oftmals umfangreiche Untersuchungen,<br />
Berechnungen und konstruktive Maßnahmen erforderlich.<br />
Das Haus der Technik greift die Thematik auf und behandelt<br />
<strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Sem<strong>in</strong>ar „Sicherheit und Betrieb hochspannungsbee<strong>in</strong>flusster<br />
Pipel<strong>in</strong>e-Netze“ am 11. und 12. Februar 2014 <strong>in</strong><br />
Essen die Grundlagen des kathodischen Korrosionsschutzes,<br />
die Normen und Vorschriften sowie die Schutzmaßnahmen<br />
beim Bau und der Verlegung der Rohrleitungen. Maßnahmen<br />
zur Reduzierung e<strong>in</strong>gekoppelter Wechsel-Spannungen beim<br />
Bau und Betrieb von Pipel<strong>in</strong>e-Netzen werden vorgestellt.<br />
KONTAKT: Haus der Technik e.V., Essen, Tel. +49 201 1803-344,<br />
E-Mail: <strong>in</strong>formation@hdt-essen.de<br />
22 11-12 | 2013
Tiefbaumesse InfraTech<br />
Der Erfolg von InfraTech <strong>in</strong> Rotterdam, die Leitmesse im<br />
Infrastruktursektor, sche<strong>in</strong>t sich <strong>in</strong> Deutschland zu wiederholen.<br />
Bereits gut zwei Monate vor Beg<strong>in</strong>n der Messe waren<br />
bereits 90 % der verfügbaren Messeflächen reserviert. Die<br />
120 Firmen, die sich bislang angemeldet haben, kommen<br />
aus Deutschland, Österreich, Belgien, Polen und den Niederlanden.<br />
Die Tiefbaumesse InfraTech f<strong>in</strong>det statt vom 15. bis<br />
zum 17. Januar 2014 <strong>in</strong> der Messe Essen (NRW).<br />
Exklusive gesamtdeutsche Zielgruppenansprache<br />
„Sowohl das Messekonzept als auch der Messestandort<br />
Essen waren für uns bereits <strong>in</strong> den ersten Gesprächen die<br />
Entscheidungskriterien für e<strong>in</strong>e Teilnahme. Mit dieser neuen<br />
Messe bietet sich für uns e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>zigartige Gelegenheit, unsere<br />
Marktpartner und Interessenten aus der gesamtdeutschen<br />
Infrastrukturbranche exklusiv anzusprechen. Die für uns wichtigsten<br />
Messen f<strong>in</strong>den bisher nur <strong>in</strong> den südlichen Bundesländern<br />
statt“, so Berndt Bathke, Leiter Werbung, Messen und<br />
Veranstaltungen bei ACO Tiefbau Vertrieb GmbH.<br />
Ebenso begeistert ist Gerhard W<strong>in</strong>kler, Geschäftsführer der<br />
Zertifizierung Bau GmbH. „Bislang gab es <strong>in</strong> Deutschland<br />
ke<strong>in</strong>e Messe, die alle Bereiche zum Thema Infrastruktur vom<br />
Straßen- und Tiefbau bis h<strong>in</strong> zum Wasser- und Kanalbau<br />
beleuchtet. Genau <strong>in</strong> diesem Spektrum bewegen wir uns<br />
als führende Zertifizierungsstelle für das Bauwesen. Daher<br />
ist es für uns <strong>in</strong>teressant, hier vertreten zu se<strong>in</strong>, unsere<br />
Kontakte zu <strong>in</strong>tensivieren und unser Leistungsspektrum<br />
umfassend und detailliert auch im Rahmen persönlicher<br />
Gespräche vorzustellen. Wir s<strong>in</strong>d sicher, dass das deutsche<br />
Baugewerbe ebenso von dieser Messe profitieren wird.“<br />
MESSEN UND TAGUNGEN<br />
Tiefbaumesse InfraTech<br />
15.-17.01.2014 <strong>in</strong> Essen; www.<strong>in</strong>fratech.de/de<br />
1. DWA-Grundstücksentwässerungstage<br />
21./22.01.2014 <strong>in</strong> Fulda; heimann@dwa.de,<br />
www.dwa.de<br />
Tagung Rohrleitungsbau<br />
21./22.01.2014 <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>; borkes@rbv-gmbh.<br />
de, www.brbv.de<br />
28. Oldenburger Rohrleitungsforum<br />
06./07.02.2014 <strong>in</strong>fo@iro-onl<strong>in</strong>e.de, www.iroonl<strong>in</strong>e.de<br />
1. Sanierungsplanungskongress<br />
12./13.02.2014 <strong>in</strong> Kassel; www.<br />
sanierungsplanungskongress.<br />
de<br />
GEOTHERM 2014<br />
20./21.02.2014 <strong>in</strong> Offenburg; geotherm@<br />
messe-offenburg.de, www.<br />
geotherm-offenburg.de<br />
14. Gött<strong>in</strong>ger Abwassertage<br />
25.-26.02.2014 <strong>in</strong> Gött<strong>in</strong>gen; www.tahannover.de<br />
DWA-Wirtschaftstage<br />
05./06.03.2014 <strong>in</strong> Hamburg; hoecherl@dwa.<br />
de, www.dwa.de<br />
29. FDBR-Fachtagung Rohrleitungstechnik<br />
25./26.03.2014 <strong>in</strong> Mannheim; www.fdbr.de<br />
12. Schlauchl<strong>in</strong>ertag<br />
27.03.2014 <strong>in</strong> Düsseldorf; www.tahannover.de,<br />
www.deutscherschlauchl<strong>in</strong>ertag.de<br />
Tube 2014<br />
07.-11.04.2014 <strong>in</strong> Düsseldorf; www.tube.de<br />
Viele Besucher kamen zur InfraTech 2013 <strong>in</strong> Rotterdam<br />
Synergieeffekte<br />
Vom 15. bis zum 17. Januar 2014 wird auf dem Gelände der<br />
Messe Essen e<strong>in</strong> echter Ansturm erwartet. Das Messegelände<br />
hat <strong>in</strong> diesem Zeitraum nämlich vier Messen gleichzeitig zu<br />
bieten. Neben der Tiefbaumesse InfraTech f<strong>in</strong>den dort auch<br />
die Messen DEUBAUKOM, DCONex und Leben+Komfort statt.<br />
Insgesamt s<strong>in</strong>d etwa 550 Aussteller vertreten und da die<br />
Messen alle e<strong>in</strong>e ähnliche Zielgruppe ansprechen, gehen die<br />
Veranstalter beim Messebesuch von starken Synergieeffekten<br />
aus. Es werden <strong>in</strong>sgesamt ca. 50.000 Besucher erwartet.<br />
KONTAKT: www.tiefbaumesse<strong>in</strong>fratech.de<br />
IFAT 2014<br />
05.-09.05.2014 <strong>in</strong> München; <strong>in</strong>fo@ifat.de,<br />
www.ifat.de<br />
forum kks<br />
19.-22.05.2014 <strong>in</strong> Weimar; www.fkks.de<br />
Technischer Kongress CeoCor<br />
20./21.05.2014 <strong>in</strong> Weimar; www.fkks.de<br />
8. Praxistag Korrosionsschutz<br />
25.06.2014 <strong>in</strong> Gelsenkirchen; b.pflamm@<br />
vulkan-verlag.de, www.<br />
praxistag-korrosionsschutz.de<br />
11-12 | 2013 23
NACHRICHTEN VERANSTALTUNGEN<br />
RSV-Praxistag „Schachtsanierung“<br />
<strong>in</strong> Geradstetten erfolgreich gestartet<br />
<strong>3R</strong>-Chefredakteur Nico Hülsdau, Dr. Jörg Sebastian,<br />
Prof. Dr.-Ing. Karsten Körkemeyer, Dr.-Ing. René Thiele und<br />
RSV-Geschäftsführer Horst Zech (v.l.n.r.)<br />
Call for Papers: RSV-Sem<strong>in</strong>ar zur „Rehabilitation<br />
von Tr<strong>in</strong>kwasserleitungen“<br />
Der RSV beabsichtigt, im Frühjahr 2014 <strong>in</strong> Mellendorf/Niedersachsen<br />
e<strong>in</strong> Sem<strong>in</strong>ar mit dem Thema „Rehabilitation von<br />
Tr<strong>in</strong>kwasserleitungen“ mit Fachausstellung auszurichten.<br />
Schwerpunktthemen dieser Veranstaltung s<strong>in</strong>d:<br />
»»<br />
Technische Zustandsbewertung<br />
»»<br />
Hygienische Aspekte<br />
»»<br />
Rehabilitationsverfahren<br />
»»<br />
Planung von Rehabilitationsmaßnahmen und grabenlosen<br />
Erneuerungen.<br />
Für Netzbetreiber und Ingenieurbüros gew<strong>in</strong>nt die Schachtsanierung<br />
– neben der Sanierung von Rohrleitungen – zunehmend<br />
an Bedeutung. Und so war der erste RSV-Praxistag<br />
„Schachtsanierung“ am 26. September <strong>in</strong> Geradstetten<br />
bei Stuttgart e<strong>in</strong> voller Erfolg. Die Teilnehmer waren von<br />
der Qualität der Vorträge und der kompakten Themenzusammenstellung<br />
begeistert und nutzten die Pausen für<br />
<strong>in</strong>tensive Gespräche mit den Referenten und den <strong>in</strong>sgesamt<br />
12 Fachausstellern, die ihre Produkte und Dienstleistungen<br />
rund um die Schachtsanierung am Veranstaltungsort im<br />
Ausbildungszentrum Bau präsentierten. E<strong>in</strong> Verbesserungsvorschlag<br />
aus dem Auditorium war die Erweiterung des<br />
RSV-Praxistages auf zwei Tage, um die Vielfalt an Aspekten<br />
der Schachtsanierung weiter vertiefen zu können.<br />
Den RSV-Praxistag Schachtsanierung, den RSV-Geschäftsführer<br />
Horst Zech moderierte, und den die Fachzeitschrift<br />
<strong>3R</strong> als Medienpartner unterstützte, widmete sich ausführlich<br />
und praxisbezogen <strong>in</strong> differenzierten Themenblöcken<br />
der Schachtsanierung. Im ersten Block rückten, nach der<br />
E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong>s Thema durch Dipl. Volkswirt Horst Zech, die<br />
Planung, die erweiterte Zustandserfassung und die Statik <strong>in</strong><br />
den Mittelpunkt. Zur erweiterten Zustandserfassung und<br />
-bewertung referierte Prof. Dr.-Ing. Karsten Körkemeyer<br />
von der TU Kaiserslautern. Die Statik brachte Dr.-Ing. René<br />
Thiele den Teilnehmern <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Vortrag „Statische Besonderheiten<br />
bei der Instandsetzung von Schächten aus Beton<br />
und Mauerwerk“ näher.<br />
Dem Thema „Schachtprüfungen und Qualitätssicherung“ widmete<br />
sich Dr. rer. nat. Jörg Sebastian, SBKS Gmbh, St. Wendel.<br />
Im zweiten Block wurden zunächst die verschiedenen<br />
Schachtsanierungsverfahren mit den notwendigen vorbereitenden<br />
Arbeiten von Dipl.-Ing. Jens Pirl<strong>in</strong>g, Unger Ingenieure,<br />
Darmstadt, vorgestellt. Anschließend beleuchtete Dr.<br />
rer. nat. André Stang von der Maleki GmbH, Osnabrück, die<br />
Thematik „M<strong>in</strong>eralische Beschichtungen“, bevor Thomas<br />
Rosenberger, Remmers Fachplanung, Lön<strong>in</strong>gen, sich dem<br />
Thema „Schleuderverfahren zur Sanierung von Abwasserschächten“<br />
widmete. Abschließend referierte Michael Grase,<br />
SB Technik, Ludwigfelde, zum Thema Spritzverfahren.<br />
Im dritten Block befasste sich Dipl.-Ing. André Maas mit den<br />
Grundlagen, der Klassifikation und den Anforderungen von<br />
Auskleidungsverfahren im Bereich von Abwasserbauwerken<br />
und stellte Schacht-<strong>in</strong>-Schacht-Systeme aus GFK, Plattenelemente<br />
und rohrförmige Elemente aus GFK und PE sowie<br />
Ortlam<strong>in</strong>ate vor. Im Anschluss daran präsentierten Dipl.-Ing.<br />
Hans-Detlev Schulz, Schulz Bau GmbH, Torgau, Verfahren<br />
zur Behältersanierung und Dipl-.-Ing. Peter Eschenbrenner,<br />
Vertil<strong>in</strong>er, Zwiesel, se<strong>in</strong>e Erfahrungen bei der Sanierung<br />
mit Vertil<strong>in</strong>ern. Dipl.-Ing. Lutz Kadoch, NBT-Systeme, Kl<strong>in</strong>genberg,<br />
präsentierte den Teilnehmern neuere Verfahren<br />
für die Schachtkopf- und E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dungssanierung. Abschließend<br />
legte M.Eng. Markus Dohmann von der Stadt Backnang<br />
se<strong>in</strong>e praktischen Erfahrungen mit der Sanierung von<br />
Schachtbauwerken aus Sicht e<strong>in</strong>es Kanalnetzbetreibers dar.<br />
Nach den Vorträgen hatten die Teilnehmer Gelegenheit, <strong>in</strong><br />
der Werkhalle des Ausbildungszentrums Bau, die verschiedenen<br />
praktischen Vorführungen der Aussteller MC Bauchemie<br />
Müller GmbH, SB Bautechnik GmbH und SBKS GmbH<br />
aus der Nähe anzuschauen, Vorzüge und Besonderheiten<br />
e<strong>in</strong>zelner Sanierungsverfahren von Anwendungsprofis zu<br />
erfahren und detaillierte Fragen zu stellen.<br />
Falls Sie <strong>in</strong> diesem Bereich Erfahrungen haben und e<strong>in</strong>en<br />
Vortrag über diese Thematik halten möchten, senden Sie<br />
e<strong>in</strong>e Kurzfassung von e<strong>in</strong>er Seite bis zum 20. Dezember<br />
2013 an die RSV-Geschäftsstelle.<br />
KONTAKT: RSV - Rohrleitungssanierungsverband e. V., L<strong>in</strong>gen (Ems), Dipl.-<br />
Volkswirt Horst Zech, Tel. +49 5963 98108-77, E-Mail: rsv-ev@tonl<strong>in</strong>e.de,<br />
www.rsv-ev.de<br />
24 11-12 | 2013
VERANSTALTUNGEN NACHRICHTEN<br />
280 Teilnehmer und 40 Aussteller bei<br />
Nürnberger Kolloquien zur Kanalsanierung<br />
Die Nürnberger Kolloquien zur Kanalsanierung standen<br />
<strong>in</strong> diesem Jahr unter dem Motto „Reparatur und Renovierung“.<br />
Das zentrale Thema war die Reparatur von<br />
Schächten, Anschlüssen und Anschlussleitungen. Sieben<br />
Referenten gaben am 26. September ihr Know-how im<br />
Bereich Kanalsanierung an Interessenten aus Geme<strong>in</strong>den<br />
und Behörden weiter.<br />
Dipl.-Ing. Dieter Walter, Prüf<strong>in</strong>genieur beim Güteschutz<br />
Kanalbau e.V., erklärte, worauf beim Neubau und nachträglicher<br />
Herstellung von Anschlüssen an den Hauptkanal<br />
zu achten ist. Neben den Grundlagen, Methoden und<br />
Materialien wurde auch die Dokumentation vor und nach<br />
den Baumaßnahmen diskutiert. Den Herstellerangaben von<br />
Bauteilen und Materialien werde <strong>in</strong> der Praxis zu wenig<br />
Beachtung geschenkt, so Walter. Dies zeigten <strong>in</strong>sbesondere<br />
Schadensbilder wie e<strong>in</strong>ragende Anschlüsse, Quer- und<br />
Längsrisse sowie undichte Anschlussanb<strong>in</strong>dungen am Kanalrohr.<br />
Der Fehler stecke oft im Detail: Bohrungen, die nicht<br />
den Herstellervorgaben entsprechen, unsauberes Schweißen<br />
oder falsch ausgewählte Anschlussformstücke könnten die<br />
Dichtheit des Systems negativ bee<strong>in</strong>flussen.<br />
Entscheidungen, welches Sanierungsverfahren und Material<br />
zu welchem E<strong>in</strong>satzzeitpunkt verwendet werden, sollte nur<br />
durch Planer <strong>in</strong> der Sanierung getroffen werden. Das weiß<br />
auch Dipl.-Ing. Mart<strong>in</strong> Liebscher vom Institut für Unterirdische<br />
Infrastruktur (IKT), der sich mit dem Thema Schachtsanierung<br />
ause<strong>in</strong>andergesetzt hat. Denn die Verfahren und<br />
verwendbaren Materialen s<strong>in</strong>d zahlreich und nicht immer<br />
ist e<strong>in</strong>fach abzuschätzen, welches Vorgehen bei welchen<br />
Schäden im Schacht am besten geeignet ist. „Wir haben die<br />
Abdichtung der verschiedenen Materialen überprüft. Gele<br />
und Harze zeigen dabei e<strong>in</strong>e gute Wirkung – auch bei mehrtägigem<br />
Außendruck. Nach e<strong>in</strong>em Zeitraum von etwa fünf<br />
Monaten fielen jedoch nennenswerte Undichtheiten auf“,<br />
so Liebscher vom IKT. Stopfmörtel zeige schon kurzfristig<br />
e<strong>in</strong>e deutlich schlechtere Abdichtwirkung und empfehle sich<br />
hauptsächlich für e<strong>in</strong>e Erstabdichtung als Vorbereitung für<br />
e<strong>in</strong>e weiterführende Injektionsmaßnahme.<br />
Nicht nur Material- und Verfahrensentscheidungen, sondern<br />
auch gängige Normen, Vorschriften und Rechtsgrundlagen<br />
wurden beleuchtet. Diese kommen u. a. bei Anschlussleitungen<br />
von privaten Grundstücken <strong>in</strong> das öffentliche Kanalsystem<br />
zum Tragen. Denn die Gewässerverunre<strong>in</strong>igung durch<br />
e<strong>in</strong>e undichte Anschlussleitung ist nach deutschem Recht<br />
strafbar. Deshalb sieht die DIN 1986-30 e<strong>in</strong>e Schadensfeststellung<br />
der Anlagen nach 20 Jahren vor. Dipl.-Ing. Markus<br />
Buda, Projektleiter und Zertifizierter Kanalsanierungsberater<br />
bei Oppermann GmbH Ingenieurbüro – Beratende Ingenieure,<br />
erläuterte, worauf bei der Analyse der Schäden zu achten<br />
ist. Da neben fachkundigem Personal aus Kommunen<br />
auch Privatpersonen mit der Thematik konfrontiert werden,<br />
eigne sich, so se<strong>in</strong> Vorschlag, e<strong>in</strong>e Zustandsbewertung im<br />
Ampelsystem. Ob e<strong>in</strong> dr<strong>in</strong>gender, mittelfristiger oder gar<br />
ke<strong>in</strong> Handlungsbedarf zur Sanierung vorliege, sei so für<br />
jedermann ersichtlich.<br />
In e<strong>in</strong>em Punkt waren sich alle Referenten e<strong>in</strong>ig: Die systematische<br />
Planung bildet die Grundlage für e<strong>in</strong>e ordentliche<br />
Kanalsanierung – qualifizierte Fachkräfte und e<strong>in</strong>e kont<strong>in</strong>uierliche<br />
Überwachung der Baumaßnahmen führen die<br />
Sanierung schließlich zum Erfolg. Nur durch e<strong>in</strong>e ordentliche<br />
Analyse und anschließenden Dokumentation der Schäden<br />
können Fehler von Anfang an vermieden werden.<br />
Die nächsten Nürnberger Kolloquien zur Kanalsanierung<br />
f<strong>in</strong>den am 25. September 2014 statt.<br />
Dem Fachbeirat der Nürnberger Kolloquien zur Kanalsanierung gehören<br />
an (v.l.n.r.): Burghard Hagspiel (Technischer Werkleiter Werksbereich<br />
Stadtentwässerung bei SUN Stadtentwässerung und Umweltanalytik<br />
Nürnberg), Dieter Walter (Güteschutz Kanalbau e.V.), Dr. Ursula Baumeister<br />
(Geschäftsführer<strong>in</strong> Verbund IQ gGmbH), für den RSV Stefan Dümler<br />
(Niederlassungsleiter Nürnberg der Dir<strong>in</strong>ger & Scheidel Rohrsanierung GmbH<br />
&Co. KG), Prof. Werner Krick (Technische Hochschule Nürnberg, Fakultät<br />
Bau<strong>in</strong>genieurwesen)<br />
Besuchen Sie uns im Internet:<br />
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
11-12 | 2013 25
NACHRICHTEN VERANSTALTUNGEN<br />
Offenes Kolloquium anlässlich des 65.<br />
Geburtstags von Prof. Dr.-Ing. Bernd Isecke<br />
In diesem Jahr hat Professor Dr.-<br />
Ing. Bernd Isecke se<strong>in</strong> 65. Lebensjahr vollendet und blickt<br />
auf e<strong>in</strong> erfolgreiches Berufsleben zurück. Als im In- und<br />
Ausland anerkannter Fachmann auf dem Gebiet des kathodischen<br />
Korrosionsschutzes hat er an maßgeblicher Stelle<br />
die Erforschung und die Entwicklung gestaltet und ist für<br />
Akzeptanz und Verbreitung dieser Technik e<strong>in</strong>getreten.<br />
Dieses besondere Jubiläum nahm der fkks Fachverband<br />
Kathodischer Korrosionsschutz e.V. zum Anlass, um e<strong>in</strong><br />
offenes Kolloquium zu Ehren von Professor Dr. Isecke am 25.<br />
Oktober 2013 im Otthe<strong>in</strong>richbau des Schlosses Heidelberg<br />
auszurichten. Im bee<strong>in</strong>druckenden Ambiente des Schlosses<br />
Heidelberg folgten mehr als 60 Fachleute aus allen Bereichen<br />
des Korrosionsschutzes den Vorträgen und erlebten<br />
e<strong>in</strong>e <strong>in</strong> jeder Beziehung ganz besondere Tagung.<br />
Namhafte Wegbegleiter von Professor Dr. Isecke spiegelten<br />
mit ihren Fachvorträgen das Wirken von Prof. Dr. Isecke<br />
wider und trugen zum Gel<strong>in</strong>gen des Kolloquiums bei.<br />
Prof. Dr. rer. nat. habil. Günter Schmitt von der<br />
IFINKOR <strong>in</strong> Iserlohn, der das Kolloquium moderierte,<br />
hielt die Laudatio auf Professor Dr. Isecke.<br />
Dr.-Ing. Andreas Burkert von der BAM Bundesanstalt für<br />
Materialforschung und -prüfung <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>, referierte über<br />
die Innovativen Methoden <strong>in</strong> der Korrosionsforschung an<br />
der BAM, Prof. Dr. Bernhard Elsener von der ETH Zürich<br />
zum Thema Korrosion von Stahl-<strong>in</strong>-Beton: Mechanismen -<br />
Monitor<strong>in</strong>g - Management, Dr. rer. nat. Andreas Erbe vom<br />
Max Planck Institut für Eisenforschung <strong>in</strong> Düsseldorf über<br />
die Modellexperimente zur Reaktion von Schwefelwasserstoff<br />
mit Eisen, Prof. Dr.-Ing. Ralf Feser von der Fachhochschule<br />
Südwestfalen <strong>in</strong> Iserlohn über die Korrosion <strong>in</strong><br />
Biogasanlagen, Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. h.c. Ulf Nürnberger<br />
aus Stuttgart zum Thema Rechtfertigen e<strong>in</strong>zelne Korrosionsschäden<br />
im Spannbetonbau die Infragestellung dieser<br />
Bauweise?, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Michael Raupach von der<br />
RWTH Aachen über die Modellierung der Schutzstromverteilung<br />
bei rückseitigem KKS, Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. e.h.<br />
Peter Schießl, München, über die Spannungsrisskorrosion<br />
vergüteter Spanndrähte <strong>in</strong> Bauwerken- e<strong>in</strong> Praxisfall und<br />
Prof. Dr.-Ing. Michael Schütze von der Dechema <strong>in</strong> Frankfurt<br />
zum Thema M<strong>in</strong>imal-<strong>in</strong>vasiver Korrosionsschutz für<br />
neuartige Hochtemperaturleichtbauwerkstoffe.<br />
Das Kolloquium fand se<strong>in</strong>en Ausklang bei e<strong>in</strong>em anschließenden<br />
Empfang.<br />
Im oberen rechten Bild überreicht Hans Gaugler (re.) von der Stadtwerke München GmbH als 1. Vorsitzender des fkks dem Jubilar<br />
Prof. Dr.-Ing. Bernd Isecke e<strong>in</strong>en Blumenstrauß<br />
26 11-12 | 2013
VERANSTALTUNGEN NACHRICHTEN<br />
iro-Treffpunkt Gasverteilleitungen<br />
Der „iro-Treffpunkt Gasverteilleitungen“ ist e<strong>in</strong>e Weiterbildungsveranstaltung<br />
für Ingenieure und Techniker und<br />
richtet sich speziell an Fachleute und Mitarbeiter von Gasversorgungsunternehmen,<br />
die e<strong>in</strong> Gasverteilnetz mit e<strong>in</strong>em<br />
Betriebsdruck von bis zu 16 bar – also e<strong>in</strong> Gasverteilnetz<br />
– betreiben. Der iro-Treffpunkt wurde erstmals <strong>in</strong> 2008 mit<br />
damals drei Arbeitskreisen durchgeführt. Seit dem ist die Veranstaltung<br />
auf vier Arbeitskreise ausgeweitet worden und die<br />
durchschnittliche Teilnehmerzahl beträgt ca. 60 Teilnehmer.<br />
Rückblick auf den iro-Treffpunkt 2013<br />
Der diesjährige iro-Treffpunkt Gasverteilleitungen fand<br />
am 9. und 10. April <strong>in</strong> Gött<strong>in</strong>gen statt und folgte damit<br />
der freundlichen E<strong>in</strong>ladung der Stadtwerke Gött<strong>in</strong>gen AG.<br />
Mit 59 Teilnehmern und zuzüglich der Arbeitskreisleitung<br />
<strong>in</strong>sgesamt 74 Personen war der Treffpunkt gut besetzt.<br />
Begonnen wurde am Dienstag mit e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>samen<br />
Eröffnungsveranstaltung aller Teilnehmer, <strong>in</strong> der sie von<br />
Prof. Thomas Wegener, Institut für Rohrleitungsbau, begrüßt<br />
wurden. Es folgte e<strong>in</strong> Grußwort von Seiten der Fachlichen<br />
Gesamtleitung durch Jens Freisenhausen, Westnetz GmbH.<br />
Die Vorstellung der Stadtwerke Gött<strong>in</strong>gen AG durch Norbert<br />
Liekmann, Vorstandsvorsitzende – <strong>in</strong> Vertretung für Dr.<br />
Rappenecker und e<strong>in</strong> Eröffnungsvortrag mit dem Thema<br />
„Das regionale Biogasprojekt der Stadtwerke Gött<strong>in</strong>gen<br />
AG“ von Dipl.-Ing. Antke Hahn <strong>in</strong> Vertretung für Klaus<br />
Brüggemann sorgten für die richtige E<strong>in</strong>stimmung <strong>in</strong> die<br />
folgenden Diskussionen <strong>in</strong> den Arbeitskreisen.<br />
E<strong>in</strong> fester Bestandteil der Veranstaltung ist die Fachexkursion<br />
am Nachmittag. Nach zwei Sitzungen <strong>in</strong> den Arbeitskreisen<br />
brachte die Fachexkursion mit dem Besuch der Biogasanlage<br />
<strong>in</strong> Rosdorf e<strong>in</strong>en frischen W<strong>in</strong>d um die Nase<br />
sowie e<strong>in</strong>e anschauliche Erläuterung vor Ort zu dem am<br />
Morgen gehörten Eröffnungsvortrag von<br />
Antje Hahn. Die Teilnehmer des Treffpunkts<br />
wurden von Mitarbeitern der Stadtwerke<br />
Gött<strong>in</strong>gen sowie von Mitarbeitern der<br />
Biogas Gött<strong>in</strong>gen GmbH & Co. KG über<br />
das Gelände geführt und bekamen fachlich<br />
versierte Erläuterungen zur dortigen<br />
Anlagentechnik. Die Anlage bee<strong>in</strong>druckte<br />
bereits durch ihre Größe, 8.300 m 3 <strong>in</strong> der<br />
Fermenter und 21.700 m 3 <strong>in</strong> vier Nachgären<br />
s<strong>in</strong>d hier nur als Beispiel aufgeführt.<br />
Am zweiten Tag standen zwei weitere<br />
Arbeitssitzungen <strong>in</strong> den Arbeitskreisen auf<br />
dem Programm. Zum Ende der Veranstaltung<br />
am Nachmittag kamen dann noch e<strong>in</strong>mal alle<br />
Teilnehmer im Plenum <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Raum zusammen,<br />
um über die Diskussionsergebnisse der<br />
jeweiligen anderen Arbeitskreise <strong>in</strong>formiert<br />
zu werden. Hierzu schilderten die Arbeitskreisleiter<br />
die <strong>in</strong> den Arbeitskreisen geführten<br />
Diskussionen und stellten die erarbeiteten<br />
Inhalte und Diskussionsergebnisse vor. In Arbeitskreis 1 „Biogas“<br />
unter der Leitung von Dipl.-Ing. Matthias Sieverd<strong>in</strong>g,<br />
Westnetz GmbH, und Dr. Osman Kurt, EWE NETZ GmbH,<br />
wurde <strong>in</strong>sbesondere die Biogasleitungen sowie Biogase<strong>in</strong>speiseanlagen<br />
und die Rückspeisung thematisiert. Unter der<br />
Leitung von Dipl.-Ing. Volker Höfs, E.ON Hanse AG, und Dipl.-<br />
Ing. Torsten Lotze, E.ON Avacon AG, wurden <strong>in</strong> Arbeitskreis<br />
2 „Betrieb von Gasverteilleitungen“ vier Themen diskutiert.<br />
Hier waren Gasströmungswächter, Qualitätsstandards im<br />
Rohrleitungsbau, Odorierung und die Kostenregelung bei<br />
Leitungsumlegung Gegenstand der Diskussionen.<br />
Die „Instandhaltung von Gasleitungen“ – der Arbeitskreis<br />
3 unter der Leitung von Dipl.-Ing. Gerold Schnier, EWE<br />
NETZ GmbH, und Dipl.-Ing. Willy Hülsdünker, Westnetz<br />
GmbH – beschäftigte sich mit Flüssigkeiten <strong>in</strong> Gasleitungen,<br />
Prüfungen an Regele<strong>in</strong>richtungen, Erfahrungen mit dem<br />
Material PE sowie mit KKS-Assetsicherung und Zustandsüberwachung<br />
bei Gasverteilleitungen.<br />
Arbeitskreis 4 „Umgang mit Störungen – Vorbereitung, Entstörung,<br />
Nachlese“ unter der Leitung von Dipl.-Ing. Christian<br />
Stürtz, enercity Netzgesellschaft mbH, und Dipl.-Ing. Richard<br />
Lunkenheimer, Westnetz GmbH, erarbeitete Diskussionsergebnisse<br />
zu den Themen Risiko- und Krisenmanagement,<br />
Belastung der Bereitschaftsdienste, Leitungen anderer Sparten<br />
sowie Bäume und Überbauung auf Leitungstrassen.<br />
Vormerken: iro-Treffpunkt 2014<br />
Der nächste „iro-Treffpunkt Gasverteilleitungen“ f<strong>in</strong>det<br />
am 1. und 2. April 2014 <strong>in</strong> Schwer<strong>in</strong> bei den Stadtwerken<br />
Schwer<strong>in</strong> statt.<br />
Das Programm steht ab Januar 2014 unter www.iro-onl<strong>in</strong>e.<br />
de zur Verfügung bzw. ist <strong>in</strong> der nächsten <strong>3R</strong>-Ausgabe, die<br />
Ende Januar 2014 ersche<strong>in</strong>t, zu sehen.<br />
Übersicht: Arbeitskreise und Themenübersicht des iro-<br />
Treffpunkt Gasverteilleitungen vom April 2013 <strong>in</strong> Gött<strong>in</strong>gen<br />
11-12 | 2013 27
Programmvorschau 6. und 7. Februar 2014<br />
28. Oldenburger Rohrleitungsforum<br />
hat den Energiemix im Blick<br />
In e<strong>in</strong> paar Wochen ist es wieder soweit: Am 6. und 7. Februar 2014 öffnet das Institut für Rohrleitungsbau Oldenburg (iro)<br />
die Räume der Jade-Hochschule für mehr als 3.000 Besucher und über 300 Aussteller. Rund 130 Referenten und Moderatoren<br />
stehen für sechs parallele Vortragsreihen, <strong>in</strong> denen die Wasser- und Abwasserfraktion ebenso zu Wort kommen wird, wie die<br />
„Gaser und Öler“. Geme<strong>in</strong>sam wird über die aktuellen Entwicklungen e<strong>in</strong>er Branche diskutiert, die <strong>in</strong> wesentlichen Teilen von<br />
Energiewende, demografischem Wandel und Klimawandel geprägt ist. Auch <strong>in</strong> 2014 stehen die Leitungs<strong>in</strong>frastruktur und ihr<br />
Wandel im Mittelpunkt der Veranstaltung.<br />
Foto: iro<br />
Am 6. und 7. Februar 2014 öffnet das iro die Räume der Jade-Hochschule für<br />
das 28. Oldenburger Rohrleitungsforum<br />
ROHRLEITUNGEN ALS TEIL VON HYBRIDNETZEN<br />
Über die Power to Gas-Initiative oder Smart grids wird schon<br />
länger diskutiert, folgerichtig s<strong>in</strong>d 2014 die Hybridnetze dran,<br />
die als mögliche Antwort auf die so genannte Speicherlücke<br />
im elektrischen Energieversorgungssystem gelten. Im Hybridnetz,<br />
das Systeme und Netze für Strom, Gas und Wärme<br />
mite<strong>in</strong>ander koppelt, kann Energie von e<strong>in</strong>er Form <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e<br />
andere umgewandelt werden. Und genau das sorgt für die<br />
erforderliche Flexibilität und Stabilität, um Angebot und Nachfrage<br />
zu regulieren. Doch bei der Diskussion um die zukunftsträchtige<br />
Technik darf die klassische Rohrleitung nicht fehlen.<br />
Welche Bedeutung werden bei der absehbaren Entwicklung<br />
h<strong>in</strong> zum Hybridnetz noch Rohrleitungen spielen? Was muss<br />
man unter betrieblichen Aspekten dabei bedenken? Welche<br />
E<strong>in</strong>flüsse s<strong>in</strong>d bei der Planung e<strong>in</strong>er Leitung, die <strong>in</strong> das System<br />
e<strong>in</strong>gebunden se<strong>in</strong> soll, zu berücksichtigen? Auf dem nunmehr<br />
28. Oldenburger Rohrleitungsforum werden diese, aber auch<br />
andere Themen unter dem Motto „Rohrleitungen als Teil von<br />
Hybridnetzen – unverzichtbar im Energiemix der Zukunft“<br />
diskutiert. H<strong>in</strong>zu kommen die „Klassiker“, die seit vielen Jahren<br />
ihren festen Platz auf dem Oldenburger Forum haben. Wie die<br />
„Diskussion im Cafe“ oder der „Ollnburger Gröönkohlabend“,<br />
der den ersten Veranstaltungstag <strong>in</strong> der Kongresshalle der<br />
Weser-Ems-Halle traditionsgemäß beschließen wird.<br />
ABWASSERWÄRME – EIN ENORMES POTENZIAL<br />
Die Fachwelt ist sich mittlerweile e<strong>in</strong>ig, dass <strong>in</strong> den Abwasserkanälen<br />
e<strong>in</strong> enormes Wärmepotenzial verborgen ist. So<br />
verwundert es nicht, dass es e<strong>in</strong>e Vielzahl an Projekten unterschiedlichster<br />
Größenordnung gibt. Unter dem Oberbegriff<br />
„Projektgebiet Hybridnetz“ werden sie auf dem Oldenburger<br />
Rohrleitungsforum vorgestellt. Vorhaben <strong>in</strong> urbanen Modellquartieren<br />
der D-A-CH-Region, der Energiebunker <strong>in</strong> Hamburg<br />
Wilhelmsburg sowie das Projekt Oldenburg-Drielake gehören<br />
hierzu. Ob die Konzepte, die <strong>in</strong> Großstädten, wie z. B. Wien,<br />
realisiert werden, dabei auf kle<strong>in</strong>ere oder ländlich geprägte<br />
Kommunen übertragbar s<strong>in</strong>d, auch darüber sollen die Vorträge<br />
Aufschluss geben. Noch drei weitere Vortragsblöcke widmen<br />
sich dem Thema Abwasserwärme: So befasst sich e<strong>in</strong> Referat<br />
<strong>in</strong>tensiv mit der Abwasserwärme <strong>in</strong> Oldenburg, angefangen<br />
bei e<strong>in</strong>er Potenzialanalyse für das Stadtgebiet Oldenburg über<br />
das konkrete Projekt „Stadthafen“ bis zur Beschreibung der<br />
Funktionsweise und Erfahrung mit modernen Kanal-Wärmetauschersystemen,<br />
wie sie z. B. bei der Pilotanlage für das iro <strong>in</strong><br />
der Ofenerstraße <strong>in</strong> Oldenburg e<strong>in</strong>gebaut wurden. Der Vortrag<br />
„Abwasserwärme als Bauste<strong>in</strong> zur <strong>in</strong>tegrierten Wärmeversorgung“<br />
schließt hieran an. Mike Böge von der iro GmbH<br />
Oldenburg beschreibt die positiven Betriebserfahrungen der<br />
Pilotanlage. Abschließend wird noch das Thema „Abwasserund<br />
Erdwärme als Teil von Hybridnetzen“ behandelt. Unter<br />
anderem wird über e<strong>in</strong> spezielles Rohrkonzept berichtet, das<br />
sowohl die Abwärme aus dem Abwasser als auch die Wärme<br />
aus dem umgebenden Erdreich aufnimmt. E<strong>in</strong> weiterer Vortrag<br />
zeigt die Möglichkeit der Erdwärmegew<strong>in</strong>nung durch Nutzung<br />
stillgelegter Altrohrleitungen auf.<br />
Bei der Nutzung der Abwasserabwärme s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>ige grundsätzliche<br />
Aspekte zu berücksichtigen. So sollte der <strong>in</strong> der<br />
Kanalisation e<strong>in</strong>gebaute Wärmetauscher <strong>in</strong> lokaler Nähe zum<br />
Energieabnehmer liegen. Die Auswahl der Wärmetauscher<br />
– z. B. Edelstahlelemente, spezielle Schlauchl<strong>in</strong>er oder Kunststoffrohre<br />
– ist u. a. abhängig von den örtlichen Gegebenheiten.<br />
S<strong>in</strong>d E<strong>in</strong>bauten im Sohlbereich z. B. erlaubt oder muss<br />
28 11-12 | 2013
28. Rohrleitungsforum<br />
e<strong>in</strong> freier Querschnitt gewährleistet se<strong>in</strong>? Für den optimalen<br />
energetischen und wirtschaftlichen Nutzen e<strong>in</strong>er Anlage s<strong>in</strong>d<br />
aber vor allem die Abstimmung der Systemkomponenten<br />
und die Steuerung der Heizungsanlage entscheidend. Wie im<br />
Strom-/Gasbereich so gibt es auch bei der Abwärmenutzung<br />
im Abwasserbereich e<strong>in</strong>e Überschneidung zweier technischer<br />
Fakultäten: <strong>in</strong> diesem Fall der Kanalbau und die Heizungstechnik.<br />
Die <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>äre Zusammenarbeit verschiedener<br />
technischer Bereiche wird daher <strong>in</strong> Zukunft e<strong>in</strong>e wichtige Rolle<br />
spielen. Ebenso wie die Informations- und Telekommunikationstechnologie<br />
zur <strong>in</strong>telligenten Steuerung und Vernetzung<br />
der neuen Energie<strong>in</strong>frastruktur <strong>in</strong> Deutschland. E<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>blick<br />
zu den Anforderungen der zukünftigen IT gibt Prof. Dr. Sebastian<br />
Lehnhoff vom OFFIS – Institut für Informatik, Oldenburg,<br />
<strong>in</strong> se<strong>in</strong>em E<strong>in</strong>führungsvortrag.<br />
MIT BEGEISTERUNG DABEI<br />
Dass die Rohrleitungsbranche e<strong>in</strong>e überaus attraktive Branche<br />
ist, wurde gerade erwähnt. Daher ist es der Hochschule<br />
und <strong>in</strong>sbesondere dem Institut e<strong>in</strong> besonderes Anliegen bei<br />
den Studenten das Interesse und die Begeisterung für diesen<br />
Berufszweig zu wecken. Bei der alljährlichen Vorstellung der<br />
Abschlussarbeiten von Studierenden aus den Bereichen des<br />
Rohrleitungsbaus oder des allgeme<strong>in</strong>en Baubetriebes kommt<br />
dies deutlich zum Tragen. Sie entstehen zum Ende des Studiums<br />
<strong>in</strong> enger Zusammenarbeit mit der Praxis. „Und die Ergebnisse<br />
können sich durchaus sehen lassen“, ist Prof. Thomas<br />
Wegener überzeugt und verweist auf mehrere überregionale<br />
Preise, die die Qualität der Arbeiten belegen. Platz wird auch<br />
den branchenspezifischen Verbänden e<strong>in</strong>geräumt, die <strong>in</strong> Vorträgen<br />
oder mit Ausstellungsständen ihr Leistungsspektrum<br />
präsentieren können.<br />
KKS – EIN WERKZEUG ZUM WERTERHALT<br />
Für so manchen ist Korrosionsschutz e<strong>in</strong> Exotenthema, <strong>in</strong>sbesondere<br />
dann, wenn man sich vertieft mit dem kathodischen<br />
Korrosionsschutz ause<strong>in</strong>ander setzen muss. „Wer da<br />
nicht sattelfest <strong>in</strong> der Elektrotechnik sitzt, gew<strong>in</strong>nt schnell<br />
den E<strong>in</strong>druck mit Alchemisten zu arbeiten“, stellt Prof. Wegener<br />
ironisch fest. Gleichzeitig ist er darüber erfreut, dass das<br />
Thema Korrosionsschutz auf dem kommenden Forum e<strong>in</strong>en<br />
ungewohnt breiten Raum e<strong>in</strong>nimmt. Die drei Schwerpunktthemen<br />
„Qualitätsreserven im passiven Korrosionsschutz“,<br />
„Crashkurs passiver Korrosionsschutz für (Fach-)Aufsichten<br />
im Leitungsbau“ und „Rohrnetze – KKS-basierte Zustandsbewertung“<br />
beleuchten die aktuellen Entwicklungen und<br />
11-12 | 2013 29
Programmvorschau 6. und 7. Februar 2014<br />
den Stand der Technik. E<strong>in</strong>e <strong>in</strong>teressante Diskussion wird es<br />
sicher im H<strong>in</strong>blick auf den im Herbst erschienen Entwurf des<br />
DVGW-Arbeitsblattes GW 15 geben. Der im Entwurf vorgesehene<br />
deutliche Schulungsmehraufwand für die Fachfirmen<br />
verursachte e<strong>in</strong>e Vielzahl an E<strong>in</strong>sprüchen.<br />
ES DARF GESTRITTEN WERDEN<br />
Heiß diskutiert wurde <strong>in</strong> den letzten Monaten auch über das<br />
Reizthema Frack<strong>in</strong>g. Dah<strong>in</strong>ter verbirgt sich das Aufschließen<br />
von Schiefergas unter E<strong>in</strong>satz von Chemikalien. Die Gegner<br />
dieser Technologie befürchten e<strong>in</strong>e Verunre<strong>in</strong>igung des Grundwassers.<br />
In den USA wird das Frack<strong>in</strong>g bereits e<strong>in</strong>gesetzt<br />
und man wird dies unter energiepolitischen Gesichtspunkten<br />
<strong>in</strong> Zukunft noch deutlich ausbauen. In Deutschland und<br />
Frankreich gibt es h<strong>in</strong>gegen zurzeit e<strong>in</strong> Frack<strong>in</strong>g-Verbot. „Ich<br />
f<strong>in</strong>de es gut, dass <strong>in</strong> unserer Veranstaltung auch unbequeme<br />
Themen aufgegriffen werden“, erklärt Wegener, „denn es<br />
gilt auszuloten, ob neue Technologien nicht weiterentwickelt<br />
und neue Energieträger unter Vermeidung e<strong>in</strong>er Gefahr für<br />
Mensch und Umwelt erschlossen werden können.“<br />
Kontrovers diskutiert werden soll natürlich auch im Rahmen<br />
der Diskussion im Cafe. „Schlauchl<strong>in</strong>er – der Weisheit letzter<br />
Schluss“ lautet das verheißungsvolle Thema, über das sich<br />
ausgewiesene Fachleute der Branche unter der Moderation<br />
von Dr.-Ing. Bert Bosseler, Wissenschaftlicher Leiter des IKT<br />
- Institut für Unterirdische Infrastruktur, Gelsenkirchen, hoffentlich<br />
trefflich streiten werden.<br />
IMMER GUT INFORMIERT<br />
Den Stand des Vulkan-Verlags f<strong>in</strong>den Sie wie gewohnt im<br />
2. OG V13. Falls Sie Fragen zum Buchprogramm, zur Fachzeitschrift<br />
<strong>3R</strong> oder zur IRO-App haben, kommen Sie vorbei.<br />
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.<br />
Falls Sie noch Fragen zum Programm oder zur Ausstellung<br />
des 28. Oldenburger Rohrleitungsforums haben, wenden Sie<br />
sich wenden an:<br />
Institut für Rohrleitungsbau Oldenburg (iro),<br />
Ina Kleist, kleist@iro-onl<strong>in</strong>e,<br />
Bernd Niedr<strong>in</strong>ghaus, niedr<strong>in</strong>ghaus@iro-onl<strong>in</strong>e.de,<br />
Tel. +49 441 361039-0, www.iro-onl<strong>in</strong>e.de oder<br />
www.oldenburger-rohrleitungsforum.de.<br />
30 11-12 | 2013
28. Rohrleitungsforum<br />
PROGRAMMÜBERSICHT<br />
Block 1: Eröffnung<br />
»»<br />
Eröffnung und Grußworte<br />
»»<br />
Das Gasnetz als komplementärer Bestandteil e<strong>in</strong>es<br />
Gesamtenergiesystems<br />
»»<br />
Hybridnetze – Anforderungen an die Informationsund<br />
Telekommunikationstechnologie<br />
Block 2: power2gas - Neues Gas <strong>in</strong> alten Leitungen<br />
»»<br />
Zumischung von Wasserstoff zum Erdgas –<br />
Chancen, Grenzen und Probleme entlang der<br />
Wertschöpfungskette<br />
»»<br />
Erfahrungen beim Transport von wasserstoffhaltigen<br />
Stadtgasen <strong>in</strong> Hochdruckleitungen<br />
»»<br />
Der Umgang mit potenzieller Werkstoffversprödung<br />
durch Wasserstoff<br />
Block 3: Zukunftssichere Ste<strong>in</strong>zeug-Systemlösungen<br />
für offene und geschlossene Bauweise<br />
»»<br />
Querung von Eisenbahnanlagen mit Ste<strong>in</strong>zeugrohren<br />
<strong>in</strong> geschlossener Bauweise<br />
»»<br />
Fachgerechte Herstellung von Bentonitsuspensionen<br />
»»<br />
Möglichkeiten mit Ste<strong>in</strong>zeug-Schachtsystemen – Neue<br />
Normen<br />
Block 4: Rechtliche Anforderungen an leitungsgebundene<br />
Infrastruktur verstehen<br />
»»<br />
Komplexer werdende rechtliche Anforderungen im<br />
Infrastrukturbau<br />
»»<br />
Änderungsgenehmigungen für Gastransportleitungen<br />
durchsetzen<br />
»»<br />
Folgen planerisch mangelhaft vorbereiteter<br />
Energietrassen<br />
Foto: Open Grid Europe GmbH<br />
Verdichterstationen s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> wesentliches Element e<strong>in</strong>er Gas-Transportkette –<br />
vom Speicher über die Transportleitungen <strong>in</strong>s Verteilnetz.<br />
Hier: Verdichterstation Porz Open Grid Europe<br />
Foto: KMG Pipe Technologies<br />
11-12 | 2013 31
Programmvorschau 6. und 7. Februar 2014<br />
Block 5: Horizontal Directional Drill<strong>in</strong>g I<br />
»»<br />
Alle<strong>in</strong> auf e<strong>in</strong>er Insel – 2 HDD‘s auf Grönland<br />
zwischen Eisbergen und Eisbären<br />
»»<br />
HDD – häufig unterschätzt (?) – Chancen und Risiken<br />
aus Sicht des Planers<br />
»»<br />
Fernwärmeleitungen und HDD – ke<strong>in</strong>e<br />
Standardkomb<strong>in</strong>ation!<br />
Block 6: Lösungen zur Planung und Betriebsführung<br />
von Rohrleitungsnetzen<br />
»»<br />
Neue Möglichkeiten der Netzplanung (Wasser/Gas/<br />
Fernwärme/Strom/Abwasser) unter Nutzung verschiedener<br />
Internetdienste<br />
»»<br />
Rohrleitungs- und Anlagenplanung durch e<strong>in</strong> CADunabhängiges<br />
XML/ACIS-Konzept<br />
»»<br />
Effiziente Betriebsführung für Rohrnetze<br />
Block 7: Projektgebiet Hybridnetz<br />
»»<br />
Hybridnetze <strong>in</strong> urbanen Modellquartieren der D-A-CH<br />
Region<br />
»»<br />
Hybridnetze <strong>in</strong> der Praxis: Energiebunker Hamburg<br />
Wilhelmsburg<br />
»»<br />
Das Hybridprojekt Oldenburg-Drielake<br />
Block 8: Kunststoff – der High Tech-Werkstoff für<br />
die moderne Infrastruktur<br />
»»<br />
Zeit und Geld sparen: Alternativen für den E<strong>in</strong>bau von<br />
T-Stücken <strong>in</strong> PE-Leitungen bis d 2.000 mm<br />
»»<br />
Kabelschutzrohrsysteme - Verlegung e<strong>in</strong>es Supraleiterstromkabels<br />
<strong>in</strong> Essen<br />
»»<br />
Fernwärmenetze aus PE-RT – Neue Gelegenheiten für<br />
alte Herausforderungen<br />
Block 9: Wasserstoff im Verteilnetz und beim<br />
Konsumenten<br />
»»<br />
Wasserstoff <strong>in</strong> Erdgasnetzen – Rechtliche Zulässigkeit<br />
und technische Grenzen<br />
»»<br />
Wasserstofftransport <strong>in</strong> polymeren Rohrleitungen<br />
»»<br />
Auswirkungen von Wasserstoff im Erdgas <strong>in</strong> Gasverteilnetzen<br />
und bei Endverbrauchern<br />
Pilotanlage zur Wasserstofferzeugung: Im August 2013 nahm E.ON die „Power<br />
to Gas“-Pilotanlage im brandenburgischen Falkenhagen <strong>in</strong> Betrieb<br />
Foto: E.ON<br />
Moderne GFK-Tr<strong>in</strong>kwasserspeicher im Baukastensystem –<br />
leicht zu montieren und flexibel anpassbar<br />
Block 10: Horizontal Directional Drill<strong>in</strong>g II<br />
»»<br />
Erfahrungen aus sieben Jahren W<strong>in</strong>dparkanlandungen<br />
»»<br />
Realisierung e<strong>in</strong>er Freigefälleleitung mit HDD<br />
»»<br />
Grabenloser Rohrleitungsbau im Felsgeste<strong>in</strong><br />
Block 11: Betriebsführungsmodelle <strong>in</strong> der Wasserversorgung<br />
und Abwasserentsorgung<br />
»»<br />
EDV-gestützte Betriebsführungslösung zur Optimierung<br />
der technischen Betriebsabläufe <strong>in</strong> Ver- und<br />
Entsorgungsnetzen<br />
»»<br />
Verknüpfung von Managementprozessen <strong>in</strong> der<br />
Instandhaltung von Rohrleitungssystemen der<br />
Ver- und Entsorgung unter Anwendung aktueller<br />
IT-Lösungen<br />
»»<br />
Planung und Steuerung von Regelbetriebsführungsleistungen<br />
an Kanalnetzen über IT-Lösungen<br />
Block 11a: Das Phänomen der Vers<strong>in</strong>terung <strong>in</strong><br />
Tunneldra<strong>in</strong>agen<br />
»»<br />
Entwässerung von Tunnelbauwerken <strong>in</strong> Deutschland<br />
»»<br />
Das Forschungsprojekt S<strong>in</strong>terfree<br />
»»<br />
Der neue DB-Standard 918 064 „Kunststoffrohre<br />
und Kunststoffschächte für die Entwässerung von<br />
Bahnanlagen“<br />
Block 12: Kommunikation und Datentransfer über<br />
vorhandene Infrastruktur<br />
»»<br />
Datentransfer durch die Abwasserleitung – Erfahrungen<br />
aus Bau und Vertrieb<br />
»»<br />
Funktionstüchtige Abwasserleitungen trotz e<strong>in</strong>gebauter<br />
Kabel – Betriebserfahrungen<br />
»»<br />
Kommunikation durch die Tr<strong>in</strong>kwasserleitungen –<br />
Chancen und Risiken<br />
Block 13: Betonrohre<br />
»»<br />
Rahmenbauteile nicht nur von der Stange – Spezielle<br />
Anwendungen und Ausführungen<br />
»»<br />
Das Beton-Kunststoff-Verbundrohr Perfect Pipe:<br />
Erfahrungen aus Produktentwicklung, Zulassung und<br />
E<strong>in</strong>bau<br />
Foto: AMITECH Germany GmbH<br />
32 11-12 | 2013
28. Rohrleitungsforum<br />
»»<br />
Werkstoffauswahl für Rohre und Schächte der Kanalisation<br />
unter besonderer Berücksichtigung der Brennbarkeit<br />
sowie der Recycl<strong>in</strong>gmöglichkeiten bzw. der<br />
Entsorgung<br />
Block 14: Sicherheit von Gasfernleitungen<br />
»»<br />
DVGW-Regelwerk und Umsetzung im <strong>in</strong>ternationalen<br />
Kontext<br />
»»<br />
Empfehlung e<strong>in</strong>es harmonisierten Sicherheitskonzeptes<br />
als Erweiterung des DVGW-Regelwerkes<br />
»»<br />
Auswirkungen des weiterentwickelten DVGW-Sicherheitskonzeptes<br />
aus der Sicht e<strong>in</strong>es Betreibers<br />
Block 15: Diskussion im Café: „Schlauchl<strong>in</strong>er – der<br />
Weisheit letzter Schluss?“<br />
Block 15a: Wasser: Hydraulik, Druckstoß und<br />
Aufbereitung<br />
»»<br />
Hydraulische Effizienz von Druckleitungen<br />
»»<br />
Druckstoßmodellierung <strong>in</strong> Kühlwasserkreisläufen<br />
»»<br />
Mobile Wasseraufbereitungsanlagen im E<strong>in</strong>satz bei<br />
Ultraschall-Molchungen von Erdgaspipel<strong>in</strong>es<br />
Block 16: RSV – Sanierung von Wasserversorgungsund<br />
Abwassernetzen<br />
»»<br />
Schadensstatistik für Tr<strong>in</strong>kwasserleitungen<br />
(Interpretationsmöglichkeiten)<br />
»»<br />
Auswechslung von Absperrarmaturen an Netzknotenpunkten<br />
(neue Technik)<br />
»»<br />
Betrachtung der Statik bei Schachtsanierung<br />
Block 17: Abwasserwärme <strong>in</strong> Oldenburg<br />
»»<br />
Funktionsweise und Erfahrungen mit modernen<br />
Kanal-Wärmetauschersystemen<br />
»»<br />
Potentialanalyse für das Stadtgebiet Oldenburg<br />
»»<br />
Konkretisierung <strong>in</strong> Oldenburg: Das Projekt „Alter<br />
Stadthafen“<br />
Block 18: Stahlrohre<br />
»»<br />
E<strong>in</strong> neues Umhüllungskonzept für Mehrschichtumhüllungen<br />
von Stahlrohren<br />
»»<br />
Untersuchungen zur Beständigkeit hochfester HFIgeschweißter<br />
Rohre für den Wasserstofftransport<br />
»»<br />
Leitungsrohre bei komb<strong>in</strong>ierten Belastungen: Versuche<br />
an Leitungsrohren unter Biegung und Innendruck<br />
Block 19: Abschlussarbeiten und Projekte an der<br />
Jade Hochschule <strong>in</strong> Oldenburg<br />
Block 20: Qualitätsreserven im passiven<br />
Korrosionsschutz<br />
»»<br />
Qualitätssicherung von Nachumhüllungsmaterialien<br />
»»<br />
Aufbau und Wirkung moderner KS-Systeme<br />
»»<br />
Untersuchungsansatz möglicher mechanischer Widerstandsreserven<br />
von Nachumhüllungssystemen<br />
Block 21: Fernwärme<br />
»»<br />
Vermeidung von Bauschäden durch Auswahl geeigneter<br />
Dichtungen und fachgerechter Montage bei Mauerdurchführungen<br />
von gedämmten Rohrleitungen<br />
»»<br />
Neue Applikationstechniken <strong>in</strong> der Fernwärme für<br />
Nachisolierung für gleichbleibende Qualitäten<br />
»»<br />
Chancen für technische Innovationen durch Weiterentwicklung<br />
der Produktionsmethoden<br />
Block 22: Abwasserwärme als Bauste<strong>in</strong> zur <strong>in</strong>tegrierten<br />
Wärmeversorgung<br />
»»<br />
Pilotanlage Oldenburg – Betriebserfahrungen<br />
»»<br />
Mehrwertdienste durch <strong>in</strong>telligente Steuerung von<br />
Wärmepumpen<br />
»»<br />
Wärme aus Abwasser als Bauste<strong>in</strong> zukünftiger<br />
Hybridnetze<br />
Block 23: GFK – Chancen <strong>in</strong> der Vielfalt der<br />
Möglichkeiten<br />
»»<br />
Neues Konstruktionspr<strong>in</strong>zip für Regenüberlaufbauwerke<br />
aus GFK<br />
»»<br />
Kunstharze als moderne Sanierungsoption für<br />
Abwassersysteme<br />
»»<br />
GFK-Druckrohre: Das Flowtite Kupplungssystem ohne<br />
Widerlager<br />
Block 24: Rohrleitungstechnik im Rampenlicht – e<strong>in</strong><br />
Spot auf Leckerkennung, Reparatur und<br />
Frack<strong>in</strong>gverfahren<br />
»»<br />
Grundzüge des Frack<strong>in</strong>g – e<strong>in</strong>e seit Jahrzehnten entwickelte<br />
Technologie<br />
»»<br />
Kont<strong>in</strong>uierliche Verfügbarkeit von Gastransportleitungen<br />
– Reparaturen und Anschlüsse bei vollem Volumenstrom<br />
und Druck<br />
Das Re<strong>in</strong>igen von Tr<strong>in</strong>kwasserrohrleitungen dient dem hygienisch<br />
e<strong>in</strong>wandfreien und sicheren Betrieb. Dies ist gerade im Zusammenhang<br />
mit rückläufigen Wasserabnahmen und Stagnationen im Leitungssystem,<br />
z.B. durch den demografischen Wandel, von großer Wichtigkeit<br />
Foto: Hammann GmbH<br />
11-12 | 2013 33
Programmvorschau 6. und 7. Februar 2014<br />
Block 26: Schweißtechnik<br />
»»<br />
Schadensfälle und deren Ursachenermittlung<br />
»»<br />
Ausbildung und Prüfung von Kunststoffschweißern<br />
nach GW 330 vor Ort<br />
»»<br />
Die neue Richtl<strong>in</strong>ie DVS 2202 – Bewertung von Fügeverb<strong>in</strong>dungen<br />
an Kunststoffen<br />
Block 27: Abwasser- und Erdwärme als Teil von<br />
Hybridnetzen<br />
»»<br />
Innovative Lösungen zur Wärmerückgew<strong>in</strong>nung –<br />
Energieoptimierung im Abwassernetz<br />
»»<br />
Erdreichgebundene Abwasserwärmetauscher als<br />
Energiespeicher und erfolgswirksame Komponente im<br />
zukünftigen Smart-Grid<br />
»»<br />
Erdwärmegew<strong>in</strong>nung durch Weiternutzung stillgelegter<br />
Altrohrleitungen<br />
Block 28: E<strong>in</strong>bau duktiler Guss-Rohrsysteme unter<br />
den Aspekten der Nachhaltigkeit – ökologisch,<br />
ökonomisch und technisch<br />
»»<br />
Erneuerbare Energien im Land der Fjorde – Hochleistungsanwendung<br />
duktiler Gussrohre für Wasserkraft<br />
»»<br />
Bau und Betrieb von Abwasserdruckleitungen<br />
»»<br />
Energieeffizienz durch <strong>in</strong>novative Beschichtung Polyurethan<br />
– Anwendungen und Möglichkeiten<br />
Block 29: Versicherungen als unverzichtbarer Teil<br />
des Risikomanagements<br />
»»<br />
Bedeutung der Assekuranz im Rahmen verantwortungsvoller<br />
Unternehmungsführung<br />
»»<br />
Versicherungsschutz für Tief- und<br />
Rohrleitungsbauunternehmen<br />
»»<br />
Die persönliche Haftung der Unternehmensleiter<br />
– Möglichkeiten und Grenzen e<strong>in</strong>er<br />
Haftpflichtversicherung<br />
Foto: iro<br />
Pilotprojekt mit Kanal-Wärmetauschersystemen <strong>in</strong> Oldenburg:<br />
E<strong>in</strong>bau der e<strong>in</strong>zelnen Wärmetauschermodule<br />
»»<br />
Leckerkennung <strong>in</strong> Rohrleitungen – e<strong>in</strong> Überblick verschiedener<br />
Lecksuch-Methoden<br />
Block 25: Rohrnetze – KKS-basierte<br />
Zustandsbewertung<br />
»»<br />
Integritätsbewertung e<strong>in</strong>er KKS-geschützten<br />
Gashochdruckleitung<br />
»»<br />
Zustandsbewertung mittels Korrosionskalkulation<br />
»»<br />
Messwertbasierte Zustandsbewertung e<strong>in</strong>es kathodisch<br />
geschützten Gasverteilungsnetzes<br />
»»<br />
Rehabilitationsplanung bei kathodisch geschützten<br />
Gasnetzen<br />
Block 30: GSTT Bauweisen – sicher und wirtschaftlich<br />
– aktuelle Informationen pro NoDig<br />
»»<br />
Stromleitungen - Kabel oder Freileitungen?<br />
»»<br />
Herrenknecht Pipe Express ® – die hocheffiziente und<br />
umweltschonende Pipel<strong>in</strong>e-Verlegetechnik – Technologie,<br />
bisherige Projekte und E<strong>in</strong>satzmöglichkeiten <strong>in</strong><br />
der Zukunft<br />
»»<br />
Leitungsgebundener Gütertransport – Stand der Entwicklung<br />
und Perspektiven für den Leitungsbau<br />
Block 31: Crashkurs passiver Korrosionsschutz für<br />
(Fach-)Aufsichten im Leitungsbau<br />
»»<br />
Materialkunde und Vorbereitung als Voraussetzung<br />
e<strong>in</strong>er dauerhaften Nachumhüllung<br />
»»<br />
Umhüllen will gelernt se<strong>in</strong> – Verarbeitungsmängel als<br />
Aufsicht erkennen und bewerten<br />
»»<br />
Besondere Situationen erfordern besondere Umhüllungen<br />
– Sonderanwendungen GfK und Polyurethane<br />
im Rohrleitungsbau<br />
34 11-12 | 2013
Erfrischung<br />
nötig…?<br />
Wenn Sie jetzt Durst bekommen haben,<br />
haben wir etwas richtig gemacht.<br />
Wir s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e Agentur spezialisiert auf<br />
Nischenmärkte und Industriebranchen –<br />
genau die Richtigen für Sie.<br />
IHR ÖFFNER FÜR ERFRISCHENDE<br />
MARKETINGIDEEN!<br />
www.lunis.de/erfrischung<br />
Sie erhalten von uns Qualitätsarbeit –<br />
made <strong>in</strong> Germany.<br />
MODERNE MARKETINGSTRATEGIE<br />
MESSEKOMMUNIKATION<br />
GRAFISCHE KOMMUNIKATION<br />
erfrischung@lunis.de<br />
LUNIS kommunikationsagentur, data-graphis GmbH, 65205 Wiesbaden, e<strong>in</strong> Unternehmen der ACM Unternehmensgruppe
INTERVIEW GERNOT SCHÖBITZ<br />
Ste<strong>in</strong>zeug-Keramo hat‘s:<br />
die Cradle to Cradle ® -Produktzertifizierung<br />
E<strong>in</strong> Label für die Umwelt<br />
Seit Frühjahr 2013 s<strong>in</strong>d die Ste<strong>in</strong>zeugrohrsysteme der Ste<strong>in</strong>zeug-Keramo GmbH von der EPEA GmbH 1 , Hamburg, <strong>in</strong><br />
Zusammenarbeit mit dem Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII), San Francisco, nach dem Cradle to<br />
Cradle ® -Design-Konzept 2 zertifiziert. Damit ist das Unternehmen im Besitz jenes Zertifikats, das zum e<strong>in</strong>en se<strong>in</strong> schon<br />
lange praktiziertes Verständnis von Nachhaltigkeit und Umweltbewusstse<strong>in</strong> bestätigt und das zum anderen die drei<br />
Säulen Ökologie – Ökonomie – Soziales um e<strong>in</strong>en s<strong>in</strong>nvollen Bauste<strong>in</strong> ergänzt. Nicht alle<strong>in</strong> das Zertifikat ist wegweisend,<br />
sondern <strong>in</strong>sbesondere auch die Vorreiterrolle <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Branche, <strong>in</strong> der umweltbewusstes Handeln höchste Priorität besitzt.<br />
<strong>3R</strong> sprach mit Gernot Schöbitz, Geschäftsführer der Ste<strong>in</strong>zeug-Keramo GmbH, über die H<strong>in</strong>tergründe und den Weg bis<br />
zur Erteilung des Zertifikats.<br />
LAUTER MÜLL UND KEIN ENDE –<br />
ODER DOCH ANDERE WEGE GEHEN?<br />
Produzieren – gebrauchen – wegwerfen. Nach diesem System<br />
hat sich vor allem über die vergangenen Jahrhunderte<br />
die <strong>in</strong>dustrielle Produktion von Gütern entwickelt. Von<br />
Beg<strong>in</strong>n an werden Produkte auf ihr Ende als Abfall programmiert.<br />
Damit gehen enorme Mengen wertvoller, oftmals<br />
begrenzter Ressourcen verloren. Rund 221 Millionen Tonnen<br />
Müll pro Jahr <strong>in</strong> Europa sprechen e<strong>in</strong>e deutliche Sprache.<br />
Aber es geht auch anders: Cradle to Cradle ® - „Von der<br />
Wiege bis zur Wiege“ ist e<strong>in</strong> Design-Konzept, das kreislauffähige<br />
Produkte nach dem Vorbild der Natur def<strong>in</strong>iert und<br />
entwickelt. Die Natur kennt ke<strong>in</strong>en Müll. Für sie s<strong>in</strong>d alle<br />
Produkte e<strong>in</strong>es Stoffwechselprozesses für e<strong>in</strong>en anderen<br />
Prozess von Nutzen – und das <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em immer wiederkehrenden<br />
biologischen Kreislauf. Jeder kennt das aus dem<br />
Garten, der Parkanlage, aus dem Wald.<br />
Mehrwert für das Produkt –<br />
Mehrwert für den Kunden<br />
Ste<strong>in</strong>zeugrohre bestehen zu 100 % aus den natürlichen Rohstoffen Ton,<br />
Schamotte und Wasser, geben ke<strong>in</strong>erlei Schadstoffe an die Umwelt ab und<br />
verfügen über e<strong>in</strong>e Nutzungsdauer von weit mehr als 100 Jahren. Sie s<strong>in</strong>d<br />
zu 100 % recycl<strong>in</strong>gfähig und werden zu e<strong>in</strong>em Teil mit Recycl<strong>in</strong>gmaterial<br />
und unter E<strong>in</strong>satz von Ökostrom und regenerativen Energien produziert.<br />
Alle diese Aspekte s<strong>in</strong>d nicht neu, bestätigen der Ste<strong>in</strong>zeug-Keramo GmbH<br />
aber nun von unabhängiger Seite sowohl e<strong>in</strong> ausgeprägtes Umweltbewusstse<strong>in</strong><br />
als auch e<strong>in</strong>e hohe Verantwortung für Mensch und Umwelt <strong>in</strong> der Zukunft.<br />
Dies schafft Mehrwert für das Produkt – e<strong>in</strong> Mehrwert, der sich jetzt erstmals<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Zertifikat widerspiegelt und an die Kunden weitergegeben wird.<br />
Mit der Cradle to Cradle ® -Zertifizierung unterstreicht die Ste<strong>in</strong>zeug-Keramo<br />
GmbH ihr Bekenntnis zu nachhaltiger Wertschöpfung – sowohl für Ste<strong>in</strong>zeug-<br />
Keramo als Rohrsystem-Hersteller als auch für ihre Kunden, die für e<strong>in</strong>e<br />
langfristige, sichere Abwasserentsorgung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em dauerhaft stabilen und<br />
wirtschaftlichen Rahmen Sorge zu tragen haben.<br />
Ste<strong>in</strong>zeug-Keramo GmbH, Melanie Khazdouzian,<br />
m.khazdouzian@ste<strong>in</strong>zeug-keramo.com, www.ste<strong>in</strong>zeug-keramo.com<br />
Das Cradle to Cradle ® -Konzept überträgt dieses Pr<strong>in</strong>zip<br />
der Natur auf Produkte und Materialien. Dies bedeutet,<br />
dass Produkte analog dem biologischen Kreislauf, <strong>in</strong> dem<br />
Restprodukte e<strong>in</strong>es Organismus von e<strong>in</strong>em anderen genutzt<br />
werden, schon im Entstehungsprozess so konzipiert werden,<br />
dass sie niemals als Abfall enden. Der Gedanke ist: Von<br />
Anfang an <strong>in</strong> kont<strong>in</strong>uierlichen Produktkreisläufen zu denken<br />
und damit erst gar ke<strong>in</strong>en Abfall entstehen zu lassen.<br />
Das ist so genial wie e<strong>in</strong>fach: Produkte entstehen, werden<br />
genutzt und recycelt, ohne dass dabei auch nur die kle<strong>in</strong>ste<br />
Menge Müll entsteht. Alles wird zu 100 % wiederverwertet<br />
und <strong>in</strong> den Kreislauf überführt. E<strong>in</strong>mal geschöpfte Werte<br />
und Ressourcen bleiben für Mensch und Umwelt erhalten.<br />
DIE PRODUKTINHALTSSTOFFE ENTSCHEIDEN<br />
Im Gegensatz zur traditionellen Produktionsweise, die die<br />
Rohstoffe unwiederbr<strong>in</strong>glich verbraucht, die Umwelt belastet<br />
und zukünftigen Generationen Probleme aufbürdet,<br />
wird bei der Herstellung von Produkten nach dem Cradle<br />
to Cradle ® -Design-Konzept stets „das Richtige“ gemacht.<br />
Dazu werden Cradle to Cradle ® -Produkte mit besonderem<br />
Fokus auf ihre Inhaltsstoffe entwickelt. Alle Inhaltsstoffe<br />
e<strong>in</strong>es Produkts müssen grundsätzlich bekannt se<strong>in</strong>, das heißt,<br />
alle Chemikalien werden anhand ihrer Chemical Abstracts<br />
Service-Nummer (CAS-Nr.) bei der Prüfung identifiziert. Dieser<br />
Überprüfung gilt höchste Aufmerksamkeit, denn die Liste<br />
der verbotenen Inhaltsstoffe (banned chemicals) ist lang.<br />
Damit bieten Cradle to Cradle ® -Produkte e<strong>in</strong>e neue Dimension<br />
an Qualität und Sicherheit: Sie s<strong>in</strong>d herkömmlich produzierten<br />
Produkten wirtschaftlich, ökologisch und sozial überlegen.<br />
Die Produktionsweise nach dem Cradle to Cradle ® -Design-<br />
Konzept ist <strong>in</strong> der Schweiz und den Niederlanden bereits<br />
vielfach verbreitet, <strong>in</strong> Deutschland aber noch nicht sehr<br />
bekannt. Dennoch stellen auch hierzulande Unternehmen<br />
wie z. B. Puma, Trigema, Frosch oder HeidelbergCement<br />
erste Produkte her, die entsprechend nach den Kriterien<br />
der Cradle to Cradle ® -Pr<strong>in</strong>zipien zertifiziert und im Handel<br />
erhältlich s<strong>in</strong>d.<br />
1 EPEA Environmental Protection Encouragement Agency, Internationales Forschungs- und Beratungs<strong>in</strong>stitut, Gründer: Prof. Dr. Michael Braungart<br />
2 Erf<strong>in</strong>der des Cradle to Cradle ® -Design-Konzepts ist Prof. Dr. Michael Braungart<br />
36 11-12 | 2013
GERNOT SCHÖBITZ INTERVIEW<br />
<strong>3R</strong>: Herr Schöbitz, die Ste<strong>in</strong>zeug Keramo GmbH hat <strong>in</strong> diesem<br />
Jahr die Zertifizierung nach den Cradle to Cradle ® -<br />
Pr<strong>in</strong>zipien durchführen lassen und das Zertifikat erhalten.<br />
Wann hat sich Ihr Unternehmen erstmalig mit dem Thema<br />
ause<strong>in</strong>andergesetzt?<br />
Schöbitz: Das Thema Umweltschutz und Rohrstoffkreislauf<br />
hat unser Unternehmen schon immer beschäftigt. Mit der<br />
speziellen Thematik Cradle to Cradle ® kamen wir im Zuge<br />
der Übernahme e<strong>in</strong>es Mitbewerbers im Jahr 2011 <strong>in</strong> Berührung.<br />
Dieser hatte für se<strong>in</strong>e Rohre und Formteile zu diesem<br />
Zeitpunkt bereits die Cradle to Cradle ® -Zertifizierung.<br />
Obwohl man <strong>in</strong> dieser H<strong>in</strong>sicht schon „first mover“ war, hat<br />
man es unterlassen, dies entsprechend zu kommunizieren.<br />
Das erste Beratungsgespräch mit der EPEA GmbH fand Ende<br />
2011 statt. Es wurde schnell deutlich, dass die Zertifizierung<br />
ke<strong>in</strong> Projekt ist, das mit e<strong>in</strong>em schönen Logo abgeschlossen<br />
wird, sondern dass es sich um e<strong>in</strong>en kont<strong>in</strong>uierlichen Prozess<br />
handelt. Nach der Präsentation durch die Mitarbeiter der<br />
EPEA haben wir uns kurzfristig entschieden, für alle vier<br />
Standorte unsere Produkte, Rohre und Formteile, zertifizieren<br />
zu lassen.<br />
<strong>3R</strong>: Welche Anforderungen s<strong>in</strong>d für e<strong>in</strong>e Cradle to Cradle ® -<br />
Zertifizierung zu erfüllen und welchen E<strong>in</strong>fluss hatte dies<br />
auf Ihre Arbeitsweise?<br />
Schöbitz: Zu den Cradle to Cradle ® -Pr<strong>in</strong>zipien und Prüfkriterien<br />
gehört an erster Stelle die Verwendung von<br />
umweltgerechten, gesunden und wieder verwertbaren<br />
Materialien. Diese Anforderung haben unsere Produkte<br />
bereits <strong>in</strong> der Vergangenheit erfüllt, da die Rohre und<br />
Formteile aus den natürlichen Rohstoffen Ton und Wasser<br />
hergestellt und bei der Produktion bis zu 40 % Recyclate<br />
e<strong>in</strong>gesetzt werden.<br />
Zudem verwenden wir für Rohrverb<strong>in</strong>dungen Dichtungsmaterialien,<br />
die ebenfalls genauestens auf ihre Inhaltsstoffe<br />
überprüft wurden. Die EPEA hat, nach Unterzeichnung<br />
entsprechender Vertraulichkeitserklärungen, die<br />
Rezepturen unserer Dichtungslieferanten erhalten und<br />
die Inhaltsstoffe entsprechend analysiert und bewertet.<br />
Weitere Kriterien für e<strong>in</strong>e Cradle to Cradle ® -Zertifizierung<br />
s<strong>in</strong>d der E<strong>in</strong>satz von regenerativen Energieformen, e<strong>in</strong> verantwortungsvolles<br />
Wassermanagement und die Verpflichtung<br />
zu sozialen Grundsätzen sowie Aspekte des sozialen<br />
Engagements.<br />
<strong>3R</strong>: Welche verfahrenstechnischen Änderungen haben sich<br />
durch den Cradle to Cradle ® -Prozess ergeben?<br />
Schöbitz: Wie schon erwähnt, setzen wir bereits e<strong>in</strong>en<br />
hohen Anteil an Recyclaten e<strong>in</strong>. Im Zuge des Cradle to<br />
Cradle ® -Prozesses schauen wir, diesen Anteil weiter zu<br />
maximieren - soweit dies fertigungstechnisch machbar<br />
ist. In den meisten Produkten s<strong>in</strong>d es heute um die 40 %<br />
Recyclat, <strong>in</strong> der Schnellbrandanlage <strong>in</strong> Bad Schmiedeberg<br />
jedoch liegen wir bereits bei e<strong>in</strong>em Anteil von ca. 60 %<br />
Sekundärrohstoffen.<br />
Was die Reduktion des Primärenergiebedarfs anbelangt,<br />
<strong>in</strong>vestieren wir kont<strong>in</strong>uierlich <strong>in</strong> entsprechende Optimierungsprojekte.<br />
So haben wir beispielsweise im Werk Frechen<br />
Wärmetauscher <strong>in</strong>stalliert, über die die Abgaswärme<br />
<strong>3R</strong>-Chefredakteur Nico Hülsdau im Gespräch mit Gernot Schöbitz, Geschäftsführer der Ste<strong>in</strong>zeug-Keramo GmbH, (li.)<br />
11-12 | 2013 37
INTERVIEW GERNOT SCHÖBITZ<br />
zurückgewonnen wird, um den Energieverbrauch deutlich<br />
zu senken. In Bad Schmiedeberg wird auf unserem Firmengelände<br />
von e<strong>in</strong>em Dritten e<strong>in</strong>e Biogasanlage betrieben,<br />
die von e<strong>in</strong>em nahegelegenen landwirtschaftlichen Betrieb<br />
mit Biogas versorgt wird. Der produzierte Strom geht <strong>in</strong>s<br />
öffentliche Netz und die Abwärme wird <strong>in</strong> unseren Trocknern<br />
verwendet. Dadurch sparen wir wieder Primärenergie<br />
für den Trocknungsprozess. Neben spezifischen Projekten<br />
machen wir immer wieder die Erfahrung, dass Produktionsabläufe<br />
oft mit ger<strong>in</strong>gen Investitionen, aber viel Know-how<br />
im H<strong>in</strong>blick auf den Energieverbrauch deutlich optimiert<br />
werden können. Es ist erstaunlich, welch große Auswirkung<br />
kle<strong>in</strong>e Ideen zum Teil haben können, wenn man<br />
mit offenen Augen durch den Betrieb geht und sich die<br />
Prozesse genau ansieht. Das ist natürlich auch e<strong>in</strong> Thema,<br />
bei dem wir im S<strong>in</strong>ne von Cradle to Cradle ® angehalten<br />
s<strong>in</strong>d, unsere Mitarbeiter zu sensibilisieren. Daher hat es<br />
für die Mitarbeiter an allen Standorten Cradle to Cradle ® -<br />
Schulungen gegeben.<br />
E<strong>in</strong>e weitere Voraussetzung für Cradle to Cradle ® ist der E<strong>in</strong>satz<br />
von möglichst regenerativen Energieformen. In diesem<br />
Zusammenhang wurde unsere Stromversorgung bereits <strong>in</strong><br />
diesem Jahr großteils über regenerative Quellen wie W<strong>in</strong>dkraft,<br />
Wasserkraft und Photovoltaik sichergestellt. Ab dem<br />
1. Januar 2014 wird dieser Anteil dann 100 % betragen.<br />
<strong>3R</strong>: In der Vermarktung zählen vor allem der Preis und die<br />
technischen Vorzüge e<strong>in</strong>es Produktes. Haben Sie schon<br />
Feedback aus Ihrem Kundenkreis zu dem eher weichen<br />
Argument der Ökoeffizienz-Steigerung bekommen?<br />
Schöbitz: Die Produkte werden durch die Cradle to Cradle ® -<br />
Zertifizierung nicht zwangsläufig teurer. Der Prozess trägt<br />
dazu bei, unsere Produkte <strong>in</strong> ihren Eigenschaften weiter<br />
zu optimieren, gleichzeitig höchst möglichen ökologischen<br />
Ansprüchen gerecht zu werden und dieses auch entsprechend<br />
darzustellen. Wir s<strong>in</strong>d die Ersten <strong>in</strong> unserer Branche,<br />
die die Cradle to Cradle ® -Produktzertifizierung besitzen.<br />
Unsere Aufgabe ist es nun, die Vorteile und die Eckpfeiler der<br />
Cradle to Cradle ® -Produktzertifizierung bekannt zu machen.<br />
Es wurden natürlich bereits Gespräche mit Entscheidern<br />
geführt. Dabei s<strong>in</strong>d wir durchweg auf Interesse gestoßen.<br />
Denn der Wille etwas Gutes für die Umwelt zu tun, ist allseits<br />
vorhanden, alle<strong>in</strong> wir stehen alle unter e<strong>in</strong>em hohen Kostendruck.<br />
Nicht das Billigste e<strong>in</strong>zubauen, sondern das technisch<br />
S<strong>in</strong>nvollste und Wirtschaftlichste und unter Umweltgesichtspunkten<br />
Beste sollte das Ziel se<strong>in</strong>. Mit der Cradle to Cradle ® -<br />
Zertifizierung können wir im S<strong>in</strong>ne unserer Kunden nun e<strong>in</strong><br />
sichtbares Zeichen unserer Unternehmensphilosophie setzen.<br />
<strong>3R</strong>: Herr Schöbitz, wir danken Ihnen für das Gespräch.<br />
Ste<strong>in</strong>zeug-Keramo-Umweltktreislauf: Verantwortung <strong>in</strong> der Praxis.<br />
8 Recycl<strong>in</strong>g<br />
. Keramikprodukte s<strong>in</strong>d zu 100 % recycelbar<br />
und kehren als Schamotte <strong>in</strong> den<br />
Produktionsprozess zurück<br />
1<br />
. Tonabbau <strong>in</strong> heimischen Regionen:<br />
anschließender Renaturierung<br />
7 Betrieb<br />
. Nachhaltiger Betrieb:<br />
kostengünstig durch<br />
ger<strong>in</strong>gen Wartungsund<br />
Instandhaltungsaufwand<br />
bei langer<br />
Nutzungsdauer<br />
2<br />
. Ressourcenschonend<br />
und CO 2<br />
-arm: die<br />
Transportwege zum<br />
Werk s<strong>in</strong>d kurz<br />
6 E<strong>in</strong>bau<br />
. E<strong>in</strong>bau mit fachlicher<br />
Begleitung vor Ort<br />
. Rohrsysteme für die<br />
3<br />
. Ton, Schamotte<br />
und Wasser: aus-<br />
nahmslos natürliche<br />
schlossene Bauweise<br />
Mischung<br />
5 Logistik<br />
. Ausgefeilte Logistik und Frachtoptimierung<br />
schonen die Umwelt<br />
. Flexibel und schnell – auf kurzen Wegen zum<br />
Fachhandel oder direkt zur Baustelle<br />
4 Herstellungsprozess<br />
. Im gesamten Herstellungsprozess werden<br />
alle Cradle to Cradle ® -Kriterien berücksichtigt<br />
. Energieoptimerungen f<strong>in</strong>den statt (Biomasse-<br />
Anlage, Wärmetauscher, Ökostrom)<br />
Bild 1: Der Ste<strong>in</strong>zeug-Kreislauf entspricht dem Cradle to Cradle ® -Kreislauf nach dem Vorbild der Natur<br />
38 11-12 | 2013
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
Konversion - wo verläuft die Grenze<br />
zwischen Änderung und vollständig<br />
anderem Vorhaben?<br />
Die bisherigen Beiträge der Aufsatzreihe haben rechtliche Anforderungen im Zusammenhang sowohl mit der Zulassung<br />
als auch mit Änderungen von Rohrfernleitungen betrachtet. Dabei ist deutlich geworden, dass für diese beiden Fälle<br />
unterschiedliche Vorschriften gelten können, die <strong>in</strong> der Praxis zu verschiedenen Anforderungen an das jeweilige (Errichtungsoder<br />
Änderungs-)Vorhaben führen. Der vorliegende Beitrag wendet sich der Frage zu, ob Umnutzungen von Rohrleitungen<br />
als Neuvorhaben oder als Änderung zu behandeln s<strong>in</strong>d. Solche Umnutzungen werden im Anlagenrecht auch als Konversion<br />
bezeichnet.<br />
EIN PRAKTISCH RELEVANTER UNTERSCHIED<br />
Der Wunsch nach e<strong>in</strong>er Umnutzung vorhandener Rohrleitungen<br />
kann <strong>in</strong>sbesondere dann entstehen, wenn der komplette<br />
Neubau deutlich größeren Aufwand verursacht. In<br />
solchen Fällen ist für den an e<strong>in</strong>er Umnutzung <strong>in</strong>teressierten<br />
Betreiber <strong>in</strong> juristischer H<strong>in</strong>sicht von Bedeutung, ob er sich<br />
zum<strong>in</strong>dest grundsätzlich auf die Zulassungsentscheidung<br />
der existenten Anlage stützen kann. Die Umnutzung wäre<br />
dann rechtlich nach den Grundsätzen über die Änderung<br />
zu beurteilen, die <strong>in</strong> dieser Reihe bereits dargestellt worden<br />
s<strong>in</strong>d (siehe <strong>3R</strong>-Ausgaben 7-8/2013, S. 34 ff., 9/2013,<br />
S. 24 ff. sowie und 10/2013, S. 32 ff.). Als unwesentliche<br />
Änderungen e<strong>in</strong>zustufende Veränderungen lösen ke<strong>in</strong> oder<br />
e<strong>in</strong> vergleichsweise moderates rechtliches Verfahren aus.<br />
Nur wenn die beabsichtigten Veränderungen im S<strong>in</strong>ne der<br />
betreffenden Vorschriften wesentliche Änderungen s<strong>in</strong>d,<br />
führen sie zu e<strong>in</strong>em <strong>in</strong>tensiven rechtlichen Prüfprogramm,<br />
das <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfahren<br />
mündet. Selbst e<strong>in</strong> solches Verfahren bezieht sich dann<br />
aber nur auf den Umfang der Änderungen, was Vorhabenträgern<br />
ermöglicht, im Übrigen auf den Bestandsschutz<br />
der genehmigten Anlage zurückzugreifen und die von der<br />
Änderung nicht betroffenen Anlagenteile nach den für sie<br />
bislang geltenden rechtlichen Anforderungen weiter zu<br />
betreiben. Von der Änderung betroffene Personen können<br />
dann auch nur gegen diese rechtlich vorgehen und nicht<br />
etwa (erneut) gegen die ursprüngliche Genehmigung. 1<br />
Diese Möglichkeit besteht nicht, wenn e<strong>in</strong>e Umnutzung<br />
so weit reicht, dass sie rechtlich nicht mehr als Änderung<br />
der vorhandenen Rohrleitungsanlage e<strong>in</strong>gestuft werden<br />
kann, sondern e<strong>in</strong> neues Vorhaben darstellt. Dann setzt<br />
die Umnutzung e<strong>in</strong>e gänzliche Neuzulassung voraus, die<br />
für die gesamte Anlage e<strong>in</strong>e Prüfung am Maßstab des<br />
1 BVerwG, Beschluss vom 17.09.2004, 9 VR 3.04, DÖV 2005, 658. Anders<br />
ist es nur <strong>in</strong> Sonderfällen, <strong>in</strong> welchen die Änderung zur Ausdehnung e<strong>in</strong>er<br />
enteignungsrechtlichen Inanspruchnahme führt und neu betroffene Personen<br />
dieser Wirkung (der Ursprungsgenehmigung) <strong>in</strong>folge der Änderung<br />
erstmalig ausgesetzt s<strong>in</strong>d; dann können diese Betroffenen auch E<strong>in</strong>wände<br />
gegen die Ursprungsgenehmigung erheben (siehe BVerwG, NVwZ 2011,<br />
175 ff.). Das kommt bei Trassenverschiebungen <strong>in</strong> Betracht.<br />
aktuell geltenden Rechts erfordert, ungeachtet der Tatsache,<br />
dass die Anlage bereits errichtet ist. Auch können<br />
Betreiber dann nicht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>zelfallbezogene Diskussion<br />
mit der Zulassungsbehörde über die (Un)wesentlichkeit von<br />
Änderungen und damit Beschränkung des Verwaltungsverfahrens<br />
e<strong>in</strong>treten. Deshalb ist die Frage von Bedeutung, wo<br />
die Grenze zwischen Änderung und vollständig anderem<br />
Vorhaben verläuft.<br />
AUSGANGSPUNKTE IN DER JURISTISCHEN<br />
FACHDISKUSSION<br />
Rechtsprechung und juristische Fachliteratur beschäftigen sich<br />
bislang kaum mit der Konversion von Rohr(fern)leitungsanlagen.<br />
Losgelöst von diesem Spezialgebiet haben sich aber allgeme<strong>in</strong>e<br />
Kriterien für die rechtliche Beurteilung entwickelt, die<br />
man folgendermaßen zusammenfassen kann: E<strong>in</strong> Vorhaben<br />
– gleich welcher Art – bedarf e<strong>in</strong>er neuen Zulassungsentscheidung<br />
und kann nicht lediglich durch e<strong>in</strong>e Änderungsgenehmigung<br />
legalisiert werden, wenn es mit dem Ausgangsvorhaben<br />
nicht mehr identisch ist und sich als e<strong>in</strong> anderes als das<br />
ursprünglich genehmigte Vorhaben darstellt 2 . E<strong>in</strong>e Änderung<br />
liegt nur vor, solange das planfestgestellte Vorhaben zum<strong>in</strong>dest<br />
<strong>in</strong> se<strong>in</strong>er charakteristischen Gestalt unverändert bleibt. 3<br />
Zu Recht wird <strong>in</strong> der rechtswissenschaftlichen Literatur zwar<br />
darauf h<strong>in</strong>gewiesen, dass sich dafür kaum allgeme<strong>in</strong>e Kriterien<br />
f<strong>in</strong>den lassen, aber als Anhaltspunkte können immerh<strong>in</strong> Größe,<br />
Funktion und Betriebsweise und die Antwort auf die Prüffrage<br />
dienen, ob die Anlage nach der Umnutzung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Abhängigkeit<br />
vom ursprünglichen Vorhaben steht 4 . E<strong>in</strong> weiterer zu<br />
beachtender Aspekt ist, ob und <strong>in</strong>wieweit die beabsichtigte<br />
Änderung bereits entschiedene Planungsfragen erneut auf-<br />
2 BVerwGE 90, 96, 98; BVerwG, NVwZ 1996, 905 f.; Kopp/Ramsauer,<br />
VwVfG, 14. Aufl. 2013, § 76 Rn. 7; Stelkens/Bonk, <strong>in</strong>: Stelkens/Bonk/Sachs,<br />
VwVfG, 7. Aufl. 2008, § 76 Rn. 8; Maus, NVwZ 2012, 1277, 1278; Keilich,<br />
Das Recht der Änderung <strong>in</strong> der Fachplanung, Baden-Baden 2001, S. 87 f.<br />
3 Maus, Die Änderung von Planfeststellungsbeschlüssen vor Fertigstellung<br />
des Vorhabens, NVwZ 2012, 1277 (1278); Wickel, <strong>in</strong>: Fehl<strong>in</strong>g/Kastner,<br />
Verwaltungsrecht, 32013. Auflage 2010, § 76 VwVfG, Rn. 7.<br />
4 Keilich, Das Recht der Änderung <strong>in</strong> der Fachplanung, Baden-Baden 2001,<br />
S. 88.<br />
11-12 | 2013 39
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
wirft 5 . Wenn e<strong>in</strong>e Modifikation die Gesamtkonzeption oder<br />
doch wesentliche Teile e<strong>in</strong>es festgestellten Plans <strong>in</strong> Frage stellt,<br />
scheidet nach der Rechtsprechung e<strong>in</strong> Änderungsverfahren<br />
aus. 6 In e<strong>in</strong>er Leitentscheidung hat das Bundesverwaltungsgericht<br />
dies alles <strong>in</strong> die Formulierung gefasst, für die Abgrenzung<br />
zwischen Änderung und vollständig neuem Vorhaben sei<br />
„… e<strong>in</strong>e am Gegenstand des festgestellten Planes orientierte<br />
materielle Betrachtung [maßgebend], bei der zu prüfen ist,<br />
ob auch angesichts der von dem Planfeststellungsbeschluss<br />
neu zugelassenen Deponieflächen noch die Art der alten<br />
Anlage gewahrt geblieben oder e<strong>in</strong>e nach Gegenstand, Art<br />
und Betriebsweise im wesentlichen andersartige Anlage h<strong>in</strong>zugekommen<br />
ist.“ 7<br />
Es gibt also ke<strong>in</strong>en im engeren S<strong>in</strong>ne messbaren Punkt des<br />
Übergangs zwischen Änderung und neuem Vorhaben. Vielmehr<br />
f<strong>in</strong>det e<strong>in</strong>e Abwägung verschiedener Gesichtspunkte<br />
statt. Je mehr Aspekte für die Annahme e<strong>in</strong>es neuen Vorhabens<br />
sprechen und je gewichtiger diese Aspekte s<strong>in</strong>d, umso<br />
eher kann im Rechtss<strong>in</strong>ne nicht mehr von e<strong>in</strong>er bloßen Änderung<br />
e<strong>in</strong>er Rohr(fern)leitungsanlage ausgegangen werden.<br />
E<strong>in</strong>e bloße Verbreiterung der (behördlichen) Erkenntnisbasis<br />
– im konkreten Fall entschieden für zusätzlich e<strong>in</strong>geholte<br />
Gutachten – berührt die Identität e<strong>in</strong>es Vorhabens andererseits<br />
jedenfalls nicht. 8 Alle<strong>in</strong> der Umstand, dass im Rahmen<br />
e<strong>in</strong>er Konversion ergänzende Untersuchungen e<strong>in</strong>geholt<br />
werden müssen, führt also nicht zur Beurteilung der Umnutzung<br />
als vollständig neues Vorhaben.<br />
Von diesen Grundlagen aus betrachten die nachfolgenden<br />
Überlegungen e<strong>in</strong>ige im Zusammenhang mit Umnutzungen<br />
von Rohr(fern)leitungsanlagen <strong>in</strong> Betracht kommende typische<br />
Modifikationen auf ihre Bedeutung für die Unterscheidung<br />
zwischen bloßer Änderung und vollständig neuem<br />
Vorhaben. Ins Gedächtnis zu rufen ist dabei: Die Zuordnung<br />
e<strong>in</strong>er konkreten Konversion zu e<strong>in</strong>er der beiden Gruppen<br />
bedeutet lediglich e<strong>in</strong>e Festlegung des e<strong>in</strong>zuhaltenden Verfahrens.<br />
Unter welchen Voraussetzungen die jeweilige Konversion<br />
zulässig ist, wird dadurch nicht vorweggenommen.<br />
Daher kann beispielsweise auch e<strong>in</strong>e als bloße Änderung<br />
e<strong>in</strong>zustufende Konversion im Ergebnis im jeweiligen E<strong>in</strong>zelfall<br />
nicht zulassungsfähig se<strong>in</strong>.<br />
TRASSENÄNDERUNG<br />
Jedenfalls Umnutzungen, <strong>in</strong> deren Zug die betreffende<br />
Rohr(fern)leitungsanlage baulich oder technisch spürbar<br />
verändert wird, dürften auf der geschilderten Grundlage<br />
oft als neue Vorhaben mit der Folge e<strong>in</strong>es komplett zu<br />
durchlaufenden Zulassungsverfahrens zu beurteilen se<strong>in</strong>.<br />
Dies trifft vor allem auf grundlegende Trassenänderungen<br />
zu. E<strong>in</strong> plastisches Beispiel f<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> der Rechtsprechung<br />
des Oberverwaltungsgerichts Bremen, welches die<br />
Verlegung e<strong>in</strong>er etwa 340 m langen Straßenbahnstrecke <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>e Straße, die bisher überhaupt ke<strong>in</strong>e Straßenbahn führte,<br />
überzeugend als Neubau und nicht lediglich als Änderung<br />
5 Kämper, <strong>in</strong>: BeckOK VwVfG, § 76 Rn. 3.<br />
6 BVerwGE 75, 214 (219).<br />
7 BVerwGE 90, 96 (98).<br />
8 BVerwG, NVwZ 1996, 905 (906).<br />
der bestehenden Straßenbahnstrecke beurteilt hat. 9 E<strong>in</strong><br />
anderes Beispiel: Im Bereich der Straßenplanung wird es <strong>in</strong><br />
der rechtswissenschaftlichen Literatur als neues Vorhaben<br />
beurteilt, e<strong>in</strong>e Ortsumgehung oder e<strong>in</strong>e Entlastungsstraße<br />
anzulegen, „weil zu der verlassenen Straße, die ihre bisherigen<br />
Funktionen zu e<strong>in</strong>em Teil behält, e<strong>in</strong>e Straße mit<br />
neuer Verkehrsfunktion h<strong>in</strong>zutritt“. 10 In e<strong>in</strong>em ähnlichen<br />
Fall hat das Bundesverwaltungsgericht die Planung e<strong>in</strong>er<br />
Bundesstraße im Unterschied zur vorher geplanten Bundesautobahn<br />
unter anderem deshalb als neues Vorhaben<br />
gewertet, weil bei Bundesautobahnen andere Anforderungen<br />
an die Trassenführung bestünden, <strong>in</strong>sbesondere die<br />
Berücksichtigung von Zwangspunkten und Abständen zur<br />
Bebauung erforderlich seien. 11<br />
Auf der anderen Seite hat das Bundesverwaltungsgericht<br />
das Anlegen e<strong>in</strong>es Rad-/Gehweges bei gleichzeitiger Verr<strong>in</strong>gerung<br />
des Fahrbahnquerschnittes im Rahmen e<strong>in</strong>er<br />
straßenrechtlichen Planfeststellung als lediglich „marg<strong>in</strong>ale<br />
Planänderung“ beurteilt; die Gesamtkonzeption des Planes<br />
sei nicht berührt. 12 Ebenfalls als nur marg<strong>in</strong>ale Planänderung<br />
hat das Bundesverwaltungsgericht im Zusammenhang<br />
mit e<strong>in</strong>em eisenbahnrechtlichen Planfeststellungsverfahren<br />
e<strong>in</strong>e Entscheidung für die e<strong>in</strong>gleisige Führung e<strong>in</strong>er Strecke<br />
e<strong>in</strong>geordnet, weil diese den Flächenverbrauch und die<br />
sonstigen Umweltauswirkungen des Vorhabens verr<strong>in</strong>gere. 13<br />
E<strong>in</strong>en weiteren bemerkenswerten Gesichtspunkt spricht<br />
schließlich der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg<br />
an. Im Zusammenhang mit Bauarbeiten an e<strong>in</strong>er Gleisanlage<br />
g<strong>in</strong>g es um die Frage, ob durch die Veränderung der Höhenlage<br />
e<strong>in</strong>e neue Strecke entstanden war. Von der Antwort<br />
h<strong>in</strong>g ab, ob e<strong>in</strong> Planfeststellungsverfahren durchzuführen<br />
war. Der Verwaltungsgerichtshof argumentierte, diese Frage<br />
müsse man möglichst zweifelsfrei beurteilen können, und<br />
deshalb könnten selbst größere Umbaumaßnahmen für<br />
sich genommen nicht die Annahme e<strong>in</strong>er neuen Strecke<br />
rechtfertigen; über deren jeweilige Bedeutung sei zu viel<br />
Diskussion möglich. Von e<strong>in</strong>er solchen sei vielmehr nur<br />
auszugehen, wenn auf e<strong>in</strong>er bislang nicht für Bahnzwecke<br />
genutzten Trasse Gleise verlegt oder sonstige Bahnanlagen<br />
hergestellt würden. 14<br />
Für die Konversion von Rohr(fern)leitungsanlagen lässt sich<br />
aus alledem die erste Schlussfolgerung ziehen, dass erst e<strong>in</strong><br />
mit e<strong>in</strong>er Umnutzung verbundenes Verlegen der Leitungstrasse<br />
regelmäßig für die Annahme e<strong>in</strong>es neuen Vorhabens<br />
anstatt e<strong>in</strong>er Änderung spricht. Umgekehrt bedeutet nicht<br />
jede bauliche Modifikation im Bereich e<strong>in</strong>er existierenden<br />
Trasse, dass die Identität e<strong>in</strong>er existierenden Anlage <strong>in</strong> Frage<br />
gestellt und der Bereich (ggf. wesentlicher) Änderungen verlassen<br />
wird. Vielmehr lassen sich die genannten Gerichtsentscheidungen<br />
dah<strong>in</strong>gehend <strong>in</strong>terpretieren, dass erst substantielle<br />
bauliche Abweichungen vom ursprünglich genehmigten<br />
Zustand die Schwelle zum neuen Vorhaben überschreiten.<br />
9 OVG Bremen, DÖV 1987, 159 (160).<br />
10 Dürr, <strong>in</strong>: Kodal, Straßenrecht, 7. Auflage 2010, Kap. 36 Rn. 7.31.<br />
11 BVerwG, NVwZ 1986, 834 (835).<br />
12 BVerwG, NVwZ 1990, 366.<br />
13 BVerwG, NVwZ 1999, 70.<br />
14 VGH BW, UPR 1987, 394.<br />
40 11-12 | 2013
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
KAPAZITÄTSÄNDERUNGEN<br />
Deutliche Modifikationen der Anlagenkapazität oder auch<br />
der Betriebsweise können zur Annahme e<strong>in</strong>es neuen Vorhabens<br />
führen. So hat das Bundesverwaltungsgericht <strong>in</strong><br />
der oben wörtlich wiedergegebenen Leitentscheidung – es<br />
g<strong>in</strong>g um e<strong>in</strong>e Abfalldeponie – e<strong>in</strong>e andersartige Anlage<br />
unter H<strong>in</strong>weis darauf angenommen, dass die neu gestattete<br />
Deponie mehr als doppelt so groß sei wie die alte und dass<br />
der angefochtene Planfeststellungsbeschluss die Betriebsweise<br />
und die E<strong>in</strong>zelheiten der Ablagerungstechnik völlig<br />
neu und <strong>in</strong>sgesamt von der Altanlage unabhängig regele.<br />
Deshalb habe der neue Anlagenteil e<strong>in</strong>e „über e<strong>in</strong>e bloße<br />
Erweiterung h<strong>in</strong>ausgehende eigenständige Bedeutung.“ 15<br />
Dass e<strong>in</strong>e im Wesentlichen andersartige Anlage ohne Identität<br />
mit der vorher bestehenden <strong>in</strong>s Auge gefasst sei, hat<br />
das Bundesverwaltungsgericht auch im Fall e<strong>in</strong>er anderen<br />
Deponie bejaht, die auf mehr als das Doppelte anwuchs und<br />
deren Betriebsweise nebst E<strong>in</strong>zelheiten der Ablagerungstechnik<br />
völlig neu im Planfeststellungsbeschluss geregelt<br />
worden war, zumal die Neuanlage von der alten <strong>in</strong>sgesamt<br />
nicht abh<strong>in</strong>g. 16<br />
Solche Modifikationen müssen allerd<strong>in</strong>gs immer im Kontext<br />
der gesamten Anlage gesehen werden. Von e<strong>in</strong>er bloßen<br />
Änderung ist das Bundesverwaltungsgericht zum Beispiel<br />
trotz der Dimension des Gesamtvorhabens <strong>in</strong> Bezug auf<br />
den Wegfall e<strong>in</strong>er dritten Start- und Landebahn im Zusammenhang<br />
mit der Planfeststellung des Flughafens München<br />
II ausgegangen, denn dieser Wegfall stellte weder<br />
die Gesamtkonzeption noch wesentliche Teile des übrigen<br />
Plan<strong>in</strong>haltes <strong>in</strong> Frage. So seien beispielsweise ke<strong>in</strong>e ernsthaften<br />
Zweifel an dem Bedürfnis für e<strong>in</strong>en Flughafenneubau<br />
oder an der Abgewogenheit der Standortentscheidung<br />
durch den Wegfall der dritten Bahn aufgeworfen worden. 17<br />
In e<strong>in</strong>em anderen Fall g<strong>in</strong>g es um e<strong>in</strong> Vorhaben, welches<br />
im Wesentlichen als „Brücke über die Elbe“ gekennzeichnet<br />
worden war. 18 Veränderungen wie die Reduzierung<br />
der Höhe e<strong>in</strong>er Straße von bisher 1,20 m auf 0,86 m, die<br />
Erhöhung der Anzahl abzureißender Gebäude sowie Änderungen,<br />
die als Folge zu e<strong>in</strong>er Reduzierung des erforderlichen<br />
Grunderwerbs führen, betrafen nicht die Identität und<br />
Gesamtkonzeption dieses Plans.<br />
Aus dieser Rechtsprechung lässt sich e<strong>in</strong> weiterer Aspekt für<br />
die Abgrenzung zwischen Änderung und vollständig neuem<br />
Vorhaben abstrahieren und für Rohr(fern)leitungsanlagen<br />
fruchtbar machen: Substantielle Kapazitätsänderungen und<br />
bauliche Modifikationen sprechen für die Annahme e<strong>in</strong>es<br />
vollständig neuen Vorhabens. Im Umkehrschluss sprechen<br />
e<strong>in</strong> Beibehalten der baulich-technischen Strukturen und der<br />
Kapazität e<strong>in</strong>er Rohr(fern)leitungsanlage dafür, e<strong>in</strong>e bloße<br />
Änderung anzunehmen. Auf viele Konversionsfälle dürfte<br />
das zutreffen, was dafür spricht, sie eher als Änderung denn<br />
als neues Vorhaben e<strong>in</strong>zustufen.<br />
WECHSEL DES TRANSPORTMEDIUMS<br />
Augensche<strong>in</strong>lich kaum <strong>in</strong> den vorhandenen Bestand e<strong>in</strong>er<br />
Rohr(fern)leitungsanlage greift es im Gegensatz zu den eben<br />
behandelten baulich-technischen Modifikationen e<strong>in</strong>, wenn<br />
lediglich das transportierte Medium ausgetauscht wird.<br />
Anpassungen im Bereich der Mess- und Regeltechnik s<strong>in</strong>d an<br />
dieser Stelle aus juristischer Sicht vernachlässigbar und werden<br />
zugunsten der Verdeutlichung der rechtlichen Aspekte<br />
hier zurückgestellt. Klärungsbedürftig ist, ob alle<strong>in</strong> schon der<br />
Wechsel des Transportmediums zu e<strong>in</strong>em vollständig neuen<br />
Vorhaben oder zu e<strong>in</strong>er bloßen Änderung der Rohr(fern)leitungsanlage<br />
führt, wenn sich also die eigentliche Anlage nicht<br />
verändert, sondern lediglich die konkrete Art ihrer Benutzung.<br />
Auch wenn die Zulassungsentscheidung der ursprünglichen<br />
Rohr(fern)leitungsanlage das zu transportierende Medium<br />
sehr konkret beschreibt, folgt daraus nicht zw<strong>in</strong>gend, dass<br />
diese Konkretisierung die Identität der Anlage maßgeblich<br />
bestimmt. Im Gegenteil zeigen die oben diskutierten Umnutzungsfälle<br />
aus anderen Teilbereichen der Rechtsordnung, dass<br />
diese die Schwelle zum vollständig neuen Vorhaben nicht<br />
alle<strong>in</strong> an der Nutzungsweise festmacht, sondern als Produkt<br />
unterschiedlicher Faktoren bestimmt: Die Identität e<strong>in</strong>er Anlage<br />
hängt von deren sämtlichen Eigenschaften geme<strong>in</strong>sam ab, ist<br />
also e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>dividuelle Komb<strong>in</strong>ation aus baulich-technischen<br />
Eigenschaften, Betriebsweise und Fördermedium. Angesichts<br />
der bei Rohr(fern)leitungen fehlenden Emissionen lässt sich<br />
deshalb unseres Erachtens gut vertreten, dem Fördermedium<br />
nur e<strong>in</strong>e eher untergeordnete Rolle zuzugestehen. 19 Auf den<br />
Punkt gebracht: Vorbehaltlich unterschiedlicher technischer<br />
und sicherheitlicher Anforderungen ist es <strong>in</strong> vielen Fällen im<br />
Grunde genommen gleichgültig, welcher Stoff durch e<strong>in</strong>e<br />
Rohr(fern)leitungsanlage befördert wird.<br />
Dieses Ergebnis deckt sich mit e<strong>in</strong>er Beobachtung aus e<strong>in</strong>em<br />
anderen juristischen Bereich: Bei der Umnutzung von Bahnanlagen<br />
gelangt man zu e<strong>in</strong>em vollständig neuen Vorhaben,<br />
wenn der Bahnbetrieb vollständig aufgegeben wird. 20 Solange<br />
die betreffenden Betriebsflächen für Bahnzwecke genutzt werden<br />
sollen, fehlt es h<strong>in</strong>gegen an grundlegenden Veränderungen,<br />
die wertungsmäßig als Identitätswechsel zu betrachten<br />
wären: Zug ist Zug. Erst wenn „ke<strong>in</strong> Verkehrsbedürfnis mehr<br />
besteht und langfristig e<strong>in</strong>e Nutzung der Infrastruktur im Rahmen<br />
der Zweckbestimmung nicht mehr zu erwarten ist“, wird<br />
e<strong>in</strong> Grundstück durch die zuständige Planfeststellungsbehörde<br />
von den Bahnbetriebszwecken und damit se<strong>in</strong>er rechtlichen<br />
B<strong>in</strong>dung an diese freigestellt (§ 23 Abs. 1 Allgeme<strong>in</strong>es Eisenbahngesetz).<br />
Mith<strong>in</strong> misst die Rechtsordnung den Identitätswechsel<br />
bei Bahnanlagen nicht am konkret auf der Schiene<br />
bewegten Objekt (und erst recht nicht am Inhalt e<strong>in</strong>zelner<br />
Waggons), sondern am allgeme<strong>in</strong> gehaltenen Betriebszweck<br />
„Eisenbahn“. Bezogen auf Rohr(fern)leitungsanlagen spricht<br />
dieser Vergleich dafür, e<strong>in</strong>en Wechsel des transportierten<br />
Mediums bei der Abgrenzung zwischen bloßer Änderung und<br />
15 BVerwGE 90, 96 (98).<br />
16 BVerwG, NVwZ 1992, 789.<br />
17 BVerwG, NVwZ 1987, 578 (589) = BVerwGE 75, 214.<br />
18 BVerwG, NVwZ 1996, 905 (906).<br />
19 Wie hier Sieder/Zeitler/Dahme/Knopp, Wasserhaushaltsgesetz, Stand: 23.<br />
Ergänzungslieferung November 2001, § 19a Rn. 43; Appold, <strong>in</strong>: Hoppe /<br />
Beckmann, UVPG, 4. Aufl. 2012, § 2 Rn. 78.<br />
20 Wie hier Keilich, Das Recht der Änderung <strong>in</strong> der Fachplanung, Baden-<br />
Baden 2001, S. 121.<br />
11-12 | 2013 41
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
Themenübersicht 2013<br />
Zulassungsverfahren für Errichtung und Betrieb von Rohrfernleitungen<br />
- Teil 1: Gasversorgungsleitungen im S<strong>in</strong>ne des EnWG<br />
<strong>3R</strong>, Ausgabe 1-2/2013, S. 36-41<br />
Zulassungsverfahren für Errichtung und Betrieb von Rohrfernleitungen -<br />
Teil 2: Rohrfernleitungen i.S.d. Ziffern 19.3 bis 19.8 der Anlage 1 des UVPG<br />
<strong>3R</strong>, Ausgabe 3/2013, S. 36-39<br />
Zulassungsverfahren für Errichtung und Betrieb von Rohrfernleitungen<br />
- Teil 3: Anforderungen des Bundesberggesetzes (BBergG) und des<br />
Kohlendioxidspeichergesetzes (KSpG)<br />
<strong>3R</strong>, Ausgabe 4-5/2013, S. 44-49<br />
Änderung von Rohrfernleitungen - Teil 1: Zulassungserfordernisse<br />
und Zulassungsverfahren<br />
<strong>3R</strong>, Ausgabe 7-8/2013, S. 34-42<br />
Änderung von Rohrfernleitungen - Teil 2: Die UVP-Relevanz von<br />
Änderungen<br />
<strong>3R</strong>, Ausgabe 9/2013, S. 24-32<br />
Änderung von Rohrfernleitungen - Teil 3: Die Änderung von<br />
Rohrfernleitungen zum Befördern wassergefährdender Stoffe,<br />
§ 20 Abs. 2 S. 4 UVPG<br />
<strong>3R</strong>, Ausgabe 10/2013, S.32-37<br />
Konversion - Wo verläuft die Grenze zwischen Änderung und<br />
vollständig anderem Vorhaben?<br />
<strong>3R</strong>, Ausgabe 11-12/2013<br />
vollständig neuem Vorhaben zwar nicht als bedeutungslos zu<br />
ignorieren, aber umgekehrt auch nicht etwa zur tragenden<br />
Erwägung zu machen.<br />
Ähnliches gilt <strong>in</strong> Bezug auf die Konversion militärischer Flugplätzen<br />
zu zivilen. Hierfür existiert mit § 8 Abs. 5 des Luftverkehrsgesetzes<br />
e<strong>in</strong>e spezielle gesetzliche Regelung, die<br />
ausdrücklich festhält, dass derartige Umnutzungsfälle durch<br />
e<strong>in</strong>e Änderungsgenehmigung ohne Planfeststellung oder<br />
Plangenehmigung zu regeln s<strong>in</strong>d. Erst wenn nicht lediglich<br />
Anpassungen an die Sicherheitserfordernisse der Zivilluftfahrt<br />
stattf<strong>in</strong>den, sondern grundlegende Veränderungen wie e<strong>in</strong>e<br />
neue Bahnkonfiguration oder e<strong>in</strong>e kapazitätserweiternde<br />
Verlängerung der Start- und Landebahn, besteht e<strong>in</strong> Planfeststellungserfordernis.<br />
21 Dieser letztere Fall ist dem bloßen<br />
Austausch des Transportmediums <strong>in</strong> Rohr(fern)leitungen nicht<br />
vergleichbar, sondern entspricht dem bereits oben angesprochenen<br />
Fall der substantiellen Veränderung. Wie oben und wie<br />
bei Bahnanlagen lässt sich aber e<strong>in</strong> Umkehrschluss formulieren:<br />
Von e<strong>in</strong>em Planfeststellungserfordernis geht der Gesetzgeber<br />
nicht aus, solange sich die Modifikation im Wesentlichen darauf<br />
beschränkt, e<strong>in</strong>e Art von Flugverkehr gegen e<strong>in</strong>e andere<br />
auszutauschen.<br />
21 BVerwGE 130, 83 (87).<br />
WECHSEL DES GENEHMIGUNGSRECHTLICHEN<br />
RAHMENS<br />
Bei Rohrleitungsanlagen kann ferner e<strong>in</strong> Aspekt relevant<br />
werden, der <strong>in</strong> dieser Form juristisch eher ungewöhnlich ist,<br />
nämlich e<strong>in</strong> konversionsbed<strong>in</strong>gtes Verlassen der Rechtsgrundlagen<br />
für die ursprüngliche Zulassungsentscheidung. Dieser<br />
Fall kann selbst dann e<strong>in</strong>treten, wenn bis auf e<strong>in</strong>en Wechsel<br />
des Transportmediums ke<strong>in</strong>e substantiellen Veränderungen<br />
an der Anlage vorgenommen werden: Weil beispielsweise<br />
§ 43 EnWG nur Errichtung, Betrieb und Änderung von<br />
Gasversorgungsleitungen regelt, wäre die Aufnahme e<strong>in</strong>er<br />
energieversorgungsfremden Nutzung unter § 43 EnWG nicht<br />
orig<strong>in</strong>är zulassungsfähig, und konsequenterweise kann auch<br />
die Aufnahme e<strong>in</strong>er energieversorgungsfremden Nutzung im<br />
Wege e<strong>in</strong>er Änderungsgenehmigung nicht nach § 43 EnWG<br />
zulassungsfähig se<strong>in</strong>. In beiden Fällen liegt der zuzulassende<br />
Sachverhalt außerhalb des Geltungsbereiches dieser Rechtsgrundlage<br />
und wird von ihr nicht erfasst. Deshalb lässt sich je<br />
nach E<strong>in</strong>zelfall allenfalls der erste Schritt e<strong>in</strong>er Konversion – die<br />
Beendigung der ursprünglichen Nutzung – noch als Änderung<br />
nach § 43 EnWG abwickeln, nicht aber der Beg<strong>in</strong>n der neuen.<br />
In der juristischen Fachliteratur f<strong>in</strong>det sich dementsprechend<br />
die Auffassung, wenn der Nutzungszweck e<strong>in</strong>er Anlage so<br />
geändert werde, dass der rechtliche Rahmen für die Genehmigung<br />
des alten Vorhabens e<strong>in</strong> anderer sei als der für die<br />
Genehmigung des neuen, dann liege ke<strong>in</strong>e Identität mehr<br />
vor, und es handele sich um e<strong>in</strong> vollständig neues Vorhaben. 22<br />
Auf dieser Grundlage spricht es umgekehrt – im Zusammenwirken<br />
mit den bisher behandelten Gesichtspunkten – gegen<br />
die Annahme e<strong>in</strong>es vollständig neuen Vorhabens und für<br />
e<strong>in</strong>e bloße Änderung, wenn die ursprüngliche und die neue<br />
Nutzung dem gleichen rechtlichen Genehmigungsregime<br />
unterliegen. Deshalb lässt sich h<strong>in</strong>sichtlich UVP-pflichtiger<br />
Vorhaben argumentieren, dass die Identität e<strong>in</strong>es Vorhabens<br />
so lange erhalten bleibt, wie sie der <strong>in</strong> Anlage 1 zum UVPG<br />
– dies ist die Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben – beschriebenen<br />
entspricht. 23 So spricht beispielsweise Ziff. 19.3 der<br />
Anlage 1 zum UVPG von Rohrleitungsanlagen „zum Befördern<br />
wassergefährdender Stoffe“. Die Identität e<strong>in</strong>er solchen<br />
Rohrleitungsanlage wird demnach nicht durch e<strong>in</strong>en konkreten<br />
wassergefährdenden Stoff bestimmt, sondern durch die<br />
wassergefährdenden Stoffe <strong>in</strong>sgesamt. Wird der durch e<strong>in</strong>e<br />
Rohrleitungsanlage transportierte wassergefährdende Stoff<br />
gegen e<strong>in</strong>en anderen wassergefährdenden Stoff ausgetauscht,<br />
bedarf dies zwar e<strong>in</strong>er Änderungsgenehmigung, berührt aber<br />
nach hier vertretener Ansicht nicht die Identität der Anlage<br />
als Leitung zum Transport wassergefährdender Stoffe. S<strong>in</strong>ngemäß<br />
gilt diese Überlegung auch für die übrigen Typen von<br />
Rohrleitungsanlagen, die <strong>in</strong> den Ziff. 19.4 ff. der Anlage 1<br />
zum UVPG erfasst werden. Erstes Zwischenergebnis ist also,<br />
dass jedenfalls e<strong>in</strong>e bloße Änderung e<strong>in</strong>er Rohrleitungsanlage<br />
gegeben ist, wenn sich die ursprüngliche und die neue Nutzung<br />
<strong>in</strong>nerhalb derselben Untergruppe der Ziff. 19 der Anlage<br />
1 zum UVPG bewegen.<br />
22 Keilich, Das Recht der Änderung <strong>in</strong> der Fachplanung, Baden-Baden<br />
2001, S. 121.<br />
23 Appold, <strong>in</strong>: Hoppe/Beckmann, UVPG, 4. Auflage 2012, § 2 Rn. 78.<br />
42 11-12 | 2013
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
Aber auch e<strong>in</strong> Wechsel zwischen verschiedenen Untergruppen<br />
der Ziff. 19 bedeutet nicht automatisch e<strong>in</strong> Abweichen von der<br />
Identität des ursprünglichen Vorhabens und damit e<strong>in</strong> neues<br />
Vorhaben, weil die rechtliche E<strong>in</strong>stufung sich nicht nach e<strong>in</strong>em<br />
e<strong>in</strong>zigen Gesichtspunkt richtet. Wie bereits ausgeführt, richtet<br />
sich die Beurteilung vielmehr nach e<strong>in</strong>er Gesamtheit mehrerer<br />
Kriterien. Der Wechsel zwischen zwei Untergruppen der<br />
Ziff. 19 fällt gegenüber anderen Umständen dabei vergleichsweise<br />
ger<strong>in</strong>g <strong>in</strong>s Gewicht, weil er kaum Konsequenzen nach<br />
sich zieht: Alle Arten von Rohrleitungen, die unter der Ziff. 19<br />
erfasst werden, unterliegen jedenfalls pr<strong>in</strong>zipiell den gleichen<br />
genehmigungsrechtlichen Anforderungen. Deshalb führt e<strong>in</strong><br />
Wechsel <strong>in</strong>nerhalb der Ziff. 19 der Anlage 1 zum UVPG nicht<br />
zw<strong>in</strong>gend – also ungeachtet aller anderen Umstände – zum<br />
Verlust der Anlagenidentität und zum Bedarf nach e<strong>in</strong>em<br />
Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfahren.<br />
An ihre Grenzen stößt diese Argumentation allerd<strong>in</strong>gs, wenn<br />
der Wechsel sich nicht auf die Untergruppen der Ziff. 19<br />
beschränkt, sondern auch die gesetzliche Genehmigungsgrundlage<br />
selbst verändert. Dies betrifft die <strong>in</strong> Ziff. 19.2 der<br />
Anlage 1 zum UVPG genannten Gasversorgungsleitungen im<br />
S<strong>in</strong>ne des EnWG. Sie s<strong>in</strong>d nach § 43 EnWG zuzulassen, der<br />
e<strong>in</strong>e Konversion aus dem Anwendungsbereich des EnWG<br />
nicht tragen kann (siehe oben). Selbiges gilt s<strong>in</strong>ngemäß für<br />
Rohrleitungsanlagen, die nach § 20 Abs. 1 UVPG zugelassen<br />
worden s<strong>in</strong>d und nun <strong>in</strong> den Bereich des EnWG überführt<br />
werden sollen; 24 hier vermag § 20 Abs. 1 UVPG wegen se<strong>in</strong>es<br />
auf Anlagen nach den Ziffern 19.3 ff. der Anlage 1 zum<br />
UVPG beschränkten Anwendungsbereichs die Nutzung nach<br />
Ziff. 19.2 der Anlage (unter welche e<strong>in</strong>e Gasversorgungsleitung<br />
im S<strong>in</strong>ne des EnWG fällt) nicht rechtlich zu begründen.<br />
BESONDERE FRAGEN BEI VOLLSTÄNDIG NEUEM<br />
VORHABEN<br />
Wie e<strong>in</strong>gangs bemerkt, ist die rechtliche Unterscheidung zwischen<br />
bloßer Änderung und vollständig neuem Vorhaben<br />
schon wegen der unterschiedlichen Verwaltungsverfahren<br />
von Bedeutung. Darüber h<strong>in</strong>aus sollen hier im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>es<br />
H<strong>in</strong>weises zwei weitere schon bei der strategischen Planung<br />
zu bedenkende Gesichtspunkte angerissen werden:<br />
Erstens kann, soweit die Umnutzung e<strong>in</strong>e Rohr(fern)leitungsanlage<br />
betrifft, die auf der Grundlage e<strong>in</strong>es Planfeststellungsbeschlusses<br />
oder e<strong>in</strong>er Plangenehmigung zugelassen worden<br />
ist, die sogenannte Planrechtfertigung e<strong>in</strong>e Rolle spielen. Dabei<br />
handelt es sich um e<strong>in</strong>e Voraussetzung für die Erteilung solcher<br />
Zulassungsentscheidungen: Was e<strong>in</strong>e Behörde auf Grundlage<br />
des Antrags e<strong>in</strong>es Vorhabenträgers plant, ist nicht um se<strong>in</strong>er<br />
selbst willen gerechtfertigt, sondern auch mit Blick auf die<br />
Auswirkungen auf Dritte rechtfertigungsbedürftig. Deshalb<br />
muss für Planungen e<strong>in</strong> Bedürfnis bestehen, die mit der jeweiligen<br />
Planung verfolgte Maßnahme muss objektiv erforderlich<br />
se<strong>in</strong>. 25 Das betreffende Vorhaben muss – <strong>in</strong> den Worten des<br />
Bundesverwaltungsgerichts – „vernünftigerweise geboten“<br />
ersche<strong>in</strong>en. 26 Obwohl es dabei lediglich um e<strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong><br />
gehaltenes Plausibilitätsurteil geht, 27 hat die Rechtsprechung<br />
immerh<strong>in</strong> formuliert, e<strong>in</strong>e Planrechtfertigung fehle, „wenn die<br />
Verwirklichung des Vorhabens bereits im Zeitpunkt des Planfeststellungsbeschlusses<br />
ausgeschlossen werden könnte, weil<br />
sie nicht beabsichtigt oder objektiv ausgeschlossen wäre“. 28<br />
Die weiteren rechtlichen E<strong>in</strong>zelheiten dieser Voraussetzungen<br />
spielen für die hier betrachtete Frage ke<strong>in</strong>e Rolle, aber wichtig<br />
ist im vorliegenden Zusammenhang, dass die Rechtfertigung<br />
sich nicht automatisch auf den Transport jedweden Mediums<br />
durch e<strong>in</strong>e Rohr(fern)leitungsanlage bezieht. Wird der Transport<br />
des ursprünglichen Mediums aufgegeben, so kann je<br />
nach E<strong>in</strong>zelfall die Planrechtfertigung für das ursprüngliche<br />
Vorhaben entfallen, weil der Medienwechsel anzeigt, dass<br />
der Betrieb e<strong>in</strong>er Rohr(fern)leitungsanlage zum Transport eben<br />
dieses Mediums zukünftig nicht mehr „vernünftigerweise<br />
geboten“ ist.<br />
Zweitens s<strong>in</strong>d neben den genehmigungsrechtlichen Zulassungsfragen<br />
der Umnutzung e<strong>in</strong>er Rohr(fern)leitungsanlage<br />
ggf. auch eigentumsrechtliche Fragen zu bedenken. Wenn<br />
die ursprüngliche Anlage fremde, also nicht im Eigentum des<br />
Betreibers stehende, Grundstücke nutzt, ist dafür entweder<br />
e<strong>in</strong>e zivilrechtliche E<strong>in</strong>igung des Anlagenbetreibers mit<br />
dem Grundstückseigentümer oder e<strong>in</strong>e enteignungsrechtliche<br />
Grundlage für die Inanspruchnahme erforderlich. Ob die<br />
gegebenenfalls vorhandenen grundbuchlichen Sicherungen<br />
auch die <strong>in</strong>s Auge gefasste neue Nutzung der vorhandenen<br />
Rohr(fern)leitungsanlage abdecken, muss im E<strong>in</strong>zelfall geprüft<br />
werden. Dies gilt erst recht, wenn solche zivilrechtlichen Nutzungsrechte<br />
nicht auf e<strong>in</strong>er vertraglichen E<strong>in</strong>igung beruhen,<br />
sondern auf Enteignungen, denn diese s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> aller Regel an<br />
e<strong>in</strong>en eng umgrenzten Zweck gebunden. Ist dieser Zweck<br />
beispielsweise <strong>in</strong> der Enteignungsentscheidung (oder <strong>in</strong> dieser<br />
zugrundeliegenden anderen rechtlichen Verfügungen wie<br />
z. B. Planfeststellungsbeschlüssen mit enteignungsrechtlicher<br />
Vorwirkung) unter Bezugnahme auf das beförderte Medium<br />
beschrieben worden, so kann unter Umständen für den<br />
Transport e<strong>in</strong>es anderen Stoffes von dieser Enteignung nicht<br />
Kredit genommen werden. Dann wäre gegebenenfalls e<strong>in</strong><br />
neues Enteignungsverfahren notwendig.<br />
In diesem Zusammenhang kann e<strong>in</strong> erhebliches rechtliches<br />
Risiko auch für den Bestand der „alten“ Enteignungen entstehen:<br />
Durch die E<strong>in</strong>leitung e<strong>in</strong>es Verfahrens mit dem Ziel<br />
neuer Enteignungen für e<strong>in</strong>e geänderte Nutzung e<strong>in</strong>er Rohrleitungsanlage<br />
schafft deren Betreiber zum<strong>in</strong>dest theoretisch<br />
Raum für das Argument, für die bisherige Nutzung bestehe<br />
offensichtlich ke<strong>in</strong> Bedarf mehr. Von diesem Punkt ausgehend<br />
lässt sich weiter argumentieren, damit müssten auch „alte“<br />
Enteignungen aufgehoben werden, denn die Erforderlichkeit<br />
der Grundstücksnutzung für den Transport des bisherigen<br />
Fördermediums fehle nunmehr. Im Ergebnis wäre also die<br />
E<strong>in</strong>leitung neuer Enteignungsverfahren mit e<strong>in</strong>em erheblichen<br />
Risiko für den Bestand der Rohrleitungsanlage im Fall e<strong>in</strong>er<br />
24 Sowohl der Fall von VG Schleswig, Urteil vom 20.01.2011, 12 A 193/09,<br />
BeckRS 2011, 46714 (aus dem veröffentlichen Urteil nicht vollständig<br />
ersichtlich).<br />
25 Siehe etwa BVerwGE 48, 56 (60).<br />
26 BVerwGE 56, 110 (119).<br />
27 Wolff/Bachof/Stober/Kluth, Verwaltungsrecht I, 12. Auflage 2007, § 62<br />
Rn. 140 f. mit weiteren Nachweisen.<br />
28 BVerwG, NVwZ 2010, 1486 (1487).<br />
11-12 | 2013 43
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
Jetzt bestellen!<br />
Sichere und effiziente<br />
Rohrleitungssysteme<br />
Nutzen Sie das Know-how der führenden Fachzeitschrift<br />
für die Entwicklung, den E<strong>in</strong>satz und Betrieb von Rohrleitungen,<br />
Komponenten und Verfahren im Bereich der<br />
Gas- und Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung,<br />
der Nah- und Fernwärmeversorgung, des Anlagenbaus<br />
und der Pipel<strong>in</strong>etechnik.<br />
Wählen Sie e<strong>in</strong>fach das Bezugsangebot, das Ihnen zusagt:<br />
als Heft, ePaper oder Heft + ePaper!<br />
späteren Aufgabe des Konversionsprojektes belastet, weil<br />
der Wunsch nach e<strong>in</strong>er Umnutzung zugleich den Wegfall des<br />
ursprünglichen Nutzungsbedürfnisses dokumentierte.<br />
E<strong>in</strong>e zusätzliche spezielle Konstellation kann sich ergeben,<br />
wenn für die angestrebte neue Nutzung aufgrund auf dieser<br />
anzuwendenden Rechtsgrundlagen erstmals e<strong>in</strong>e so genannte<br />
enteignungsrechtliche Vorwirkung besteht (was <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfällen<br />
zutreffen kann, meist im Zusammenhang mit projektbezogenen<br />
Gesetzen). Diese Vorwirkung bedeutet, dass durch die<br />
Zulassungsentscheidung zugleich die Notwendigkeit festgestellt<br />
wird, zugunsten des Vorhabens nötigenfalls Grundstücke<br />
im Wege der Enteignung zu beschaffen. Daraus wiederum<br />
ergibt sich die Notwendigkeit, bereits im Rahmen der<br />
Zulassungsentscheidung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e umfassende Abwägung des<br />
Vorhabens e<strong>in</strong>zutreten – was wiederum für e<strong>in</strong> umfassendes<br />
Zulassungsverfahren spricht. Infolgedessen kann e<strong>in</strong>e im E<strong>in</strong>zelfall<br />
für e<strong>in</strong>e neue Nutzung gesetzlich angeordnete enteignungsrechtliche<br />
Vorwirkung der Zulassungsentscheidung also<br />
auch dagegen sprechen, von e<strong>in</strong>er bloßen Anlagenänderung<br />
auszugehen.<br />
ZUSAMMENFASSUNG<br />
Konversionen von Rohr(fern)leitungsanlagen können rechtlich<br />
sowohl als Änderung der ursprünglichen E<strong>in</strong>richtung<br />
als auch als vollständig neues Vorhaben e<strong>in</strong>zuordnen se<strong>in</strong>.<br />
Je nachdem ist entweder e<strong>in</strong> Änderungsverfahren oder e<strong>in</strong><br />
Verfahren zur grundsätzlich neuen Zulassung erforderlich.<br />
Rechtlich zeichnen sich vollständig neue Vorhaben dadurch<br />
aus, dass sie die Identität der ursprünglichen Anlage verlassen<br />
und etwas gegenüber dem Vorherigen ganz anderes zu existieren<br />
beg<strong>in</strong>nt. Dafür gibt es ke<strong>in</strong>e starre Grenze, sondern es<br />
kommt auf das konkrete Zusammenspiel mehrerer Aspekte<br />
an. Dabei spielt bei Rohr(fern)leitungsanlagen vor allem e<strong>in</strong>e<br />
Rolle, ob die gewünschte neue Nutzung <strong>in</strong>nerhalb des gleichen<br />
genehmigungsrechtlichen Rahmens zugelassen werden kann<br />
wie die ursprüngliche.<br />
<strong>3R</strong> ersche<strong>in</strong>t <strong>in</strong> der Vulkan-Verlag GmbH, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen<br />
AUTOREN<br />
Dr. BETTINA KEIENBURG<br />
Kümmerle<strong>in</strong> Rechtsanwälte & Notare, Essen<br />
Tel. +49 201 1756-624<br />
E-Mail: bett<strong>in</strong>a.keienburg@kuemmerle<strong>in</strong>.de<br />
Dr. MICHAEL NEUPERT<br />
Kümmerle<strong>in</strong> Rechtsanwälte & Notare, Essen<br />
Tel. +49 201 1756-624<br />
E-Mail: michael.neupert@kuemmerle<strong>in</strong>.de<br />
44 11-12 | 2013
RECHT & REGELWERK DWA/DVGW<br />
Regelwerk<br />
Entwurf Merkblatt M 217 „Explosionsschutz für abwassertechnische Anlagen“<br />
AUFRUF ZUR<br />
STELLUNGNAHME<br />
Geraten Bio- oder Faulgas <strong>in</strong> die Luft oder brennbare Flüssigkeiten<br />
<strong>in</strong> die Kanalisation, kann dies <strong>in</strong> Abwasseranlagen<br />
zu Explosionen führen, die immense Schäden verursachen.<br />
Um Anlagenbetreibern bei der Sicherstellung e<strong>in</strong>es angemessenen<br />
Schutzes vor Explosionen zu unterstützen, hat die<br />
Deutsche Vere<strong>in</strong>igung für Wasserwirtschaft, Abwasser und<br />
Abfall e. V. (DWA) e<strong>in</strong> Merkblatt erarbeitet, das Grundsätze<br />
und Lösungen für den Explosionsschutz abwassertechnischer<br />
Anlagen vorstellt.<br />
DWA-M 217 stellt die Rechtsgrundlagen sowie H<strong>in</strong>weise für<br />
e<strong>in</strong>e rechtssichere und fachlich angemessene Umsetzung<br />
der gesetzlichen Vorgaben dar und gibt e<strong>in</strong>en Überblick<br />
über die fachlich relevanten Aspekte beim Explosionsschutz.<br />
Das Merkblatt enthält außerdem H<strong>in</strong>weise zu technischen<br />
und organisatorischen Schutzmaßnahmen. Auf das Explosionsschutzdokument,<br />
das laut Betriebssicherheitsverordnung<br />
für Anlagen vorgeschrieben ist, <strong>in</strong> denen e<strong>in</strong>e gefährliche<br />
explosionsfähige Atmosphäre auftreten kann, wird<br />
ebenfalls e<strong>in</strong>gegangen. Hier müssen die Beurteilung des<br />
Gefährdungspotentials und Schutzkonzepte dokumentiert<br />
werden. Unterschiede zwischen dem Betrieb von Entwässerungssystemen<br />
und Kläranlagen werden <strong>in</strong> den e<strong>in</strong>zelnen<br />
Kapiteln beschrieben. Das Merkblatt richtet sich an Betreiber<br />
abwassertechnischer Anlagen.<br />
Frist zur Stellungnahme: Das Merkblatt DWA-M 217 wird<br />
bis zum 31. Januar 2014 öffentlich zur Diskussion gestellt.<br />
H<strong>in</strong>weise und Anregungen zu dieser Thematik nimmt die<br />
DWA-Bundesgeschäftsstelle schriftlich, möglichst <strong>in</strong> digitaler<br />
Form entgegen: DWA-Bundesgeschäftsstelle, Dr. Stefanie<br />
Budewig, E-Mail: budewig@dwa.de<br />
G 498 „Druckbehälter <strong>in</strong> Rohrleitungen und Anlagen zur leitungsgebundenen<br />
Versorgung der Allgeme<strong>in</strong>heit mit Gas“<br />
NEUERSCHEINUNG<br />
Das vom Technischen Komitee „Anlagentechnik“ überarbeitete<br />
Arbeitsblatt G 498 ist im Oktober 2013 als neue<br />
Ausgabe erschienen. Es dient als Grundlage für den Betrieb<br />
von Druckbehältern <strong>in</strong> Anlagen zur leitungsgebundenen<br />
Versorgung der Allgeme<strong>in</strong>heit mit Gas. Die Überarbeitung<br />
erfolgte zur Klarstellung praktischer Fragestellungen bei der<br />
Zuordnung von Druckbehältern im funktionalen Zusammenhang<br />
mit Energieanlagen der Gasversorgung. Dabei<br />
waren folgende Punkte von besonderer Bedeutung: Auch<br />
Druckbehälter <strong>in</strong> Anlagen zur Erzeugung, Speicherung,<br />
Fortleitung und Abgabe von Energie <strong>in</strong> der Gasversorgung<br />
gehören zu den Energieanlagen im S<strong>in</strong>ne von § 3 Nr. 15<br />
EnWG. Energieanlagen zählen nach § 2 Nr. 30 Satz 3 des<br />
Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) nicht zu den überwachungsbedürftigen<br />
Anlagen.<br />
Aufgrund dieser rechtlichen Festlegung wurde der Anwendungsbereich<br />
des DVGW-Arbeitsblattes G 498 um die<br />
Druckbehälter <strong>in</strong> der Gaserzeugung, wie z. B. <strong>in</strong> der Biogas-<br />
Aufbereitung, und <strong>in</strong> der E<strong>in</strong>- und Ausspeicherung von<br />
Untergrundspeicheranlagen erweitert. Diese Behälter werden<br />
zum Teil mit Gasen beaufschlagt, die nicht den Anforderungen<br />
des DVGW-Arbeitsblattes G 260 entsprechen. Zu<br />
den Energieanlagen gehören nach § 2 Nr. 30 Satz 2 ProdSG<br />
u. a. „auch Mess-, Steuer- und Regele<strong>in</strong>richtungen, die dem<br />
sicheren Betrieb der Anlage dienen“. Somit s<strong>in</strong>d die mit<br />
den Energieanlagen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em funktionalen und sicherheitstechnischen<br />
Zusammenhang stehenden E<strong>in</strong>richtungen und<br />
Anlagekomponenten <strong>in</strong>tegrale Bestandteile der Energieanlage.<br />
Zu diesen Anlagenkomponenten gehören auch nicht<br />
gasdurchströmte Druckbehälter, wie z. B. Druckluftbehälter<br />
<strong>in</strong> pneumatischen Steuerungen, Sperrölbehälter auf Verdichteranlagen<br />
usw. Diese Behälter werden <strong>in</strong> den Anwendungsbereich<br />
des DVGW-Arbeitsblattes aufgenommen.<br />
Das Arbeitsblatt G 498 ist auch für Druckbehälter <strong>in</strong> Erdgastankstellen<br />
nach DVGW-Arbeitsblatt G 651 anzuwenden.<br />
Vom Anwendungsbereich ausgeschlossen werden Druckbehälter,<br />
für die e<strong>in</strong> eigenes, spezifisches Regelwerksdokument<br />
existiert. Alle zuvor beschriebenen Druckbehälter<br />
fallen <strong>in</strong> den Geltungsbereich der Druckgeräteverordnung<br />
(14. ProdSV), die die europäische Druckgeräterichtl<strong>in</strong>ie RL<br />
97/23/EG <strong>in</strong> nationales Recht umsetzt. Sie s<strong>in</strong>d gemäß Artikel<br />
1, Absatz 3.1 der Druckgeräterichtl<strong>in</strong>ie als sogenannte<br />
Standard-Druckgeräte zu betrachten und müssen daher alle<br />
relevanten, grundlegenden Anforderungen nach Anhang I<br />
der Druckgeräterichtl<strong>in</strong>ie erfüllen.<br />
Im DVGW-Arbeitsblatt G 491 s<strong>in</strong>d bis zu e<strong>in</strong>em maximalen<br />
Betriebsdruck von 16 bar die erweiterten Spielräume für<br />
die Drucke<strong>in</strong>stellung der Sicherheitse<strong>in</strong>richtungen gemäß<br />
DIN EN 12186 dargestellt. Wenn diese Spielräume genutzt<br />
werden, müssen auch die nachgeschalteten Durchleitungsdruckbehälter<br />
für die <strong>in</strong> G 491 genannten höheren Druckwerte<br />
ausgelegt werden.<br />
Neben der Erweiterung des Anwendungsbereichs und der<br />
entsprechenden Anpassung des Titels des Arbeitsblattes<br />
wurden im Zuge der Überarbeitung folgende <strong>in</strong>haltliche<br />
Änderungen vorgenommen:<br />
Mit der Erweiterung des Anwendungsbereiches des Arbeitsblattes<br />
werden auch die Prüfzuständigkeiten der <strong>in</strong> diesem<br />
11-12 | 2013 45
RECHT & REGELWERK DVGW<br />
Arbeitsblatt genannten Prüfer Sachverständige und Sachkundige<br />
erweitert. Dadurch ergeben sich unter Umständen<br />
erweiterte Qualifikationsanforderungen an die Prüfer.<br />
Im Abschnitt „Zuständigkeiten“ für die Prüfungen vor der<br />
Inbetriebnahme wurden die Sachverständigen nach DVGW-<br />
Prüfgrundlage VP 265-1 für die Prüfung von Durchleitungsdruckbehältern<br />
<strong>in</strong> Biogas-Aufbereitungs- und -E<strong>in</strong>speiseanlagen<br />
am Aufstellungsort aufgenommen.<br />
Die Zuständigkeit von Sachkundigen nach den DVGW-<br />
Arbeitsblättern G 491, G 495 und G 497 und von Sachverständigen<br />
nach den DVGW-Arbeitsblättern G 491 und<br />
G 497 für Prüfungen im Rahmen der Instandhaltung wurde<br />
auf die Prüfung von Filtern, Kondensatabscheidern und<br />
Vorwärmern beschränkt. Die Sachkundigen nach DVGW-<br />
Prüfgrundlage VP 265-1 und DVGW-Merkblatt G 265-2 und<br />
die Sachverständigen nach DVGW-Prüfgrundlage VP 265-1<br />
wurden neu aufgenommen.<br />
Die Voraussetzungen, unter denen e<strong>in</strong>e Dichtheitsprüfung<br />
beim Hersteller möglicherweise nicht durchgeführt wird, wurden<br />
präziser gefasst. Die Möglichkeit des E<strong>in</strong>satzes alternativer<br />
Verfahren für die Dichtheitsprüfung wurde aufgenommen.<br />
Im Abschnitt „Innere Prüfungen“ wurde die Historie der<br />
Wasserzusammensetzung als Kriterium für die Festlegung<br />
des Prüfumfangs und der Prüffristen der <strong>in</strong>neren Prüfung<br />
neu aufgenommen.<br />
Als Ersatz für die <strong>in</strong>nere Prüfung wurden neben der Festigkeitsprüfung<br />
auch andere zerstörungsfreie Ersatzprüfverfahren<br />
aufgenommen.<br />
Im Abschnitt „Festigkeitsprüfung im Rahmen der Instandhaltung“<br />
wurden im Zusammenhang mit den alternativen<br />
zerstörungsfreien Prüfverfahren die Anforderungen an die<br />
erforderliche Dichtheitsprüfung nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
G 469 genauer spezifiziert.<br />
Durchleitungsdruckbehälter, die vor dem Inkrafttreten der<br />
Ausgabe März 2007 des G 498 <strong>in</strong> Betrieb genommen wurden,<br />
können weiterh<strong>in</strong> nach den Vorgaben des G 498, Ausgabe<br />
August 1994, geprüft und <strong>in</strong>stand gehalten werden.<br />
Im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>heitlichen Vorgehensweise ist es allerd<strong>in</strong>gs<br />
empfehlenswert, Durchleitungsdruckbehälter, die noch nicht<br />
nach den Vorgaben der Ausgaben des G 498 ab März<br />
2007 gefertigt wurden, den jetzt geltenden Prüfkategorien<br />
zuzuordnen und bei der Instandhaltung und Prüfung die<br />
aktuelle Ausgabe anzuwenden.<br />
Das DVGW-Arbeitsblatt G 498 ist das fachspezifische Regelwerk<br />
für die Druckbehälter. Daher kommen bei der äußeren<br />
Prüfung von Durchleitungsdruckbehältern abweichend<br />
vom DVGW-Arbeitsblatt G 495 die im DVGW-Arbeitsblatt<br />
G 498 festgelegten Prüffristen bzw. Verweisungen<br />
zur Anwendung.<br />
Dieses Arbeitsblatt ersetzt das DVGW-Arbeitsblatt G 498,<br />
Ausgabe März 2007.<br />
Ausgabe 10/2013, EUR 29,87 für DVGW-Mitglieder, EUR 39,82<br />
für Nicht-Mitglieder<br />
G 5305-2 „Gasströmungswächter für Hausanschlussleitungen“<br />
NEUERSCHEINUNG<br />
Das Technische Komitee „Bauteile und Hilfsstoffe - Gas“ hatte<br />
beschlossen, die VP 305-2 gemäß der Geschäftsordnung<br />
GW 100 <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Technische Prüfgrundlage G 5305-2 zu überführen.<br />
Im Rahmen der Überführung wurde e<strong>in</strong>e Anpassung<br />
an die aktuelle Regelwerksstruktur und e<strong>in</strong>e redaktionelle<br />
Anpassung der zertifizierungsrelevanten Textpassagen vorgenommen.<br />
Zusätzlich wurden die Regelwerksbezüge aktualisiert.<br />
Die Gasströmungswächter nach G 5305-2 sperren die Gaszufuhr<br />
für das nachgeschaltete Leitungssystem ab, wenn<br />
der vorgegebene Schließdurchfluss überschritten wird, z. B.<br />
durch e<strong>in</strong>e mechanisch bed<strong>in</strong>gte Leckage (Baggerangriff)<br />
mit ausreichend hohem Öffnungsquerschnitt.<br />
Diese Technische Prüfgrundlage gilt für Anforderungen<br />
und Prüfungen von Gasströmungswächtern bis zu e<strong>in</strong>er<br />
Nennweite von DN 50 mit def<strong>in</strong>ierter Durchflussrichtung.<br />
Sie werden mit Gasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260<br />
(jedoch nicht für Flüssiggas <strong>in</strong> der Flüssigphase) betrieben.<br />
Sie werden entsprechend dem Betriebsdruckbereich unterteilt<br />
<strong>in</strong> die Typen A (15 mbar bis 100 mbar), B (0,1 bar bis<br />
5 bar), C (25 mbar bis 5 bar) und D (25 mbar bis 1 bar).<br />
Ausgabe 10/2013, EUR 34,29 für DVGW-Mitglieder, EUR 45,72<br />
für Nicht-Mitglieder<br />
INFO<br />
Der neue Newsletter –<br />
immer aktuell, immer gut <strong>in</strong>formiert<br />
46 GAS | WASSER | ABWASSER | PIPELINEBAU | SANIERUNG | KORROSIONSSCHUTZ | FERNWÄRME | ANLAGENBAU<br />
11-12 | 2013
DVGW | DIN RECHT & REGELWERK<br />
G 5600-1 „Werkstoffübergangsverb<strong>in</strong>der aus Metall für Gasrohrleitungen<br />
aus Polyethylen“<br />
NEUERSCHEINUNG<br />
Die DVGW-VP 600 wurde vom Technischen Komitee „Gasarmaturen“<br />
grundlegend überarbeitet, e<strong>in</strong>er Aktualisierung,<br />
im H<strong>in</strong>blick auf den nationalen und europäischen technischen<br />
Standard, unterzogen und <strong>in</strong> die Prüfgrundlage<br />
G 5600-1 überführt. Da für Wasser e<strong>in</strong> eigenständiges<br />
Regelwerk erarbeitet worden ist, ist die Prüfgrundlage nun<br />
nur für den Bereich Gas zuständig.<br />
Maßgebliche Änderungen, die vorgenommen wurden,<br />
s<strong>in</strong>d z. B:<br />
»»<br />
Anpassung der maximal zulässigen Betriebsdrücke bei<br />
den unterschiedlichen Polyethylen-Rohrwerkstoffen<br />
»»<br />
Öffnung des Anwendungsbereiches für den maximalen<br />
Rohraußendurchmesser<br />
»»<br />
Möglichkeit der Anwendung bei weiteren<br />
PE-X-Rohrwerkstoffen<br />
»»<br />
Überarbeitung der Darstellungen<br />
»»<br />
Aufnahme der Tabelle mit der Zuordnung der Prüfl<strong>in</strong>ge<br />
zu den Prüfungen<br />
»»<br />
E<strong>in</strong>schränkung bei der Prüfung der Ausreißsicherheit<br />
auf Werkstoffübergangsverb<strong>in</strong>der mit Polyethylen-<br />
Rohraußendurchmesser d ≤ 63 mm<br />
Ausgabe 10/2013, EUR 22,27 für DVGW-Mitglieder, EUR 29,69<br />
für Nicht-Mitglieder<br />
W 336 „Wasseranbohrarmaturen; Anforderungen und Prüfungen“<br />
NEUERSCHEINUNG<br />
Die Prüfgrundlage W 336 gilt für erde<strong>in</strong>gebaute Anbohrarmaturen<br />
<strong>in</strong> der Tr<strong>in</strong>kwasserverteilung mit Betriebsabsperrung,<br />
Hilfsabsperrung oder <strong>in</strong>tegriertem Anbohrwerkzeug<br />
für PFA 10 bar und PFA 16 bar. Dabei be<strong>in</strong>haltet die Prüfgrundlage<br />
die Rohr- und Armaturenkomb<strong>in</strong>ationen gemäß<br />
Tabelle 1.<br />
Die neue Prüfgrundlage stellt e<strong>in</strong>e Überarbeitung des gleichnamigen<br />
Arbeitsblattes vom Juni 2004 dar. Sie wurde vom<br />
DVGW-Projektkreis „Armaturen <strong>in</strong> Wasserversorgungssystemen“<br />
im DVGW-Technischen Komitee „Bauteile Wasserversorgungssysteme“<br />
erarbeitet und kann als Grundlage<br />
für die DVGW-Zertifizierung von Wasseranbohrarmaturen<br />
herangezogen werden. W 336 def<strong>in</strong>iert die entsprechenden<br />
Anforderungen und Prüfungen zur Durchführung der<br />
Baumusterprüfung, ebenso s<strong>in</strong>d Angaben h<strong>in</strong>sichtlich der<br />
Eigen- und Fremdüberwachung zur Sicherung e<strong>in</strong>er gleichbleibenden<br />
Produktqualität enthalten.<br />
Ausgabe 10/2013, EUR 29,87 für DVGW-Mitglieder, EUR 39,82<br />
für Nicht-Mitglieder<br />
DIN 30678 „Polypropylen-Umhüllungen von Rohren und Formstücken aus<br />
Stahl - Anforderungen und Prüfungen“<br />
NEUERSCHEINUNG<br />
Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 032-02-09<br />
AA „Außenkorrosion“ im Normenausschuss Gastechnik<br />
(NAGas) überarbeitet. Die letzte Fassung der DIN 30678<br />
wurde 1992 veröffentlicht und durfte aufgrund des Normungsprojekts<br />
EN 10286 auf europäischer Ebene lange<br />
Zeit nicht überarbeitet werden. Die vorliegende Fassung der<br />
DIN 30678 deckt nunmehr nicht nur die Anwendungsbereiche<br />
ab, die von DIN EN ISO 21809-1 nicht erfasst s<strong>in</strong>d,<br />
sondern berücksichtigt darüber h<strong>in</strong>aus den aktuellen Stand<br />
der Technik. Dies betrifft nicht nur die neu aufgenommenen<br />
Prüfungen und Prüfhäufigkeiten, sondern auch verschiedene<br />
Produktanforderungen.<br />
Gegenüber DIN 30678:1992-10 wurden folgende Änderungen<br />
und Ergänzungen vorgenommen: a) E<strong>in</strong>schränkung<br />
des Anwendungsbereiches; b) Anforderungen an<br />
und Prüfungen für den Epoxidharzprimer der Dreischicht-<br />
Polypropylenumhüllung; c) Angaben zur Prüfhäufigkeit;<br />
d) Berücksichtigung aktueller Normen; e) Anforderungen<br />
an die Dokumentation; f) Getrennte Anforderungen an<br />
die verschiedenen Umhüllungsverfahren (S<strong>in</strong>tern oder extrudierte<br />
Verfahren); g) Änderung des Temperaturbereiches;<br />
h) Prüfung der kathodischen Unterwanderung; i) Anpassung<br />
der Schälwiderstände.<br />
Ausgabe 9/2013<br />
11-12 | 2013 47
PRODUKTE & NEUHEITEN<br />
Schnellere Lokalisierung und E<strong>in</strong>schätzung<br />
gefährlicher Leckagen<br />
Die Betreiber von Biogasanlagen unterschätzen häufig die<br />
Kosten, die selbst kle<strong>in</strong>ste Leckagen verursachen. Dabei<br />
führen diese regelmäßig zu fünfstelligen Verlusten – ganz<br />
zu schweigen von der Gefahr für Leib und Leben, die von<br />
dem austretenden hochexplosiven Methan ausgeht, und der<br />
signifikanten Umweltbelastung. Bisher wurden Leckagen<br />
mit herkömmlichen Flammen-Ionisations- oder Halbleiter-<br />
Gasdetektoren aufgespürt, was jedoch sehr aufwändig,<br />
zeit- und kosten<strong>in</strong>tensiv war. Dies gilt auch für die Überprüfung<br />
von Verdichteranlagen, Rohrbrücken und andere<br />
freiliegende Rohrleitungen der Erdgas<strong>in</strong>dustrie.<br />
Deshalb hat die Esders GmbH die GasCam entwickelt, die<br />
jetzt neu aufgelegt wurde. Das nur noch 6 kg schwere<br />
Gerät (Bild 1) detektiert Methan bei der Überprüfung von<br />
Biogasanlagen aus e<strong>in</strong>er Entfernung von bis zu 100 m.<br />
Im Gegensatz zu Kameras von Wettbewerbern, die Gas<br />
maximal als grauen Schleier anzeigen, wodurch Fehl<strong>in</strong>terpretationen<br />
möglich s<strong>in</strong>d, zeigt die GasCam Methanaustritte<br />
<strong>in</strong> Echtzeit als farbige Gaswolke (Bild 2) an, deren Abstufung<br />
auch über die jeweilige<br />
Konzentration Auskunft gibt.<br />
„Da Erdgas e<strong>in</strong> brennbares<br />
Gas ist, besteht grundsätzlich<br />
die Gefahr e<strong>in</strong>er Entzündung<br />
oder Explosion“, erklärt Bernd<br />
Esders, Geschäftsführer der<br />
Esders GmbH. „Die turnusmäßige<br />
Dichtheitsprüfung von<br />
Anlagen dient somit dem frühzeitigen<br />
Erkennen von Leckagen<br />
sowie der Vermeidung von<br />
Schäden.“<br />
Das austretende Methan ist<br />
zudem e<strong>in</strong> um den Faktor 25<br />
stärkeres Klimagas als CO 2<br />
,<br />
weshalb es e<strong>in</strong>e signifikante<br />
Belastung für die Umwelt darstellt.<br />
Doch auch für die Rentabilität<br />
der jeweiligen Biogasanlage<br />
s<strong>in</strong>d Leckagen fatal. „In<br />
e<strong>in</strong>em Fall trat Gas aus e<strong>in</strong>em<br />
Riss <strong>in</strong> der Folienabdeckung<br />
aus, was e<strong>in</strong>en erhöhten Substrate<strong>in</strong>satz<br />
von drei Tonnen<br />
pro Tag erforderlich machte,<br />
Bild 1: Die 6 kg schwere GasCam SG<br />
verfügt über e<strong>in</strong>en abnehmbaren Akku<br />
wobei der Preis für e<strong>in</strong>e Tonne<br />
bei 45 Euro liegt. Daraus ergibt<br />
sich e<strong>in</strong> E<strong>in</strong>sparpotential von<br />
135 Euro pro Tag bzw. mehr<br />
als 49.000 Euro im Jahr, wenn<br />
die Leckage gefunden und<br />
geschlossen wird“, so Esders.<br />
Farbige Bilder <strong>in</strong> Echtzeit bei leichtem Handl<strong>in</strong>g<br />
Dennoch wurde bisher meist nur mit herkömmlichen Flammen-Ionisations-<br />
oder Halbleiter-Gasdetektoren versucht,<br />
Leckagen aufzuspüren, was zum e<strong>in</strong>en äußerst aufwändig<br />
war und zum anderen Fehler nicht ausgeschloss, da Gasaustritte<br />
häufig pulsierend <strong>in</strong> Intervallen auftreten, so dass sie<br />
übersehen werden können.<br />
Deshalb werden nun immer häufiger Kameras verwendet,<br />
die austretende Gaswolken aufspüren und auf e<strong>in</strong>em Bildschirm<br />
visualisieren. Diese zeigen das Methan allerd<strong>in</strong>gs nur<br />
<strong>in</strong> Grautönen an, weshalb die Lecks leicht übersehen werden<br />
können. „Die Prüfung e<strong>in</strong>er großen Anlage mit diesen Kameras<br />
nimmt unter Umständen e<strong>in</strong>en ganzen Tag <strong>in</strong> Anspruch.<br />
Bei Grau-<strong>in</strong>-Grau-Anzeigen ist e<strong>in</strong>e erhebliche Konzentration<br />
notwendig, die mit der Zeit auch nachlässt, ebenso ist e<strong>in</strong>e<br />
Abschätzung der Ausbreitung bei monochromen Bildern fast<br />
unmöglich“, so Esders. Deshalb hat se<strong>in</strong> Unternehmen mit<br />
der GasCam e<strong>in</strong>e mobile Infrarot-Messe<strong>in</strong>heit entwickelt,<br />
die <strong>in</strong> Echtzeit Undichtigkeiten <strong>in</strong> gastechnischen Anlagen<br />
erkennt und dem jeweiligen Messtechniker sofort e<strong>in</strong> farbiges<br />
Bild der austretenden Methanwolke zur Verfügung stellt.<br />
Die neu aufgelegte GasCam ® SG ist mit 6 kg nur halb so schwer<br />
wie ihr Vorgängermodell und spürt Gaswolken aus e<strong>in</strong>er sicheren<br />
Entfernung von 100 m auf. Sie produziert e<strong>in</strong> Infrarot-<br />
Videobild mit e<strong>in</strong>er Auflösung von 384 x 288 Pixel, das durch<br />
e<strong>in</strong> Falschfarbenbild von dem ausströmenden Gas überlagert<br />
wird. So lassen sich Leckagen vor jedem H<strong>in</strong>tergrund visualisieren<br />
und kle<strong>in</strong>ste Leckagen an bisher schwer zugänglichen<br />
oder unvermuteten Stellen erkennen. Um die Kamera noch<br />
handlicher zu machen, ist auch das Lithium-Ionen-Akkupack<br />
abnehmbar. Der LWIR-Spektralbereich stellt e<strong>in</strong>e rauschäquivalente<br />
Säulendichte von Methan von bis 50 ppm x m<br />
Bild 2: Die GasCam produziert e<strong>in</strong> Infrarot-Videobild, das durch<br />
e<strong>in</strong> Falschfarbenbild von dem ausströmenden Gas überlagert<br />
wird<br />
Fotos: Esders GmbH<br />
48 11-12 | 2013
PRODUKTE & NEUHEITEN<br />
dar. Die Brennweite beträgt 25 mm bei e<strong>in</strong>em Bildfeld von<br />
360 mrad x 280 mrad und e<strong>in</strong>er motorisierten Fokussierung.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus verfügt die GasCam über e<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>gebauten<br />
GPS-Empfänger für die Dokumentation der Messposition.<br />
Die Überprüfung mit der GasCam lohnt sich für Anlagenbetreiber,<br />
-hersteller oder Behörden besonders bei der Abnahme<br />
e<strong>in</strong>er neuen oder reparierten Anlage, vor Ablauf der<br />
Gewährleistungsfrist, bei Verdacht auf Gasaustritt durch<br />
Geruchsemissionen oder Differenzen zwischen Substrat<strong>in</strong>put<br />
und Gasausbeute. Für die Erdgas<strong>in</strong>dustrie gelten turnusmäßige<br />
Prüfungs<strong>in</strong>tervalle entsprechend dem Regelwerk des<br />
DVGW. Dazu bietet Esders auch e<strong>in</strong>e Dienstleistung an, <strong>in</strong><br />
deren Rahmen die hochspezialisierten Techniker des Unternehmens<br />
die betreffende Anlage professionell überprüfen.<br />
KONTAKT: Esders GmbH, Haselünne, Tel. +49 5961 9565-0,<br />
E-Mail: <strong>in</strong>fo@esders.de, www.esders.de<br />
E<strong>in</strong>e App macht verborgene Infrastruktur sichtbar<br />
E<strong>in</strong> Defekt, wie er gerade im W<strong>in</strong>ter oft vorkommt: E<strong>in</strong><br />
Wasserrohrbruch <strong>in</strong> der Straße wird gemeldet, der Bereitschaftsdienst<br />
der Stadtwerke rückt aus. Am Schadensort<br />
stellt sich den Monteuren erst e<strong>in</strong>mal die Frage, welche<br />
Leitungen und Rohre dort entlanglaufen und beim Ausheben<br />
der Grube beschädigt werden könnten. Also Lagepläne<br />
anfordern und durchforsten. Das könnte bald der Vergangenheit<br />
angehören, denn mit den Mitteln der Augmented<br />
Reality (AR = erweiterte Realität) kann die im Verborgenen<br />
liegende Infrastruktur virtuell auf dem Smartphone oder<br />
Tablet-PC des Mitarbeiters dargestellt werden.<br />
Möglich wird das mit dem Programm Augview des neuseeländischen<br />
Technologieunternehmens Augview Limited.<br />
Bus<strong>in</strong>ess Development Manager<strong>in</strong> Melanie Langlotz stellte die<br />
Applikation zusammen mit ihrem deutschen Vertriebspartner,<br />
Tim Krüger, Geschäftsführer von 8SEAS erstmalig <strong>in</strong><br />
Deutschland vor.<br />
„Das Problem ist überall auf der Welt das gleiche. GIS-Daten<br />
s<strong>in</strong>d zwar oft vorhanden, aber jedes Unternehmen hat se<strong>in</strong><br />
eigenes GIS-System und nirgends s<strong>in</strong>d diese Daten zentral<br />
abrufbar“, erklärt Melanie Langlotz. Das ändert sich jetzt –<br />
zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong> Neuseeland. Hierfür stellen Energieversorger,<br />
KLINGER-Anzeigen_4.Quartal_Layout Telekommunikationsunternehmen, 1 11.09.13 Wasser- 17:27 Seite und 2Abwas-<br />
serbetriebe und andere Infrastrukturträger ihre GIS-Daten<br />
zur Verfügung. Wobei die Unternehmen<br />
bestimmen können, was sichtbar ist – sensible<br />
Daten können zurückgehalten werden.<br />
„Augview führt die verschiedensten<br />
GIS-Systeme zusammen und stellt die Infrastruktur<br />
auf e<strong>in</strong>em Smartphone oder<br />
Tablet-PC entweder als <strong>in</strong>teraktive Karte<br />
<strong>in</strong> 2D oder <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit der Kamera<br />
des Mobilgeräts <strong>in</strong> 3D als virtuelle Ansicht<br />
dar“, so Langlotz. Und das <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung<br />
mit GPS-Koord<strong>in</strong>aten und <strong>in</strong> Echtzeit. Darüber<br />
h<strong>in</strong>aus können die virtuellen Objekte<br />
noch mit weiteren Informationen h<strong>in</strong>terlegt<br />
werden: Welchen Durchmesser hat<br />
das Rohr, wann wurde die Leitung verlegt,<br />
wann der Schacht das letzte Mal gewartet und vieles mehr.<br />
Nachdem das System erfolgreich <strong>in</strong> Hamilton, e<strong>in</strong>er Kle<strong>in</strong>stadt<br />
im Großraum Aukland, e<strong>in</strong>geführt wurde, <strong>in</strong>teressieren<br />
sich jetzt auch etliche Großstädte weltweit dafür.<br />
KONTAKT: 8seas consult<strong>in</strong>g eng<strong>in</strong>eers for water and energy, Nackenheim,<br />
Tel. +49 6135 704738, E-Mail: tim.krueger@8-seas.com<br />
11-12 | 2013 49<br />
KLINGER-Anzeige<br />
<strong>3R</strong>-4 182 x 62 mm
PRODUKTE & NEUHEITEN<br />
Qualitätssicherung beim E<strong>in</strong>bau von Harz8<br />
Es ist eigentlich nicht neu: Die Produktqualität von Kanalsanierungssystemen<br />
hängt entscheidend von der Ausführung<br />
im E<strong>in</strong>zelfall ab. Neu ist h<strong>in</strong>gegen, was man sich bei der<br />
res<strong>in</strong>novation GmbH, Rülzheim, hat e<strong>in</strong>fallen lassen, um<br />
diese E<strong>in</strong>bauqualität für die Schachte<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung von L<strong>in</strong>ern<br />
mit dem dauerelastischen, DIBT-zugelassenen Epoxidharzsystem<br />
Harz8 sicher zu stellen.<br />
Die Schachte<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung von Schlauchl<strong>in</strong>ern mit dem Epoxid-<br />
Spachtelharz Harz8 erfreut sich auf dem Markt wachsender<br />
Popularität. Schnell und e<strong>in</strong>fach zu applizieren, bietet Harz8<br />
e<strong>in</strong>e dauerhaft dichte Lösung, mit der L<strong>in</strong>er nicht nur ans<br />
Altrohr, sondern s<strong>in</strong>nvoller Weise an das Schachtbauwerk<br />
angebunden werden. Was Harz8 gegenüber den üblichen<br />
m<strong>in</strong>eralischen Werkstoffen wesentlich auszeichnet, ist die<br />
dauerhafte Elastizität des ausgehärteten Systems. Egal, ob<br />
der L<strong>in</strong>er sich bewegt oder ob der Schacht Erschütterungen<br />
durch Verkehrslasten ausgesetzt ist - das markant rote Harz<br />
hält immer dicht. Voraussetzung ist aber auch hier e<strong>in</strong> vorschriftsgemäßer<br />
Umgang mit dem Material beim E<strong>in</strong>bau.<br />
Die DIBT-Zulassung Z. 42.3-492 für Harz8 regelt <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung<br />
mit dem Anwenderhandbuch exakt das Procedere,<br />
nach dem Harz8 ordnungsgemäß zur L<strong>in</strong>er-Schachtanb<strong>in</strong>dung<br />
e<strong>in</strong>gebaut wird und ist damit das Fundament der<br />
Qualitätssicherung. E<strong>in</strong> zweites Qualitäts-Essential für die<br />
Harz8-Awendung ist die strikte Beschränkung des E<strong>in</strong>baus<br />
auf qualifizierte Anwender, die bei res<strong>in</strong>novation geschult<br />
wurden. Damit nur diese <strong>in</strong> der Praxis Harz8 zur L<strong>in</strong>er-<br />
E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung verwenden, hat man sich bei res<strong>in</strong>novation<br />
etwas e<strong>in</strong>fallen lassen: Jede e<strong>in</strong>zelne Schachte<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung mit<br />
Harz8 wird durch e<strong>in</strong>e dauerbeständige Kunststoffplakette<br />
markiert, auf der der technische „Steckbrief“ der jeweiligen<br />
Schachte<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung vom Anwender e<strong>in</strong>getragen wird – vor<br />
allem aber der Anwender selbst und se<strong>in</strong> verantwortlicher<br />
Mitarbeiter. Die ausgefüllte (und persönlich unterschriebene!)<br />
Plakette wird oberhalb des jeweiligen Gewerks an die<br />
Schachtwand gedübelt bzw. geklebt und dokumentiert<br />
noch Jahrzehnte später, was hier von wem e<strong>in</strong>gebaut wurde.<br />
Dies soll nicht nur <strong>in</strong> ferner Zukunft zur Orientierung beitragen,<br />
sondern schon heute zur Selbstdiszipl<strong>in</strong> zum Nutzen<br />
des Netzbetreibers.<br />
Wichtig ist, dass<br />
der Auftraggeber<br />
<strong>in</strong> dem S<strong>in</strong>ne aktiv<br />
mitwirkt, dass er im<br />
Leistungsverzeichnis<br />
die Plakettierung<br />
Letzter Handgriff jeder Schlauchl<strong>in</strong>er-Anb<strong>in</strong>dung:<br />
Die QS-Plakette wird an der Schachtwand befestigt<br />
der L<strong>in</strong>er-E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung<br />
ausdrücklich fordert.<br />
E<strong>in</strong> entsprechend<br />
ausformuliertes<br />
Leistungsverzeichnis<br />
kann auf der<br />
res<strong>in</strong>novation-Website<br />
heruntergeladen<br />
werden (http://www.res<strong>in</strong>novation.de/Downloads), und<br />
er ist gut beraten, dies zu tun. Die Vergabe der Plaketten<br />
ist nämlich an die erfolgreiche Schulung bei res<strong>in</strong>novation<br />
gebunden. Erst nach dieser wird e<strong>in</strong> gewisses Quantum<br />
Plaketten an den Sanierer ausgehändigt, die er dann beim<br />
E<strong>in</strong>bau von Harz8 nach und nach verbraucht. Der Plaketten-<br />
Vorrat ist jedoch regenerierbar: Für jedes aussagekräftige,<br />
per Mail e<strong>in</strong>gesandte Foto e<strong>in</strong>er ordnungsgemäßen Harz8-<br />
L<strong>in</strong>ere<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung bekommt der Anwender von res<strong>in</strong>novation<br />
e<strong>in</strong>e neue Plakette. Außerdem wird das Foto mit Angabe<br />
des Anwenders auf der res<strong>in</strong>novation-Website öffentlich<br />
präsentiert und der Anwender als „qualifizierter Harz8-<br />
Partner“ präsentiert. Zugleich wirkt res<strong>in</strong>novation <strong>in</strong>tensiv<br />
darauf h<strong>in</strong>, dass Netzbetreiber auch nur solche offiziellen<br />
Partner beauftragen.<br />
E<strong>in</strong>en qualifizierten Harz8-Partner erkennt man also daran,<br />
dass er die Plakette e<strong>in</strong>baut, weil er aufgrund se<strong>in</strong>er Schulung<br />
bzw. erfolgreicher Installationen über Plaketten verfügt.<br />
Gehen e<strong>in</strong>em Anwender wegen unzureichender<br />
Qualität oder versäumter Rückmeldung die Plaketten aus,<br />
muss er e<strong>in</strong>e erneute Schulung absolvieren, um wieder an<br />
Plaketten zu kommen.<br />
Bei res<strong>in</strong>novation behält man durch dieses e<strong>in</strong>fache Modell<br />
die Übersicht darüber, dass das Harz durch qualifizierte<br />
Partner korrekt e<strong>in</strong>gebaut wird und ke<strong>in</strong>e rufschädigenden<br />
Mängel entstehen. Zudem entwickelt sich e<strong>in</strong>e sehr<br />
anschauliche, onl<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>sehbare Referenz-Datenbank.<br />
Erkennbare Anwenderdefizite werden im Rahmen der Neuschulung<br />
postwendend behoben.<br />
Der e<strong>in</strong>zelne Anwender kann durch Empfang neuer Plaketten<br />
weiter mit dem System werben und arbeiten und wird<br />
mit se<strong>in</strong>er guten Leistung zugleich der Fachöffentlichkeit als<br />
qualifizierter Harz8-Partner vorgestellt. Denn natürlich können<br />
auch die Netzbetreiber auf der res<strong>in</strong>novation-Webseite<br />
nach qualifizierten Sanierungspartnern suchen – was für<br />
diese sicher e<strong>in</strong> wichtiger Faktor der Akquise <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em hart<br />
umkämpften Markt ist.<br />
Beim Netzbetreiber schließlich stellt dieses System der automatischen,<br />
am tatsächlich ausgeführten Gewerk ausgerichteten<br />
Kontrolle das Vertrauen <strong>in</strong> die ordnungsgemäße und<br />
Hersteller-konforme Anwendung des Produktes und damit<br />
<strong>in</strong> se<strong>in</strong>e Qualität sicher. Zugleich wird die Suche nach geeigneten<br />
Anwendern vere<strong>in</strong>facht und bei Verwendung des<br />
vorgegebenen LV automatisch ausgeschlossen, dass man<br />
via Niedrigpreis an e<strong>in</strong> unqualifiziertes Unternehmen gerät.<br />
Das Modell der Qualitätssicherung läuft bislang sehr erfolgreich<br />
an, denn es ist nach Ansicht von Unternehmensgründer<br />
und Geschäftsführer Dipl.-Ing. Mirko Heuser „e<strong>in</strong> klassisches<br />
All-W<strong>in</strong>ner-System“. An e<strong>in</strong>e Übernahme auf andere<br />
res<strong>in</strong>novation- Produktbereiche wird bereits nachgedacht.<br />
KONTAKT: res<strong>in</strong>novation GmbH, Rülzheim, Dipl.-Ing. Ulrich W<strong>in</strong>kler,<br />
Tel. +49 7272 702-502, E-Mail: ulrich.w<strong>in</strong>kler@res<strong>in</strong>novation.de<br />
50 11-12 | 2013
PRODUKTE & NEUHEITEN<br />
Plattenschweißmasch<strong>in</strong>en für Stumpfschweißverb<strong>in</strong>dungen<br />
Seit vielen Jahren s<strong>in</strong>d die Plattenschweißmasch<strong>in</strong>en, abgekürzt<br />
PSM, im Produktprogramm von WIDOS. Bei dem Hersteller<br />
für Kunststoffschweißtechnik steht die Langlebigkeit<br />
der Masch<strong>in</strong>en, die hohe Verarbeitungsqualität und der<br />
Service im Vordergrund.<br />
Die Anwendungsfälle für Kunststoffplatten s<strong>in</strong>d vielseitig:<br />
im Behälterbau, aber auch im Rohrleitungsbau bei der Auskleidung<br />
von Betonrohren, Behältern und Becken, oder <strong>in</strong><br />
Lüftungssystemen, und viele mehr.<br />
Die Materialien PE, PP und andere schweißbare Thermoplaste<br />
werden <strong>in</strong> Abhängigkeit von ihren Eigenschaften<br />
und dem Anwendungsfall e<strong>in</strong>gesetzt. In besonderen Fällen<br />
werden Platten mit e<strong>in</strong>em hohen Anteil an Füllstoffen,<br />
wie z. B. Glasfaser, Holzspäne, oder aus geschäumten<br />
Material, verarbeitet. Als Schweißparameter für das Heizelementstumpfschweißen<br />
wird <strong>in</strong> den Standardfällen die<br />
DVS-Richtl<strong>in</strong>ie (2207) herangezogen. Neben Massivplatten<br />
werden immer häufiger Hohlkammerplatten geschweißt.<br />
Der maximale Verarbeitungsbereich der WIDOS PSM<br />
liegt bei 20 mm dicken Massivplatten und 60 mm dicken<br />
Hohlkammerplatten.<br />
Bei PSM 10 und PSM 15 wird die Schweißkraft <strong>in</strong> bewährter<br />
Weise manuell mittels Handrad über Federkraft aufgebracht.<br />
Für größere Schweißkräfte wird die PSM 20 mit e<strong>in</strong>em<br />
Hydrauliksystem betrieben.<br />
Optional für höheren Bedienerkomfort<br />
(mit Fußschalter)<br />
kann e<strong>in</strong>e pneumatische<br />
Spannvorrichtung angebracht<br />
werden. Alle Spannbalken<br />
besitzen e<strong>in</strong>e spezielle<br />
Oberfläche mit „Grip“,<br />
die das Durchrutschen der<br />
Platten unter Schweißdruck<br />
verh<strong>in</strong>dern. Durch e<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>fachen<br />
Verstellmechanismus<br />
ist das stufenlose Schweißen<br />
von W<strong>in</strong>keln möglich. Mit<br />
allen diesen Features ergibt<br />
sich e<strong>in</strong> großer Freiraum für<br />
Schweißkonstruktionen aus<br />
Thermoplast-Platten.<br />
KONTAKT: WIDOS Wilhelm Dommer Soehne GmbH, Heimerd<strong>in</strong>gen,<br />
Bernd Klemm, Tel. +49 171 4234466,<br />
E-Mail: bernd.klemm@widos.de<br />
PSM 10 mit 1 m Arbeitsbreite<br />
Flexibler Anschluss an große Betonrohre<br />
Rohrverb<strong>in</strong>dung leicht gemacht: Der flexible Sattel FA 150-B<br />
von Flexseal schließt Rohre mit Wandstärken bis 150 mm<br />
schnell und unkompliziert an Beton-Hauptleitungen mit großen<br />
Durchmessern an. Das Anschlusselement eignet sich<br />
für den Anschluss von<br />
Ste<strong>in</strong>zeugrohren nach<br />
DIN EN 295, DN 150 und<br />
DN 200, an Betonrohre<br />
nach DIN 4032 ab DN 300<br />
sowie für Stahlbetonrohre<br />
nach DIN 4035 ab<br />
DN 300. Über nur vier verschiedene<br />
Ausgleichsr<strong>in</strong>ge<br />
von Flexseal schließt das<br />
Sattelstück zum Beispiel<br />
SML, GFK oder EuroTop-<br />
Rohre der Nennweite<br />
DN 150 an den Stutzen<br />
FA 150-B an.<br />
Damit produziert Flexseal nach DIN EN 295, Teil 4 für be<strong>in</strong>ahe<br />
jede Rohrkomb<strong>in</strong>ation laterale und vom WRc genehmigte<br />
Verb<strong>in</strong>dungen. Der hochwertige Materialmix – Kompressionsdichtung<br />
und Muffe bestehen aus Ethylen-Propylen-<br />
Dien-Monomer-(EPDM)-Kautschuk, Grundkörper und<br />
Spannhülse aus Acrylnitril-Butadien-Styrol-(ABS)-Kunststoff,<br />
die Muffenhülse aus Polypropylen (PP) – garantiert sichere<br />
und langlebige Übergänge zwischen den Rohrarten. Dabei<br />
nimmt die Muffenhülse Scherlasten von mehr als 4 kN auf,<br />
ohne dass das ihre Funktion bee<strong>in</strong>trächtigt. Das übertrifft<br />
die Anforderungen der Norm (1,5 kN) um e<strong>in</strong> Vielfaches.<br />
Die flexible EPDM-Muffe lässt sich im Rahmen der Norm<br />
abw<strong>in</strong>keln. E<strong>in</strong>e spezielle Kunststoffhülse sichert die Verb<strong>in</strong>dung<br />
gegen Scherlast und Abw<strong>in</strong>klung. Die Kompressionsdichtung<br />
eignet sich optimal für Betonrohre.<br />
KONTAKT: Flexseal GmbH, Eschwege, www.flexseal.de<br />
11-12 | 2013 51
FACHBERICHT PIPELINEBAU<br />
<strong>Rohrleitungssicherung</strong> <strong>in</strong> <strong>Nordwestdeutschland</strong>:<br />
Moor und Sumpf clever<br />
bewältigt<br />
Mit e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>zigartigen Methodik und zum Teil sehr aufwändigen technischen Mitteln konnte e<strong>in</strong>e aufgeschwommene<br />
Gasleitung gesichert und mit ausreichender Überdeckung wieder auf die geforderte Tiefe gebracht werden.<br />
Dabei waren neben der eigentlichen Maßnahme e<strong>in</strong>e ganze Reihe widriger Randbed<strong>in</strong>gungen der Landschaft zu<br />
berücksichtigen und Herausforderungen durch die extrem erschwerte Zuwegung zu bewältigen.<br />
In etwa 2,5 km südwestlich der Ortschaft Groß Midlum<br />
nahe der Stadt Emden bef<strong>in</strong>det sich das zur Leitung 63<br />
gehörende, ca. 180 m lange zu sanierende Teilstück des<br />
Betreibers Open Grid Europe GmbH (OGE). Das Stahlrohr<br />
mit e<strong>in</strong>em Außendurchmesser von 1.016 mm und e<strong>in</strong>er<br />
Wandstärke von 14,1 mm gehört zum Nordsystem. Diese<br />
Pipel<strong>in</strong>e, die Offshore-Leitungen aus der norwegischen<br />
Nordsee mit dem deutschen Leitungsnetz verb<strong>in</strong>det und<br />
zur Verdichterstation Werne führt, durchquert hier das<br />
sogenannte Uhlsmeer. Das s<strong>in</strong>d Ländereien, die zur Verh<strong>in</strong>derung<br />
der flächendeckenden Landvernässung <strong>in</strong> Küstennähe<br />
eigentlich vor langer Zeit trocken gelegt wurden.<br />
Da dieser Landstrich unterhalb des Meeresspiegels liegt<br />
und die Entwässerung <strong>in</strong> die tidedom<strong>in</strong>ierte Unterems<br />
schwierig ist, bildete sich e<strong>in</strong> von Moor und wassergesättigtem<br />
Boden dom<strong>in</strong>iertes Gebiet aus (Bild 1). Der<br />
Grundwasserstand liegt hier jahreszeitlich schwankend<br />
im Bereich der Geländeoberfläche bzw. nur wenige Zentimeter<br />
darunter.<br />
Die Gasleitung, die im Jahre 1975 gebaut wurde, war bereits<br />
damals mit Auftriebssicherungen und Ballastierung versehen<br />
worden. Nur so konnte e<strong>in</strong> Aufschwimmen und damit<br />
Freilegen der Leitung verh<strong>in</strong>dert werden. Während des Baus<br />
war der betroffene Abschnitt landwirtschaftlich genutzt,<br />
so dass auch e<strong>in</strong>e Entwässerung bestand. In den Folgejahren<br />
erfolgte e<strong>in</strong>e Umwidmung der Ländereien, die Flächen<br />
wurden renaturiert und somit auch nicht mehr entwässert<br />
(Bild 2). Die beim Bau <strong>in</strong>stallierte Auftriebssicherung war<br />
dafür aber nicht ausgelegt worden.<br />
Der Boden <strong>in</strong> diesem Bereich besteht <strong>in</strong> den oberen Schichten<br />
zum Großteil aus Moorboden, der aufgrund der sehr ger<strong>in</strong>gen<br />
Dichte <strong>in</strong>sbesondere bei Wassersättigung den Auftriebskräften<br />
des Rohres ke<strong>in</strong>en Widerstand entgegensetzt. Darunter s<strong>in</strong>d<br />
Kleiboden mit stark wechselnden Sandanteilen und schließlich<br />
Sand zu f<strong>in</strong>den. Die Halterungen der Leitung für die Auftriebssicherung<br />
waren im Laufe der Jahre korrodiert und konnten<br />
sich lösen. Ebenso waren die aufgebrachten Betonreiter<br />
wirkungslos geworden. Damit war ke<strong>in</strong>e Auftriebssicherung<br />
Bild 1: Luftbild Gesamtübersicht<br />
Bild 2: Luftbild Aufständerung<br />
52 11-12 | 2013
PIPELINEBAU FACHBERICHT<br />
mehr vorhanden, die Leitung schwamm <strong>in</strong> der Folge bis zur<br />
Oberfläche auf und lag <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen Abschnitten sogar frei an<br />
der Erdoberfläche. Innerhalb e<strong>in</strong>er Strecke von ca. 180 m ergab<br />
sich e<strong>in</strong> maximaler Auftrieb von 2,73 m.<br />
Der Betreiber Open Grid Europe war daher zur Wiederherstellung<br />
der Integrität der Leitung zum Handeln gezwungen. Die<br />
Leitung wurde während der gesamten Zeit mit hoher Genauigkeit<br />
vermessungstechnisch überwacht und die jeweils aktuelle<br />
Situation dokumentiert. Auf dieser Basis konnte dann e<strong>in</strong>e<br />
Entscheidung zur Beseitigung der M<strong>in</strong>derdeckung getroffen<br />
werden. Da ke<strong>in</strong>e Bebauung <strong>in</strong> der Nähe besteht und sich der<br />
Bereich <strong>in</strong> der freien Landschaft bef<strong>in</strong>det, wurde die behördliche<br />
Genehmigung zur Sicherung erteilt. Ansonsten hätte die<br />
Leitung gegebenenfalls gesperrt werden müssen. Weiterh<strong>in</strong><br />
hatte das bis dah<strong>in</strong> regelmäßig durchgeführte Monitor<strong>in</strong>g<br />
des Leitungsbetreibers ergeben, dass der Zustand nicht so<br />
kritisch war, dass e<strong>in</strong> Bruch befürchtet werden musste. Der<br />
Auftraggeber entschied sich gegen e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>faches Beschweren<br />
der Leitung mit Betonreitern oder vergleichbarer Technik, da im<br />
Untergrund die Ankerstäbe der ursprünglichen Sicherung noch<br />
vorhanden s<strong>in</strong>d. Diese könnten dann die Leitung beschädigen.<br />
WIDRIGE UNTERGRUNDVERHÄLTNISSE,<br />
KREUZENDE VORFLUTER<br />
Für die Durchführung wurde der Auftrag im Februar 2012<br />
<strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es Rahmenvertrages vergeben. Die beauftragte<br />
Bohlen & Doyen Bauunternehmung GmbH gilt als<br />
äußerst leistungsfähiges Unternehmen der Region, das<br />
auch bei verschiedenen anderen Baumaßnahmen des Pipel<strong>in</strong>e-<br />
und Tiefbaus <strong>in</strong> unmittelbarer Nähe im E<strong>in</strong>satz ist.<br />
Neben der eigentlichen Bewältigung der Rohrverlegung<br />
<strong>in</strong> dem schwierig zu beherrschenden Boden ergab sich<br />
darüber h<strong>in</strong>aus das Problem der Erreichbarkeit mit Baufahrzeugen<br />
und -geräten. Weder e<strong>in</strong> E<strong>in</strong>satz von Kettenfahrzeugen<br />
auch mit breiten Ketten noch die Errichtung<br />
e<strong>in</strong>er Baustraße mit Baggermatratzen konnte <strong>in</strong> diesem<br />
Fall angewendet werden. Die Baustelle war durch die<br />
widrigen Untergrundverhältnisse und verschiedene kreuzende<br />
Vorfluter nicht befahrbar. Daher musste für die<br />
Zufahrt von den passierbaren Wegen an der Lagerfläche<br />
bis zur Baustellene<strong>in</strong>richtungsfläche e<strong>in</strong>e über 700 m<br />
lange Baustraße hergestellt werden. Die Verwendung von<br />
konventionellen Baggermatratzen schied hier als optimale<br />
Lösung aus verschiedenen Gründen aus. Die Strecke<br />
verläuft <strong>in</strong> sehr dichtem Abstand parallel zum Gewässer<br />
und ist hochwassergefährdet. Weiterh<strong>in</strong> war schon <strong>in</strong> der<br />
Planung e<strong>in</strong>e lange Bauzeit und damit auch lange E<strong>in</strong>satzzeit<br />
für die Baggermatratzen anzunehmen. Somit wäre<br />
e<strong>in</strong>e dauerhafte und feste Lage der Baustraße bestehend<br />
aus Holzbaggermatratzen für den Baustellenverkehr nicht<br />
möglich gewesen. Daher wurden annähernd 300 Baustraßenelemente<br />
aus Stahl vom Typ E+S am Ufer des Knockster<br />
Tiefs ausgelegt. Mit ihrer Breite von 3,8 m waren auch<br />
weniger Elemente zu verlegen als Baggermatratzen. Durch<br />
ihr Koppelsystem mit Verb<strong>in</strong>dungslaschen und Verriegelungsbolzen<br />
war auch e<strong>in</strong>e hervorragende Lagestabilität<br />
über den gesamten Zeitraum sichergestellt.<br />
BEHELFSBRÜCKE ÜBER EINEN VORFLUTER<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus musste über den Vorfluter „Freepsumer Tief“<br />
e<strong>in</strong>e Behelfsbrücke gebaut werden. Die Brücke ist aus zwei<br />
Hauptträgern und Querträgern im Abstand von 1,83 m, die<br />
alle jeweils e<strong>in</strong>e Höhe von jeweils 1,65 m haben, konstruiert.<br />
Sie hat damit e<strong>in</strong> Eigengewicht von <strong>in</strong>sgesamt mehr als 24,5 t.<br />
Bei e<strong>in</strong>er Stützweite von 30 m und e<strong>in</strong>er Fahrbahnbreite von<br />
6,00 m ist hier e<strong>in</strong>e Nutzlast von 60 t auf der Hauptspur und<br />
30 t Nutzlast auf der Nebenspur ausgelegt. Mit dieser Typenstatik<br />
entspricht sie damit der höchsten Brückenklasse. Alle<strong>in</strong><br />
der Aufbau <strong>in</strong>klusive der Errichtung der Brückenwiderlager<br />
bestehend aus acht Doppelbohlen von jeweils 10 m Länge<br />
als Spundwandkonstruktion dauerte im Zuge der Errichtung<br />
der Baustellenzuwegung acht Wochen.<br />
Aber das Gelände forderte noch mehr und viel aufwändigere<br />
Maßnahmen, um die Erreichbarkeit der Baustelle durch die<br />
Baugeräte zu ermöglichen. Wegen des anstehenden wassergesättigten<br />
Moorbodens musste e<strong>in</strong>e Zuwegung von der<br />
Baustellene<strong>in</strong>richtungsfläche entlang der gesamten Leitung bis<br />
zum Ende der Sanierungsstrecke als aufgeständerte Baustraße<br />
konstruiert werden (Bild 2). Dazu waren zunächst Spundwandsegmente<br />
bestehend aus vier Doppelbohlen vom Typ<br />
Larssen 604 S240GP senkrecht zur Straßenachse e<strong>in</strong>zubr<strong>in</strong>gen.<br />
Die E<strong>in</strong>zelbohlen haben e<strong>in</strong>e Länge von 12 m. Sie reichen damit<br />
etwa 9 m tief bis <strong>in</strong> den tragfähigen Untergrund, der etwa<br />
bei 4,6 m unterhalb der mächtigen Torfschichten beg<strong>in</strong>nt.<br />
Die Spundwandsegmente hatten e<strong>in</strong>en Abstand von 6,90 m<br />
und dienten als Auflager für Stahlträger der Größe HEB 500,<br />
auf denen wiederum die befahrbaren Gitterroste als typengeprüfte<br />
Brücke für die Baustraße <strong>in</strong>stalliert wurden. Dabei<br />
stellte es sich u. a. als besonders zeit<strong>in</strong>tensiv heraus, dass die<br />
Baustraße im Bogen parallel zur Leitung verläuft und damit<br />
immer wieder aufwändige Passstücke anzufertigen waren. Die<br />
Baustraßenkonstruktion war schließlich unter der Lastannahme<br />
e<strong>in</strong>es Baggergesamtgewichts von 45 t zu planen. Insgesamt<br />
erforderte die Baustellenzufahrt mit dem aufgeständerten<br />
Abschnitt e<strong>in</strong>e Bauzeit von drei Monaten.<br />
Erst nach Fertigstellung der schwebenden Baustraße<br />
konnten die Arbeiten für den beiderseitigen Verbau der<br />
Leitung durchgeführt werden. Mit mehreren 40-t-Seilbaggern<br />
und Vibratoren vom Typ Müller MS 10 konnten<br />
<strong>in</strong>sgesamt mehr als 400 t Spundwandprofil vom Typ Larssen<br />
603 <strong>in</strong>nerhalb von vier Wochen e<strong>in</strong>gebracht werden.<br />
Die Spundbohlen haben e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>zellänge von bis zu 10 m<br />
und reichen damit bis zu 5,5 m <strong>in</strong> den tragfähigen Baugrund,<br />
der hier überwiegend aus sandigem Material besteht. Die<br />
Baugrube hatte bei e<strong>in</strong>er lichten Breite von 5 m <strong>in</strong>sgesamt<br />
e<strong>in</strong>e Länge von 180 m. Sie wurde schließlich 10 cm unterhalb<br />
der Oberkante mit Stahlträgern HEB 500 gegurtet und mit<br />
Stahlrohren der Dimension 323,9 mm x 8,0 mm ausgesteift.<br />
Der Abstand der Aussteifung betrug 8,0 m, was mit der<br />
schweren und damit statisch höher belastbaren Gurtung<br />
erreicht werden konnte. Mit dem relativ großen Abstand<br />
wurde der Arbeitsraum für die eigentlichen Arbeiten an<br />
der Rohrleitung nicht zu stark e<strong>in</strong>geschränkt. Damit waren<br />
überhaupt erst die technischen Grundlagen geschaffen, um<br />
mit den Pipel<strong>in</strong>e-Arbeiten beg<strong>in</strong>nen zu können.<br />
11-12 | 2013 53
FACHBERICHT PIPELINEBAU<br />
Bild 3: Jochreihe zur sicheren Fixierung der Leitung<br />
Die Leitung musste während der gesamten Aushubarbeiten<br />
<strong>in</strong> ihrer bestehenden horizontalen und vertikalen Lage<br />
gesichert werden. Dies war e<strong>in</strong>e besonders anspruchsvolle<br />
Herausforderung, die nur unter großem technischem<br />
Aufwand und mit besonderer Sorgfalt gemeistert<br />
werden konnte. Bereits vor Projektbeg<strong>in</strong>n und während<br />
der Arbeiten wurde die Pipel<strong>in</strong>e täglich vermessen. Der<br />
E<strong>in</strong>satz von mit Sand gefüllten Bigpacks ermöglichte das<br />
Trimmen <strong>in</strong> der vertikalen Position, <strong>in</strong> dem das Rohr an<br />
verschiedenen Stellen be- bzw. entlastet wurde. Die Leitung<br />
durfte wegen ihres Spannungszustands nicht <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em Arbeitsgang abgesenkt werden, sondern konnte<br />
nur <strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelnen Schritten unter E<strong>in</strong>haltung der Maximalbelastung<br />
tiefer gelegt werden. Hierfür wären auf e<strong>in</strong>er<br />
Länge von 180 m mehr als 20 Hebegeräte <strong>in</strong> Form von<br />
Seitenbäumen bzw. Seilbaggern nötig gewesen. Da dies<br />
auf der engen und statisch nur begrenzt belastbaren<br />
Behelfsstraße nicht möglich war, entschieden sich der AG<br />
und die Projektleitung von Bohlen & Doyen dafür, die Leitung<br />
mit Flaschenzügen und Gurten an dafür gerammten<br />
Stahlträgern mit Querjoch zu sichern. Diese Aufhängung<br />
der Leitung wurde alle 10 m <strong>in</strong>stalliert, um die maximale<br />
zulässige Biegelast der Leitung e<strong>in</strong>zuhalten. Parallel zur<br />
Tragkonstruktion war e<strong>in</strong> Behelfssteg zu <strong>in</strong>stallieren, um<br />
e<strong>in</strong>e gesicherte Zugänglichkeit zu erreichen. Die Kettenzüge<br />
konnten auf diese Weise problemlos per Hand bedient<br />
werden. Sie sorgten außerdem mit e<strong>in</strong>em durch Laser<br />
gemessenen Arbeitsvorgang für e<strong>in</strong>e auf die gesamte<br />
Arbeitslänge fe<strong>in</strong> abgestimmte und gesicherte vertikale<br />
Lage des Rohres. Um die neue Reparaturbeschichtung,<br />
die Felsschutzmatte, die Schalung und letztlich die Auftriebssicherung<br />
aufbr<strong>in</strong>gen zu können, muss das Rohr<br />
entlang des betroffenen Abschnitts freiliegen und e<strong>in</strong><br />
ausreichender Arbeitsraum darunter vorhanden se<strong>in</strong>. Die<br />
Jochkonstruktion (Bild 3) sorgte dabei dafür, dass das<br />
Rohr entsprechend gehalten wurde.<br />
5 METER BREITE, AUF STAHLTRÄGERN<br />
AUFGESTÄNDERTE BAUSTRASSE<br />
Mit e<strong>in</strong>er Tiefe von etwa 3,5 m unter Geländeoberkante<br />
waren nun <strong>in</strong>sgesamt ca. 3.100 m 3 Boden auszuheben<br />
per Dumper abzutransportieren und zu lagern (Bild 4).<br />
Mittels e<strong>in</strong>es 25 t-Hydraulikbaggers, ausgerüstet mit<br />
Greifer und Auslegerverlängerung ließ sich e<strong>in</strong>e gute<br />
Baggerleistung erreichen und der Graben konnte <strong>in</strong>nerhalb<br />
von zweie<strong>in</strong>halb Wochen fertig gestellt werden.<br />
Mit e<strong>in</strong>er Breite von knapp 5 m ließ die auf Stahlträgern<br />
aufgeständerte Baustraße allerd<strong>in</strong>gs nur jeweils<br />
e<strong>in</strong>e Fahrtrichtung zu. E<strong>in</strong> Wenden der Fahrzeuge oder<br />
e<strong>in</strong>e mehrspuriges Befahren waren unmöglich. Der Kettendumper<br />
zum Transport des gebaggerten Bodens <strong>in</strong><br />
die 200 m entfernten Zwischenlagerflächen war daher<br />
mit drehbarem Oberwagen ausgerüstet. Er konnte damit<br />
auf der Stahlstraße problemlos h<strong>in</strong>- und herfahren.<br />
ZWISCHENLAGERUNG DES TORFBODENS<br />
UNTER WASSER<br />
Da es sich bei dem anstehenden Boden hauptsächlich<br />
um besonders schützenswertes Moor handelt, waren<br />
auch hier besondere Maßnahmen zu treffen. Moorboden<br />
ist e<strong>in</strong> Erdmaterial mit besonders hohem pH-Wert,<br />
das an der Luft sehr leicht oxidiert und zerfällt. Im Zuge<br />
des Oxidationsprozesses werden gegebenenfalls auch<br />
Schadstoffe wie z. B. Schwermetalle freigesetzt. Das<br />
gesamte betroffene Bodenmaterial wäre dann <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung<br />
mit äußerst hohen Kosten als Sondermüll zu<br />
entsorgen gewesen. Um das zu verh<strong>in</strong>dern, kam nur die<br />
Zwischenlagerung des Torfbodens unter Wasser und<br />
damit unter Luftabschluss <strong>in</strong> Frage. Der ausgehobene<br />
Boden war folglich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em eigens dafür hergestellten<br />
Wasserbecken zwischenzulagern. Dafür war neben<br />
der Baustellene<strong>in</strong>richtungsfläche e<strong>in</strong>e künstliche Lagune<br />
durch Aufschütten von Boden <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em umlaufenden Wall<br />
herzustellen. Die gesamte Fläche wurde anschließend mit<br />
PE-Folie ausgelegt und wasserdicht verschweißt, so dass<br />
e<strong>in</strong> Wasserstand von etwa 2 m erreicht werden konnte.<br />
Hier<strong>in</strong> war dann die Zwischenlagerung des empf<strong>in</strong>dlichen<br />
Moorbodens z. T. mit e<strong>in</strong>er Wasserbedeckung von bis<br />
zu 20 cm möglich. Die Lagerkapazität der künstlichen<br />
Lagunen betrug <strong>in</strong>sgesamt 3.100 m 3 . Die natürlichen<br />
Randbed<strong>in</strong>gungen dieses vernässten Abschnittes mit dem<br />
sehr hohen Grundwasserstand forderte auch dem Grundwassermanagement<br />
extrem viel ab. So waren zunächst<br />
26 Tiefbrunnen zu bohren, die am Ende e<strong>in</strong>e Menge von<br />
mehr als 92.000 m 3 förderten. Das gepumpte Grundwasser<br />
musste enteisent werden und war wegen des hohen<br />
Ammoniumgehalts <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em ca. 800 m entfernten Spülfeld<br />
zu verrieseln. E<strong>in</strong>e direkte E<strong>in</strong>leitung <strong>in</strong> die Vorflut<br />
war nicht erlaubt. Dies wiederum erforderte zusätzlich<br />
den Bau e<strong>in</strong>es Dükers durch das Knockster Tief.<br />
Für die weiteren Arbeiten an der Pipel<strong>in</strong>e war zunächst<br />
die PE-Hülle vollständig zu entfernen. Dazu wurden 16<br />
sogenannte Bristle Blaster ® e<strong>in</strong>gesetzt, die aufgrund der<br />
starken mechanischen E<strong>in</strong>wirkung e<strong>in</strong>e besonders hohe<br />
54 11-12 | 2013
PIPELINEBAU FACHBERICHT<br />
Oberflächenrauhheit und -re<strong>in</strong>heit erzeugen. Anschließend<br />
konnten sämtliche Schweißnähte entlang des<br />
betroffenen Abschnitts kontrolliert werden. Abschließend<br />
wurde auf das Rohr wieder e<strong>in</strong>e PE-Hülle aufgebacht.<br />
Um hier den höchsten Anforderungen der Open Grid<br />
Europe gerecht zu werden, wurden Belastungs-Reißtests<br />
durchgeführt. Diese konnten die ausreichende Haftungsfestigkeit<br />
der Reparaturschutzhülle bestätigen.<br />
Die nun anzubr<strong>in</strong>gende Auftriebssicherung der Leitung<br />
wurde geme<strong>in</strong>sam mit der Hülskens Wasserbau GmbH<br />
aus Wesel durch das von diesem Unternehmen patentierte<br />
System „König“ realisiert. Dazu war die vorhandene<br />
starke Polyethylenschicht mit e<strong>in</strong>em Vlies als Felsschutzmatte<br />
zu ummanteln. Das 8 mm dicke Vliesmaterial<br />
sorgt dafür, dass weder Betonkies noch die Kanten der<br />
Schalungselemente auf das Rohr bzw. dessen Beschichtung<br />
drücken und diese beschädigen. Darauf konnte<br />
dann die Schalung für das Aufbr<strong>in</strong>gen des Ortsbetons<br />
gebaut werden. Dazu mussten zunächst im Abstand<br />
von 2 m Halb- und Viertelr<strong>in</strong>ge von etwa 130 mm Dicke<br />
als Abstandshalter für die Schalung um das Rohr gelegt<br />
werden. Mit entsprechenden Bohrungen versehen, waren<br />
die R<strong>in</strong>gelemente dann durch die Bewehrung mite<strong>in</strong>ander<br />
zu verb<strong>in</strong>den. Als Bewehrung (Bild 5) dient bei diesem<br />
Betonmantel ke<strong>in</strong> Stahl, sondern ca. 14 mm starke<br />
Nylonseile, die sowohl <strong>in</strong> Längs- als auch <strong>in</strong> Querrichtung<br />
verspannt werden. Der Beton muss hier im Wesentlichen<br />
nur Zugkräfte <strong>in</strong> Längsrichtung aufnehmen, so dass diese<br />
Bewehrung nur für e<strong>in</strong>en sicheren Halt des Betonmantels<br />
um das Rohr sorgen muss. E<strong>in</strong>e Aufnahme von Zuglasten<br />
durch den Beton ist nicht erforderlich und gegebenenfalls<br />
auftretende Biegungen des Rohres z. B. durch Setzung<br />
und damit verbundene Risse im Beton können durchaus <strong>in</strong><br />
Kauf genommen werden. Auf die Betonhalb- und Viertelr<strong>in</strong>gelemente<br />
wurden zwei Blechhalbschalen aufgebracht<br />
und mit Stahlbändern straff gesichert, um damit e<strong>in</strong>e<br />
Schalung für den Beton herzustellen. Die beiden Halbschalen<br />
s<strong>in</strong>d so konzipiert, das oben e<strong>in</strong> ausreichend breiter<br />
Spalt zum Betone<strong>in</strong>füllen verbleibt. Schließlich erhält<br />
man e<strong>in</strong>e umlaufende Betonhülle. Diese musste nach<br />
Berechnung des Sachverständigen der Open Grid Europe<br />
m<strong>in</strong>destens 130 mm dick se<strong>in</strong>, um als Ballastierung e<strong>in</strong>e<br />
künftig sichere Lage des Rohres zu gewährleisten.<br />
BESCHWEREN UND ABSENKEN DER LEITUNG<br />
Neben der Beschwerung der Leitung durch Betonummantelung<br />
war die Leitung außerdem gegen e<strong>in</strong> tieferes<br />
Abs<strong>in</strong>ken zu sichern und entsprechend zu gründen. Dafür<br />
wurden zunächst entlang des betroffenen Abschnitts<br />
die Stahlträger HEB 340 der vorab <strong>in</strong>stallierten Jochkonstruktion<br />
genutzt. Die Gründungselemente mit Längen<br />
von jeweils 19 m und e<strong>in</strong>en Abstand von 10 m waren<br />
entsprechend des Bodenniveaus zu kürzen. Darauf war<br />
dann e<strong>in</strong> Stahlträger ebenfalls vom Typ HEB 340 zu<br />
schweißen, der als Auflager für die Fußbleche dient. Mit<br />
zwei senkrechten Blechen und zwei Lagerblechen wurde<br />
e<strong>in</strong>e halbschalenförmige Aufnahmeform für das Rohr<br />
gefertigt, die vor Ort auf den Querträger aufzuschweißen<br />
war. Die Dimension der Träger und die Stärke der Bleche<br />
von 30 mm wurden gewählt, um e<strong>in</strong>e Lebensdauer von<br />
50 Jahren zu gewährleisten. Das Gesamtgewicht dieser<br />
Gründungskonstruktion betrug annähernd 5,7 t. Sämtliche<br />
Stahlbauteile, die zur temporären Sicherung aber<br />
auch zur dauerhaften Lagesicherung der Leitung dienen,<br />
Bild 4: Freilegen der Rohrleitung<br />
Bild 5: Bewehrung für den Betonmantel<br />
11-12 | 2013 55
FACHBERICHT PIPELINEBAU<br />
Bild 6: Rohrgraben<br />
wurden geme<strong>in</strong>sam mit der Open Grid Europe entwickelt<br />
und bei Bohlen & Doyen geplant und hergestellt. Mit den<br />
per Hand bedienten Kettenzügen der Jochkonstruktion<br />
und der genauen Lasermessung konnte das Rohr sicher<br />
und präzise abgesenkt werden. Darüber h<strong>in</strong>aus blieb die<br />
Leitung während der gesamten Maßnahme unter Druck,<br />
was e<strong>in</strong>e besondere Umsichtigkeit und Sorgfalt sämtlicher<br />
Arbeiten erforderlich machte. Nachdem die Rohrleitung<br />
auf die Trägerkonstruktion mit Halbschalen vorsichtig<br />
abgesetzt worden war, konnte mit dem Wiederverfüllen<br />
der Baugrube begonnen werden. Auch diese Arbeiten<br />
waren nur mit vorherigen baulichen Sondermaßnahmen<br />
zu lösen. Denn durch den statisch erforderlichen<br />
Abstand zwischen der aufgeständerten Baustraße und<br />
dem Rohrgraben (Bild 6) von 1 m ergibt sich e<strong>in</strong>e Distanz,<br />
über die der gewählte Kettendumper den Boden<br />
nicht rückverfüllen konnte. E<strong>in</strong> größerer Kettendumper<br />
kam aufgrund der beschränkten Platzverhältnisse auf<br />
der Baustraße sowie e<strong>in</strong>er sehr stark e<strong>in</strong>geschränkten<br />
Beweglichkeit auf diesem Untergrund nicht <strong>in</strong> Frage. Um<br />
dennoch e<strong>in</strong>en zielgerichteten und sicheren E<strong>in</strong>bau des<br />
Bodens zu gewährleisten, musste dazu e<strong>in</strong>e Schüttrampe<br />
gebaut werden. Diese überbrückte den Abstand zwischen<br />
Baustraße und Rohrgraben und ließ e<strong>in</strong>e stetige Kontrolle<br />
des Materials und damit auch e<strong>in</strong>en lagegerechten<br />
Wiedere<strong>in</strong>bau des Bodens zu.<br />
Das Team von Bohlen & Doyen hatte die Arbeiten unter<br />
ständiger naturschutzfachlicher Baubegleitung mit höchsten<br />
Anforderungen an Lärmemission, habitatgetreuen Wiedere<strong>in</strong>bau<br />
des Bodens sowie Urzustand des Oberbodens durchzuführen.<br />
Das gesamte Gebiet unterliegt besonders dem<br />
Artenschutz (Natura 2000) und gehört zum Europäischen<br />
Vogelschutzgebiet V04 Krummhörn mit entsprechenden<br />
Anforderungen. So war z. B. die Baustellene<strong>in</strong>richtungsfläche<br />
e<strong>in</strong>seitig mit e<strong>in</strong>er Wand aus Conta<strong>in</strong>ern<br />
gegen eventuellen Baulärm zu sichern,<br />
um Brut- und Rastvögel der angrenzenden Flächen<br />
nicht zu stören. E<strong>in</strong> e<strong>in</strong>gesetzter Hydraulikbagger,<br />
der technisch nicht auf Panol<strong>in</strong>, d. h.<br />
biologisch abbaubares Hydrauliköl umgerüstet<br />
werden konnte, erhielt e<strong>in</strong>e spezielle Vorrichtung,<br />
um frühzeitig drohende Umweltgefährdungen<br />
zu erkennen. Unter dem Gerät wurde e<strong>in</strong>e Auffangwanne<br />
aus durchsichtigem Acryl <strong>in</strong>stalliert,<br />
die bei e<strong>in</strong>setzendem Verlust von Hydrauliköl e<strong>in</strong>e<br />
sofortige Sichtkontrolle ermöglichte.<br />
Nach etwa 15-monatiger Bauzeit konnte Bohlen<br />
& Doyen die Maßnahme im Mai 2013 erfolgreich<br />
beenden und die Leitung mit e<strong>in</strong>er Überdeckung<br />
von 2,5-3,0 m wieder gesichert verlegen. Zeitweise<br />
war auf dem schwer zu bewältigenden<br />
Teilstück von nur 180 m e<strong>in</strong> Team von bis zu<br />
30 Spezialisten beschäftigt. Abschließend bleibt<br />
festzuhalten, dass dieses anspruchsvolle Projekt<br />
mit der Vielzahl von schwierigen Randbed<strong>in</strong>gungen<br />
auch aufgrund der hervorragenden und<br />
engen fachlichen und organisatorischen Zusammenarbeit<br />
zwischen Open Grid Europe und Bohlen & Doyen<br />
so reibungslos verlief.<br />
Dr. FRANK KRÖGEL<br />
Leiter Technisches Büro, Bohlen & Doyen<br />
Bauunternehmung GmbH, Wiesmoor<br />
Tel. +49 04944 301-146<br />
E-Mail: f.kroegel@bohlen-doyen.com<br />
Dipl. Ing. FRANK GEHLENBORG<br />
Projektleitung, Bohlen & Doyen<br />
Bauunternehmung GmbH, Wiesmoor<br />
Tel. +49 04944 301-418<br />
E-Mail: f.gehlenborg@bohlen-doyen.com<br />
ARDE ROSENDAHL<br />
Betriebsbereich Nord, Open Grid Europe GmbH,<br />
Krummhörn<br />
Tel. +49 4923 917-126<br />
E-Mail: arde.rosendahl@open-grid-europe.com<br />
Dipl. Ing. FRIEDHELM ENGBERT<br />
AUTOREN<br />
Leiter Konstruktion, Open Grid Europe GmbH, Essen<br />
Tel. +49 201 364218-463<br />
E-Mail: friedhelm.engbert@open-grid-europe.com<br />
56 11-12 | 2013
11-12 | 2013 57
FACHBERICHT PIPELINEBAU<br />
Hochdruckleitung für Erdgaskavernenspeicher<br />
<strong>in</strong> Rekordzeit verlegt<br />
Mit e<strong>in</strong>em überzeugenden Nebenangebot hat die Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG im vergangenen<br />
Jahr von der Storengy Deutschland GmbH den Auftrag für die Verlegung e<strong>in</strong>er 13 km langen Hochdruckleitung für<br />
die Erweiterung der Erdgaskavernenspeicheranlage Peckensen erhalten. Entgegen der ursprünglichen Ausschreibung,<br />
nach der im Vorfeld der Baumaßnahme drei Lagerplätze für die Zwischenlagerung der benötigten Rohre hergestellt<br />
werden sollten, erarbeitete Bunte geme<strong>in</strong>sam mit dem Rohrhersteller Salzgitter Mannesmann Großrohr GmbH und dem<br />
Logistikunternehmen F<strong>in</strong>ke Spezialtransporte e<strong>in</strong> Konzept, das auf e<strong>in</strong>er längeren Lagerung der Rohre im Rohrwerk und<br />
e<strong>in</strong>er späteren Just-<strong>in</strong>-time-Lieferung zum E<strong>in</strong>bauort basierte.<br />
Neben dem Schutz der Umwelt durch die Vermeidung<br />
e<strong>in</strong>er temporären Versiegelung der Lagerflächen und<br />
durch e<strong>in</strong>e Reduzierung des Baustellenverkehrs konnten<br />
<strong>in</strong>sbesondere die Kosten für die Herstellung der Lagerplätze<br />
und deren Sicherung sowie für die E<strong>in</strong>lagerung<br />
der Rohre und die Zwischentransporte e<strong>in</strong>gespart werden.<br />
Auch <strong>in</strong> anderer H<strong>in</strong>sicht haben die Baupartner den<br />
Auftraggeber und das für die Planung und Bauleitung<br />
verantwortliche Ingenieurbüro Nickel GmbH überzeugt:<br />
Aufgrund der zielorientierten und partnerschaftlichen<br />
Zusammenarbeit aller am Bau beteiligten Parteien konnte<br />
die vorgegebene fünfmonatige Bauphase mit der<br />
mechanischen Fertigstellung der Gashochdruckleitung<br />
im November 2012 nicht nur e<strong>in</strong>gehalten, sondern mit<br />
lediglich 16 Wochen Bauzeit sogar deutlich unterschritten<br />
werden.<br />
Bild 1: Bau der Gashochdruckleitung (DN 800) zwischen der<br />
Obertageanlage <strong>in</strong> Peckensen und dem Netzkopplungspunkt Ste<strong>in</strong>itz der<br />
ONTRAS-VNG Gastransport GmbH<br />
Im Zuge der Energiewende gew<strong>in</strong>nt die Erdgasspeicherung<br />
<strong>in</strong> Deutschland aufgrund steigender Importabhängigkeiten<br />
und e<strong>in</strong>em dynamischen Wettbewerbsumfeld<br />
immer mehr an Bedeutung. E<strong>in</strong>e Schlüsselrolle kommt<br />
hierbei den unterirdischen Erdgaskavernenspeichern zu.<br />
Die Storengy Deutschland GmbH zählt zu den Unternehmen,<br />
die solche unterirdischen Anlagen <strong>in</strong> Deutschland<br />
entwickelt, baut und vermarktet. Unter anderem<br />
besitzt und betreibt sie den Erdgasspeicher am Standort<br />
Peckensen im Altmarkkreis Salzwedel, Geme<strong>in</strong>de Wallstawe,<br />
ca. 20 km südwestlich der Hansestadt Salzwedel<br />
im Bundesland Sachsen -Anhalt. Die seit 2002 genutzten<br />
Kavernen haben jeweils e<strong>in</strong>en nutzbaren Hohlraum<br />
zwischen 500.000 und 700.000 m 3 und bef<strong>in</strong>den sich<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Tiefe von etwa 1.300 bis 1.450 m. Zur Erweiterung<br />
der Speicherkapazität wurde im Jahr 2012 u. a. der<br />
Bau e<strong>in</strong>er neuen 13 km langen Gashochdruckleitung <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>er Nennweite von DN 800 und e<strong>in</strong>em Nenndruck von<br />
PN 100 erforderlich.<br />
157 e<strong>in</strong>gebaute Werksbögen, kreuzende<br />
Fremdleitungen<br />
„Die Errichtung der neuen Gashochdruckleitung wurde<br />
unter E<strong>in</strong>haltung höchster Anforderungen durchgeführt“,<br />
er<strong>in</strong>nert sich Dipl.-Ing. He<strong>in</strong>o Boekhoff, Niederlassungsleiter<br />
Bunte Rohrleitungs- und Anlagenbau. Schon vor dem<br />
Grabenaushub fand e<strong>in</strong>e archäologische Voruntersuchung<br />
der Trasse statt. Zudem mussten verschiedene bautechnische<br />
Besonderheiten berücksichtigt werden. So folgt<br />
der Leitungsverlauf auf der gesamten Länge e<strong>in</strong>er bereits<br />
bestehenden Verb<strong>in</strong>dungsleitung DN 600 und wurde <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>igen Trassenabschnitten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Korridor zwischen<br />
verschiedene Fremdleitungen gebaut. „Zur präzisen E<strong>in</strong>haltung<br />
der def<strong>in</strong>ierten Achsabstände wurden deshalb<br />
ausschließlich Werksbogen e<strong>in</strong>gesetzt“, so Boekhoff.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus kreuzt die Leitung <strong>in</strong> ihrem Verlauf<br />
acht Straßen, sieben Wege, zwei Flüsse, 75 Kabel und<br />
113 Rohrleitungen <strong>in</strong> Nennweiten von DN 100 bis<br />
DN 1200. Die Anzahl der e<strong>in</strong>gebauten Werksbogen<br />
betrug <strong>in</strong>sgesamt 157 Stück. Aus diesen Gegebenheiten<br />
folgte e<strong>in</strong> ungewöhnlich hoher Anteil an Verb<strong>in</strong>-<br />
58 11-12 | 2013
PIPELINEBAU FACHBERICHT<br />
Bild 2: Aufgrund der großen Anzahl kreuzender Fremdleitungen<br />
betrug der Anteil der Verb<strong>in</strong>dungsnähte mehr als 40 %<br />
Bild 3: Im Rohrgraben ist der variierende Bodenaufbau gut zu erkennen<br />
dungsschweißnähten. Der Anteil der Verb<strong>in</strong>dungsnähte<br />
– bezogen auf die Gesamtmenge aller Nähte – betrug<br />
mehr als 40 %. Die Schweißnähte wurden überwiegend<br />
als E-Hand-Schweißung mit Cellulose-umhüllten Fallnahtelektroden<br />
ausgeführt. Daneben wurde auch e<strong>in</strong>e Komb<strong>in</strong>ation<br />
aus WIG-Wurzel und Fülldraht angewendet. Die<br />
Schweißqualität kann nach Angaben des Auftragsgebers<br />
als hervorragend bezeichnet werden. Bezogen auf die<br />
Gesamtzahl der Schweißnähte betrug die Reparaturquote<br />
nur 0,3 %.<br />
Auch die Tatsache, dass über die gesamte Leitungslänge<br />
stark variierende Bodenverhältnisse angetroffen wurden,<br />
machte weitere besondere Baumaßnahmen erforderlich.<br />
Fe<strong>in</strong>er Sand und fester, b<strong>in</strong>diger Boden wechselten<br />
zum Teil <strong>in</strong> kurzen Abständen unmittelbar aufe<strong>in</strong>ander.<br />
Aufgrund des hohen Aufkommens an scharfkantigen<br />
Ste<strong>in</strong>en musste die Rohrleitung zusätzlich zu der werksseitigen<br />
PE-Umhüllung auf der Baustelle auf ganzer Länge<br />
komplett mit Felsschutzmatten umhüllt werden. Darüber<br />
h<strong>in</strong>aus wurde der für die Verfüllung verwendete Aushub<br />
durch e<strong>in</strong>en Pipel<strong>in</strong>epadder aufbereitet.<br />
Arbeitssicherheit und Umweltschutz im Fokus<br />
Selbstverständlich standen auch Arbeitssicherheitsaspekte<br />
und der Schutz der Umwelt bei der Baumaßnahme im<br />
Fokus. Deshalb wurden alle Arbeitsgänge vor Aufnahme<br />
der Tätigkeiten auf Gefahren untersucht, e<strong>in</strong> Sicherheitsund<br />
Gesundheitsschutzplan erstellt und Gefährdungsanalysen<br />
erarbeitet. Vor der erstmaligen Tätigkeit auf<br />
der Baustelle erhielt jeder Beschäftigte e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>weisung<br />
<strong>in</strong> die Besonderheiten der Baumaßnahme.<br />
Aufgrund der großen Anzahl kreuzender Fremdleitungen<br />
wurden zusätzlich alle betroffenen Tiefbaukolonnen<br />
täglich detailliert <strong>in</strong> den Verlauf der vorhandenen Fremdleitungen<br />
im jeweiligen Trassenabschnitt e<strong>in</strong>gewiesen.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus fanden regelmäßige Sicherheitsunterweisungen<br />
statt. Zusammengefasst führten diese Maßnahmen<br />
dazu, dass bei den wöchentlich durchgeführten<br />
Sicherheitsbegehungen ke<strong>in</strong>e kritischen Vorkommnisse<br />
festgestellt wurden.<br />
Beim Ausbau der Energienetze <strong>in</strong> Deutschland ist die<br />
Johann Bunte Bauunternehmung mit dem Geschäftsbereich<br />
Rohrleitungs- und Anlagenbau seit vielen Jahren<br />
beteiligt. Das Unternehmen, das seit 2008 Mitglied im<br />
Rohrleitungsbauverband (rbv) ist, hat durch die im gleichen<br />
Jahr erlangte DVGW-Zertifizierung sowie durch<br />
umfangreiche Investitionen die Grundlagen geschaffen,<br />
um sich beim Ausbau der Gasleitungsnetze als leistungsfähiger<br />
Partner etablieren zu können, so auch beim Bau<br />
der Gashochdruckleitung zwischen der Obertageanlage<br />
<strong>in</strong> Peckensen und dem Netzkopplungspunkt Ste<strong>in</strong>itz der<br />
ONTRAS-VNG Gastransport GmbH.<br />
Der Leistungsumfang, der aus der kompletten Errichtung<br />
der Gashochdruckleitung e<strong>in</strong>schließlich e<strong>in</strong>er KKS-Anlage<br />
und e<strong>in</strong>er Kabelschutzrohranlage bestand, konnte <strong>in</strong><br />
Bezug auf wirtschaftliche Aspekte und zeitliche Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
geme<strong>in</strong>sam mit den Baupartner zur vollsten<br />
Zufriedenheit des Auftraggebers abgeschlossen werden.<br />
KONTAKT: Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Papenburg,<br />
E-Mail: papenburg@johann-bunte.de<br />
11-12 | 2013 59
FACHBERICHT KORROSIONSSCHUTZ<br />
Erhöhter Korrosionsschutz bei<br />
Stellantrieben<br />
Die Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit von Feldgeräten ist für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb<br />
prozesstechnischer Anlagen unerlässlich. E<strong>in</strong> entscheidender Faktor ist die Widerstandskraft der Geräte gegen die<br />
herrschenden Umgebungsbed<strong>in</strong>gungen. Durch Korrosionsschäden hervorgerufene Anlagenstillstände zeigen, dass diesem<br />
Thema nicht immer die notwendige Aufmerksamkeit gewidmet wird, obwohl die korrosionsbed<strong>in</strong>gten wirtschaftlichen<br />
Schäden immens s<strong>in</strong>d. Wie man mit dem Thema Korrosionsschutz ernsthaft umgehen kann, zeigt dieser Fachbericht am<br />
Beispiel elektrischer Stellantriebe.<br />
ELEKTRISCHE STELLANTRIEBE<br />
Elektrische Stellantriebe dienen zur Automatisierung von<br />
Industriearmaturen jeglicher Bauform und Größe. Sie stellen<br />
die Armaturenposition entsprechend der vom Leitsystem<br />
vorgegebenen Stellbefehle beziehungsweise Sollwertvorgaben<br />
e<strong>in</strong> und haben somit entscheidenden Anteil an der<br />
korrekten Steuerung und Regelung der Stoffströme <strong>in</strong> prozesstechnischen<br />
Anlagen. Überall dort, wo Rohrleitungen<br />
und Industriearmaturen e<strong>in</strong>gesetzt werden, s<strong>in</strong>d sie auch zu<br />
f<strong>in</strong>den: Kläranlagen, Wasserwerke, Kraftwerke, Raff<strong>in</strong>erien<br />
oder Bohr<strong>in</strong>seln.<br />
GESTIEGENE ANFORDERUNGEN<br />
Der letztgenannte E<strong>in</strong>satzort repräsentiert e<strong>in</strong>en Bereich,<br />
den Offshore-Bereich, der <strong>in</strong> der zurückliegenden Dekade<br />
bezüglich der Ansprüche an den Korrosionsschutz treibend<br />
war und immer noch ist. Die Weiterentwicklung der<br />
Fördertechnik und die gestiegenen Energiepreise erlauben<br />
es, die Öl- und Gasförderung unter immer schwierigeren<br />
Bed<strong>in</strong>gungen auf offener See wirtschaftlich zu betreiben,<br />
von den tropischen Gewässern bis <strong>in</strong> die hohen polaren<br />
Breitengrade. Durch die feuchte, salzhaltige und damit<br />
hochkorrosive Luft ist das technische Gerät dort extremen<br />
Bed<strong>in</strong>gungen ausgesetzt. Erschwerend kommt h<strong>in</strong>zu, dass<br />
Ausfälle <strong>in</strong> diesen Anlagen noch höhere wirtschaftliche<br />
Verluste bedeuten, als es für E<strong>in</strong>richtungen an Land gilt.<br />
Daraus resultiert e<strong>in</strong>e erhöhte Sensibilität der Betreiber für<br />
das Thema Korrosionsschutz.<br />
Nicht zu unterschätzen ist auch das erhöhte ästhetische<br />
Empf<strong>in</strong>den von Anlagenbetreibern und Bedienpersonal.<br />
Rostflecken, auch wenn sie für die Funktion e<strong>in</strong>es Geräts<br />
nicht relevant s<strong>in</strong>d, werden zunehmend als nicht tolerierbarer<br />
Makel empfunden. Letztlich verb<strong>in</strong>det der Nutzer solche<br />
Ersche<strong>in</strong>ungen mit funktionalen Nachteilen, beispielsweise<br />
festgerosteten Schrauben, die die Revisionsarbeiten an den<br />
Geräten erschweren.<br />
DIE NORMENSITUATION<br />
Für Planer und Betreiber bildet der zweite Teil der<br />
DIN EN ISO 12944 e<strong>in</strong>e solide Basis zur Klassifizierung der<br />
Umgebungsbed<strong>in</strong>gungen. Diese werden dort beschrieben<br />
und <strong>in</strong> Korrosivitätskategorien e<strong>in</strong>geteilt (Tabelle 1).<br />
Im Offshore-Bereich muss die Korrosivitätskategorie C5-M<br />
erfüllt werden. Die Kategorien s<strong>in</strong>d wiederum <strong>in</strong> die Schutzdauern<br />
kurz, mittel und lang e<strong>in</strong>geteilt. Stellantriebe verrichten<br />
über Jahre h<strong>in</strong>weg ihren Dienst. Für sie kommt nur<br />
die lange Schutzdauer <strong>in</strong> Frage.<br />
Nicht immer werden die <strong>in</strong> der DIN EN ISO 12944 beschriebenen<br />
Maßnahmen als ausreichend betrachtet. Besonders<br />
ambitioniert ist der von der norwegischen Öl<strong>in</strong>dustrie etablierte<br />
NORSOK M-501 Standard. Dieser stützt sich wiederum<br />
auf die <strong>in</strong> der ISO 20 340 beschriebene Korrosionsschutzprüfung.<br />
Die Prüfl<strong>in</strong>ge werden dort über 25 Wochen e<strong>in</strong>er<br />
Klimaprüfung unterzogen, <strong>in</strong> der sich zyklisch die Klimaverhältnisse<br />
ändern. Kern aller <strong>in</strong> den Normen beschriebenen<br />
Korrosionsschutzprüfungen ist der Salzsprühnebeltest nach<br />
Tabelle 1: Klassifizierung der Umgebungsbed<strong>in</strong>gungen auf Basis von DIN EN ISO 12944, Teil 2<br />
Korrosivitätskategorie<br />
Beispiele<br />
C1 unbedeutend nur <strong>in</strong>nen: geheizte Gebäude mit neutralen Atmosphären<br />
C2 ger<strong>in</strong>g ländliche Bereiche, ungeheizte Gebäude, <strong>in</strong> denen Kondensation auftreten kann, z. B. Lager, Sporthallen<br />
C3 mäßig Stadt- und Industrieatmosphäre mit mäßiger Luftverunre<strong>in</strong>igung, Küstenbereiche mit ger<strong>in</strong>ger Salzbelastung,<br />
Produktionsräume mit hoher Luftfeuchte und etwas Luftverunre<strong>in</strong>igung (z. B. Lebensmittelherstellung,<br />
Wäschereien, Brauereien)<br />
C4 stark <strong>in</strong>dustrielle Bereiche, Küstenbereiche mit mäßiger Salzbelastung, Chemieanlagen, Schwimmbäder<br />
C5-I sehr stark (Industrie) <strong>in</strong>dustrielle Bereiche mit hoher Luftfeuchte und aggressiver Atmosphäre<br />
C5-M sehr stark (Meer) Küsten- und Offshore-Bereich mit hoher Salzbelastung, Gebäude mit nahezu ständiger Kondensation und<br />
mit starker Schadstoffkonzentration<br />
60 11-12 / 2013
KORROSIONSSCHUTZ FACHBERICHT<br />
DIN EN ISO 9227 NSS. Bei diesem Test werden Bauteile,<br />
deren Beschichtung bis auf das Substrat e<strong>in</strong>geritzt ist, e<strong>in</strong>er<br />
salzhaltigen Atmosphäre <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er geschlossenen Kammer<br />
ausgesetzt und anschließend nach normierten Kriterien<br />
beurteilt. Bei der Prüfung für C5-M mit langer Schutzdauer<br />
nach DIN EN ISO 12944-6 beträgt die Testdauer 1.440<br />
Stunden, bei der ISO 20 340 summiert sich die Zeit der<br />
Besprühung im Rahmen der zyklischen Klimaprüfung auf<br />
1.800 Stunden.<br />
E<strong>in</strong>e grundlegende Schwäche ist allen Normen geme<strong>in</strong>. Sie<br />
berücksichtigen noch nicht die Entwicklungen der letzten<br />
Jahre im Bereich der Pulverbeschichtung. So fehlt <strong>in</strong> den<br />
Maßnahmelisten diese seit Jahren etablierte und bewährte<br />
Korrosionsschutzbeschichtung. Dies liegt <strong>in</strong> den langwierigen<br />
Normierungsprozessen begründet.<br />
PULVERBESCHICHTUNG SETZT NEUE MASSSTÄBE<br />
Die Verabschiedung neuer Umweltrichtl<strong>in</strong>ien startete<br />
den Countdown für das Ende der alten Lackieranlage bei<br />
AUMA. Angesichts der genannten gestiegenen Anforderungen<br />
nahm das Unternehmen dies als Gelegenheit, die<br />
Beschichtungsmethodik generell zu h<strong>in</strong>terfragen. Nach<br />
e<strong>in</strong>er ausführlichen Evaluierungsphase entschied sich das<br />
Unternehmen für e<strong>in</strong>e zweischichtige Pulverbeschichtung<br />
der Gehäusebauteile. Mehrere Millionen Euro wurden <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>e Pulverbeschichtungsanlage <strong>in</strong>vestiert; nach und nach<br />
wurden Gehäuseteile auf Pulverbeschichtung umgestellt.<br />
E<strong>in</strong> grundlegender Paradigmenwechsel bedeutete die<br />
Umstellung von der Lackierung des kompletten Gerätes<br />
nach der Montage zur Beschichtung der Gehäuseteile vor<br />
der Montage. Der große Vorteil für die Anlagenbetreiber:<br />
Auch bei noch so häufigem Öffnen des Gerätegehäuses<br />
auf der Anlage, bei Installation, Inbetriebnahme oder Revisionsarbeiten,<br />
bleibt die Korrosionsschutzbeschichtung<br />
unversehrt.<br />
Aufgrund der maßlich nicht vernachlässigbaren Dicke des<br />
zweischichtigen Lacksystems, mussten die metallischen<br />
E<strong>in</strong>zelteile h<strong>in</strong>sichtlich ihrer Abmessungen angepasst und<br />
umkonstruiert werden. Als verschärfende Anforderung kam<br />
das ambitionierte selbst auferlegte Ziel h<strong>in</strong>zu, die Gehäuseteile<br />
bis h<strong>in</strong>ter die Dichtkante zu beschichten. Dieses Ziel<br />
wurde erreicht, so dass alle Dichtflächen beschichtet s<strong>in</strong>d<br />
und dadurch die ohneh<strong>in</strong> guten Korrosionsschutzeigenschaften<br />
weiter verbessert werden (Bild 2).<br />
SCHICHTAUFBAU UND VERFAHREN<br />
Vor Aufbr<strong>in</strong>gen der Pulverschichten müssen die Bauteile<br />
e<strong>in</strong>er nasschemischen Vorbehandlung unterzogen werden.<br />
Dabei werden Fett und Verschmutzungen entfernt und die<br />
Oberfläche aktiviert. Die dabei entstehende Konversionsschicht<br />
bewirkt, dass sich die nachfolgende Pulverschicht<br />
optimal mit der Gehäuseoberfläche verb<strong>in</strong>det, was zu<br />
e<strong>in</strong>er hohen Haftung führt. AUMA setzt hier auf die Silantechnologie<br />
(Oxsilan), die bei gleicher Qualität wesentlich<br />
umweltfreundlicher ist als die sonst gebräuchliche Z<strong>in</strong>kphosphatierung.<br />
In e<strong>in</strong>er Pulverkab<strong>in</strong>e wird für die Grundbeschichtung<br />
das elektrostatisch geladene Epoxidharz-Pulver<br />
Bild 1: Ablauf der Pulverbeschichtung<br />
auf die geerdeten Gehäuseteile aufgebracht. Die Ladung<br />
sorgt dafür, dass das Pulver über die Dichtkanten h<strong>in</strong>weg<br />
an dem Material gleichmäßig haftet. Aus der Pulverkab<strong>in</strong>e<br />
wandern die Träger mit den Bauteilen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Ofen, wo<br />
das Pulver <strong>in</strong> die Gehäuseoberfläche e<strong>in</strong>gebrannt wird. Das<br />
Epoxidharzpulver vernetzt sich dabei <strong>in</strong> hohem Maße, was<br />
zur außerordentlichen mechanischen Widerstandfähigkeit<br />
der Beschichtung beiträgt. In e<strong>in</strong>em weiteren Verfahrensschritt<br />
wird das Polyurethan-Deckpulver <strong>in</strong> vergleichbarer<br />
Weise aufgebracht. Diese Beschichtung sorgt für sehr hohe<br />
Chemikalien-, Witterungs- und UV-Beständigkeit. Beide<br />
Pulverschichten s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den relevanten Eigenschaften optimal<br />
aufe<strong>in</strong>ander abgestimmt, <strong>in</strong>sbesondere h<strong>in</strong>sichtlich der<br />
Zwischenhaftung von Deck- und Grundpulver.<br />
Mit den am Markt verfügbaren Pulverlacken waren die<br />
gewünschten Eigenschaften nicht zu erzielen. Deshalb hat<br />
AUMA zusammen mit dem Lackhersteller e<strong>in</strong>e eigene Lackrezeptur<br />
entwickelt. Durch die Beimischung von Metallic-<br />
Partikeln zum Decklackpulver wird die Hochwertigkeit der<br />
Beschichtung auch optisch untermauert.<br />
Der ganze Prozess (Bild 1) ist hochautomatisiert, so dass<br />
e<strong>in</strong>e konstante Beschichtungsqualität erzielt wird. Pr<strong>in</strong>zipiell<br />
können die Geräte abschließend mit e<strong>in</strong>em Nasslack<br />
überlackiert werden. Dies wird dann durchgeführt, wenn<br />
die Geräte <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Sonderfarbton bestellt wurden oder<br />
wenn die Gerätespezifikation e<strong>in</strong>e höhere M<strong>in</strong>destschicht-<br />
11-12 / 2013 61
FACHBERICHT KORROSIONSSCHUTZ<br />
Bild 2: Die geschnittene<br />
Dichtung [1] verdeutlicht<br />
es: Die Beschichtung<br />
reicht bis h<strong>in</strong>ter die<br />
Dichtkante [2]<br />
Bild 3: Schichtaufbau: [1] Gehäuse (Alum<strong>in</strong>ium oder Grauguss),<br />
[2] Konversionsschicht aus Oxsilan, [3] Epoxidharzpulver (70 µm),<br />
[4] Polyurethan-Pulver (70 µm)<br />
Bild 4: Deckel nach 2.520 Stunden <strong>in</strong> der<br />
Salzsprühnebelkammer. Am zugefügten<br />
Riss zeigt sich ke<strong>in</strong> Korrosionsansatz<br />
dicke vorschreibt. Aus Korrosionsschutzgründen ist dies<br />
nicht erforderlich, denn trotz der vergleichsweise zarten<br />
Beschichtungsdicke von 140 µm (Bild 3) erfüllt die Pulverbeschichtung<br />
die Anforderungen der Korrosivitätskategorie<br />
C5-M mit der Schutzdauer lang, selbst nach den verschärften<br />
Testvorschriften der ISO 20 340.<br />
FAZIT<br />
Das beschriebene Korrosionsschutzsystem wurde 2.520<br />
Stunden dem Salzsprühnebeltest unterzogen. Danach<br />
wurde dieser abgebrochen, nachdem sich auch dann noch<br />
ke<strong>in</strong>e signifikanten Korrosionsschäden feststellen ließen<br />
(Bild 4). Damit wurde die <strong>in</strong> allen Normen geforderte Dauer<br />
weit übertroffen. Im Zuge der Tests wurde der komplette<br />
Prüfzyklus nach ISO 20 340 durchgeführt und zertifiziert.<br />
Derzeit gibt es im Bereich der Stellantriebe ke<strong>in</strong>en vergleichbar<br />
wirksamen Korrosionsschutz. E<strong>in</strong> solches Korrosionsschutzsystem<br />
lässt sich nicht über Nacht etablieren.<br />
Es s<strong>in</strong>d hohe Investitionen und e<strong>in</strong> hoher Initialaufwand zu<br />
erbr<strong>in</strong>gen. Das lohnt sich aber, denn die Bereitschaft der<br />
Anlagenbetreiber, durch Korrosion verursachte Anlagenstillstände<br />
h<strong>in</strong>zunehmen, s<strong>in</strong>kt und wird weiter s<strong>in</strong>ken. Mit<br />
der e<strong>in</strong>zigartigen zweischichtigen Pulverbeschichtung bietet<br />
AUMA e<strong>in</strong>en hohen Kundennutzen und verfügt über e<strong>in</strong>en<br />
klaren Wettbewerbsvorteil.<br />
WEITERE MASSNAHMEN<br />
Der AUMA Korrosionsschutz besteht nicht nur aus der Pulverbeschichtung.<br />
Nicht alle außenliegenden Elemente lassen<br />
sich mit diesem Verfahren behandeln. Bedien- und Anzeigeelemente,<br />
Typenschilder, Schrauben oder die Handradwelle<br />
werden aus geeigneten Materialien hergestellt, beispielsweise<br />
aus nicht rostendem Stahl oder mit anderen Beschichtungen<br />
geschützt. Unter bestimmten Bed<strong>in</strong>gungen kann auch<br />
Korrosion an den Kontaktstellen zweier unterschiedlicher,<br />
an sich korrosionsbeständiger Bauteile entstehen. Um diese<br />
sogenannte Kontaktkorrosion zu vermeiden, wurden zeitaufwändigen<br />
Tests durchgeführt und so konnten ungünstige<br />
Materialpaarungen ausgeschlossen werden.<br />
Dipl.-Ing. MICHAEL HERBSTRITT<br />
AUMA Riester GmbH & Co. KG, Müllheim<br />
Tel.: +49 7631 809-0<br />
E-Mail: michael.herbstritt@auma.com<br />
Dipl.-Ing. GERT WETZEL<br />
AUMA Riester GmbH & Co. KG, Müllheim<br />
Tel.: +49 7631 809-0<br />
E-Mail: gert.wetzel@auma.com<br />
ANDREAS BAUMGART<br />
AUMA Riester GmbH & Co. KG, Müllheim<br />
Tel.: +49 7631 809-0<br />
E-Mail: andreas.baumgart@auma.com<br />
Dipl.-Ing. DIETMAR ISELE<br />
Hochschule Offenburg<br />
Fakultät Masch<strong>in</strong>enbau und Verfahrenstechnik<br />
E-Mail: dietmar.isele@hs-offenburg.de<br />
AUTOREN<br />
62 11-12 / 2013
KORROSIONSSCHUTZ FACHBERICHT<br />
Korrosion gummierter Bauteile mit<br />
thermischer Isolierung verzögern<br />
Rohrleitungssysteme und Apparate <strong>in</strong> der chemischen Industrie müssen nicht selten regelrechte Schwerstarbeit verrichten.<br />
Denn die aggressiven Medien <strong>in</strong>itiieren bei den meist hohen Betriebstemperaturen Korrosionsprozesse an der Innenwand<br />
der Metallrohre. Deshalb s<strong>in</strong>d diese vielfach mit Gummierungen auf Kautschukbasis ausgekleidet. Langfristig schützen<br />
diese jedoch nur vor Korrosion, wenn das Temperaturgefälle zur Umgebung ger<strong>in</strong>g ist. Das zeigen Experimente von<br />
TÜV SÜD, die erstmals konkrete H<strong>in</strong>weise zur bedarfsgerechten, thermischen Außenisolierung geben.<br />
Die Gummischichten, mit denen Rohrleitungen, Behälter<br />
und Apparate vieler Chemieanlagen von <strong>in</strong>nen ausgekleidet<br />
s<strong>in</strong>d, stellen e<strong>in</strong>e Barriere zwischen dem Betriebsmedium<br />
und der Rohr<strong>in</strong>nenseite dar und schützen so vor Korrosion.<br />
Mit der Zeit dr<strong>in</strong>gen jedoch Wassermoleküle <strong>in</strong> die Zwischenräume<br />
der Polymerketten e<strong>in</strong>. Allmählich diffundieren<br />
sie durch die Gummierung und <strong>in</strong>itiieren Korrosionsprozesse<br />
am Trägermaterial, wenn e<strong>in</strong>e kritische Wassermenge die<br />
Schutzschicht passiert hat. Sie quillt auf und löst sich dann<br />
unter Blasenbildung ab. Das Korrosionsschutzsystem hat<br />
das Ende se<strong>in</strong>er Lebensdauer erreicht.<br />
Diese Prozesse laufen wesentlich schneller ab, wenn zwischen<br />
dem Betriebsmedium und der Umgebung (z. B.<br />
Raumluft, Freiland, Erdreich) hohe Temperaturunterschiede<br />
herrschen. Das wussten schon die Verantwortlichen der<br />
großen Chemieunternehmen <strong>in</strong> den 1950er Jahren. In den<br />
unternehmenseigenen Konstruktionsleitl<strong>in</strong>ien schrieben sie<br />
die thermische Isolierung gummierter Bauteile und Komponenten<br />
fest. Denn langjährige Erfahrungen aus Betrieb und<br />
Instandhaltung zeigten, dass sich die Schutzschichten immer<br />
wieder im Bereich von Wärmebrücken frühzeitig ablösten<br />
– noch bevor die anvisierte Lebensdauer erreicht werden<br />
konnte (Bild 1). Aufwändige und kosten<strong>in</strong>tensive Ausbesserungen<br />
waren dann die Folge, weil das Trägermaterial des<br />
Bauteils bereits korrodiert und <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Funktion bee<strong>in</strong>trächtigt<br />
war. Doch das Wissen um die Zusammenhänge ist <strong>in</strong><br />
den vergangenen Jahrzehnten zunehmend <strong>in</strong> Vergessenheit<br />
geraten. Aus Kostengründen wurde deshalb vielfach auf<br />
die thermische Isolierung verzichtet, was beschleunigten<br />
Korrosionsprozessen den Weg ebnete.<br />
HOHE TEMPERATURDIFFERENZEN SIND KRITISCH<br />
Die Ursache liegt <strong>in</strong> den Gesetzen der Thermodynamik,<br />
denn Moleküle bewegen sich immer entlang ihres Konzentrationsgradienten.<br />
In diesem Fall ist die Konzentration<br />
im Betriebsmedium hoch und anfangs liegt sie unter der<br />
Schutzschicht bei null. Weil die Polymerketten der Kautschukgummierung<br />
ke<strong>in</strong>eswegs e<strong>in</strong> unpassierbares H<strong>in</strong>dernis<br />
darstellen – auf mikroskopischer Ebene weisen die verzweigten<br />
Netzwerke w<strong>in</strong>zige, verbundene Hohlräume auf, die<br />
groß genug für kle<strong>in</strong>ere Moleküle s<strong>in</strong>d – ist es lediglich e<strong>in</strong>e<br />
Frage der Zeit, wann e<strong>in</strong>e kritische Stoffmenge die Schutzschicht<br />
passiert hat. Aus den thermodynamischen Pr<strong>in</strong>zipien<br />
folgt außerdem, dass die Diffusionsgeschw<strong>in</strong>digkeit abhängig<br />
von dem Temperaturgefälle ist – ähnlich e<strong>in</strong>em Ste<strong>in</strong>,<br />
der an e<strong>in</strong>em Abhang <strong>in</strong>s Rollen kommt (Bild 2). In der<br />
chemischen Industrie können hier leicht Temperaturunterschiede<br />
von über 30 °C herrschen, wenn die Rohrleitungen<br />
für heiße Medien im Freien verlegt s<strong>in</strong>d.<br />
Bis heute ist der Diffusionsprozess <strong>in</strong> Abhängigkeit der<br />
Temperaturdifferenz jedoch nicht h<strong>in</strong>reichend untersucht<br />
worden. Auch die damaligen Konstruktionsleitl<strong>in</strong>ien der<br />
Chemieunternehmen enthalten ke<strong>in</strong>e konkreten Angaben<br />
Bild 1: Bei hohen Temperaturgefällen zwischen Innenraum und<br />
Außenluft diffundiert Wasser schneller durch die Gummierung.<br />
Das <strong>in</strong>itiiert Korrosionsprozesse am Trägermaterial, so dass sich<br />
die Gummierung löst und Blasen bildet<br />
Bild 2: Je höher die Temperaturdifferenz zwischen Betriebsmedium<br />
und Umgebungsluft ist, desto schneller diffundieren<br />
die Moleküle durch die Gummierung<br />
11-12 | 2013 63
FACHBERICHT KORROSIONSSCHUTZ<br />
zu Geschw<strong>in</strong>digkeit, Zeitdauer, weiteren E<strong>in</strong>flussparametern<br />
und erforderlichen Schichtdicken der Gummierung respektive<br />
Isolierung. Am TÜV SÜD-Institut für Kunststoffe haben<br />
die Ingenieure deshalb drei verschiedene Kautschuksorten<br />
analysiert und die Wasseraufnahme bei unterschiedlichen<br />
Temperaturgradienten ermittelt. Die Untersuchungsergebnisse<br />
wurden Ende November 2012 bei der zweiten Fachtagung<br />
„Schwerer Korrosionsschutz“ <strong>in</strong> München präsentiert.<br />
Sie quantifizieren erstmals die allgeme<strong>in</strong>en Erfahrungswerte<br />
der chemischen Industrie.<br />
a)<br />
b)<br />
Bild 3: Die Untersuchung wurde mit e<strong>in</strong>er modifizierten Atlaszelle<br />
durchgeführt. Hierbei trennen gummierte Platten die<br />
drei Kammern, die unterschiedlich temperiert werden. Nach<br />
dem Experiment wird der relative Wassergehalt der e<strong>in</strong>zelnen<br />
Gummischichten Abb.4a: bestimmt Chlorbutyl-Kautschuk Flüssigphase<br />
(∆T = 42°C) <br />
Wassergehalt [%]<br />
Wassergehalt [%]<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4<br />
Gummidicke [mm]<br />
Abb. 4b Chlorbutyl-Kautschuk Flüssigphase<br />
nach 66 Tagen<br />
(∆T<br />
nach<br />
=<br />
33<br />
2°C)<br />
Tagen<br />
<br />
nach 16 Tagen<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4<br />
Wassergehalt [%]<br />
Gummidicke [mm]<br />
nach 66 Tagen nach 33 Tagen nach 16 Tagen<br />
Bild 4: Mit der Zeit nimmt die Gummierung medien seitig<br />
immer mehr Wasser auf. a) Nach 66 Tagen wird bei hohen<br />
Temperaturdifferenzen am Bauteil e<strong>in</strong> Wa sser gehalt von<br />
rund 7 %, b) bei niedrigen Temperaturdifferenzen wird e<strong>in</strong><br />
Wassergehalt von Abb. rund 5: 3 Chlorbutyl-Kautschuk<br />
% erreicht<br />
Wassergehalt nach 66 Tagen (Schicht 1; 0-1 mm) <br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
0 10 20 30 40<br />
Temperaturdifferenz ∆T [°C]<br />
Flüssigphase<br />
Gasphase<br />
Bild 5: Am ger<strong>in</strong>gsten ist der Wassergehalt der tiefsten<br />
Gummischicht nach 66 Tagen bei e<strong>in</strong>er Temperaturdifferenz<br />
von 0 °C bis 2 °C<br />
WASSERAUFNAHME BEI DREI KAUTSCHUKSORTEN<br />
QUANTIFIZIERT<br />
Bei den Experimenten haben die Kunststoffexperten von<br />
TÜV SÜD fünf Temperaturgradienten im Bereich von 0 bis<br />
42 °C zu Grunde gelegt und das Diffusionsverhalten von<br />
Wasser bei Gummierungen aus Brombutyl-, Chlorbutyl- und<br />
Re<strong>in</strong>butylkautschuk analysiert. Dazu wurden die 3,5 mm<br />
dicken Proben bis zu 66 Tage <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er modifizierten Atlaszelle<br />
<strong>in</strong>stalliert und konstant mit 80 °C warmem Wasser<br />
beaufschlagt (Bild 3). Die Testkammer wurde nur halb<br />
gefüllt, so dass die E<strong>in</strong>wirkungen der Flüssigphase und der<br />
Dampfphase unterschieden werden konnten. Nach Ablauf<br />
der Testzeiten wurden die Proben <strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelne, dünne Schichten<br />
geschnitten. Von diesen wurde dann der prozentuale<br />
Wassergehalt durch Rücktrocknung bestimmt.<br />
Die Ergebnisse s<strong>in</strong>d hier exemplarisch für die Experimente<br />
mit Chlorbutylkautschuk dargestellt. Bild 4 zeigt die Wasseraufnahme<br />
im Verlauf der Zeit. Im Vergleich zu ger<strong>in</strong>gen<br />
Temperaturdifferenzen von 2 °C ist die Wasseraufnahme bei<br />
größeren Unterschieden von 42 °C medienseitig erhöht. An<br />
der Grenzschicht beträgt der prozentuale Wassergehalt nach<br />
66 Tagen nahezu 40 %. Gleichzeitig dr<strong>in</strong>gen die Wassermoleküle<br />
schneller <strong>in</strong> tiefere Schichten vor. Am Trägermaterial<br />
steigt der Wassergehalt auf etwa 7 %. Das ist rund doppelt<br />
so hoch wie bei e<strong>in</strong>em ger<strong>in</strong>gen Temperaturgefälle von<br />
2 °C. Hier wird e<strong>in</strong> Wasseranteil von etwa 3 % gemessen.<br />
TEMPERATURUNTERSCHIED AUF 2 °C BEGRENZEN<br />
Doch schon bei e<strong>in</strong>er Temperaturdifferenz von etwa 20 °C<br />
ist die Wasseraufnahme maximal und der Diffusionsprozess<br />
läuft mit größtmöglicher Geschw<strong>in</strong>digkeit ab. Das geht<br />
aus Bild 5 hervor. Das Diagramm zeigt den Wassergehalt<br />
der tiefsten Gummischicht nach 66 Tagen. S<strong>in</strong>d die<br />
Temperaturdifferenzen ger<strong>in</strong>g, enthalten die Schichten am<br />
Trägermaterial rund 3 % Wasser. Die Wassermenge am<br />
Trägermaterial nimmt mit größeren Temperaturunterschieden<br />
kont<strong>in</strong>uierlich zu, bis das Maximum bei e<strong>in</strong>er Differenz<br />
von ca. 20 °C erreicht wird. Größere Unterschiede bewirken<br />
ke<strong>in</strong>e beschleunigte Diffusion mehr. Dabei wirken Flüssigkeits-<br />
und Dampfphase unterschiedlich auf Chlorbutylkautschuk<br />
e<strong>in</strong>, denn der Wassergehalt ist <strong>in</strong> der Flüssigphase<br />
leicht erhöht (6,5 % zu 5 %). Dieser Effekt konnte bei den<br />
anderen Gummiqualitäten nicht beobachtet werden.<br />
Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die Temperatur differenz<br />
zwischen Betriebsmedium und Außenluft auf maximal 2 °C<br />
begrenzt werden muss, um die optimale Lebensdauer der<br />
64 11-12 | 2013
KORROSIONSSCHUTZ FACHBERICHT<br />
Innengummierung zu erreichen. Das kann <strong>in</strong> der Praxis nur<br />
mit e<strong>in</strong>er Isolierung des Bauteils erreicht werden. Doch wie<br />
viel Isoliermaterial ist notwendig, um diese enge Grenze<br />
e<strong>in</strong>zuhalten? Die Ingenieure von TÜV SÜD haben exemplarisch<br />
die erforderliche Schichtdicke für Ste<strong>in</strong>wolle berechnet,<br />
die für den Anlagenbetrieb mit 80 °C heißem Medium<br />
notwendig ist.<br />
In e<strong>in</strong>em Szenario wird die Anlage bei Raumtemperatur<br />
betrieben (T 1<br />
= 20 °C). In e<strong>in</strong>em weiteren Freilandszenario<br />
s<strong>in</strong>d die Anlagenkomponenten W<strong>in</strong>d und Frost ausgesetzt<br />
(T 2<br />
= -10 °C). Im ersten Fall müssen die Anlagenkomponenten<br />
mit e<strong>in</strong>er ca. 50 mm starken Schicht aus<br />
Ste<strong>in</strong>wolle isoliert werden, um das Temperaturgefälle auf<br />
2 °C zu begrenzen. Im zweiten Fall ist e<strong>in</strong>e 100 mm starke<br />
Isolierschicht erforderlich, um die Wasseraufnahme der<br />
Gummierung zu m<strong>in</strong>imieren. So kann die Lebensdauer<br />
des Korrosionsschutzes wesentlich verlängert werden: bei<br />
Betrieb <strong>in</strong> temperierten Räumen um ca. 50 % und bei<br />
Betrieb im Freien um ca. 100 %.<br />
Es lohnt deshalb, die belasteten Bauteile optimal zu isolieren.<br />
Die anfänglichen Mehrkosten amortisieren sich durch<br />
wesentlich längere Betriebszeiten. Denn die verfrühte<br />
Instandsetzung bzw. der Austausch der Gummierung und<br />
Rohre ist mit erheblichem Aufwand, hohen Kosten und<br />
langen Betriebsausfällen verbunden. Die thermische Isolierung<br />
der Rohre h<strong>in</strong>gegen ist e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>fache, praktikable und<br />
verhältnismäßig günstige Maßnahme, um das Maximum an<br />
Lebensdauer, Sicherheit und Kosteneffizienz herauszuholen.<br />
HELMUT ZIMMERMANN<br />
TÜV SÜD Industrie Service GmbH,<br />
München, Institut für Kunststoffe<br />
Tel: +49 89 5791-3221<br />
E-Mail: kunststoffe@tuev-sued.de<br />
AUTOR<br />
Werden sie HDD-experte<br />
www.vulkan-verlag.de<br />
Jetzt bestellen!<br />
Praxishandbuch HDD-felsbohrtechnik<br />
Die Technologie des „Horizontal Directional Drill<strong>in</strong>g“ war vor wenigen Jahren<br />
noch kaum bekannt. Mittlerweile hat sich die HDD-Felsbohrtechnologie zu<br />
e<strong>in</strong>em bedeutenden Praxisbereich entwickelt und nimmt e<strong>in</strong>en festen Platz<br />
<strong>in</strong> der Bohr- und Bautechnik e<strong>in</strong>.<br />
Aus diesem Grund ist es wichtig, den Stand dieser Bohrtechnologie<br />
<strong>in</strong> ihren Grundlagen, masch<strong>in</strong>enbautechnischen Funktionen<br />
sowie Anwendungen zu beschreiben und anhand zahlreicher<br />
Nutzungsbeispiele zu erläutern. Dieses Handbuch ist aus der<br />
Praxis entstanden und eröffnet den E<strong>in</strong>stieg <strong>in</strong> die vielfältigen<br />
E<strong>in</strong>satzmöglichkeiten des HDDBohrens. Dabei werden neue,<br />
bisher für undenkbar gehaltene Verfahren aufgezeigt. Zielgruppen<br />
für dieses Grundlagenwerk s<strong>in</strong>d BohrIngenieure<br />
und BohrTechniker, Baufachleute <strong>in</strong> der HDDTechnologie<br />
und ambitionierte Nachwuchskräfte. Es hilft Ingenieurbüros,<br />
Versorgungsfi rmen und Entsorgungsbetrieben, Kraftwerksplanern<br />
und Baubehörden bei Planungen, Trassenkonzeptionen,<br />
Regionalplanungskonzepten für neue Leitungskorridore und<br />
Versorgungswege sowie energetische Erschließungen.<br />
H.J. Bayer und M. Reich<br />
1. Auflage 2013,<br />
216 Seiten, Broschur<br />
DIN A5 <strong>in</strong> Farbe<br />
Wissen für die<br />
11-12 | 2013 65<br />
Zukunft
FACHBERICHT WASSERVERSORGUNG<br />
Interdiszipl<strong>in</strong>äre Planung von Netzspülungen<br />
unter Berücksichtigung der<br />
biologischen Tr<strong>in</strong>kwasserqualität<br />
Aus den Praxiserfahrungen hat sich gezeigt, dass Instandhaltung und Pflegemaßnahmen bei den Betreibern von<br />
Tr<strong>in</strong>kwasserverteilungssystemen nach unterschiedlichen Kriterien und Schwerpunkten organisiert werden. Hierbei spielen<br />
strukturelle sowie <strong>in</strong>dividuelle betriebliche Bed<strong>in</strong>gungen e<strong>in</strong>e übergeordnete Rolle.<br />
1. ZIEL DER TRINKWASSERVERTEILUNG:<br />
WIRTSCHAFTLICHER BETRIEB DES VERTEILUNGS-<br />
SYSTEMS UNTER EINHALTUNG DER TRINKWAS-<br />
SERQUALITÄT BIS ZUM ENDVERBRAUCHER<br />
Je nach Wasserqualität und Wasser<strong>in</strong>haltstoffen haben die<br />
Wasserversorgungsunternehmen verschiedene Aufgaben für<br />
die Sicherstellung der Tr<strong>in</strong>kwasserversorgung zu lösen. Daher<br />
kommt auch dem Bereich der Rohrnetzpflege unterschiedliche<br />
Bedeutung zu. Zum e<strong>in</strong>en werden die Anforderungen an<br />
Pflegemaßnahmen von Regelwerken umgesetzt und zum<br />
anderen nach Auffälligkeiten z. B. Kundenbeschwerden wegen<br />
Braunwasser oder Grenzwertüberschreitung bei der Mikrobiologie<br />
gehandelt. Um die <strong>in</strong>dividuellen Gegebenheiten <strong>in</strong> den<br />
verschiedenen Versorgungssystemen zu berücksichtigen ist<br />
der <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>äre Ansatz für e<strong>in</strong>e wirtschaftlich optimierte<br />
Organisation von Pflegemaßnahmen entstanden. Dabei hat<br />
die Wasserqualität sowohl bei der E<strong>in</strong>speisung als auch bei<br />
der Verteilung besonders mit Blick zur Biologie e<strong>in</strong>e übergeordnete<br />
Bedeutung.<br />
Bei dem <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>ären Ansatz für die Organisation von<br />
Pflegemaßnahmen rücken die Zustände der Verteilungssysteme,<br />
sowie die Auswahl der möglichen Spülverfahren themenübergreifend<br />
<strong>in</strong> den Fokus.<br />
THESE 1: Die E<strong>in</strong>speisung e<strong>in</strong>es biologisch stabilen Tr<strong>in</strong>kwassers<br />
hat Auswirkungen auf den Aufwand der Rohrnetzpflege.<br />
2. BETRACHTUNG UND VERSTEHEN DER WASSER-<br />
VERTEILUNG ALS GESAMTSYSTEM<br />
Für e<strong>in</strong>e Auswahl e<strong>in</strong>er Komb<strong>in</strong>ation von Maßnahmen ist es<br />
wichtig, den Zustand des Leitungssystems möglichst gut zu<br />
kennen, um somit e<strong>in</strong>e effektive Organisation <strong>in</strong> Bezug zum<br />
Aufwand als auch zur Wirtschaftlichkeit zu erzielen. Der Leitungszustand<br />
ist von mehreren E<strong>in</strong>flüssen abhängig:<br />
»»<br />
E<strong>in</strong>trag von Partikeln und organischen Wasser<strong>in</strong>haltsstoffen<br />
führt zur<br />
- Erhöhung der biologischen Masse mit Bildung<br />
von Biofilmen an den Rohrwandungen,<br />
- Ablagerungen auf der Rohrsohle,<br />
- Erhöhung des Aufkeimungspotentials /<br />
Wiederverkeimungspotentials,<br />
- Bildung von Nahrungsgrundlagen für<br />
Kle<strong>in</strong>stlebewesen.<br />
»»<br />
Der E<strong>in</strong>trag von Organismen ist unvermeidbar und kann<br />
bei ausreichendem Nahrungsangebot zur Vermehrung<br />
führen.<br />
»»<br />
Hydraulische Bed<strong>in</strong>gungen def<strong>in</strong>ieren die Ablagerungsdicke<br />
der lam<strong>in</strong>aren Grenzschicht an der Rohrwandung.<br />
»»<br />
Durchfluss-Spitzen führen zu Verlagerungen der mobilisierbaren<br />
Ablagerungen im Netz.<br />
»»<br />
Störungen durch Baumaßnahmen, Rohrbrüche etc. nehmen<br />
E<strong>in</strong>fluss auf den Betriebszustand.<br />
Daher ist es bei der Betrachtung des Gesamtsystems wichtig<br />
sowohl die E<strong>in</strong>flüsse bei der E<strong>in</strong>speisung als auch bei der Speicherung<br />
und der Verteilung zu kennen.<br />
THESE 2: Die Rohrnetzpflege beg<strong>in</strong>nt im Wasserwerk.<br />
3. ERMITTLUNG DES ZUSTANDS DES<br />
VERTEILUNGSSYSTEMS<br />
Betrachtung der Wasserqualität bei der E<strong>in</strong>speisung<br />
Hier können Analysen der Tr<strong>in</strong>kwasseruntersuchungen und<br />
bei Bedarf ergänzende Zusatzuntersuchungen Aufschluss auf<br />
die biologische Stabilität des Wassers bei der Abgabe <strong>in</strong> das<br />
Verteilungssystem geben. Damit ist nicht die E<strong>in</strong>haltung von<br />
Grenzwerten bzgl. chemischer und mikrobiologischer Parameter<br />
ausschlaggebend, sondern die spezielle Betrachtung des<br />
E<strong>in</strong>trags von Partikeln und Wasser<strong>in</strong>haltstoffen mit E<strong>in</strong>fluss<br />
auf die biologische Eigenschaft des Wassers und das Ablagerungsverhalten<br />
bei der weiteren Verteilung.<br />
Hierbei können z. B. noch Nachreaktionen durch e<strong>in</strong>e nicht<br />
vollständig abgeschlossene Aufbereitung e<strong>in</strong>e Rolle spielen.<br />
Des Weiteren geben verschiedene Parameter Aufschluss auf<br />
Nahrung für Organismen auch <strong>in</strong> Form von leicht verfügbarem,<br />
assimilierbaren organischem Kohlenstoff (AOC).<br />
Dieser wiederum hat Auswirkungen auf die Bildung von Biofilmen<br />
an den Rohrwandungen und kann bei starken Schwankungen<br />
nach Untersuchungen des DVGW zur Steigerung<br />
des Aufkeimungspotentials (AKP) des Tr<strong>in</strong>kwassers führen<br />
[1] (Quelle: Abschlussbericht DVGW-Forschungsvorhaben<br />
W4/01/05 – Juli 2009).<br />
Betrachtung der Speicherung<br />
Bei der Entleerung des Tr<strong>in</strong>kwasserspeichers z. B. vor der Re<strong>in</strong>igung<br />
können über Abklatschproben an der Behälterwand<br />
66 11-12 | 2013
WASSERVERSORGUNG FACHBERICHT<br />
oder Entnahme von Proben aus<br />
den sedimentierten Ablagerungen<br />
am Behälterboden H<strong>in</strong>weise<br />
auf die Ausprägung von Biofilmen<br />
und Vorkommen von Organismen<br />
gefunden werden. Dies ist e<strong>in</strong>e<br />
verhältnismäßig günstige und<br />
e<strong>in</strong>fache Methode zur Ergänzung<br />
der Aussagen zur biologischen<br />
Tr<strong>in</strong>kwasserqualität.<br />
Betrachtung des<br />
Verteilungsnetzes<br />
Die Untersuchungen zum Zustand<br />
der Verteilungsleitungen gestalten<br />
sich aufgrund der Zugänglichkeit<br />
gegenüber Auswertungen von<br />
Wasserwerksanalysen oder Behälteruntersuchungen<br />
etwas schwieriger.<br />
Da hierbei die Biofilme und<br />
Ablagerungen e<strong>in</strong>e übergeordnete<br />
Rolle spielen s<strong>in</strong>d die direkten<br />
Untersuchungsmöglichkeiten ohne<br />
größere E<strong>in</strong>griffe <strong>in</strong> das Rohrleitungssystem kaum möglich.<br />
Daher wird für die Zustandsbetrachtung über <strong>in</strong>direkte<br />
Untersuchungsmethoden z. B. durch Hydrantenuntersuchungen<br />
versucht, e<strong>in</strong>e möglichst repräsentative Aussage<br />
zum Leitungszustand zu erhalten. Für Aussagen zum Ablagerungszustand<br />
im Allgeme<strong>in</strong>en ist die Trübungsmessung<br />
e<strong>in</strong>e Möglichkeit, die auch für zustandsoptimierte Spülplanungen<br />
herangezogen wird.<br />
Als Ergänzung für Aussagen zur biologischen Tr<strong>in</strong>kwasserqualität<br />
ist <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Kooperations-Forschungsprojekt [2] von<br />
2010-2012 e<strong>in</strong> neues Probenahme- und Messsystem für Invertebraten<br />
entwickelt worden. Diese Untersuchungsmethode<br />
be<strong>in</strong>haltet zu Aussagen über Organismen (Invertebraten) h<strong>in</strong>aus<br />
noch weitere Möglichkeiten <strong>in</strong> Bezug zum Leitungszustand<br />
mit Blick auf die biologische Tr<strong>in</strong>kwasserqualität.<br />
Die Schwerpunkte und Möglichkeiten bei der Planung von<br />
Pflegemaßnahmen dieser Untersuchungsmethode werden<br />
im Folgenden detaillierter vorgestellt.<br />
Bild 1: Gesamtapparatur: NDHD-S2-Filter (Aus Scheideler et al., 2013 [5])<br />
4. NEUE UNTERSUCHUNGSMETHODE MIT<br />
BERÜCKSICHTIGUNG DER BIOLOGISCHEN<br />
TRINKWASSERQUALITÄT<br />
Zur Beurteilung der biologischen Tr<strong>in</strong>kwasserqualität <strong>in</strong><br />
Verteilungssystemen ist es erforderlich diese regelmäßig zu<br />
untersuchen. Es hat sich gezeigt, dass die Besiedlung durch<br />
Invertebraten (wirbellose Organismen) e<strong>in</strong>e Folge von ausreichendem<br />
Nahrungsangebot und guten strömungstechnischen<br />
Bed<strong>in</strong>gungen s<strong>in</strong>d, die punktuell oder auch flächendeckend<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Verteilungssystem vorhanden s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong> E<strong>in</strong>trag von<br />
Organismen lässt sich nicht grundsätzlich vermeiden, so dass<br />
diese für Aussagen zur biologischen Tr<strong>in</strong>kwasserqualität erfasst<br />
werden müssen.<br />
In der Tr<strong>in</strong>kwasserverordnung wird das Vorkommen von Invertebraten<br />
nicht direkt geregelt. Es gab zum Zeitpunkt des Forschungsprojektes<br />
noch ke<strong>in</strong>en festgelegten Grenzwert für<br />
Invertebraten im Tr<strong>in</strong>kwasser. Das Merkblatt W 271 „soll dem<br />
Betriebspersonal und der Betriebsleitung H<strong>in</strong>weise über das<br />
Vorkommen von tierischen Organismen <strong>in</strong> Wasserversorgungsanlagen<br />
geben“ [3] (DVGW-Regelwerk, Merkblatt W 271,<br />
Ausgabe 1997). Weiterh<strong>in</strong> heißt es hier<strong>in</strong>: „ Die Überprüfung<br />
und gegebenenfalls Verr<strong>in</strong>gerung des Vorkommens tierischer<br />
Organismen <strong>in</strong> Wasserversorgungsanlagen ist Bestandteil der<br />
verantwortungsbewussten Selbstüberwachung e<strong>in</strong>es Wasserversorgungs-Unternehmens“.<br />
In Kapitel 2 Probenahme wird<br />
empfohlen: „ Es ist zweckmäßig, die aus den Verteilungsanlagen<br />
ausgespülten sedimentierbaren Stoffe von Zeit zu Zeit<br />
e<strong>in</strong>er mikroskopischen Untersuchung zu unterziehen, um e<strong>in</strong>e<br />
Besiedlung des Rohnetzes mit Mikroorganismen und anderen<br />
Kle<strong>in</strong>lebewesen frühzeitig zu erkennen“.<br />
Bisher s<strong>in</strong>d kaum Untersuchungsmethoden für diese Anwendung<br />
standardisiert. Auch verfügbare Probenahmeapparaturen<br />
s<strong>in</strong>d bislang nicht genormt. Die Entwicklung e<strong>in</strong>er Probenahmeapparatur<br />
mit entsprechender Untersuchungsmethode und<br />
Ergebnisbewertung stand im Fokus e<strong>in</strong>es <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>ären<br />
Forschungsprojektes der TU Berl<strong>in</strong>, TU Dresden, der Firmen<br />
Aqualytis und Scheideler Verfahrenstechnik GmbH.<br />
Um die Aussagen für e<strong>in</strong>e Gesamtbetrachtung des Zustands<br />
e<strong>in</strong>es Tr<strong>in</strong>kwasserverteilungsnetzes zu vervollständigen,<br />
haben auch Untersuchungen auf den Ablagerungszustand<br />
mit Schwerpunkt auf Nahrungsbestandteile für Organismen<br />
stattgefunden. Das Kooperations-Forschungsprojekt wurde<br />
von 2010-2012 durchgeführt, vom BMWi gefördert und be<strong>in</strong>haltete<br />
folgende Teilprojekte (TP) [4]:<br />
»»<br />
TP1: Entwicklung e<strong>in</strong>es mobilen Probenahme-<br />
und Messsytems für Invertebraten <strong>in</strong><br />
Tr<strong>in</strong>kwasserverteilungssystemen<br />
»»<br />
TP2: Partikuläre organische Stoffe als Nahrungsquelle für<br />
Invertebraten – Modellierung der Ablagerung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
11-12 | 2013 67
FACHBERICHT WASSERVERSORGUNG<br />
Tr<strong>in</strong>kwasserverteilungssystem<br />
»»<br />
TP3: Repräsentative Beprobung von<br />
Tr<strong>in</strong>kwasserverteilungssystemen<br />
»»<br />
TP4: Kotpellets der Wasserassel als Indikator für die<br />
Besiedlung von Tr<strong>in</strong>kwasser-Versorgungssystemen<br />
»»<br />
TP5: Multimetrischer Bewertungs<strong>in</strong>dex für Invertebraten<br />
<strong>in</strong> Tr<strong>in</strong>kwasserverteilungssystemen<br />
Entwicklung e<strong>in</strong>es mobilen Probenahmeund<br />
Messsystems für Invertebraten <strong>in</strong><br />
Tr<strong>in</strong>kwasserverteilungssystemen<br />
Im Ergebnis wurde e<strong>in</strong>e Gesamtapparatur, der NDHD-<br />
S2-Filter (Nieder-Druck-Hoch-Durchsatz, Baureihe S2)<br />
entwickelt.<br />
Der NDHD-S2 vere<strong>in</strong>t die drucklose Filtrierung großer<br />
Durchflussmengen bei zwei verschiedenen Maschenweiten<br />
parallel.<br />
Dazu wurde e<strong>in</strong> Stromteiler entwickelt, der nicht nur die<br />
Durchflussmengen exakt aufteilt, sondern vor allem die<br />
dar<strong>in</strong> mittransportierten Partikel, die den eigentlichen<br />
Gegenstand der Untersuchung darstellen. Der NDHD-S2<br />
arbeitet mit e<strong>in</strong>em Teilstrom von 9/10 des Gesamtstroms,<br />
der über e<strong>in</strong>en 100 µm-Filter (Bild 2) geleitet wird. Der<br />
verbleibende 1/10-Teilstrom wird über 25 µm filtriert<br />
(Bild 3).<br />
Die Eignung der Filtermaterialien für diesen Untersuchungszweck<br />
wurde aufwändig getestet. Für e<strong>in</strong>e rückstandsfreie<br />
Probenahme wurden die Filter so konstruiert,<br />
dass zum e<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>e schonende Anströmung im Zulauf<br />
der Filter erfolgt, als auch bei der Re<strong>in</strong>igung das Filtrat<br />
<strong>in</strong> dem kegelförmigen Filter zum Entnahmestutzen aufkonzentriert<br />
wird.<br />
Um die Probengefäße für den Weitertransport <strong>in</strong>s Labor<br />
kle<strong>in</strong> zu halten, wurde zur Reduzierung der Wassermenge<br />
e<strong>in</strong>e Reduzierstation (Bild 4) entwickelt.<br />
Die Größe der Probenahmegefäße konnte so <strong>in</strong> der<br />
Regel auf 300ml beschränkt werden. In diesen 300 ml<br />
Probemenge ist e<strong>in</strong>e Spülwassermenge aus dem Rohrnetz<br />
von m<strong>in</strong>. 1m³ filtriert. Der NDHD-S2 ist <strong>in</strong> der Lage,<br />
Durchflussmengen von bis zu 60m³/h drucklos zu filtrieren.<br />
Für e<strong>in</strong>e repräsentative Probeentnahme wurde<br />
e<strong>in</strong>e Verfahrensvorschrift entwickelt, die e<strong>in</strong>e spezielle<br />
Bild 2: 100 μm Filter, ger<strong>in</strong>ge Beladung (Aus Scheideler et<br />
al., 2013 [5]<br />
Bedienungsanleitung für den NDHD-S2 be<strong>in</strong>haltet. Hier<strong>in</strong><br />
wird besonders die rückstandsfreie Probenahme und<br />
Re<strong>in</strong>igung, sowie die Inbetriebnahme mit E<strong>in</strong>schiebern<br />
der Rohrleitungsstrecke im Detail vorgegeben.<br />
Für e<strong>in</strong>e repräsentative und vergleichbare Datenerhebung<br />
s<strong>in</strong>d die technischen und verfahrenstechnischen<br />
Grundlagen für die Probeentnahme erarbeitet worden.<br />
Es wurde untersucht, bei welchen Randbed<strong>in</strong>gungen<br />
der Probeentnahme e<strong>in</strong> möglichst vollständiger Austrag<br />
tierischer Kle<strong>in</strong>stlebewesen erreicht werden kann und<br />
unter welchen Bed<strong>in</strong>gungen vergleichbare Ergebnisse<br />
zu erzielen s<strong>in</strong>d. Im Rahmen der Versuchsdurchführung<br />
wurde nach e<strong>in</strong>er standardisierten Probenahme auch der<br />
Gesamtbestand wirbelloser Tiere jeder Teststrecke mittels<br />
CO 2<br />
-Spülverfahren ermittelt.<br />
Der Austrag wirbelloser Tiere aus Tr<strong>in</strong>kwasserverteilungssystemen<br />
ist unter den Versuchsbed<strong>in</strong>gungen (erzeugte<br />
Fließgeschw<strong>in</strong>digkeit <strong>in</strong> der Teststrecke zwischen 0,4 m/s<br />
bis 1,5 m/s) unabhängig von der Höhe der Fließgeschw<strong>in</strong>digkeit<br />
und dem Material der Rohrleitung. E<strong>in</strong> vergleichbares<br />
Ergebnis hängt vor allem von der Art der Probeentnahme<br />
(drucklose Filtration, verwendete Maschenweiten)<br />
ab. Im Falle der Wasserasseln ist darüber h<strong>in</strong>aus<br />
die Kenntnis des ‚Ablagerungszustandes‘ (gespült, nicht<br />
gespült) für die Bewertung des <strong>in</strong>sgesamt vorhandenen<br />
Individuenbestandes erforderlich.<br />
In Tabelle 1 und Tabelle 2 s<strong>in</strong>d die für e<strong>in</strong>e standardisierte<br />
Probeentnahme empfohlenen Parameter bzw.<br />
Randbed<strong>in</strong>gungen und die unter diesen Bed<strong>in</strong>gungen<br />
registrierten Remobilisierungsraten für die wichtigsten<br />
Arten bzw. Tiergruppen als e<strong>in</strong> Ergebnis der Forschungsarbeiten<br />
zusammengestellt.<br />
Auffällig ist besonders bei der Austragsrate von Wasserasseln<br />
im ungespülten Leitungszustand (normale<br />
Betriebsbed<strong>in</strong>gungen) die hohe Differenz zum tatsächlichen<br />
Besiedlungszustand. Bei Bewertungen von Hydrantenuntersuchungen<br />
ist es auf Grund dieser Erkenntnisse<br />
umso wichtiger, entsprechende Zusatzbewertungen e<strong>in</strong>fließen<br />
zu lassen.<br />
Zu der Entwicklung des Probenahme- und Messsystems<br />
s<strong>in</strong>d noch weitere Untersuchungen zu diversen Aspekten<br />
der biologischen Tr<strong>in</strong>kwasserqualität<br />
und vor<br />
allem zu Bewertungsmöglichkeiten<br />
durchgeführt<br />
worden.<br />
Dabei wurde <strong>in</strong>sbesondere<br />
der Asselkot<br />
als Indikator für Wasserasseln<br />
betrachtet.<br />
Wasserasseln stellen<br />
schwer nachweisbare<br />
Bild 3: 25 μm Filter, hohe Beladung (Aus Scheideler et<br />
al., 2013 [5]<br />
Besiedler von Tr<strong>in</strong>kwasserverteilungsnetzen<br />
dar, weil sie über<br />
e<strong>in</strong>en ausgeprägten<br />
68 11-12 | 2013
WASSERVERSORGUNG FACHBERICHT<br />
Festhaltereflex verfügen und deshalb nur prozentual<br />
ger<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Hydrantenuntersuchung ausgespült<br />
werden (siehe Tabelle 2, ca. 7 % der tatsächlichen<br />
Besiedlungsdichte). Asselkotpellets s<strong>in</strong>d langfristig<br />
stabil (> 6 Wochen) und werden unter den normalen<br />
Betriebsbed<strong>in</strong>gungen nur ger<strong>in</strong>g im Tr<strong>in</strong>kwassernetz<br />
verfrachtet; die Größe des Asselkots ist signifikant<br />
mit der Größe der Wasserasseln korreliert.<br />
Bei Untersuchungen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er norddeutschen Kle<strong>in</strong>stadt<br />
konnte gezeigt werden, dass aus den Größenverteilungen<br />
des Asselkots die Größe der im Tr<strong>in</strong>kwasserversorgungssystem<br />
enthaltenen Wasserasseln errechnet<br />
werden kann. Somit kommt dem Asselkot als Indikator<br />
bei der Beprobung von Tr<strong>in</strong>kwasserversorgungssystemen<br />
am Hydranten e<strong>in</strong>e große Bedeutung zu.<br />
Für die Bewertung der biologischen Tr<strong>in</strong>kwasserqualität<br />
war zum Zeitpunkt des Forschungsprojektes ke<strong>in</strong><br />
Parameter oder Grenzwert <strong>in</strong> der Tr<strong>in</strong>kwasserverordnung<br />
def<strong>in</strong>iert. Für die Produktion e<strong>in</strong>es biologisch<br />
stabilen Tr<strong>in</strong>kwassers [8] oder dem Betrieb von<br />
Tr<strong>in</strong>kwasserverteilungssystemen im H<strong>in</strong>blick auf die<br />
Vermeidung von Aufkeimungsersche<strong>in</strong>ungen [9] s<strong>in</strong>d<br />
im DVGW bereits Forschungsprojekte durchgeführt<br />
worden. Um die Aussagen zur biologischen Tr<strong>in</strong>kwasserqualität,<br />
vor allem unter Berücksichtigung von<br />
Invertebratenbesiedlungen zu praktischen Handlungsmöglichkeiten<br />
weiterzuentwickeln, ist dem Aspekt der<br />
Bewertungsmöglichkeit e<strong>in</strong>e besondere Bedeutung<br />
zugekommen.<br />
Hierbei wurde der Schwerpunkt nicht auf die Entwicklung<br />
e<strong>in</strong>es e<strong>in</strong>zelnen Parameters oder gar e<strong>in</strong>es Grenzwertes gelegt,<br />
sondern vielmehr auf e<strong>in</strong>e Zusammenstellung von e<strong>in</strong>zelnen<br />
E<strong>in</strong>flussfaktoren <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Bewertungssystem.<br />
Auf der Grundlage von Relevanz und Anwendbarkeit e<strong>in</strong>zelner<br />
Bewertungskriterien (Aspekte) wurde e<strong>in</strong>e entsprechende<br />
Auswahl <strong>in</strong> das Bewertungssystem <strong>in</strong>tegriert. Das s<strong>in</strong>d derzeit<br />
Informationen zur Quantität des Vorkommens wirbelloser<br />
Art der Probeentnahme<br />
Probevolumen 1m 3<br />
Filtration und Filter<br />
Fließgeschw<strong>in</strong>digkeit während<br />
der Probeentnahme<br />
Probeentnahme aus Hydranten,<br />
Filtration vor Ort mittels Filtrierapparatur<br />
drucklose Filtration, parallele Filtration über zwei Filter<br />
nach Stromteilung, Maschenweiten 100 m und 25 µm<br />
0,5 bis 1,5 m/s<br />
Tabelle 1: Empfohlene Parameter bzw. Randbed<strong>in</strong>gungen für die Beprobung von<br />
Tr<strong>in</strong>kwasserverteilungssystemen. (Aus Michels et al., 2013 [6])<br />
Art / Tiergruppe Anteil nachweisbarer Individuen [%]<br />
Asellus aquaticus (ungespülter<br />
Rohrabschnitt)<br />
Asellus aquaticus (gespülter<br />
Rohrabschnitt)<br />
Gliederwürmer (Oligochaeta)<br />
7 (3-10)<br />
65 (65-73)<br />
Rädertiere (Rotatoria) 50 (44-57)<br />
Fadenwürmer (Nematoda) 74 (60-75)<br />
Ruderfußkrebse (Copepoda) 69 (49-73)<br />
Schalenamöben (Testacea)<br />
17 unsicher, da sehr große Schwankungsbreite<br />
41 unsicher, da sehr große Schwankungsbreite<br />
Tabelle 2: Beprobung von Tr<strong>in</strong>kwasserverteilungssystemen: Anteil nachweisbarer<br />
Individuen bezogen auf die Gesamtbesiedelungsdichte, angegeben s<strong>in</strong>d Median,<br />
M<strong>in</strong>imum und Maximum (Aus Michels et al., 2013 [6])<br />
Tiere, zur ästhetischen Bewertung des Tr<strong>in</strong>kwassers und zum<br />
Risiko e<strong>in</strong>er Wiederverkeimung. Auf Grund der Vielzahl zu<br />
betrachtender Aspekte und der Möglichkeit e<strong>in</strong>e Gesamtbewertung<br />
durchzuführen wurde e<strong>in</strong> multimetrischer<br />
Bewertungsansatz gewählt. So können die Ergebnisse<br />
von E<strong>in</strong>zeluntersuchungen wie z. B. die Individuendichte<br />
von Invertebraten als E<strong>in</strong>zelkriterium wie <strong>in</strong> Bild 6 dar-<br />
Bild 4: Reduzierstation mit Probeabfüllung <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Gefäß<br />
zum Transport <strong>in</strong>s Labor (Aus Scheideler et al., 2013 [5])<br />
Bild 5: Fotografische Dokumentation (35-fache Vergrößerung) von ausgewählten<br />
Spülproben. A und B: Verdünnungsfaktor 1:100, A = 100 μm Filter, B = 25 μm Filter C und D:<br />
Verdünnungsfaktor 1:10, C = 100 μm Filter, D = 25 μm Filter. (Aus Titze & Gunkel, 2013 [7])<br />
11-12 | 2013 69
FACHBERICHT WASSERVERSORGUNG<br />
E<strong>in</strong>ordnung<br />
verbale Bewertung<br />
Klasse 1 Wert < 20% Percentil wenig, ger<strong>in</strong>g, niedrig<br />
Klasse 2 Wert >= 20% und < 40% Percentil wenig bis durchschnittlich<br />
Klasse 3 Wert >= 40% und < 60% Percentil mäßig, durchschnittlich<br />
Klasse 4 Wert >= 60% und < 80% Percentil durchschnittlich bis hoch<br />
Klasse 5 Wert > 80% Perzentil viel, hoch<br />
Tabelle 3: Klassengrenzen und Bewertung (Aus Michels & Gunkel, 2013 [10])<br />
Die qualitative und quantitative Analyse<br />
wirbelloser Tiere <strong>in</strong> Tr<strong>in</strong>kwasserverteilungssystemen<br />
ist e<strong>in</strong>e wichtige<br />
Kenngröße der biologischen<br />
Wasserqualität.<br />
THESE 3: Die biologische Wasserqualität<br />
im Verteilungsnetz ist erfassbar<br />
und für die Betrachtung des Gesamtsystems,<br />
sowie für die Planung von<br />
Pflegemaßnahmen unverzichtbar.<br />
Modul/Index E<strong>in</strong>heit Wert<br />
Quantität / Diversität<br />
Bewertung<br />
e<strong>in</strong>zeln<br />
Anzahl der Tiergruppen - 8 mäßig bis viele<br />
Anzahl der Taxa - 17 viel<br />
Individuendichte Invertebraten ges. Ind./m 3 2.654.779 viel<br />
Biomasse Invertebraten ges. mg/m 3 36,2 viel<br />
Ästhetische Bewertung<br />
Biomasse der Makroorganismen mg/m³ 0,07 wenig bis<br />
mäßig<br />
Biomasseanteil Makroorganismen % 0,21 mäßig<br />
durchschnittliche Körpergröße der<br />
Makroorganismen<br />
mm 4,0<br />
wenig<br />
Anzahl sichtbarer Tiere Ind./m³ 1 wenig bis<br />
mäßig<br />
Risiko e<strong>in</strong>er Verkeimung<br />
Biomasse mg/m³ 36,2 hoch<br />
Anzahl vorhandener Kotpellets Anzahl./m³ 809.104 hoch<br />
Masse vorhandener Kotpellets mg/m³ 134 hoch<br />
gestellt e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>ordnung <strong>in</strong> vergleichbare Datensätze<br />
unterzogen und gemäß Tabelle 3 bewertet werden.<br />
In Tabelle 4 ist beispielhaft e<strong>in</strong>e Übersicht e<strong>in</strong>er Auswertung<br />
mit verschiedenen E<strong>in</strong>zel<strong>in</strong>dizes zu e<strong>in</strong>em Multimetrischem<br />
Index zusammengestellt.<br />
Mit dem vorliegenden Multimetrischen Index ist es möglich,<br />
Ergebnisse aus Hydrantenuntersuchungen mite<strong>in</strong>ander<br />
zu vergleichen und <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e größere Datenbasis<br />
e<strong>in</strong>zuordnen. Darüber h<strong>in</strong>aus können verschiedene<br />
Detail<strong>in</strong>formationen zu den im Rohrleitungssystem aktuell<br />
vorhandenen wirbellosen Tieren gewonnen und beurteilt<br />
werden. Daraus lassen sich konkrete Pflegemaßnahmen<br />
abstimmen, um die biologische Tr<strong>in</strong>kwasserqualität von<br />
der E<strong>in</strong>speisung im Wasserwerk bis zur Entnahmestelle<br />
beim Endverbraucher zu kontrollieren und entsprechend<br />
zu bee<strong>in</strong>flussen.<br />
gesamt<br />
viel<br />
wenig bis<br />
mäßig<br />
Mult<strong>in</strong>umerischer Index 4,0 mäßig bis viel<br />
Tabelle 4: Beispielbewertung e<strong>in</strong>er Hydrantenuntersuchung (Aus Michels & Gunkel, 2013 [10])<br />
viel<br />
5. ABLEITUNG EINES ZUSTANDS-<br />
BASIERTEN PFLEGEKONZEPTES<br />
Aus der Gesamtbetrachtung des Verteilungssystems<br />
e<strong>in</strong>schließlich der<br />
Wasserqualität bei der E<strong>in</strong>speisung<br />
und Ermittlung des Netzzustandes<br />
kann e<strong>in</strong> <strong>in</strong>dividuelles Pflegekonzept<br />
erstellt werden. Dabei ist es wichtig die<br />
vorhandenen Daten zu nutzen und bei<br />
Bedarf neue Erkenntnisse durch ergänzende<br />
Untersuchungen zu <strong>in</strong>tegrieren.<br />
Durch e<strong>in</strong>e möglichst genaue Erfassung<br />
der IST-Situation können Optimierungen<br />
von E<strong>in</strong>flüssen am Wasserwerksausgang<br />
und e<strong>in</strong>e bedarfsgerechte<br />
Auswahl von Pflegemaßnahmen z. B.<br />
<strong>in</strong> Form von Netzspülungen erfolgen.<br />
Hierbei macht es S<strong>in</strong>n, Daten aus GIS-<br />
Systemen, Softwarebasierte Entwicklung<br />
von Spülprogrammen, Untersuchungsdaten<br />
z. B. für die Aufstellung<br />
von zustandsorientierten Spülmaßnahmen<br />
oder auch Untersuchungen<br />
zur biologischen Wasserqualität mit<br />
e<strong>in</strong>ander zu verknüpfen. Daraus lassen<br />
sich Aussagen zur Effektivität bei<br />
gleichzeitig wirtschaftlicher Betrachtung<br />
des Aufwands treffen, um e<strong>in</strong>e<br />
optimierte Maßnahmenstrategie für<br />
das Pflegekonzept zu erhalten.<br />
6. EINSATZ VON SPÜLVERFAHREN ZUR<br />
NETZPFLEGE<br />
Für e<strong>in</strong>e zustandsorientierten und bedarfsoptimierter<br />
Auswahl von geeigneten Spülverfahren s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>ige<br />
Kriterien zu beachten. Dazu muss zunächst der Bedarf<br />
def<strong>in</strong>iert werden, der sehr unterschiedlich ausgeprägt<br />
se<strong>in</strong> kann.<br />
Mögliche Bedarfskriterien können z. B. se<strong>in</strong>:<br />
»»<br />
Wasseraustausch aufgrund von Stagnation<br />
(Endstrangspülung)<br />
»»<br />
Austrag von losen, resuspendierbaren Ablagerungen<br />
Aufgrund von<br />
- Auftreten von Trübung >> Kundenbeschwerden<br />
- Auftreten von Verkeimungen<br />
- Prävention<br />
70 11-12 | 2013
WASSERVERSORGUNG FACHBERICHT<br />
»»<br />
Ablösen und Austragen von Biofilmen und losen<br />
Ablagerungen Aufgrund von<br />
- Auftreten von Trübung >> Kundenbeschwerden<br />
- Auftreten von Verkeimungen<br />
- Prävention<br />
»»<br />
Ablösen und Austragen von festen Ablagerungen<br />
(Inkrustationen) Aufgrund von<br />
- Querschnittsverengungen,<br />
Durchflusse<strong>in</strong>schränkungen<br />
»»<br />
Austrag von Kle<strong>in</strong>stlebewesen (Invertebraten) Aufgrund<br />
von<br />
- Massenpopulationen >> E<strong>in</strong>fluss auf die<br />
bio logische Tr<strong>in</strong>kwasserqualität<br />
- Sichtbarwerden von Makro<strong>in</strong>vertebraten <strong>in</strong><br />
Haus<strong>in</strong>stallationen<br />
- Prävention<br />
»»<br />
Austrag von Nahrung für Invertebraten (Biofilm<br />
an der Rohrwandung und verwertbarer Teil <strong>in</strong> den<br />
losen Ablagerungen)<br />
- Nahrungsentzug hemmt Massenpopulationen<br />
- Nahrung ist auch gleichzeitig biologische<br />
Substanz mit E<strong>in</strong>fluss auf die biologische<br />
Tr<strong>in</strong>kwasserqualität<br />
Der unterschiedliche Bedarf von Netzspülungen kann wiederum<br />
mit verschiedenen Spülverfahren gedeckt werden. In<br />
e<strong>in</strong>igen Bedarfsfällen können mehrere Verfahren angewendet<br />
werden, <strong>in</strong> anderen speziellen Fällen ist die Auswahl e<strong>in</strong>geschränkt.<br />
Dies hängt zum e<strong>in</strong>en von den E<strong>in</strong>satzbereichen<br />
z. B. bei der Erzeugung von erforderlichen Fließgeschw<strong>in</strong>digkeiten<br />
<strong>in</strong> Abhängigkeit vom Rohr<strong>in</strong>nendurchmesser ab.<br />
Zum anderen können nicht alle Verfahren z. B. zum Lösen<br />
und Entfernen von festen Ablagerungen (Inkrustationen)<br />
e<strong>in</strong>gesetzt werden.<br />
Zurzeit üblicherweise e<strong>in</strong>gesetzte Spülverfahren s<strong>in</strong>d:<br />
»»<br />
Punktuell oder abschnittsweise Wasserspülung<br />
»»<br />
Systematische Netzspülung mit klarer Wasserfront<br />
(Unidirectional Flush<strong>in</strong>g)<br />
»»<br />
Luft-Wasser-Spülung (e<strong>in</strong>schließlich Sonderverfahren<br />
mit Luftimpulsen)<br />
»»<br />
Saugspülung<br />
Relativ neue Spülverfahren s<strong>in</strong>d:<br />
»»<br />
CO 2<br />
-Spülung<br />
»»<br />
Eismolchen<br />
»»<br />
In Sonderfällen auch andere Molchverfahren<br />
Aufgrund der Vielzahl von Bedarfsmöglichkeiten und der<br />
Auswahlmöglichkeiten von Spülverfahren ist e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>dividuelle<br />
Auswertung unabd<strong>in</strong>gbar. In e<strong>in</strong>igen Fällen ist auch e<strong>in</strong>e<br />
Komb<strong>in</strong>ation bzw. der E<strong>in</strong>satz von verschiedenen Spülverfahren<br />
erforderlich. Nur bei der bedarfsabhängigen Betrachtung<br />
ist e<strong>in</strong>e optimale Spülstrategie zu f<strong>in</strong>den. Dazu kann<br />
e<strong>in</strong>e themenübergreifende Betrachtung hilfreich se<strong>in</strong>, die<br />
im ersten Ansatz wie die Matrix im nachfolgenden Bild aussehen<br />
könnte.<br />
Bild 6: Skalierung des Bewertungskriteriums “Individuendichte Invertberaten<br />
gesamt” über statistische Lagemaße (Perzentile). (Aus Michels & Gunkel,<br />
2013 [10])<br />
gut geeignet<br />
bed<strong>in</strong>gt geeignet<br />
nicht geeignet<br />
Bild 7: Spülverfahren und E<strong>in</strong>satzmöglichkeiten<br />
Spülverfahren:<br />
A) Luft-Wasser-Spülung e<strong>in</strong>schl.<br />
Sonderverfahren mit Luftimpulsen,<br />
B) Saugspülung,<br />
C) Eismolch<br />
(„Flüssigkörper-Molch“-Verfahren),<br />
D) systematische Wasserspülung mit<br />
gerichteter Wasserfront,<br />
E) CO2-Spülung,<br />
F) Wasserspülung,<br />
G) Andere „Festkörper-Molch“-Verfahren<br />
Ziele von Rohrnetzspülungen s<strong>in</strong>d<br />
der Austrag von:<br />
1) Stagnationswasser,<br />
2) losen, leicht mobilisierbaren<br />
Ablagerungen,<br />
3) losen Biofilmen / Biomasse als Teil <strong>in</strong><br />
den losen Ablagerungen,<br />
4) Organismen / Invertebraten,<br />
5) Nahrung für Organismen, als Teil <strong>in</strong><br />
den losen Ablagerungen,<br />
6) stabilen Biofilmen an der<br />
Rohrwandung,<br />
7) Wasserasseln, als besonders schwierig<br />
austragbare Organismen,<br />
8) festen Ablagerungen, Inkrustationen<br />
Bild 7 ist zu entnehmen, dass mehrere Ziele von Spülmaßnahmen<br />
mit den meisten Spülverfahren zu erreichen ist.<br />
Ausnahmen gibt es vor allem bei den festen Ablagerungen<br />
(Inkrustationen) und beim Austragen von speziellen Organismen<br />
den Wasserasseln, die Aufgrund von ihrem thigmotaktischen<br />
Verhalten (Festhaltereflex) e<strong>in</strong>e Besonderheit<br />
darstellen.<br />
Nicht alle Spülverfahren lassen sich jedoch bei allen Leitungsdurchmessern<br />
e<strong>in</strong>setzen, da hier <strong>in</strong> Abhängigkeit des<br />
Spülziels die Fließgeschw<strong>in</strong>digkeit <strong>in</strong> der Regel e<strong>in</strong>e übergeordnete<br />
Rolle spielt. In Bild 8 ist vere<strong>in</strong>facht dargestellt,<br />
welche Leitungsdimensionen sich noch mit Spülverfahren<br />
über Hydranten ohne zusätzliche Hilfsmittel realisieren lassen.<br />
11-12 | 2013 71
FACHBERICHT WASSERVERSORGUNG<br />
gut erreichbar<br />
bed<strong>in</strong>gt erreichbar<br />
nicht erreichbar<br />
Bild 8: E<strong>in</strong>satzgrenzen für Spülverfahren ohne zusätzliche<br />
Fließgeschw<strong>in</strong>digkeitserhöhung begrenzt durch die Durchflussmenge <strong>in</strong> m³/h<br />
Hierbei s<strong>in</strong>d die Fließgeschw<strong>in</strong>digkeiten <strong>in</strong> Abhängigkeit der<br />
Leitungsdurchmesser aufgetragen. Es wird bei dieser Betrachtung<br />
unterstellt, dass je nach Wasserdruck und Verfügbarkeit<br />
Durchflussmengen <strong>in</strong> der Spitze von ca. 50-60 m³/h an<br />
herkömmlichen Hydranten erreicht werden. In e<strong>in</strong>igen Fällen<br />
kann weit mehr an Durchflussmenge erzielt werden, so dass<br />
sich der E<strong>in</strong>satzbereich dann deutlich erhöhen kann.<br />
In e<strong>in</strong>em Forschungsprojekt des DVGW-Technologiezentrums<br />
Wasser (TZW) „Spülverfahren und Spülstrategien“<br />
ist nach Angaben aus e<strong>in</strong>er Zwischenveröffentlichung<br />
<strong>in</strong> der energie-wasser-praxis, Ausgabe 6-2011 bereits<br />
ab Fließgeschw<strong>in</strong>digkeiten von 0,3 m/s e<strong>in</strong> Austrag von<br />
80 % der losen, leicht mobilisierbaren Ablagerungen<br />
bei dem 1. Leitungsvolumen nachgewiesen. Des Weiteren<br />
ist das Ablagerungsverhalten <strong>in</strong> Abhängigkeit der<br />
Betriebsbed<strong>in</strong>gungen beschrieben und mathematisch<br />
identifiziert. Hierbei wird e<strong>in</strong> Bezug von der maximalen<br />
Ablagerungsmenge zur maximalen Fließgeschw<strong>in</strong>digkeit<br />
unter Betriebsbed<strong>in</strong>gungen oder <strong>in</strong> Ausnahmen bei e<strong>in</strong>er<br />
Verdoppelung angenommen. Darüber kann die Dicke der<br />
lam<strong>in</strong>aren Grenzschicht und somit das Ablagerungsvolumen<br />
bestimmt werden.<br />
Bei e<strong>in</strong>er Gesamtbetrachtung - E<strong>in</strong>satz von Spülverfahren<br />
– E<strong>in</strong>satzgrenzen – Wirkungsgrade – Wirtschaftlichkeit –<br />
Austragsziel ist besonders mit Blick zur Optimierung das<br />
Austragsziel differenzierter zu ermitteln.<br />
Der überwiegende Anteil der Rohrleitungen bef<strong>in</strong>det<br />
sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Durchmesserbereich bis DN 150. Daraus<br />
lässt sich <strong>in</strong> der Gesamtbetrachtung ableiten, dass der<br />
größte Teil der Rohrleitungen im Verteilungssystem mit<br />
dem e<strong>in</strong>fachsten Spülverfahren, mit klarer Wasserfront<br />
gepflegt werden kann. Somit ist auch e<strong>in</strong>e Komb<strong>in</strong>ation<br />
von Spülverfahren im größten Teil des Netzes möglich<br />
und <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen Bereichen, vor allem größeren Durchmessers<br />
s<strong>in</strong>nvoll oder notwendig.<br />
7. INTERDISZIPLINÄRE PLANUNG VON NETZ-<br />
SPÜLUNGEN ZUR ROHRNETZPFLEGE<br />
Um unter wirtschaftlicher Betrachtung e<strong>in</strong> Optimum an<br />
Effektivität von Pflegemaßnahmen <strong>in</strong> Abhängigkeit der<br />
Zieldef<strong>in</strong>ition zu erreichen ist es erforderlich alle verfügbaren<br />
Methoden, Verfahren, Software, Erkenntnisse und<br />
Erfahrungen zusammen zu fügen. E<strong>in</strong>ige neue Methoden<br />
können erheblich zu E<strong>in</strong>sparungen im Aufwand<br />
bei der Planung, E<strong>in</strong>schränkung von Pflege<strong>in</strong>tervallen,<br />
Ableiten von geeigneten Spülverfahren, etc. führen.<br />
Wichtige Voraussetzung hierfür ist e<strong>in</strong>e möglichst präzise<br />
Zieldef<strong>in</strong>ition, die <strong>in</strong>dividuell anders ausgeprägt se<strong>in</strong><br />
kann. E<strong>in</strong>e übergeordnete Zielsetzung, dem Endverbraucher<br />
e<strong>in</strong> Tr<strong>in</strong>kwasser nach Tr<strong>in</strong>kwasserverordnung zu<br />
liefern, muss als M<strong>in</strong>imaldef<strong>in</strong>ition verstanden werden.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus ist für e<strong>in</strong>e nachhaltige Kosten-Nutzen-<br />
Betrachtung der moderne Betrieb e<strong>in</strong>es Wasserverteilungssystems<br />
an e<strong>in</strong>ige zusätzliche Randbed<strong>in</strong>gungen<br />
geknüpft. Besonders das Image des Wasserversorgers<br />
als Lieferant unseres Lebensmittels Nr. 1 spielt mit Blick<br />
zur Kundenzufriedenheit e<strong>in</strong>e übergeordnete Rolle.<br />
Umso wichtiger s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e themenübergreifende Betrachtung<br />
und das Verstehen der Wasserverteilung als Gesamtsystem,<br />
<strong>in</strong>dem die E<strong>in</strong>flüsse auf den Pflegeaufwand bereits<br />
bei der E<strong>in</strong>speisung im Wasserwerk bzw. bei der Wasseraufbereitung<br />
beg<strong>in</strong>nen.<br />
8. BERÜCKSICHTIGUNG DER BIOLOGISCHEN<br />
TRINKWASSERQUALITÄT MIT NEUER<br />
UNTERSUCHUNGSMETHODE<br />
Die Möglichkeiten über Hydrantenuntersuchungen Aussagen<br />
zur biologischen Tr<strong>in</strong>kwasserqualität zu erhalten<br />
s<strong>in</strong>d unter Punkt 5 bereits beschrieben. Dadurch lässt sich<br />
die moderne Planung von Pflegemaßnahmen ganz neu<br />
gestalten. Bereits e<strong>in</strong>gesetzte Methoden, z. B. Aussagen<br />
zum Leitungszustand <strong>in</strong> Bezug zum Ablagerungsverhalten<br />
lassen sich um e<strong>in</strong>e Möglichkeit ergänzen, die e<strong>in</strong>en<br />
wesentlichen E<strong>in</strong>fluss auf die biologische Stabilität des<br />
Tr<strong>in</strong>kwassers letztendlich bis zur Entnahmestelle beim<br />
Endverbraucher nehmen kann. Somit kann nicht nur<br />
unter Kostenbetrachtung sondern auch mit Blick auf<br />
den Imageerhalt des Wasserversorgers E<strong>in</strong>fluss genommen<br />
werden, <strong>in</strong>dem der Leitungszustand diesbezüglich<br />
kontrollierbar ist. Hydrantenuntersuchungen lassen sich<br />
vielseitig e<strong>in</strong>setzen und komb<strong>in</strong>ieren, so dass die Prioritäten<br />
und Zieldef<strong>in</strong>itionen im Netzbetrieb Berücksichtigung<br />
f<strong>in</strong>den können. E<strong>in</strong>satzmöglichkeiten s<strong>in</strong>d z. B.:<br />
»»<br />
HU (Hydrantenuntersuchung) zur Soforterkennung<br />
für Makro<strong>in</strong>vertebraten<br />
»»<br />
HU für Feststellung der biologischen TWQ und Integration<br />
<strong>in</strong> Pflegemaßnahmen<br />
»»<br />
HU zur Überprüfung von Maßnahmen<br />
»»<br />
HU zur regelmäßigen Kontrolle (Nachhaltigkeit)<br />
72 11-12 | 2013
WASSERVERSORGUNG FACHBERICHT<br />
THESE 4: Moderne Rohrnetzpflege be<strong>in</strong>haltet Hydrantenuntersuchungen<br />
für die Planung, sowie für die Überprüfung<br />
von Spülmaßnahmen und Nachhaltigkeitskontrollen.<br />
THESE 5: Moderne Dienstleistungen für die Wasserwirtschaft<br />
bedeuten e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>äre Herangehensweise<br />
an die komplexen Aufgabenstellungen bei der<br />
Wasserversorgung.<br />
REFERENZEN<br />
[1] Abschlussbericht DVGW-Forschungsvorhaben W4/01/05 – Juli 2009<br />
[2] Invertebraten im Tr<strong>in</strong>kwasser, Probenahme, Analytik und Bewertung;<br />
Universitätsverlag der Technischen Universität Berl<strong>in</strong> 2013; U. Michels,<br />
G. Gunkel, M. Scheideler, K. Ripl; ISBN 978-3-7983-2575-3 (onl<strong>in</strong>e)<br />
[3] DVGW-Regelwerk, Merkblatt W271, Ausgabe 1997<br />
[4] Entwicklung e<strong>in</strong>es mobilen Probenahme- und Messsytems für<br />
Invertebraten <strong>in</strong> Tr<strong>in</strong>kwasserverteilungssystemen; Universitätsverlag<br />
der Technischen Universität Berl<strong>in</strong> · 2013; M. Scheideler, G. Gunkel,<br />
U. Michels; ISBN 978-3-7983-2575-3 (onl<strong>in</strong>e)<br />
[5] Entwicklung e<strong>in</strong>es mobilen Probenahme- und Messsytems für<br />
Invertebraten <strong>in</strong> Tr<strong>in</strong>kwasserverteilungssystemen; Universitätsverlag<br />
der Technischen Universität Berl<strong>in</strong> · 2013; M. Scheideler, G. Gunkel,<br />
U. Michels; ISBN 978-3-7983-2575-3 (onl<strong>in</strong>e)<br />
[6] Repräsentative Beprobung von Tr<strong>in</strong>kwasserverteilungssystemen;<br />
Universitätsverlag der Technischen Universität<br />
Berl<strong>in</strong> · 2013; U. Michels, J. Polak, M. Scheideler, G. Gunkel<br />
ISBN 978-3-7983-2575-3 (onl<strong>in</strong>e)<br />
[7] Kotpellets der Wasserassel als Indikator für die Besiedlung<br />
von Tr<strong>in</strong>kwasser-Versorgungssystemen; Universitätsverlag der<br />
Technischen Universität Berl<strong>in</strong> · 2013; D. Titze, G. Gunkel;<br />
ISBN 978-3-7983-2575-3 (onl<strong>in</strong>e)<br />
[8] Abschlussbericht DVGW-Forschungsvorhaben W4/01/05-F –<br />
Oktober 2011<br />
[9] Abschlussbericht DVGW-Forschungsvorhaben W6/01/05 –<br />
November 2009<br />
[10] Multimetrischer Bewertungs<strong>in</strong>dex für Invertebraten <strong>in</strong><br />
Tr<strong>in</strong>kwasserverteilungssystemen; Universitätsverlag der<br />
Technischen Universität Berl<strong>in</strong> 2013; U. Michels, G. Gunkel;<br />
ISBN 978-3-7983-2575-3 (onl<strong>in</strong>e)<br />
DANKSAGUNG<br />
Unser besonders herzlicher Dank gilt den an den Untersuchungen<br />
beteiligten Wasserversorgungsunternehmen für<br />
die Möglichkeit der Durchführung verschiedener Untersuchungen<br />
und für die praktische, technische Unterstützung<br />
des Projektes. Ohne die Unterstützung der Wasserversorger<br />
wäre das Projekt nicht durchführbar gewesen.<br />
Bild 9: Anwendungsschema e<strong>in</strong>es <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>ären Planungsansatzes<br />
Das Projekt wurde gefördert durch das Bundesm<strong>in</strong>isterium<br />
für Wirtschaft und Technologie, Aif, ZIM - wir<br />
bedanken uns für die kompetente Projektbegleitung. Den<br />
Projektpartnern e<strong>in</strong>schließlich derer Mitarbeiter gilt e<strong>in</strong><br />
besonderer Dank für die Unterstützung, kompetenten<br />
und konstruktiven Diskussionen bei der Entwicklung der<br />
Apparatur und für die angenehme und vertrauensvolle<br />
Zusammenarbeit.<br />
Dipl.-Ing.(FH) MICHAEL SCHEIDELER<br />
AUTOR<br />
Scheideler Dienstleistungen, Haltern am See<br />
Tel. +49 2364 105 45-0<br />
E-Mail: ms@scheideler.com<br />
Mithilfe dieses QR-Codes können Sie den vollständigen Forschungsbericht vom TUB-<br />
Verlag „Invertebraten im Tr<strong>in</strong>kwasser, Probenahme, Analytik und Bewertung“ kostenlos<br />
downloaden.<br />
11-12 | 2013 73
FACHBERICHT ABWASSERENTSORGUNG / SANIERUNG<br />
Altrohr-Zustand III und Grundwasser:<br />
Nachweiskonzept für L<strong>in</strong>er <strong>in</strong> nicht<br />
dauerhaft standsicheren Kanälen<br />
Für die Sanierung von nicht mehr dauerhaft standsicheren Abwasserkanälen und -leitungen (Altrohr-Zustand III) mit<br />
L<strong>in</strong><strong>in</strong>g- und Montageverfahren reicht die Aufstellung e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>zelnen statischen Berechnung <strong>in</strong> der Regel nicht aus.<br />
Insbesondere bei wechselnden Überdeckungshöhen und/oder e<strong>in</strong>em schwankenden Grundwasserspiegel ist ohne<br />
genauere Berechnungen nicht vorab abschätzbar, welche E<strong>in</strong>wirkungskomb<strong>in</strong>ationen zu den größten Beanspruchungen<br />
des L<strong>in</strong>ers und des Altrohres führen. Darüber h<strong>in</strong>aus kann e<strong>in</strong> eventuell vorhandener R<strong>in</strong>gspalt zwischen L<strong>in</strong>er und<br />
Altrohr entweder günstig oder aber auch ungünstig wirken. Aus diesem Grunde wird <strong>in</strong> diesem Fachbericht e<strong>in</strong><br />
systematisches Nachweiskonzept für den Altrohr-Zustand III vorgestellt, das <strong>in</strong> dem neuen Rechenmodul M127-2 der<br />
Software IngSoft EasyPipe bereits <strong>in</strong>tegriert ist.<br />
BERECHNUNGSGRUNDLAGEN<br />
Die statische Berechnung und Bemessung von L<strong>in</strong>ern<br />
<strong>in</strong> Kanälen erfolgt auf Grundlage des ATV-Merkblatts<br />
M 127-2 „Statische Berechnung zur Sanierung von<br />
Abwasserkanälen und -leitungen mit L<strong>in</strong><strong>in</strong>g- und Montageverfahren“<br />
<strong>in</strong> der Ausgabe vom Januar 2000. Diese<br />
Berechnungsvorschrift wird derzeit von der Arbeitsgruppe<br />
ES 8.16 der DWA überarbeitet. Die Neufassung soll als<br />
DWA-Arbeitsblatt A 143-2 ersche<strong>in</strong>en, dessen Gelbdruck<br />
bereits seit November 2012 vorliegt.<br />
Die entscheidende Grundlage für die statische Berechnung<br />
von L<strong>in</strong>ern ist der Zustand des Altrohres. Dazu werden<br />
entsprechend dem gültigen ATV-M 127 drei „Altrohrzustände<br />
unterschieden:<br />
a) Altrohrzustand I: Das Altrohr ist alle<strong>in</strong> tragfähig. In diesem<br />
Fall hat der L<strong>in</strong>er lediglich die Dichtheit des Kanals<br />
herzustellen. Da das Altrohr alle von außen wirkenden<br />
Lasten alle<strong>in</strong>e abtragen kann, wird der L<strong>in</strong>er <strong>in</strong> der<br />
Regel neben se<strong>in</strong>em Eigengewicht lediglich durch das<br />
Grundwasser belastet, das durch Risse oder undichte<br />
Fugen h<strong>in</strong>durchfließt und e<strong>in</strong>en Außendruck aufbaut.<br />
b) Altrohrzustand II: Das Altrohr ist nicht alle<strong>in</strong> tragfähig<br />
und an vier Stellen im Umfang (Scheitel, Kämpfer und<br />
Sohle) längs gerissen. Die dabei entstandenen Viertelschalen<br />
haben sich gegene<strong>in</strong>ander verdreht, wobei der<br />
Querschnitt „ovalisiert“. Der Boden stützt den Kanal,<br />
und es entsteht e<strong>in</strong> Tragsystem, bestehend aus dem<br />
gerissenen Altrohr und dem stützenden Boden, das<br />
so genannte Altrohr-Bodensystem. Ist dieses Altrohr-<br />
Bodensystem standsicher, bef<strong>in</strong>det sich das Altrohr<br />
im Altrohrzustand II. Die E<strong>in</strong>wirkungen s<strong>in</strong>d mit dem<br />
Altrohrzustand I identisch, aber es muss mit e<strong>in</strong>em<br />
„oval“ vorgeformten L<strong>in</strong>er gerechnet werden.<br />
c) Altrohrzustand III: Dieser Altrohrzustand entspricht<br />
dem Altrohrzustand II mit dem entscheidenden<br />
Unterschied, dass die Standsicherheit des Altrohr-<br />
Bodensystems nicht mehr nachweisbar ist. In diesem<br />
Fall hat der L<strong>in</strong>er nicht nur Grundwasserlasten<br />
zu tragen, sondern muss sich zum<strong>in</strong>dest teilweise<br />
an der Aufnahme aller E<strong>in</strong>wirkungen wie Erdlasten,<br />
Verkehrslasten, Auflasten beteiligen. Im Vergleich zu<br />
den Altrohrzuständen I und II s<strong>in</strong>d die E<strong>in</strong>wirkungen<br />
auf den L<strong>in</strong>er im Altrohrzustand III <strong>in</strong> der Regel um<br />
e<strong>in</strong> Vielfaches größer.<br />
In Abhängigkeit vom Altrohrzustand s<strong>in</strong>d für den L<strong>in</strong>er<br />
Imperfektionen anzusetzen, d. h. es ist bei der Berechnung<br />
davon auszugehen, dass die Querschnittsform des<br />
L<strong>in</strong>ers nicht der Soll- oder Ausgangs<strong>in</strong>nenkontur des Altkanals<br />
entspricht, sondern <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er bestimmten Form und<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em bestimmten Ausmaß davon abweicht.<br />
Im derzeit gültigen Regelwerk s<strong>in</strong>d die folgenden drei<br />
Arten von Imperfektionen zu berücksichtigen:<br />
»»<br />
Die örtliche Imperfektion w v<br />
ist e<strong>in</strong>e kurzwellige<br />
Beule und hat <strong>in</strong> statischer H<strong>in</strong>sicht mehrere Aufgaben<br />
zu erfüllen. Erstens entsteht sie tatsächlich bei<br />
(<strong>in</strong>sbesondere im E<strong>in</strong>bauzustand weichen) Schläuchen<br />
durch Buckel <strong>in</strong> der Wandung des Altkanals.<br />
Zweitens soll sie Schwankungen der Werkstoffeigenschaften<br />
im L<strong>in</strong>er abdecken und drittens ist sie e<strong>in</strong>e<br />
re<strong>in</strong> rechnerische Hilfe, um das Beulen des L<strong>in</strong>ers bei<br />
der Berechnung nach Theorie II. Ordnung tatsächlich<br />
auszulösen.<br />
»»<br />
Die Gelenkr<strong>in</strong>gverformung w GR,V<br />
entsteht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
gerissenen Altkanal, wenn sich se<strong>in</strong>e Kämpfer nach<br />
außen sowie Scheitel und Sohle nach <strong>in</strong>nen verschoben<br />
haben und der L<strong>in</strong>er <strong>in</strong> den „ovalisierten“ Kanal<br />
e<strong>in</strong>gebaut wird.<br />
»»<br />
Die Spaltbildung w S<br />
entsteht durch Schw<strong>in</strong>den und/oder<br />
Schrumpfen des L<strong>in</strong>ers oder des H<strong>in</strong>terfüllbaustoffes nach<br />
dem E<strong>in</strong>bau, so dass ke<strong>in</strong> direkter Kontakt zwischen dem<br />
Altrohr und dem L<strong>in</strong>er mehr besteht.<br />
74 11-12 | 2013
ABWASSERENTSORGUNG / SANIERUNG FACHBERICHT<br />
Jeder L<strong>in</strong>er wird neben se<strong>in</strong>em<br />
Eigengewicht durch E<strong>in</strong>wirkungen<br />
aus Grundwasserdruck und<br />
gegebenenfalls aus Erddruck und<br />
Verkehr belastet, die <strong>in</strong> der Statik<br />
durch Teilsicherheitsfaktoren<br />
beaufschlagt werden. Grundsätzlich<br />
s<strong>in</strong>d zwei Versagensarten zu<br />
unterscheiden, die durch entsprechende<br />
Nachweise rechnerisch<br />
auszuschließen s<strong>in</strong>d:<br />
»»<br />
Versagen durch Bruch<br />
»»<br />
Versagen durch Instabilität<br />
(Beulen)<br />
Bruchversagen tritt auf, wenn die<br />
Zug- bzw. Druck-Spannungen im<br />
L<strong>in</strong>er größer s<strong>in</strong>d als die Biegezug-<br />
bzw. Druckfestigkeit des<br />
Werkstoffes. In der Statik erfolgt<br />
die Absicherung gegen dieses<br />
Versagen durch Spannungsoder<br />
Verzerrungsnachweise mit<br />
entsprechenden Teilsicherheitsfaktoren<br />
für die Festigkeiten des<br />
Werkstoffes.<br />
Stabilitätsversagen zeigt sich bei<br />
L<strong>in</strong>ern meist durch e<strong>in</strong>e gegebenenfalls<br />
schlagartig auftretende,<br />
große Verformung (Beule). In der<br />
Statik erfolgt die Absicherung<br />
gegen dieses Versagen durch<br />
Stabilitätsnachweise.<br />
Lastfall Überdeckung Grundwasserstand Imperfektionen<br />
III1 maximal unter Rohrsohle – – + –<br />
III2 maximal maximal – – + –<br />
III3 m<strong>in</strong>imal unter Rohrsohle – – + –<br />
III4 m<strong>in</strong>imal maximal – – + –<br />
II1 – – Bemessungswert 1) + + +<br />
II2 – – maximal + + + 2)<br />
II3 – – maximal + + + 3)<br />
1) Gemäß ATV-M 127-2, Abschnitt 6.3.1.2<br />
2) Unter Berücksichtigung der Gelenkr<strong>in</strong>gaufweitung <strong>in</strong>folge der Verformung des Altrohres aus Lastfall III2<br />
3) Unter Berücksichtigung der Gelenkr<strong>in</strong>gaufweitung <strong>in</strong>folge der Verformung des Altrohres aus Lastfall III4<br />
Tabelle 1: Erforderliche E<strong>in</strong>zelberechnungen beim Altrohrzustand III<br />
Nr.<br />
für Bodenauftrieb als L<strong>in</strong>erbelastung örtlich Gelenkr<strong>in</strong>g<br />
Lastfallkomb<strong>in</strong>ation<br />
Nachweise L<strong>in</strong>er<br />
Nachweise<br />
Altrohr<br />
Biegespannung Stabilität Biege spannung <strong>in</strong><br />
den Viertelschalen<br />
Spalt<br />
Nachweise Gesamtsystem<br />
Stabilität Rohr-<br />
Boden-System<br />
Bettungsreaktionsdruck<br />
K1 III1 + + + + +<br />
K2 III2 + II2 + + + + +<br />
K3 III3 + + + + +<br />
K4 III4 + II3 + + + + +<br />
K5 II1 + + – – –<br />
K6 II2 + + – – –<br />
K7 II3 + + – – –<br />
Tabelle 2: Erforderliche Lastfallkomb<strong>in</strong>ationen und zugehörige Nachweise beim Altrohrzustand III<br />
EINWIRKUNGSKOMBINATION<br />
Alle erforderlichen Nachweise für L<strong>in</strong>er können bei den<br />
Altrohrzuständen I und II mit e<strong>in</strong>em e<strong>in</strong>zigen Rechenlauf<br />
nach Theorie II. Ordnung mit den charakteristischen Lasten<br />
(Spannungs- und Verformungsnachweis) und den γ-fachen<br />
Lasten (Stabilitäts- und Spannungs-nachweis) erbracht<br />
werden. Liegt der Altrohrzustand III vor, ist das Problem<br />
wesentlich komplexer, so dass zumeist ohne genauere<br />
Berechnung nicht vorhersagbar ist, welche E<strong>in</strong>wirkungskomb<strong>in</strong>ation<br />
zu den größten Beanspruchungen führt oder<br />
das Stabilitätsversagen zuerst auslöst. So bewirkt beispielsweise<br />
e<strong>in</strong> s<strong>in</strong>kender Grundwasserstand e<strong>in</strong>erseits e<strong>in</strong>e<br />
Verr<strong>in</strong>gerung des Außenwasserdrucks auf den L<strong>in</strong>er und<br />
somit e<strong>in</strong>e Beanspruchungsm<strong>in</strong>derung, andererseits aber<br />
auch e<strong>in</strong>e Erhöhung der Erdlast auf das Altrohr, wodurch<br />
der L<strong>in</strong>er <strong>in</strong>direkt höher beansprucht wird. Welcher E<strong>in</strong>fluss<br />
größer ist, lässt sich <strong>in</strong> der Regel nicht voraussagen,<br />
so dass beide Fälle überprüft werden müssen. E<strong>in</strong> analoges<br />
Problem besteht bei der Wahl der ungünstigsten<br />
Erdüberdeckung, da mit abnehmender Tiefe zwar die<br />
Erdlast abnimmt, die Verkehrslast aber zunimmt.<br />
Aus diesen Gründen ist der Rechenaufwand beim Vorliegen<br />
des Altrohrzustandes III <strong>in</strong>sbesondere dann wesentlich<br />
größer, wenn der Kanal im Grundwasser liegt und die Überdeckungshöhe<br />
nicht konstant ist. In diesem Fall müssen die<br />
folgenden E<strong>in</strong>wirkungssituationen erfasst werden:<br />
»»<br />
Höchster und niedrigster Grundwasserstand<br />
»»<br />
Größte und kle<strong>in</strong>ste Überdeckung<br />
»»<br />
Erd- und Verkehrslasten auf dem Altrohr<br />
Wie Tabelle 1 und Tabelle 2 zeigen, müssen im Standardfall<br />
vier Berechnungen des Altrohrzustandes III und<br />
drei Berechnungen des Altrohrzustandes II durchgeführt<br />
werden, deren Ergebnisse zu <strong>in</strong>sgesamt sieben Lastfallkomb<strong>in</strong>ationen<br />
überlagert werden müssen. Dabei ist<br />
sogar bereits vere<strong>in</strong>fachend vorausgesetzt, dass der niedrigste<br />
Grundwasserstand stets unterhalb der Rohrsohle<br />
liegt. Diese Annahme liegt auf der sicheren Seite und<br />
ist <strong>in</strong> der Regel s<strong>in</strong>nvoll, da damit auch e<strong>in</strong>e eventuelle<br />
Grundwasserabsenkung für e<strong>in</strong>e benachbarte Baumaßnahme<br />
im Laufe der Betriebsdauer abgedeckt wird.<br />
Obwohl somit eigentlich nur die Beanspruchungen aus<br />
dem höchsten Grundwasserstand zu ermitteln s<strong>in</strong>d, müssen<br />
drei verschiedene Berechnungen für re<strong>in</strong>en Grundwasserdruck<br />
(II1 bis II3) durchgeführt werden. E<strong>in</strong>e dieser<br />
E<strong>in</strong>zelberechnungen muss unter Beachtung des M<strong>in</strong>destgrundwasserstandes<br />
nach Regelwerk (m<strong>in</strong>destens<br />
10 cm über Scheitel und m<strong>in</strong>destens 1,5 m über Sohle)<br />
11-12 | 2013 75
FACHBERICHT ABWASSERENTSORGUNG / SANIERUNG<br />
Bild 1: Ergebnisdarstellung e<strong>in</strong>er vollständigen L<strong>in</strong>erstatik für den Altrohrzustand III (© EasyPipe)<br />
vorgenommen werden. Darüber h<strong>in</strong>aus ist sowohl für die<br />
höchste als auch für die niedrigste Erdüberdeckung e<strong>in</strong>e<br />
eigene Berechnung für höchsten tatsächlichen Grundwasserstand<br />
durchzuführen, da die jeweilige Vergrößerung<br />
des R<strong>in</strong>gspaltes <strong>in</strong>folge der lastabhängigen Gelenkr<strong>in</strong>gaufweitung<br />
das Ergebnis bee<strong>in</strong>flusst.<br />
NACHWEISKONZEPT<br />
In allen sieben Überlagerungsfällen müssen für den L<strong>in</strong>er<br />
die Nachweise für die Bruchsicherheit (Biegespannung)<br />
und die Beulsicherheit (Stabilität) geführt werden. Aber<br />
auch für das Altrohr muss nachgewiesen werden, dass<br />
die Viertelschalen zwischen den Rissen nicht unzulässig<br />
beansprucht werden.<br />
Insbesondere bei e<strong>in</strong>er weichen Bettung des Altrohres im<br />
Boden ist e<strong>in</strong> Stabilitätsversagen des Gesamtsystems (e<strong>in</strong><br />
gegebenenfalls schlagartiger E<strong>in</strong>sturz des Kanals) trotz<br />
L<strong>in</strong>er möglich, so dass auch das Rohr-Bodensystem <strong>in</strong><br />
dieser H<strong>in</strong>sicht nachzuweisen ist. Darüber h<strong>in</strong>aus begrenzt<br />
das M 127 den Bettungsreaktionsdruck, um <strong>in</strong>sbesondere<br />
bei ger<strong>in</strong>gen Überdeckungen sicherzustellen, dass<br />
der Bettungsreaktionsdruck den aktivierbaren passiven<br />
Erddruck nicht überschreitet.<br />
Das neue L<strong>in</strong>ermodul des Statikprogramms IngSoft<br />
EasyPipe führt die beschriebenen Berechnungen und<br />
Komb<strong>in</strong>ationen <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es umfangreichen Rechenlaufs<br />
selbständig aus. Bild 1 zeigt beispielhaft e<strong>in</strong>e stark<br />
komprimierte Ergebnisdarstellung e<strong>in</strong>er L<strong>in</strong>erberechnung<br />
für den Altrohrzustand III mit allen erforderlichen<br />
Nachweisen.<br />
Mit e<strong>in</strong>em entsprechend leistungsfähigen und praxisnahen<br />
Berechnungsprogramm lässt sich auch die komplexe<br />
L<strong>in</strong>erstatik beim Altrohrzustand III komfortabel<br />
durchführen.<br />
Dr.-Ing. DIETMAR BECKMANN<br />
S&P Consult GmbH, Bochum<br />
Tel.+ 49 234 5167-181<br />
E-Mail: dietmar.beckmann@ste<strong>in</strong>.de<br />
JACQUES KOHLER<br />
IngSoft GmbH, Nürnberg<br />
Tel. +49 911 430879-16<br />
E-Mail: jacques.kohler@<strong>in</strong>gsoft.de<br />
AUTOREN<br />
76 11-12 | 2013
sichere und effiziente<br />
Rohrleitungssysteme<br />
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
Jetzt bestellen!<br />
Nutzen Sie das Know-how der führenden fachzeitschrift<br />
für die entwicklung, den e<strong>in</strong>satz und Betrieb von Rohrleitungen,<br />
Komponenten und Verfahren im Bereich der<br />
Gas- und Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung,<br />
der Nah- und fernwärmeversorgung, des Anlagenbaus<br />
und der Pipel<strong>in</strong>etechnik.<br />
Wählen Sie e<strong>in</strong>fach das Bezugsangebot, das Ihnen zusagt:<br />
als Heft, ePaper oder Heft + ePaper!<br />
<strong>3R</strong> ersche<strong>in</strong>t <strong>in</strong> der Vulkan-Verlag GmbH, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen<br />
Wissen füR DIe<br />
Zukunft<br />
Vorteilsanforderung per fax: +49 Deutscher 931 Industrieverlag / 4170-494 GmbH | Arnulfstr. oder 124 abtrennen | 80636 München und im fensterumschlag e<strong>in</strong>senden<br />
Ja, ich möchte <strong>3R</strong> regelmäßig lesen.<br />
Bitte schicken Sie mir das Fachmagaz<strong>in</strong> für zunächst e<strong>in</strong> Jahr (8 Ausgaben)<br />
als Heft für € 275,- zzgl. Versand<br />
(Deutschland: € 24,- / Ausland: € 28,-).<br />
als ePaper (E<strong>in</strong>zellizenz) für € 275,-<br />
als Heft + ePaper für € 381,50<br />
(Deutschland) / € 385,50 (Ausland).<br />
Für Schüler / Studenten (gegen Nachweis) zum Vorzugspreis<br />
als Heft für € 137,50 zzgl. Versand<br />
(Deutschland: € 24,- / Ausland: € 28,-).<br />
als ePaper (E<strong>in</strong>zellizenz) für € 137,50<br />
als Heft + ePaper für € 202,75<br />
(Deutschland) / € 206,75 (Ausland).<br />
Nur wenn ich nicht bis 8 Wochen vor Bezugsjahresende kündige, verlängert sich der Bezug um e<strong>in</strong><br />
Jahr. Die sichere, pünktliche und bequeme Bezahlung per Bankabbuchung wird mit e<strong>in</strong>er Gutschrift<br />
von € 20,- auf die erste Rechnung belohnt.<br />
firma/Institution<br />
Vorname, Name des empfängers<br />
Straße / Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Antwort<br />
Leserservice <strong>3R</strong><br />
Postfach 91 61<br />
97091 Würzburg<br />
e-Mail<br />
Branche / Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise Bankabbuchung Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung <strong>in</strong>nerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen <strong>in</strong> Textform (z.B.<br />
Brief, fax, e-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die frist beg<strong>in</strong>nt nach erhalt dieser Belehrung <strong>in</strong> Textform. Zur<br />
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an den Leserservice <strong>3R</strong>, Postfach<br />
9161, 97091 Würzburg.<br />
Bankleitzahl<br />
nutzung personenbezogener Daten: für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit e<strong>in</strong>verstanden, dass ich<br />
vom DIV Deutscher 11-12 Industrieverlag | 2013 oder vom Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per e-Mail, nicht über <strong>in</strong>teressante, fachspezifische Medien und Informationsangebote <strong>in</strong>formiert und beworben werde.<br />
77<br />
Diese erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.<br />
✘<br />
Ort, Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer<br />
PA<strong>3R</strong>IN0313
FACHBERICHT ABWASSERENTSORGUNG / SANIERUNG<br />
Schlauchl<strong>in</strong>erprüfungen – Teil 1:<br />
Überblick<br />
Für die Sanierung schadhafter Kanalisationen ist das Verfahren Schlauchl<strong>in</strong>er mittlerweile zu e<strong>in</strong>em Standard avanciert<br />
und nicht mehr wegzudenken. Da sich die Herstellung des Gewerks Schlauchl<strong>in</strong>er auf die Baustelle, mit all ihren<br />
Eigenheiten und auch Nachteilen, konzentriert, kommt der Überwachung dieser Systeme e<strong>in</strong>e besondere Bedeutung zu.<br />
Die Rahmenbed<strong>in</strong>gungen ändern sich selbstverständlich bei jeder Sanierungsmaßnahme und teilweise natürlich auch<br />
während der Sanierung. Deshalb kann hierbei ke<strong>in</strong> standardisiertes Produkt, wie es z. B. bei der werkseitigen Fertigung<br />
produziert wird, entstehen. Hierbei ist vor allem die Erfahrung der bauausführenden Personen von wesentlicher Bedeutung,<br />
denn mit ihnen steht und fällt die Baumaßnahme.<br />
Im Rahmen der Qualitätssicherung ist neben der baubegleitenden<br />
und bauüberwachenden Tätigkeit selbstverständlich<br />
die planerische und ausschreibende Tätigkeit von wesentlicher<br />
Bedeutung. E<strong>in</strong>e nicht vorhandene oder schlechte<br />
Planung bzw. e<strong>in</strong> lückenhaftes Leistungsverzeichnis führt<br />
<strong>in</strong> der Regel zu Problemen auf der Baustelle, die oftmals<br />
Mängel oder Nachträge nach sich ziehen. Hier sei auf die<br />
e<strong>in</strong>schlägigen Regelwerke bzw. Arbeitshilfen der DWA, des<br />
DIN bzw. der GAEB h<strong>in</strong>gewiesen.<br />
Die Feststellung dieser Defizite erfolgt oftmals erst nach<br />
Abschluss der Baumaßnahme, also wenn nur noch wenig<br />
Handlungsspielraum bleibt. Nun, warum ist das so? Dem<br />
Leser stellt sich doch die Frage, warum ke<strong>in</strong>e Prüfung im<br />
Vorfeld erfolgen kann, wie das bei anderen standardisierten<br />
Produkten der Fall ist (CE-Kennzeichnung). Die Antwort<br />
hierauf ist recht e<strong>in</strong>fach: Es gibt „das standardisierte Produkt<br />
Schlauchl<strong>in</strong>er“ <strong>in</strong> dem S<strong>in</strong>ne eigentlich gar nicht. Z. B.<br />
e<strong>in</strong>e Yacht aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff – also<br />
im gewissen S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong> Schlauchl<strong>in</strong>er) entsteht immer unter<br />
annähernd gleichen Bed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Fertigungshalle,<br />
bei annähernd gleichen Temperaturen und Feuchte- bzw.<br />
Härtungsbed<strong>in</strong>gungen und gleichen Harz-/Härterbed<strong>in</strong>gungen.<br />
Dies stellt die Warene<strong>in</strong>gangskontrolle bzw. die<br />
Produktionsüberwachung sicher.<br />
SCHWIERIGKEIT 1: HETEROGENER<br />
VERBUNDWERKSTOFF<br />
Wie soll das bei e<strong>in</strong>em Produkt, das erst auf der Baustelle<br />
entsteht, funktionieren? In den e<strong>in</strong>schlägigen Normenkommissionen<br />
wird seit Jahren die Möglichkeit e<strong>in</strong>er CE-<br />
Kennzeichnung für Schlauchl<strong>in</strong>er diskutiert. Aber auch diese<br />
Fachgremien sehen sich <strong>in</strong> diesem Fall vor e<strong>in</strong>e unlösbare<br />
Aufgabe gestellt. Immer wieder hört man von <strong>in</strong>dustrieller<br />
Seite, dass sich die Materialkomponenten und das Aushärteprocedere<br />
nicht ändern, weshalb jeder Schlauchl<strong>in</strong>er<br />
identische Materialkennwerte haben müsste. Weit gefehlt.<br />
Hier s<strong>in</strong>d es die Randbed<strong>in</strong>gungen der Sanierung, die diese<br />
Betrachtungsweise erschwert. Selbst <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es L<strong>in</strong>ers<br />
s<strong>in</strong>d größere Schwankungen ke<strong>in</strong>e Seltenheit, da es sich bei<br />
dem Produkt Schlauchl<strong>in</strong>er um e<strong>in</strong>en heterogenen Verbundwerkstoff<br />
handelt, der e<strong>in</strong>e solche Schwankung materialbed<strong>in</strong>gt<br />
mit sich br<strong>in</strong>gt. Jeder <strong>in</strong>homogene Werkstoff, z. B.<br />
Verbundwerkstoff, unterliegt diesen Materialschwankungen.<br />
Auch wenn sich diese Aussage beim ersten Lesen nicht<br />
vertrauenswürdig anhört, so kommen solche Werkstoffe<br />
z. B. <strong>in</strong> Flugzeugen oder Rennwagen vor, denen man sogar<br />
h<strong>in</strong> und wieder se<strong>in</strong> Leben anvertraut (für die meisten der<br />
Leser ist diese Aussage natürlich auf Flugzeuge beschränkt).<br />
SCHWIERIGKEIT 2: FAKTOR BAUSTELLE UND<br />
FAKTOR MENSCH<br />
Gerade der Faktor Baustelle und vor allem auch der Faktor<br />
Mensch spielen bei der Qualität des entstehenden Produkts<br />
Schlauchl<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>e wesentliche Rolle. Die Baustellenbed<strong>in</strong>gungen<br />
Temperatur, Luftfeuchte, Taupunkt, Platzangebot,<br />
L<strong>in</strong>er (Harz- bzw. Härtertemperatur, Alter des Harzes/Härters),<br />
Prel<strong>in</strong>er ja oder ne<strong>in</strong>, und die Zeit, um nur e<strong>in</strong>ige zu<br />
nennen, bestimmen das Endprodukt ebenso wie der Faktor<br />
Mensch. E<strong>in</strong>e Sanierungskolonne, die 12 bis 15 Stunden pro<br />
Tag an sechs Tagen pro Woche arbeitet, wird mit Sicherheit<br />
weniger konzentriert oder engagiert an den E<strong>in</strong>bau herangehen<br />
als e<strong>in</strong>e Kolonne, die nur acht bis zehn Stunden am<br />
Tag arbeitet. Stellen Sie sich Folgendes vor: Es ist Freitag,<br />
Ihre Arbeitswoche hatte ca. 48 Stunden, es regnet <strong>in</strong> Strömen<br />
bei ca. 5 °C und Sie wissen, der letzte L<strong>in</strong>er ist gegen<br />
19:00 Uhr fertig – danach drei Stunden Arbeitsweg plus e<strong>in</strong>e<br />
Stunde Heimweg. Man muss erkennen, dass unter gewissen<br />
E<strong>in</strong>flüssen sowohl Konzentration als auch Arbeitswut<br />
empf<strong>in</strong>dliche E<strong>in</strong>bußen erleiden können. So kann z. B. e<strong>in</strong><br />
sehr guter Koch auch aus m<strong>in</strong>derwertigeren Materialien<br />
e<strong>in</strong>e Mahlzeit zubereiten, e<strong>in</strong>e „Gaumenfreude“ wird es<br />
allerd<strong>in</strong>gs erst mit den entsprechenden Zutaten. E<strong>in</strong> schlechter<br />
Koch h<strong>in</strong>gegen wird auch aus den besten Zutaten nur<br />
maximal e<strong>in</strong>e Mahlzeit kreieren können. Da das „Menü“<br />
Schlauchl<strong>in</strong>er vor Ort entsteht, spielt ebenfalls die Aus- und<br />
Weiterbildung des technischen Personals e<strong>in</strong>e wesentliche<br />
Rolle und trägt damit zum Sanierungserfolg bei 1 .<br />
Insofern hat das Produkt Schlauchl<strong>in</strong>er viele Freiheitsgrade<br />
<strong>in</strong> Bezug auf se<strong>in</strong>e Qualität. Nichtsdestotrotz steht am<br />
1 Schlauchl<strong>in</strong>erprüfungen, J. Sebastian, <strong>3R</strong> International – Zeitschrift für die<br />
Rohrleitungspraxis (46) 10/2007; Vulkan Verlag GmbH<br />
78 11-12 | 2013
ABWASSERENTSORGUNG / SANIERUNG FACHBERICHT<br />
Ende e<strong>in</strong>er Sanierungsmaßnahme e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>wandfreie Leistung<br />
und vor allem auch e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>wandfreies Produkt, das <strong>in</strong><br />
der Planung und Leistungsbeschreibung gefordert wurde.<br />
Die Schwierigkeit für die Polymerchemiker, die solche<br />
Harz-/Härtersysteme entwickeln, besteht nun dar<strong>in</strong>, die<br />
Verträglichkeit der Produkte so anzupassen, dass auch<br />
unter all diesen zugegebenermaßen recht ungünstigen<br />
Bed<strong>in</strong>gungen e<strong>in</strong> mangelfreies Produkt entstehen kann.<br />
NORMEN UND REGELWERKE<br />
Die am Markt bef<strong>in</strong>dlichen zugelassenen Systeme s<strong>in</strong>d von<br />
den verwendeten Materialien so aufe<strong>in</strong>ander abgestimmt,<br />
dass auch ungünstige Rahmenbed<strong>in</strong>gungen während des<br />
E<strong>in</strong>baus kompensiert werden können. Werden nun Harz-<br />
Härter-Trägermaterial oder Füllstoffe unterschiedlicher<br />
Anbieter nach momentan günstigstem Preis e<strong>in</strong>gekauft<br />
und gemischt, schrumpft diese „Materialtoleranz“ und<br />
die damit verbundenen Materialkennwerte verändern sich<br />
<strong>in</strong> der Regel zum Nachteil. Da sich je nach Systemzusammensetzung<br />
z. B. die mechanischen Eigenschaften drastisch<br />
ändern, liefert die Normung (DIN EN ISO 11296-4)<br />
bzw. die e<strong>in</strong>schlägigen Regelwerke e<strong>in</strong>e Vorgehensweise,<br />
die Grundeigenschaften e<strong>in</strong>es Systems festzustellen und<br />
damit e<strong>in</strong>e Qualität festzuschreiben, die es dann auf der<br />
Baustelle zu sichern gilt. In den letzten Jahren hat sich <strong>in</strong><br />
Deutschland neben dieser „assessment of conformity“<br />
– also der „Konformitätsbewertung“ der entsprechenden<br />
Normung (z. B. Annex A der DIN EN 13566) auch<br />
die DIBt-Zulassung als e<strong>in</strong> solches Instrument etabliert.<br />
Liegt e<strong>in</strong>e solche Zulassung vor, kann man getrost davon<br />
ausgehen, dass das jeweilige System auf „Herz und Nieren“<br />
geprüft wurde und somit alle baustellenrelevanten<br />
Materialkennwerte <strong>in</strong> dieser Zulassung festgeschrieben<br />
wurden, um das entstehende System umfassend charakterisieren<br />
zu können. Als wesentlicher Bestandteil dieser<br />
Untersuchungen können die mechanischen Langzeitkenndaten<br />
(Kriechneigung) als Grundlage der statischen<br />
Berechnung herangezogen werden. Des Weiteren s<strong>in</strong>d<br />
die baustellenrelevanten Kenndaten h<strong>in</strong>terlegt, die e<strong>in</strong>e<br />
abschließende Qualitätssicherung (Materialprobe) überhaupt<br />
erst möglich machen.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs ist das Ergebnis der Materialanalyse selbstverständlich<br />
nur so gut wie das dem Labor zur Verfügung<br />
gestellte Probestück. Hierbei liegt e<strong>in</strong> großes Problem der<br />
Überwachung e<strong>in</strong>es solchen Systems. Nach DWA M 144-3<br />
muss das entnommene Probestück den Schlauchl<strong>in</strong>er aus<br />
der Haltung widerspiegeln, d. h. repräsentativ se<strong>in</strong>. Unter<br />
Annahme der Repräsentativität kann nun e<strong>in</strong> Rückschluss<br />
ausgehend von dem Probestück auf den Schlauchl<strong>in</strong>er<br />
durchgeführt werden. Allerd<strong>in</strong>gs sieht die Realität hierbei<br />
leider oft ganz anders aus.<br />
MANGELNDE REPRÄSENTATIVITÄT VON PROBEN<br />
Die Proben, die im Labor zur Untersuchung und eventuell<br />
zur Bewertung ankommen, entsprechen häufig nicht den<br />
Vorgaben der Regelwerke <strong>in</strong> Bezug auf z. B. die Größe oder<br />
es ist e<strong>in</strong>deutig erkennbar, dass das abgegebene Probestück<br />
ke<strong>in</strong>em Widerlager zur Simulation der Kanalwandung<br />
ausgesetzt war, was zu e<strong>in</strong>er Überdehnung der Probe und<br />
somit zu e<strong>in</strong>em Verfälschen der Analyseergebnisse führt.<br />
Die Bewertung durch das Labor kann <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em solchen<br />
Fall fehlerhaft se<strong>in</strong>, da das Analyselabor außer der Probe<br />
<strong>in</strong> der Regel ke<strong>in</strong>erlei Informationen oder aussagekräftige<br />
Unterlagen zur Baustelle erhält. Also obliegt es dem Analysten,<br />
sich anhand des gelieferten Probestücks e<strong>in</strong> Bild vom<br />
Zustand des Schlauchl<strong>in</strong>ers zu machen, allerd<strong>in</strong>gs ohne<br />
(und das ist <strong>in</strong> der Regel die Forderung) auf kosten<strong>in</strong>tensive<br />
Analysemethoden zurückzugreifen. Umso wichtiger ist es,<br />
sich vom ordnungsgemäßen Zustand des Probestücks zu<br />
überzeugen. Sehr viele Mängel, wie z. B. Überdehnung der<br />
Probe, extreme Re<strong>in</strong>harzschichten im Außenbereich usw.<br />
können auf der Baustelle von Seiten der ausführenden Firma<br />
und dem Auftraggeber erkannt werden. E<strong>in</strong>e solche Probe<br />
sollte aufgrund mangelnder Repräsentativität nicht an das<br />
Analyselabor übersandt werden.<br />
Gerade die Re<strong>in</strong>harzschichten im Außenbereich der Probe<br />
bereiten den Prüflaboren zunehmend Kopfzerbrechen.<br />
Während die Forderung der Norm DIN EN ISO 11296-4<br />
am Punkt „B.3.2 Dicke: Die Verbunddicke <strong>in</strong>nerhalb des<br />
mittleren Drittels der Länge jedes e<strong>in</strong>zelnen Probekörpers<br />
darf an ke<strong>in</strong>er Stelle mehr als 10 % von deren Mittelwert<br />
abweichen 2 “, e<strong>in</strong>deutig ist, können hier durchaus<br />
Probleme auftreten.<br />
Als kle<strong>in</strong>es Rechenbeispiel sollte e<strong>in</strong> Schlauchl<strong>in</strong>er DN 300<br />
mit e<strong>in</strong>er Wandstärke von 5 mm dienen. Die Abweichung<br />
vom Mittelwert darf demnach 0,5 mm (!) betragen. Bei<br />
e<strong>in</strong>em Werkstoff, der vor Ort im Kanal entsteht, kann dies<br />
durchaus e<strong>in</strong>e anspruchsvolle Forderung se<strong>in</strong>. E<strong>in</strong> weiteres<br />
Kriterium lässt sich aus der Norm DIN EN ISO 11296-4<br />
Tabelle 4 ableiten, wonach die M<strong>in</strong>destwanddicke des<br />
Verbundes, also des Harz-Trägermaterialsystems ohne<br />
nicht tragende Schichten wie Folien oder Re<strong>in</strong>harzbereiche,<br />
m<strong>in</strong>destens 80 % oder 3 mm (der größere Wert<br />
zählt) der Konstruktionswanddicke se<strong>in</strong> muss.<br />
Das bedeutet, dass das statisch tragende System nicht<br />
weniger als 80 % des Gesamtsystems se<strong>in</strong> darf, oder<br />
anders ausgedrückt, die Re<strong>in</strong>harz- und Folienschichten<br />
zusammen dürfen nicht mehr als 20 % der Gesamtwandstärke<br />
ausmachen. Das hört sich zunächst recht e<strong>in</strong>fach<br />
an, ist es allerd<strong>in</strong>gs <strong>in</strong> der Realität nicht. Gerade die immer<br />
größer werdende Gruppe der glasfaserverstärkten Lam<strong>in</strong>ate<br />
kann, durch z. B. e<strong>in</strong>e beengte Probenahmesituation<br />
und dadurch fehlende Simulation der Rohrwandung, <strong>in</strong><br />
Konflikt mit diesem Kriterium kommen. Als Folge daraus<br />
und der Forderung der DWA M 144-3 nach e<strong>in</strong>er repräsentativen<br />
Probe muss es zum Verwerfen der Probe durch<br />
das Prüflabor und zu e<strong>in</strong>er erneuten Probenahme aus der<br />
Haltung kommen. Der Aufwand hierfür ist alles andere<br />
als ger<strong>in</strong>g e<strong>in</strong>zuschätzen und sollte demnach möglichst<br />
vermieden werden.<br />
Diese Forderungen stellen an das betreffende Prüflabor<br />
auch erhöhte Anforderungen, da die Bestimmung der<br />
2 DIN EN ISO 11296-4: 2011<br />
11-12 | 2013 79
FACHBERICHT ABWASSERENTSORGUNG / SANIERUNG<br />
Bild 1: Schwierigkeit Wandstärkenbestimmung, hier die L<strong>in</strong>erwanddicke<br />
<strong>in</strong> Orig<strong>in</strong>algröße<br />
Bild 2: Die gleiche Probe aufgenommen mit e<strong>in</strong>em Messmikroskop<br />
Probe<br />
Verbundwandstärke aufgrund der Vielfalt der Systeme<br />
und Wandaufbauten nicht mehr trivial ist. In unserem<br />
Institut werden z. B. mikroskopische Aufnahmen der<br />
Wandaufbauten durchgeführt, um die Lage der tragenden<br />
Glasfasern e<strong>in</strong>deutig und zweifelsfrei bestimmen zu<br />
können. Da es sich hierbei um Unterschiede im Zehntel-<br />
mechanische Analyse<br />
chemische Analyse<br />
thermoanalytische<br />
Untersuchungen<br />
3-Punkt Biegung<br />
Scheiteldruckversuch<br />
Kriechneigung<br />
FT-IR<br />
Chromatographie<br />
DSC<br />
DMA<br />
bzw. Hunderstelmillimeterbereich handelt, ist die re<strong>in</strong>e<br />
optische Bestimmung im Streitfall nicht mehr geeignet,<br />
um belastbare Beweise anzuführen zu können.<br />
An Bild 1 ist die Schwierigkeit dieser Wandstärkenbestimmung<br />
deutlich sichtbar. Bild 1 beschreibt die L<strong>in</strong>erwanddicke<br />
<strong>in</strong> Orig<strong>in</strong>algröße, Bild 2 zeigt die gleiche Probe<br />
aufgenommen mit e<strong>in</strong>em Messmikroskop.<br />
S<strong>in</strong>d all diese vorbereitenden Arbeiten, Überlegungen<br />
und Untersuchungen abgeschlossen, kann es im Labor<br />
zur Untersuchung der Probe kommen. Neben den herkömmlichen<br />
„klassischen“ mechanischen Prüfverfahren,<br />
werden neuerd<strong>in</strong>gs immer häufiger chemische oder thermoanalytische<br />
Analyseverfahren zur Charakterisierung<br />
von Schlauchl<strong>in</strong>ern herangezogen. Diese „neuen“ Verfahren<br />
liefern <strong>in</strong> der Regel ke<strong>in</strong>e gewohnten Größen<br />
wie N/mm 2 oder MPa, was die Bewertung e<strong>in</strong>er solchen<br />
Analyse schwierig ersche<strong>in</strong>en lässt 3 .<br />
Im Rahmen dieser Reihe werden nun diese Prüfverfahren<br />
erläutert und der S<strong>in</strong>n und Zweck der e<strong>in</strong>zelnen Prüfungen<br />
beleuchtet. Die Untersuchung der auf der Baustelle<br />
gewonnenen Probestücke kann <strong>in</strong> drei grundsätzliche<br />
Untersuchungsmethoden unterschieden werden:<br />
1. mechanische Analysen<br />
2. chemische Analysen<br />
3. thermoanalytische Untersuchungen<br />
Bild 3 gibt e<strong>in</strong>e Übersicht der zurzeit angewendeten Analyseverfahren.<br />
Als Standardanalysen werden hierbei die<br />
mechanischen Analysen und <strong>in</strong>sbesondere der 3-Punkt<br />
Biegeversuch angewendet.<br />
sonstige<br />
Bild 3: Übersicht der Analysemethoden<br />
3 Schlauchl<strong>in</strong>erprüfungen, J. Sebastian, <strong>3R</strong> International – Zeitschrift für die<br />
Rohrleitungspraxis (46) 10/2007; Vulkan Verlag GmbH<br />
80 11-12 | 2013
„SCHLAUCHLINER-SERIE“<br />
Dieser Fachbericht ist der erste Teil e<strong>in</strong>er fünfteiligen<br />
Serie. Im 2. Teil dieser Veröffentlichungsreihe werden<br />
die mechanischen Untersuchungen beleuchtet, die z. T.<br />
bei der sogenannten Eignungsprüfung der Systeme zum<br />
Tragen kommen oder aber als Bewertungskriterium zur<br />
Baustellenüberprüfung herangezogen werden. Hierbei<br />
handelt es sich um Standardprüfungen, die bei jeder<br />
L<strong>in</strong>ermaßnahme durchgeführt werden müssen.<br />
Der 3. Teil dieser Veröffentlichungsreihe befasst sich mit<br />
dem Bereich der chemischen Analyse. Was sich zunächst<br />
sehr trocken und wissenschaftlich anhört, hat allerd<strong>in</strong>gs<br />
seit langem se<strong>in</strong>e Berechtigung im Bereich der Bewertung<br />
von Produkten erreicht. Dieser Teil wird vornehmlich die<br />
Frage klären, welche Prüfung wofür S<strong>in</strong>n macht und<br />
welche Ergebnisse man daraus gew<strong>in</strong>nen kann.<br />
Im 4. Teil der Reihe beschäftige ich mich mit dem Gebiet<br />
der thermischen Analyse, was als wichtigster Analysebauste<strong>in</strong><br />
im Bereich der Kunststoffe angesehen werden kann.<br />
Bei diesen Analyseverfahren geht es um die Fragestellung,<br />
welche Informationen man z. B. durch das Aufheizen oder<br />
gezielte Verbrennen e<strong>in</strong>es Kunststoffs erhalten kann.<br />
Auch diese Fragestellung hört sich zunächst sehr theoretisch<br />
an, liefert aber ganz konkrete Aussagen über z. B.<br />
den Aushärtegrad e<strong>in</strong>es Schlauchl<strong>in</strong>ers.<br />
Im 5. und letzten Teil dieser Veröffentlichungsreihe werde<br />
ich e<strong>in</strong>e statistische Auswertung über ca. 30.000 L<strong>in</strong>erprüfungen,<br />
also ca. 150.000 E<strong>in</strong>zelprüfungen präsentieren,<br />
die e<strong>in</strong>en Querschnitt über die Entwicklung dieses<br />
Produkts der letzten acht Jahre aus der Sicht e<strong>in</strong>es Prüflabors<br />
aufzeigt.<br />
presented by IFAT CHINA | EPTEE | CWS<br />
No.1 Environmental Trade Show <strong>in</strong> Asia<br />
International Trade Fair for Water,<br />
Sewage, Refuse, Recycl<strong>in</strong>g, Air Pollution Control<br />
and Energy Conservation<br />
Water and Sewage Treatment Show Area<br />
Waste Management Show Area<br />
Site Remediation Show Area<br />
Air Pollution Control and Air Purification Show Area<br />
AUTOR<br />
Dr. rer. nat. JÖRG SEBASTIAN<br />
SBKS GmbH & Co. KG, St. Wendel<br />
Tel. +49 6851 80008-30<br />
E-Mail: dr.sebastian@sbks.de<br />
May 20 – 22, 2014<br />
Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)<br />
www.ie-expo.com<br />
Officially Supported by<br />
M<strong>in</strong>istry of Environmental Protection of the<br />
People's Republic of Ch<strong>in</strong>a<br />
Ch<strong>in</strong>a Association for Science and Technology<br />
Co-organized by<br />
11-12 | 2013 81
PROJEKT KURZ BELEUCHTET ABWASSERENTSORGUNG / SANIERUNG<br />
Sanierung e<strong>in</strong>er Druckrohrleitung<br />
DN 300 im V<strong>in</strong>schgau/Südtirol<br />
Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet zum Berg – dieses geflügelte Wort beschreibt recht<br />
genau die Voraussetzungen für die Sanierung e<strong>in</strong>er Druckrohrleitung der im oberen Teil des Etschtals <strong>in</strong> Südtirol<br />
gelegenen Beregnungsanlage Tartsch-Mals. Im Auftrag des Bonifizierungskonsortiums V<strong>in</strong>schgau hat die ROTECH<br />
Srl, e<strong>in</strong> italienisches Tochterunternehmen der Dir<strong>in</strong>ger & Scheidel Rohrsanierung GmbH & Co. KG, rund 800 m e<strong>in</strong>er<br />
Leitung aus stark korrodierten Stahlrohren <strong>in</strong> der Nennweite DN 300 mit e<strong>in</strong>em RS-BlueL<strong>in</strong>er ® ausgekleidet.<br />
Bei der Ausführung der Arbeiten <strong>in</strong> rund 1.000 m Höhe<br />
haben die Sanierungsprofis von ROTECH die Anlagentechnik<br />
fit fürs Gelände gemacht und Geräte und Spezialausrüstung<br />
den Erfordernissen angepasst: Aufgrund des für<br />
Baufahrzeuge nur schwer zugänglichen Baufeldes wurde<br />
die für den E<strong>in</strong>bau des L<strong>in</strong>ers nötige Dampfanlage im<br />
Conta<strong>in</strong>er vom Fahrzeug gehoben und mit e<strong>in</strong>em Bagger<br />
zur E<strong>in</strong>baustelle transportiert. Ebenso wie der L<strong>in</strong>er selbst,<br />
der nach der Tränkung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er zentral positionierten<br />
Tränkanlage mit geeignetem Gerät zur Dampfanlage<br />
gefahren wurde. Diese Maßnahmen haben entscheidend<br />
dazu beigetragen, dass die Sanierungsarbeiten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
nur knapp bemessenen Zeitfenster <strong>in</strong> den W<strong>in</strong>termonaten,<br />
<strong>in</strong> denen sich die Beregnungsanlagen außer Betrieb<br />
bef<strong>in</strong>den, erfolgreich durchgeführt werden konnten.<br />
Die rund 550 ha große Beregnungsanlage Tartsch-Mals ist<br />
e<strong>in</strong>e von 50 Anlagen, die die Bewässerung der landwirtschaftlich<br />
genutzten Flächen im V<strong>in</strong>schgau sicherstellen.<br />
Regelmäßig werden die Leitungen überprüft und – wenn<br />
nötig – im Auftrag des für die Wartung der Anlagen<br />
zuständigen Bonifizierungskonsortium V<strong>in</strong>schgau saniert.<br />
So auch die Anlage Tartsch-Mals, deren Leitungen aus<br />
Stahlrohren nach rund 30-jähriger Nutzung <strong>in</strong> Teilen<br />
starke Korrosionsschäden aufwiesen. Aufgrund der geomorphologischen<br />
Rahmenbed<strong>in</strong>gungen und mit Blick auf<br />
Umweltschutzaspekte entschied sich der Auftraggeber<br />
für e<strong>in</strong> statisch tragfähiges System. Konsequent fiel deshalb<br />
die Wahl auf den BlueL<strong>in</strong>er ® der RS Technik Aqua<br />
GmbH, der <strong>in</strong> Komb<strong>in</strong>ation mit der Gerätetechnik von der<br />
D&S Rohrsanierung das gewünschte Sanierungsergebnis<br />
erbrachte.<br />
In Module zerlegt<br />
„Die Auskleidung der Rohre erfolgt dabei mit e<strong>in</strong>em<br />
Produkt, das über e<strong>in</strong>en erheblichen Anteil an Glasfasern<br />
verfügt“, erläutert Karl-He<strong>in</strong>z Robatscher, Geschäfts-<br />
Bild 1: In der zentral im Baufeld e<strong>in</strong>gerichteten Tränkanlage wurde der Schlauch für<br />
den E<strong>in</strong>bau vorbereitet und dann zur Dampfanlage transportiert<br />
Bild 2: Die Dosierung und Mischung der<br />
Harzkomponenten sowie die Imprägnierung<br />
des L<strong>in</strong>ers erfolgte <strong>in</strong> der zentral im Baufeld<br />
e<strong>in</strong>gerichteten Tränkanlage<br />
82 11-12 | 2013
ABWASSERENTSORGUNG / SANIERUNG PROJEKT KURZ BELEUCHTET<br />
Fotos: DIRINGER&SCHEIDEL ROHRSANIERUNG<br />
Bild 3: Mit der Drucktrommel wird der L<strong>in</strong>er <strong>in</strong> die zu sanierende Haltung<br />
<strong>in</strong>versiert<br />
Bild 4: Die neue Auskleidung übernimmt ohne Unterstützung des<br />
Altrohres alle statischen Außen- und Innenlasten<br />
führer ROTECH Srl. Der L<strong>in</strong>er, der die Bestimmungen des<br />
DVGW-Arbeitsblattes W 270 sowie der „Leitl<strong>in</strong>ie des<br />
Umweltbundesamtes zur hygienischen Beurteilung von<br />
organischen Materialien im Kontakt mit Tr<strong>in</strong>kwasser“<br />
(KTW-Leitl<strong>in</strong>ie) erfüllt, wird vor Ort mit e<strong>in</strong>em Zweikomponenten-Epoxidharz<br />
getränkt, über e<strong>in</strong>e Drucktrommel<br />
<strong>in</strong> die zu sanierende Haltung e<strong>in</strong>gebracht und mit Dampf<br />
ausgehärtet. Die hierfür notwendige Anlagentechnik ist<br />
üblicherweise auf e<strong>in</strong>em vollständig ausgebauten Fahrzeug<br />
angebracht, das als mobile Tränk- und Mischanlage<br />
genutzt wird, <strong>in</strong> der die Dosierung und Mischung der<br />
Harzkomponenten sowie die Imprägnierung des L<strong>in</strong>ers<br />
direkt vor Ort an der E<strong>in</strong>baustelle erfolgt. „Da der E<strong>in</strong>satz<br />
e<strong>in</strong>es Lkw aufgrund der Unzugänglichkeit des Geländes<br />
nicht möglich war, haben die beteiligten Baupartner<br />
e<strong>in</strong> Konzept erstellt, bei dem die Baustellene<strong>in</strong>richtung<br />
<strong>in</strong> Module zerlegt und auf diese Weise geländegängig<br />
gemacht wurde“, so Robatscher weiter. Während e<strong>in</strong><br />
Bagger vorab die Dampfanlage im Conta<strong>in</strong>er direkt an der<br />
jeweiligen E<strong>in</strong>baustelle positionierte, wurde <strong>in</strong> der zentral<br />
im Baufeld e<strong>in</strong>gerichteten Tränkanlage der Schlauch<br />
für den E<strong>in</strong>bau vorbereitet und dann zur Dampfanlage<br />
transportiert. Mit dieser modularen und damit flexiblen<br />
Anlagentechnik der D&S Rohrsanierung ist man <strong>in</strong> der<br />
Lage, auch an Orten zu arbeiten, bei denen sonst ke<strong>in</strong><br />
für Baustellen üblicher Zugang möglich ist.<br />
Unabhängig und tragfähig<br />
An Ort und Stelle konnte der L<strong>in</strong>er dann <strong>in</strong> die stillgelegten<br />
Haltungen <strong>in</strong>versiert werden, die vorab für den<br />
E<strong>in</strong>bau vorbereitet, gründlich gere<strong>in</strong>igt und zur Kontrolle<br />
mit der Kamera befahren worden waren. Nach dem E<strong>in</strong>bau<br />
über die Drucktrommel wurde der Schlauch durch<br />
Wärmezufuhr mit Dampf zu e<strong>in</strong>em neuen Rohr ausgehärtet.<br />
„Diese Rohr im Rohr-Lösung ist unabhängig und<br />
alle<strong>in</strong>e tragfähig und übernimmt ohne Unterstützung<br />
des Altrohres alle statischen Außen- und Innenlasten“,<br />
erläutert Dipl.-Ing.(FH) Jens Wahr, Dir<strong>in</strong>ger & Scheidel<br />
Rohrsanierung GmbH & Co. KG, e<strong>in</strong>e entscheidende<br />
Eigenschaft des BlueL<strong>in</strong>e ® -Systems.<br />
„Die für das Verfahren charakteristische Vor-Ort-Imprägnierung<br />
mit Epoxidharz sorgt für größtmögliche Flexibilität<br />
an der E<strong>in</strong>baustelle“, so Wahr. Bei der Imprägnierung<br />
wird der L<strong>in</strong>er unter Vakuum gesetzt, gleichmäßig mit<br />
dem Harzsystem getränkt und kalibriert. E<strong>in</strong>e für das<br />
Verfahren entwickelte Steuerung sorgt dann für e<strong>in</strong>en<br />
kontrollierten E<strong>in</strong>bauprozess bei dem wichtige e<strong>in</strong>baurelevante<br />
Daten permanent aufgezeichnet werden.<br />
Die mit EU-Geldern geförderte Sanierung der Leitungen<br />
<strong>in</strong> der Beregnungsanlage Tartsch-Mals konnte zur<br />
vollsten Zufriedenheit des Auftraggebers abgeschlossen<br />
werden. Das e<strong>in</strong>gesetzte Produkt und die ausgewählte<br />
Technik haben ihre Vorteile unter den gegebenen schwierigen<br />
Bed<strong>in</strong>gungen voll ausspielen können. Dampf- und<br />
Tränkanlage entsprechen modernstem technologischem<br />
Standard und der im Verbund gefertigte elastische Glas-<br />
Filz-Schlauch kann mit hervorragenden Werkstoffeigenschaften<br />
aufwarten. So macht z. B. se<strong>in</strong>e Bogengängigkeit<br />
den E<strong>in</strong>satz <strong>in</strong> Bögen bis 45° und mehr möglich.<br />
H<strong>in</strong>zu kommt: Aufgrund der Materialeigenschaften des<br />
verwendeten Epoxidharzes f<strong>in</strong>den auch umweltschutztechnische<br />
Gesichtspunkte Berücksichtigung. Deshalb<br />
kann sich das Konsortium vorstellen, das Verfahren <strong>in</strong>sbesondere<br />
<strong>in</strong> Dorflagen, bei Unterführungen oder <strong>in</strong><br />
schwierigem Gelände auch bei zukünftigen Sanierungen<br />
anzuwenden.<br />
KONTAKT: DIRINGER & SCHEIDEL Rohrsanierung GmbH & Co. KG, Mannheim,<br />
Tel. +49 621 8607440, E-Mail: zentrale.rohrsan@dus.de,<br />
www.dus-rohr.de<br />
11-12 | 2013 83
PROJEKT KURZ BELEUCHTET ABWASSERENTSORGUNG / SANIERUNG<br />
Licht-L<strong>in</strong>er <strong>in</strong> Landau: Grabenlose<br />
Sanierung e<strong>in</strong>es Eiprofils 1350/900<br />
Es war e<strong>in</strong> E<strong>in</strong>satz am oberen Ende des heutzutage Machbaren: Im Oktober 2013 sanierte die Swietelsky-Faber GmbH<br />
Kanalsanierung <strong>in</strong> Landau/Pfalz rund 300 m e<strong>in</strong>es Eiprofil-Sammlers 1350/900 per Schlauchl<strong>in</strong><strong>in</strong>g. E<strong>in</strong>gesetzt wurde der Alpha-<br />
L<strong>in</strong>er der Rel<strong>in</strong>e Europe GmbH (Rohrbach/Pfalz) <strong>in</strong> vier E<strong>in</strong>zelstrecken von bis zu 9 m Länge.<br />
Der Mischwassersammler „Mühlweg“ entsorgt seit se<strong>in</strong>em<br />
Bau im Jahre 1955 den Landauer Vorort Queichheim und<br />
andere angrenzende Liegenschaften <strong>in</strong> Richtung Landauer<br />
Kläranlage. Wie Inspektionen <strong>in</strong> jüngster Vergangenheit zeigten,<br />
wies das Beton-Eiprofil der Dimension 1350/900 diverse<br />
Schäden auf: Korrosion, Risse, undichte Muffen – hier zeigten<br />
sich alle Probleme, die für e<strong>in</strong>en fast 60 Jahre alten Betonkanal<br />
dieser Auslastung charakteristisch s<strong>in</strong>d. Nach Begutachtung<br />
der Befunde durch das Ingenieurbüro TeamBau (Bergzabern)<br />
wurde dem Bauwerk e<strong>in</strong> „Altrohrzustand Klasse 2“ nach<br />
ATV A 127 attestiert: Noch grabenlos sanierbar, aber eben<br />
auch dr<strong>in</strong>gend sanierungsbedürftig. Dass der marode Mühlweg-Sammler<br />
zwischen Queichheim und dem angrenzenden<br />
St.-Josef-Jugendwerk durch e<strong>in</strong> Wasserschutzgebiet läuft,<br />
machte aus ihm e<strong>in</strong> Projekt mit hoher Priorität für die EWL<br />
Landau als Netzbetreiber.<br />
Knapp bemessene Trockenwetter-Zeitfenster<br />
Das von TeamBau zeitnah ausgearbeitete Sanierungskonzept<br />
setzte auf grabenlose Sanierung <strong>in</strong> Schlauchl<strong>in</strong><strong>in</strong>g-Technologie.<br />
Im Detail entschied man sich für die lichthärtende, auf<br />
e<strong>in</strong>em GFK-Trägerschlauch basierende Verfahrensvariante. Der<br />
Grund: Angesichts der hohen Auslastung des Kanals und der<br />
absehbar exorbitanten Kosten für e<strong>in</strong>e oberirdische Wasserhaltung,<br />
die e<strong>in</strong>en Niederschlagsfall abgedeckt hätte, g<strong>in</strong>g die<br />
Ausführungsplanung von Trockenwetter-Zeitfenstern aus, die<br />
potentiell knapp bemessen s<strong>in</strong>d. Es g<strong>in</strong>g somit um e<strong>in</strong> Verfahren,<br />
mit dem man so schnell wie möglich erfolgreich „vom<br />
Acker“ konnte – und hier bieten lichthärtende Systeme mit<br />
ihrem m<strong>in</strong>imalistischen, hoch mobilen Equipment naturgemäß<br />
Vorteile. Die Bauplanung teilte das Projekt <strong>in</strong> <strong>in</strong>sgesamt vier<br />
L<strong>in</strong>er-E<strong>in</strong>züge zwischen 70,50 und 92,60 m Länge auf.<br />
Überhaupt stellten die vorhandenen Schächte e<strong>in</strong>e sehr spezielle<br />
Randbed<strong>in</strong>gung dieses Projektes dar; die massiven Ortbetonschächte<br />
waren als Rechteck-Profile 60 x 60 cm ausgeführt<br />
worden und damit def<strong>in</strong>itiv zu kle<strong>in</strong> für das E<strong>in</strong>ziehen der<br />
L<strong>in</strong>er <strong>in</strong> diesen mächtigen Kanal. Mehrere Schächte wurden<br />
daher abgebrochen und durch neue Rundschächte DN 1200/<br />
DN 1500 ersetzt, über die dann die L<strong>in</strong>er-Installationen stattfanden.<br />
Nur e<strong>in</strong> Schacht musste nicht aufgeweitet werden, da<br />
hier zwei Haltungen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em E<strong>in</strong>zug saniert werden konnten.<br />
DIBt-Zulassung für Schlauchl<strong>in</strong>er <strong>in</strong> E<strong>in</strong>bau-Nennweite<br />
oberhalb von DN 1200<br />
Im Rahmen e<strong>in</strong>er beschränkten Ausschreibung nach öffentlichem<br />
Teilnahmewettbewerb bekam letztlich die Niederlassung<br />
Alzey der Swietelsky-Faber GmbH Kanalsanierung den<br />
Zuschlag: Sie hatte e<strong>in</strong> Schlauchl<strong>in</strong><strong>in</strong>g mit dem lichthärtenden<br />
Bild 1: Zwei Mitarbeiter steuern den E<strong>in</strong>zug des Alpha-L<strong>in</strong>ers <strong>in</strong> das<br />
über neue Kontrollschächte zugänglich gemachte Beton-Eiprofil<br />
Bild 2: E<strong>in</strong>es der vier jeweils 2.000 Watt starken Elemente<br />
des Lampenzuges auf dem Weg zum E<strong>in</strong>satz<br />
84 11-12 | 2013
ABWASSERENTSORGUNG / SANIERUNG PROJEKT KURZ BELEUCHTET<br />
GFK-L<strong>in</strong>er System „Alpha-L<strong>in</strong>er“ der Rel<strong>in</strong>e Europe GmbH,<br />
Rohrbach, angeboten und sich gegen drei Mitbewerber durchgesetzt.<br />
E<strong>in</strong> ganz starkes Argument für den Alpha-L<strong>in</strong>er war<br />
hier die Tatsache, dass dieses System über die <strong>in</strong> Landau geforderte<br />
DIBt-Zulassung auch für E<strong>in</strong>bau-Nennweiten oberhalb<br />
von DN 1200 verfügt. Diese Bed<strong>in</strong>gung erfüllen derzeit überhaupt<br />
nur zwei Anbieter im Schlauchl<strong>in</strong><strong>in</strong>g-Markt.<br />
Vier Materialkomponenten beim Alpha-L<strong>in</strong>er<br />
Der Alpha-L<strong>in</strong>er besteht aus <strong>in</strong>sgesamt vier Materialkomponenten:<br />
Kern des L<strong>in</strong>ers s<strong>in</strong>d gewickelte Schichten aus ECR-<br />
Glasfasern, die werkseitig mit e<strong>in</strong>em UV-reaktiven UP-Harz<br />
getränkt werden, bei extremen Abwässern optional auch<br />
mit lichthärtendem VE-Harz. Nach außen schützt e<strong>in</strong>e hoch<br />
stabile Mehrschicht-Verbundfolie den L<strong>in</strong>er gegen mechanische<br />
Beschädigung und vorzeitige Belichtung – zugleich<br />
optimiert die Folie das Dehnungsverhalten des L<strong>in</strong>ers beim<br />
E<strong>in</strong>bauvorgang. E<strong>in</strong>e weitere ganz wesentliche Komponente<br />
ist e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>nenliegende, harzgetränkte Polyestervlies-Schicht;<br />
diese übernimmt die Funktion der im technischen Regelwerk<br />
geforderten Re<strong>in</strong>harz-Schicht auf der Verschleiß-Seite des<br />
L<strong>in</strong>ers. Der Alphal<strong>in</strong>er erfüllt die Forderung nach e<strong>in</strong>er def<strong>in</strong>iert<br />
dicken Chemie- und Verschleißschicht als erstes System am<br />
Sanierungsmarkt. Während des E<strong>in</strong>bauvorgangs dient e<strong>in</strong>e<br />
3-schichtige Verbundfolie als Styrolsperre und E<strong>in</strong>bauhilfe: Sie<br />
trennt die noch nicht gehärtete harzgetränkte Innenschicht<br />
vom durchfahrenden UV-Lampenzug und wird nach Aushärtung<br />
des L<strong>in</strong>ers entfernt.<br />
Bild 3: Seitene<strong>in</strong>steiger: E<strong>in</strong> Mitarbeiter klettert <strong>in</strong> die<br />
aufgeblasene Schlauchschleuse, um den Lampenzug <strong>in</strong><br />
se<strong>in</strong>e Startposition im L<strong>in</strong>er zu schieben<br />
Bild 4: Ausgehärteter Alpha-L<strong>in</strong>er 1350/900 im<br />
Landauer Mühlweg-Sammler<br />
Reißverschluss als Schleuse im Textilschlauch<br />
Der E<strong>in</strong>bau- und Aushärtungsvorgang erfolgt im Grundsatz<br />
und von Details abgesehen wie bei allen anderen GFK-Lichthärter-Systemen:<br />
Der L<strong>in</strong>er wird mechanisch e<strong>in</strong>gezogen, <strong>in</strong><br />
Start- und Zielschacht mit e<strong>in</strong>er Druckschleuse bestückt und<br />
mit Luftdruck formschlüssig aufkalibriert. E<strong>in</strong>e spezifische<br />
F<strong>in</strong>esse ist das E<strong>in</strong>setzen des Lampenzuges bei diesem System.<br />
Da dieser z. B. <strong>in</strong> Landau 6 m lang war, flanschte man<br />
dem L<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>en mehrere Meter langen Textilschlauch gleicher<br />
Nennweite auf, der mit e<strong>in</strong>em Reißverschluss geöffnet<br />
und verschlossen werden kann. In diese geöffnete Schleuse<br />
setzt man die Elemente des Lampenzuges e<strong>in</strong> und koppelt sie<br />
mite<strong>in</strong>ander; die anschließend verschlossene Schleuse wird<br />
beim Aufstellen des L<strong>in</strong>ers als erstes aufgeblasen. Liegt der<br />
L<strong>in</strong>er <strong>in</strong> ganzer Länge bündig an der Rohrwand an, wird der<br />
Reißverschluss nochmals kurz geöffnet, e<strong>in</strong> Mitarbeiter klettert<br />
<strong>in</strong> die Schleuse und schiebt den Lampenzug <strong>in</strong> se<strong>in</strong>e Startposition<br />
im L<strong>in</strong>er. Die Schleuse wird wieder verschlossen und der<br />
Aushärtungsvorgang beg<strong>in</strong>nt.<br />
Im Mühlweg-L<strong>in</strong>er wurde e<strong>in</strong>e UV-Strahler-E<strong>in</strong>heit mit<br />
8 x 1.000 Watt Lichtleistung mit e<strong>in</strong>er Geschw<strong>in</strong>digkeit von<br />
25 cm/m<strong>in</strong> <strong>in</strong> Bewegung gesetzt. E<strong>in</strong> 83 m langer L<strong>in</strong>er wie der<br />
des Bauabschnitts im Bereich des St.-Josef-Werks ist b<strong>in</strong>nen<br />
fünfe<strong>in</strong>halb Stunden e<strong>in</strong>satzfertig ausgehärtet. Der gesamte<br />
E<strong>in</strong>bau war somit an e<strong>in</strong>em Arbeitstag vollständig erledigt.<br />
Alles <strong>in</strong> allem dauerte es mit allen Vor- und Nebenarbeiten (den<br />
offenen Neubau der Schächte ausgenommen) zwei Wochen,<br />
die 300 m des Mühlweg-Sammlers zu sanieren: E<strong>in</strong>e beachtliche<br />
Leistung, wenn man <strong>in</strong> Rechnung stellt, dass man sich hier<br />
im derzeitigen oberen Bereich der lichthärtenden Schlauchl<strong>in</strong><strong>in</strong>g-Technologie<br />
bewegt. Für die Sanierungskolonne von<br />
Michel Bonagura, die bislang schon jedes GFK-L<strong>in</strong>er-System<br />
erfolgreich e<strong>in</strong>gebaut hat, war der E<strong>in</strong>bau e<strong>in</strong>es Alpha-L<strong>in</strong>ers<br />
dieser Dimension dennoch e<strong>in</strong> besonderes Erfolgserlebnis.<br />
KONTAKT Bauausführung: Swietelsky-Faber GmbH Kanalsanierung, NL Alzey,<br />
Dipl.-Ing. Christian Heuss, E-Mail: c.heuss@swietelsky-faber.de<br />
Ingenieurbüro: Ingenieurbüro TeamBau, Bad Bergzabern, Dipl.-Ing.<br />
Horst Fischer, E-Mail: h.fischer@teambau.de<br />
11-12 | 2013 85
FACHBERICHT ABWASSERENTSORGUNG / SANIERUNG<br />
Tipp für Bauunternehmer und Handwerker:<br />
Erst die Abwasserleitungen<br />
prüfen<br />
Bei Modernisierungsmaßnahmen sollten Bauverantwortliche auf die Prüfung privater Abwasserleitungen drängen.<br />
So schützen sie Bauherren vor hohen Folgeschäden und bewahren sich selbst vor Haftungsrisiken.<br />
Jedes Kanalnetz unterliegt e<strong>in</strong>em schleichenden Alterungsprozess.<br />
Im Laufe der Zeit bilden sich durch Fette<br />
oder Ur<strong>in</strong>ste<strong>in</strong> an den Rohrwänden vermehrt feste Verkrustungen<br />
und Ablagerungen. Zudem wachsen Wurzeln<br />
DAS RICHTIGE VORGEHEN<br />
Bei Planung und Ausführung von Modernisierungsarbeiten sollten<br />
die Abwasserleitungen nicht außen vor bleiben. E<strong>in</strong>e Dichtheitsprüfung<br />
bewahrt vor bösen Überraschungen.<br />
1. Anzeichen erkennen:<br />
Viele Leitungsschäden kündigen sich an, etwa durch nasse Wände<br />
und Decken <strong>in</strong> Räumen oder im Keller. Auch häufig auftretende<br />
Verstopfungen oder faulige Gerüche s<strong>in</strong>d Warnsignale. Bauverantwortliche<br />
sollten den Dialog mit dem Bauherrn suchen und<br />
den Ursachen zügig auf den Grund gehen.<br />
2. Dienstleister auswählen:<br />
Wer Qualität erwartet, sollte bevorzugt auf zertifizierte Firmen<br />
und Meisterbetriebe zurückgreifen. Sicherheitshalber sollten sich<br />
Auftraggeber Referenzen vorlegen lassen. Schnell zum passenden<br />
regionalen Anbieter führt e<strong>in</strong>e bundesweite Dienstleistersuche<br />
über www.vdrk.de.<br />
3. Angebote e<strong>in</strong>holen:<br />
Verantwortliche sollten bevorzugt regionale Unternehmen kontaktieren.<br />
Gerade bei größeren Aufträgen s<strong>in</strong>d mehrere Vergleichsangebote<br />
e<strong>in</strong>zuholen. Pauschalangebote s<strong>in</strong>d nicht aussagekräftig.<br />
Lohn- und Materialkosten s<strong>in</strong>d grundsätzlich zu trennen. Dann<br />
kann der Immobilienbesitzer die Kosten womöglich steuerlich<br />
absetzen.<br />
<strong>in</strong> das Leitungsnetz e<strong>in</strong> und können zu Verstopfungen<br />
und Beschädigungen führen. Werden Abwassergrundleitungen<br />
nicht regelmäßig kontrolliert, steigt die Gefahr<br />
von Verstopfungen und Rückstaus, warnt der Verband<br />
der Rohr- und Kanal-Technik-Unternehmen e.V. (VDRK).<br />
Bei Um- und Erweiterungsbauten ist erhöhte Vorsicht<br />
geboten. Neue Sanitär<strong>in</strong>stallationen können die Abwassermengen<br />
erhöhen oder auch reduzieren. Dies kann zu<br />
Überlastungen und weiteren Ablagerungen führen. So<br />
können Baumaßnahmen vorhandene Schäden verschlimmern<br />
oder sogar neu entstehen lassen. H<strong>in</strong>zu kommt:<br />
Fehlende oder fehlerhafte Pläne s<strong>in</strong>d im Altbestand eher<br />
die Regel als die Ausnahme. Wurden <strong>in</strong> der Vergangenheit<br />
Dra<strong>in</strong>agen falsch angeschlossen, ist dies den Eigentümern<br />
meist unbekannt. Die Folgen planerischer oder handwerklicher<br />
Fehler bei Abwasserleitungen s<strong>in</strong>d fatal: Durch<br />
Vernässungen, Schimmelbildungen oder absackende Flächen<br />
kann die Immobilie erheblichen Schaden nehmen.<br />
Die von defekten Abwasserleitungen ausgehenden Risiken<br />
können nicht nur Immobilienbesitzer, sondern auch<br />
Bauunternehmer und Handwerker treffen. Laut Grundsatzurteil<br />
des Bundesgerichtshof (Az. VII ZR 109/10) haben<br />
Werkunternehmer weitgehende Prüfungspflichten, wenn<br />
ihre Arbeiten <strong>in</strong> engem Zusammenhang mit den Leistungen<br />
anderer Bauunternehmen stehen. Sie müssen die<br />
Planungen und Vorarbeiten von anderen Unternehmen<br />
gründlich prüfen, bevor sie eigene Leistungen erbr<strong>in</strong>gen.<br />
Sonst nimmt die laufende Rechtsprechung Bauunternehmen<br />
und Handwerker unter Umständen als Gesamtschuldner<br />
<strong>in</strong> die Pflicht.<br />
Hat der Bauunternehmer Bedenken h<strong>in</strong>sichtlich der Vorarbeiten,<br />
sollte er diese dem Bauherren schriftlich anzeigen<br />
und eigene Leistungen zurückstellen. So schützt er den<br />
Bauherrn vor unliebsamen und teuren Überraschungen.<br />
Obendre<strong>in</strong> bewahrt der Bauunternehmer auch sich selbst<br />
vor hohen Schadenersatzforderungen. Deshalb muss<br />
bei Um- und Erweiterungsbauten gemäß den Regeln<br />
der Technik (DIN 1986-30:2012) nicht nur e<strong>in</strong>e optische<br />
Inspektion, sondern auch e<strong>in</strong>e Dichtheitsprüfung vorgenommen<br />
werden.<br />
Die Kosten für e<strong>in</strong>e Leitungsprüfung s<strong>in</strong>d im Verhältnis<br />
zu den drohenden Folgekosten verschw<strong>in</strong>dend ger<strong>in</strong>g.<br />
Die Marktpreise für e<strong>in</strong>e Funktionsprüfung, also e<strong>in</strong>e<br />
86 11-12 | 2013
Kamerauntersuchung <strong>in</strong>klusive Re<strong>in</strong>igung, liegen bei<br />
durchschnittlich rund 305 Euro für e<strong>in</strong> E<strong>in</strong>familienhaus.<br />
Für e<strong>in</strong> Zweifamilienhaus fallen etwa 355 Euro und für e<strong>in</strong><br />
Dreifamilienhaus ungefähr 450 Euro an. Besser: Gleichzeitig<br />
auch den Rückstauschutz kontrollieren, damit der<br />
Keller nach e<strong>in</strong>em Starkregen oder bei verstopftem Kanal<br />
nicht unter Wasser oder Abwasser steht. Solche Prüfungen<br />
s<strong>in</strong>d spätestens nach 20 Jahren wiederkehrend notwendig.<br />
Sie stellen grundsätzlich e<strong>in</strong>e lohnende Vorsorgemaßnahme<br />
für Hauseigentümer dar. Denn e<strong>in</strong> Nachweis<br />
<strong>in</strong>takter Leitungen wertet die Immobilie auf. Beim Verkauf<br />
e<strong>in</strong>er Immobilie wird die Dichtigkeit von Abwasserleitungen<br />
zunehmend zum Thema. Wer <strong>in</strong>takte Leitungen<br />
nachweisen kann, hat bessere Verkaufsargumente.<br />
Nicht jede Prüfung muss Schäden zutage fördern. Die<br />
Erfahrung zeigt: Rund 65 % der Abwasserleitung s<strong>in</strong>d<br />
dicht und weisen allenfalls ger<strong>in</strong>ge Mängel auf. Nur etwa<br />
35 % der Abwasserleitungen s<strong>in</strong>d sehr schadhaft und<br />
erfordern kurzfristige Sanierungsmaßnahmen. Im Rahmen<br />
von Um- und Erweiterungsbauten lassen sich Arbeiten<br />
vielfach s<strong>in</strong>nvoll komb<strong>in</strong>ieren, um die Bee<strong>in</strong>trächtigungen<br />
und Kosten zu begrenzen.<br />
Im Rahmen der Funktionskontrolle im Altbestand werden<br />
die Rohrleitungen zunächst mit Hochdruckspülung<br />
gere<strong>in</strong>igt. Dann wird e<strong>in</strong>e spezielle Rohr-Kamera<br />
<strong>in</strong> das Kanalsystem e<strong>in</strong>geführt. Sie liefert hochauflösende<br />
Live-Bilder aus dem Leitungsnetz, die auf e<strong>in</strong>en<br />
Monitor übertragen werden und grundsätzlich als Film<br />
zu dokumentieren s<strong>in</strong>d. So lässt sich der Zustand der<br />
Rohrleitungen zuverlässig kontrollieren, ohne dass vorher<br />
aufwändige bauliche E<strong>in</strong>griffe nötig s<strong>in</strong>d. Etwaige<br />
Rohrleitungsschäden lassen sich <strong>in</strong> den meisten Fällen<br />
<strong>in</strong> geschlossener Bauweise, also ohne Aufgrabung, kostengünstig<br />
beheben.<br />
Nach Abschluss der Prüfung erhalten Auftraggeber e<strong>in</strong>e<br />
Dokumentation <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>er Dichtheitsbesche<strong>in</strong>igung.<br />
Diese be<strong>in</strong>haltet neben dem Prüfungsergebnis auch e<strong>in</strong>en<br />
Lageplan, die Filmaufzeichnungen und Prüfprotokolle. Um<br />
Unstimmigkeiten zu vermeiden, sollten Auftraggeber den<br />
Prüfungsablauf und den Umfang der Dichtheitsbesche<strong>in</strong>igung<br />
vor Auftragsvergabe klären. Grundsätzlich sollten<br />
Bauverantwortliche erste Anzeichen von Leitungsschäden<br />
sehr ernst nehmen und gezielt Spezialisten h<strong>in</strong>zuziehen<br />
(siehe Infokasten „Das richtige Vorgehen“).<br />
GERHARD TREUTLEIN<br />
Geschäftsführer Verband der Rohr- und<br />
Kanal-Technik-Unternehmen e.V. (VDRK),<br />
Kassel<br />
Tel. +49 561 207567-0<br />
E-Mail: treutle<strong>in</strong>@vdrk.de<br />
AUTOR<br />
www.funkegruppe.de<br />
Funke Kunststoffe GmbH<br />
11-12 | 2013 87
PROJEKT KURZ BELEUCHTET ABWASSERENTSORGUNG/SANIERUNG<br />
Erfurter Eigentümergeme<strong>in</strong>schaft baut<br />
Rückstausicherung GiWA ® -Stop e<strong>in</strong><br />
Wenn sich nach Starkregenereignissen e<strong>in</strong> Rückstau zum Mischwassersammler bildet und Schmutz- und Niederschlagswasser<br />
über die Hausanschlussleitung <strong>in</strong> die Kellerräume gedrückt wird, kostet es die Bewohner Kraft, Nerven und Geld. Doch<br />
das Problem lässt sich mit der Rückstausicherung GiWA ® -Stop vermeiden wie dieses Praxisbeispiel aus der thür<strong>in</strong>gischen<br />
Landeshauptstadt zeigt.<br />
Seit 1985 bewohnt Lothar Albert mit se<strong>in</strong>er Familie die Stadtvilla<br />
<strong>in</strong> der Richard-Breslau-Straße <strong>in</strong> Erfurt. Das Gebäude aus<br />
den 1920er Jahren wurde seitdem umfangreich renoviert und<br />
bietet heute Platz für drei Wohnparteien. Umso ärgerlicher war<br />
der Umstand, dass der Keller des Hauses seitdem teilweise<br />
mehrmals im Jahr überflutet wurde – vor allem, wenn sich nach<br />
Starkregenereignissen e<strong>in</strong> Rückstau zum Mischwassersammler<br />
bildete. Dabei wurde das Schmutz- und Niederschlagswasser<br />
über die Hausanschlussleitung <strong>in</strong> die Keller- und Hobbyräume<br />
gedrückt, wo es durch Bodene<strong>in</strong>läufe, WC-Spülbecken und <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em Fall sogar durch e<strong>in</strong> Waschbecken <strong>in</strong> die betreffenden<br />
Räume drang. Das kostete die Bewohner nicht nur viel Kraft,<br />
Zeit und Nerven, sondern vor allem Geld.<br />
Mit dem E<strong>in</strong>bau des GiWA ® -Stops von der Funke Kunststoffe<br />
GmbH hat die Eigentümergeme<strong>in</strong>schaft das Problem jetzt<br />
langfristig gelöst: Bei dem System, das ohne fremde Energie<br />
auskommt, handelt es sich um e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>zigartige mechanische<br />
Rückstausicherung für fäkalienhaltiges Abwasser. Es wird <strong>in</strong><br />
den Hauskontrollschacht e<strong>in</strong>gesetzt und verh<strong>in</strong>dert dauerhaft<br />
weitere Überflutungen des Kellers. Aufgrund se<strong>in</strong>er mechanischen<br />
Funktion benötigt das System ke<strong>in</strong>en Elektroanschluss.<br />
Zu den weiteren Vorteilen des Bauteils <strong>in</strong> Edelstahl-Ausführung<br />
zählen der überaus e<strong>in</strong>fache E<strong>in</strong>bau und der Umstand, dass<br />
die Hausanschlussleitungen durch den permanenten Spülschwallbetrieb<br />
gere<strong>in</strong>igt werden.<br />
Lothar Albert war schon seit längerem an e<strong>in</strong>er zuverlässig<br />
funktionierenden, nachrüstbaren Rückstausicherung für fäkalienhaltige<br />
Abwässer <strong>in</strong>teressiert, mit der er das Haus künftig<br />
dauerhaft gegen den ungewollten Rückstau schützen kann.<br />
Der bei e<strong>in</strong>em Wasser- und Abwasserverband beschäftigte<br />
Bild 1: Bauherr Lothar Albert mit se<strong>in</strong>em neuen GiWA ® -Stop<br />
Bild 2: Vor E<strong>in</strong>bau des Systems wird die Schutzhaube<br />
abgenommen, die Dichtung auf den Rohrstutzen aufgezogen und<br />
mit Gleitmittel e<strong>in</strong>gestrichen. Danach wird der GiWA ® -Stop <strong>in</strong> den<br />
Zulauf des Schachtes e<strong>in</strong>geschoben, ausgerichtet und mit e<strong>in</strong>em<br />
Montageband gesichert<br />
88 11-12 | 2013
ABWASSERENTSORGUNG/SANIERUNG PROJEKT KURZ BELEUCHTET<br />
Fotos: Funke Kunststoffe GmbH<br />
Bild 3: Zum Schluss wird die rote<br />
Abdeckung aufgesetzt und das Drahtseil der<br />
Notverriegelung im Schachtkonus angebracht<br />
Bild 4: Dichtung, Montageband und e<strong>in</strong> Drahtseil für die Notverriegelung<br />
gehören zum Lieferumfang des GiWA ® -Stops<br />
Baubetreuer hatte bereits mehrere Monate erfolglos gesucht<br />
und dabei e<strong>in</strong>ige letztlich nicht überzeugende Produkte <strong>in</strong><br />
Augensche<strong>in</strong> genommen.<br />
Nachrüstung möglich<br />
Fündig wurde er schließlich bei der Funke Kunststoffe GmbH.<br />
Das Unternehmen bietet mit dem GiWA ® -Stop e<strong>in</strong> System, das<br />
für den E<strong>in</strong>satz <strong>in</strong> neuen oder bestehenden Schächten konzipiert<br />
worden ist. Es handelt sich um e<strong>in</strong>e mechanische Rückstausicherung<br />
für fäkalienhaltiges Abwasser, die ohne fremde<br />
Energie auskommt. „Als E<strong>in</strong>satz <strong>in</strong> Hauskontrollschächten DN/<br />
ID 800/1000 verh<strong>in</strong>dert sie nicht nur e<strong>in</strong>e Überflutung des<br />
Kellers, sondern hält ganz nebenbei auch ungebetene Gäste,<br />
wie z. B. Ratten fern“, erklärt Funke Fachberater Dipl.-Bau<strong>in</strong>g.<br />
Olaf Schreiter. H<strong>in</strong>zu kommt: Alle Schmutzwasser-Leitungen<br />
auch unterschiedlicher Fabrikate <strong>in</strong> der Nennweite DN 150<br />
können nachgerüstet werden. „Aufgrund der mechanischen<br />
Funktion benötigt das System ke<strong>in</strong>en Elektroanschluss“, so<br />
Schreiter. „Das spart enorme Installationskosten.“<br />
Bauherrencheckliste und Wartungsheft<br />
Schreiter war es auch, der den E<strong>in</strong>bau des GiWA ® -Stops<br />
betreute. In e<strong>in</strong>em ersten Schritt wurden die technischen<br />
Voraussetzungen für die Installation des Systems vor Ort überprüft.<br />
Als Leitfaden diente dabei e<strong>in</strong>e sogenannte Bauherrencheckliste,<br />
die ebenso wie e<strong>in</strong> Wartungsheft zum Lieferumfang<br />
gehört. Danach hat e<strong>in</strong>e Baufirma zunächst die für den E<strong>in</strong>bau<br />
erforderlichen Vorarbeiten im vorhandenen gemauerten<br />
Schachtbauwerk ausgeführt. „Unter anderem musste das<br />
Ger<strong>in</strong>ne erneuert werden“, er<strong>in</strong>nert sich Schreiter, der die<br />
Arbeiter bei der dann folgenden Montage im fachgerechten<br />
Umgang mit dem GiWA ® -Stop unterwies.<br />
E<strong>in</strong>bau schnell und unkompliziert<br />
Der E<strong>in</strong>bau hat alles <strong>in</strong> allem nur gut e<strong>in</strong>e Stunde gedauert.<br />
Die kurze Bauzeit und das positive Ergebnis der abschließend<br />
durchgeführten mehrmaligen Funktionskontrollen<br />
haben den Bauherren <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Überzeugung gestärkt,<br />
die richtige Wahl getroffen zu haben. Für Albert gehören<br />
die Überschwemmungen damit der Vergangenheit an. In<br />
Zukunft muss er nur dafür Sorge tragen, dass die erforderlichen<br />
Inspektions-und Wartungsarbeiten an der Rückstausicherung<br />
entsprechend der Vorgaben des Wartungsheftes<br />
turnusmäßig durchgeführt werden. „Für die Ausführung<br />
dieser Arbeiten empfehlen wir die Beauftragung e<strong>in</strong>er<br />
ortsansässigen Firma, denn dadurch wird die dauerhafte<br />
Funktionssicherheit der Rückstausicherung sichergestellt“,<br />
erklärt Schreiter, der abschließend darauf h<strong>in</strong>weist, dass<br />
mit dem GiWA ® -Stop nur Räume unterhalb der Rückstauebene<br />
(Kellerräume) geschützt werden dürfen.<br />
Die Rückmeldungen von Auftraggebern, die den GiWA ® -<br />
Stop <strong>in</strong> den letzten Jahren e<strong>in</strong>gebaut haben s<strong>in</strong>d durchweg<br />
positiv. In allen Fällen funktioniert das System e<strong>in</strong>wandfrei.<br />
Doch nicht nur <strong>in</strong> punkto Funktionalität und Betriebssicherheit<br />
kann das Bauteil überzeugen. Auch die Kosten<br />
s<strong>in</strong>d deutlich niedriger als bei den alternativen Angeboten.<br />
H<strong>in</strong>zu kommt der Qualitätsaspekt: So hat dieses System<br />
Prüfungen, die bei der LGA QualiTest GmbH <strong>in</strong> Anlehnung<br />
an die DIN EN 13564, Typ III, durchgeführt wurden,<br />
bestanden.<br />
KONTAKT: Funke Kunststoffe GmbH, Hamm-Uentrop, Tel. +492388 3071-0,<br />
E-Mail: <strong>in</strong>fo@funkegruppe.de<br />
11-12 | 2013 89
PROJEKT KURZ BELEUCHTET ENERGIEVERSORGUNG<br />
Leitungsbündel grabenlos mit der<br />
Felsbohranlage 18 ACS <strong>in</strong> Jurakalk<br />
und bei Gefälle verlegt<br />
Sigmar<strong>in</strong>gen ist bekannt durch das seit fast 1.000 Jahre bestehende Schloss der Fürsten von Hohenzollern-Sigmar<strong>in</strong>gen.<br />
Die Gegend dort ist geologisch und hydrologisch durch eiszeitliche und nacheiszeitliche Schotterr<strong>in</strong>nen der Donau und<br />
der Lauchert geprägt und durch massige, gebankte und damit auch geklüftete Felsvorkommen, <strong>in</strong>sbesondere von harten<br />
Kalkste<strong>in</strong>en der jüngeren Jurazeit, gekennzeichnet.<br />
Ganz <strong>in</strong> der Nähe, nur 4 km entfernt von diesem geschichtsträchtigen Ort liegt die Burgru<strong>in</strong>e Hornste<strong>in</strong>. Hoch oben auf<br />
der Felskuppe, unmittelbar vor dem E<strong>in</strong>gang der Burgru<strong>in</strong>e wurde die gesteuerte Bohranlage GRUNDODRILL 18 ACS<br />
(Hersteller Tracto-Technik, Lennestadt) <strong>in</strong> Stellung gebracht (Bild 1, Bild 2).<br />
Die Geme<strong>in</strong>de B<strong>in</strong>gen bei Sigmar<strong>in</strong>gen und der Netzbetreiber<br />
EnBW wollen hier e<strong>in</strong> Leitungsbündel bestehend<br />
aus drei PEHD-Rohren 75 x 6,8 mm und vier PEHD-Rohren<br />
50 x 4,6 mm grabenlos verlegen. Die bestehenden Freileitungen<br />
hätten teuer saniert werden müssen und können<br />
nun nach der Erdverlegung rückgebaut werden. Die 75er-<br />
Leerrohre s<strong>in</strong>d für e<strong>in</strong>e <strong>in</strong> der Zukunft liegende Nutzung<br />
gedacht. E<strong>in</strong> 50er-Rohr ist als Schutzrohr für Glasfaserkabel<br />
vorgesehen. Die anderen 50er-Rohre dienen als<br />
Schutzrohre für Stromkabel. Genutzt werden die neuen<br />
erdverlegten Stromkabel auch von e<strong>in</strong>em ortsansässigen<br />
Betreiber e<strong>in</strong>er Biogas- und Photovoltaikanlage, der <strong>in</strong>sgesamt<br />
ca. 550 kW Strom erzeugt und <strong>in</strong> das Stromnetz<br />
e<strong>in</strong>speist.<br />
Bohrung durch Felsboden aus hartem Jurakalk<br />
Die nur 100 m lange Bohrung hat mehrere Schwierigkeitsgrade:<br />
Neben dem vorherrschenden Felsboden (Bild 3)<br />
aus hartem Jurakalk (Massenkalk) war es das Gelände<br />
mit e<strong>in</strong>em Gefälle bis zu 58 % (Bild 4) und dichtem<br />
Baum- und Strauchbestand. Die Firma GAUPP Erd- und<br />
Tiefbau GmbH aus Engen Welsch<strong>in</strong>gen wurde mit der<br />
Verlegung beauftragt und von der TRACTO-TECHNIK,<br />
Niederlassung Altbach b. Stuttgart, mit der Bereitstellung<br />
der Felsbohranlage GRUNDODRILL 18 ACS unterstützt.<br />
Felsbohrungen <strong>in</strong>sbesondere im wechselnden Geste<strong>in</strong>sbestand<br />
s<strong>in</strong>d die besondere Stärke des GRUNDODRILL 18<br />
ACS. Das steckbare Innenrohr des Doppelrohrgestänges<br />
ist bei der Pilotbohrung zuständig für den Antrieb<br />
Bild 1: Der GRUNDODRILL 18 ACS während des<br />
Aufweitungsvorgangs<br />
Bild 2: E<strong>in</strong>gezogenes Rohrbündel mit 12“-Holeopener<br />
90 11-12 | 2013
ENERGIEVERSORGUNG PROJEKT KURZ BELEUCHTET<br />
Bild 3: Bohrung im harten Jurakalk<br />
Bild 4: Bei fast 60 % Gefälle musste sich der „Ortungsmann“<br />
mit e<strong>in</strong>em Seil sichern.<br />
der Rollenmeißel, die an der Spitze des 1,55 m langen<br />
Rockbreakers (Bild 5) angeordnet s<strong>in</strong>d. Dabei wird das<br />
Drehmoment mit maximal 2.500 Nm optimal übertragen<br />
und genutzt.<br />
Das Außenrohr steuert den Rockbreaker. Der Neigungsw<strong>in</strong>kel<br />
beträgt 1,75°. Der Sender für die Ortung bef<strong>in</strong>det<br />
sich direkt h<strong>in</strong>ter den Rollenmeißeln, wodurch der<br />
Vortrieb <strong>in</strong> kurzer Distanz h<strong>in</strong>ter dem Bohrkopf verfolgt<br />
und erfasst werden kann. Die Ortung erfolgte mit dem<br />
Messsystem DCI F 5.<br />
In der extremen, nicht standsicheren und rutschigen<br />
Hanglage war e<strong>in</strong>e Seilsicherung als besondere Schutzmaßnahme<br />
für den Bedienungsmann erforderlich.<br />
Die Bohrtiefe lag maximal bei 5,70 m. Die Pilotbohrung<br />
mit 160 mm Durchmesser konnte bereits nach e<strong>in</strong>em<br />
Arbeitstag erfolgreich abgeschlossen werden. Nun musste<br />
die Pilotbohrung noch auf ca. 300 mm aufgeweitet<br />
werden. Dafür wurde der Rockbreaker demontiert und<br />
e<strong>in</strong> 12“-Holeopener mit dem Gestänge verbunden und<br />
zurückgezogen. Diese Arbeiten nahmen mit Unterbrechungen<br />
für die Erstellung der Bohrsuspension ebenfalls<br />
e<strong>in</strong>en Arbeitstag <strong>in</strong> Anspruch. Der E<strong>in</strong>zug des Rohrbündels<br />
dauerte dagegen nicht e<strong>in</strong>mal 1 1/4 Stunde.<br />
Fotos Tracto-Technik, Lennestadt<br />
Fazit<br />
Insgesamt e<strong>in</strong>e erfolgreiche Maßnahme, die <strong>in</strong>nerhalb von<br />
drei Tage realisiert werden konnte, und die vor allem bei<br />
den Anliegern auf großes Interesse und Zuspruch stieß.<br />
KONTAKT: TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG, Lennestadt,<br />
Tel. +49 2723 808-0, E-Mail: walter.schad@t-onl<strong>in</strong>e.de,<br />
www.tracto-technik.de<br />
Bild 5: Der Rockbreaker mit dem Rollenmeißel nach der Pilotbohrung<br />
11-12 | 2013 91
FACHBERICHT ENERGIEVERSORGUNG<br />
Thermoplastische Großrohre für den<br />
Kühlwassertransport<br />
Die Kühlwasserversorgung ist e<strong>in</strong> essentieller Bestandteil von modernen Industrieanlagen. Stillstandszeiten s<strong>in</strong>d bei<br />
Umbauten wenn möglich zu vermeiden, oder auf e<strong>in</strong> M<strong>in</strong>imum zu reduzieren. Die Lebensdauer ist auf lange Betriebszeiten<br />
auszulegen. Polymere Werkstoffe bieten hierbei Lösungsmöglichkeiten und stehen für e<strong>in</strong>en sicheren und<br />
langfristigen Betrieb. Im Besonderen bei der Korrosionsbeständigkeit bieten thermoplastische Rohrsysteme deutliche<br />
Vorteile gegenüber herkömmlichen Systemen. Im Zuge der stetigen Verbesserung <strong>in</strong> der Extrusionstechnik von thermoplastischen<br />
Rohren können mittlerweile deutlich größere Dimensionen produziert werden als dies noch vor wenigen<br />
Jahren der Fall war. Auch die notwendige Verb<strong>in</strong>dungstechnik wird weiterentwickelt. So kann bei guter Planung und<br />
Umsetzung <strong>in</strong>nerhalb kürzester Zeit e<strong>in</strong> Komplettsystem <strong>in</strong>stalliert oder bestehende Systeme umgerüstet werden. Der<br />
Fachbeitrag zeigt am Beispiel e<strong>in</strong>er PE 100-Kühlwasserleitung da 1200 mm SDR 17 die Möglichkeiten von thermoplastischen<br />
Rohrsystemen bei Ausnutzung der aktuell zur Verfügung stehenden Technik auf.<br />
EINLEITUNG<br />
Die Zellstoff Stendal GmbH mit Sitz <strong>in</strong> Arneburg ist Zentraleuropas<br />
modernster und größter Hersteller von NBSK (Northern<br />
Bleached Softwood Kraft) Marktzellstoff und Betreiber von<br />
Deutschlands größtem Biomassekraftwerk mit e<strong>in</strong>er Leistung<br />
von 100 MW (Bild 1). Im Oktober 2012 begann bei Zellstoff<br />
Stendal im Rahmen e<strong>in</strong>er Anlagenerweiterung die Installation<br />
e<strong>in</strong>er 45 MW-Turb<strong>in</strong>e mit zugehörigen Zellenkühltürmen.<br />
Für die Verb<strong>in</strong>dung der beiden Anlagenteile wurden 250 m<br />
da 1200 mm Kühlwasserleitung sowie die entsprechenden<br />
Formteile projektiert, um den notwendigen Durchsatz von<br />
9.600 m³/h bewältigen zu können. Auf Grund des engen<br />
Term<strong>in</strong>plans musste der E<strong>in</strong>bau der Kühlwasserleitung auf<br />
verlässliche Technik zurückgegriffen werden.<br />
Vorgabe war es, die Anlage <strong>in</strong>nerhalb möglichst kurzer Zeit<br />
<strong>in</strong> Betrieb zu nehmen. Dabei durften die Anlagensicherheit,<br />
die Langlebigkeit und die Kostenstruktur nicht vernachlässigt<br />
werden. Die möglichen Systeme wurden e<strong>in</strong>gehend geprüft<br />
und gegenübergestellt. Nach Sichtung aller Varianten entschied<br />
man sich sowohl unter Betrachtung der oben genannten<br />
Kriterien, als auch durch die guten Erfahrungen mit der<br />
im Jahr 2004 <strong>in</strong>stallierten PE-Kühlwasserleitung für die 100<br />
MW-Turb<strong>in</strong>e wiederum für e<strong>in</strong> PE 100-Rohrsystem. Polyethylen<br />
zeichnet sich durch hervorragende technische, chemische und<br />
physiologische Eigenschaften aus. Dies spiegelt sich <strong>in</strong> den<br />
vorhandenen Prüfungen und Zulassungen wider [1]. Auch<br />
kann gemäß DIN 8075 [2] mit e<strong>in</strong>er Nutzungsdauer von bis<br />
zu 100 Jahren e<strong>in</strong> hohes Maß an Langlebigkeit angesetzt<br />
werden, die bei der Abschreibung der Investition berücksichtigt<br />
werden kann.<br />
In den vergangenen Jahren wurden die PE-Rohstoffe immer<br />
weiter verbessert und für immer höhere Belastungen konzipiert<br />
[3]. Dadurch wird der E<strong>in</strong>satz von axial extrudierten<br />
Rohren <strong>in</strong> Dimensionen möglich, die den thermoplastischen<br />
Systemen bisher verschlossen blieben. Somit lassen sich die<br />
Vorteile der Thermoplaste, im Besonderen die des verwendeten<br />
PE 100 [4] nutzen.<br />
Die Materialeigenschaften von PE werden seit fast 60 Jahren<br />
im Bereich der Ver- und Entsorgung [5] mit wachsendem<br />
Marktanteil genutzt [6]. Der E<strong>in</strong>satz von PE-Rohren für den<br />
Kühlwassertransport bewährt sich <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>eren Rohrdimensionen<br />
ebenfalls seit Jahren bestens <strong>in</strong> Kraftwerksanlagen,<br />
Automobilbetrieben und der Chemie<strong>in</strong>dustrie [7]. Hiermit<br />
Bild 1: Zellstoff Stendal GmbH <strong>in</strong> Arneburg<br />
92 11-12 | 2013
ENERGIEVERSORGUNG FACHBERICHT<br />
Bild 2: Querung mehrerer Rohrtrassen<br />
Bild 3: Vorfertigung des Etagenbogens<br />
lassen sich Sicherheit, Langlebigkeit und hohe Korrosionsbeständigkeit<br />
<strong>in</strong> Komb<strong>in</strong>ation mit e<strong>in</strong>em optimalen Kosten-/<br />
Nutzenverhältnis vere<strong>in</strong>en.<br />
Die Entwicklung von thermoplastischen Rohrsystemen ist <strong>in</strong><br />
den vergangenen Jahren stetig vorangeschritten. Wurden<br />
Anfang der 1990er Jahre PE 80-Rohre bis da 630 mm axial<br />
extrudiert, so können mittlerweile PE 100-Druckrohre bis da<br />
2250 mm im Extrusionsverfahren hergestellt werden. Dies<br />
ermöglicht es, bestehende Anwendungsgebiete auszuweiten<br />
und neue zu erschließen. Um den anwendungsspezifischen<br />
Anforderungen gerecht zu werden, müssen neben der Rohrleitung<br />
auch die Formteile, sowie die Verb<strong>in</strong>dungstechnik die<br />
Voraussetzung für e<strong>in</strong>en sicheren und dauerhaften Betrieb<br />
erfüllen.<br />
PLANUNG UND VORBEREITUNG<br />
Die Verb<strong>in</strong>dungsleitungen wurden als System aus Vor- und<br />
Rücklauf <strong>in</strong> der Dimension da 1200 mm aus PE 100-Rohr<br />
SDR 17 mit 71,2 mm Wanddicke geplant. Sowohl die Anb<strong>in</strong>dung<br />
der Turb<strong>in</strong>enseite als auch zum Kühlturm war als<br />
Komb<strong>in</strong>ation aus Losflansch nach DIN EN 1092-1 [8] und<br />
PE 100-Vorschweißbund spezifiziert. Bis auf diese Übergangsstellen<br />
war die Verb<strong>in</strong>dung der Rohre und Formteile<br />
lediglich mittels Heizelementstumpfschweißen nach DVS<br />
2207-1 [9] gestattet. Dies erhöht die Sicherheit, da Schweißverb<strong>in</strong>dungen<br />
ke<strong>in</strong>e Wartung oder Revision benötigen und<br />
somit problemlos bei erdverlegten Leitungen zum E<strong>in</strong>satz<br />
kommen können.<br />
PE 100-Rohrsysteme s<strong>in</strong>d gemäß ATV-DVWK-A 127 [10]<br />
als biegeweiche Systeme def<strong>in</strong>iert. Diese Eigenschaft kann<br />
man sich <strong>in</strong> Bezug auf Lastwechsel, Setzungen und Konsolidierungsvorgänge<br />
von Gebäuden zu Nutze machen,<br />
<strong>in</strong>dem die Rohre die auftretenden Kräfte aufnehmen und<br />
über Festpunkte oder an das umgebende Erdreich ableiten.<br />
Aufwändige Lösungen mittels Kompensatoren <strong>in</strong> druckklassengerechter<br />
Ausführung oder ähnlicher Bauteile entfallen.<br />
Somit wird sowohl der Wartungsaufwand reduziert als auch<br />
die Kosten drastisch gesenkt.<br />
Der turb<strong>in</strong>enseitige Anschluss erfolgte unter der Geländeoberkante<br />
im Turb<strong>in</strong>engebäude, die Anb<strong>in</strong>dung an den<br />
Kühlturm h<strong>in</strong>gegen <strong>in</strong> 8 m Höhe über GOK. Die Rohrleitung<br />
war gemäß Isometrie als Steigleitung aus dem Erdreich<br />
herauszuführen, 8 m senkrecht an der Gebäudeaußenseite<br />
nach oben und anschließend <strong>in</strong> das Bauwerk h<strong>in</strong>e<strong>in</strong> zu<br />
führen. Der Anschluss an den GFK-Verteilerbalken vor den<br />
Zellenkühlern musste komplett lastfrei erfolgen, um diesen<br />
nicht zu beschädigen. Hierfür wurden auf den Anwendungsfall<br />
ausgelegte und statisch berechnete Festpunktformteile<br />
direkt vor der Flanschverb<strong>in</strong>dung e<strong>in</strong>gebaut, die<br />
durch Temperaturschwankungen auftretende Längenänderung<br />
wurde mittels Festpunktkonstruktion unterbunden<br />
und die Kräfte vor dem GFK-Bauteil <strong>in</strong> die Unterkonstruktion<br />
e<strong>in</strong>geleitet.<br />
Um die Funktionsfähigkeit der Rohrleitung auf Dauer<br />
gewährleisten zu können, wurde das System sowohl nach<br />
ATV-DVWK-A 127 für den erdverlegten Abschnitt als auch<br />
nach DVS 2210-1 [11] für den überirdisch verlegten Bereich<br />
ausgelegt. Hierbei wurde besonders Augenmerk auf die<br />
Lebensdauer <strong>in</strong> Komb<strong>in</strong>ation mit den auftretenden Temperaturen<br />
und den daraus resultierenden Spannungen gelegt.<br />
Auch die Positionierung der Festpunkte und der Formteile<br />
zusammen mit der verwendeten Schweißtechnik ist für das<br />
Gesamtsystem ausschlaggebend. Hierfür konnte die DVS<br />
2210-1 ebenfalls für erste H<strong>in</strong>weise zum materialgerechten<br />
Planen herangezogen werden. Die Wanddicke der Rohre lag<br />
über den <strong>in</strong> der DVS 2207-1 erfassten Wanddicken. Somit<br />
wurden die dort angegebenen Richtwerte für das Angleichen,<br />
Anwärmen, Umstellen und Fügen anhand vorangegangener<br />
Untersuchungen angepasst [12]. Seit August 2013<br />
kann für das Schweißen von Großrohren zusätzlich das DVS<br />
2207-1 Beiblatt 2 [13] als Richtl<strong>in</strong>ie herangezogen werden.<br />
Die Formteile <strong>in</strong> der Dimension da 1200 SDR 17 wurden<br />
als Segmentbauteile geplant und umgesetzt. Segmentierte<br />
Formteile werden <strong>in</strong> dieser Größenordnung entweder als<br />
extrusionsgeschweißte oder stumpfgeschweißte Formteile<br />
gefertigt. Auf Grund der höheren Kurz- und Langzeitfestigkeit<br />
gemäß DVS 2205-1 [14] und somit der höheren Druckbelastbarkeit<br />
als auch auf Grund der Planungsvorgaben, fiel<br />
die Wahl auf stumpfgeschweißte Formteile.<br />
Die Rohrleitung quert Abwasser-, Feuerlösch- und Versorgungsleitungen<br />
auf gleicher Achse im Verlauf des Rohrstranges<br />
(Bild 2). Somit war es mittels Formteilen notwendig,<br />
die vorhandenen Leitungen zu umspr<strong>in</strong>gen, wobei die<br />
vorhandenen Leitungen nicht außer Betrieb genommen<br />
11-12 | 2013 93
FACHBERICHT ENERGIEVERSORGUNG<br />
Bild 4: Dokumentation der Schweißnähte<br />
Bild 5: Verschluss des Rohrendes zur Sicherung gegen Zugluft<br />
werden durften. Im vorliegenden Fall entschied man sich<br />
aufgrund der örtlichen Gegebenheiten, den vorherrschenden<br />
Witterungsbed<strong>in</strong>gungen während des Jahreswechsels<br />
2012/2013 und der e<strong>in</strong>zuhaltenden Zeitschiene für werkseitig<br />
vorgefertigte Etagenbögen (Bild 3).<br />
AUSFÜHRUNG<br />
Die Bauausführung erfolgte durch Gerhard Rode Rohrleitungsbau,<br />
Zweigniederlassung Wischhafen, die neben der<br />
Zertifizierung als WHG-Fachbetrieb auch die Zertifizierung<br />
der Kunststoffschweißer nach DVS 2212-1 [15] verfügt. Aufgrund<br />
der langjährigen Erfahrung im Kunststoffrohrleitungsbau<br />
wurde das ursprüngliche Mengengerüst angepasst und<br />
die Stangenlänge dort, wo es möglich war von 6 m auf 12<br />
m vergrößert. Dies ermöglicht e<strong>in</strong>en Geschw<strong>in</strong>digkeitsvorteil<br />
aufgrund der entfallenden Schweißverb<strong>in</strong>dungen vor Ort.<br />
Weiterh<strong>in</strong> wurde e<strong>in</strong> ausführlicher Montageplan erstellt, der<br />
es ebenfalls erlaubte, die Ausführung den Gegebenheiten<br />
vor Ort anzupassen.<br />
Durch die Mitarbeit aller Beteiligten konnte der Verlegeaufwand<br />
mittels kunststoffgerechter Anpassung auf e<strong>in</strong> M<strong>in</strong>imum<br />
reduziert werden. Als Beispiel sei hier e<strong>in</strong>er der vorgefertigten<br />
Etagenbögen genannt, die als Sonderkonstruktion<br />
<strong>in</strong> enger Zusammenarbeit mit der Bauleitung vor Ort auf das<br />
Bauwerk abgestimmt und <strong>in</strong> der werkseigenen Fertigung<br />
umgesetzt wurde. Das Bauteil hat e<strong>in</strong>e Länge von über 14<br />
m bei e<strong>in</strong>em Achsversatz von über 1 m, welches als e<strong>in</strong><br />
Bauteil auf die Baustelle verbracht wurde.<br />
Rohre und Formteile aus PE 100 bieten durch ihr relativ niedriges<br />
Gewicht von 0,96 g/cm³ erhebliche Vorteile gegenüber<br />
anderen Werkstoffen. So ist es möglich, mit vergleichsweise<br />
kle<strong>in</strong>em Hebegerät große Teilstücke zu bewegen und punktgenau<br />
zu positionieren. Dies bee<strong>in</strong>flusst die Montage und<br />
somit auch die Installationsgeschw<strong>in</strong>digkeit positiv.<br />
Die genaue Markierung, Bezeichnung und somit auch die<br />
Dokumentation ist für den Erfolg e<strong>in</strong>es Projektes dieser<br />
Größenordnung essentiell. Dies beg<strong>in</strong>nt bei der Fertigung<br />
der segmentierten Rohrformteile, bei denen sowohl die e<strong>in</strong>zelnen<br />
Schenkel mittels Signierung genau zur Endposition im<br />
Formteil zuzuordnen s<strong>in</strong>d. Es setzt sich bei der Benennung<br />
und gut sichtbaren Markierung der e<strong>in</strong>zelnen Formteile fort,<br />
die wiederum genau der Position im Verlegeplan zuzuordnen<br />
ist und endet schließlich bei der Markierung der<br />
Schweißnähte mit Übertrag <strong>in</strong> den Verlegeplan zur Dokumentation<br />
und Rückverfolgbarkeit nach DVS 2210-1 (Bild 4).<br />
Auch die Anb<strong>in</strong>dung an andere Gewerke wie das Turb<strong>in</strong>enhaus<br />
und die Zellenkühler mittels genau def<strong>in</strong>ierter Übergabepunkte<br />
beschleunigte den Bauablauf deutlich. Durch<br />
die Verwendung von DN 1000-Losflanschen aus Edelstahl<br />
1.4571 nach DIN EN 1092-1 mit PE 100-Vorschweißbunden<br />
da 1200 mm konnte die Übergabe mittels Vermessungse<strong>in</strong>richtungen<br />
an exakt spezifizierten Positionen im Vorfeld<br />
festgelegt und <strong>in</strong> der Bauphase umgesetzt werden.<br />
Die Schweißarbeiten wurden im Zeitraum vom Dezember<br />
2012 bis März 2013 unter für Schweißarbeiten widrigen<br />
Wetterbed<strong>in</strong>gungen durchgeführt. Um die Qualität der<br />
Schweißverb<strong>in</strong>dungen zu sichern, wurden die nach DVS<br />
2207-1 notwendigen Vorkehrungen getroffen. Hierzu<br />
zählt neben der E<strong>in</strong>hausung des Schweißbereichs bei<br />
starkem Regenfall oder W<strong>in</strong>d der Verschluss der Rohrenden<br />
zur Vermeidung des Kam<strong>in</strong>effekts, der je nach<br />
Isometrie und Umgebungsbed<strong>in</strong>gungen die Temperatur<br />
im Schweißbereich deutlich absenken kann. Ist dies bei<br />
kle<strong>in</strong>eren Rohrdimensionen beim Infrarotschweißen nach<br />
DDVS 2207-6 bereits für die Schweißnahtqualität ausschlaggebend,<br />
so ist dies bei Rohrdimensionen da 1200<br />
mm und den während der Bauzeit herrschenden Temperaturen<br />
um den Gefrierpunkt ebenfalls beim Stumpfschweißen<br />
möglich. In kle<strong>in</strong>eren Dimensionen können<br />
marktübliche Rohrverschlusskappen verwendet werden.<br />
In der vorliegenden Dimension s<strong>in</strong>d diese jedoch nicht<br />
verfügbar. Durch den vorausschauenden Umgang mit<br />
bauseits verfügbaren Mitteln konnten die Fachkräfte vor<br />
Ort den gewünschten Effekt mittels e<strong>in</strong>facher Hilfsmittel<br />
effektiv umsetzen (Bild 5).<br />
Um die Qualität der Schweißnähte zu gewährleisten, wurden<br />
Vorversuche vor Ort unter den Umgebungsbed<strong>in</strong>gungen der<br />
Baustelle durchgeführt. Somit konnte die Qualität der Schweißnähte<br />
mit hoher Sicherheit auch bei widrigen Bed<strong>in</strong>gungen<br />
94 11-12 | 2013
ENERGIEVERSORGUNG FACHBERICHT<br />
bestimmt werden. Nach Abschluss der Probeschweißungen<br />
und Kontrolle der vorliegenden 3.1 Zeugnisse nach DIN EN<br />
10204 [16] wurden die ersten Baustellennähte ausgeführt.<br />
Nach Fertigstellung der Rohrleitung wurde die Druckprüfung<br />
<strong>in</strong> Anlehnung an die DIN EN 805 [17] im Normalprüfungsverfahren<br />
durchgeführt. Hierfür erfolgt zunächst e<strong>in</strong>e Vorprüfung,<br />
die dafür sorgt, dass sich e<strong>in</strong> Spannungs-Dehnungs-<br />
Gleichgewicht <strong>in</strong> der Rohrleitung e<strong>in</strong>stellt. Dabei tritt e<strong>in</strong><br />
werkstoffbed<strong>in</strong>gter Druckabfall auf, der durch wiederholte<br />
Wasserzugabe zur Wiederherstellung des Prüfdrucks kompensiert<br />
werden muss. Weiterh<strong>in</strong> ist bei großdimensionierten<br />
Rohrsystemen häufig das Nachziehen der Flanschverb<strong>in</strong>dung<br />
erforderlich. Im direkten Anschluss an die Vorprüfung erfolgt<br />
die Hauptprüfung. Diese f<strong>in</strong>det für PE 100-Rohrsysteme<br />
mit e<strong>in</strong>er Gesamtlänge pro Rohrstrang größer 100 m und<br />
kle<strong>in</strong>er gleich 500 m bei 85 % des zulässigen Prüfdrucks<br />
über m<strong>in</strong>destens sechs Stunden statt. Hierbei gilt es auch<br />
die Temperatur der Rohrleitung zu berücksichtigen, die E<strong>in</strong>fluss<br />
auf den Prüfdruck und das Verhalten der Rohrleitung<br />
während der Druckprüfung haben kann. Im vorliegenden<br />
Fall war dies aufgrund der konstanten Temperaturen jedoch<br />
nur <strong>in</strong> ger<strong>in</strong>gfügigem Maße ausschlaggebend. Die Rohrleitung<br />
wurde <strong>in</strong>klusive Formteile mit 7 bar geprüft, was den<br />
Vorgaben der DVS 2210-1 Beiblatt 2 [18] entspricht.<br />
ZUSAMMENFASSUNG<br />
Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass PE 100-Rohrsysteme<br />
für Kühlwassersysteme bestens geeignet s<strong>in</strong>d. Die<br />
kurze E<strong>in</strong>bauzeit bei hohem Vorfertigungsgrad lässt es zu,<br />
dass komplexe Systeme schnell und zur Zufriedenheit aller<br />
<strong>in</strong>stalliert werden können. Weiterh<strong>in</strong> kann durch die materialgerechte<br />
Auslegung des Systems Zeit und Geld e<strong>in</strong>gespart<br />
werden, was gleichzeitig den Arbeitsaufwand bei der<br />
Verlegung reduziert. Bei der Zellstoff Stendal GmbH konnte<br />
die neue Turb<strong>in</strong>e <strong>in</strong>nerhalb kürzester Zeit <strong>in</strong> Betrieb gehen.<br />
Durch den E<strong>in</strong>satz moderner Rohrwerkstoffe aus PE ergeben<br />
sich somit Chancen beim Bau von <strong>in</strong>dustriellen Anlagen<br />
zur Medien- und Kühlwasserversorgung, die vor wenigen<br />
Jahren noch nicht möglich waren. Anlagenbetreiber können<br />
so schnell und kostengünstig bestehende Systeme erweitern<br />
oder neue Anlagen <strong>in</strong> Betrieb nehmen.<br />
LITERATURVERZEICHNIS<br />
[1] D. I. f. Bautechnik „Allgeme<strong>in</strong>e bauaufsichtliche Zulassung, Rohre<br />
aus Polyethylen Z-40.23-231“ (2009)<br />
[2] DIN 8074 „Rohre aus Polyethylen (PE) – Maße“ (2011)<br />
[3] Frank GmbH, „Der Rohrwerkstoff PE 100“, http://www.frankgmbh.de/download/download-deutsch/download/fachbeitraege/<br />
pe_100.pdf (1999)<br />
[4] Frank GmbH, „Technische Informationen zu Kunststoff-<br />
Rohrsystemen“ (2003)<br />
[5] E. D. G. u. M. W. Gaube, „Rohre aus thermoplastischen<br />
Kunststoffen - Erfahrungen aus 20 Jahren Zeitstandprüfung,“<br />
Kunststoffe, Bd. 66. Jahrgang, Nr. 1, pp. 2-8 (1976)<br />
[6] T. H. C. L. V. Frank, „Rohrwerkstoffe <strong>in</strong> der öffentlichen<br />
Abwasser-entsorgung - Verbreitung, Erfahrung und mögliche<br />
Kostensenkungspotentiale,“ <strong>3R</strong> International (45), Bd. 8 (2006)<br />
[7] T. Knöß, „Hohe Qualitätsanforderungen für thermoplastische<br />
Wickelrohre im <strong>in</strong>dustriellen E<strong>in</strong>satz,“ <strong>3R</strong> <strong>in</strong>ternational -<br />
Sonderausgabe, pp. 29-33, 01 (2010)<br />
[8] DIN EN 1092-1 „Flansche und ihre Verb<strong>in</strong>dungen - Runde Flansche<br />
für Rohre, Armaturen, Formstücke und Zubehörteile, nach PN<br />
bezeichnet - Teil 1: Stahlflansche“ (2007)<br />
[9] DVS 2207-1 „Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen -<br />
Heizelementschweißen von Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln<br />
aus PE-HD“ (2005)<br />
[10] ATV-DVWK A 127 „Statische Berechnung von Abwasserkanälen<br />
und -leitungen“ (2008-04)<br />
[11] DVS2210-1 „Industrierohrleitungen aus thermoplastischen<br />
Kunststoffen - Projektierung und Ausführung - Oberiridsche<br />
Systeme“ (1997)<br />
[12] T. Frank, „Schweißen von Rohren mit großem Durchmesser“<br />
Jo<strong>in</strong><strong>in</strong>g Plastics, Nr. 4, pp. 272-284 (2008)<br />
[13] DVS 2207-1 BB2 „Heizelementstumpfschweißen von Rohren und<br />
Rohrleitungsteilen großer Wanddicke bzw. Durchmesser aus PE“<br />
(2013)<br />
[14] DVS 2205-1 „Berechnung von Behältern und Apparaten aus<br />
Thermoplasten - Kennwerte“ (2002)<br />
[15] DVS 2212-1 „Prüfung von Kunststoffschweißern Prüfgruppe I<br />
und II“ (2006)<br />
[16] DIN EN 10204 „Metallische Erzeugnisse - Arten von<br />
Prüfbesche<strong>in</strong>igungen“ (2004)<br />
[17] DIN EN 805 „Anforderungen an Wasserversorgungssysteme und<br />
deren Bauteile außerhalb von Gebäuden“ (2000)<br />
[18] DVS 2210-1 BB2 „Industrierohrleitungen aus thermoplastischen<br />
Kunststoffen - Empfehlung zur Innendruck- und Dichtheitsprüfung“<br />
(2004)<br />
AUTOREN<br />
MAIK BRETTSCHNEIDER<br />
Gerhard Rode Rohrleitungsbau GmbH & Co.<br />
KG, Niederlassung Wischhafen<br />
Tel. +49 4141 4075-792<br />
E-Mail: m.brettschneider@gerhard-rode.de<br />
RONALD ZIERAU<br />
Zellstoff Stendal GmbH, Arneburg<br />
E-Mail: ronald.zierau@zellstoff-stendal.de<br />
ANDREAS KUNZ<br />
Frank GmbH, Mörfelden-Walldorf<br />
Tel. +49 6105 4085-148<br />
E-Mail: a.kunz@frank-gmbh.de<br />
11-12 | 2013 95
PROJEKT KURZ BELEUCHTET ENERGIEVERSORGUNG<br />
Kelag Wärme verbessert tech nische<br />
Genauigkeit und unternehmensweite<br />
Produktivität mit Bentley sisNET<br />
Kelag Wärme GmbH ist Teil der Energieversorgungs-Unternehmensgruppe Kelag. Das Unternehmen operiert <strong>in</strong> Österreich,<br />
Rumänien, Bulgarien, Slowenien und der Tschechischen Republik. Kelag Wärme hat 40 Jahre Erfahrung und gehört zu<br />
den führenden Fernwärmeversorgern. In Österreich betreibt Kelag 77 Fernwärmenetze und mehr als 1.000 Heizkaftwerke<br />
unterschiedlichster Größe; von der Kle<strong>in</strong>stanlage bis h<strong>in</strong> zu sehr großen Kraftwerks-Installationen. Das Netzwerk des<br />
Unternehmens hat e<strong>in</strong>e Gesamtlänge von mehr als 700 km. Kelag Wärme ist e<strong>in</strong> Wegbereiter bei der Wärmeerzeugung auf<br />
nachhaltigere Art und hat e<strong>in</strong>en größeren Schritt zur Nutzung e<strong>in</strong>es erneuerbaren Brennstoffs gemacht - Biomasse - <strong>in</strong> Form<br />
von Hackschnitzel-Pellets. Kelag Wärme ist der größte Erzeuger von Wärme aus Biomasse <strong>in</strong> Österreich. In dem Bentley-Projekt<br />
g<strong>in</strong>g es auch darum, das <strong>in</strong> Österreich bei der Fernwärmeversorgung verwendete GIS zu ersetzen.<br />
GRÜNDE FÜR EIN<br />
NEUES GIS<br />
Kelag Wärme hat festgestellt,<br />
dass das existierende<br />
GIS nicht mehr<br />
alle Anforderungen<br />
erfüllen konnte und das<br />
bedeutete, dass es durch<br />
e<strong>in</strong>e Technologie neuer<br />
Generation ersetzt werden<br />
musste. Teil dieser<br />
Probleme war, mit e<strong>in</strong>em<br />
GIS zu arbeiten, das<br />
nicht für Fernwärme-<br />
Infrastrukturen optimiert<br />
ist. Auch konnten die bei<br />
Kelag Wärme verwendeten<br />
thermohydraulischen<br />
Bild 1: E<strong>in</strong> Kelag Wärme-Fernheizkraftwerk<br />
<strong>in</strong> Österreich erzeugt heißes Wasser für die Modellierungs-Systeme<br />
Nutzung von Fernwärme<br />
die Daten des bisherigen<br />
GIS nicht e<strong>in</strong>b<strong>in</strong>den. Die<br />
Daten mussten mit unnötigem Aufwand von Zeit und Geld<br />
neu erstellt werden. Es war also e<strong>in</strong> Neubeg<strong>in</strong>n erforderlich.<br />
BENTLEY SISNET – EIN FÜR FERNWÄRME<br />
OPTIMIERTES GIS<br />
Kelag Wärme hat sich genau über das Angebot <strong>in</strong>formiert und<br />
dann die Entscheidung zugunsten des auf sisNET basierenden<br />
Bentley Systems gefällt. Laut Norbert Fischer von KELAG<br />
Wärme gibt es viele Gründe, warum das Bentley System das<br />
richtige für Kelag Wärme ist:<br />
»»<br />
Bentley sisNET ist e<strong>in</strong>es der wenigen für die Fernwärme-<br />
Infrastruktur optimierten GIS-Anwendungen (mit e<strong>in</strong>em<br />
separaten Fernwärme-Modul)<br />
»»<br />
Bentley sisNET basiert auf MicroStation ® – das bei Kelag<br />
Wärme für CAD-Projekte verwendet wird. Das Datenmodell<br />
<strong>in</strong> Bentley sisNET ist anpass- und erweiterbar,<br />
was bedeutet, dass alle erforderlichen Attribute für<br />
Analyse, Entwicklungsablauf und andere Management-<br />
Entscheidungen erfasst und verwendet werden können<br />
»»<br />
Die Daten s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Standard-Oracle-Datenbank<br />
gespeichert<br />
»»<br />
Die GIS-Daten können direkt von den thermohydraulischen<br />
Modellierungssystemen verwendet werden, die<br />
bei Kelag Wärme im E<strong>in</strong>satz s<strong>in</strong>d.<br />
„Die besseren Möglichkeiten <strong>in</strong> Bentley sisNET bei der Bearbeitung<br />
und Modellierung von Fernwärme-Infrastrukturen hat<br />
uns zu der Entscheidung für das Bentley Produkt und nicht für<br />
e<strong>in</strong>es der Wettbewerber bewogen. Wichtig ist für uns auch das<br />
offene Datenmodell und die Tatsache, dass das GIS mit anderen<br />
IT-Systemen, e<strong>in</strong>schließlich unserem thermohydraulischen<br />
Modellierungssystem und unserem SAP Asset-Management-<br />
System problemlos zusammenarbeitet“, so Fischer weiter.<br />
ABTEILUNGSÜBERGREIFENDE EINBINDUNG DER<br />
GIS-DATEN<br />
Die Daten im Bentley GIS werden jetzt, da sie genau und zuverlässig<br />
s<strong>in</strong>d, <strong>in</strong> vielen Abteilungen verwendet. Sie werden für<br />
Entwicklung und Planung, Betrieb und Wartung, Verkauf und<br />
Market<strong>in</strong>g und zukünftig von der Geschäftsführung auch für<br />
strategische Entscheidungen e<strong>in</strong>gesetzt. E<strong>in</strong> Großteil der Planung<br />
neuer oder der Erweiterung vorhandener Netze wird mit<br />
Bentley sisNet durchgeführt. Die Daten müssen nicht erneut<br />
erzeugt werden, da die Bestandsdaten absolut zuverlässig s<strong>in</strong>d.<br />
Bei Betrieb und Wartung können die Daten für Planungsänderungen<br />
und Ausrüstungsersatz-Strategien e<strong>in</strong>gesetzt werden.<br />
Wenn Sie zum Beispiel wissen, dass e<strong>in</strong> Reglerventil e<strong>in</strong>e<br />
Lebensdauer von 30 Jahren hat, können Sie alle Ventile mit<br />
e<strong>in</strong>em E<strong>in</strong>bau-Datum vor mehr als 30 Jahren auswählen und<br />
deren E<strong>in</strong>bauort ermitteln. Die Montage-Crews können dann<br />
für den Austausch sorgen. Der Austausch von Anlagenteilen<br />
am Ende ihrer Lebensdauer ist aus Gründen der Sicherheit sehr<br />
wichtig, um das Risiko von Schäden durch heißes Wasser aus<br />
gebrochenen Rohren oder durch den Ausfall von Ventilen zu<br />
96 11-12 | 2013
ENERGIEVERSORGUNG PROJEKT KURZ BELEUCHTET<br />
vermeiden. Verkauf und Market<strong>in</strong>g benutzen die Orthophotos<br />
im GIS für die Suche nach möglichen neuen Kunden, <strong>in</strong>dem<br />
neue Gebäude gefunden werden, die nahe genug an e<strong>in</strong>em<br />
vorhandenen Netz s<strong>in</strong>d, um angeschlossen zu werden.<br />
EINSATZ DES GIS FÜR DIE WARTUNGSPLANUNG<br />
UND VOR ORT<br />
Das Bentley GIS wird für die zeitliche Planung e<strong>in</strong>er Druckabsenkung<br />
<strong>in</strong> Teilen des Netzes zum Zwecke der Reparatur<br />
oder Verbesserung e<strong>in</strong>gesetzt. Mit dem GIS können die<br />
betroffenen Kunden ermittelt und über mögliche Betriebsunterbrechungen<br />
<strong>in</strong>formiert werden. Schächte und Armaturen<br />
müssen häufig überprüft werden, um sicherzustellen,<br />
dass sie richtig funktionieren und e<strong>in</strong>en Ausfall von Ventilen<br />
zu vermeiden. Die GIS-Daten werden auch vor Ort verwendet.<br />
Zur Zeit werden die Daten <strong>in</strong> Arbeitsplänen benutzt,<br />
aber da Kelag Wärme die Mobil-Geräte für den Außene<strong>in</strong>satz<br />
aufrüstet, wird Bentley ® sisVIEW für die papierlose<br />
Steuerung der Arbeitsabläufe vor Ort e<strong>in</strong>geführt, was zu<br />
weiteren Kosten-E<strong>in</strong>sparungen führt.<br />
DER VORTEIL EINES BROWSER-BASIERTEN ZUGRIFFS<br />
AUF GIS-DATEN<br />
Mit Bentley ® sisIMS, der Webserver-Komponente der Produkt-Suite,<br />
können die GIS-Daten auch nicht-technischen<br />
Benutzern wie der Geschäftsleitung, Verkauf und Market<strong>in</strong>g<br />
und dem Kundenservice zur Verfügung gestellt werden,<br />
wodurch die Verwendung der Daten erweitert und ihr Nutzen<br />
für die Organisation vermehrt wird. Zum Beispiel werden<br />
die Daten für die Rückmeldung an andere Dienstleister<br />
und Auftragsnehmer genutzt, die e<strong>in</strong>e Straße aufgraben<br />
müssen. Mit dem GIS werden bestehende Fernwärme-<br />
Infrastrukturen bekannt gemacht - Daten, die Kelag Wärme<br />
gesetzlich verpflichtet ist zu veröffentlichen. Die GIS-Daten<br />
werden e<strong>in</strong>mal erzeugt und dann immer wieder verwendet.<br />
Hierdurch wird e<strong>in</strong> kont<strong>in</strong>uierlicher Verbesserungsprozess <strong>in</strong><br />
Gang gesetzt: Je mehr Benutzer diese Daten haben, desto<br />
wahrsche<strong>in</strong>licher werden die Daten aktuell gehalten und<br />
jeder folgt genehmigten Abläufen bei der Aufnahme der<br />
Daten <strong>in</strong> das GIS.<br />
DER BISHERIGE NUTZEN<br />
Norbert Fischer erklärt, wie das neue Bentley GIS Kelag<br />
Wärme schon jetzt e<strong>in</strong>en großen Mehrwert gebracht hat,<br />
“Wir können bereits jetzt e<strong>in</strong>e beachtliche Reduktion der<br />
Zeit feststellen, die erforderlich ist, um Daten für neue<br />
Projekte und die Arbeit vor Ort zu erzeugen. Was früher<br />
Stunden oder Tage gedauert hat, ist heute fast augenblicklich<br />
erledigt. Dadurch werden wir alle produktiver.<br />
Die Daten bef<strong>in</strong>den sich alle an e<strong>in</strong>er Stelle, so dass es<br />
nicht notwendig ist, alte GIS-Ausdrucke, Excel-Spreadsheets<br />
und Word-Dokumente zu verknüpfen. Unsere thermohydraulischen<br />
Modellierungs-Prozesse wurden verbessert und<br />
ganz allgeme<strong>in</strong> hilft die Qualität des GIS uns allen <strong>in</strong> den<br />
verschiedenen Abteilungen fundiertere Entscheidungen zu<br />
treffen - und das ist genau das, was wir wollten, als wir das<br />
Projekt gestartet haben.“<br />
Bild 2: Die Verlegung neuer Fernwärme-Infrastruktur von Kelag<br />
wird <strong>in</strong> sisNET dokumentiert<br />
Bild 3: sisNET zeigt das Fernwärmenetz und mite<strong>in</strong>ander<br />
verbundene Gebäude<br />
Bild 4: Die <strong>in</strong> sisNET dokumentierte Netzwerk-Infrastruktur<br />
wird <strong>in</strong> Google Earth exportiert<br />
DIE NÄCHSTEN SCHRITTE<br />
E<strong>in</strong> Projekt dieses Umfangs ist niemals wirklich abgeschlossen.<br />
Die Organisation entwickelt sich weiter und das muss das GIS<br />
auch. Es gibt bereits Pläne, den Nutzen aus dem GIS noch weiter<br />
zu vergrößern; durch e<strong>in</strong>e Integration mit dem SAP-Asset-<br />
Management-System und mit Echtzeit-Scada-Systemen, die<br />
Daten über das Netzwerkverhalten mit räumlichen Ansichten<br />
der Infrastruktur verknüpfen.<br />
KONTAKT: Bentley Systems Germany, Isman<strong>in</strong>g<br />
Tel: +49 89 9624320, www.bentley.com<br />
11-12 | 2013 97
KORROSIONSSCHUTZ<br />
8. Praxistag<br />
Korrosionsschutz<br />
SAVE THE DATE<br />
25. Juni 2014<br />
VELTINS-Arena, Gelsenkirchen<br />
Veranstalter:
ABWASSERENTSORGUNG / SANIERUNG PROJEKT KURZ BELEUCHTET<br />
Marktübersicht<br />
2013<br />
Rohre + Komponenten<br />
Masch<strong>in</strong>en + Geräte<br />
Korrosionsschutz<br />
Dienstleistungen<br />
Sanierung<br />
Institute + Verbände<br />
Fordern Sie weitere Informationen an unter<br />
Tel. 0201/82002-35 oder E-Mail: h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
www.3r-marktuebersicht.de<br />
11-12 | 2013 99
2013<br />
FACHBERICHT RohRe RECHT + & Komponenten<br />
REGELWERK<br />
Marktübersicht<br />
Armaturen<br />
Armaturen + Zubehör<br />
Anbohrarmaturen<br />
Rohre<br />
Formstücke<br />
Schutzmantelrohre<br />
Kunststoff<br />
100 11-12 | 2013
RohRe + Komponenten<br />
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
2013<br />
Rohrdurchführungen<br />
Marktübersicht<br />
Dichtungen<br />
Ihr „Draht“ zur Anzeigenabteilung von<br />
Helga Pelzer<br />
Tel. 0201 82002-35<br />
Fax 0201 82002-40<br />
h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
11-12 | 2013 101
2013<br />
masch<strong>in</strong>en + GeRäte<br />
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
Marktübersicht<br />
Kunststoffschweißmasch<strong>in</strong>en<br />
Horizontalbohrtechnik<br />
Leckageortung<br />
102 11-12 | 2013
KoRRosionsschutz<br />
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
2013<br />
Kathodischer Korrosionsschutz<br />
Marktübersicht<br />
11-12 | 2013 103
2013<br />
KoRRosionsschutz<br />
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
Marktübersicht<br />
Kathodischer Korrosionsschutz<br />
104 11-12 | 2013
KoRRosionsschutz<br />
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
2013<br />
Korrosionsschutz<br />
Marktübersicht<br />
Ihr „Draht“ zur Anzeigenabteilung von<br />
Helga Pelzer<br />
Tel. 0201 82002-35<br />
Fax 0201 82002-40<br />
h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
11-12 | 2013 105
2013<br />
DienstleistunGen / sanieRunG<br />
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
Marktübersicht<br />
Sanierung<br />
Sanierung<br />
<strong>in</strong>stitute + VeRbänDe<br />
Institute<br />
106 11-12 | 2013
<strong>in</strong>stitute + VeRbänDe<br />
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
2013<br />
Verbände<br />
Marktübersicht<br />
11-12 | 2013 107
2013<br />
<strong>in</strong>stitute + VeRbänDe<br />
Marktübersicht<br />
Verbände<br />
INSERENTENVERZEICHNIS<br />
Firma<br />
Amitech Germany GmbH, Mochau 13<br />
AUMA Riester GmbH & Co. KG, Müllheim 7<br />
Dir<strong>in</strong>ger & Scheidel Rohrsanierung GmbH & Co. KG, Mannheim 17<br />
Funke Kunststoffe GmbH, Hamm 87<br />
Güteschutz Kanalbau e.V., Bad Honnef 15<br />
Haus der Technik e.V., Essen<br />
Beilage<br />
IE expo 2014, Shanghai, Volksrepublik Ch<strong>in</strong>a 81<br />
Infratech 2014, Essen Beilage, 19<br />
KLINGER GmbH, Idste<strong>in</strong> 49<br />
LUNIS Kommunikationsagentur, data graphis GmbH, Wiesbaden 35<br />
MEE Middle East Electricity 2014, Dubai, UAE 57<br />
Hermann Sewer<strong>in</strong> GmbH, Gütersloh 29<br />
Ste<strong>in</strong>zeug Keramo GmbH, Frechen 3<br />
Technische Akademie Hannover e.V., Hannover<br />
Beilage<br />
TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG, Lennestadt 9<br />
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hannover 5<br />
WAVIN GmbH,Twist<br />
Titelseite<br />
wire 2014 / Tube 2014, Düsseldorf<br />
Aufkleber<br />
Marktübersicht 98-108<br />
108 11-12 | 2013
SERVICES BUCHBESPRECHUNG<br />
HANDBUCH ROHRLEITUNGSBAU<br />
Band II: Berechnung<br />
Handbuch Rohrleitungsbau<br />
Band II: Berechnung<br />
3. Auflage<br />
Günter Wossog<br />
(Hrsg.)<br />
Günter Wossog (Hrsg.)<br />
Handbuch<br />
Rohrleitungsbau<br />
Band II: Berechnung<br />
3. Auflage<br />
INFOS:<br />
Herausgeber: Günter Wossog, Vulkan-Verlag, Essen,<br />
3. Auflage 2014, 950 Seiten, Gebunden, Preis € 179,00,<br />
ISBN: 9-783-8027-2768-9<br />
Seit vielen Jahren gehört das Handbuch Rohrleitungsbau<br />
mit se<strong>in</strong>en beiden Bänden zur Standardliteratur<br />
des Rohrleitungsbaus. Sie bilden den<br />
aktuellen Stand der Technik ab für die Berechnung,<br />
die Planung, die Herstellung und Errichtung<br />
von Rohrleitungssystemen sowohl im <strong>in</strong>dustriellen<br />
Anlagenbau als auch <strong>in</strong> der Versorgungstechnik.<br />
Der vorliegende Band II widmet sich dem Thema<br />
Berechnung von Rohrleitungen und ist nun <strong>in</strong><br />
der 3. Auflage erschienen. Inhaltlich wurde die 3.<br />
Auflage um jeweils e<strong>in</strong> Kapitel über e<strong>in</strong>fache statische<br />
Berechnungen sowie über die Dämpfung<br />
von Schw<strong>in</strong>gungen erweitert. Alle anderen Kapitel<br />
wurden stark überarbeitet und dem Stand der<br />
Technik angepasst. Die erheblichen Veränderungen<br />
im nationalen und <strong>in</strong>ternationalen Vorschriftenwerk<br />
wurden berücksichtigt.<br />
SANDFANG - LEITFADEN<br />
Effizienz-Steigerung, erweiterte Anwendungen und Prüfmethode<br />
Bertram Botsch<br />
Sandfang – Fettfang<br />
Bertram Botsch<br />
Sandfang – Leitfaden<br />
für Betreiber und Planer<br />
Effizienz-Steigerung, erweiterte Anwendungen und Prüfmethode<br />
INFOS:<br />
Autor: Bertram Botsch, Vulkan-Verlag, Essen, 1. Auflage<br />
2013, 116 Seiten, Broschur, Preis: € 34,00,<br />
ISBN: 9-783-8027-2565-4<br />
In diesem Leitfaden werden gezielte Maßnahmen<br />
zur Effizienz-Steigerung beschrieben, die<br />
vom Betreiber oder Planer von Sandfanganlagen<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>facher Weise umgesetzt werden können. E<strong>in</strong><br />
hydraulisch optimierter, umgerüsteter und betriebener<br />
Sandfang kann mit dem Begriff Hydrosandfang<br />
gekennzeichnet werden. Dieser weist e<strong>in</strong>e<br />
wesentlich höhere zulässige spezifische Belastung<br />
(Flächenbeschickung) auf. Die Ausführung Hydrosandfang<br />
kann bei fast allen bestehenden und<br />
geplanten Sandfängen vorgesehen werden: bei belüfteten<br />
oder unbelüfteten Sand- und Fettfängen<br />
und bei Sandfängen ohne Fettfang. Vorauszusetzen<br />
s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e hydraulisch richtige E<strong>in</strong>laufgestaltung und<br />
Trennwände im Fettfang. Die beschriebenen Effizienz-Steigerungen<br />
betreffen im E<strong>in</strong>zelfall: Sandabscheidung,<br />
Fettabscheidung, Energie, Lufte<strong>in</strong>trag,<br />
Räumerbetrieb, Ablagerungsfreiheit, Wartungsaufwand,<br />
Betriebssicherheit und Wirkungsgrad. Die<br />
vorteilhafte Verwendung e<strong>in</strong>es Zwill<strong>in</strong>gs-, Vierl<strong>in</strong>gsoder<br />
Mehrl<strong>in</strong>gssandfangs ist nachgewiesen.<br />
GASQUALITÄTEN IM VERÄNDERTEN ENERGIEMARKT<br />
Herausforderungen und Chancen für die häusliche, gewerbliche und <strong>in</strong>dustrielle Anwendung<br />
INFOS:<br />
Herausgeber: Jörg Leicher, Anne Giese, Norbert Burger,<br />
1. Auflage 2014, 596 Seiten, Broschur, Preis: € 80,00,<br />
ISBN: 9-783-8356-7122-5<br />
Erdgas hat sich <strong>in</strong> Deutschland und <strong>in</strong> Europa <strong>in</strong><br />
den letzten Jahrzehnten als vielseitiger, effizienter<br />
und umweltschonender Energieträger <strong>in</strong> Haushalt,<br />
Gewerbe und Industrie etabliert. Doch der<br />
Erdgasmarkt bef<strong>in</strong>det sich im Wandel: traditionelle<br />
Erdgasquellen versiegen, während neue Quellen,<br />
<strong>in</strong>sbesondere im außereuropäischen Ausland,<br />
an Bedeutung gew<strong>in</strong>nen. Im Rahmen der deutschen<br />
Energiewende spielt zudem die Nutzung<br />
regenerativer Quellen (Biogas oder auch Wasserstoff<br />
und Methan mittels „Power-to-Gas“) e<strong>in</strong>e<br />
immer größere Rolle, während auf EU-Ebene Handelshemmnisse<br />
zunehmend abgebaut werden.<br />
Diese Veränderungen bieten große Chancen für die<br />
Gasversorgung und -anwendung: erhöhte Versorgungssicherheit,<br />
wettbewerbsfähige Preise und global<br />
verr<strong>in</strong>gerte CO 2<br />
-Emissionen durch die Integration<br />
erneuerbarer Energien. Allerd<strong>in</strong>gs wird dies auch zu<br />
größeren Schwankungen der verbrennungstechnischen<br />
Eigenschaften des Erdgases führen, worauf<br />
nicht jede Anwendung <strong>in</strong> Industrie und Haushalt<br />
ausreichend vorbereitet ist.<br />
In diesem Sammelband s<strong>in</strong>d relevante Veröffentlichungen<br />
aus den Fachzeitschriften „gwf<br />
Gas|Erdgas“ und „Gaswärme International“ zusammengetragen,<br />
die dieses hochaktuelle Thema<br />
aus ganz unterschiedlichen Blickw<strong>in</strong>keln betrachten.<br />
Gasversorger kommen ebenso zu Wort wie<br />
Gasverbraucher aus Haushalt und Industrie. Begleitet<br />
wird der Band durch e<strong>in</strong>e Reihe von Texten, <strong>in</strong><br />
denen wesentliche Grundlagen zu Fragen der Gasqualität<br />
erläutert und die aktuelle und zukünftige<br />
Situation analysiert wird.<br />
11-12 | 2013 109
SERVICES AKTUELLE TERMINE<br />
brbv<br />
SPARTENÜBERGREIFENDE<br />
GRUNDLAGENSCHULUNGEN<br />
Fachaufsicht (A/B) für horizontales<br />
Spülbohrverfahren nach GW 329<br />
A: 10.-14.02.2014 Oldenburg<br />
B: 10.-19.02.2014 Oldenburg<br />
Bauleiter (A/B) für horizontales<br />
Spülbohrverfahren nach GW 329<br />
A: 13.-24.01.2014 Oldenburg<br />
B: 13.-31.01.2014 Oldenburg<br />
SEMINARE<br />
Spülbohrsem<strong>in</strong>ar<br />
egeplast<br />
23.01.2014 Greven<br />
GWI Essen<br />
SEMINARE<br />
Gas-Druckregel- und Messanlagen<br />
13./14.01.2014 Essen<br />
Verfahren zur Montage und Demontage<br />
von Dichtverb<strong>in</strong>dungen an Rohrleitungen<br />
und Apparaten<br />
01.04.2014 Essen<br />
Prüfungen von Druckbehälteranlagen<br />
und Rohrleitungen nach der<br />
Betriebssicherheitsverordnung<br />
02.04.2014 Essen<br />
Dichtungen – Schrauben – Flansche<br />
02.04.2014 Essen<br />
05.06.2014 Bremerhaven<br />
Geräteführer (A/B) für horizontales<br />
Spülbohrverfahren nach GW 329<br />
A: 13.-28.01.2014 Oldenburg<br />
B: 13.1.-4.2.2014 Oldenburg<br />
GFK-Rohrleger nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
W 324 - Nachschulung<br />
17.01.2014 Gera<br />
GAS/WASSER<br />
INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN<br />
Arbeiten an Gasleitungen – BGR 500 Kap.<br />
2.31<br />
08.01.2014 Frankfurt/Ma<strong>in</strong><br />
14.01.2014 Münster<br />
Bau von Gasrohrnetzen bis 16 bar<br />
28./29.01.2014 Northeim<br />
Techniklehrgang für Vorarbeiter im<br />
Rohrleitungsbau – Gas/Wasser<br />
27.-31.01.2014 Hamburg<br />
DVGW-Arbeitsblatt GW 301<br />
– Qualitätsanforderungen für<br />
Rohrleitungsbauunternehmen<br />
09.01.2014 Berl<strong>in</strong><br />
PRAXISSEMINARE<br />
Druckprüfung von Gas- und<br />
Wasserleitungen<br />
15./16.01.2014 Nürnberg<br />
Arbeiten an Gasleit8ungen – BGR 500,<br />
Kap. 2.31 – Fachaufsicht<br />
13.-17.01.2014 Gera<br />
Fachaufsicht Korrosionsschutz für<br />
Nachumhüllungsarbeiten gemäß DVGW-<br />
Merkblatt GW 15<br />
16.01.2014 Münster<br />
Praxis der Ortsgasverteilung<br />
14./15.01.2014 Essen<br />
Sicherheitstra<strong>in</strong><strong>in</strong>g zum Gaszählerwechsel<br />
16./17.01.2014 Essen<br />
Technische Regeln der Gas<strong>in</strong>stallation<br />
(TRGI) <strong>in</strong>tensiv<br />
22./23.01.2014 Essen<br />
Sicherheitstra<strong>in</strong><strong>in</strong>g bei Bauarbeiten im<br />
Bereich von Versorgungsleitungen –<br />
BALSibau - DVGW GW 129<br />
24.01.2014 Essen<br />
HDT<br />
SEMINARE<br />
Planung und Auslegung von Rohrleitungen<br />
06./07.02.2014 Essen<br />
26./27.06.2014 Bremerhaven<br />
Sicherheit beim Bau und Betrieb<br />
hochspannungsbee<strong>in</strong>flusster Pipel<strong>in</strong>e-<br />
Netze<br />
11.02.2014 Essen<br />
Kraftwerkstechnik<br />
11./12.02.2014 Essen<br />
24./25.06.2014 Essen<br />
11./12.11.2014 Essen<br />
Druckstöße, Dampfschläge und<br />
Pulsationen <strong>in</strong> Rohrleitungen<br />
10./11.03.2014 Essen<br />
30.06./01.07.2014 Berl<strong>in</strong><br />
22./23.09.2014 Knochel<br />
Rohrleitungen nach EN 13480 – Allgeme<strong>in</strong>e<br />
Anforderungen, Werkstoffe, Fertigung und<br />
Prüfung<br />
09./10.04.2014 Essen<br />
09./10.12.2014 München<br />
Rohrleitungssysteme für Kraftwerke<br />
(Dampf) nach ASME B31.1 und für Prozesse<br />
wie def<strong>in</strong>iert <strong>in</strong> ASME B31.3<br />
07.05.2014 Essen<br />
Planung und Auslegung von Rohrleitungen<br />
15./16.05.2014 Essen<br />
Schweißen von Rohrleitungen im Energieund<br />
Chemieanlagenbau – Planung und<br />
Auslegung von Rohrleitungen<br />
03./04.06.2014 Essen<br />
Dichtverb<strong>in</strong>dungen an Rohrleitungen<br />
04.06.2014 Bremerhaven<br />
Planung und Auslegung von Rohrleitungen<br />
15./16.05.2014 Essen<br />
RSV<br />
ZKS-BERATER-LEHRGÄNGE<br />
Blockschulung 2014<br />
13.-18.01.2014 Kerpen<br />
20.-25.01.2014 Kerpen<br />
27.-31.01.2014 Kerpen<br />
03.-08.02.2014 Kerpen<br />
Module Schulung 2014<br />
10.-15.03.2014 Dresden<br />
17.-22.03.2014 Dresden<br />
31.03.-04.04.2014 Dresden<br />
07.-12.04.2014 Dresden<br />
110 11-12 | 2013
AKTUELLE TERMINE SERVICES<br />
24.-29.03.2014 Feuchtwangen<br />
07.-12.04.2014 Feuchtwangen<br />
05.-09.05.2014 Feuchtwangen<br />
19.-24.05.2014 Feuchtwangen<br />
06.-11.10.2014 Hamburg<br />
10.-15.11.2014 Hamburg<br />
24.-28.11.2014 Hamburg<br />
08.-13.12.2014 Kiel<br />
TAE<br />
SEMINARE<br />
Hochspannungsbee<strong>in</strong>flussung erdverlegter<br />
Rohrleitungen<br />
30.01.2014 Ostfildern<br />
TAH<br />
TAW<br />
SEMINARE<br />
Kathodischer Korrosionsschutz<br />
unterirdischer Anlagen<br />
12.-14.03.2014 Wuppertal<br />
Rohrleitungen <strong>in</strong> verfahrenstechnischen<br />
Anlagen planen und auslegen<br />
25./26.03.2014 Wuppertal<br />
SAG<br />
SEMINARE<br />
Sachkundelehrgang Grundlagen und<br />
Anwendung des Berstl<strong>in</strong><strong>in</strong>gverfahrens<br />
27.01.2014 Lau<strong>in</strong>gen<br />
SEMINARE<br />
Zertifizierter Kanalsanierungs-Berater<br />
06.-11.01.2014 Essen<br />
17.-22.03.2014 Hannover<br />
Urbane Sturzfluten: Analyse, Bewertung,<br />
Lösung<br />
29.01.2014 Würzburg<br />
Verfahrenstechnische Erfahrungsregeln bei<br />
der Auslegung von Apparaten und Anlagen<br />
12./13.05.2014 Wuppertal<br />
KONTAKTADRESSEN<br />
Berufsförderungswerk des Rohrleitungsbauverbandes<br />
Kurt Rhode, Tel. 0221/37668-44, Fax 0221/37668-62,<br />
E-Mail: rhode@brbv.de, www.brbv.de<br />
DVGW Deutsche Vere<strong>in</strong>igung des Gasund<br />
Wasserfaches e.V.<br />
Tel. 0228/9188-607, Fax 0228/9188-997,<br />
E-Mail: splittgerber@dvgw.de, www.dvgw.de<br />
egeplast<br />
Holger Hesse, Tel. 02575/9710-252, E-Mail: holger.hesse@egeplast.de,<br />
www.egeplast-sem<strong>in</strong>are.de<br />
GWI Gas- und Wärme<strong>in</strong>stitut Essen e.V.,<br />
Barbara Hohnhorst, Tel. 0201/3618-143,<br />
Fax 0201/3618-146, E-Mail: hohnhorst@gwi-essen.de, www.gwi-essen.de<br />
HdT<br />
Haus der Technik Essen, Tel. 0201/1803-1,<br />
E-Mail: hdt@hdt-essen.de,<br />
www.hdt-essen.de<br />
E-Mail: rd.sales.de@spx.com, www.radiodetection.com<br />
SAG-Akademie<br />
Anja Kratt, Tel. 06151/10155-111, Fax 06151/10155-155,<br />
E-Mail: Kratt@SAG-Akademie.de, www.SAG-Akademie.de<br />
Technische Akademie Hannover<br />
Dr. Igor Borovsky, Tel. 0511/39433-30, Fax 0511/39433-40,<br />
E-Mail: borovsky@ta-hannover.de, www.ta-hannover.de<br />
Technische Akademie Wuppertal<br />
Tel. 0202/7495-207, Fax 0202/7495-228,<br />
E-Mail: taw@taw.de, www.taw.de<br />
ZKS<br />
RSV - Rohrleitungssanierungsverband e.V.,<br />
Tel.: 05963/9810877, Fax 05963/9810878,<br />
E-Mail: rsv-ev@t-onl<strong>in</strong>e.de, www.rsv-ev.de<br />
11-12 | 2013 111
Gasqualitäten im veränderten<br />
Energiemarkt<br />
Herausforderungen und Chancen für die häusliche,<br />
gewerbliche und <strong>in</strong>dustrielle Anwendung<br />
Erdgas hat sich <strong>in</strong> Deutschland und <strong>in</strong> Europa <strong>in</strong> den letzten Jahrzehnten als<br />
vielseitiger, effizienter und umweltschonender Energieträger <strong>in</strong> Haushalt,<br />
Gewerbe und Industrie etabliert. Doch der Erdgasmarkt bef<strong>in</strong>det sich im Wandel:<br />
traditionelle Erdgasquellen versiegen, während neue Quellen, <strong>in</strong>sbesondere<br />
im außereuropäischen Ausland, an Bedeutung gew<strong>in</strong>nen. Im Rahmen der<br />
deutschen Energiewende spielt zudem die Nutzung regenerativer Quellen<br />
(Biogas oder auch Wasserstoff und Methan mittels „Power-to-Gas“) e<strong>in</strong>e<br />
immer größere Rolle, während auf EU-Ebene Handelshemmnisse zunehmend<br />
abgebaut werden. Diese Veränderungen bieten große Chancen für die Gasversorgung<br />
und -anwendung.<br />
Hrsg.: Jörg Leicher, Anne Giese, Norbert Burger<br />
1. Auflage 2014<br />
ca. 250 Seiten, Farbdruck, broschiert mit festem Pappumschlag, DIN A5<br />
ISBN: 978-3-8356-7122-5<br />
Preis: € 60,–<br />
www.di-verlag.de<br />
Das Buch ersche<strong>in</strong>t im DIV Deutscher Industrieverlag GmbH, Arnulfstr. 124, 80636 München<br />
Jetzt vorbestellen!<br />
WISSEN FÜR DIE<br />
ZUKUNFT<br />
Bestellung per Fax: +49 201 / 820 Deutscher 02-34 Industrieverlag oder GmbH abtrennen | Arnulfstr. und 124 im | Fensterumschlag 80636 München e<strong>in</strong>senden<br />
Ja, ich bestelle gegen Rechnung 3 Wochen zur Ansicht<br />
___Ex.<br />
Gasqualitäten im veränderten Energiemarkt<br />
1. Auflage 2014 – ISBN: 978-3-8356-7122-5 für € 60,– (zzgl. Versand)<br />
Firma/Institution<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Straße / Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Antwort<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
Versandbuchhandlung<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
E-Mail<br />
Branche / Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise Bankabbuchung Rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung <strong>in</strong>nerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen <strong>in</strong> Textform (z.B.<br />
Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beg<strong>in</strong>nt nach Erhalt dieser Belehrung <strong>in</strong> Textform.<br />
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an die Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Versandbuchhandlung, Postfach 10 39 62, 45039 Essen.<br />
Bankleitzahl<br />
Ort, Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer<br />
PAGQEM2013<br />
Nutzung personenbezogener Daten: Für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit e<strong>in</strong>verstanden, dass ich<br />
vom DIV Deutscher Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per E-Mail, nicht über <strong>in</strong>teressante, fachspezifische Medien und Informationsangebote <strong>in</strong>formiert und beworben werde.<br />
Diese Erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
IMPRESSUM<br />
IMPRESSUM<br />
Verlag<br />
© 1974 Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Postfach 10 39 62, 45039 Essen,<br />
Telefon +49 201-82002-0, Fax -40<br />
Geschäftsführer: Carsten Augsburger, Jürgen Franke<br />
Redaktion<br />
Dipl.-Ing. N. Hülsdau, Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Huyssenallee 52-56, 45128 Essen,<br />
Telefon +49 201-82002-33, Fax +49 201-82002-40,<br />
E-Mail: n.huelsdau@vulkan-verlag.de<br />
Kathr<strong>in</strong> Lange, Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Telefon +49 201-82002-32, Fax +49 201-82002-40,<br />
E-Mail: k.lange@vulkan-verlag.de<br />
Barbara Pflamm, Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Telefon +49 201-82002-28, Fax +49 201-82002-40,<br />
E-Mail: b.pflamm@vulkan-verlag.de<br />
Anzeigenverkauf<br />
Helga Pelzer, Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Telefon +49 201-82002-66, Fax +49 201-82002-40,<br />
E-Mail: h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
Anzeigenverwaltung<br />
Mart<strong>in</strong>a Mittermayer,<br />
Vulkan-Verlag/DIV Deutscher Industrieverlag GmbH,<br />
Telefon +49 89-203 53 66-16, Fax +49 89-203 53 66-66,<br />
E-Mail: mittermayer@di-verlag.de<br />
Abonnements/E<strong>in</strong>zelheftbestellungen<br />
Leserservice <strong>3R</strong> INTERNATIONAL,<br />
Postfach 91 61, 97091 Würzburg,<br />
Telefon +49 931-4170-1616, Fax +49 931-4170-492,<br />
E-Mail: leserservice@vulkan-verlag.de<br />
Layout und Satz<br />
Dipl.-Des. Nilofar Mokhtarzada, Vulkan-Verlag GmbH<br />
E-Mail: n.mokhtarzada@vulkan-verlag.de<br />
Druck<br />
Druckerei Chmielorz, Ostr<strong>in</strong>g 13,<br />
65205 Wiesbaden-Nordenstadt<br />
Bezugsbed<strong>in</strong>gungen<br />
<strong>3R</strong> ersche<strong>in</strong>t monatlich mit Doppelausgaben im Januar/Februar,<br />
März/April und August/September · Bezugspreise: Abonnement<br />
(Deutschland): € 275,- + € 24,- Versand; Abonnement (Ausland):<br />
€ 275,- + € 28 Versand; E<strong>in</strong>zelheft (Deutschland): € 39,- + € 3,-<br />
Versand; E<strong>in</strong>zelheft (Ausland): € 39,- + € 3,50 Versand; E<strong>in</strong>zelheft<br />
als ePaper (PDF): € 39,-; Studenten: 50 % Ermäßigung auf<br />
den Heftbezugspreis gegen Nachweis · Die Preise enthalten bei<br />
Lieferung <strong>in</strong> EU-Staaten die Mehrwertsteuer, für alle übrigen<br />
Länder s<strong>in</strong>d es Nettopreise.<br />
Bestellungen s<strong>in</strong>d jederzeit über den Leserservice oder jede<br />
Buchhandlung möglich. Die Kündigungsfrist für Abonnementaufträge<br />
beträgt 8 Wochen zum Bezugsjahresende.<br />
Die Zeitschrift und alle <strong>in</strong> ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen<br />
s<strong>in</strong>d urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb<br />
der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung<br />
des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt <strong>in</strong>sbesondere<br />
für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen<br />
und die E<strong>in</strong>speicherung und Bearbeitung <strong>in</strong> elektronischen Systemen.<br />
Auch die Rechte der Wiedergabe durch Vortrag, Funkund<br />
Fernsehsendung, im Magnettonverfahren oder ähnlichem<br />
Wege bleiben vorbehalten.<br />
Jede im Bereich e<strong>in</strong>es gewerblichen Unternehmens hergestellte<br />
oder benutzte Kopie dient gewerblichen Zwecken gem. § 54 (2)<br />
UrhG und verpflichtet zur Gebührenzahlung an die VG WORT,<br />
Abteilung Wissenschaft, Goethestraße 49, 80336 München, von<br />
der die e<strong>in</strong>zelnen Zahlungsmodalitäten zu erfragen s<strong>in</strong>d.<br />
ISSN 2191-9798<br />
Informationsgeme<strong>in</strong>schaft zur Feststellung<br />
der Verbreitung von Werbeträgern<br />
Organschaften<br />
Fachbereich Rohrleitungen im Fachverband Dampfkessel-, Behälterund<br />
Rohrleitungsbau e.V. (FDBR), Düsseldorf · Fachverband Kathodischer<br />
Korrosionsschutz e.V., Essl<strong>in</strong>gen · Kunststoffrohrverband e.V.,<br />
Köln · Rohrleitungsbauverband e.V., Köln · Rohrleitungssanierungsverband<br />
e.V., Essen · Verband der Deutschen Hersteller von Gasdruck-Regelgeräten,<br />
Gasmeß- und Gasregelanlagen e.V., Köln<br />
Herausgeber<br />
H. Fastje, EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg (Federführender Herausgeber)<br />
· Dr.-Ing. M. K. Gräf, Vorsitzender der Geschäftsführung<br />
der Europipe GmbH, Mülheim · Dipl.-Ing. R.-H. Klaer, Bayer AG, Krefeld,<br />
Vorsitzender des Fachausschusses „Rohrleitungstechnik“ der VDI-<br />
Gesellschaft Verfahrenstechnik und Chemie-Ingenieurwesen (GVC)<br />
Dipl.-Volksw. H. Zech, Geschäftsführer des Rohrleitungssanierungsverbandes<br />
e.V., L<strong>in</strong>gen (Ems)<br />
Schriftleiter<br />
Dipl.-Ing. M. Buschmann, Rohrleitungsbauverband e.V. (rbv), Köln<br />
Rechtsanwalt C. Fürst, Erdgas Münster GmbH, Münster · Dipl.‐Ing.<br />
Th. Grage, Institutsleiter des Fernwärme-Forschungs<strong>in</strong>stituts, Hemm<strong>in</strong>gen<br />
Dr.-Ing. A. Hilgenstock, E.ON New Build & Technology GmbH, Gelsenkirchen<br />
(Gastechnologie und Handelsunterstützung) Dipl.-Ing. D. Homann,<br />
IKT Institut für Unterirdische Infrastruktur, Gelsenkirchen · Dipl.‐Ing.<br />
N. Hülsdau, Vulkan-Verlag, Essen · Dipl.-Ing. T. Laier, Westnetz,<br />
Dortmund · Dipl.-Ing. J. W. Mußmann, FDBR e.V., Düsseldorf<br />
Dr.-Ing. O. Reepmeyer, Europipe GmbH, Mülheim · Dr. H.-C. Sorge,<br />
IWW Rhe<strong>in</strong>isch-Westfälisches Institut für Wasser, Biebesheim · Dr. J.<br />
Wüst, SKZ - TeConA GmbH, Würzburg<br />
Beirat<br />
Dr.-Ing. W. Berger, Direktor des Forschungs<strong>in</strong>stitutes für Tief-und<br />
Rohrleitungsbau e.V., Weimar · Dr.-Ing. B. Bosseler, Wissenschaftlicher<br />
Leiter des IKT – Institut für Unterirdische Infra struktur, Gelsenkirchen<br />
· Dipl.-Ing. D. Bückemeyer, Vorstand der Stadtwerke Essen AG<br />
W. Burchard, Geschäftsführer des Fachverbands Armaturen im VD-<br />
MA, Frankfurt · Bauassessor Dipl.‐Ing. K.-H. Flick, Fachverband Ste<strong>in</strong>zeug<strong>in</strong>dustrie<br />
e.V., Köln · Prof. Dr.-Ing. W. Firk, Vorstand des Wasserverbandes<br />
Eifel-Rur, Düren · Dipl.-Wirt. D. Hesselmann, Geschäftsführer<br />
des Rohrleitungsbauverbandes e.V., Köln · Dipl.-Ing. H.-J. Huhn,<br />
BASF AG, Ludwigshafen · Dipl.-Ing. B. Lässer, ILF Beratende Ingenieure<br />
GmbH, München · Dr.-Ing. W. L<strong>in</strong>dner, Vorstand des Erftverbandes,<br />
Bergheim · Dr. rer. pol. E. Löckenhoff, Geschäftsführer des Kunststoffrohrverbands<br />
e.V., Bonn · Dr.-Ing. R. Maaß, Mitglied des Vorstandes,<br />
FDBR Fachverband Dampfkessel-, Behälter- und Rohrleitungsbau<br />
e.V., Düsseldorf · Dipl.-Ing. R. Middelhauve, TÜV NORD Systems<br />
GmbH & Co. KG, Essen · Dipl.-Ing. R. Moisa, Geschäftsführer der Fachgeme<strong>in</strong>schaft<br />
Guss-Rohrsysteme e.V., Griesheim · Dipl.‐Berg<strong>in</strong>g.<br />
H. W. Richter, GAWACON, Essen · Dipl.-Ing. T. Schamer, Geschäftsführer<br />
der ARKIL INPIPE GmbH, Bottrop · Prof. Dipl.-Ing. Th. Wegener,<br />
Institut für Rohrleitungsbau an der Fachhochschule Oldenburg<br />
Prof. Dr.-Ing. B. Wielage, Lehrstuhl für Verbundwerkstoffe, Technische<br />
Universität Chemnitz-Zwickau · Dipl.-Ing. J. W<strong>in</strong>kels, Technischer<br />
Geschäftsführer der Salzgitter Mannesmann L<strong>in</strong>e Pipe GmbH, Siegen<br />
und<br />
s<strong>in</strong>d Unternehmen der
KORROSIONSSCHUTZ<br />
8. Praxistag<br />
Korrosionsschutz<br />
SAVE THE DATE<br />
25. Juni 2014<br />
VELTINS-Arena, Gelsenkirchen<br />
Veranstalter: