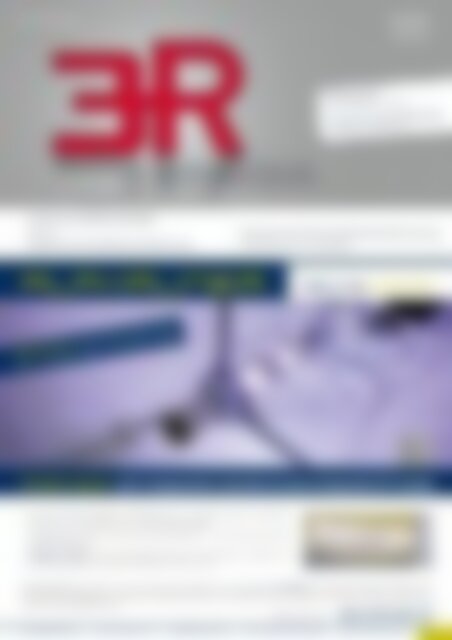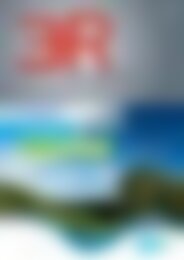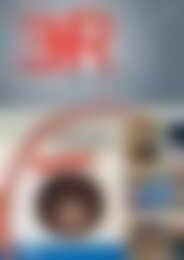3R Inspektion & Grundstücksentwässerung (Vorschau)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
03 | 2013<br />
ISSN 2191-9798<br />
RO-KA-TECH<br />
21.-23.03.2013 in Kassel<br />
Deutscher Schlauchlinertag<br />
11.04.2013 in Würzburg<br />
Fachzeitschrift für sichere und<br />
effiziente Rohrleitungssysteme<br />
LESEN SIE IN DIESER AUSGABE:<br />
Special<br />
<strong>Inspektion</strong> & <strong>Grundstücksentwässerung</strong><br />
Interview mit Christian Noll & Benedikt Stentrup<br />
„Wir gehen gerne neue Wege“<br />
Besuchen Sie uns auf der RO-KA-TECH 2013<br />
(21. – 23. März) Halle 12, Stand Nr. B06<br />
Perfektes System: Licht-transparentes Linermaterial und leistungstarke UV-Technik<br />
:: Liner-Durchmesser DN150 – DN1300 (Kreis-, Ei-, Sonderprofile) mit einzigartig<br />
definierter Verschleißschicht für höchste Beständigkeit<br />
:: Aushärtung mit neuer innovativer UV-Aushärtetechnik – mit kontrolliert stabiler<br />
UV-Strahlerleistung<br />
:: Alphaliner 1500 mit UV-Licht-transparenterem Linermaterial für schnelle und<br />
zuverlässige Aushärtung hoher Wanddicken über 10 mm<br />
RELINEEUROPE verwendet mit seinen Alphaliner-Anwendern das einzigartige RE-TQM-Total Quality Management-System als<br />
ganzheitliches QM-System mit definierten Qualitätsrichtlinien vom Rohstoff bis zum fertigen Linereinbau, um das hohe Qualitätsniveau<br />
stets zu gewährleisten.<br />
Mehr über uns ::<br />
RELINEEUROPE AG :: Große Ahlmühle 31 :: D-76865 Rohrbach :: Fon +49 63 49 93 934-0 :: info@relineeurope.com
7. Praxistag<br />
Korrosionsschutz<br />
am 19. Juni 2013 in Gelsenkirchen<br />
PROGRAMM<br />
Moderation: U. Bette, Technische Akademie Wuppertal<br />
• Beurteilung der Wechselstromkorrosionsgefährdung von<br />
Rohrleitungen anhand von Probeblechen: Relevante<br />
Einflussgrößen für die Bewertung der ermittelten<br />
Korrosionsgeschwindigkeit<br />
Dr. M. Büchler, SGK Schweizerische Gesellschaft für Korrosionsschutz, Zürich<br />
• Untersuchungen von verschiedenen Flüssigböden zur<br />
Verfüllung von Rohrgräben hinsichtlich ihres Einflusses<br />
auf den kathodischen Außenkorrosionsschutz von<br />
Stahlrohrleitungen<br />
n.n, TFH Bochum, Bochum; Ulrich Bette, Technische Akademie Wuppertal,<br />
Wuppertal<br />
• Smart KKS:<br />
Von der Fernüberwachung zur Online-Überwachung<br />
M. Müller, RBS Wave GmbH, Stuttgart<br />
• Fernüberwachung des KKS –<br />
Ein wesentlicher Beitrag zur Sicherheit von Rohrleitungen<br />
J. Maurmann, Maurmann GmbH, Sprockhövel<br />
• Umsetzung eines konsequenten LKS Konzeptes am<br />
Beispiel des Erdgaskavernenspeichers Jemgum<br />
n.n<br />
• Materialvielfalt und Anwendungsbereiche im passiven<br />
Korrosionsschutz – was sollte die zukünftige Ausbildung<br />
nach GW 15 leisten?<br />
H. Fuchs, RBV GmbH, Köln<br />
• Qualitätssicherung und Zustandserfassung<br />
in der Rohrleitungstrasse<br />
Dr. H.-J. Kocks, Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH, Siegen<br />
• Intelligente Molchungen aus KKS-Sicht<br />
Dr. M. Brecht, Open Grid Europe GmbH, Essen<br />
• Möglichkeiten bei der Ortung von erdverlegten<br />
Versorgungsleitungen über die Magnetfeldortung<br />
R. Klar, SebaKMT, Baunach<br />
Wann WAnn und Und Wo? WO?<br />
Veranstalter:<br />
<strong>3R</strong>, fkks<br />
Termin: Mittwoch, 19.06.2013,<br />
9:00 Uhr – 17:15 Uhr<br />
Ort:<br />
Zielgruppe:<br />
Veranstalter VERAnSTALTER<br />
Veltinsarena, Gelsenkirchen,<br />
www.veltins-arena.de<br />
Mitarbeiter von Stadtwerken,<br />
Energieversorgungs- und<br />
Korrosionsschutzfachunternehmen<br />
Teilnahmegebühr * :<br />
<strong>3R</strong>-Abonnenten<br />
und fkks-Mitglieder: 380,- €<br />
Nichtabonnenten: 410,- €<br />
Bei weiteren Anmeldungen aus einem Unternehmen wird<br />
ein Rabatt von 10 % auf den jeweiligen Preis gewährt.<br />
Im Preis enthalten sind die Tagungsunterlagen sowie<br />
das Catering (2 x Kaffee, 1 x Mittagessen).<br />
* Nach Eingang Ihrer schriftlichen Anmeldung (auch per Internet möglich) sind<br />
Sie als Teilnehmer registriert und erhalten eine schriftliche Bestätigung sowie<br />
die Rechnung, die vor Veranstaltungsbeginn zu begleichen ist. Bei Absagen<br />
nach dem 7. Juni 2013 oder Nichterscheinen wird ein Betrag von 100,- €<br />
für den Verwaltungsaufwand in Rechnung gestellt. Die Preise verstehen sich<br />
zzgl. MwSt.<br />
Mehr Information und Online-Anmeldung unter<br />
www.praxistag-korrosionsschutz.de<br />
Fax-Anmeldung: +49 201 82002-40 oder Online-Anmeldung: www.praxistag-korrosionsschutz.de<br />
Ich bin <strong>3R</strong>-Abonnent<br />
Ich bin fkks-Mitglied<br />
Ich bin Nichtabonnent/kein fkks-Mitglied<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Firma/Institution<br />
E-Mail<br />
Straße/Postfach<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Nummer<br />
✘<br />
Ort, Datum, Unterschrift
EDITORIAL<br />
NRW-Landtag verabschiedet<br />
Landeswassergesetz<br />
Anfang Januar dieses Jahres fand eine öffentliche Anhörung<br />
zur Änderung des § 61a LWG im NRW-Landtag statt. Ziel<br />
war es, das festgefahrene Thema in einer sachlichen und<br />
konstruktiven Diskussion wieder in Bewegung zu bringen<br />
- vergeblich: Die Debatte wurde ohne Annäherung der<br />
konträren Standpunkte beendet. Am 27.02.2013 hat der<br />
NRW-Landtag nun in der 2. Lesung zum Landeswassergesetz<br />
das Gesetz mit den Stimmen von SPD und Grünen<br />
verabschiedet. Mit dem Gesetz will man den Gewässerschutz<br />
gewährleisten und dem Vorsorge- und Verursacherprinzip<br />
Rechnung tragen. Die Prüfung des Zustands sowie der<br />
Funktionsfähigkeit privater Abwasseranlagen wird damit<br />
gesetzlich geregelt. Die Einzelheiten sollen durch eine<br />
Rechtsverordnung festgelegt werden. Die Gemeinden<br />
erhalten eine Ermächtigung für satzungsrechtliche<br />
Regelungen und damit auch die Möglichkeit, die Kontrolle<br />
und ggf. Sanierung öffentlicher Kanalisationen mit der<br />
privater Abwasserleitungen zu verzahnen.<br />
Heiß diskutiert wird die Verabschiedung des NRW-<br />
Landeswassergesetzes sicher auch auf dem diesjährigen<br />
Forum für die Kanalbranche: der RO-KA-TECH 2013.<br />
Die Internationale Fachmesse für Rohr-, Kanal- und<br />
Industrieservice findet vom 21. bis zum 23. März in Kassel<br />
statt. Rund 230 Aussteller haben sich in diesem Jahr<br />
angemeldet, damit setzt sich der Trend dieser Veranstaltung<br />
fort: andauerndes Wachstum.<br />
In der Ausstellung werden die aktuellsten Techniken<br />
und Verfahren zur Reinigung, <strong>Inspektion</strong> und Sanierung<br />
von Kanalisationssystemen gezeigt. Schwerpunkte<br />
sind u.a. die verschiedenen Kamerasysteme zur<br />
Untersuchung von Abwassernetzen - von der<br />
<strong>Inspektion</strong> der <strong>Grundstücksentwässerung</strong>sleitungen<br />
bis hin zur Untersuchung von Hauptkanälen - sowie<br />
die unterschiedlichen Software- und Ortungssysteme,<br />
die zur Unterstützung der <strong>Inspektion</strong>saufgaben und der<br />
exakten, lagegenauen Messung des Leitungsverlaufs<br />
eingesetzt werden können. In diesem Zusammenhang<br />
sei auf den Beitrag „Ein neues Messsystem zur<br />
Verlaufsbestimmung von gekrümmten Haltungen“ auf<br />
Seite 42 hingewiesen.<br />
Die Schlauchliningtechnik zur Sanierung von<br />
Entwässerungskanälen hat sich bekanntermaßen zum<br />
meistgenutzten Renovierungsverfahren in Deutschland<br />
entwickelt. Dazu beigetragen haben die Anwendungsbreite<br />
der am Markt eingeführten Verfahrensvarianten und vor<br />
allem die erfolgreichen Bemühungen zur Standardisierung<br />
und Qualitätssicherung, dank derer die Herstellungs- und<br />
Anwendungssicherheit kontinuierlich gesteigert werden<br />
konnten.<br />
Technische Weiterentwicklungen werden sowohl auf<br />
der RO-KA-TECH als auch auf dem am 11. April 2013 in<br />
Würzburg stattfindenden 11. Deutschen Schlauchlinertag<br />
vorgestellt und diskutiert. Neben den aktuellen technischen<br />
Neuheiten und der Qualitätssicherung wird es auch um<br />
die Fortschreibung des Regelwerkes gehen. So soll u.a.<br />
das DWA-Arbeitsblatt A 143-2 zur Linerdimensionierung<br />
in diesem Jahr als Weißdruck erscheinen. Über die<br />
wesentlichen Änderungen des ehemaligen ATV-Merkblattes<br />
M 127-2, das im November 2012 in 2. Auflage als Gelbdruck<br />
erschienen ist, informieren Prof. Falter und Prof. Wagner<br />
im Beitrag „Linerdimensionierung nach DWA-A 143-2“ auf<br />
Seite 26. Ein weiteres, akutes Thema bei der Renovation<br />
von Kanälen und Abwasserleitungen ist die Anbindung<br />
von Linern an Schächte. Über erste Erfahrungen mit zwei<br />
Manschettensystemen berichtet Markus Vogel ab Seite 60.<br />
Nico Hülsdau<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
03 / 2013 01
INHALT<br />
NACHRICHTEN<br />
06<br />
20<br />
Subtech liefert ein Sanierungsfahrzeug in die Niederlande<br />
RELINEEUROPE-Geschäftsführer Benedikt Stentrup (li). und<br />
Vorstand Christian Noll im Interview<br />
INDUSTRIE & WIRTSCHAFT<br />
05 RBS wave feiert 50. Jubiläum<br />
05 IBAK unterstützt Wassernetzausbau in ugandischer Kleinstadt<br />
06 NORMA erwirbt Vertriebsgeschäft von Davydick in Australien<br />
06 Subtech liefert Sanierungsfahrzeug in die Niederlande<br />
EDITORIAL<br />
01 NRW-Landtag<br />
verabschiedet<br />
Landeswassergesetz<br />
Nico Hülsdau<br />
INTERVIEW<br />
20 „Wir gehen gern<br />
neue Wege“<br />
mit Christian Noll und<br />
Benedikt Stentrup<br />
von RELINEEUROPE<br />
PERSONALIEN<br />
07 „Kunststoff-Profi“ Jungmann feiert Jubiläum<br />
07 BKP Berolina Polyester erweitert Geschäftsführung<br />
08 Schöbitz zum neuen FEUGRES-Präsidenten gewählt<br />
08 Neuer DVGW-Präsident heißt Dr. Roth<br />
VERBÄNDE<br />
09 SKZ erhält Bayerischen Mittelstandspreis<br />
10 IKT zeichnet engagierte Projektleiter mit Goldenem Kanaldeckel aus<br />
12 Gütesicherung Kanalbau bei HAMBURG WASSER hoch im Kurs<br />
VERANSTALTUNGEN<br />
14 Deutscher Schlauchlinertag 2013 am 11. April<br />
16 Trends rund um PE- und PP-Kunststoffrohre<br />
16 26. Mülheimer Wassertechnisches Seminar<br />
17 Seminar zur Sicherung von Baustellen an Straßen<br />
18 Neuer Sachkundelehrgang zum Berstlining-Verfahren<br />
18 Weseler Wasser Wissen mit 150 Teilnehmern<br />
02 03 / 2013
78<br />
Produktvorschau zur RO-KA-TECH: resinnovation präsentiert<br />
Harz8 zum dauerelastischen Abdichten von Schachtdeckeln<br />
Verantwortung<br />
übernehmen ...<br />
PRODUKTE & VERFAHREN<br />
75 Neueste Bohrtechnik auf der Bauma<br />
76 Flexibles Schiebeinspektionssystem<br />
77 Kanalrohrinspektionsanlage mit Full-HD<br />
Technologie<br />
78 Harz8 bindet Schachtdeckelrahmen<br />
dauerelastisch ein<br />
79 Sanierung vom Hauptkanal zum Gebäude<br />
79 DIBT erteilt Zulassung für Konudur Robopox 10<br />
80 Erstellung von Hausanschlüssen und Straßenabläufen<br />
RECHT & REGELWERK<br />
26 Linerdimensionierung nach DWA-A 143-2 –<br />
Gelbdruck der 2. Auflage des Merkblattes<br />
ATV-M 127-2<br />
von Prof. Dr.-Ing. Bernhard Falter, Prof. Dr.-Ing. Volker Wagner<br />
36 Zulassungsverfahren für Errichtung und<br />
Betrieb von Rohrfernleitungen – Rohrfernleitungen<br />
i.S.d. Ziffern 19.3 bis 19.8 der<br />
Anlage 1 des UVPG<br />
von Dr. Bettina Keienburg, Dr. Michael Neupert<br />
40 Aktuelles zum DWA-Regelwerk<br />
... Gütesicherung Kanalbau<br />
fordern<br />
Ihr Partner bei<br />
der Bewertung der<br />
■ Fachkunde<br />
■ technischen<br />
Leistungsfähigkeit<br />
■ technischen<br />
Zuverlässigkeit<br />
der ausführenden<br />
Unternehmen<br />
neutral – fair –<br />
zuverlässig<br />
Gütesicherung Kanalbau<br />
steht für eine objektive<br />
Bewertung nach einheitlichem<br />
Maßstab<br />
Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961<br />
03 / 2013 03
INHALT<br />
HAUPTTHEMEN<br />
26 53<br />
Messung der Gelenkringverformung bei einem nicht<br />
begehbaren Sammler mit zwei angepassten Kreisen<br />
Unerlaubter Dränageschluss am öffentlichen Kanal<br />
SPECIAL INSPEKTION & GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNG<br />
42 Ein neues Messsystem zur Verlaufsbestimmung von gekrümmten Haltungen<br />
von Dipl.-Ing. Frank Hümmer, Dr.-Ing. Admire Kandawasvika, Prof. Dr.-Ing. habil. Hans Heister<br />
47 Abwasserinhaltsstoffe perkolieren in den Untergrund<br />
von Prof. Dr. -Ing. Johannes Weinig<br />
48 Sind private Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Straßenraum<br />
eine tickende Zeitbombe?<br />
von Dipl.-Ing. Manfred Müller<br />
53 Umgang mit Dränagewasser von privaten Grundstücken<br />
von Dipl.-Ing. Amely Dyrbusch, Dipl.-Biol. Dagmar Carina Schaaf, RBD Dipl.-Ing. Bert Schumacher<br />
SERVICES<br />
19 Messen | Tagungen<br />
81 Marktübersicht<br />
90 Inserentenverzeichnis<br />
92 Buchbesprechung<br />
93 Seminare<br />
97 Impressum<br />
ABWASSERENTSORGUNG<br />
60 Anbindung von Schlauchlinern an Schächte –<br />
Erste Erfahrungen mit Manschetten<br />
von Dipl.-Ing. (FH) Markus Vogel<br />
64 Gemeinde Ense stellt große Anforderungen an Synthesefaserliner<br />
67 105 t-Stahlbetonschachtbauwerk für Industrie- und Gewerbegebiet in Münster<br />
68 Stauraumkanal aus GFK-Rohren für das Technische Zentrum Heiterblick<br />
70 Entflechtung der Leerer Mischwasserkanalisation<br />
72 PP-Vollwandwandrohre sichern Entwässerung im Simplontunnel<br />
04 1-2 | 2013
INDUSTRIE RECHT && WIRTSCHAFT REGELWERK NACHRICHTEN<br />
FACHBERICHT<br />
RBS wave feiert 50. Jubiläum<br />
Ihr Ursprung reicht bis in die 1960er Jahre – nun tritt die<br />
RBS wave als eines der führenden Ingenieurunternehmen<br />
für die Versorgungswirtschaft in Baden-Württemberg dieses<br />
Jahr ihren 50. Geburtstag an. Mit neuer Unternehmensstruktur<br />
geht das Unternehmen den eingeschlagenen Weg<br />
der Markt- und Kundenorientierung konsequent weiter.<br />
Innerhalb ihrer Kernkompetenzen Energie, Wasser und Infrastruktur<br />
bietet die RBS wave Stadtwerken, Versorgern,<br />
Kommunen und der Industrie ein breites Spektrum an technischen<br />
Kompetenzen an. Ganzheitliche Konzepte zur Optimierung<br />
von Versorgungsnetzen und Energieeffizienz sowie<br />
die Planung von Wasseranlagen und dezentralen Energieund<br />
Wärmeerzeugungsanlagen bilden die Schwerpunkte.<br />
Die neue Unternehmensstruktur mit ihren drei Bereichen<br />
Consulting, Engineering und Operations ist noch stärker auf<br />
den Kunden ausgerichtet. Mit einer spezifischen Kundenorientierung<br />
und Ihrer starken Position in Baden-Württemberg,<br />
strebt die RBS wave weiteres Wachstum im nationalen<br />
und internationalen Markt an.<br />
Feierliche Urkundenübergabe anlässlich des RBS wave-Firmenjubiläums<br />
durch die IHK. Die RBS wave-Geschäftsführer Frank Tarnowski (li.) und<br />
Erwin Kober rahmen Gerlinde Kohlrieser (IHK) ein<br />
IBAK unterstützt Wassernetzausbau in<br />
ugandischer Kleinstadt<br />
Ende 2012 unterstützte die Kieler Firma IBAK mit einer<br />
Spende den Ausbau des Wassernetzes in der ugandischen<br />
Kleinstadt Yumbe. Mit dieser Spende wurde die die Einrichtung<br />
von fünf öffentlichen Zapfstellen (Public Standpipes<br />
- PSP) ermöglicht, durch die bis zu 1.000 Menschen Zugang<br />
zu sauberem Wasser erhalten. Alle fünf Wasserstellen wurden<br />
Ende des Jahres 2012 fertiggestellt und sind bereits<br />
in Betrieb. Insbesondere arme Haushalte, die in einfachen<br />
Hütten zur Miete leben und sich keinen eigenen Wasseranschluss<br />
leisten können, profitieren von diesen öffentlichen<br />
PSPs. Es ist für sie leichter, täglich einen kleinen Betrag für<br />
sauberes Trinkwasser zu bezahlen, als bis zum Monatsende<br />
einen größeren Betrag anzusparen.<br />
Yumbe liegt in der West-Nil Region im äußersten Nordwesten<br />
Ugandas, nahe der südsudanesischen Grenze. In dieser Region<br />
fehlen Infrastrukturen, wie etwa Straßen, Schulen, Gesundheitszentren<br />
sowie Wasser- und Sanitärversorgungssysteme.<br />
Mit rund 25.000 Einwohnern ist Yumbe eine typische<br />
ugandische Kleinstadt. Ein Großteil der Bevölkerung lebt in<br />
traditionellen Rundhütten ohne Wasseranschlüsse oder Sanitäranlagen.<br />
Wasser wird von Frauen und Kindern in Kanistern<br />
transportiert – die gelben ‚jerry cans‘ prägen das Bild der<br />
Wohngebiete. Yumbe verfügt über ein kleines Wasserleitungsnetz<br />
(rund 9 km), das das Stadtzentrum sowie einige<br />
Wohngebiete versorgt. Die Mehrzahl der Einwohner bezieht<br />
ihr Leitungswasser über Hofanschlüsse, die meist gemeinsam<br />
von mehreren Haushalten genutzt werden. Derzeit wird mit<br />
rund 360 Anschlüssen etwa ein Viertel der Bevölkerung mit<br />
Leitungswasser versorgt. Außerhalb der Reichweite des Wasserversorgungsnetzes<br />
und vor allem in den ärmeren Stadtgebieten<br />
stellen mit Handpumpen betriebene Tiefbrunnen<br />
die wesentlichen Versorgungsquellen dar. Bei zunehmender<br />
Verstädterung erhöht sich jedoch das Risiko der Verunreinigung,<br />
insbesondere durch Latrinen. Andere Wasserquellen,<br />
wie zum Beispiel ungefasste Quellen, stellen ein noch höheres<br />
Gesundheitsrisiko für arme Haushalte dar.<br />
Das Projekt für die Errichtung von öffentlichen Wasserstellen<br />
wird von Anna Kristina Mayr und Torben Gerlach von der<br />
Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit<br />
(GIZ) GmbH betreut.<br />
Die offizielle Übergabe aller fünf Wasserstellen am 19. Dezember 2012<br />
Foto: © Torben Gerlach<br />
03 / 2013 05
FACHBERICHT NACHRICHTEN RECHT INDUSTRIE & REGELWERK & WIRTSCHAFT<br />
NORMA erwirbt Vertriebsgeschäft von Davydick in<br />
Australien<br />
Die NORMA Group hat am 10. Januar den Kaufvertrag zur<br />
Übernahme des Vertriebsgeschäfts von Davydick & Co.<br />
Pty Limited („Davydick“) in Australien unterzeichnet. Über<br />
die Details der Transaktion wurde zwischen den Parteien<br />
Stillschweigen vereinbart. Davydick mit Sitz in Goulburn,<br />
etwa 150 km südwestlich von Sydney, vertreibt seit über 20<br />
Jahren unterschiedliche Elemente zum Transport von Wasser<br />
in Bewässerungsanlagen. Das Unternehmen beliefert in<br />
Australien über 700 Kunden mit Verbindungsprodukten für<br />
Bewässerungssysteme sowie Ventilen und Pumpen unter<br />
der Marke PUMPMASTER insbesondere in der Agrarwirtschaft<br />
sowie den Bereichen Sanitär und Haushaltswaren.<br />
Davydick unterhält Niederlassungen in Melbourne, Adelaide<br />
und Brisbane. Im abgelaufenen Geschäftsjahr verzeichnete<br />
das Unternehmen einen Umsatz von rund vier Millionen<br />
Euro. Die Übernahme von Davydick ist für die NORMA<br />
Group ein bedeutender Schritt zum Ausbau ihrer Geschäftsaktivitäten<br />
im Bereich Wassermanagement. Damit erweitert<br />
das Unternehmen sein Infrastruktur-Produktangebot und<br />
das Vertriebsnetzwerk vor allem in den Bereichen Agrarwirtschaft<br />
und Bewässerung. Die NORMA Group ist bereits seit<br />
1992 in Australien aktiv. „Wir freuen uns mit dem Erwerb<br />
der Vertriebsaktivitäten von Davydick unser bestehendes<br />
Distributionsnetzwerk in Australien deutlich zu stärken“,<br />
sagt Werner Deggim, Vorstandsvorsitzender der NORMA<br />
Group.<br />
Subtech liefert Sanierungsfahrzeug in die Niederlande<br />
Der niederländische Dienstleister Hamers Leidingtechniek B.V.<br />
setzt bei der grabenlosen Kanalsanierung zukünftig auf die<br />
Janssen-Process-Verfahren. Die besondere Technik wurde<br />
von der SUBTECH GmbH in ein Spezialfahrzeug integriert,<br />
dessen Sanierungsfunktionen passgenau auf den hohen<br />
Grundwasserspiegel in den Niederlanden abgestimmt sind.<br />
„Unser Sanierungsfahrzeug für Hamers Leidingtechniek<br />
B.V. haben wir bis ins letzte Detail maßgeschneidert auf die<br />
Anforderungen des Kunden“, erklärt SUBTECH-Geschäftsführer<br />
Michael Holtermann. „Das ist auch notwendig, denn<br />
in den Niederlanden hat man bei der Kanalsanierung mit<br />
anderen Unwägbarkeiten zu kämpfen als in Ländern, die<br />
deutlich über dem Meeresspiegel liegen.“ Durch den hohen<br />
Grundwasserspiegel gehen Schäden an niederländischen<br />
Kanälen fast immer mit Infiltrationen einher. Auch bei<br />
üblichen Anschluss- oder Sanierungsarbeiten – etwa beim<br />
Linereinbau – tritt häufig Grundwasser ein. Das führt zu<br />
Folgeproblemen, wie Holtermann beschreibt: „Durch Infiltrationen<br />
kommt es zu entsprechenden Abtragungen um<br />
das Rohr herum. Die entstehenden Hohlräume begünstigen<br />
dann die Entwicklung von Straßenabsackungen.“<br />
Eine weitere Folge starken Grundwassereintritts bei der<br />
Kanalsanierung ist ein vermehrter Sandeintrag. Zusätzlich<br />
wird die Sanierung des niederländischen Kanalsystems häufig<br />
durch die sehr kleinen Schächte erschwert. Mit dem<br />
neuen Fahrzeug ist das aber kein Problem mehr.<br />
„Der große Vorteil der Verfahren von Janßen ist die Möglichkeit,<br />
das Rohr von innen auch bei starker Infiltration abdichten<br />
zu können und zugleich die Hohlräume hinter dem Rohr dauerhaft<br />
zu verfüllen“, so Holtermann. „Möglich wird das durch<br />
ein spezielles Zweikomponentenharz, das an den undichten<br />
Schadstellen mit einem Packer von innen nach außen injiziert<br />
wird und binnen kurzer Zeit aushärtet.“ Die Technik ermöglicht<br />
zudem eine Verfüllung des Ringraums zwischen Liner<br />
und Altrohr.<br />
Das neue Sanierungsfahrzeug verfügt über eine Farb-, Dreh-,<br />
und Schwenkkopfkamera Visionmaster 200 und den Fräsroboter<br />
Titan 250 mit Eiprofillafette und einer Frästiefe von bis zu<br />
60 cm in den Hausanschluss. Die Ausstattung des Fahrzeugs<br />
bietet zudem drei patentierte Janssen-Process-Sanierungsverfahren<br />
vom Niederrhein: die Riss- und Scherbensanierung,<br />
Stutzensanierung sowie Schachtsanierung mit Lanzeninjektion.<br />
Bedienraum eines<br />
Sanierungsfahrzeugs<br />
06 03 / 2013
„Kunststoff-Profi“ Jungmann<br />
feiert Jubiläum<br />
Im Dezember des vergangenen Jahres feierte<br />
Dieter Jungmann sein 25-jähriges Betriebsjubiläum<br />
bei der Funke Kunststoffe GmbH<br />
und nahm die Glückwünsche der Kollegen<br />
und von den Geschäftsführern Norbert und<br />
Hans-Günter Funke entgegen. In den vielen<br />
Jahren seiner Betriebszugehörigkeit hat der<br />
Dieter Jungmann<br />
Jubilar die Entwicklung des Unternehmens<br />
hautnah begleitet und mit seinem Engagement und fachlichen Können<br />
einen wichtigen Beitrag zum Erfolg des traditionsreichen Familienunternehmens<br />
geleistet. Sowohl als junger Vertriebsmitarbeiter<br />
als auch als Leiter des Geschäftsbereichs Tiefbau trug Jungmann<br />
wesentlich dazu bei, immer mehr ausführende Unternehmen und<br />
öffentliche Auftraggeber von den Vorzügen der Produkte aus dem<br />
Werkstoff PVC-U zu überzeugen.<br />
Die Begeisterung für den Tief- und Kanalbau, speziell für Produkte<br />
aus Kunststoff, haben Jungmanns beruflichen Werdegang geprägt.<br />
1987 als einer von zwei Außendienstmitarbeitern des noch jungen<br />
Familienunternehmens für die Regionen NRW und Niedersachsen<br />
verantwortlich, bekam der Vertriebsprofi nicht nur Jahr für Jahr<br />
neue Kollegen zur Seite gestellt, sondern auch zunehmend mehr<br />
Verantwortung im Unternehmen übertragen. Als Vertriebsleiter<br />
Außendienst machte Jungmann mit seiner Mannschaft in den 1990er<br />
Jahren die Vorteile von Rohren und Formteilen aus Kunststoff in<br />
der Branche von Kiel bis München bekannt. Nach der erfolgreichen<br />
Umstrukturierung des Unternehmens, bei dem die Funke Kunststoffe<br />
in neue Geschäftsbereiche aufgeteilt wurde, übernahm Jungmann<br />
die neu geschaffene Position des Leiters Geschäftsbereich Tiefbau.<br />
In dieser Funktion zeichnet er heute für den Vertrieb und das Marketing<br />
sowie die Entwicklung der Funke-Produktpalette von der<br />
Dachentwässerung bis zum Hauptsammler verantwortlich.<br />
BKP Berolina Polyester<br />
erweitert Geschäftsführung<br />
Zur Unterstützung des erwarteten künftigen Wachstums in der<br />
Kanalsanierungstechnologie erweitert die BKP Berolina Polyester<br />
GmbH & Co. KG, Velten, ihre Geschäftsführung. Neben dem<br />
Mitgesellschafter und bisherigem Alleingeschäftsführer Dipl.-Ing.<br />
Ralf Odenwald (50) wurde Dipl.-Ing. (FH) Lars Quernheim (41),<br />
langjähriger Prokurist der Gesellschaft, am 1. Januar 2013 zum<br />
weiteren Geschäftsführer bestellt.<br />
Lars Quernheim übernimmt die Verantwortung für den weltweiten<br />
Vertrieb der Produkte der BKP. Ralf Odenwald konzentriert sich auf<br />
die Bereiche Produktion, Technik und Entwicklung.<br />
„Die BKP hat sich in den letzten Jahren sehr erfolgreich entwickelt.<br />
Für die kommenden Jahre ist weiteres Wachstum im In- und Ausland<br />
geplant. Mit der Doppelspitze in der Geschäftsführung soll die bisherige<br />
erfolgreiche Unternehmensentwicklung energisch vorangetrieben werden“,<br />
erklärt Stefan Greiffenberger, Vorstand der Greiffenberger AG.<br />
Dieter Jungmann<br />
Kanal-TV-<strong>Inspektion</strong><br />
leicht gemacht<br />
Kamera- und Sondenortungssystem<br />
für Jedermann<br />
vCam und vLocCam2<br />
<strong>Inspektion</strong>, Kontrolle und Überprüfung<br />
Einfachste Bedienung mit intuitivem<br />
Menu-Interface<br />
Akkubetrieb bis 6 Stunden<br />
Integrierte Ortungssonden (kompatibel<br />
mit allen gängigen Ortungsgeräten)<br />
Robuster Kamerakopf<br />
mit aufrechtem Bild<br />
www.sebakmt.com/cctv<br />
SebaKMT<br />
Dr.-Herbert-Iann-Str. 6<br />
96148 Baunach<br />
T +49 (0) 95 44 - 6 80<br />
F +49 (0) 95 44 - 22 73<br />
sales@sebakmt.com<br />
www.sebakmt.com<br />
03 / 2013 07
FACHBERICHT NACHRICHTEN RECHT PERSONALIEN & REGELWERK<br />
Schöbitz zum neuen FEUGRES-Präsidenten gewählt<br />
Gernot Schöbitz<br />
Im Rahmen der FEUGRES-Jahreshauptversammlung 2012<br />
am 26. November 2012 in Brüssel wurde Gernot Schöbitz,<br />
Geschäftsführer der Steinzeug-Keramo GmbH, ein<br />
Unternehmen der Wienerberger Gruppe, einstimmig für die<br />
nächsten zwei Jahre (2013 bis 2015) zum neuen Präsidenten<br />
gewählt. Nach Ablauf der planmäßigen Amtszeit seines Vorgängers<br />
Rudolf Harsch, Geschäftsführender Gesellschafter<br />
der Harsch-Gruppe, stand die Neuwahl auf der Agenda.<br />
Gernot Schöbitz zeichnet seit August 2009 als Geschäftsführer<br />
der Steinzeug-Keramo GmbH und ist mit den Aufgaben<br />
und Zielen der FEUGRES bestens vertraut. „Der Werkstoff<br />
Steinzeug ist mit den Prinzipien höchster Qualität<br />
und Nachhaltigkeit eng verknüpft. Es gilt, hierfür verstärkt<br />
Bewusstsein zu schaffen und die Position von Steinzeugrohrsystemen<br />
zu stärken.“, formuliert Schöbitz ein wichtiges<br />
Ziel für seine Amtszeit. „Darüber hinaus wird die FEUGRES<br />
im Verbund mit der europäischen keramischen Industrie<br />
einen Beitrag zur gemeinsamen Zielerreichung leisten. Die<br />
Roadmap 2050 der Cerame Unie ist hierzu ein wichtiger<br />
Schritt“, erklärt Schöbitz abschließend.<br />
FEUGRES, die Europäische Vereinigung der Steinzeugröhrenindustrie,<br />
fördert und unterstützt seit 1957 die Verwendung<br />
von Steinzeugrohrsystemen in der Abwasserentsorgung und<br />
schafft Bewusstsein für nachhaltige und zukunftsfähige<br />
Lösungen. Als Fachvereinigung der Hersteller hat sich die<br />
Vereinigung die Ziele gesteckt, keramische Systemlösungen<br />
mit ihren herausragenden Eigenschaften noch stärker im<br />
Markt zu positionieren und verstärkt das Augenmerk von<br />
Planern und Baubeteiligten auf einen umweltverträglichen<br />
und -freundlichen Rohrwerkstoff zu richten. Nicht zuletzt<br />
will FEUGRES im Sinne ihrer Mitglieder deutlich machen,<br />
dass mit der Verwendung von Steinzeugrohrsystemen in<br />
der Abwasserentsorgung über den gesamten Lebenszyklus<br />
eine finanzielle Entlastung für die Betreiber und somit<br />
abgabenzahlenden Nutzer einhergeht und aufgrund der<br />
Verwendung natürlicher, mineralischer Rohstoffe aus heimischen<br />
Lagerstätten ein hoher Beitrag zu einer nachhaltig<br />
intakten Umwelt geleistet wird.<br />
Die Vereinigung FEUGRES selbst ist Mitglied der Cerame-<br />
Unie, dem Europäischen Dachverband der keramischen<br />
Industrie, der acht Verbände/Vereinigungen der verschiedenen<br />
keramischen Sparten in Europa unter seinem Dach<br />
zusammenfasst und deren Interessen vertritt.<br />
Dr. Karl Roth<br />
Neuer DVGW-Präsident heißt<br />
Dr. Roth<br />
Dr. Karl Roth ist mit<br />
Wirkung zum 15.<br />
Januar 2013 zum<br />
neuen Präsidenten<br />
des Deutschen Vereins<br />
des Gas- und<br />
Wasserfaches (DVGW)<br />
gewählt worden. Die<br />
Wahl erfolgte einstimmig<br />
durch den<br />
Vorstand des DVGW.<br />
Der bisherige DVGW-Vizepräsident hat Prof. Dr. Matthias<br />
Krause im Amt des Präsidenten abgelöst. Dieser hatte das<br />
Ehrenamt seit Juli 2011 bekleidet.<br />
Dr. Roth ist seit 2002 Technischer Geschäftsführer der Stadtwerke<br />
Karlsruhe und leitet seit 2005 die DVGW-Landesgruppe<br />
mit ihren rund 240 Unternehmen in Baden-Württemberg.<br />
Bevor er Technischer Geschäftsführer und Werkleiter<br />
der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm und Worms wurde, war er<br />
bei den Stadtwerken Mainz sowie bei der Kraftanlagen AG<br />
Heidelberg tätig. Der gebürtige Gelsenkirchener promovierte<br />
im Bereich der Ingenieurwissenschaften.<br />
08 03 / 2013
RECHT & REGELWERK VERBÄNDE NACHRICHTEN<br />
FACHBERICHT<br />
SKZ erhält Bayerischen Mittelstandspreis<br />
Nach diversen Auszeichnungen in den letzten Jahren wird<br />
der Erfolg des SKZ mit dem Bayerischen Mittelstandspreis<br />
2012 gekrönt. Jutta Leitherer, Bezirksvorsitzende der Mittelstands-Union<br />
Unterfranken, überreichte am 6. Februar<br />
feierlich an Institutsdirektor Prof. Dr. Martin Bastian. „Mit<br />
dieser Auszeichnung werden die herausragenden Leistungen<br />
des SKZ gewürdigt“ freut sich Bastian.<br />
Das Kunststoff-Zentrum ist nach Meinung der Juroren eine<br />
herausragende Schnittstelle zwischen Wissenschaft und<br />
Wirtschaft und ermöglicht so besonders den kleinen und<br />
mittelständischen Unternehmen einen exzellenten Zugang<br />
zu den breit gefächerten Technologie-Angeboten und<br />
-Transfermaßnahmen. „Die Auszeichnung erhält das SKZ<br />
auch, weil es sich exemplarisch für den bayerischen Mittelstand<br />
durch innovative Produkte und Dienstleistungen<br />
hervor getan hat“, betont Jutta Leitherer.<br />
Unzählige kleine und große Erfolge konnte das SKZ in den<br />
letzten Jahren verzeichnen, so hat z. B. eine SKZ-Doktorandin<br />
den Rehau-Preis gewonnen. Im vergangenen Jahr wurde<br />
dem Institut die Ehre zuteil, zum ausgewählten „Ort im Land<br />
der Ideen“ gekürt zu werden, nachdem die Forscher des<br />
SKZ ein Jahr zuvor für eine herausragende wissenschaftliche<br />
Arbeit den „Otto-von-Guericke-Preis“ erhalten haben.<br />
Nicht unerwähnt bleiben soll,<br />
dass eine SKZ-Auszubildende von<br />
Bundeskanzlerin Angela Merkel<br />
als „jahrgangsbeste Physiklaborantin“<br />
geehrt wurde. Die stetig<br />
wachsende Mitarbeiterzahl und<br />
ein Rekordumsatz unterstreichen<br />
die bemerkenswerte Erfolgsgeschichte<br />
des SKZ. Möglich wurde<br />
dies u. a. durch die Erweiterung<br />
der Räumlichkeiten. So entstand<br />
in den letzten zehn Jahren ein<br />
hochmodern ausgestattetes<br />
Bezirksvorsitzende der Mittelstandsunion<br />
Jutta Leitherer bei der Preisübergabe an<br />
SKZ-Institutsdirektor Prof. Dr. Bastian<br />
Verarbeitungstechnikum, das über 8.000 m 2 große Technologiezentrum<br />
mit sehr breit aufgestellter Prüftechnik<br />
und das Direktverarbeitungstechnikum mit modernsten<br />
Maschinen von Arburg und KraussMaffei. Mit den erst Ende<br />
2012 in Betrieb genommenen neuen Standorten in Horb<br />
(Nordschwarzwald), Kunshan (China) und bald auch in Selb<br />
(Oberfranken) wurde und wird den regionalen Bedürfnissen<br />
der Branche Rechnung getragen. An allen Standorten<br />
wurde die Ausstattung extrem verbessert, so wurden z. B.<br />
innovative Möglichkeiten zur Additiven Fertigung ergänzt.<br />
„Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann,<br />
steht in den Herzen seiner Mitmenschen.“<br />
Albert Schweitzer<br />
Viel zu früh und unerwartet ist unser Geschäftsführer<br />
Dipl.-Ing.<br />
Stefan Girod<br />
in der Nacht zum 30.01.2013 verstorben.<br />
Mit seinem Engagement und seiner Begeisterung für die Ziele von German Water Partnership<br />
hat Stefan Girod maßgeblich dazu beigetragen, dass GWP weltweit als Schaufenster der deutschen<br />
Wasserwirtschaft und -forschung anerkannt ist. Durch seinen aktiven und vielseitigen Einsatz<br />
hat er das Gesicht unseres Netzwerkes von Beginn an bleibend geprägt.<br />
Gemeinsam wird es uns ein Anliegen sein, die von Stefan Girod mit ganzem Herzen betriebene<br />
Vereinsarbeit in seinem Sinne fortzusetzen und für die Zukunft weiter zu entwickeln.<br />
Wir werden ihn nicht vergessen.<br />
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen.<br />
In tiefer Betroffenheit,<br />
der Vorstand, die Kollegen in der Geschäftsstelle und die Mitglieder<br />
von German Water Partnership<br />
Die Urnenbeisetzung findet am 23. Februar 2013 im Familienkreis statt. Beileidsbekundungen an die Familie<br />
bitten wir an die Geschäftsstelle zu senden. Für die Kinder von Stefan Girod wurde ein Ausbildungskonto eingerichtet.<br />
Details dazu erhalten Sie ebenfalls in der GWP-Geschäftsstelle.<br />
03 / 2013 09
FACHBERICHT NACHRICHTEN RECHT VERBÄNDE & REGELWERK<br />
IKT zeichnet engagierte Projektleiter mit Goldenem<br />
Kanaldeckel aus<br />
Das IKT hat zum elften Mal den Preis „Goldener Kanaldeckel“<br />
vergeben. Drei Mitarbeiter von Kanalnetzbetreibern<br />
wurden für ihr herausragendes Engagement und ihre vorbildhaften<br />
Projekte im Bereich der Kanalinfrastruktur geehrt.<br />
AUFWÄNDIGE GERUCHSBEKÄMPFUNG NACH<br />
RÜCKSTAU EINER KLÄRANLAGE<br />
Den mit einem Preisgeld von 2.000 Euro dotierten ersten<br />
Platz belegt Dipl.-Ing. Horst Baxpehler vom Erftverband. Sein<br />
Projekt zur Bekämpfung von Geruchsbelastungen in Zusammenhang<br />
mit dem Betrieb einer Druckentwässerungsleitung<br />
hat die Jury überzeugt. Seit dem Rückbau einer kleinen Kläranlage<br />
für rund 300 Einwohnerwerte vor einigen Jahren wird<br />
das Abwasser über eine Druckleitung durch eine Talniederung<br />
zu einem Freispiegelkanal gefördert. Diese Mischwasserleitung<br />
verläuft dann im Ort sehr oberflächennah. Dort<br />
kam es in der Folge zu erheblichen Geruchsbelästigungen,<br />
die sich zu einem Politikum auswuchsen.<br />
Baxpehler setzte auf eine geschickte Kombination technischer<br />
Lösungen bei gleichzeitiger Einbindung der Bürger in diesen<br />
Entwicklungsprozess. Zunächst wurden die Ursachen der<br />
Geruchsentstehung und -verbreitung ermittelt. Nach mehreren<br />
Messkampagnen mit innovativen Werkzeugen aus Messtechnik<br />
und Datenkommunikation stand fest: Fäulnisprozesse<br />
in der Druckleitung verursachten die Geruchsbelästigung. In<br />
der Folge wurden vielfältige Maßnahmen zur Reduzierung<br />
des Geruchs durchgeführt. Ein zentrales Element war eine<br />
gezielte Entlüftungsführung in der Freispiegelleitung gegen<br />
die Fließrichtung durch den Einsatz von selbst entwickelten<br />
Verschlüssen und Lüftungskaminen. Außerdem erwies sich<br />
der Einsatz einer Streckenbelüftung mit Luftdosierschlauch<br />
im letzten Teil der Druckleitung als besonders wirksam.<br />
Baxpehlers Projekt bietet eine umwelt- und bürgerfreundliche<br />
Lösung für das schwierige Problem der Geruchsentstehung<br />
in Kanälen, insbesondere im Umfeld von Abwasserdruckleitungen.<br />
Technische Innovationen spiegeln sich<br />
sowohl in der Kombination als auch in der technische<br />
Umsetzung der Einzelmaßnahmen wider.<br />
DICHTHEITSPRÜFUNG VON<br />
GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNGSANLAGEN<br />
Mit dem zweiten Platz und einem Preisgeld von 1.000 Euro<br />
wurde die Leistung von Dipl.-Ing. Volker Jansen, stellvertretender<br />
Vorstand des Abwasserbetriebs Troisdorf, gewürdigt. Auf<br />
sein Betreiben hin wurde in Troisdorf (NRW, 77.000 Einwohner)<br />
das Thema Dichtheitsprüfung privater Abwasseranlagen aktiv<br />
angepackt. Als Schlüssel zu einer erfolgreichen Umsetzung der<br />
gesetzlichen Vorgaben hat sich die intensive Öffentlichkeitsarbeit<br />
erwiesen: Mit Bürgerinformationsabenden, Einzelberatungen,<br />
einer Internetseite, Broschüren und persönlichen Anschreiben<br />
wurden die Eigentümer stets auf dem Laufenden gehalten.<br />
Ergebnis des engagierten Vorgehens der Stadt Troisdorf und<br />
des Abwasserbetriebs: Bis Ende 2011 lagen bereits für mehr als<br />
6.000 von 17.500 Liegenschaften Bescheinigungen mit dem<br />
Vermerk „dicht“ vor – und das obwohl bei der Erstprüfung<br />
etwa 80 % aller Leitungen undicht waren. Einen großen Anteil<br />
an diesem Erfolg hat die aktive Sanierungsberatung, die der<br />
Abwasserbetrieb zusätzlich durchgeführt hat.<br />
Volker Jansen hat sich in vorbildlicher Weise für die Bürgerberatung<br />
zur Dichtheitsprüfung eingesetzt – und tut es<br />
immer noch. Mit seiner hohen Sensibilität<br />
für das Empfinden der Bürger schafft er<br />
große Akzeptanz für die Kanaluntersuchung<br />
unter den Eigentümern.<br />
Preisträger 2012 (v.l.): Holger Hesse (Stadtwerke Arnsberg),<br />
Horst Baxpehler (Erftverband), Volker Jansen (Abwasserbetrieb Troisdorf),<br />
IKT-Geschäftsführer Roland W. Waniek<br />
GERUCHS- UND KORRO-<br />
SIONSBEKÄMPFUNG IN<br />
ABWASSERSONDERBAUWERKEN<br />
Als dritter Preisträger wurde Holger Hesse<br />
von den Stadtwerken Arnsberg mit der Trophäe<br />
und 500 Euro Preisgeld ausgezeichnet.<br />
Mit dem von ihm geleiteten Projekt<br />
haben sich die Stadtwerke Arnsberg dem<br />
Thema Geruchs- und Korrosionsbekämpfung<br />
zugewandt, das viele Abwassernetzbetreiber<br />
betrifft. Problemfall in Arnsberg<br />
war ein Schmutzwasserpumpwerk mit<br />
abgehender Druckleitung, an deren Hochpunkt<br />
das Abwasser in eine Freispiegelleitung<br />
eingeleitet wird, die mitten in einem<br />
Wohngebiet liegt und dort zu Geruchsbelästigungen<br />
führt. Korrosionsschäden,<br />
10 03 / 2013
RECHT & REGELWERK VERBÄNDE NACHRICHTEN<br />
FACHBERICHT<br />
wiederkehrende Fettanhaftungen im Pumpwerk und erhebliche<br />
Geruchsbelästigungen im Umkreis des Pumpwerks und<br />
entlang der Freigefälleleitung sorgten für Ärger. Die zunächst<br />
eingesetzten, herkömmlichen Techniken brachten keinen<br />
Erfolg. In enger Zusammenarbeit mit der Firma Fix Chemie<br />
Produktion aus Selm wurde ein Produkt mit oberflächenwirksamen<br />
Detergentien entwickelt und als Feststoff im Pumpwerk<br />
angewendet. Das Produkt wurde Schritt für Schritt<br />
weiterentwickelt und optimiert und ist seit mittlerweile vier<br />
Jahren erfolgreich im Einsatz.<br />
Holger Hesse hat mit seinem Engagement Entwicklung in<br />
einem Bereich initiiert, begleitet und umgesetzt, der für<br />
viele Betreiber von Kanalnetzen bisher ungelöste Probleme<br />
bereithält. Ergebnis ist eine einfache und effiziente Methode,<br />
die nach Überzeugung der Stadtwerke Arnsberg in einer<br />
Art Baukastenprinzip auf eine Vielzahl anderer Problemfälle<br />
übertragbar ist.<br />
Mit dem Goldenen Kanaldeckel zeichnet das IKT jedes Jahr<br />
Mitarbeiter von Kanalnetzbetreibern für herausragende Leistungen<br />
bei Neubau, Sanierung oder Betrieb einer modernen<br />
und zukunftsweisenden Kanalinfrastruktur aus. Wichtige,<br />
innovative Leistungen, die üblicherweise im Verborgenen<br />
erbracht werden, rücken so ein wenig ins Bewusstsein der<br />
Öffentlichkeit.<br />
Pioniere im grabenlosen Leitungsbau seit 1962<br />
Berstlining<br />
mit bewährter<br />
Schneidtechnik<br />
• 5 Typen 40-250 t Zugkraft • robuste, belastbare Technik<br />
• QuickLock Berstgestänge • einfache Bedienung<br />
TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG · Postfach 4020 · D 57356 Lennestadt<br />
Tel.: +49 (0)2723 8080 · Email: vertrieb@tracto-technik.de · www.tracto-technik.de<br />
Wir stellen aus: BAUMA München, 15.-.21.4.13, Freigelände FGN.N521/1<br />
03 / 2013 11
FACHBERICHT NACHRICHTEN RECHT VERBÄNDE & REGELWERK<br />
Gütesicherung Kanalbau bei<br />
HAMBURG WASSER hoch im Kurs<br />
In Hamburg heißen die Straßenabläufe Trumme und<br />
die Abwasserkanäle Siele – so steht es im Vorwort der<br />
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen für den<br />
Bau von Sielen (ZTV – Siele Hamburg), die in Ergänzung<br />
zu den geltenden DIN-Normen und Richtlinien auf die<br />
Gegebenheiten der Hansestadt abgestimmt sind. Das<br />
„Hamburger Standardwerk“<br />
genießt<br />
seit vielen Jahren<br />
einen hervorragenden<br />
Ruf und setzt<br />
mit seinen hohen<br />
Anforderungen<br />
Maßstäbe beim<br />
Neubau und bei<br />
der Sanierung von<br />
Abwasserleitungen<br />
und -kanälen.<br />
Konsequent wird<br />
in Hamburg auf die<br />
Qualität von Material<br />
und Ausführung<br />
Burkhard Schonlau vor der Karte des britischen<br />
Ingenieurs Lindley, die die Anfänge des Sielbaus sowie die Qualifikation<br />
der ausführen-<br />
in Hamburg dokumentiert<br />
den Unternehmen<br />
geachtet. Dementsprechend wird bei Auftragsvergabe<br />
ein Qualifikationsnachweis von den Bietern gefordert.<br />
Der Auftragnehmer darf nur dann Sielbaumaßnahmen<br />
ausführen, wenn er über die erforderliche Fachkunde,<br />
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit verfügt. Der Auftragnehmer<br />
hat seine Eignung vor Auftragserteilung auf<br />
Grundlage der Gütesicherung RAL-GZ 961 nachzuweisen.<br />
Damit ist der Grundstein für einen verantwortungsvollen<br />
und nachhaltigen Kanalbau in Hamburg gelegt. Ziel ist es,<br />
mit geeigneten Maßnahmen und Prüfungen Bauwerke<br />
mit langer Nutzungsdauer und geringen Unterhaltskosten<br />
zu errichten. Davon profitieren alle: Mit zuverlässiger<br />
Bauausführung verbessert sich die Wirtschaftlichkeit der<br />
Abwassernetze, denn geringere Unterhaltskosten sowie<br />
eine längere Nutzungsdauer sind die Folgen – hierin ist<br />
man sich bei HAMBURG WASSER einig. Im Gleichordnungskonzern<br />
HAMBURG WASSER sind die Unternehmen<br />
Hamburger Wasserwerke GmbH (HWW) und die Hamburger<br />
Stadtentwässerung AöR (HSE) zusammengeschlossen.<br />
Kernaufgaben sind die Wasserbeseitigung in der Region<br />
und die Beseitigung des anfallenden Abwassers, das in<br />
das unterirdische Sielnetz fließt. Dieses hat eine Länge<br />
von 5.700 km und sammelt das Abwasser von rund 2,2<br />
Millionen Haushalten, Gewerbe- und Industriebetrieben<br />
sowie von 28 Umlandgemeinden. Es wird zum Klärwerksverbund<br />
Köhlbrandhöft/Dradenau transportiert, wo eine<br />
mehrstufige Behandlung und Reststoffverwertung erfolgt.<br />
HOHE AUSFÜHRUNGSQUALITÄT<br />
Bei der Hamburger Stadtentwässerung stehen der Werterhalt<br />
und die Modernisierung des Sielsystems im Vordergrund.<br />
Bereits im 19. Jahrhundert wurden unter Federführung<br />
des britischen Ingenieurs William Lindley die ersten<br />
Siele in Hamburg gebaut. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts<br />
sind bereits 900 km gemauerter Abwasserkanäle entstanden.<br />
„Und das auf einem handwerklich hohen Niveau“,<br />
wie Dipl.-Ing. Burkhard Schonlau, Ingenieurbüro, Abteilungsleiter<br />
Sonderprojekte, HAMBURG WASSER erklärt.<br />
Hierauf basiert in Hamburg eine 170-jährige Ingenieurstradition,<br />
die – unter Berücksichtigung der infrastrukturellen und<br />
baulichen Rahmenbedingungen der Region – ausschlaggebend<br />
für die Schaffung und stete Weiterentwicklung der<br />
hohen Anforderungen war, wie sie heute charakteristisch<br />
für den Umgang mit der unterirdischen Infrastruktur sind.<br />
Vor allem die nicht einfachen Baugrundverhältnisse – es<br />
handelt sich häufig um Marschgebiete mit hohem Grundwasserspiegel<br />
und organischen Böden – und der baulichen<br />
Ausgestaltung des Innenstadtbereichs mit seinen typischen<br />
Fleeten und der engen Bebauung schaffen besondere Spielregeln.<br />
Hinzu kommt: Mehr als 200 Pumpwerke halten das<br />
Abwasser in Bewegung, denn das Gelände ist äußerst flach.<br />
Das stellt u. a. hohe Anforderungen an die eingesetzten<br />
Materialien, da die geringe Fließgeschwindigkeit bei gleichzeitig<br />
hoher Verweildauer die biogene Schwefelsäurekorrosion<br />
begünstigen. „Bei einem pH-Wert < 1 ist da schon<br />
eine besondere Sorgfalt bei der Auswahl der Werkstoffe<br />
gefragt“, so Schonlau. Orientierungshilfe gibt hier die so<br />
genannte Materialliste, die Bestandteil der ZTV – Siele ist.<br />
„Erfüllt ein Werkstoff bestimmte Prüfkriterien, wird er in<br />
die Liste aufgenommen und darf bei Neubau- oder Sanierungsmaßnahmen<br />
eingesetzt werden“, erklärt Schonlau.<br />
Ebenso große Anforderungen bestehen hinsichtlich der<br />
Bauausführung. Es muss sehr präzise gearbeitet werden.<br />
Deshalb gibt es zum Beispiel besondere Anforderungen<br />
hinsichtlich der Lagegenauigkeit.<br />
Entsprechende Sielbauvorschriften gibt es in Hamburg<br />
bereits seit den 1920er Jahren. Hieraus hat sich die ZTV<br />
– Siele entwickelt, die zurzeit in der 2011er Ausgabe vorliegt.<br />
Nach Aussage von Schonlau handelt es sich um eine<br />
dynamische Arbeitsunterlage, in die die Erfahrung von<br />
allen Baustellen sukzessive einfließt – vom ersten Planungsgedanken<br />
über die Ausschreibung und Ausführung bis hin<br />
zur Bauabnahme. Besonders wertvoll sind die langjährigen<br />
Betriebserfahrungen, die systematisch vom Netzbetrieb<br />
rückgekoppelt werden. Hauptverantwortlich hierfür ist das<br />
unternehmenszugehörige Ingenieurbüro, das allerdings<br />
nicht nur Leistungen für HAMBURG WASSER erbringt,<br />
sondern auch für externe Auftraggeber tätig wird. „Und<br />
das mit Brief und Siegel“, weist Dipl.-Ing. Hans-Christian<br />
Möser, vom Güteausschuss der Gütegemeinschaft beauf-<br />
12 03 / 2013
tragter Prüfingenieur, auf den Umstand<br />
hin, dass das Ingenieurbüro ebenso<br />
wie HAMBURG WASSER Mitglied in<br />
der RAL-Gütegemeinschaft Kanalbau<br />
ist. „Während HAMBURG WASSER als<br />
Gründungsmitglied seit 1988 mit der Nr.<br />
15 zur Mitgliedsgruppe 2 gehört, führt<br />
das Ingenieurbüro ein Gütezeichen der<br />
Beurteilungsgruppe ABS, die Eignungskriterien<br />
für die Ausschreibung und<br />
Bauüberwachung von Maßnahmen in<br />
der grabenlosen Sanierung definiert“,<br />
so Möser weiter. Auch hier waren die<br />
Hamburger ganz vorne mit dabei. Dem<br />
Ingenieurbüro wurde als eine der ersten<br />
Organisationen die Erfüllung der Anforderungen<br />
bestätigt und das Recht zum<br />
Führen des Gütezeichens ABS verliehen.<br />
HAMBURG WASSER ist das größte<br />
kommunale Trinkwasserversorgungsund<br />
Abwasserbeseitigungsunternehmen<br />
Deutschlands<br />
HANDLAUF DER TÄGLICHEN<br />
ARBEIT<br />
„Aufgrund unserer Historie und mit Blick<br />
auf die hohen Erwartungen, die wir an<br />
alle Personen und Unternehmen stellen,<br />
die sich mit der Sanierung der Hamburger<br />
Siele beschäftigen, war es für uns eine<br />
Selbstverständlichkeit, das entsprechende<br />
Gütezeichen zu beantragen“, so Schonlau.<br />
Die Anforderungen der Checkliste<br />
zur Erlangung des Gütezeichens haben<br />
die Hamburger Ingenieure jedenfalls<br />
locker erfüllt. „Besondere Erfahrungen<br />
der Organisation bzw. des eingesetzten<br />
Personals werden durch Belege über<br />
entsprechende Tätigkeiten nachgewiesen“,<br />
erklärt Dipl.-Ing. Dirk Stoffers, wie<br />
Möser ein vom Güteausschuss beauftragter<br />
Prüfingenieur. „Die Zuverlässigkeit der<br />
Organisation wird durch Vorlage eines<br />
zertifizierten Qualitätsmanagementsystems<br />
zur Fehlerminimierung, die Zuverlässigkeit<br />
des eingesetzten Personals durch<br />
Vorlage entsprechender Referenzen (z.B.<br />
Zeugnisse) nachgewiesen“. Als vorteilhaft<br />
hat sich der Umstand erwiesen, dass im<br />
Unternehmen seit Jahren ein Qualitätsmanagementsystem<br />
vorhanden ist: „Auf<br />
hohem Niveau und in vielen Teilen praktisch<br />
deckungsgleich mit der Checkliste“,<br />
so Schonlau, für den das QM-System den<br />
Handlauf darstellt, den die Mitarbeiter bei<br />
ihrer täglichen Arbeit nutzen können. Eine<br />
praktische Arbeitsgrundlage, etwa zur<br />
Dokumentation der Eigenüberwachung,<br />
stellen für Schonlau die Arbeitshilfen dar,<br />
die die Gütegemeinschaft in Form der<br />
Leitfäden anbietet.<br />
PRAKTISCHER MEHRWERT<br />
Einen Mehrwert bietet für Schonlau auch<br />
der Internetauftritt der Gütegemeinschaft.<br />
Auf der Seite www.kanalbau.com<br />
steht u. a. umfangreiches Informationsmaterial<br />
zur Verfügung. Etwa die Broschüre<br />
„Gütegesicherte Ausschreibung<br />
und Bauüberwachung“ oder die „Güteund<br />
Prüfbestimmungen RAL-GZ 961“.<br />
Ebenso umfangreich sind die Informationen<br />
über die Gütezeicheninhaber, die<br />
ihre Angaben zur Qualifikation oder ihre<br />
Baustellenmeldungen über den Login-<br />
Bereich eingeben.<br />
„Das sind wichtige Informationen, wenn<br />
es um Ausschreibung und Bauüberwachung<br />
von Maßnahmen in der Sanierung<br />
geht“, fasst Schonlau zusammen, für den<br />
qualifiziertes Personal und Arbeitssicherheitsaspekte<br />
zu den entscheidenden Faktoren<br />
bei der erfolgreichen Durchführung<br />
einer Baumaßnahme zählen. Und wenn<br />
es mal nicht läuft, dann steht der Prüfingenieur<br />
als kompetenter Ansprechpartner<br />
zur Verfügung. Etwa bei festgestellten<br />
Mängeln, bei denen dem<br />
Güteausschuss der Gütegemeinschaft<br />
ein Prüfbericht vorgelegt wird, den dieser<br />
neutral bewertet und über mögliche<br />
Maßnahmen entscheidet. Darüber hinaus<br />
– z. B. bei strittigen Themen – kann der<br />
Prüfinge-nieur auch mit fachlichen Stellungnahmen<br />
zwischen Auftraggebern<br />
und Auftragnehmern vermitteln.<br />
Rohrsysteme<br />
aus GFK<br />
von Amitech<br />
Flowtite-Rohre bestehen aus glasfaserverstärktem<br />
Polyesterharz,<br />
kurz GFK.<br />
GFK ist extrem leicht, enorm fest<br />
und erstaunlich flexibel. Aus GFK<br />
bauen Ingenieure rund um den<br />
Globus Flugzeuge, Schiffe, hoch<br />
beanspruchte Teile im Fahrzeugbau,<br />
und wir bauen daraus Rohre<br />
für Ihre Ansprüche.<br />
Flowtite-Rohre eignen sich für alle<br />
Druck- und drucklosen Anwendungen,<br />
in denen traditionell<br />
Guss-, Stahl-, Stahlbeton oder<br />
Steinzeugrohre eingesetzt werden.<br />
Amitech Germany GmbH · Am Fuchsloch 19 ·<br />
04720 Mochau · Tel.: + 49 34 31 71 82 - 0 ·<br />
Fax: + 49 34 31 70 23 24 · info@amitech-germany.de ·<br />
www.amitech-germany.de<br />
A Member of the<br />
Group<br />
Weitere Informationen unter www.amiantit.com<br />
03 / 2013 13
FACHBERICHT NACHRICHTEN RECHT VERANSTALTUNGEN<br />
& REGELWERK<br />
Deutscher Schlauchlinertag 2013 am 11. April<br />
Schlauchlining ist eine wirtschaftliche und technisch nachhaltige<br />
Lösung für Sanierungsmaßnahmen in Hauptkanälen, bei<br />
Hausanschlüssen und von Grundleitungen<br />
Am 11. April 2013 findet in Würzburg der diesjährige 11.<br />
Deutsche Schlauchlinertag statt. Veranstaltern und Sponsoren<br />
ist es gelungen, ein Publikum mit durchaus unterschiedlichen<br />
Interessen auf eine gemeinsame Sache einzuschwören<br />
– im Sinne von Verfahren und Produkt. Die Veranstaltung<br />
macht auch deshalb Appetit auf mehr, weil sie sich als<br />
Forum etabliert hat, auf dem nicht nur aktuelles Know-how<br />
vermittelt wird, sondern auch kritische Töne willkommen<br />
sind. Wie in den Jahren zuvor werden Sponsoren und Unternehmen<br />
aus der Sanierungsbranche in diesem Jahr die Gelegenheit<br />
nutzen, Auftraggebern, Planern und Netzbetreibern<br />
ihre Dienstleistungen und Produkte zu präsentieren und<br />
ihren Beitrag zur aktuellen Diskussion rund um das Thema<br />
Schlauchliner leisten. Neben einer thematischen Einführung<br />
gehören Schwerpunkte wie die Entwicklungen im Regelwerk,<br />
die Auseinandersetzung mit Qualitätsaspekten sowie<br />
einer fachgerechten Sanierungsplanung und qualifizierten<br />
Ausschreibung ebenso zum geplanten Vortragsprogramm<br />
wie die Vorstellung von Kostenvergleichsrechnungen oder<br />
neuen Anwendungsbereichen und die Diskussion über ein<br />
„heißes Eisen“ wie die <strong>Grundstücksentwässerung</strong>.<br />
Deutschlands Abwasserkanäle sind in weiten Teilen sanierungsbedürftig.<br />
Die von der DWA Deutsche Vereinigung für<br />
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. und anderen<br />
Institutionen geschätzte Nutzungsdauer von 80 Jahren für<br />
neu gebaute Abwasserleitungen und -kanäle ist vielfach<br />
überschritten. „Kommunen investieren zwar notgedrungen,<br />
aber das reicht vielfach nicht, um die Abwassernetze dauerhaft<br />
in Ordnung zu halten“, macht Dr.-Ing. Igor Borovsky<br />
von der Technischen Akademie Hannover deutlich, die den<br />
Deutschen Schlauchlinertag organisiert. Die Liner-Technologie<br />
hat hier eine Lücke gefüllt, indem sie mit leistungsstarken<br />
Verfahren für nachhaltige Sanierungsergebnisse<br />
sorgt. Das belegen auch die Ergebnisse der DWA-Umfrage<br />
zum Zustand der Kanalisation in Deutschland (2009): Der<br />
Foto: Rainer Kiel Kanalsanierung<br />
Anteil der Kanalerneuerung durch Neuverlegung geht nach<br />
und nach zurück, grabenlose Verfahren laufen der offenen<br />
Bauweise inzwischen den Rang ab. Erkennbar ist, dass<br />
Netzbetreiber zunehmend auf die Behebung der Schäden<br />
in den Kanälen setzen. Dies kann durch die Verbesserung<br />
der Funktionsfähigkeit des Kanals (Renovierung) oder durch<br />
die Behebung von örtlich begrenzten Schäden (Reparatur)<br />
geschehen. „Bei den Renovierungsverfahren nehmen<br />
Reliningverfahren inzwischen die absolute Spitzenstellung<br />
ein“, weiß Borovsky. „So wurden geschätzte 80% aller<br />
renovierten Abwasserkanäle in den letzten Jahren mit den<br />
unterschiedlichen Schlauchliningtechniken saniert.“<br />
ENORME EINSATZVIELFALT<br />
Vor allem die enorme Vielfalt der Technologie in punkto<br />
Material und Einbauverfahren bei zugleich wirtschaftlich<br />
günstigen und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten haben zu<br />
dieser Entwicklung beigetragen – bei der Renovierung des<br />
öffentlichen Kanalnetzes ebenso wie bei der Sanierung privater<br />
Entwässerungssysteme. Hinzu kommt: Das Material<br />
ist für den Einbau in verschiedene Werkstoffe geeignet und<br />
kann mittlerweile auch in größeren Nennweitenbereichen<br />
eingesetzt werden. Dabei werden flexible, mit Reaktionsharzen<br />
getränkte Schlauchträger in die zu sanierende Haltung<br />
eingebracht und ausgehärtet. Durch unterschiedliche Aushärteverfahren<br />
wie Warmwasser-, UV- Licht- oder Dampfhärtung<br />
erfolgt eine Reaktion zu einem statisch tragfähigen, biegeweichen<br />
Kunststoffrohr. Die unterschiedlichen Verfahren<br />
zeichnen sich dadurch aus, dass in der Regel keinerlei Aufgrabungen<br />
im Bereich der zu sanierenden Haltungen nötig sind.<br />
„Ein Konzept, das die Auftraggeber überzeugt – vor allem<br />
in puncto Schnelligkeit und Wirtschaftlichkeit“, erklärt Dipl.-<br />
Ing. Franz Hoppe, Hamburg Wasser. „So sind die Kosten, die<br />
im Gegensatz zu einer Neuverlegung für eine Sanierungsmaßnahme<br />
aufzubringen sind, meist deutlich geringer“ so<br />
Hoppe weiter. „Zudem können die notwendigen Arbeiten in<br />
kurzer Bauzeit ausgeführt werden und die Unterbrechung der<br />
Abwasserentsorgung ist in der Regel innerhalb von Stunden<br />
erledigt.“ Auch die Beeinträchtigungen für den Fußgängerund<br />
Straßenverkehr halten sich in akzeptablen Grenzen. Ein<br />
Umstand, der zu einem deutlich reduzierten CO 2<br />
-Ausstoß<br />
beiträgt. Nicht zuletzt verfügt der sanierte Leitungsabschnitt<br />
wieder über eine wesentlich erhöhte Lebensdauer.Fast alle<br />
Produkte der Hersteller und auch die vorgesehene Qualitätssicherung<br />
der eingebauten Schlauchliner sind mittlerweile<br />
auf einem hohen technischen und qualitativen Niveau. Ein<br />
Ergebnis, das auch der LinerReport 2011 vom IKT - Institut<br />
für Unterirdische Infrastruktur gGmbH wiederspiegelt.<br />
„Alles in allem kann festgestellt werden, dass Schlauchliner<br />
im Jahr 2011 ein hohes Qualitätsniveau erreicht haben“ –<br />
so das positive Fazit. Für die Erstellung des seit 2003/2004<br />
jährlich erscheinenden Reports werden Liner und Verfahren<br />
unter Labor- und Praxisbedingungen geprüft. Beim letzten<br />
Report waren dies rund 2.100 Schlauchlinerproben, die auf<br />
14 03 / 2013
Baustellen entnommen und in der IKT-Prüfstelle für Schlauchliner<br />
hinsichtlich der Kennwerte E-Modul, Biegefestigkeit, Wanddicke<br />
und Wasser-Dichtheit untersucht und mit den Sollwerten aus den<br />
DIBt-Zulassungen bzw. den Sollwerten der Hersteller verglichen<br />
wurden. Die Ergebnisse sollen den Netzbetreibern verlässliche Informationen<br />
über Stärken und Schwächen der angebotenen Produkte<br />
liefern. Allerdings finden die Ergebnisse erfahrungsgemäß nicht nur<br />
ungeteilte Zustimmung, sondern sorgen regelmäßig für durchaus<br />
kontroverse Diskussionen.<br />
KRITISCHE AUSEINANDERSETZUNG BRINGT ALLE WEITER<br />
Auch das ist typisch für die Auseinandersetzung mit dem Produkt<br />
Schlauchliner: Trotz der seit Jahren anhaltenden Erfolgsgeschichte<br />
scheiden sich in mancherlei Hinsicht nach wie vor die Geister. „Zwar<br />
gibt es mittlerweile die verschiedensten Regelwerke auf internationaler<br />
und nationaler Ebene und fast alle Hersteller und Verfahrensanbieter<br />
können auf eine bauaufsichtliche Zulassung verweisen“,<br />
so Hoppe, „dennoch gibt es immer wieder einmal Enttäuschungen<br />
über das fertiggestellte Produkt. Fehler werden oft schon in der<br />
Planung, in der Ausschreibungs- und in der Überwachungsphase<br />
gemacht“, ist Hoppe sicher. Es reicht nicht aus, Ansprüche an Hersteller<br />
und Auftragnehmer zu stellen, sondern es ist gleichermaßen<br />
wichtig, diese Ansprüche im Bauvertrag und in der Ausschreibung<br />
ausreichend zu definieren. Eine Sanierungsmaßnahme kann nur<br />
gelingen, wenn das nötige Fachwissen vorhanden ist, und wenn<br />
Auftraggeber, Ingenieurbüro und Auftragnehmer Hand in Hand<br />
zusammenarbeiten. Besonderes Augenmerk ist auf die Definition<br />
von Anforderungsprofilen, das Vergabeverfahren, die Bauüberwachung<br />
sowie die Qualitätskontrollen zu legen. Genauso wichtig ist<br />
die gezielte Auseinandersetzung mit Parametern wie Kosten, Verfahren<br />
und Techniken. Hier können Auftraggeber und Netzbetreiber<br />
mittlerweile aus einer Vielfalt an Verfahren und Produkten wählen.<br />
Diese werden von den Anbietern der Schlauchlinertechnologie<br />
sukzessive weiterentwickelt. So geht die Tendenz hin zu größeren<br />
Nennweiten, z.B. bei den lichtaushärtenden Verfahren. Höher, dicker,<br />
schneller lauten die Ansprüche an die Technik, wenn es darum geht,<br />
verfahrensrelevante Rahmenbedingungen und materialtechnische<br />
Parameter in Einklang zu bringen. Je größer die Nennweite, desto<br />
dicker der Schlauch. Und umso dicker der Schlauch, desto mehr<br />
Energie ist nötig, um den Liner aufzustellen und auszuhärten, lautet<br />
die Gleichung. Doch irgendwann ist die Belastungsgrenze von Folie<br />
und Schlauch erreicht. Auch in den kleinen Nennweitenbereichen tut<br />
sich was, etwa im Bereich der Wiedereinbindung von Schächten und<br />
Hausanschlüssen. Trotz der kontroversen Diskussion über das Für und<br />
Wider der Dichtheitsprüfung und dem momentanen Status in NRW<br />
ist das Thema Sanierung von <strong>Grundstücksentwässerung</strong>sleitungen<br />
ein Marktsegment, das aufgrund der vielfältigen Verfahrensvorteile<br />
der Linertechnologie noch großes Entwicklungspotential verspricht.<br />
Auf der anderen Seite besteht gerade bei der Einbindung von Hausanschlussleitungen<br />
in den Sammler und den teilweise nicht optimalen<br />
Lösungen durchaus noch Handlungsbedarf auf Seiten der Hersteller.<br />
Mit diesem Spannungsfeld werden sich gleich mehrere Referenten<br />
in Würzburg beschäftigen, u. a. mit Beiträgen über die Dichtheit<br />
von <strong>Grundstücksentwässerung</strong>sanlagen und den politischen und<br />
technischen Rahmenbedingungen der <strong>Grundstücksentwässerung</strong>.<br />
Kompetenz, die<br />
verbindet<br />
Wir suchen Sie!<br />
(Ingenieure für Anlagenbau<br />
und Pipelines w/m)<br />
www.tuev-nord.de/karriere<br />
TÜV NORD begleitet Sie<br />
über den gesamten Lebenszyklus<br />
Ihrer Pipelines<br />
Planung und Konstruktion<br />
Fertigung, Montage und Inbetriebnahme<br />
Betriebsbegleitung<br />
Rückbau und Stilllegung<br />
Ihr Nutzen:<br />
Einhaltung hoher Sicherheitsstandards<br />
Reduzierung von Betriebsstörungen<br />
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit<br />
Reduzierung der Ausfall- und<br />
Reparaturkosten<br />
Kontakt: pipeline@tuev-nord.de<br />
KONTAKT: www.deutscher-schlauchlinertag.de<br />
03 / 2013 15
FACHBERICHT NACHRICHTEN RECHT VERANSTALTUNGEN<br />
& REGELWERK<br />
Trends rund um PE- und PP-Kunststoffrohre<br />
Innovative Herstellungskonzepte, alternative Verlegetechniken<br />
und aktualisierte Regelwerke – das Anwendungsgebiet<br />
von Kunststoffrohren wird kontinuierlich erweitert. Einen<br />
Überblick über die aktuellsten Entwicklungen auf dem<br />
dynamischen Markt geben die 17. Wiesbadener Kunststoffrohrtage.<br />
Bereits zum dritten Mal wird die Fachtagung<br />
von TÜV SÜD veranstaltet und bietet den Branchenexperten<br />
am 18./19. April 2013 Gelegenheit zu einem intensiven<br />
Erfahrungsaustausch.<br />
„Moderne, thermoplastische Kunststoffrohre sind in vielen<br />
Bereichen eine wirtschaftliche und innovative Alternative<br />
zu Rohren aus Stahl, Steinzeug oder Beton – egal, ob<br />
neu verlegt oder grabenlos saniert“, sagt Frank Griebel,<br />
unabhängiger Experte des Instituts für Kunststoffe der<br />
TÜV SÜD Industrie Service GmbH. Wesentliche Vorteile der<br />
Kunststoffrohre sind die einfache Verarbeitung, die vielseitigen<br />
Anwendungsmöglichkeiten und die hervorragenden<br />
Langzeiteigenschaften auch unter widrigen Bedingungen.<br />
„Materialien und Verlegetechniken werden ständig verbessert,<br />
Anwendungen erweitert und Regelwerke angepasst“,<br />
so Griebel. „Daher ist es immens wichtig, den Dialog mit<br />
anderen Experten aus Produktion, Praxis und Forschung<br />
zu suchen.“<br />
Zu Beginn der Wiesbadener Kunststoffrohrtage rücken in<br />
den Vorträgen die Rohstoffe in den Fokus – die Erfolgsgeschichte<br />
von Druckrohren aus PE-HD wird ebenso vorgestellt<br />
wie innovative Konzepte zur Werkstoffentwicklung und<br />
neuentwickelte PP-Typen für den Rohrmarkt. Mit Berichten<br />
aus der Praxis zur grabenlosen Installation einer PE<br />
100-Trinkwasserleitung und zu Doppelrohrlösungen für<br />
Abwasserleitungen durch Trinkwasser-Schutzzonen wird<br />
anschließend der Bogen zu neuen, zukunftsweisenden Entwicklungen<br />
wie der grabenlosen Gashausanschlusstechnik<br />
für den Gebäudebestand gespannt. Vorträge über Neuerungen<br />
in der Schweiß- und Prüftechnik runden den ersten<br />
Veranstaltungstag ab.<br />
Alternative Verlegetechniken und Anwendungen im Bereich<br />
der regenerativen Energien stehen am zweiten Veranstaltungstag<br />
auf dem Programm: Informationen über das Verlegen<br />
von Kunststoffrohrleitungen nach aktuellem Regelwerk<br />
und ein Kostenvergleich von grabenloser Neuverlegung und<br />
offener Neuverlegung werden vorgestellt. Bei den alternativen<br />
Verlegetechniken wird insbesondere über den aktuellen<br />
Stand bei HDD- und Berstlining-Verfahren informiert. Die<br />
Anforderungen an Schutzrohre im Bereich der Hochspannungskabelsysteme<br />
stehen ebenso auf dem Programm<br />
wie die Möglichkeiten zur thermischen Aktivierung der<br />
Verkehrsinfrastruktur durch Kunststoff-Rohrsysteme. Der<br />
abschließende Vortrag zur Rolle von Kunststoffrohren als<br />
PE-Wärmetauschersystem richtet den Blick auf bestehende<br />
und zukünftige Entwicklungen und Anwendungen.<br />
Seit über 16 Jahren bieten die Wiesbadener Kunststoffrohrtage<br />
praxisnahe Fachinformationen für Planungs-, Bau- und<br />
Betriebsingenieure, Instandhalter, Schweißtechniker sowie<br />
Experten aus der Kommunal- und Energiewirtschaft. Initiator<br />
und langjähriger Veranstalter dieser renommierten Fachtagung<br />
war Heiner Brömstrup, Geschäftsführer der Dipl.-<br />
Ing. Brömstrup Internationale Ingenieurberatung GmbH.<br />
KONTAKT: www.tuev-sued.de/wiesbadener-kunststoffrohrtage<br />
26. Mülheimer Wassertechnisches Seminar<br />
Am 9. April 2013 findet das 26. Mülheimer Wassertechnische<br />
Seminar zum Thema „Optimierung und Innovation<br />
im Wasserwerk“ statt, bei dem Fachleute von Innovationen<br />
und Optimierungen zum Aktivkohleeinsatz, zu erweiterter<br />
Oxidation, Enteisenung und Enthärtung berichten. Optimierung<br />
und Innovation in der Wasseraufbereitung finden nicht<br />
nur bei der Neuentwicklung von Verfahren statt. Auch in<br />
altbewährten Verfahren stecken erhebliche Optimierungspotenziale<br />
oder neue Anwendungsmöglichkeiten. Das 26.<br />
Mülheimer Wassertechnische Seminar zeigt für verschiedene<br />
Verfahren aktuelle Entwicklungen und Optimierungen aus<br />
den vergangenen Jahren zusammen mit Erkenntnissen zu<br />
neueren Technologien auf.<br />
Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Fachleute<br />
und Praktiker aus Wasserversorgungsunternehmen, Wissenschaft<br />
und Forschung sowie an Mitarbeiter von Planungsbüros<br />
und Anlagenbauern. Erstmals wird die Teilnahme an<br />
einer geselligen Vorabendveranstaltung inklusive Abendessen<br />
angeboten, bei der die Möglichkeit zu Gesprächen mit<br />
den Referenten besteht.<br />
Das IWW Rheinische-Westfälische Institut für Wasserforschung<br />
gGmbH ist national und international in Forschung<br />
und Beratung für die Wasserversorgung und den Gewässerschutz<br />
tätig. Kernkompetenzen von IWW sind Ressourcenschutz,<br />
Gewinnung, Aufbereitung, Wassernetze, Korrosion,<br />
Analytik, Hygiene und Managementberatung für Wasserversorger,<br />
Industrie und Schwimmbadbetreiber.<br />
IWW ist An-Institut der Universität Duisburg-Essen und<br />
kooperiert mit den Hochschulen Dortmund, Darmstadt<br />
und international. IWW-Fachleute des Bereichs Wassertechnologie<br />
konzipieren und optimieren Trinkwasseraufbereitungsverfahren<br />
von kleinen bis größten Wasserwerken<br />
in engem Verbund mit allen IWW-Fachbereichen, Planern<br />
und Anlagenbauern.<br />
16 03 / 2013
Seminar zur Sicherung von Baustellen<br />
an Straßen<br />
© Gina Sanders - Fotolia.com<br />
Bei Reinigungs- und Kanalinspektionsarbeiten,<br />
wie auch bei anderen Arbeiten,<br />
müssen Baustellen im öffentlichen<br />
Verkehrsraum entsprechend gesichert<br />
werden. Bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde<br />
muss vom Unternehmer vor<br />
Beginn der Arbeiten, die sich auf den Straßenverkehr<br />
auswirken, unter Vorlage eines<br />
Verkehrszeichenplanes, eine verkehrsrechtliche<br />
Anordnung beantragt werden. Im<br />
Antrag ist gemäß RSA ein Verantwortlicher<br />
des Unternehmens zu benennen,<br />
der jederzeit Zugriff auf die Arbeitsstelle<br />
vor Ort hat und über ausreichende Entscheidungsvollmachten<br />
in der Firma verfügt.<br />
Die Anordnung muss schriftlich vor<br />
Beginn der Arbeiten vorhanden und auf<br />
der Baustelle verfügbar sein. Bei Ausschreibungen<br />
wird die Beantragung in der Regel<br />
gefordert. Ohne Qualifikationsnachweis<br />
können Angebote von der Wertung ausgeschlossen<br />
werden.<br />
Nicht selten werden jedoch auch von Auftraggeberseite<br />
Arbeiten zugelassen, ohne<br />
dass eine verkehrsrechtliche Anordnung<br />
vorliegt. Spätestens im Falle eines Unfalls,<br />
aufgrund ungenügender Sicherungsmaßnahmen,<br />
kommt das böse Erwachen.<br />
Denn ordnungswidrig handelt, wer ohne<br />
Anordnung mit den Arbeiten beginnt oder<br />
von der Anordnung abweicht. Wird die<br />
Verkehrssicherungspflicht nicht beachtet,<br />
kann es zudem zu Schadensersatzansprüchen<br />
kommen und derjenige, der die<br />
Pflicht verletzt, haftet dem Geschädigten.<br />
Neben der zivilrechtlichen Haftung besteht<br />
in diesen Fällen auch das Risiko einer strafrechtlichen<br />
Verfolgung.<br />
Bereits seit dem 1. Januar 2001 gilt das<br />
„Merkblatt über Rahmenbedingungen<br />
für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung<br />
von Arbeitsstellen an Straßen<br />
(MVAS 99)“ und damit verschärfte<br />
Anforderungen an die Vergabe von Bauleistungen.<br />
Danach wird vom namentlich<br />
benannten Verantwortlichen eine entsprechende<br />
Qualifikation verlangt: „Die<br />
Qualifikation des Verantwortlichen für die<br />
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an<br />
Straßen ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen.<br />
Der Auftraggeber behält sich vor,<br />
bei Fehlen eines solchen Nachweises das<br />
Angebot von der Wertung auszuschließen.“<br />
Dieser Nachweis kann durch den<br />
Besuch von Schulungsveranstaltungen<br />
geführt werden.<br />
Mit dem neuen Seminar der SAG-Akademie<br />
„Baustellensicherung an Straßen,<br />
innerorts, außerorts (Land- und Bundesstraßen)<br />
gemäß MVAS/RSA für Verantwortliche“<br />
(VS-RSA1), wird diese Thematik<br />
nun aufgegriffen. Das Seminar erfüllt<br />
die Forderungen des Bundesministeriums<br />
für Verkehr-, Bau- und Wohnungswesen<br />
bezüglich der Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung<br />
von Arbeitsstellen an<br />
Straßen. Es werden die notwendigen<br />
Kenntnisse für alle Personen, die mit Ausschreibung,<br />
Vergabe, Sicherungsmaßnahmen<br />
und Überwachungspflichten vor Ort<br />
befasst sind, vermittelt. Der Teilnehmer<br />
erlangt mit dem erfolgreichen Abschluss<br />
des Seminars ein anerkanntes Zertifikat,<br />
das er, z. B. im Rahmen öffentlicher Ausschreibungen,<br />
bei der Angebotsabgabe<br />
vorlegen kann.<br />
KONTAKT: SAG-Akademie GmbH für berufliche Weiterbildung,<br />
Darmstadt , Tel. +49 6151 101<br />
55-111, E-Mail: info@SAG-Akademie.de,<br />
www.SAG-Akademie.de<br />
H2/E06<br />
Wiesbadener<br />
Kunststoffrohrtage<br />
17. Internationales Forum<br />
für Rohrsysteme aus polymeren<br />
Werkstoffen<br />
18. – 19. April 2013, Wiesbaden<br />
Beim diesjährigen Forum liegen,<br />
neben Praxisberichten, Schweiß- und<br />
Prüftechniken, weitere Schwerpunkte<br />
auf Alternativen Verlegetechniken<br />
sowie Anwendungen bei Alternativen<br />
Energien. Profitieren Sie von der technischen<br />
Expertise und dem Knowhow<br />
von Anwendern sowie Rohstoff-,<br />
Halbzeug- und Rohrherstellern.<br />
Veranstaltungspreis:<br />
650,00 € zzgl. gesetzlicher USt.<br />
Medienpartner:<br />
TÜV SÜD Akademie GmbH<br />
Tagungen und Kongresse<br />
Telefon +49 89 5791-2410<br />
viktoria.wolter@tuev-sued.de<br />
www.tuev-sued.de/tagungen<br />
03 / 2013 17
FACHBERICHT NACHRICHTEN RECHT VERANSTALTUNGEN<br />
& REGELWERK<br />
Neuer Sachkundelehrgang zum Berstlining-Verfahren<br />
Bereits Anfang der 1980er initiierte ein britisches Energieunternehmen<br />
(die heutige BG Group) eine Methode, mit der<br />
nicht mehr funktionstüchtige Rohre grabenlos durch neue<br />
ersetzt werden können: das Berstlining. Dieses Verfahren<br />
dient der grabenlosen Erneuerung von Gas-, Wasser- und<br />
Abwasserrohrleitungen aus verschiedenen Werkstoffen.<br />
Das heute vielfach eingesetzte Berstlining kann statisch,<br />
dynamisch, als Kurz- oder Langrohrverfahren angewendet<br />
werden. Das eingesetzte Personal muss umfangreiches<br />
theoretisches und praktisches Wissen aufweisen, um die<br />
Arbeiten qualifiziert ausführen zu können.<br />
In dem zweitägigen Sachkundeseminar, das in Kooperation<br />
mit dem RSV Rohrleitungssanierungsverband e.V. stattfindet,<br />
werden dem Teilnehmer u.a. das notwendige theoretische<br />
Wissen zur Ausführung der Arbeiten anschaulich<br />
vermittelt und Möglichkeiten und Grenzen des Verfahrens<br />
aufgezeigt. Anhand umfangreichen Filmmaterials von diversen<br />
Baustellen wird der Bezug zur praktischen Anwendung<br />
hergestellt. Der Referent hat langjährige Erfahrung<br />
im Bereich Berstlining.<br />
Der nächste Sachkunde-Lehrgang findet am 17. bis 18. Juni<br />
in Darmstadt statt.<br />
KONTAKT: SAG-Akademie GmbH für berufliche Weiterbildung, Darmstadt,<br />
Tel. +49 6151 101 55-111, E-Mail: info@SAG-Akademie.de,<br />
www.SAG-Akademie.de<br />
Weseler Wasser Wissen mit 150 Teilnehmern<br />
Das 2. Weseler Wasser Wissen, eine von der PLASSON<br />
GmbH, Stadtwerken Wesel GmbH und m. hübers gmbh<br />
initiierte Kompetenzveranstaltung am 31. Januar in Wesel/<br />
Niederrhein, brachte auch dieses Jahr den 150, aus ganz<br />
Deutschland angereisten Teilnehmern ein vielfältiges Angebot<br />
an informativen Fachvorträgen zum Thema „Wasser“<br />
nahe. Eingeleitet durch das Grußwort des Geschäftsführers<br />
der Stadtwerke Wesel Franz Michelbrink wurde die Tagung<br />
durch den technischen Leiter Hans-Jürgen Zaczek, PLASSON<br />
GmbH, moderiert. Die Veranstaltung konzentrierte sich<br />
überwiegend auf die Erhaltung der Trinkwasserqualität und<br />
der damit verbundenen Anforderungen sowie Risiken. Sie<br />
befasste sich eingehend mit den Einflussfaktoren, die diese<br />
nachteilig beeinträchtigen können. Aber es wurden auch<br />
Methoden und Möglichkeiten präsentiert, die zur Reinigung<br />
von Rohren und Leitungen und damit zur Wahrung der<br />
Trinkwasserqualität beitragen können. Abgerundet wurde<br />
die Veranstaltung durch juristische Aspekte und Gesetzesänderungen<br />
in der Trinkwasserverordnung.<br />
Die Darlegung der wesentlichen Gesetzesänderungen in der<br />
1. und 2. Trinkwasserverordnung, die zum 01.11.2011 und<br />
15.12.2012 in Kraft getreten sind, waren Gegenstand des<br />
ersten Vortrages von Dipl.-Ing. Rainer Pütz, RP-Aqua. Mit<br />
seinem Vortrag konkretisierte Pütz die gesetzlichen Anforderungen<br />
zur Erhaltung von Trinkwasserqualität, machte die<br />
Verantwortlichkeit der Betreiber in diesem Zusammenhang<br />
deutlich und präzisierte die Untersuchungspflichten von<br />
Unternehmern und Inhabern von Trinkwasser-Installationen.<br />
Weiterhin thematisierte er die Legionellenproblematik,<br />
demonstrierte die Bedeutung von qualifizierten Probenahmen<br />
und die Wichtigkeit der Einhaltung der allgemein<br />
anerkannten Regeln der Technik. In seinen Ausführungen<br />
wurde den Zuhörern verdeutlicht, wie in Deutschland durch<br />
schärfere Gesetze eine saubere und hygienischere Wasserqualität<br />
erzielt werden soll.<br />
Während Pütz die gesetzlichen Rahmenbedingungen aufzeigte,<br />
die zur Wahrung von sauberem Wasser geschaffen<br />
werden müssen, referierte Dipl.-Kfm. Siegfried Gendries<br />
über das von der RWW neu entwickelte und zum 01.01.2012<br />
eingeführte „Mülheimer Tarifsystem“. Kerngedanke dieses<br />
Systems ist die Umstellung der Tarifpreise für Wasser, um<br />
steigende Wasserkosten für den Einzelbürger und für Unternehmen<br />
verhindern zu können. Durch den demografischen<br />
Wandel und den eindeutig zu verzeichnenden Bevölkerungsrückgang,<br />
durch den technischen Fortschritt, der uns<br />
Haushaltsgeräte mit einem geringeren Wasserverbrauch<br />
liefert, sowie durch das Konsumverhalten der Verbraucher<br />
hinsichtlich Kosten- und Umweltbewusstsein sind Rückgänge<br />
bei der Trinkwassernachfrage zu verzeichnen. Ein<br />
anhaltendes Wassersparen führt nicht nur zur Gefährdung<br />
der Aufrechterhaltung und stetiger Versorgungssicherheit<br />
von Wasser, sondern auch zu steigenden Kosten. Um eine<br />
gerechte Kostenverteilung und Kostendeckung zu erzielen,<br />
wurde ein zählerunabhängiger Systempreis eingeführt, der<br />
sich nach der Anzahl der Wohneinheiten bei Wohngebäuden<br />
und nach den Verbrauchsklassen bei Gewerbe und<br />
Industrie bemisst. In seiner praxisorientierten Darbietung<br />
veranschaulichte Gendries, wie hierdurch unterschiedliche<br />
Nutzergruppen, vergleichsweise zu früher, angemessen an<br />
den Systemkosten beteiligt werden, der Mengenpreis für<br />
alle Kunden sinkt und die Umsatzerlöse gesichert werden.<br />
Um eine dauerhafte Trinkwasserqualität gewährleisten zu<br />
können, müssen Trinkwasserleitungen jederzeit im gereinigten<br />
und desinfizierten Zustand vorliegen. Diese Thematik<br />
stand im Vordergrund des Vortrages von Dipl.-Ing. Dietmar<br />
Hölting, GELSENWASSER AG in Unna. Detailliert brachte er<br />
18 03 / 2013
Einflussfaktoren vor, die zur Verunreinigung von Wasserleitungen<br />
und damit des Trinkwassers führen. Eine maßgebliche<br />
Rolle spielt hierbei die Lagerung, Transport und Montage<br />
von Rohrleitungen und Armaturen. Den Besuchern zeigte<br />
er praxisnah auf, wie eine Rohrlagerung vorzunehmen ist,<br />
worauf beim Einsatz von Hilfs- und Montagestoffen sowie<br />
beim Transport und der Verlegung zu achten ist. Nicht nur<br />
die Überprüfung auf Dichtheit, sondern auch die mikrobiologische<br />
Untersuchung sei von beträchtlicher Relevanz. Im<br />
weiteren Verlauf präsentierte Hölting verschiedene Spül- und<br />
Desinfektionsverfahren sowie die Auswahlmöglichkeiten von<br />
geeigneten Desinfektionsmitteln. Auch die Beschreibung der<br />
Durchführung von bakteriologischen Probenahmen sowie<br />
die Inbetriebnahmen von Trinkwasserleitungen standen im<br />
Zentrum des Vortrages.<br />
MESSEN UND TAGUNGEN<br />
8th Pipeline Technology Conference<br />
18.-20.03.2013 in Hannover; EITEP, Dennis Fandrich,<br />
Tel. 0511/90992-22, Fax 0511/90992-69,<br />
E-Mail: fandrich@eitep.de, www.eitep.de<br />
RO-KA-TECH 2013<br />
21.-23.03.2013 in Kassel; VDRK e.V., Tel.: 0561/2075670,<br />
Fax 0561/20756729, E-Mail: info@vdrk.de,<br />
www.vdrk.de<br />
Schlauchlinertag 2013<br />
11.04.2013 Technische Akademie Hannover e.V.,<br />
Dr. Igor Borovsky, Tel. 0511/39433-30,<br />
Fax 0511/39433-40, E-Mail: borovsky@ta-hannover.de,<br />
www.ta-hannover.de<br />
Wiesbadener Kunststoffrohrtage<br />
18./19.04.2013 TÜV SÜD, Viktoria Wolter, Tel. 089/5791-2410,<br />
E-Mail: congress@tuev-sued.de<br />
WASSER BERLIN INTERNATIONAL<br />
23.-26.04.2013 Messe Berlin GmbH, Tel. 030/3038-0,<br />
Fax 030/3038-2325, E-Mail: central@messe-berlin.de,<br />
www.wasser-berlin.de<br />
Hans-Jürgen Zaczek, Dietmar Hölting, Rainer Pütz,<br />
Siegried Gendries, Hans-Curt Flemming (v. li.)<br />
Im Anschluss hieran berichtete Prof. Dr. rer. Nat. habil. Hans-<br />
Curt Flemming vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wasserforschung<br />
über die Belastungen des Trinkwassers, verursacht<br />
durch „Biofilme – Freunde und Feinde der Trinkwasserversorgung“.<br />
Hierbei stellte er den Zuschauern vor, wie es zur<br />
Biofilmbildung in Trinkwassersystemen kommt und vor allem<br />
welche nachteiligen Auswirkungen diese auf die Trinkwasserqualität<br />
haben. Denn auch in Trinkwasserleitungen können<br />
hygienisch relevante Mikroorganismen wachsen, sich vermehren<br />
und dadurch zur Kontamination beitragen. Damit wirken<br />
Biofilme als hygienisches Risiko, da sie die Entstehung von<br />
Krankheitserregern fördern. Eine Vermeidung dieser Risiken sei<br />
einerseits durch ein nährstoffarmes Wasser, andererseits durch<br />
eine sorgfältige Materialauswahl zu erzielen, da verschiedene<br />
Werkstoffe als potentielle Nährstoffquelle dienen. Des Weiteren<br />
wurden Ansätze aufgezeigt, mit welchen methodischen<br />
Vorgehensweisen Biofilme zu lokalisieren und Gegenmaßnahmen<br />
zu treffen sind. Abschließend stellte Flemming dar, dass<br />
das Risiko zur Bildung hygienisch relevanter Mikroorganismen<br />
durch die fachgerechte Umsetzung der allgemein anerkannten<br />
Regeln der Technik minimiert werden könne.<br />
Die an der Praxis orientierten Vorträge der renommierten<br />
Referenten verschafften den Zuhörern einen ausgeweiteten<br />
Einblick in die gesetzlichen und praktischen Anforderungen<br />
an Trinkwasserleitungen. Der Erfolg und die herausragende<br />
Resonanz des Weseler Wasser Wissens haben die PLASSON<br />
GmbH, die Stadtwerke GmbH und die m. hübers gmbh dazu<br />
veranlasst, bereits den Folgetermin für 2015 fest in ihre Planung<br />
aufzunehmen.<br />
NoDig-Berlin 2013<br />
23.-26.04.2013 GSTT e.V., Tel. 030/30a38-0, Fax 030/3038-2325,<br />
E-Mail: info@gstt.de, www.gstt.de<br />
8. Forum Industriearmaturen<br />
16.05.2013 Vulkan-Verlag GmbH, Barbara Pflamm, Tel.<br />
0201/82002-28, Fax 0201-82002-40, E-Mail:<br />
b.pflamm@vulkan-verlag.de,<br />
www.forum-industriearmaturen.de<br />
7. Praxistag Korrosionsschutz<br />
19.06.2013 Vulkan-Verlag GmbH, Barbara Pflamm, Tel.<br />
0201/82002-28, Fax 0201-82002-40,<br />
E-Mail: b.pflamm@vulkan-verlag.de,<br />
www.praxistag-korrosionsschutz.de<br />
5. Europäische Rohrleitungstage 2013<br />
26./27.06.2013 in St. Veit an der Glan, Österreich; MTA Messtechnik<br />
GmbH, Tel: +43/ 4212/71491, Fax: +43/4212/72298,<br />
E-Mail: office@mta-messtechnik.at,<br />
www.mta-messtechnik.at<br />
Würzburger Kunststoffrohrtagung<br />
26./27.06.2013 mit Fachausstellung; rbv GmbH, Kurt Rhode,<br />
Tel. 0221/37668-20, Fax 0221/37668-62,<br />
E-Mail: rhode@brbv.de, www.brbv.de<br />
GAT 2013 & WAT 2013<br />
30.09.-02.10.2013 in Nürnberg; Dipl.-Ing. Rainer Jockenhöfer,<br />
Tel. 0228/9188-611, Fax 0228/9188-990,<br />
E-Mail: jockenhoefer@dvgw.de, www.dvgw.de<br />
K2013<br />
16.-23.10.2013 in Düsseldorf; Messe Düsseldorf GmbH, Tel.<br />
0211/4560-01, Fax 0211/4560-668, E-Mail: info@<br />
messe-duesseldorf.de, www.messe-duesseldorf.de<br />
03 / 2013 19
FACHBERICHT INTERVIEW RECHT & REGELWERK<br />
„Wir gehen gern neue Wege“<br />
Die RELINEEUROPE-Unternehmensgruppe wurde 2009 gegründet und hat sich im Bereich der grabenlosen Kanalsanierung<br />
in kürzester Zeit zu einem der führenden Hersteller von UV-lichthärtenden Schlauchlinern weltweit entwickelt. Das noch<br />
junge Unternehmen mit Sitz im pfälzischen Rohrbach hat auch zukünftig viel vor. Darüber sprachen RELINEEUROPE-Vorstand<br />
Christian Noll und Geschäftsführer Benedikt Stentrup mit der <strong>3R</strong>-Redaktion während des 27. Oldenburger Rohrleitungsforums.<br />
: Herr Noll, was treibt jemanden dazu an, in einem etablierten<br />
Markt mit einem neuen Unternehmen zu starten<br />
und vor allem: Was ist die Voraussetzung, dies dann auch<br />
noch erfolgreich zu tun?<br />
Noll: Generell gilt: Wenn man eine neue Firma aufbaut,<br />
egal ob als Linerhersteller oder Kanalsanierer, müssen Sie<br />
ein gewisses Know-how – Technik- und Anwenderwissen<br />
– mitbringen. Wir beide, Herr Stentrup und ich, und unsere<br />
Geschäftsführer- und Vorstandskollegen kennen den Liner-<br />
Markt sehr lange und sehr gut. Wir gehen einfach gern<br />
neue Wege und nutzen nicht die ausgetretenen Pfade der<br />
Branche. Ich glaube, wenn man überzeugt ist von einer<br />
Idee, die man umsetzen will, die richtigen Leute dafür hat,<br />
120%-ige Arbeit reinsteckt und etwas Glück hat, kann man<br />
das auch meistern. Das Wichtigste ist jedoch: Vertrauen der<br />
Kunden und Kundenzufriedenheit sind auch hier das A&O.<br />
: Herr Stentrup, blicken wir einmal zurück ins Jahr 2009.<br />
Mit welchem Team haben Sie damals begonnen?<br />
Stentrup: Meine heutigen Geschäftsführerkollegen Stefan<br />
Reichel, Herbert Wind und Anke Masek, geb. Allmann, und<br />
ich haben zuvor bei Brandenburger zusammengearbeitet.<br />
Herr Reichel war zuständig für die Entwicklung, Herr Wind<br />
für die Maschinen, Anlagen und UV-Aushärte-Equipments<br />
und Frau Masek für den kaufmännischen Bereich.<br />
Der fünfte, Stefan Jensen, hat sich Anfang April 2010 dann<br />
nach der Anfangsphase von RELINEEUROPE selbstständig<br />
gemacht. Er hatte damals die Aufgabe, die Zulassungsbaustellen<br />
zu akquirieren und zu betreuen sowie Baustellen mit<br />
unserer eigenen Einbaukolonne vernünftig abzuwickeln.<br />
Noll: Ich selbst bin Anfang 2010 zusammen mit Wilhelm<br />
Kröller (vormals Insituform) dazu gestoßen. Wir und auch mein<br />
Bild 1: Christian Noll (li.), RELINEEUROPE-Vorstandsmitglied,<br />
mit Benedikt Stentrup, RELINEEUROPE-Geschäftsführer<br />
damaliger Brandenburger-Kollege Ludwig Allmann haben als<br />
Vorstand versucht, unsere Erfahrungen noch in das neue Start-<br />
Up-Unternehmen mit einzubringen und das Team zu stärken.<br />
: Für einen Außenstehenden agiert eine ungewöhnlich<br />
große Führungsriege.<br />
Noll: Viele Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder, dazu<br />
als AG – das ist in der Branche nicht so üblich. Aber: Wir<br />
mussten ja erst einmal etwas aufbauen, nicht nur Liner und<br />
Maschinen fertigungstechnisch hinbekommen, Zulassungen<br />
und Marktakzeptanz schaffen, sondern auch Kunden überzeugen<br />
und gewinnen. Kurz: Keine Hand war überflüssig!<br />
Stentrup: Diejenigen, die gesagt haben, ,Ihr habt zu viele<br />
Häuptlinge‘, haben die ganzen Indianer dahinter nicht gesehen<br />
und nicht mitbekommen, dass die ganze Zeit schon<br />
Schichtbetrieb lief.<br />
Noll: Sie bekommen ein solches Unternehmen nur aufgebaut,<br />
wenn Sie ein richtig gutes Team haben und einer<br />
für den anderen steht. In der Kürze der Zeit, in der wir das<br />
hinbekommen haben, war das nur im Team möglich.<br />
Stentrup: Ich denke, da kommt uns das technische Knowhow<br />
aus den Spezialbereichen, in denen wir uns bewegen,<br />
zusammen mit der Motivation der Führung bis runter zum<br />
Produktionspersonal zugute. Alle ziehen richtig mit – auch<br />
wenn in Spitzenzeiten keiner jubelt, wenn er dann sonntags<br />
in der Nachtschicht am Band stehen muss, aber es ziehen<br />
wirklich alle mit.<br />
: Neue Produkte in einem eher konservativ denkenden<br />
Markt erfolgreich platzieren zu wollen, ist nicht ganz einfach.<br />
Stentrup: Der entscheidendste Punkt war neben dem schnellen<br />
Erhalt der DIBt-Zulassung sowie anderen nationalen Zulassungen<br />
der Vertrauensvorschuss von der Marktseite. Vielen<br />
Kunden hat unser Konzept von vorneherein gefallen, sie<br />
haben Vertrauen in uns gesetzt. Sie sind davon ausgegangen,<br />
dass wir es hinbekommen, und sie haben uns die Möglichkeit<br />
gegeben, unsere Liner in Musterbaustellen einzubauen und<br />
die Qualität zu beweisen. Diesen allen sind wir sehr dankbar.<br />
: Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang Ihr<br />
TQM-System?<br />
Noll: Linerhersteller produzieren Halbfertigteile, die unter<br />
Baustellenbedingungen von der Baustellenkolonne zum<br />
Rohr gefertigt werden. Sollte auf dem Weg zur Baustelle<br />
etwas schiefgehen, stellt sich die Frage nach der Verantwortlichkeit.<br />
Das ist immer schwierig zu klären. Unser<br />
Ansatz war daher, mögliche Fehler sofort zu entdecken,<br />
20 03 / 2013
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT INTERVIEW<br />
schnell abzustellen, im Idealfall bereits im Vorfeld zu verhindern<br />
oder schnellstmöglich Ursachen zu klären.<br />
Wir wussten aus der Vergangenheit, dass man kein Feedback<br />
bekommt, wenn nichts Gravierendes auf der Baustelle<br />
passiert. Aber als neuer Anbieter auf dem Markt ist das nicht<br />
ausreichend. Wir brauchten direkte schnelle Informationen<br />
über das Endprodukt, die gesamte Abwicklung zuvor, den<br />
Transport zur Baustelle, zum Beispiel, ob die Transportverpackungen<br />
geeignet sind usw. Wir brauchten früh die Rückmeldung<br />
zur Akzeptanz und Kundenzufriedenheit.<br />
Unser TQM-System (siehe Infokasten) ist ein Controlling-System,<br />
ein Regelkreis, der uns und unseren Kunden zweigeteilte<br />
Informationen zurückbringt: Einmal die reinen Baustellenergebnisse.<br />
Wir sehen und analysieren zusammen mit den<br />
jeweiligen Anwendern die Materialergebnisse der verschiedenen<br />
Baustellen. Bei Abweichungen können wir zusammen<br />
mit dem Alphaliner-Anwender individuell dagegen reagieren,<br />
um stets das Qualitätsniveau auf höchster Stufe zu halten.<br />
Stentrup: Zum anderen haben wir ein Rückmeldesystem,<br />
das die Kolonne direkt vor Ort ausfüllt, damit wir wissen,<br />
was nicht in Ordnung war, aber auch was gut war. Pro Jahr<br />
kommen über 1.000 dieser Rückmeldebögen bei uns an,<br />
das ist also ein sehr hilfreiches Instrument. Wir haben uns<br />
bisher um die schnellstmögliche Behebung aller, auch noch<br />
so vermeintlich kleiner Fehler, gekümmert. Das hat wiederum<br />
Kundenzufriedenheit geschaffen. Es hat geholfen, die<br />
Baustellen effizienter durchzuführen. Fehlerquellen wurden<br />
immer weiter vermieden und haben zum besseren Ablauf<br />
einer Sanierungsmaßnahme beigetragen.<br />
: Wie hat sich aus Ihrer Sicht der Schlauchlinermarkt<br />
entwickelt und wo sind Sie überwiegend aktiv, welcher ist<br />
Ihr Hauptmarkt?<br />
Noll: Die Branche hat sich in den letzten Jahren stark verändert.<br />
Der Markt ist gewachsen, es gab viel stärkeren<br />
Wettbewerb bei unseren Anwendern und den Zulieferern.<br />
Wir haben in 2012 ein großes Wachstum hingelegt. Unsere<br />
Kunden in Deutschland und in anderen Ländern haben uns<br />
sehr großes Vertrauen geschenkt, so dass wir 380.000 m<br />
produzieren konnten. Das waren über 6.700 Liner, oder<br />
noch einmal 100.000 m mehr als im Jahr zuvor. Damit<br />
dürften wir der größte Hersteller von lichthärtenden Linern<br />
Zu den Personen<br />
Dipl.-Kfm. Christian Noll (53) hat langjährige Erfahrungen im<br />
Sanierungs- und Schlauchlinermarkt. Seit April 2010 ist er<br />
Vorstandsmitglied der RELINEEUROPE AG. Mit ihm arbeiten<br />
heute Wilhelm Kröller, Ludwig Allmann und Bernd Flossmann.<br />
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Benedikt Stentrup (30) ist als<br />
Geschäftsführer zuständig und verantwortlich für den<br />
Vertrieb. Die Geschäftsführerposition bekleidet er zusammen<br />
mit Dipl.-Ing. Stefan Reichel, Herbert Wind und Dipl.-Kfm.<br />
Anke Masek.<br />
Bild 2: Bei der Sanierung von Großprofilen müssen die Produktion, die<br />
Logistik und das Handling auf der Baustelle genau aufeinander abgestimmt<br />
werden. Allein im Jahr 2012 produzierte das Rohrbacher Unternehmen<br />
380.000m Liner<br />
weltweit sein. Neben dem Erfolg steht dies für eine große<br />
Verantwortung unseren Kunden gegenüber, zuverlässig,<br />
pünktlich und in bester Qualität heute und in Zukunft zu<br />
liefern. Das bedeutet natürlich einen großen Aufwand in der<br />
Produktion, der Disposition, Rohstoffplanung mit Zulieferern,<br />
dazu die Produktentwicklung und Weiterentwicklung.<br />
Stentrup: Zu Ihrer Frage nach unserem Hauptmarkt: Deutschland<br />
ist sicherlich das größte Abnehmerland für uns. Der Markt<br />
hierzulande ist vom Volumen und von den technischen Ansprüchen<br />
im internationalen Vergleich am weitesten entwickelt.<br />
Unsere Exportrate liegt zurzeit bei knapp 50 %, wobei der<br />
Schwerpunkt auf Europa liegt: Von den 380.000 m in 2012<br />
haben wir beispielsweise rund 100.000 m nach Frankreich<br />
geliefert. Die Beneluxländer oder Dänemark sind flächenmäßig<br />
zwar klein, aber relativ gesehen sind es Länder mit<br />
großem Kanalsanierungspotenzial.<br />
Aber wir haben auch „exotischere“ Kunden im Mittleren<br />
Osten, im asiatischen Raum oder in Australien/Neuseeland.<br />
Das ist insofern angenehm, weil es aufgrund der klimatischen<br />
Gegebenheiten antizyklisch zum hiesigen Markt läuft.<br />
Andererseits ist die Betreuung durch die Zeitverschiebung<br />
und die Distanz schwieriger.<br />
Generell haben wir im Ausland den Vorteil, dass „Made in<br />
Germany“ sehr gut funktioniert. Viele Firmen haben mit<br />
deutschen Produkten und Herstellern gute Erfahrungen in<br />
puncto Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Professionalität<br />
gemacht. Das kommt uns auch als Linerhersteller zugute.<br />
Wenn wir als deutscher Hersteller die DIBt-Zulassung<br />
haben, wird das im Zweifel auch in Australien akzeptiert,<br />
weil bekannt ist, dass die deutschen Standards „drei Nummern“<br />
strenger sind als die dort geforderten.<br />
: Wie viel Prozent Marktanteil hat die Linertechnik?<br />
Noll: Relativ gesehen haben wir die größte Einbaurate hier in<br />
Deutschland, die meisten namhaften Hersteller sitzen hier. Die<br />
03 / 2013 21
FACHBERICHT INTERVIEW RECHT & REGELWERK<br />
Bild 3: Optimale Anpassung: Lichtquellen-Geometrie und Anzahl der<br />
UV-Strahler sind auf den Linerdurchmesser abgestimmt<br />
UV-Härtung, die wir anbieten, hat sich in den letzten Jahren ein<br />
bisschen zur Trendtechnologie gemausert. In den 1990er Jahren<br />
war die Technologie noch neu und der Marktanteil sehr klein.<br />
Stentrup: In Deutschland erfasst Prof. Dr.-Ing. Volker Wagner<br />
von der Hochschule in Wismar jährlich die Einbaukilometerlängen<br />
von Schlauchlinern in Deutschland, unterteilt in<br />
Glas und Synthesenadelfilz. Derzeit reden wir von einem<br />
Investitionsvolumen von 1.300 km jährlich. Davon machen<br />
die lichthärtenden GFK-Liner mittlerweile 60 bis 70 % aus.<br />
Die konventionellen Sanierungstechniken sind auch weiterhin<br />
vorhanden, aber man sieht, dass sich dort seit etwa<br />
2003/2004 die Kurve ziemlich abgeflacht hat. Diese wird es<br />
weiterhin geben, allein weil bei manchen Projekten andere<br />
technische Ansprüche bestehen und diese konventionellen<br />
Techniken erforderlich machen. Aber man sieht ganz klar, in<br />
welche Richtung sich der Markt entwickelt hat.<br />
: Wie sieht diese in Deutschland zu verzeichnende Entwicklung<br />
in anderen Ländern aus?<br />
Noll: Das merkt man auch in anderen Ländern. In Frankreich,<br />
Schweiz, Benelux setzt sich UV-Licht langsam durch.<br />
In der Schweiz dürften es sicherlich schon 50 % Marktanteil<br />
sein, in Frankreich auch in etwa, dort natürlich in absoluten<br />
Zahlen auf höherem Niveau.<br />
Früher, wenn man in anderen Ländern und auf anderen<br />
Kontinenten unterwegs war, war UV-Lichthärtung nicht oder<br />
kaum bekannt und man musste viele grundsätzliche Fragen<br />
beantworten. Vergangenen November haben wir auf der<br />
Messe NO-DIG 2012 in Sao Paulo ausgestellt. Bislang gibt es<br />
in Südamerika sehr wenig Schlauchlining, aber die dortigen<br />
Kanalsanierer bzw. Abwasserexperten wissen einfach auch<br />
inzwischen, was UV-Licht ist und macht.<br />
Man sieht daran, dass die Technik der UVlichthärtenden<br />
Liner weltweit mehr und<br />
mehr bekannt ist. Ich würde sagen wollen,<br />
dass diese Technik in nächsten Jahren auch<br />
in Nordamerika stärker nachgefragt wird.<br />
In Australien nimmt das stark zu, in Asien<br />
auch so langsam.<br />
Dieser Trend ist natürlich auch für unsere<br />
Zukunft ein wichtiges Signal. Wir fahren<br />
ganz klar eine Internationalisierungsstrategie<br />
und wollen in verschiedenen Ländern<br />
in den Markt hineinkommen bzw. unsere<br />
Position ausbauen. Zunächst werden wir<br />
hier überwiegend in Europa in Schwerpunktregionen<br />
arbeiten, wie z.B. in Tschechien,<br />
Polen, Kroatien, Montenegro und<br />
Serbien. Im letzten Jahr haben wir ein Büro<br />
in Tschechien eröffnet, um von dort aus den<br />
osteuropäischen Markt zu betreuen und<br />
gemäß unserer Philosophie ebenfalls dort<br />
näher am Kunden zu sein. Das hat sich in<br />
den Umsätzen direkt bemerkbar gemacht,<br />
und in den nächsten Jahren erwarten wir<br />
dort noch eine deutliche Verbesserung.<br />
: Die Anforderungen an Linersysteme im Ausland weichen<br />
zum Teil erheblich von denen im deutschen Markt<br />
ab. Mit welchen Strategien kann man darauf reagieren?<br />
Noll: Ja, man darf nicht vergessen, dass in anderen Ländern<br />
andere, eigene Anforderungen in Bezug auf Einbau,<br />
Kontrolle und Qualität bestehen. Deshalb haben wir segmentierte<br />
Regionen und verschiedene Bereiche gebildet.<br />
Das hat mit Einbau, Kontrolle und Qualität zu tun.<br />
In Deutschland gibt es weltweit die höchsten Anforderungen,<br />
die an einen Liner gestellt werden. Kein anderes Land<br />
stellt so hohe Ansprüche an das Material, den Anwender<br />
und den Einbau an sich. Deshalb tun wir uns immer schwer,<br />
wenn wir mit so einem Hightech-Liner in ein Land mit<br />
weniger hohen Anforderungen kommen, weil man gegen<br />
einen ganz anderen Wettbewerb antritt. Wir müssen also<br />
diese anderen Anforderungen kennenlernen und schauen,<br />
wie wir diese Märkte mit den Produkten, die wir herstellen,<br />
ernsthaft bedienen können. Strukturiert und je nach<br />
Schwerpunktregion prüfen wir, wie wir unsere Produkte<br />
so anpassen können, dass sie den dortigen Anforderungen<br />
und Normierungen genügen, ohne dass wir ein schlechteres<br />
Produkt herstellen. So haben wir im vergangenen Jahr ein<br />
Produktmanagement für die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung<br />
marktspezifischer Produkte eingeführt. Denn:<br />
Ein einziges Universalprodukt reicht nicht aus, sondern wir<br />
benötigen verschiedene Produktvarianten.<br />
: Sie bauen also schwerpunktmäßig Vertriebs- bzw. Servicebüros<br />
aus und produzieren weiterhin in Rohrbach? Wie groß<br />
ist der logistische Aufwand, Liner weltweit zu verschicken?<br />
Stentrup: Produziert wird zunächst weiterhin in Rohrbach, ja.<br />
22 03 / 2013
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT INTERVIEW<br />
Grundsätzlich ist es bei lichthärtenden Linern nicht problematisch<br />
sie zu verschicken. Denn es ist kein Gefahrgut, lagerstabil<br />
und lässt sich als konventionelle Ware per See- und Luftfracht<br />
verschicken. Seefracht ist sogar vergleichsweise günstig. Der<br />
Nachteil ist, dass Seefracht mehr Zeit benötigt, die man bei<br />
der Baustellenabwicklung berücksichtigen muss. In Australien<br />
reicht es nicht aus, sechs Tage vor dem gewünschten<br />
Liefertermin zu bestellen, sondern sechs Wochen, damit es<br />
zeitlich passend im Hafen von Sydney ankommt. Wenn es<br />
eilt, kann man auch innerhalb einer Woche nach Australien<br />
liefern, aber Luftfracht kostet natürlich deutlich mehr.<br />
Bei zentraler Fertigung in Rohrbach sind wir zwar weniger<br />
flexibel, aber andererseits macht eine dezentrale Fertigung nur<br />
Sinn, wenn die Auslastung stimmt. Die zentrale Fertigung gibt<br />
uns Synergien, so dass wir heute selbst bei großem Produktionsvolumen<br />
innerhalb von ein bis drei Wochen ausliefern.<br />
Momentan lohnt es sich für uns nicht, an einem anderen<br />
Standort eine ähnliche Fabrik aufzubauen, weil wir das Volumen<br />
nicht oder noch nicht haben.<br />
Wir wollen so lang wie möglich von einem Standort aus<br />
beliefern. Frankreich ist ein wichtiger Markt für uns und die<br />
Bretagne lässt sich heute per Spedition über Nacht beliefern.<br />
Eine dezentrale Herstellung lohnt momentan nur dann,<br />
wenn wir ein völlig anderes Produkt liefern müssten und<br />
auch ein gewisses Volumen erforderlich ist.<br />
: Sie stellen als Systemanbieter neben dem Liner auch<br />
die UV-Technologie und das Equipment für die Baustelle<br />
her, das Sie standardmäßig nicht kaufen können. Wie viele<br />
Anlagen sind das im Jahr?<br />
Stentrup: So zwischen fünf und zehn. Wir haben außerdem<br />
einen Mietpark, es schwankt also ein wenig.<br />
Noll: Es gibt mittlerweile einige UV-Anlagenanbieter, zumindest<br />
hier in Deutschland. Außerhalb Deutschlands kenne ich<br />
keine nennenswerten. Alle unsere Liner herstellenden Mitwettbewerber<br />
arbeiten unabhängig von den Anlagen, mit<br />
denen die Liner eingebaut werden. Wir gehen strategisch<br />
den anderen Weg, weil wir in Bereiche vordringen wollen,<br />
die nicht standardmäßig gelöst werden können. Sicherlich<br />
sind die meisten Durchmesser eher kleiner oder gleich<br />
DN 300 und lassen sich mit einer Standard-UV-Technik<br />
lösen. Aber wir wollen in Bereiche der GFK-Lichthärtung<br />
mit größeren Durchmessern und dickeren Wandstärken<br />
hinein. Einer unserer schweizerischen Partner hat letztes<br />
Jahr bespielweise DN 1100er Liner mit 245 bis 260 m Länge<br />
am Stück eingebaut. Einer unserer deutschen Alphaliner-<br />
Anwender hat in 2012 einen DN 1200/220m lang mit<br />
einem Gesamtgewicht von 20 t erfolgreich eingebaut. Das<br />
sind Dimensionen, die in den 1990ern undenkbar waren.<br />
: Welche Durchmesser sind heute möglich oder in<br />
Zukunft denkbar?<br />
Noll: Derzeit DN 1300. Technisch kann man Liner sicher<br />
auch größer als DN 1300 fertigen, dazu muss die Produktionsmaschine<br />
einfach nur größer dimensioniert sein. Allerdings<br />
muss man auch den Markt betrachten und abwägen,<br />
ob sich die Investition in eine entsprechende Anlagentechnik<br />
rechnet. Und man muss die Anwender denken. Bevor produziert<br />
wird muss die Anwendungstechnik entwickelt werden,<br />
um solche Liner auch fehlerfrei einbauen zu können.<br />
Stentrup: Es gibt einfach zwei begrenzende Faktoren:<br />
Erstens das Netz, das in der Erde verlegt ist. Hier gibt es<br />
eine Pyramidendarstellung; die meisten Leitungen liegen<br />
zwischen DN 200 und DN 600. Je größer der Durchmesser,<br />
desto weniger häufig ist er verlegt. Größer als DN 1200 sind<br />
nur noch ein paar Hundert Kilometer in ganz Deutschland<br />
– und davon ist auch nur ein gewisser Teil zu sanieren. Zweitens<br />
die Alternative: Es gibt hier die Möglichkeit, manuell<br />
zu sanieren.<br />
Total Quality Management (TQM)<br />
Das TQM-System von RELINEEUROPE umfasst die kontrollierte,<br />
gesteuerte Qualitätssicherung über die gesamte Wertschöpfungskette<br />
– vom Rohstoff bis zum fertig ausgehärteten<br />
Alphaliner auf der Baustelle und dokumentiert alle Qualitäts-<br />
Prozessdaten in einer speziellen Datenbank. Regelmäßige Qualitätsreports,<br />
die ebenso von den Partnern von RELINEEUROPE<br />
genutzt werden, dokumentieren die Qualitätsergebnisse. Dieses<br />
konsequent durchgeführte Qualitätsmanagement ist in der<br />
Schlauchlining-Branche einzigartig.<br />
Das TQM-System sichert die Qualität in diesen Bereichen:<br />
»»<br />
Linerherstellung (Rohstoffe von qualifizierten Lieferanten,<br />
Wareneingangskontrollen, durchgängige Überwachung<br />
der einzelnen Prozessschritte, lückenlose Dokumentation)<br />
»»<br />
Logistik (Transport, auch weltweit, in dafür geeigneten<br />
Transportverpackungen, Dokumentation des Transports)<br />
»»<br />
Auf der Baustelle (Kontrolle der Aggregate und sämtlicher<br />
Materialien, Überwachung des Linereinbaus, der Einziehkräfte<br />
und der Aushärteparameter, permanente Steuerung<br />
des Einbauprozesses, lückenlose Dokumentation)<br />
» » Qualitätsprüfung und Dokumentation (Prüfung der Baustellenproben,<br />
Ergebnisauswertung, Dokumentation)<br />
03 / 2013 23
FACHBERICHT INTERVIEW RECHT & REGELWERK<br />
: Ein neuralgischer Punkt bei der Renovation von Kanälen<br />
ist die Anbindung von Schächten oder Zuläufen. Auch an<br />
dieser Thematik arbeiten Sie mit Partnerunternehmen an<br />
technischen Systemlösungen.<br />
Stentrup: Grundsätzlich war uns relativ schnell klar, dass<br />
Renovationsverfahren mit Linern im In- und Ausland nur<br />
weiter wachsen können, wenn diese neuralgischen Punkte<br />
gelöst werden. Keine Kommune wird sich langfristig damit<br />
zufriedengeben, dass ihre eingebauten Liner funktionieren,<br />
aber an jedem Zulauf, an jeder Schachtanbindung das Wasser<br />
hineinfließt. Wenn wir also den Anspruch haben, langfristig<br />
strategisch zu denken und zu planen, gehört auch dazu,<br />
die Anschlusspunkte zu anderen Netzteilen sicherzustellen.<br />
Im Bereich der Schachtanbindung haben wir daher zwei<br />
technisch ausgereifte Lösungen, zum einen eine Edelstahlmanschette<br />
und zum anderen ein Epoxidharz-System, die<br />
wir mit unseren Partnern Uhrig Kanaltechnik GmbH bzw.<br />
resinnovation GmbH entwickelt haben.<br />
: Als Systemanbieter widmen Sie sich nun auch dem<br />
Bereich der Robotertechnik. Wie sind die nächsten Schritte<br />
bei der neugegründeten RELINEROBOTICS GmbH?<br />
Noll: Vom Namen her soll signalisiert werden, dass es zur<br />
selben Familie gehört, aber dennoch etwas Eigenständiges<br />
ist. Ende vergangenen Jahres haben wir zusammen<br />
mit Andreas Lieb, zuvor langjähriger Geschäftspartner bei<br />
der KA-TE AG, die RELINEROBOTICS GmbH gegründet.<br />
Unserer Systemanbieter-Philosophie folgend, waren wir<br />
2011 im Gespräch mit KA-TE wegen Möglichkeiten der<br />
Zusammenarbeit, nicht nur über die Schnittstelle Seitenzulauf/Epoxidharze,<br />
sondern auch im Bereich Fräsroboter.<br />
Leider kamen wir nicht zu einem Abschluss, so dass wir nun<br />
unseren eigenen Weg gehen.<br />
: Und wann kommt der erste von Ihnen entwickelte und<br />
gefertigte Roboter auf den Markt?<br />
Noll: Es kommt darauf an, wie viele technische Sackgassen<br />
wir bei dieser Entwicklung durchlaufen müssen. Wir haben<br />
und setzen hohe Ansprüche in den zu entwickelnden Roboter,<br />
was diese Sache nicht einfacher macht. Natürlich würden<br />
wir ihn gerne im Sommer präsentieren, aber das kann<br />
ich nicht versprechen. Beim Oldenburger Rohrleitungsforum<br />
Zum Unternehmen<br />
2009 gegründet, hat sich RELINEEUROPE mit den drei<br />
Unternehmensbereichen Liner & Technologien, Equipment und Services<br />
am Markt (Schwerpunkt grabenlose Rohrsanierungstechnologien für<br />
Abwasserkanäle und Hausanschlussleitungen) etabliert und gehört im<br />
Bereich der UV-härtenden Schlauchliner weltweit zu den führenden<br />
Herstellern. In 2012 wurden in Rohrbach/Pfalz ca. 380 km Schlauchliner<br />
der Typen Alphaliner500, Alphaliner1200 und Alphaliner1500 produziert.<br />
In der Spitze bei Vollauslastung waren 2012 rund 120 Mitarbeiter für<br />
RELINEEUROPE tätig, davon etwa 40 temporär.<br />
zeigen wir schon einmal Einzelkomponenten. Zunächst einmal<br />
haben wir uns auf den Fräsroboter konzentriert. Die<br />
Multifunktion muss mitgedacht werden, z. B. Verpressen<br />
von Zuläufen usw.<br />
Seit letztem Jahr arbeiten wir bereits an der Grundentwicklung.<br />
Wenn man etwas ganz neu entwickelt, muss man<br />
schauen, wo Verbesserungspotenzial besteht. Was muss der<br />
Fräsroboter können, wie tief muss er in den Zulauf greifen<br />
können usw.? Welche generelle Leistung soll er anbieten?<br />
Die Erwartungen an den neuen Roboter sind ebenfalls hoch,<br />
das wissen wir. Das ist so wie bei den Linern auch. Wenn wir<br />
irgendeinen Liner produziert hätten, wären die Kunden sehr<br />
enttäuscht gewesen. Deshalb nehmen wir uns die nötige<br />
Zeit, bis das Produkt marktreif ist. Ziel ist es im Moment,<br />
einen Prototyp zu fertigen, der auf Baustellen getestet wird.<br />
Um schon in Richtung Multifunktion zu denken, braucht<br />
man natürlich das Harz. Wir werden ein Epoxidharz einsetzen,<br />
da dies die beste kraftschlüssige Verbindung mit dem<br />
Liner bietet. Hier haben wir mit der Firma Sika AG, einem<br />
Hersteller aus der Schweiz, eine enge Zusammenarbeit<br />
beschlossen. Wir sind ab sofort auch Vertriebspartner für<br />
die Roboterharze für Sika International.<br />
: Wann wird es nach Ihrem erfolgreichen Start Up 2009<br />
wieder etwas ruhiger für Sie werden?<br />
Stentrup: Das kann noch etwas dauern. Man wird nie<br />
an den Punkt gelangen, wo man sagen kann: ‚Jetzt habe<br />
ich alles erledigt‘. Solange es aber Spaß macht, wir Erfolg<br />
haben, wird es spannend bleiben.<br />
Noll: Also, in den nächsten zwei Jahren haben ein Investitionsprogramm<br />
vor uns, das gut siebenstellig ist...<br />
: Herr Noll, Herr Stentrup, wir danken Ihnen für das<br />
Gespräch.<br />
24 03 / 2013
Clever kombiniert und<br />
doppelt clever informiert<br />
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
Auch als<br />
ePaper<br />
erhältlich!<br />
3r + gwf Wasser/Abwasser im Kombi-Angebot.<br />
Wählen Sie einfach das Bezugsangebot, das Ihnen zusagt: als Heft, ePaper oder Heft + ePaper!<br />
+<br />
<strong>3R</strong> erscheint in der Vulkan-Verlag GmbH, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen<br />
gwf Wasser/Abwasser erscheint in der DIV Deutscher Industrieverlag GmbH, Arnulfstr. 124, 80636 München<br />
Wissen für DIe<br />
Zukunft<br />
Vorteilsanforderung per fax: +49 Deutscher 931 Industrieverlag / 4170-494 GmbH | Arnulfstr. oder 124 abtrennen | 80636 München und im fensterumschlag einsenden<br />
Ja, ich möchte clever kombinieren und bestelle für ein Jahr die Fachmagazine <strong>3R</strong> (8 Ausgaben)<br />
und gwf Wasser/Abwasser (11 Ausgaben) im attraktiven Kombi-Bezug.<br />
als Heft für € 556,25 zzgl. Versand (Deutschland: € 54,- / Ausland: € 63,-) pro Jahr.<br />
als ePaper (Einzellizenz) für € 556,25 pro Jahr.<br />
Für Schüler und Studenten (gegen Nachweis) zum Vorzugspreis<br />
als Heft für € 278,13 zzgl. Versand (Deutschland: € 54,- / Ausland: € 63,-) pro Jahr.<br />
als ePaper (Einzellizenz) für € 278,13 pro Jahr.<br />
firma/Institution<br />
Vorname, Name des empfängers<br />
Straße / Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Antwort<br />
Leserservice gwf<br />
Postfach 91 61<br />
97091 Würzburg<br />
e-Mail<br />
Branche / Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise Bankabbuchung rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B.<br />
Brief, fax, e-Mail) oder durch rücksendung der Sache widerrufen. Die frist beginnt nach erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur<br />
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an den Leserservice gwf, Postfach<br />
9161, 97091 Würzburg.<br />
Bankleitzahl<br />
Ort, Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer<br />
PA3rIN0213<br />
nutzung personenbezogener Daten: für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich<br />
vom DIV Deutscher 03 / 2013 Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per e-Mail, nicht über interessante, fachspezifische Medien und Informationsangebote informiert und beworben werde. 25<br />
Diese erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
Linerdimensionierung nach DWA-A 143-2<br />
Gelbdruck der 2. Auflage des Merkblattes ATV-M 127-2<br />
Die DWA-Arbeitsgruppe ES 8.16 hat dem Fachpublikum am 1. November 2012 das Arbeitsblatt DWA-A 143-2 als<br />
Gelbdruck vorgestellt. Im Folgenden werden die wesentlichen Grundzüge dieser 2. Auflage des Merkblattes ATV-M 127-2<br />
zur Dimensionierung von Linern und zu Montageverfahren dargestellt. Wie bereits in der 1. Auflage aus dem Jahr 2000<br />
werden wichtige Größen durch Diagramme für Beiwerte ermittelt, deren Anwendungsbereich jedoch bezüglich der<br />
Nennweiten, der Linerwerkstoffe und der Geometrie erheblich erweitert wurde. Die relevanten Unterschiede zwischen<br />
den beiden Auflagen werden erläutert. So werden die Lasten und Werkstoffkennwerte als Design-Werte in die Nachweise<br />
eingeführt. Resultat ist der Ausnutzungsgrad der Konstruktion – bisher war dies der globale Sicherheitsbeiwert.<br />
ATV-M<br />
127-2:2000<br />
1. EINFÜHRUNG<br />
Das Merkblatt ATV-M 127-2 hat sich seit 13 Jahren im praktischen<br />
Einsatz bei der statischen Berechnung von Linern<br />
und Montagesystemen zur Sanierung von Abwasserkanälen<br />
und -leitungen bewährt. Dies gilt nicht nur für die Standardbemessung<br />
von kreisförmigen Linern, für die der Anhang<br />
des Merkblattes Beiwerte zum Spannungsnachweis enthält,<br />
sondern auch für eiförmige Konstruktionen und andere<br />
Querschnitte wie Maulquerschnitte, Kastenquerschnitte,<br />
Querschnitte mit Berme.<br />
Aufgrund neuer Entwicklungen im Bauwesen (z. B. die<br />
verbindliche Einführung der Eurocodes im Jahr 2012) und<br />
neuer Erkenntnisse wurde eine weit gehende Überarbeitung<br />
der Vorschrift erforderlich:<br />
»»<br />
Einführung von Teilsicherheitsbeiwerten (siehe Abschnitte<br />
2.3 und 2.4)<br />
»»<br />
Erweiterung des Anwendungsbereichs, Zusammenfassung<br />
von Diagrammen (siehe Abschnitt 3)<br />
»»<br />
Straßenverkehrslasten nach DIN-Fachbericht 101 (Lastmodell<br />
1, siehe Abschnitt 4)<br />
»»<br />
Erweiterung der Regelung für Imperfektionen (siehe<br />
Abschnitt 5)<br />
»»<br />
Altrohrdruckzonen (siehe Abschnitt 6.3)<br />
»»<br />
Altrohre mit geringer Druckfestigkeit (Altrohrzustand<br />
IIIa, siehe Abschnitt 6.4)<br />
Tabelle 1: Neue Bezeichnungen<br />
DWA-A<br />
143-2:2012<br />
Bedeutung<br />
s, s L<br />
t, t L<br />
Wanddicke Altrohr, Liner<br />
p V<br />
p T<br />
(traffic) Bodenspannung am Rohrscheitel aus<br />
Verkehrslasten<br />
w v<br />
/ r L<br />
∙ 100% w v<br />
auf r L<br />
bezogene örtliche Vorverformung<br />
w GR,v<br />
/ r L<br />
∙ 100% w GR,v<br />
auf r L<br />
bezogene<br />
Gelenkringvorverformung<br />
w s<br />
/ r L<br />
∙ 100% w s<br />
auf r L<br />
bezogener Ringspalt<br />
ohne Index Index k Gebrauchsgrößen (Lasten, Festigkeiten<br />
usw.)<br />
- Index d (design) Bemessungsgrößen (Lasten,<br />
Festigkeiten usw.)<br />
2. ERFORDERLICHE NACHWEISE<br />
2.1 Montagezustände<br />
Für Montagezustände sind wie bisher die folgenden Nachweise<br />
zu führen:<br />
»»<br />
Beulnachweis für den Lastfall Verdämmern,<br />
»»<br />
Verformungsnachweis (Verformungen, die beim Verdämmern<br />
entstehen, sind als Vorverformungen im<br />
Betriebszustand zu berücksichtigen),<br />
»»<br />
Spannungs- und Beulnachweise beim Einziehen von<br />
Rohren<br />
Die Nachweise werden mit dem Kriechmodul des Liners<br />
geführt, in dem die Dauer bis zum Erhärten des Dämmers<br />
und ggf. die Abbindetemperatur berücksichtigt ist. Auf<br />
Probleme bei verformten Altrohren und/oder gekrümmten<br />
Trassen wird hingewiesen.<br />
2.2 Betriebszustände<br />
Für Betriebszustände sind die folgenden Nachweise zu<br />
führen:<br />
»»<br />
Beulnachweis für den Lastfall Wasseraußendruck (sowie<br />
ggf. für alle anderen Lastfälle, bei denen Druckspannungen<br />
im Liner entstehen können),<br />
»»<br />
Spannungsnachweise,<br />
»»<br />
Verformungsnachweis (eher von untergeordneter<br />
Bedeutung),<br />
»»<br />
Ermüdungsnachweis bei geringeren Überdeckungen<br />
unter Verkehrslasten (vgl. Regelungen im Arbeitsblatt<br />
ATV-DVWK-A 127)<br />
Als Nachweisdauer ist in der Regel eine Lebensdauer von<br />
50 Jahren zu berücksichtigen. Hierfür sind für E-Modul und<br />
Festigkeit entsprechende Abminderungsfaktoren anzuwenden.<br />
Für den Ermüdungsnachweis ist die Schwingbreite 2s A<br />
der Linerkonstruktion erforderlich, vgl. ATV-DVWK-A 127,<br />
Abschnitt 9.7.4.<br />
2.3 Charakteristische Größen und<br />
Bemessungsgrößen<br />
Zum Verständnis der neuen Nachweisformate ist es wichtig,<br />
zwischen den beiden Niveaus<br />
»»<br />
charakteristische Größen, gekennzeichnet durch den<br />
26 03 / 2013
Index k (z. B. der Wasserdruck p a,k<br />
und Langzeit-E-Modul<br />
des Liners E L,k<br />
) sowie die<br />
»»<br />
Bemessungsgrößen, gekennzeichnet durch den Index<br />
d (z. B. p a,d<br />
und E L,d<br />
)<br />
zu unterscheiden. Bemessungsgrößen sind die Einwirkungen<br />
S d<br />
(mit Teilsicherheitsbeiwerten g F<br />
multiplizierte Lasten)<br />
und die Widerstände R d<br />
(durch Teilsicherheitsbeiwerte g M<br />
dividierte Werkstoffkennwerte). Damit sind die Eingabedaten<br />
nicht mehr die vom Merkblatt ATV-M 127-2 gewohnten<br />
Lasten z. B. bei 4,5 m Wassersäule p a<br />
= 45 kN/m² (sondern<br />
p a,d<br />
= g F<br />
∙p a<br />
= 67,5 kN/m²) und Werkstoffkennwerte wie z. B.<br />
E L<br />
= 1400 N/mm² für UP-SF (sondern E L,d<br />
= E L<br />
/g M<br />
@ 1000 N/mm²).<br />
Die Teilsicherheitsbeiwerte g F<br />
und g M<br />
sind an der Wahrscheinlichkeit<br />
des Auftretens von Ereignissen sowie den<br />
statistischen Streuungen der Größen orientiert.<br />
Damit folgt das von den Eurocodes bekannte Nachweisformat<br />
in verallgemeinerter Form<br />
S d<br />
/ R d<br />
≤ 1<br />
(Bemessungswert der Einwirkung S / Bemessungswert<br />
des Widerstandes R) (1)<br />
Tabelle 2: Teilsicherheitsbeiwerte g M<br />
und g F<br />
der 2. Auflage,<br />
Vergleich mit der 1. Auflage (erf g)<br />
Vorschrift Beiwert Schlauch liner<br />
ATV-A 143-2:2012<br />
Tab. 13 und 14<br />
DWA-M 127-2:2000<br />
Tab. 4<br />
Montageverfahren<br />
g M<br />
1,35 1,25 1,0<br />
g F,G<br />
(ständig) 1,35 1,35 1,35<br />
g F,Q<br />
(veränderlich)<br />
1,5 1,5 1,5<br />
g M<br />
∙g F,Q<br />
2,025 1,875 1,5<br />
erf g 2,0 2,0 1,5<br />
alle<br />
Verfahren,<br />
Lastfall q v<br />
Altrohrzustand<br />
III<br />
Tabelle 3: Anwendungsbereich der Beiwerte m pa<br />
im Anhang D.1 für Kreis profile<br />
(grau hinterlegt), Lastfall Wassseraußendruck p a<br />
bei Altrohrzustand I bis III<br />
Vorschrift<br />
ATV-M<br />
127-2: 2000<br />
DWA-A<br />
143-2: 2012<br />
(Gelbdruck)<br />
Werkstoff<br />
DN 100<br />
DN 250<br />
DN 300<br />
DN 400<br />
DN 500<br />
DN 600<br />
UP-SF - - 1) - 1) - 1) - 1) - 1) - -<br />
UP-GF - - - - - - - - - - - - -<br />
UP-SF AZ I und II: w GR,v<br />
= 0, 3 und 6%<br />
UP-GF AZ III und IIIa: w GR,v<br />
= 3, 6 und 9%<br />
1) AZ I und II: w GR,v<br />
= 0 und 3%; AZ III: w GR,v<br />
= 0, 3 und 6%; AZ IIIa: nicht behandelt<br />
DN 900<br />
Beim Nachweis resultiert nicht mehr ein Sicherheitsbeiwert,<br />
sondern ein Ausnutzungsgrad bzw. die Reserve des Systems.<br />
2.4 Teilsicherheitsbeiwerte<br />
Die Teilsicherheitsbeiwerte der 2. Auflage sind den Tabellen<br />
13 und 14 zu entnehmen. Die Werte wurden soweit möglich<br />
dem Eurocode 1 mit dem Ziel angepasst, das globale<br />
Sicherheitsniveau der 1. Auflage mit erf g = 2,0 zu erreichen,<br />
vgl. die Zeile für g M<br />
∙g F<br />
der Tabelle 2. Außerdem wird der<br />
Unterschied zwischen einer Herstellung von Rohren im<br />
Werk und auf der Baustelle durch unterschiedliche Werte<br />
für g M<br />
verdeutlicht.<br />
Bei Altrohrzustand III liegt ein Formschlussproblem vor, der<br />
Liner erfährt in der gerissenen Altleitung eine Zwangsverformung.<br />
Hierfür ist die Berechnung des E-Moduls mit g M<br />
=<br />
1,0 erforderlich, da eine Verringerung des E-Moduls durch<br />
g M<br />
> 1 günstig wirkt. Ist unklar, ob Form- oder Kraftschluss<br />
vorliegt, so sind zwei Berechnungen mit g M<br />
= 1,0 und 1,35<br />
durchzuführen.<br />
Bild 1: Biegemomentenbeiwerte m pa<br />
für UP-SF-Liner DN 300 aus Anhang D.1 der<br />
2. Auflage, Ablesung bei p a,d<br />
und Interpolation für das Beispiel im Abschnitt 8.1<br />
3. ANWENDUNGSBEREICHE<br />
3.1 Kreisquerschnitte<br />
Zum Zeitpunkt des Erscheinens des Merkblattes M 127-2<br />
im Jahr 2000 wurden im Wesentlichen synthesefaserverstärkte<br />
Liner (UP-SF) angewendet, die Bemessungshilfen im<br />
Anhang A4 (Altrohrzustand I und II) und A5 (Altrohrzustand<br />
III) waren infolgedessen auf UP-SF-Liner beschränkt. Der<br />
Anwendungsbereich wurde in der zweiten Auflage für<br />
glasfaserverstärkte Liner erweitert. Zur Beschränkung des<br />
Umfanges wurden die Nennweiten bis ca. DN 900 in einem<br />
Diagramm zusammengefasst, das für die Nennweite DN<br />
300 direkt verwendet werden kann, vgl. Bild 1.<br />
Für abweichende Nennweiten ist der Kurvenparameter<br />
t L,DN300<br />
wie folgt zu berechnen:<br />
Bild 2: Biegemomentenbeiwerte m q<br />
für UP-SF-Liner DN 300 aus Anhang E.2<br />
der 2. Auflage, e G<br />
/t = 0,25 Ablesung bei q v,d<br />
und Interpolation für das Beispiel<br />
im Abschnitt 8.2<br />
03 / 2013 27
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
Bild 4:<br />
Vergleich der<br />
Bodenspannungen<br />
für Rohre<br />
d m<br />
= 0,7 m aus<br />
Straßenverkehrslasten<br />
nach<br />
DIN 1072 und<br />
DIN-Fachbericht<br />
101<br />
Bild 3:<br />
Biegemomenten beiwerte m pa<br />
für UP-GF-Liner mit<br />
Eiquerschnitt aus Anhang D.2 der 2. Auflage<br />
t L,DN300<br />
= t L,DN<br />
∙ 300 / DN (2)<br />
Für das Beispiel im Abschnitt 8.1 mit d L<br />
= 490 mm und<br />
t L<br />
= 10 mm gilt: Ablesung des Biegemomentenbeiwertes im<br />
Diagramm DN 300 bei t L,DN300<br />
= 10 ∙ 300 / 490 = 6,1 mm,<br />
vgl. Bild 1.<br />
Mit diesem Verfahren ist ein stufenloser Übergang zwischen<br />
zwei Nennweiten möglich, vgl. Tabelle 3. Die Ablesung erfolgt<br />
bei p a,d<br />
= 67,5 kN/m² und t L<br />
= 6,1 mm, vgl. Abschnitt 8.1.<br />
Die Normalkraftbeiwerte liegen bei Kreisprofilen zwischen<br />
–1,6 < n pa<br />
< –0,8, für Überschlagsberechnungen ist die<br />
Verwendung von n pa<br />
= –1 zulässig.<br />
Bei AZ III können die Beiwerte m q<br />
und n q<br />
für Berechnungen<br />
den Diagrammen im Anhang E.2.1 (UP-SF) und E.2.2 (UP-<br />
GF) der 2. Auflage entnommen werden, vgl. Bild 2.<br />
Die Kurven für AZ III wurden für w GR,v<br />
= 9 % erweitert und<br />
in kleinen Schritten ermittelt, so dass das Stabilitätsversagen<br />
am Anstieg der Kurven sichtbar wird.<br />
Für das Beispiel ist auf der x-Achse bei q v,d<br />
= 103,5 kN/m²<br />
abzulesen, der Rechengang für q v,d<br />
ist dem Abschnitt<br />
8.2 zu entnehmen. Als Kurvenparameter gilt wieder<br />
t L,DN300<br />
= 6,1 mm, vgl. Bild 2.<br />
3.2 Genormte Eiquerschnitte<br />
Für genormte Eiquerschnitte werden im Anhang D.2 der 2.<br />
Auflage erstmalig Beiwerte m pa<br />
und n pa<br />
der Biegemomente<br />
und der Normalkräfte für den Lastfall Wasserdruck angegeben.<br />
Die Kurven zeigen bei bestimmten Belastungen h W,d<br />
Knicke – hier geht die symmetrische Biegelinie in die für<br />
den Beulfall maßgebende einseitige Form über, vgl. Bild 3<br />
(z. B. für AZ I und t L<br />
= 12,5 mm bei h W,d<br />
= 3 m).<br />
Die Schnittgrößen werden mit den bekannten Gleichungen<br />
und dem Scheitelradius r L,S<br />
ermittelt:<br />
M pa,d<br />
= m pa<br />
∙ p a,d<br />
∙ r L,S<br />
² und N pa,d<br />
= n pa<br />
∙ p a,d<br />
∙ r L,S<br />
(3)<br />
Bei Eiprofilen sind – abweichend von Kreisquerschnitten –<br />
zusätzliche Diagramme für die Beiwerte n pa<br />
der Normalkräfte<br />
erforderlich, da diese von –1 abweichen.<br />
Da der Lastfall q v<br />
(Erd- und Verkehrslasten) bei Eiprofilen<br />
im Altrohrzustand III am Ersatzkreis mit dem Radius r L<br />
=<br />
r L,S<br />
berechnet werden kann (vgl. den Abschnitt 6.8.1 der<br />
2. Auflage), können die Beiwerte m q<br />
und n q<br />
verwendet<br />
werden, siehe Bild 2.<br />
3.3 Weitere Querschnittsformen<br />
Für andere Querschnittsformen werden Hinweise zur Form<br />
und Größe der Imperfektionen angegeben. So ist z. B. bei<br />
Maulprofilen mit einer flachen Sohle sowohl eine symmetrische<br />
als auch eine seitliche Lage der örtlichen Vorverformung<br />
zu untersuchen – vgl. die Stabilitätstheorie des<br />
Bogens, der einen Übergang von der symmetrischen zur<br />
antimetrischen Knickfigur für zunehmende Bogenstiche<br />
aufweist.<br />
4. VERKEHRSLASTEN<br />
Als größte Straßenverkehrslast wurde bis 2012 das Lastbild<br />
des SLW 60/30 mit jeweils drei Achsen nach DIN 1072<br />
definiert. Nach DIN-Fachbericht 101 ist ein Schwerlastfahrzeug<br />
mit zwei Achsen und je 240 kN Achslast (Lastmodell<br />
1) anzusetzen, der Schwingbeiwert ist hierin enthalten.<br />
Die Achsabstände und die Radaufstandsflächen wurden<br />
ebenfalls geändert, Einzelheiten vgl. Falter & Wolters (2008).<br />
Für Betriebsfestigkeitsnachweise gilt eine weitere Achskonfiguration,<br />
das Ermüdungslastmodell 3.<br />
Aufgrund der engeren Anordnung der Radlasten ergeben<br />
sich für Überdeckungen h < 3,5 m größere Bodenspannungen,<br />
vgl. Bild 4. Der Vergleich der Spannungen p V<br />
und p T<br />
ist allein nicht aussagekräftig, da die Nachweise noch durch<br />
weitere Änderungen der 2. Auflage beeinflusst werden:<br />
»»<br />
Die Teilsicherheitsfaktoren g F<br />
für Verkehr und Erdlasten<br />
sind verschieden, vgl. Tab. 2.<br />
»»<br />
Bei Erfüllung geometrischer Kriterien darf nun die entlastende<br />
Wirkung der horizontalen Bodenspannungen<br />
28 03 / 2013
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
a) b)<br />
1<br />
a<br />
a‘<br />
2<br />
Bild 5: Messung der Gelenkringverformung bei einem nicht<br />
begehbaren Sammler mit zwei angepassten Kreisen und bei<br />
begehbaren Sammlern mit einer Schablone mit dem Radius des<br />
Scheitelkreises<br />
v<br />
k v,s<br />
0,9<br />
0,8<br />
0,7<br />
0,6<br />
0,5<br />
0,4<br />
0,3<br />
0,2<br />
0,1<br />
0,0<br />
0 2 3 4 5-6 6 8 10<br />
Altrohrzustand<br />
I<br />
PE-Rohre<br />
UP-SF<br />
UP-GF<br />
Stahlmanschetten<br />
Altrohrzustand<br />
II<br />
r L/t L = 10<br />
15<br />
20<br />
25<br />
35<br />
50<br />
100<br />
Altrohrzustand III<br />
w GR,v [%]<br />
w v = 2,0 %<br />
w s = 0,5 %<br />
Bild 6: Reduktionsfaktor k v,s<br />
für variable Gelenkringverformungen,<br />
jedoch feste Werte w v<br />
= 2 % und<br />
w s<br />
= 0,5 % nach Falter et al. (2003) mit typischen<br />
Wertebereichen r L<br />
/t L<br />
für Liner und Stahlmanschetten<br />
q h<br />
(p T<br />
) am Kämpfer berücksichtigt werden, Näheres siehe<br />
2. Auflage, Gleichung 12a-c.<br />
»»<br />
Die Abhängigkeit der Bodenspannungen p T<br />
vom mittleren<br />
Rohrdurchmesser d m<br />
wird nur noch für h < 1 m<br />
berücksichtigt.<br />
Bei den Eisenbahnverkehrslasten sind ebenfalls Änderungen<br />
zu verzeichnen, die dem Arbeitsblatt DWA-A 161 und nach<br />
Fertigstellung der 4. Auflage dem Arbeitsblatt DWA-A 127<br />
(zurzeit Entwurf) zu entnehmen sind.<br />
5. IMPERFEKTIONEN UND BEULNACHWEIS<br />
5.1 Vorgaben<br />
Bei schlanken Konstruktionen, die durch hohe Druckkräfte<br />
beansprucht werden, müssen strukturelle und geometrische<br />
Imperfektionen angenommen werden, vgl. z. B. DIN<br />
EN 1993-1-1, Abschnitt 5.3 „Imperfektionen“. Die Größen<br />
und Formen der hierfür anzunehmenden geometrischen<br />
Ersatzimperfektionen sind in den Tabellen 5 bis 9 der 2.<br />
Auflage – getrennt nach dem Sanierungsverfahren – angegeben.<br />
In Tabelle 4 sind diese Regelungen auszugsweise<br />
zusammengefasst. Für „Mörtelliner“ (Liner, die in einem<br />
Mörtel bzw. Dämmer verankert werden) oder verdämmerte<br />
Rohre ist ein verbleibender Ringspalt w s<br />
> 0 anzunehmen,<br />
da diese Werkstoffe hierauf empfindlich reagieren.<br />
Für die Wahl der örtlichen Vorverformung ist die folgende<br />
Vorgehensweise zu beachten:<br />
1. Schätzen der zum ersten Eigenwert (zur maßgebenden<br />
Beullast) gehörenden Beulform (in Einzelfällen können<br />
hierfür mehrere Versuche erforderlich werden),<br />
2. Annahme einer affinen oder zumindest ähnlichen<br />
Vorverformung und<br />
3. Kalibrierung dieser Figur mit den Mindestwerten aus<br />
Tabelle 4 und / oder Verwendung der Größen entsprechend<br />
den Messwerten (vgl. Abschnitt 5.2)<br />
Auch für nicht kreisförmige Querschnitte werden Vorgaben<br />
gemacht. So sind für Rechteckquerschnitte eine<br />
Berechnung mit einer Vorverformung in der Sohle und<br />
eine zweite Berechnung mit vorverformter Seitenwand<br />
durchzuführen.<br />
5.2 Messung von Vorverformungen<br />
Die Gelenkringverformung w GR,v<br />
ist eine wichtige Größe, um<br />
den Liner sicher zu dimensionieren - eine pauschale Annahme<br />
des Mindestwertes von w GR,v<br />
= 3 % ist nicht zulässig.<br />
Bild 5 zeigt einfache Verfahren zur genäherten Ermittlung<br />
der Gelenkringverformung bei Eiprofilen: a) in nicht begehbaren<br />
Kanälen (Einzel- und Gesamtdurchmesser a und a‘<br />
von zwei Kreisen) und b) in begehbaren Kanälen (Abstand<br />
v zwischen Sammler und Kreisschablone in Scheitelmitte),<br />
Näheres siehe 2. Auflage, 6.3.1.<br />
Tabelle 4: Imperfektionen bei Schlauchlinern und Montageverfahren<br />
Imperfektion Kreisprofil genormtes Eiprofil Maulprofil sonstige<br />
örtliche Vorverformung w v<br />
2%<br />
j = 40°<br />
0,5% 2) von r K<br />
3)<br />
j = 30°<br />
0,5% von r So<br />
mind. 10 mm<br />
Gelenkringvorverformung w GR,v<br />
1)<br />
≥ 3% ≥ 3% - -<br />
10 – 20 mm 5)<br />
Ringspalt w s<br />
4)<br />
0,5% 0,5% von r S<br />
1 – 2 mm 1 – 2 mm<br />
1)<br />
AZ II ff.: aus Messungen zu ermitteln 2) bei gemauerten Kanälen 1%<br />
3)<br />
AZ II ff.: zuzügl. w GR,v<br />
/10 4) AZ III: w s<br />
= 0 5) Lage und Öffnungswinkel ingenieurmäßig festlegen<br />
03 / 2013 29
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
krit qv,d [kN/m²]<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
E 2 = 8 N/mm²<br />
E 2 = 3 N/mm²<br />
5.3 Abminderungsfaktoren<br />
Bereits drei Jahre nach Erscheinen der 1. Auflage konnten<br />
die Abminderungsfaktoren für Imperfektionen bei Standardfällen<br />
(Kreisprofil, w v<br />
= 2 % lokale Vorverformung,<br />
w s<br />
= 0,5 % Ringspalt) in einem einzigen Diagramm abgelesen<br />
werden, vgl. Bild 6. Zudem liefert dieses Diagramm<br />
mit einer direkten Ablesung von k v,s<br />
um ca. 20 % günstigere<br />
Werte als das Verfahren der Multiplikation von drei<br />
einzelnen Faktoren nach der 1. Auflage (k v,s<br />
= k v<br />
∙ k GR,v<br />
∙ k s<br />
).<br />
Dennoch ist die Multiplikationsmethode für Fälle mit Werten<br />
w v<br />
≠ 2 % und w s<br />
≠ 0,5 % z. B. bei rückverformten Linern<br />
mit w s<br />
= 2 % (statt 0,5 %) weiter anzuwenden.<br />
Wie bereits in der 1. Auflage ist es auch möglich, ein produktbezogenes<br />
Diagramm zu entwickeln und dieses beim<br />
Beulnachweis anzuwenden.<br />
5.4 Beulnachweis<br />
Die Gleichung für den kritischen Wasserdruck von Linern<br />
mit Kreisprofil lautet in der 2. Auflage, Abschnitt 6.6.4.1:<br />
t L = 10<br />
t<br />
t L = 10 mm<br />
7,5<br />
5<br />
0<br />
e G<br />
7,5<br />
5<br />
0<br />
0<br />
3 6 9<br />
w GR,v [% ]<br />
b D<br />
N K,d<br />
DN 300, e G/t = 0,25,<br />
E L,d = 4400 N/mm²<br />
max d<br />
Tabelle 5: Definition der Altrohrzustände I bis IIIa<br />
t L = 0: gerissenes Rohr-<br />
Bodensystem ohne Liner<br />
Bild 7: Kritische<br />
Lasten des<br />
Liner-Altrohr-<br />
Bodensystems,<br />
abhängig von E 2<br />
, t L<br />
und w GR,v<br />
Bild 8: Parabelförmige<br />
Spannungsverteilung<br />
in der Kontaktzone der<br />
Kämpferlängsrisse<br />
Altrohrzustand (AZ)<br />
Altrohr I II III IIIa<br />
ausreichende Biegezugfestigkeit s bZ,AR<br />
+ - - -<br />
Altrohr-Bodensystem in Ruhe + + - -<br />
ausreichende Druckfestigkeit s D,AR<br />
+ + + -<br />
krit p a,d<br />
= k v,s<br />
∙ a D<br />
∙ S L,d<br />
mit S L,d<br />
= 1 E<br />
⋅ L,k<br />
γ M<br />
12⋅ (1− µ 2 ) ⋅ # t L<br />
&<br />
% (<br />
$ '<br />
r L<br />
3<br />
und k v,s<br />
nach Bild 6<br />
(4a)<br />
(4b)<br />
Neu sind die Division von S L<br />
durch g M<br />
und die Berücksichtigung<br />
der Querdehnzahl m. Liegt für m ein Werkstoffgutachten vor,<br />
so wird die Beullast z. B. bei m = 0,35 um ca. 10 % erhöht.<br />
Damit folgt der Nachweis im Format der Gleichung (1):<br />
p a,d<br />
/ krit p a,d<br />
≤ 1<br />
Bei Eiprofilen ist ein ausreichend genauer Beulnachweis mit<br />
dem Ersatzradius r E<br />
= 0,6 ∙ H – t L<br />
/2 möglich (vgl. Abschnitt<br />
6.8.1). Diese Näherung wurde in der Arbeitsgruppe DWA-ES<br />
8.16 durch Kontrollberechnungen nach der Finite Element<br />
Methode für die 2. Auflage erneut bestätigt.<br />
6. ALTROHRZUSTAND<br />
6.1 Abgrenzungen<br />
Die für eine sichere Linerdimensionierung erforderliche<br />
Abgrenzung der Altrohrzustände (AZ) ist auf verschiedene<br />
Weise möglich. Zum besseren Verständnis wird in der<br />
2. Auflage die Tabelle 5 ergänzt.<br />
Ist weiterhin eine ausreichende Biegezugfestigkeit der<br />
Altrohre vorhanden, so liegt AZ I vor. Bei Überlastung<br />
reißt das Altrohr vierfach und wird – allein betrachtet –<br />
instabil. Nach Abschluss der Rohrverformungen und einer<br />
damit verbundenen Umlagerung der Bodenspannungen<br />
(der Konzentrationsfaktor der Bodenspannungen über dem<br />
Rohr verringert sich auf den Rechenwert l R<br />
= 0,75) wird<br />
zusammen mit dem seitlich stützenden Boden ein neuer<br />
Gleichgewichtszustand möglich: AZ II.<br />
Treten weitere Bodenbewegungen infolge Verkehrslasten<br />
(bei geringen Überdeckungen), späteren Überschüttungen,<br />
Bodenentzug, Grundwasserschwankungen usw. auf oder<br />
ist das System aus anderen Gründen langzeitig nicht stabil,<br />
so liegt der AZ III vor. Ein weiteres, durch theoretische<br />
Überlegungen gestütztes Kriterium für AZ III sind Gelenkringverformungen<br />
w GR,v<br />
> 6 %, vgl. 2. Auflage, Anhang F.<br />
Eine Betrachtung der Druckübertragung über die Teilflächen<br />
insbesondere in den Kämpferpunkten führt im Falle<br />
nicht ausreichender Druckfestigkeit zum AZ IIIa, der in der<br />
2. Auflage neu eingeführt wird, vgl. hierzu die folgenden<br />
Abschnitte.<br />
6.2 Altrohrzustand III<br />
Für eine Berechnung nach AZ III müssen einige bodenmechanische<br />
Kennwerte bekannt sein oder auf der sicheren<br />
Seite geschätzt werden:<br />
»»<br />
Bodengruppe (Kies, Sand, bindiger Boden usw.)<br />
»»<br />
Verformungsmodul E 2<br />
»»<br />
Lagerungsdichte D Pr<br />
»»<br />
Koeffizient K 2<br />
des horizontalen Erddrucks<br />
»»<br />
Winkel der inneren Reibung j’, der den passiven Erddruck<br />
beeinflusst<br />
30 03 / 2013
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
Bild 9 a) Guter Zustand der Druckzone:<br />
keine Abplatzung, hohe Druckfestigkeit,<br />
keine Korrosion, neues Rohr<br />
(→ Gelenkexzentrizität e G<br />
/t £ 0,45,<br />
→ Druckzonenbreite b D<br />
/t ³ 0,13)<br />
Bild 9 b) Normaler Zustand der<br />
Druckzonen: keine oder geringe<br />
Abplatzungen, gute Druckfestigkeit,<br />
wenig Korrosion = Standardfall<br />
(→ Gelenkexzentrizität e G<br />
/t ~ 0,35,<br />
→ Druckzonenbreite b D<br />
/t ~ 0,40)<br />
Bild 9 c) Schlechter Zustand der<br />
Druckzonen: sichtbare Abplatzungen,<br />
geringe Druckfestigkeit, erhebliche Korrosion<br />
(→ Gelenkexzentrizität e G<br />
/t ~ 0,25,<br />
→ Druckzonenbreite b D<br />
/t ~ 0,67)<br />
Der Index 2 kennzeichnet die Leitungszonen neben den<br />
Altrohrkämpfern, die für die seitliche Stützung der Altrohrscherben<br />
besonders wichtig sind.<br />
Die kritischen Lasten krit q v,d<br />
des Altrohr-Bodensystems<br />
ohne und mit UP-GF-Liner sind in Bild 7 angegeben. Die<br />
Werte mit Liner sind die Maximalwerte aus Bild 2 bzw.<br />
dem Anhang E.2 (am Ende des steilen Anstiegs der Kurven<br />
für m q<br />
).<br />
Nehmen Linerwanddicke t L<br />
und Verformungsmodul des<br />
Bodens E 2<br />
zu, so steigt die kritische Last an. Die gestrichelten<br />
Linien repräsentieren ein Altrohr-Bodensystem ohne Liner<br />
(t L<br />
= 0). Es wird auch deutlich, dass ein Liner mit Wanddicken<br />
t L<br />
≤ 5 mm das Gesamtsystem nicht nennenswert<br />
ertüchtigen kann.<br />
Die Bodenspannung q h,d<br />
+ q h,d<br />
* neben dem Altrohr muss<br />
durch max q h,d<br />
beschränkt werden (plastisches Bodenverhalten).<br />
Diese Situation tritt auf, wenn die Bodenspannungen<br />
aus Verkehrslasten dominieren, also bei geringen Überdeckungen<br />
und / oder bei geringem inneren Reibungswinkel<br />
j’ des Bodens:<br />
max q h,d<br />
= 0.75 ∙ K p<br />
∙ l B<br />
∙ q v,d<br />
(5)<br />
mit K p<br />
= tan² (45° + ½ j’) = Beiwert für den passiven<br />
Erddruck,<br />
l B<br />
= 1,08 = Konzentrationsfaktor der Bodenspannungen<br />
neben dem Altrohr,<br />
q v,d<br />
= vertikale Bodenspannung am Kämpfer aus Erdund<br />
Verkehrslasten.<br />
Die Beiwerte m q<br />
und n q<br />
sowie krit q v,d<br />
sind unter Berücksichtigung<br />
der Gleichung (5) ermittelt worden.<br />
6.3 Druckzonen im Altrohrkämpfer<br />
Bei den Altrohrzuständen II und III ist die Übertragung der<br />
Kämpferdruckkräfte in den Druckzonen des Altrohres nachzuweisen:<br />
Über einen Teil b D<br />
der Altrohrwanddicke t wird ein<br />
parabelförmiger Spannungsverlauf angenommen, vgl. Bild 8.<br />
Damit folgt die maximale Druckspannung im Altrohr<br />
max s d<br />
= 1,5 ∙ N K,d<br />
/ b D<br />
mit der Druckkraft im Kämpfer<br />
N K,d<br />
@ –q v,d<br />
(1 + δ h<br />
)·d a<br />
/2<br />
und der horizontalen Verformung<br />
δ h<br />
@ w GR,v<br />
/ 100<br />
(6a)<br />
(6b)<br />
(6c)<br />
Bereits in der 1. Auflage wurden in den Druckzonen der<br />
Kämpferlinien exzentrische Gelenke angenommen. Da die<br />
Wahl der Exzentrizität einen großen Einfluss auf die erforderliche<br />
Linerwanddicke hat, ist dieser Parameter sorgfältig<br />
zu wählen, vgl. Bild 9a) bis c).<br />
Nach Wahl der Gelenkexzentrizität folgt für eine angenommene<br />
parabelförmige Verteilung der Druckspannungen die<br />
Druckzonenbreite b D<br />
b D<br />
= 8t / 3 ∙ (0,5 – e G<br />
/t) (7)<br />
Mit b D<br />
wird die maximale Druckspannung nach Gleichung<br />
(6a) ermittelt. Der Nachweis für die Altrohrdruckspannungen<br />
lautet damit:<br />
max s d<br />
/ s D,AR,d<br />
≤ 1 (8)<br />
Bei begehbaren Kanälen ist die charakteristische Druckfestigkeit<br />
σ D,AR,k<br />
in der Regel durch Kernbohrungen zu<br />
ermitteln. Bei nicht begehbaren Profilen ist diese Größe zu<br />
schätzen, z. B. zu 50 % eines neuwertigen Rohres.<br />
Wird der Nachweis nicht erfüllt, so ist der Liner für Altrohrzustand<br />
IIIa zu dimensionieren.<br />
Im Fall eines guten Kontaktes mit hoher Druckfestigkeit<br />
kann der Wert für e G<br />
/t mit 0,45 angenommen werden,<br />
während zunehmende Korrosion oder Abplatzungen im<br />
Bereich der Kämpferlinien mit reduzierter Exzentrizität kor-<br />
03 / 2013 31
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
Bild 10: Erforderliche Wanddicken, abhängig von der<br />
Gelenkexzentrizität e G<br />
, Überdeckung h ≥ 0,5 m, Verkehrslasten<br />
nach DIN-FB 101, kein Grundwasser vorhanden<br />
a) b)<br />
Bild 11: Biegemomente eines UP-GF-Liners DN 500,<br />
a) AZ III, b) AZ IIIa<br />
außen: Versagen durch Knicken<br />
Mitte: Schubversagen<br />
innen: Biegezugversagen<br />
Bild 12: Zeitabhängiger Scheiteldruckversuch an einem GFK-Ring<br />
unter Wasser, Versagensarten, maximale Versuchsdauer 48 h<br />
(Osterhues, 2010)<br />
respondieren, z. B. e G<br />
/t = 0,25.<br />
Bild 10 zeigt den Einfluss der Gelenkexzentrizität e G<br />
auf die<br />
erforderliche Linerwanddicke z. B. für Altrohre DN 300 mit<br />
40 mm Wanddicke. Besonders bei kleinen Überdeckungen<br />
und / oder großen Nennweiten ermöglicht eine genauere<br />
Bestimmung der beeinflussenden Parameter E 2<br />
und K 2<br />
(z. B.<br />
Bodensondierungen) sowie t und e G<br />
(z. B. Kernbohrungen<br />
aus dem Kämpfer) eine wirtschaftlichere Bemessung.<br />
In Bild 10 dominiert der Einfluss der Verkehrslasten nach<br />
DIN-FB 101. Die resultierenden Linerwanddicken stimmen<br />
ungefähr mit den Werten nach DIN 1072 überein, vgl. Falter<br />
& Fingerhut (2011).<br />
6.4 Altrohrzustand IIIa<br />
Für den Fall im Abschnitt 6.3, dass in den Druckzonen und /<br />
oder über den gesamten Umfang der Altrohre keine ausreichende<br />
Druckfestigkeit festgestellt wird, oder bei massiver<br />
Scherbenbildung wird in der 2. Auflage ein neuer Altrohrzustand<br />
IIIa eingeführt. Dieser Zustand bedeutet, dass das<br />
Altrohr als Boden aufgefasst und der Liner als elastisch<br />
gebetteter Ring modelliert wird.<br />
Der Bettungsmodul setzt sich aus den Einzelmoduln E AR<br />
und<br />
E B<br />
zusammen, wobei allerdings E AR<br />
wegen der vergleichsweise<br />
geringen Wanddicke des Altrohres nur wenig Einfluss<br />
hat. Dieses Modell ist bereits im Arbeitsblatt ATV-DVWK-<br />
A 127 in allgemeiner Form geregelt, im Anhang E.4 des<br />
Arbeitsblattes DWA-A 143-2 werden zusätzlich Beiwerte<br />
m q<br />
und n q<br />
für Kreisprofile angegeben.<br />
Bild 11 zeigt den Vergleich der M-Linien für AZ III und IIIa<br />
mit den Parametern h = 4 m, h W<br />
= 2 m sowie E 2<br />
= 8 N/mm²,<br />
K 2<br />
= 0,3, e G<br />
/t = 0,25 und w GR,v<br />
= 9 %. Aus einer EDV-<br />
Berechnung resultieren die maximalen Biegemomente<br />
M d<br />
= 212 bzw. 242 Nmm/mm und die Linerwanddicken<br />
erf t L<br />
= 6 bzw. 6,5 mm.<br />
7. WERKSTOFFKENNWERTE<br />
In der Tabelle 3 der 2. Auflage werden die charakteristischen<br />
Werkstoffkennwerte E L,k<br />
und s bZ,k<br />
als Mindestwerte für<br />
Schlauchliner angegeben, die aus dem neuen Merkblatt<br />
DWA-M 144-3 übernommen wurden.<br />
Bei einer Linerbemessung dominiert der E-Modul E L<br />
das<br />
Stabilitätsproblem, während die Biegezugfestigkeit s bZ<br />
für das Bruchverhalten des Querschnitts vorrangig ist. So<br />
wird z. B. ein PE-Liner zuerst beulen, ein „Mörtelliner“<br />
dagegen durch Bruch versagen. Für typische Schlauchliner<br />
können beide Versagensarten auftreten, abhängig von<br />
der Art und der Größe der Imperfektionen und anderer<br />
Parameter.<br />
Es ist daher unstrittig, dass beide Kennwerte eines Linerproduktes,<br />
E L<br />
und s bZ<br />
für Langzeitbedingungen ermittelt<br />
werden müssen. Die Faktoren A 1E<br />
zur Reduktion von E L<br />
für<br />
Kriecheffekte und A 1s<br />
der Langzeitfestigkeit sind jedoch<br />
nicht gleich – sie müssen durch unterschiedliche Prüfverfahren<br />
ermittelt werden. Die Ermittlung von A 1s<br />
für GFK<br />
(Prüfkörper und notwendige Zahl der Prüflinge) wird in DIN<br />
EN 14364, Tabelle 12 aufgezeigt.<br />
Im Rahmen eines Forschungsvorhabens an der Fachhochschule<br />
Münster werden Prüflinge eines Herstellers in Zeitstandversuchen<br />
mit Lasten in der Nähe der Bruchlast beansprucht,<br />
um Aussagen zum Abminderungsfaktor A 1s<br />
zu<br />
ermöglichen. Zurzeit beträgt die erreichte Versuchsdauer<br />
ca. 9.000 Stunden.<br />
Bei den Versuchen wurde auch das Bruchverhalten von<br />
UP-GF-Rohrabschnitten und von Dreipunkt-Biegeversuchen<br />
näher betrachtet. Einige Prüfkörper zeigten drei verschiedene<br />
Brucharten mit interlaminaren Brüchen im mittleren<br />
Wanddickenbereich, vgl. Bild 12. Der Nachweis der<br />
Schubspannungen im Abschnitt 6.5.4.1 der 2. Auflage soll<br />
verhindern, dass bei Werkstoffen mit geringer interlaminarer<br />
Festigkeit ein Schubversagen in der Mitte des Querschnitts<br />
32 03 / 2013
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
auftritt. Die für den Nachweis erforderlichen Scherfestigkeiten<br />
können näherungsweise aus dem Biegeversuch am<br />
kurzen Balken nach EN ISO 14130 ermittelt werden.<br />
Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurden außerdem<br />
Versuche zur Ermüdungsfestigkeit mit zyklischen Belastungen<br />
bis maximal 10 7 Lastspiele durchgeführt (Frequenz<br />
7 Hz, s o<br />
/s u<br />
= 0,3). Die Versuche haben gezeigt, dass Linerproben<br />
mit tieferen Oberflächenkerben bis zu den Glasfaserlagen<br />
unter Schwellbeanspruchung zu vorzeitigem<br />
Versagen neigen.<br />
8. NACHWEISE FÜR EINEN UP-SF-LINER<br />
8.1 Altrohrzustand II<br />
Altrohr: Steinzeugkanal DN 500<br />
Beschreibung der Schäden:<br />
»»<br />
Längsrisse in Scheitel, Kämpfer und Sohle,<br />
»»<br />
aus <strong>Inspektion</strong>: Altrohrzustand II,<br />
»»<br />
Messung: maximale Gelenkringverformung w GR,v<br />
= 3 %<br />
des Linerradius.<br />
»»<br />
Es wurde nachgewiesen, dass das Altrohr-Bodensystem<br />
tragfähig ist.<br />
Schlauchliner aus Synthesefaserlaminat, Kennwerte:<br />
»»<br />
Außendurchmesser: d a,L<br />
= 500 mm<br />
»»<br />
Wanddicke, gewählt: t L<br />
= 10 mm<br />
»»<br />
Langzeit-E-Modul: E L,k<br />
= 1500 N/mm² * )<br />
»»<br />
Langzeit-Biegezugfestigkeit: s bZ,k<br />
= 20 N/mm² * )<br />
»»<br />
Langzeit-Druckfestigkeit: s D,k<br />
= 25 N/mm² * )<br />
»»<br />
Querdehnzahl: m = 0,35<br />
»»<br />
* ) charakteristische Werte, Werkstoffgutachten und<br />
DIBt-Zulassung liegen vor<br />
Belastung (charakteristische Werte):<br />
»»<br />
Grundwasserstand: max h W,k<br />
= 4,5 m über Linersohle<br />
»»<br />
Erd- und Verkehrslasten: Übernahme durch das<br />
Altrohr-Bodensystem<br />
Teilsicherheitsbeiwerte:<br />
»»<br />
Wasserdruck: g F,Q<br />
= 1,50<br />
»»<br />
Linerwerkstoff: g M<br />
= 1,35<br />
Nachweis 1: Beulnachweis für Wasseraußendruck<br />
Altrohrzustand II<br />
Radius der Mittellinie:<br />
r L<br />
= DN/2 – t L<br />
/2 = 500/2 – 5 = 245 mm<br />
Parameter für Ablesungen:<br />
r L<br />
/ t L<br />
= 245 / 10 = 24,5<br />
Rohrsteifigkeit des Liners nach Gleichung (4b), Designwert:<br />
1<br />
S L,d<br />
=<br />
1,35 ⋅ 1500<br />
12⋅ (1− 0,35 2 ) ⋅ # 10 &<br />
% (<br />
$ 245'<br />
3<br />
= 0,00718 N/mm² (6.38a)<br />
Durchschlagbeiwert:<br />
a D<br />
= 2,62 ∙ (r L<br />
/ t L<br />
) 0,8 = 2,62 ∙ 24,5 0,8 = 33,9<br />
Abminderungsfaktor für die Standardwerte<br />
w v<br />
= 2 % und w s<br />
= 0,5 %:<br />
ablesen bei w GR,v<br />
= 3 % ergibt k v,s<br />
@ 0,52 (Diagramm D4)<br />
Beullast:<br />
krit p a,d<br />
= k v,s<br />
∙ a D<br />
∙ S L,d<br />
= 0,52 ∙ 33,9 ∙ 0,00718<br />
= 0,1266 N/mm² (6.36)<br />
Wasserdruck, Bemessungswert:<br />
h W,So<br />
= 4,5 m<br />
→ p a,d<br />
= g W<br />
∙ h W,So<br />
∙ g F,Q<br />
= 10 ∙ 4,5 ∙ 1,5 = 67,5 kN/m²<br />
= 0,0675 N/mm² (6.16)<br />
Nachweis gegen Versagen durch Instabilität:<br />
p a,d<br />
= 0,0675<br />
krit p a,d<br />
0,1266<br />
= 0,53 < 1 → Nachweis erfüllt (6.42)<br />
Nachweis 2: Spannungsnachweis Altrohrzustand II<br />
Durchmesser der Mittellinie:<br />
d L<br />
= 500 – 10 = 490 mm<br />
Beiwerte der Schnittgrößen M pa<br />
und N pa<br />
,<br />
Altrohrzustand II (Anhang D):<br />
ablesen bei t L,DN300<br />
= 10 ∙ 300 / 490 = 6,1 mm und<br />
h W,d<br />
= 6,75 m (Diagramm D.1, siehe Bild 1)<br />
m pa<br />
@ +0,050 (Voraussetzung: E L,d<br />
= 1500 / 1,35 = 1111 @<br />
1000 N/mm²)<br />
n pa<br />
= –1,0<br />
(6.17c)<br />
Schnittgrößen für Wasserdruck p a,d<br />
= 0,0675 N/mm²:<br />
M pa,d<br />
= m pa<br />
∙ p a,d<br />
∙ r L<br />
² = 0,050 ∙ 0,0675 ∙ 245²<br />
= 202,6 Nmm/mm (6.18a)<br />
N pa,d<br />
= n pa<br />
∙ p a,d<br />
∙ r L<br />
= –1,0 ∙ 0,0675 ∙ 245<br />
= –16,5 N/mm (6.18b)<br />
Krümmungsbeiwerte:<br />
a ki<br />
= 1 + t L<br />
/ 3r L<br />
= 1 + 10 / (3∙245) = 1,014,<br />
a ka<br />
= 0,986 (6.21a, b)<br />
Querschnittswerte:<br />
A = 1∙t L<br />
= 10 mm²/mm<br />
W = 1∙t L<br />
² / 6 = 10² / 6 = 16,7 mm³/mm (6.22a, b)<br />
maximale Biegezugspannung (Linersohle,<br />
innen):s So,i<br />
= N pa,d<br />
A<br />
+α ki<br />
⋅ M pa,d<br />
W = −16,5<br />
10<br />
+1,014 ⋅<br />
202,6<br />
16,7 =<br />
-1,65 + 12,30 = 10,65 N/mm² = max s d<br />
(6.20a)<br />
03 / 2013 33
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
Nachweis gegen Versagen des Linerwerkstoffs durch<br />
Biegezug:<br />
max σ d<br />
σ bZ,d<br />
= 10,65<br />
20 / 1,35<br />
= 0,72 < 1 → Nachweis erfüllt<br />
Maximale Druckspannung (Linersohle, außen):<br />
s So,i<br />
=<br />
−16,5 202,6<br />
− 0,986⋅ = –1,65 – 11,96 = –13,61 N/mm²<br />
10 16,7<br />
= min s d<br />
(6.20b)<br />
Nachweis gegen Versagen des Linerwerkstoffs durch Druck:<br />
Schnittgrößen für Gesamtlast q v,d<br />
= 0,1035 N/mm²:<br />
M q,d<br />
= m q ∙ q v,d ∙ r L ² = 0,018 ∙ 0,1035 ∙ 245²<br />
= 111,8 Nmm/mm (6.18a)<br />
N q,d = n q ∙ q v,d ∙ r L = –0,06 ∙ 0,1035 ∙ 245<br />
= –1,52 N/mm (6.18b)<br />
Maximale Biegezugspannung (Linersohle, innen):<br />
s So,i<br />
= N q,d<br />
A +α ki<br />
⋅ M q,d<br />
W = −1,52<br />
10<br />
+1,014 ⋅<br />
111,8<br />
16,7 =<br />
–0,15 + 6,79 = 6,64 N/mm² = max s d<br />
(6.20a)<br />
minσ d<br />
σ D,d<br />
= 13,61<br />
25 / 1,35<br />
= 0,74 < 1 → Nachweis erfüllt<br />
Nachweis gegen Versagen des Linerwerkstoffs durch<br />
Biegezug:<br />
8.2 Altrohrzustand III<br />
Angaben für die Nachweise nach Altrohrzustand III<br />
Belastung (charakteristische Werte):<br />
»»<br />
Erdlasten aus Überdeckung h = 2,0 m<br />
»»<br />
Lastmodell 1 nach DIN-Fachbericht 101 (Doppelachse<br />
mit je 240 kN)<br />
Teilsicherheitsbeiwerte:<br />
»»<br />
Erdlasten: g F,G<br />
= 1,35<br />
»»<br />
Verkehrslasten: g F,Q<br />
= 1,50<br />
»»<br />
Linerwerkstoff, ungünstig wirkend: g M<br />
= 1,35 (Festigkeit)<br />
»»<br />
Linerwerkstoff, günstig wirkend: g M<br />
= 1,00<br />
(Steifigkeit bei AZ III)<br />
»»<br />
Bodengruppe G2, D Pr<br />
= 92 %:<br />
»»<br />
E 2<br />
= 8 N/mm² (A 127, Tab. 1)<br />
Erddruckbeiwert:<br />
K 2<br />
= 0,3 (A 127, Tab. 9)<br />
Verkehrslast:<br />
p T,k<br />
= 42 kN/m² (Diagramm 1d)<br />
Gesamtlast Scheitel:<br />
q v,d<br />
= 1,35 ∙ 0,75 ∙ 2,0 ∙ 20 + 1,5 ∙ 42,0 = 40,5 + 63,0<br />
= 103,5 kN/m²<br />
Horizontaler Erddruck (Kämpfer):<br />
q h,d<br />
= 1,35 ∙ 0,30 ∙ 1,08 ∙ (2,0 + 0,25) ∙ 20 = 19,7 kN/m²<br />
Rechnerischer Erddruckbeiwert:<br />
K 2<br />
‘ = 19,7 / 103,5 = 0,19 ≅ 0,2<br />
Beiwerte der Schnittgrößen M q<br />
und N q<br />
, Altrohrzustand III<br />
(Anhang E):<br />
ablesen bei t L,DN300<br />
= 10 ∙ 300 / 490 = 6,1 mm,<br />
max σ d<br />
σ bZ,d<br />
= 6,64<br />
20 / 1,35<br />
= 0,45 < 1 → Nachweis erfüllt<br />
Maximale Druckspannung (Linersohle, außen):<br />
s So,i<br />
=<br />
−1,52 111,8<br />
− 0,986⋅<br />
10 16,7<br />
= –0,15 – 6,60 = –6,75 N/mm²<br />
= min s d<br />
(6.20b)<br />
Nachweis gegen Versagen des Linerwerkstoffs durch Druck:<br />
minσ d<br />
σ D,d<br />
= 6,75<br />
25 / 1,35<br />
= 0,36 < 1 → Nachweis erfüllt<br />
9. AUSBLICK<br />
Bei DWA-Arbeitsblättern wird ein öffentliches Einspruchsverfahren<br />
durchgeführt, die Einspruchsfrist für das Arbeitsblatt<br />
DWA-A 143-2 endete am 1. Februar 2013. Zum Zeitpunkt<br />
des Erscheinens dieses Artikels werden die Einsprüche<br />
in der zuständigen DWA-Arbeitsgruppe 8.16 behandelt.<br />
Voraussichtlich Mitte 2013 ist dann mit der Veröffentlichung<br />
des Weißdruckes zu rechnen.<br />
Wie bereits bei der Bearbeitung des Merkblattes<br />
ATV-M 127-2 wurden auch für die 2. Auflage nationale und<br />
internationale Forschungsergebnisse mit einbezogen. Während<br />
der Treffen des „International Trenchless Technology<br />
Research Colloquium“ wurde auch das deutsche Verfahren<br />
vorgestellt – die Autoren danken den Teilnehmern für die<br />
offene Aussprache und konstruktive Kritik.<br />
Ferner danken die Autoren der DWA-Arbeitsgruppe ES 8.16<br />
für die intensive ehrenamtliche Mitarbeit bei der Erstellung<br />
des neuen Arbeitsblattes, dem DWA für die Betreuung der<br />
Arbeiten und den Stellungnehmenden für konstruktive Beiträge.<br />
Über eventuelle Änderungen, die sich aus der Behandlung<br />
der Stellungnahmen ergeben, wird gesondert berichtet.<br />
E 2<br />
= 8 N/mm² und q v,d<br />
= 103,5 kN/m²: (siehe Bild 2)<br />
m q<br />
@ +0,018<br />
(Diagramm E.2a)<br />
n q<br />
@ –0,06<br />
(Diagramm E.2b)<br />
34 03 / 2013
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
Jetzt bestellen!<br />
LITERATUR<br />
[1] EN ISO 14130 „Faserverstärkte Kunststoffe. Bestimmung<br />
der scheinbaren interlaminaren Scherfestigkeit nach dem<br />
Dreipunktverfahren mit kurzem Balken“ (1998)<br />
[2] ATV-M 127-2 „Statische Berechnung zur Sanierung<br />
von Abwasserkanälen und -leitungen mit Lining- und<br />
Montageverfahren“ (2000-01)<br />
[3] ATV-DVWK-A 127 „Statische Berechnung von Abwasserkanälen<br />
und -leitungen“ (2000-08)<br />
[4] Falter, B.; Hoch, A.; Wagner, V.: Hinweise und Kommentare zur<br />
Anwendung des Merkblattes ATV-M 127-2 für die statische<br />
Berechnung von Linern. Korrespondenz Abwasser 50 (2003) S.<br />
451-463<br />
[5] Falter, B.; Wolters, M.: (2008). Mindestüberdeckung und<br />
Belastungsansätze für flach überdeckte Abwasserkanäle (MIBAK).<br />
Kooperatives Forschungsprojekt IV-9-042 3E1, IV-7-042 3E1 0010,<br />
gefördert durch das MUNLV. http://www.hb.fh-muenster.de/opus/<br />
fhms/volltexte/2009/238/<br />
[6] DIN EN 14364 „Kunststoff-Rohrleitungssysteme für<br />
Abwasserleitungen und -kanäle mit oder ohne Druck –<br />
Glasfaserverstärkte duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis<br />
von ungesättigtem Polyesterharz (UP) – Festlegungen für Rohre,<br />
Formstücke und Verbindungen“ (2009)<br />
[7] DIN-Fachbericht 101 „Einwirkungen auf Brücken“ (2009)<br />
[8] DIN EN 1993-1-1 „Eurocode 3; Bemessung und Konstruktion von<br />
Stahlbauten. Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den<br />
Hochbau“ (2010)<br />
[9] Osterhues, F.: Scheiteldruckversuche mit Zeiteinfluss an GFK-<br />
Linern. Diplomarbeit, FH Münster, 2010<br />
[10] Falter, B.; Fingerhut, S.: Altrohrzustand und erforderliche<br />
Linerwanddicke. <strong>3R</strong> (2011) Nr. 7, S. 558-566<br />
[11] DWA-A 143-2 „Sanierung von Entwässerungssystemen<br />
außerhalb von Gebäuden. Teil 2: Statische Berechnung zur<br />
Sanierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit Lining- und<br />
Montageverfahren“ (Gelbdruck 2012-11)<br />
[12] DWA-M 144-3 „Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen<br />
(ZTV) für die Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb<br />
von Gebäuden. Teil 3: Renovierung mit Schlauchverfahren (vor<br />
Ort härtendes Schlauchlining) für Abwasserkanäle“ (2012-11)<br />
Sichere und effiziente<br />
Rohrleitungssysteme<br />
Nutzen Sie das Know-how der führenden Fachzeitschrift<br />
für die Entwicklung, den Einsatz und Betrieb von Rohrleitungen,<br />
Komponenten und Verfahren im Bereich der<br />
Gas- und Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung,<br />
der Nah- und Fernwärmeversorgung, des Anlagenbaus<br />
und der Pipelinetechnik.<br />
Wählen Sie einfach das Bezugsangebot, das Ihnen zusagt:<br />
als Heft, ePaper oder Heft + ePaper!<br />
Prof. Dr.-Ing. BERNHARD FALTER<br />
Fachhochschule Münster, Münster<br />
Tel. +49 251 8365-218<br />
E-Mail: falter@fh-muenster.de<br />
Prof. Dr.-Ing. VOLKER WAGNER<br />
Hochschule Wismar, Wismar<br />
Tel. +49 3841 753-490<br />
E-Mail: volker.wagner@hs-wismar.de<br />
AUTOREN<br />
<strong>3R</strong> erscheint in der Vulkan-Verlag GmbH, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen<br />
03 / 2013 35
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
Zulassungsverfahren für Errichtung<br />
und Betrieb von Rohrfernleitungen<br />
Teil 2: Rohrfernleitungen i.S.d. Ziffern 19.3 bis 19.8<br />
der Anlage 1 des UVPG<br />
Das Zulassungsverfahren für Gasversorgungsleitungen wurde in Ausgabe 1-2/2013 behandelt. In dieser Ausgabe geht<br />
es um das davon zu differenzierende Zulassungsverfahren für Rohrfernleitungen i.S.d. Ziffer 19.3 bis 19.8 der Anlage 1<br />
des UVPG, d.h. für Rohrfernleitungen zum Transport von wassergefährdenden Stoffen, zum Transport verflüssigter und<br />
nicht verflüssigter Gase, soweit nicht das EnWG einschlägig ist, zum Transport von Stoffen i.S.d. Chemikaliengesetzes,<br />
zum Transport von Dampf oder Warmwasser aus bestimmten Anlagen, sowie für Wasserfernleitungen. Das einschlägige<br />
Zulassungsverfahren ist in § 20 UVPG geregelt.<br />
Gem. § 20 Abs. 1 UVPG erfordern Errichtung und Betrieb von<br />
Rohrfernleitungen im Sinne der Ziffern 19.3 bis 19.8 der Anlage<br />
1 des UVPG – sowie die ab <strong>3R</strong>-Ausgabe 6/2013 zu behandelnde<br />
Änderung derartiger Rohrfernleitungen – eine Planfeststellung,<br />
sofern eine UVP-Pflicht besteht: „Vorhaben, die in der Anlage<br />
1 unter den Nummern 19.3 bis 19.9 aufgeführt sind, sowie<br />
die Änderung solcher Vorhaben bedürfen der Planfeststellung<br />
durch die zuständige Behörde, sofern dafür nach den §§<br />
3b bis 3f UVPG eine Verpflichtung zur Durchführung einer<br />
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.“<br />
Besteht keine UVP-Pflicht, entfällt das Erfordernis einer<br />
Planfeststellung aus § 20 Abs. 1 UVPG.<br />
Rohrfernleitungen i.S.d. Ziffern 19.3 bis 19.8 der Anlage<br />
1 des UVPG sind dann gem. § 20 Abs. 2 S. 1 UVPG<br />
grundsätzlich plangenehmigungspflichtig. Dies gilt für<br />
Errichtung und Betrieb von Rohrfernleitungen zum<br />
Befördern wassergefährdender Stoffe i.S.d. Ziffer 19.3 der<br />
Anlage 1 des UVPG gem. § 20 Abs. 2 S. 4 UVPG ohne<br />
Ausnahme. Für sonstige Rohrleitungen i.S.d. Ziffern 19.4<br />
bis 19.8 der Anlage 1 des UVPG gilt anderes, wenn es<br />
sich um Fälle von unwesentlicher Bedeutung i.S.d. § 20<br />
Abs. 2 S. 3 UVPG handelt, die vorliegen, wenn entweder<br />
bereits die Schwellenwerte einer Vorprüfung unterschritten<br />
werden oder öffentliche Belange nicht berührt werden<br />
oder die erforderlichen behördlichen Entscheidungen<br />
vorliegen und Rechte anderer nicht beeinflusst werden<br />
oder die Betroffenen sich mit einer Inanspruchnahme ihrer<br />
Rechte einverstanden erklärt haben; in diesem Fall entfällt<br />
das Plangenehmigungserfordernis gem. § 20 Abs. 2 S. 2<br />
UVPG. Das bedeutet:<br />
»»<br />
Eine Rohrfernleitung i.S.d. Ziffern 19.3 bis 19.8 der<br />
Anlage 1 des UVPG, die die Schwellenwerte der<br />
X-Kennzeichnung in Ziffern 19.3 bis 19.8 der Anlage<br />
1 erreicht und damit zwingend UVP-pflichtig ist oder<br />
die aufgrund Erreichens der Schwellenwerte einer<br />
Vorprüfpflicht nach behördlicher Vorprüfung eine UVP<br />
erfordert, ist planfeststellungspflichtig,<br />
»»<br />
eine Rohrfernleitung i.S.d. Ziffern 19.3 bis 19.8 der<br />
Anlage 1 des UVPG, die keine UVP erfordert, erfordert<br />
auch keine Planfeststellung,<br />
»»<br />
eine Rohrfernleitung zum Befördern wassergefährdender<br />
Stoffe i.S.d. Ziffer 19.3 der Anlage 1 des UVPG, die keine<br />
UVP und damit auch keine Planfeststellung erfordert,<br />
ist zwingend plangenehmigungspflichtig,<br />
»»<br />
eine Rohrfernleitung zum Befördern sonstiger Stoffe<br />
i.S.d. Ziffern 19.4 bis 19.8 der Anlage 1 des UVPG,<br />
die keine UVP erfordert, ist ebenfalls grundsätzlich<br />
plangenehmigungspflichtig, es sei denn, es handelt sich<br />
um einen Fall von unwesentlicher Bedeutung; Fälle von<br />
unwesentlicher Bedeutung sind plangenehmigungsfrei.<br />
1. UVP-ERFORDERNISSE GEM. ZIFFERN 19.3 BIS<br />
19.8 DER ANLAGE 1 DES UVPG<br />
Rohrfernleitungen zum Befördern wassergefährdender<br />
Stoffe, zum Befördern von Gasen, soweit sie nicht dem<br />
EnWG unterfallen und zum Befördern von Stoffen<br />
i.S.d. Chemikaliengesetzes (Ziffern 19.3 bis 19.6 der<br />
Anlage 1 des UVPG) sind unter der Voraussetzung, dass<br />
sie das Werksgelände überschreiten, teilweise längen- und/<br />
oder durchmesserabhängig aufgrund X-Kennzeichnung<br />
zwingend UVP-pflichtig und teilweise – ebenfalls längenund<br />
durchmesserabhängig – vorprüfpflichtig. Dampf- und<br />
Warmwasserpipelines sowie Wasserfernleitungen (Ziffern<br />
19.7 und 19.8 der Anlage 1 des UVPG) sind dagegen<br />
keinesfalls zwingend UVP-pflichtig, sondern längenabhängig<br />
vorprüfpflichtig.<br />
Rohrfernleitungsanlagen zum Befördern wassergefährdender<br />
Stoffe sind bei einer Länge > 40 km<br />
durchmesserunabhängig zwingend UVP-pflichtig (Ziffer<br />
19.3.1), bei geringeren Längen und einem Durchmesser von<br />
mehr als 150 mm dagegen längenabhängig allgemein oder<br />
standortbezogen vorprüfpflichtig (Ziffern 19.3.2 und 19.3.3);<br />
Rohrfernleitungen zum Befördern wassergefährdender<br />
Stoffe mit einer Länge von max. 40 km und einem<br />
36 03 / 2013
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
Durchmesser von max. 150 mm sind weder zwingend<br />
UVP-pflichtig noch vorprüfpflichtig. Rohrfernleitungen<br />
zum Befördern nicht verflüssigter Gase, die nicht unter das<br />
EnWG fallen, sowie Rohrfernleitungen zum Befördern von<br />
Stoffen i.S.d. Chemikaliengesetzes unterliegen denselben<br />
Schwellenwerten wie Gasversorgungsleitungen i.S.d. EnWG;<br />
die Schwellenwerte der Ziffern 19.5 und 19.6 entsprechen<br />
exakt denen der Ziffer 19.2 (siehe Teil 1 des Beitrags in<br />
<strong>3R</strong>, Ausgabe 1-2/2013, Seite 37). Rohrfernleitungen zum<br />
Befördern verflüssigter Gase i.S.d. Ziffer 19.4 unterliegen<br />
in etwa denselben Schwellenwerten wie Rohrfernleitungen<br />
zum Transport nicht verflüssigter Gase und von Stoffen<br />
i.S.d. Chemikaliengesetzes; anders als in Ziffern 19.2 und<br />
19.5 sowie 19.6 der Anlage 1 des UVPG geregelt, greifen<br />
die Schwellenwerte einer Vorprüfung für Rohrfernleitungen<br />
zum Transport verflüssigter Gase allerdings bereits ab einem<br />
Durchmesser von mehr als 150 mm (Ziffern 19.4.2 bis 19.4.4)<br />
und ist eine allgemeine Vorprüfung in Abgrenzung zu einer<br />
standortbezogenen Vorprüfung bereits bei einer Länge ab 2<br />
km bis 40 km erforderlich (Ziffer 19.4.3) 1 . Rohrfernleitungen<br />
zum Befördern von Dampf oder Warmwasser von Anlagen<br />
i.S.d. Ziffern 1 bis 10 der Anlage 1 des UVPG unterliegen<br />
bei einer Länge von 5 km oder mehr außerhalb des<br />
Werksgeländes einer allgemeinen Vorprüfung (Ziffer<br />
19.7.1) und bei einer Länge von weniger als 5 km einer<br />
standortbezogenen Vorprüfung, wenn die Rohrleitung sich<br />
im Außenbereich befindet (Ziffer 19.7.2); Rohrfernleitungen<br />
zum Befördern von Dampf oder Warmwasser mit einer<br />
Länge von weniger als 5 km im Innenbereich sind damit<br />
keinesfalls UVP-pflichtig. Wasserfernleitungen, d.h.<br />
Rohrfernleitungen zum Befördern von Wasser, die das<br />
Gelände einer Gemeinde überschreiten, unterliegen bei<br />
einer Länge von 10 km oder mehr einer allgemeinen<br />
Vorprüfung (Ziffer 19.8.1) und bei einer Länge von 2 bis<br />
weniger als 10 km einer standortbezogenen Vorprüfung<br />
(Ziffer 19.8.2); Rohrfernleitungen zum Befördern von<br />
Wasser, die das Gebiet einer Gemeinde nicht überschreiten,<br />
sind mangels Erfüllung der definitorischen Voraussetzungen<br />
einer Wasserfernleitung keinesfalls UVP-pflichtig, ebenso<br />
wie Wasserfernleitungen mit einer Länge von weniger als<br />
2 km keinesfalls UVP-pflichtig sind.<br />
Im Übrigen kann auf die Ausführungen des ersten Teils<br />
dieses Beitrags in <strong>3R</strong>, Ausgabe 1-2/2013, S. 37 verwiesen<br />
werden. Auch im Falle von Rohrfernleitungen i.S.d. Ziffern<br />
19.3 bis 19.8 der Anlage 1 des UVPG ist die Kumulation<br />
mehrerer Vorhaben gem. § 3b Abs. 2 UVPG zu prüfen, kann<br />
eine durch X-Kennzeichnung vorgegebene zwingende UVP<br />
nicht überregelt werden und richten sich die Anforderungen<br />
einer allgemeinen oder standortbezogenen Vorprüfung<br />
nach § 3c UVPG.<br />
1 Die Schwellenwerte für Rohrfernleitungen zum Befördern<br />
verflüssigter Gase sind geringer als die für Rohrfernleitungen zum<br />
Befördern gasförmiger Stoffe, da der Gesetzgeber verflüssigten<br />
Gasen im Schadensfalls ein höheres Freisetzungspotenzial zumisst,<br />
vgl. BT-Drs. 14/4599, S. 123<br />
2. PLANFESTSTELLUNGSERFORDERNIS<br />
Rohrfernleitungen i.S.d. Ziffern 19.3 bis 19.8 der<br />
Anlage 1 des UVPG, die entweder aufgrund Erreichens<br />
der Schwellenwerte der X-Kennzeichnung oder<br />
aufgrund Erreichens der Schwellenwerte der A- oder<br />
S-Kennzeichnung nach einer behördlichen Vorprüfung eine<br />
UVP erfordern, sind gem. § 20 Abs. 1 UVPG zwingend<br />
planfeststellungspflichtig. Das Planfeststellungsverfahren<br />
ist in diesem Fall unentbehrlich.<br />
Rohrfernleitungen i.S.d. Ziffern 19.3 bis 19.8 der Anlage<br />
1 des UVPG, die nicht UVP-pflichtig sind, weil sie<br />
entweder bereits die Schwellenwerte einer Vorprüfpflicht<br />
unterschreiten oder die Behörde im Rahmen einer<br />
Vorprüfung zu dem Ergebnis kommt, dass das Vorhaben<br />
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen<br />
erwarten lässt, erfordern dagegen mangels Erfassung<br />
durch § 20 Abs. 1 UVPG keine Planfeststellung; die<br />
Planfeststellungspflicht von Rohrfernleitungen i.S.d. Ziffern<br />
19.3 bis 19.8 der Anlage 1 des UVPG ist damit – anders als<br />
die Planfeststellungspflicht von Gasversorgungsleitungen<br />
i.S.d. EnWG mit einem Durchmesser von mehr als 300 mm<br />
– allein von der UVP-Pflicht abhängig. Nicht UVP-pflichtige<br />
Rohrfernleitungen i.S.d. Ziffern 19.3 bis 19.8 der Anlage 1<br />
des UVPG sind unter den Voraussetzungen des § 20 Abs.<br />
2 UVPG allenfalls plangenehmigungspflichtig.<br />
»»<br />
Rohrfernleitungen i.S.d. Ziffern 19.3 bis 19.8 der Anlage<br />
1 des UVPG sind im Falle einer UVP-Pflicht gem. § 20<br />
Abs. 1 UVPG zwingend planfestzustellen,<br />
»»<br />
nicht UVP-pflichtige Rohrfernleitungen i.S.d. Ziffern<br />
19.3 bis 19.8 der Anlage 1 des UVPG sind keinesfalls<br />
planfestzustellen, sondern unter den Voraussetzungen<br />
des § 20 Abs. 2 UVPG ggf. plangenehmigungspflichtig.<br />
3. PLANGENEHMIGUNGSERFORDERNIS<br />
Gem. § 20 Abs. 2 S. 1 UVPG bedürfen Rohrfernleitungen<br />
i.S.d. Ziffern 19.3 bis 19.8 der Anlage 1 des UVPG,<br />
für die keine UVP-Pflicht besteht, grundsätzlich<br />
einer Plangenehmigung. Diese Grundsatzregelung<br />
wird jedoch durch § 20 Abs. 2 S. 2 u. 3 UVPG<br />
eingeschränkt. Gem. § 20 Abs. 2 S. 2 UVPG entfällt das<br />
Plangenehmigungserfordernis in Fällen unwesentlicher<br />
Bedeutung, die bei Rohrfernleitungen i.S.d. Ziffern 19.4<br />
bis 19.8 der Anlage 1 des UVPG vorliegen können,<br />
nicht aber bei Rohrfernleitungen zum Befördern<br />
wassergefährdender Stoffe i.S.d. Ziffer 19.3 der Anlage 1<br />
des UVPG. Errichtung und Betrieb von Rohrfernleitungen<br />
zum Befördern wassergefährdender Stoffe sind gem. §<br />
20 Abs. 2 S. 4 UVPG dann, wenn eine UVP und damit<br />
eine Planfeststellung i.S.d. § 20 Abs. 1 UVPG entbehrlich<br />
ist, zwingend plangenehmigungspflichtig. Eine Ausnahme<br />
von der Plangenehmigungspflicht als Mindestanforderung<br />
ist auch in Fällen von Errichtung und Betrieb kleiner<br />
Rohrfernleitungen zum Befördern wassergefährdender<br />
Stoffe nicht möglich; zu der schwierigen Beurteilung<br />
von Änderungen von Rohrfernleitungen zum Befördern<br />
wassergefährdender Stoffe wird in einer nachfolgenden<br />
Veröffentlichung ausgeführt.<br />
03 / 2013 37
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK<br />
Zulassungserfordernisse von Errichtung und Betrieb einer Rohrfernleitung<br />
i.S.d. Ziffern 19.3 bis 19.8 der Anlage 1 des UVPG<br />
Planung <br />
Rohrfernleitungsanlage<br />
UVP-Pflicht?<br />
Nein<br />
Art der RFL<br />
Bedeutung<br />
RFL zum Befördern wassergefährdender<br />
Stoffe i.S.d. Ziffer<br />
19.3 der Anlage 1 des UVPG<br />
Rohrfernleitung i.S.d. Ziffern 19.4 bis<br />
19.8 der Anlage 1 des UVPG<br />
Unwesentlich<br />
gem. § 20 Abs. 2 S. 2 UVPG kein<br />
Plangenehmigungserfordernis<br />
Wesentlich<br />
Bild 1: Zulassungserfordernisse von Errichtung und Betrieb einer<br />
Rohrfernleitung i.S.d. Ziffern 19.3 bis 19.8 der Anlage 1 des UVPG<br />
Ja<br />
Planfeststellung<br />
gemäß § 20 Abs. 1 UVPG <br />
Plangenehmigung<br />
gem. § 20 Abs. 2 S. 1 u. 4 UVPG <br />
Plangenehmigung<br />
gem. § 20 Abs. 2 S. 1 UVPG<br />
»»<br />
Rohrfernleitungen zum Befördern wassergefährdender<br />
Stoffe i.S.d. Ziffer 19.3 der Anlage 1 des UVPG<br />
sind, wenn sie nicht aufgrund UVP-Pflicht<br />
planfeststellungspflichtig sind, immer und ohne<br />
Ausnahme plangenehmigungspflichtig.<br />
4. ENTFALL VON PLANFESTSTELLUNG UND<br />
PLANGENEHMIGUNG<br />
Alle anderen Rohrfernleitungen i.S.d. Ziffern 19.4<br />
bis 19.8 der Anlage 1 des UVPG sind in Fällen<br />
unwesentlicher Bedeutung von einem Planfeststellungsund<br />
Plangenehmigungserfordernis befreit. Um Fälle<br />
unwesentlicher Bedeutung wiederum handelt es sich gem.<br />
§ 20 Abs. 2 S. 3 UVPG dann, wenn ein Vorhaben bereits<br />
die Schwellenwerte, die eine Vorprüfung eröffnen, nicht<br />
erreicht und dann, wenn die allgemein zum Entfall des<br />
Planfeststellungs- und Plangenehmigungserfordernisses<br />
führenden Voraussetzungen des § 74 Abs. 7 S. 2 VwVfG<br />
erfüllt sind. Diese Anforderungen sind nicht kumulativ<br />
zu erfüllen, so dass sowohl bei einer Unterschreitung<br />
der Schwellenwerte der Vorprüfung als auch bei einer<br />
Überschreitung der Schwellenwerte der Vorprüfung aber<br />
Erfüllung der Anforderungen des § 74 Abs. 7 S. 2 VwVfG das<br />
Plangenehmigungserfordernis entfällt. Zu beachten ist, dass<br />
die Prüfung einer unwesentlichen Bedeutung kumulierende<br />
Vorhaben gem. § 3b Abs. 2 UVPG einbeziehen muss.<br />
Damit sind zum einen Rohrfernleitungen, die die<br />
Schwellenwerte der Vorprüfung nicht erreichen, ohne<br />
weitere Anforderungen plangenehmigungsfrei. Dies sind:<br />
»»<br />
Rohrfernleitungen zum Befördern nicht<br />
verflüssigter Gase i.S.d. Ziffer 19.5 sowie<br />
Rohrfernleitungen zum Befördern von<br />
Stoffen des Chemikaliengesetzes i.S.d.<br />
Ziffer 19.6, die – längenunabhängig – einen<br />
Durchmesser von max. 300 mm aufweisen,<br />
»»<br />
Rohrfernleitungen zum Befördern<br />
verflüssigter Gase i.S.d. Ziffer 19.4, die –<br />
längenunabhängig – einen Durchmesser<br />
von max. 150 mm aufweisen,<br />
»»<br />
Rohrfernleitungen zum Befördern von<br />
Dampf oder Warmwasser i.S.d. Ziffer<br />
19.7, die eine Länge von weniger als 5<br />
km aufweisen und nicht im Außenbereich<br />
verlaufen,<br />
»»<br />
Wasserfernleitungen i.S.d. Ziffer 19.8, die<br />
eine Länge von weniger als 2 km aufweisen.<br />
Auch wenn diese Kriterien, d.h. eine<br />
Unterschreitung der Schwellenwerte einer<br />
Vorprüfpflicht, nicht erfüllt sind, kann es<br />
sich bei Vorhaben i.S.d. Ziffern 19.4 bis<br />
19.8 der Anlage 1 des UVPG, die zwar die<br />
Schwellenwerte einer Vorprüfung erreichen,<br />
aber auf Grundlage der dann erforderlichen<br />
behördlichen Vorprüfung keine erheblichen<br />
nachteiligen Umweltauswirkungen erwarten<br />
lassen und daher keine UVP erfordern, um<br />
Fälle unwesentlicher Bedeutung handeln,<br />
wenn die Voraussetzungen des § 74 Abs. 7 S. 2 VwVfG<br />
erfüllt sind. Insoweit kann auf die Ausführungen in <strong>3R</strong>,<br />
Ausgabe 1-2/2013, S. 40, Punkt 4. verwiesen werden.<br />
»»<br />
Plangenehmigungsfrei sind auch Rohrfernleitungen i.S.d.<br />
Ziffern 19.4 bis 19.8 der Anlage 1 des UVPG, die die<br />
Schwellenwerte einer Vorprüfung erreichen, aber aufgrund<br />
behördlicher Vorprüfung keine UVP erfordern und die<br />
Voraussetzungen des § 74 Abs. 7 S. 2 VwVfG erfüllen.<br />
Die Plangenehmigungsfreiheit in Fällen unwesentlicher<br />
Bedeutung ist ein gesetzlicher Automatismus. Dies setzt<br />
weder einen Antrag des Vorhabenträgers voraus, noch<br />
steht der Behörde eine Ermessensentscheidung darüber<br />
zu, ob sie in Fällen unwesentlicher Bedeutung von einem<br />
Plangenehmigungsverfahren absieht oder nicht.<br />
Im Übrigen gilt auch hier, wie bereits unter Punkt 4 im<br />
Teil 1 des Beitrags (<strong>3R</strong>-Ausgabe 1-2/2013) ausgeführt,<br />
dass ein Vorhaben, das weder einer Planfeststellung<br />
noch einer Plangenehmigung mit Konzentrationswirkung<br />
bedarf, daraufhin zu überprüfen ist, ob es sonstigen<br />
Zulassungserfordernissen anderer Gesetze unterliegt.<br />
Zudem greift ggf. das Anzeigeerfordernis aus § 4a<br />
RohrFltgV. Rohrfernleitungen i.S.d. Ziffern 19.4 bis 19.6<br />
der Anlage 1 des UVPG, die nach Maßgabe des § 20 Abs.<br />
2 S. 2 u. 3 UVPG weder einer Planfeststellung noch einer<br />
Plangenehmigung bedürfen, unterliegen dann, wenn sie<br />
dem Anwendungsbereich der Rohrfernleitungsverordnung<br />
unterfallen, seit dem 01.03.2010 einem Anzeigeverfahren<br />
gem. § 4a Abs. 1 RohrFltgV. Für Rohrfernleitungen<br />
i.S.d. Ziffer 19.3 der Anlage 1 des UVPG zum Befördern<br />
38 03 / 2013
RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
wassergefährdender Stoffe kommt dem Anzeigeverfahren<br />
gem. § 4a RohrFltgV keine alleinige Bedeutung zu, da<br />
Errichtung und Betrieb von Rohrfernleitungen zum Befördern<br />
wassergefährdender Stoffe gem. § 20 Abs. 2 S. 4 UVPG<br />
ohnehin mindestens plangenehmigungsbedürftig, wenn<br />
nicht planfeststellungspflichtig sind. Auf Rohrfernleitungen<br />
i.S.d. Ziffern 19.7 und 19.8 der Anlage 1 des UVPG findet<br />
die Rohrfernleitungsverordnung gem. § 2 Abs. 2 S. 1 Nr. 2<br />
bei Unterschreitung der Schwellenwerte der Vorprüfung<br />
keine Anwendung.<br />
ZUSAMMENFASSUNG<br />
Ebenso wie Zulassungen von Gasversorgungsleitungen<br />
i.S.d. EnWG mit einem Durchmesser von mehr als 300<br />
mm bewegen sich auch die erforderlichen Zulassungen<br />
von Rohrfernleitungen i.S.d. Ziffern 19.3 bis 19.8 der<br />
Anlage 1 des UVPG von einer Planfeststellung – mit<br />
Öffentlichkeitsbeteiligung – über eine Plangenehmigung –<br />
ohne Öffentlichkeitsbeteiligung – bis zu der vollständigen<br />
Entbehrlichkeit von Planfeststellung und Plangenehmigung<br />
mit der Folge des eventuellen Erfordernisses sonstiger<br />
Anzeigen und Zulassungen. Während allerdings<br />
Gasversorgungsleitungen mit einem Durchmesser von<br />
mehr als 300 mm – vorbehaltlich der Ausnahmeregelungen<br />
des § 43b Nr. 2 EnWG sowie des § 74 Abs. 7 VwVfG – im<br />
Grundsatz immer eine Planfeststellung erfordern, gilt dies für<br />
Rohrfernleitungen i.S.d. Ziffern 19.3 bis 19.8 der Anlage 1 des<br />
UVPG nicht. Diese sind nur dann planfeststellungspflichtig,<br />
wenn sie gemessen an den einschlägigen Schwellenwerten<br />
und einer ggf. durchzuführenden behördlichen Vorprüfung<br />
eine UVP erfordern. Anderenfalls, bei Entbehrlichkeit einer<br />
UVP, sind Rohrfernleitungen i.S.d. Ziffern 19.3 bis 19.8 der<br />
Anlage 1 des UVPG allenfalls plangenehmigungspflichtig<br />
und auch dies nicht in Fällen unwesentlicher Bedeutung,<br />
die zwingend vorliegen, wenn bereits die Schwellenwerte<br />
einer Vorprüfung unterschritten werden oder anderenfalls<br />
die Voraussetzungen des § 74 Abs. 7 S. 2 VwVfG erfüllt sind.<br />
Eine Ausnahme davon gilt für Errichtung und Betrieb von<br />
Rohrfernleitungen zum Befördern wassergefährdender Stoffe,<br />
die der Gesetzgeber nicht zulassungsfrei stellt, sondern die<br />
immer mindestens eine Plangenehmigung erfordern.<br />
Weitere Besonderheiten des Zulassungsverfahrens gelten<br />
für Rohrleitungen, die einem Bergbaubetrieb dienen<br />
und für Transit-Rohrleitungen, die bergrechtlichen<br />
Verfahren unterliegen, sowie für Kohlendioxidleitungen,<br />
die von dem am 24.08.2012 in Kraft getretenen<br />
Kohlendioxidspeichergesetz erfasst werden. Dazu wird in<br />
Ausgabe 4-5/2013 ausgeführt.<br />
Themenübersicht 2013<br />
Zulassungsverfahren für Errichtung und Betrieb von Rohrfernleitungen<br />
- Teil 1: Gasversorgungsleitungen im Sinne des EnWG<br />
<strong>3R</strong>, Ausgabe 1-2/2013, S. 36-41<br />
Zulassungsverfahren für Errichtung und Betrieb von Rohrfernleitungen -<br />
Teil 2: Rohrfernleitungen i.S.d. Ziffern 19.3 bis 19.8 der Anlage 1 des UVPG<br />
<strong>3R</strong>, Ausgabe 3/2013, S. 36-39<br />
Zulassungsverfahren für Errichtung und Betrieb von Rohrfernleitungen<br />
- Teil 3: Anforderungen des Bundesberggesetzes (BBergG) und des<br />
Kohlendioxidspeichergesetzes (KSpG)<br />
<strong>3R</strong>, Ausgabe 4-5/2013, Erscheinungstermin 8. April 2013<br />
Änderung von Rohrfernleitungen - Teil 1: Zulassungserfordernisse<br />
und Zulassungsverfahren<br />
<strong>3R</strong>, Ausgabe 6/2013, Erscheinungstermin 10. Juni 2013<br />
Änderung von Rohrfernleitungen - Teil 2: Die UVP-Relevanz von<br />
Änderungen<br />
<strong>3R</strong>, Ausgabe 7-8/2013, Erscheinungstermin 13. August 2013<br />
Änderung von Rohrfernleitungen - Teil 3: Die Änderung von<br />
Rohrfernleitungen zum Befördern wassergefährdender Stoffe, § 20<br />
Abs. 2 S. 4 UVPG<br />
<strong>3R</strong>, Ausgabe 9/2013, Erscheinungstermin 16. September 2013<br />
Konversion - Wo verläuft die Grenze zwischen Änderung und Aliud?<br />
<strong>3R</strong>, Ausgabe 10/2013, Erscheinungstermin 15. Oktober 2013<br />
Rechtliche Konsequenzen von Fehlern des Zulassungsverfahrens<br />
<strong>3R</strong>, Ausgabe 11-12/2013, Erscheinungstermin 12. November 2013<br />
Dr. BETTINA KEIENBURG<br />
Kümmerlein Rechtsanwälte & Notare, Essen<br />
Tel. +49 201 1756 624<br />
E-Mail: bettina.keienburg@kuemmerlein.de<br />
Dr. MICHAEL NEUPERT<br />
Kümmerlein Rechtsanwälte & Notare, Essen<br />
Tel. +49 201 1756 624<br />
AUTOREN<br />
E-Mail: michael.neupert@kuemmerlein.de<br />
Besuchen Sie uns im Internet:<br />
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
03 / 2013 39
FACHBERICHT RECHT & REGELWERK RECHT & REGELWERK<br />
DWA-Regelwerk<br />
Merkblatt DWA-M 115-1: Indirekteinleitung nicht häuslichen Abwassers<br />
Teil 1: Rechtsgrundlagen<br />
NEUERSCHEINUNG<br />
Ausgabe 2/2013, 12 Seiten, ISBN 978-3-942964-26-5, Ladenpreis: 22,00 Euro, fördernde DWA-Mitglieder: 17,60 Euro<br />
Gewerbe- und Industrieunternehmen, die ihr Abwasser<br />
in eine kommunale Abwasseranlage einleiten, müssen<br />
neben dem wasserrechtlichen Regelungsregime (Wasserhaushaltsgesetz,<br />
Abwasserverordnung) die Vorgaben<br />
kommunaler Entwässerungs- bzw. Abwassersatzungen<br />
beachten, in denen die Gemeinden bzw. Zweckverbände<br />
die Inanspruchnahme ihrer Abwasseranlagen regeln. Das<br />
aktualisierte Merkblatt DWA-M 115-1 enthält Hinweise<br />
und Empfehlungen zur Gestaltung kommunaler Entwässerungs-/<br />
Abwassersatzungen.<br />
Im Merkblatt werden die zu berücksichtigenden Rechtsgrundlagen<br />
und die wesentlichen Regelungen dargestellt,<br />
die für Indirekteinleiter in der kommunalen Entwässerungssatzung<br />
zu treffen sind. Das Merkblatt wurde im<br />
Hinblick auf die umfassende Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes<br />
(WHG) mit Wirkung zum 1. März 2010<br />
aktualisiert. Während die Anforderungen für das Einleiten<br />
von Abwasser in Gewässer mit in Wesentlichem gleichen<br />
Inhalt in § 57 WHG geregelt worden sind, enthält § 58<br />
WHG gegenüber dem bisherigen Bundesrecht umfassendere<br />
Regelungen für das Einleiten von Abwasser in<br />
öffentliche Abwasseranlagen. Diese Vorschrift, die unverändert<br />
sicherstellen soll, dass bei den Indirekteinleitungen<br />
grundsätzlich auch die nach § 57 WHG maßgebenden<br />
Anforderungen nach dem in § 3 Nr. 11 WHG definierten<br />
Stand der Technik eingehalten werden, regelt nunmehr<br />
in Absatz 1 und 2 die bisher nach Landesrecht bestandene<br />
Genehmigungspflicht und die Voraussetzungen für<br />
die Genehmigungserteilung und in Absatz 3 die Anpassungspflicht<br />
für vorhandene Indirekteinleitungen, die<br />
den Anforderungen nicht entsprechen. Neu ist die in<br />
§ 59 Abs. 1 WHG getroffene Bestimmung, dass dem<br />
Einleiten von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen<br />
Abwassereinleitungen Dritter in private Abwasseranlagen<br />
gleichstehen, die der Beseitigung von gewerblichem<br />
Abwasser dienen. Dabei können gemäß Absatz 2 diese<br />
Abwassereinleitungen von der Genehmigungsbedürftigkeit<br />
freigestellt werden, wenn durch vertragliche Regelungen<br />
zwischen dem Betreiber der privaten Abwasseranlage<br />
und dem Einleiter die Einhaltung der Anforderungen nach<br />
§ 58 Absatz 2 sichergestellt ist.<br />
Das Merkblatt richtet sich an Betreiber öffentlicher<br />
Abwasseranlagen, an Indirekteinleiter nicht häuslichen<br />
Abwassers, örtlich zuständige Behörden sowie Anlagenplaner<br />
und -hersteller. Ziel ist es, die Allgemeinheit<br />
sowie das Personal von Abwasseranlagen vor Gefahren zu<br />
schützen, den Bestand von Abwasseranlagen zu sichern,<br />
ihre optimale Funktionsfähigkeit zu gewährleisten, die<br />
wasserrechtlichen Vorgaben einzuhalten und Belastungen<br />
des anfallenden Klärschlamms zu vermeiden.<br />
Merkblatt DWA-M 115-2: Indirekteinleitung nicht häuslichen<br />
Abwassers Teil 2: Anforderungen<br />
NEUERSCHEINUNG<br />
Ausgabe 2/2013, 21 Seiten, ISBN 978-3-942964-27-2, Ladenpreis: 29,00 Euro, fördernde DWA-Mitglieder: 23,20 Euro<br />
Gewerbe- und Industrieunternehmen müssen die Vorgaben<br />
der kommunalen Entwässerungs-/Abwassersatzung<br />
beachten, wenn sie Abwässer in eine kommunale<br />
Abwasseranlage einleiten. Im zweiten Teil der<br />
DWA-Merkblattreihe 115 werden Hinweise und Empfehlungen<br />
zu Anforderungen an die Einleitung nicht<br />
häuslichen Abwassers in öffentliche Abwasseranlagen<br />
gegeben.<br />
Das Merkblatt gibt für wesentliche Abwasserparameter<br />
Richtwerte für Grenzkonzentrationen an, die sich auf<br />
den Übergabepunkt in die öffentliche Abwasseranlage<br />
beziehen. Um dem Satzungsgeber mehr Möglichkeiten<br />
für eine den örtlichen Gegebenheiten angepasste<br />
Ausgestaltung der Benutzungsbedingungen für die<br />
öffentliche Abwasseranlage aufzuzeigen, werden hierzu<br />
ausführliche Hinweise zur Verfügung gestellt. Ergänzend<br />
werden zu jedem Parameter die anzuwendenden<br />
Untersuchungsverfahren benannt.<br />
Der zweite Teil der Merkblattreihe ergänzt den ebenfalls<br />
aktualisierten Teil 1 „Rechtsgrundlagen“, der Hinweise<br />
und Empfehlungen zur Gestaltung kommunaler Entwässerungs-/Abwassersatzungen<br />
enthält.<br />
Das Merkblatt richtet sich an Betreiber öffentlicher<br />
Abwasseranlagen, an Indirekteinleiter nicht häuslichen<br />
Abwassers, örtlich zuständige Behörden sowie Anlagenplaner<br />
und -hersteller.<br />
Ziel des Merkblatts ist es, die Allgemeinheit sowie das<br />
Personal von Abwasseranlagen vor Gefahren zu schützen,<br />
den Bestand von Abwasseranlagen zu sichern, ihre<br />
optimale Funktionsfähigkeit zu gewährleisten, die wasserrechtlichen<br />
Vorgaben einzuhalten und Belastungen<br />
des anfallenden Klärschlamms zu vermeiden.<br />
40 03 / 2013
RECHT & REGELWERK RECHT & FACHBERICHT REGELWERK<br />
NEUERSCHEINUNG<br />
Entwurf Merkblatt<br />
DWA-M 149-8:<br />
Zustandserfassung<br />
AUFRUF ZUR<br />
STELLUNGNAHME<br />
und -beurteilung von Entwässerungssystemen<br />
außerhalb von Gebäuden. Teil 8:<br />
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen<br />
(ZTV) – Optische <strong>Inspektion</strong><br />
Ausgabe 2/2013, 29 Seiten, ISBN 978-3-942964-85-2,<br />
Ladenpreis: 35,00 Euro, fördernde DWA-Mitglieder:<br />
28,00 Euro<br />
Die optische <strong>Inspektion</strong> von Abwasserleitungen<br />
und -kanälen ist Grundlage für<br />
deren Zustandsbewertungen und für die<br />
Planung eventuell zu ergreifender Maßnahmen.<br />
Eindeutige Formulierungen<br />
der auftragsbezogenen Anforderungen<br />
durch den Auftraggeber sind Voraussetzung<br />
für die Wirtschaftlichkeit und Qualität der zu<br />
erzielenden <strong>Inspektion</strong>sergebnisse.<br />
Die erarbeiteten ZTV liefern den Vertragspartnern auf<br />
Auftraggeber- wie Auftragnehmerseite ergänzend zur<br />
Leistungsbeschreibung und zu den Besonderen Vertragsbedingungen<br />
ein strukturiertes Anforderungsprofil für die<br />
Ausführung der beauftragten Arbeiten. Die ZTV enthalten<br />
feste, unveränderliche Texte, die durch Auswahlfelder<br />
und/oder zusätzliche, Auftraggeber spezifische Texteingaben<br />
ergänzt und auf das konkrete <strong>Inspektion</strong>svorhaben<br />
angepasst werden können. Für Auftraggeber stellen die<br />
ZTV eine Hilfe dar, die zu beschreibenden Anforderungen<br />
eindeutig zu formulieren. Gleichzeitig unterstützen sie<br />
Bieter bei der Angebotskalkulation sowie Auftragnehmer<br />
und Inspekteure bei der Ausführung durch eine erleichterte<br />
Erfassung der vom Auftraggeber geforderten technischen<br />
Standards. Die Anhänge A bis E des Merkblatts sind<br />
informativ und nicht Bestandteil der ZTV. Sie weisen auf<br />
weitere Inhalte in den Vergabe- und Vertragsunterlagen<br />
hin, z. B. auf Anforderungen an die Auswahl geeigneter<br />
Unternehmen und den Umfang von Vorhabensbeschreibungen<br />
und Projekteinweisungen des Auftragnehmers.<br />
Die ZTV lassen Anwendungen im Vertrag nach VOL und<br />
nach VOB zu. Es ist zu beachten, dass beim VOL-Vertrag<br />
die VOB/C ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen<br />
für Bauarbeiten jeder Art“ nicht automatisch (per se)<br />
zur Anwendung kommt. Beim VOL-Vertrag kann die<br />
VOB/C ATV DIN 18299 jedoch sinngemäß angewandt<br />
werden. Das Merkblatt richtet sich an alle im Bereich<br />
der Sanierung von Entwässerungssystemen planenden,<br />
betreibenden sowie Aufsicht führenden Institutionen<br />
sowie an Sanierungsfirmen.<br />
Das Merkblatt DWA-M 149-8 wird bis zum 30. April<br />
2013 öffentlich zur Diskussion gestellt. Stellungnahmen<br />
bitte schriftlich an die DWA-Bundesgeschäftsstelle,<br />
Dipl.-Ing. Christian Berger, E-Mail: berger@dwa.de<br />
NEUERSCHEINUNG<br />
03 / 2013 41
FACHBERICHT SPECIAL: INSPEKTION & GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNG<br />
Ein neues Messsystem zur<br />
Verlaufsbestimmung von gekrümmten<br />
Haltungen<br />
EINFÜHRUNG<br />
Die geometrisch exakte und lagerichtige Dokumentation<br />
von Haltungsverläufen ist essentielle Voraussetzung für<br />
weiterführende Planungen innerhalb von Kanalnetzen.<br />
Dies wird umso wichtiger, wenn an vorhandene<br />
Haltungen eine anschließende Erfassung der<br />
<strong>Grundstücksentwässerung</strong>sanlagen (GEA) erfolgen soll. Die<br />
Städte und Kommunen haben in den letzten Jahrzehnten<br />
die Datenqualität der Kanalnetze durch terrestrische<br />
Vermessung der Schachtbauwerke gesteigert. Dabei<br />
wurden sämtliche Zu- und Abläufe zentimetergenau in<br />
Lage und Höhe bestimmt. Dagegen entsteht der Verlauf<br />
einer Haltung meist durch CAD-Konstruktionen zwischen<br />
den vermessenen Schachtpunkten.<br />
Im Idealfall einer geradlinigen Verbindung zwischen zwei<br />
Schächten führt dies zu ausreichenden Ergebnissen.<br />
Bei kreis- oder bogenförmigen Verläufen reichen die<br />
Informationen – meist aus analogen Planunterlagen<br />
entnommen – jedoch nicht mehr aus, um einen lagerichtigen<br />
Verlauf zu konstruieren. Die so entstandenen Unsicherheiten<br />
können mehrere Meter aufweisen.<br />
Da nur in seltenen Fällen vermessungstechnisch erfasste<br />
Haltungsverläufe aus der Bauzeit vorliegen, muss die<br />
Vermessung nachträglich, aus der Haltung heraus,<br />
erfolgen. Die bekannten terrestrischen Methoden scheiden<br />
aus mehreren Gründen aus: Zu nennen sind hier die<br />
Wirtschaftlichkeit, die Umgebungsbedingungen, sowie<br />
der geringe Querschnitt < DN 1000, der eine Begehung<br />
nicht mehr ermöglicht.<br />
In einer gemeinsamen Entwicklung der Firmen JT-elektronik<br />
und PPMsys gelang es, dieses Defizit mittels inertialer<br />
Messtechnik zu lösen. Die hierzu erforderliche Sensorik<br />
wurde vollständig in die bewährte Fahrwagenkonstruktion<br />
von JT-elektronik integriert (Bild 1).<br />
Von der Sensorsteuerung über die Datenerfassung bis<br />
zur Berechnung des gewünschten dreidimensionalen<br />
Haltungsverlaufs wurden die langjährigen Erfahrungen<br />
des Systems geoASYS genutzt und entsprechend<br />
weiterentwickelt. Die Firma PPMsys entwickelt und erprobt<br />
derzeit die Software zur automatischen Vermessung von<br />
beliebig gekrümmten Haltungen.<br />
Für die Genauigkeit des Haltungsverlaufs wird, bei<br />
bekanntem Anfangs- und Endpunkt, eine maximale<br />
Lageabweichung in der Größenordnung der Breite der<br />
Haltungsrinne angestrebt. Nach ersten erfolgreichen Tests<br />
auf einem Versuchsgelände von JT-elektronik konnte das<br />
System einem ersten Praxistest in Regensburg unterzogen<br />
werden, über den im Folgenden berichtet wird.<br />
PRAXISTEST IN REGENSBURG<br />
Das Regensburger Kanalnetz weist zahlreiche gekrümmte<br />
Haltungen auf. Die Stadt Regensburg sucht deshalb seit<br />
längerem nach Möglichkeiten zur exakten geometrischen<br />
Erfassung solcher Haltungen und erklärte sich bereit, einen<br />
Testkanal auszuwählen und zur Verfügung zu stellen.<br />
Das Testgebiet enthielt insgesamt zwei Haltungen mit<br />
bekannter bzw. vermuteter Kreisbogengeometrie mit einer<br />
Gesamtlänge von ca. 210 m (Bild 2).<br />
1. Untersuchungsaspekt<br />
Der erste Test wurde in der kreisbogenförmig bekannten<br />
Haltung durchgeführt (Bild 3).<br />
Die Koordinaten der Haltungsanfangs- und -endpunkte<br />
liegen bei der Stadt Regensburg aus einer terrestrischen<br />
Vermessung in Lage und Höhe mit cm-Genauigkeit vor.<br />
Sämtliche Punkte werden im Landeskoordinatensystem<br />
als Gauß-Krüger-Koordinaten geführt. Die bereitgestellten<br />
DXF-Daten konnten unmittelbar für die Vermessung<br />
Bild 1: JT-Fahrwagen mit integrierter Sensorik zur Haltungsvermessung<br />
42 03 / 2013
SPECIAL: INSPEKTION & GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNG FACHBERICHT<br />
Bild 2: Testgebiet Regensburg mit gekrümmten Haltungen<br />
Bild 3: Haltung FM-83 zwischen den Schächten 2817002 und 2817008<br />
der Haltungen verwendet werden. hakASYS führt die<br />
Vermessung zunächst in einem lokalen Koordinatensystem<br />
durch und überführt die Ergebnisse anschließend in das<br />
Koordinatensystem des Kunden. Dabei wird sichergestellt,<br />
dass die durch das Messsystem neu bestimmten<br />
Koordinaten von Haltungsanfangs- und Haltungsendpunkt<br />
exakt den von der Stadt Regensburg übernommenen<br />
Koordinaten entsprechen. Hierdurch werden Klaffen<br />
und Mehrdeutigkeiten vermieden. Haltungen beginnen<br />
und enden genau an den vermessenen Knoten der<br />
Schachtbauwerke (Bild 4).<br />
Die Lage des Messsystems zum Fahrwagen von hakASYS<br />
wurde vor Beginn der Messung kalibriert. Dies ist nur<br />
einmal notwendig, um den Fahrwagen anhand bekannter<br />
Bezugspunkte so in der Haltung positionieren zu können,<br />
dass ein Bezug zum Haltungsanfang hergestellt werden<br />
kann (Bild 5).<br />
Die Vermessung durch hakASYS selbst erfolgt automatisch<br />
während der Hin- und Rückfahrt des Fahrwagens zwischen<br />
den beiden Schachtbauwerken. Der Operateur muss<br />
während der Messfahrt keine Eingaben vornehmen und<br />
kann sich vollständig auf die Steuerung des Fahrwagens<br />
konzentrieren. Das Testgebiet wurde mit einem<br />
nichtlenkbaren Fahrwagen vom Typ Turbo II der Fa.<br />
JT-elektronik untersucht. Die Bereifung des Fahrwagens<br />
wurde an den Querschnitt so angepasst, dass eine Führung<br />
in der Mitte des Profils sichergestellt werden konnte. Ein<br />
Klettern am Haltungsrand wurde nicht beobachtet, so<br />
dass jeweils ohne verzögernde Stopps kontinuierlich vom<br />
Haltungsanfang zum Ende und zurück gefahren werden<br />
konnte. In Bild 6a ist die Krümmung des Haltungsverlaufes<br />
des untersuchten Eiprofils 700/1050 zu erkennen.<br />
Am Haltungsende angekommen teilt der Operateur dies der<br />
Software mit, um die exakte Wegposition der Haltungslänge<br />
zu bestimmen. Die Positionierung erfolgt optisch mittels<br />
des Kamerabildes (Bild 6b). Die momentane Position des<br />
Fahrwagens kann während der Vermessung kontinuierlich<br />
mit hinterlegtem Hintergrundbild live verfolgt werden. Nach<br />
der Positionierung des Fahrwagens im Schacht lassen sich pro<br />
Minute durchschnittlich 10 m Haltungsverlauf erfassen. Diese<br />
Durchschnittsangabe schließt die Hin- und Rückfahrt ein.<br />
Bild 7 zeigt die berechneten Stützpunkte der Hin-<br />
(violett) und Rückmessung (blau). Der maximale Abstand<br />
zwischen Hin- und Rückmessung beträgt in der Mitte der<br />
Bild 4: Schachtbauwerke der Haltung FM-83<br />
Bild 5: Positionieren des Fahrwagens am Haltungsanfang<br />
03 / 2013 43
FACHBERICHT SPECIAL: INSPEKTION & GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNG<br />
Bild 6: a) Gebogener Eiprofilverlauf (Haltung FM-83),<br />
b) Haltungsende FM-83<br />
Haltung weniger als 8 cm. Deutlich erkennbar ist die gute<br />
Übereinstimmung beider Messungen. Das endgültige<br />
Ergebnis, der neue Haltungsverlauf (grüne Linie), wird aus<br />
beiden Lösungen bestmöglich mathematisch bestimmt.<br />
Die Haltungen wurden zur Überprüfung der Genauigkeit<br />
(Reproduzierbarkeit) mehrmals befahren. Bild 8 zeigt<br />
die endgültigen Ergebnisse aller drei Befahrungen. Die<br />
Lösungen liegen innerhalb eines Bandes mit maximaler<br />
Breite von 15 cm. Diese Abweichung resultiert nicht nur aus<br />
der Genauigkeit des Messsystems, sondern auch aus der<br />
Unsicherheit der Befahrung. Insgesamt lässt dieses Ergebnis<br />
auf eine sehr gute Reproduzierbarkeit des Messsystems<br />
schließen und bedeutet, dass mehrere Vermessungen das<br />
Ergebnis nur geringfügig verbessern können und bereits<br />
eine Befahrung, bestehend aus Hin- und Rückmessung,<br />
zuverlässige Informationen über den geometrischen Verlauf<br />
der Haltung liefert.<br />
2. Untersuchungsaspekt<br />
Der zweite zu untersuchende Kanal verläuft von Süden<br />
(Nr. 1) nach Norden (Nr. 3) und ist in Bild 9 in gelber Farbe<br />
eingezeichnet. Die Gesamtlänge beträgt ca. 122 m und setzt<br />
sich aus zwei Teilabschnitten zusammen, die in der Mitte<br />
durch einen Schacht (Nr. 2) geteilt werden. Der südliche<br />
Teil zwischen den Schächten 1 und 2 verläuft auf<br />
einer Strecke von ca. 58 m geradlinig. Anhand<br />
dieser Haltung sollte untersucht werden, wie<br />
stabil die Sensorik geradlinige Verläufe erfassen<br />
kann. Ein weiterer Teil der Haltung, nördlich<br />
von Schacht Nr. 2 verläuft nach Angaben der<br />
Stadt Regensburg leicht (in Bild 10 nur im<br />
Ansatz erkennbar) gebogen. Allerdings ist dieser<br />
gekrümmte Verlauf nicht exakt bekannt.<br />
In diesem zweiten Versuch sollte zunächst Haltung<br />
FM-84 zwischen Schacht Nr. 1 und Nr. 3 untersucht<br />
werden, welche Resultate bei längeren Distanzen<br />
von über 100 m erzielt werden können. Dabei<br />
diente der in der Mitte liegende Schacht Nr. 2 als<br />
Kontrolle, weil seine Position exakt vermessen ist.<br />
Die Haltung FM-84 wurde insgesamt dreimal<br />
in Hin- und Rückmessung befahren. Die Grüne<br />
Linie in Bild 10 zeigt das endgültige Ergebnis. Die laterale<br />
Abweichung der aus den Einzelpunkten gerechneten<br />
Graden, die dem Sollverlauf entspricht, beträgt nur wenige<br />
Zentimeter.<br />
Wie Bild 11 zeigt, ist auch bei geradlinigen Haltungen eine<br />
gute Reproduzierbarkeit am Verlauf der Stützpunkte der<br />
Hin- (violett) und der Rückmessungen (blau) erkennbar. Die<br />
jeweils daraus abgeleiteten endgültigen Haltungsverläufe (rot)<br />
weichen einander maximal um 7 cm ab. Deutlich zu erkennen<br />
ist die Kompensation von systematischen Fehlern durch die<br />
gemeinsame Auswertung der Hin- und Rückmessungen.<br />
Wie bereits erwähnt bestand der zweite Teil des Versuchs<br />
darin, die bekannte Position des Schachtes Nr. 2 als<br />
Kontrollpunkt zu nutzen. Die Abweichung von diesen<br />
vermessenen Haltungspunkten ist ein Maß für die<br />
Genauigkeit des Messsystems nach 60 m Leitungsverlauf,<br />
wobei die Gesamtlänge der Messung ca. 122 m beträgt.<br />
Bild 12 zeigt die Auswertungen am Schacht Nr. 2. Die grüne<br />
Linie entspricht der durch hakASYS vermessenen Haltung.<br />
Die südliche rote Linie zeigt die im vorausgegangenen<br />
Versuch bestimmte Haltung FM-84. Die Abweichung<br />
am Haltungsende beträgt nur 10 cm. Noch besser<br />
ist das Ergebnis am nördlichen Haltungsanfang. Hier<br />
beträgt die Abweichung lediglich 5 cm! Es sei bemerkt,<br />
< 8 cm<br />
Bild 7: Hinmessung (violett), Rückmessung (blau) und endgültiger<br />
Verlauf (grün)<br />
Bild 8: Endgültige Ergebnisse aus Hin- und Rückmessung von drei<br />
unabhängigen Vermessungen<br />
44 03 / 2013
SPECIAL: INSPEKTION & GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNG FACHBERICHT<br />
den Schächten 1 und 2 verläuft auf einer Strecke von ca. 58 m geradlinig. Anhand <br />
dass dieser Betrag nach bereits 60 m zurückgelegter<br />
Haltungsvermessung erreicht wurde. Da der Anfangsund<br />
Endpunkt (bei Schacht Nr. 1 und 3) jeweils bekannt<br />
ist und damit fehlerfrei in die Bestimmung eingeführt<br />
wurde, ist prinzipiell die in der Mitte der Haltung zu<br />
erwartende Abweichung am größten. Es sind demnach<br />
keine Lagedifferenzen von mehr als 10 cm zu erwarten.<br />
Auch hier ist noch zu berücksichtigen, dass dieses Ergebnis<br />
durch die Unsicherheit des Fahrweges beeinflusst wurde.<br />
Um den Verlauf zwischen Schacht 2 und 3 nochmals<br />
getrennt zu untersuchen, wurde die ganzheitliche<br />
Vermessung zwischen Schacht 1 und 3 nur in diesem<br />
Teilabschnitt ausgewertet.<br />
Das erzielte Ergebnis bestätigt die Vermutungen der<br />
Vertreter der Stadt Regensburg, dass die Haltung zwischen<br />
Schacht 2 und 3 (grüne Linie in Bild 13) in einem leichten<br />
Bogen verläuft. Die bestimmte Querabweichung beträgt<br />
etwa 1,5 m. Eine Abweichung, die ohne eine derartige<br />
Vermessung nicht erkannt worden wäre. An diesem<br />
Beispiel lässt sich erahnen, welche Verbesserung der<br />
Lageinformation bei gebogenen Haltungsverläufen<br />
mit dem neuen System hakASYS erreichbar ist. Die<br />
Datenqualität geometrischer Parameter von gekrümmten<br />
Haltungsverläufen lässt sich somit auf 1 - 2 Dezimeter<br />
steigern, dies schließt die Messunsicherheit des Systems<br />
ein, aber auch die Unregelmäßigkeit der Befahrung selbst.<br />
3 <br />
2 <br />
1 <br />
Bild 9:<br />
Untersuchung von zwei<br />
aufeinanderfolgenden<br />
Haltungen<br />
Bild 10:<br />
Geradlinige<br />
Haltung<br />
FM-84<br />
3. Untersuchungsaspekt<br />
In einem dritten Test wurde die Haltung FM-228 befahren. Das<br />
Besondere an dieser Haltung ist der anfangs gebogene Verlauf<br />
bis zur Straßenmitte, der dann ohne Schachtbauwerk in einen<br />
geraden Verlauf übergeht. In den Planunterlagen der Stadt<br />
Regensburg ist diese Haltung als Kreisbogen mit anschließender<br />
Gerade verzeichnet. Auch hier lag die Vermutung nahe, dass<br />
der tatsächliche Verlauf abweicht und wesentlich flacher –<br />
an der Straßenachse orientiert – verläuft. Bereits die erste<br />
Vermessung mit hakASYS bestätigte diese Vermutung. Bild 14<br />
zeigt den Verlauf der Planunterlagen in blau und den neu<br />
bestimmten endgültigen Haltungsverlauf in grün.<br />
Die Querabweichung zwischen vermessener und<br />
dokumentierter Haltung beträgt im Maximum 3,4 m<br />
(Bild 14). Dies ist eine Größenordnung, die auch bereits<br />
erheblichen Einfluss auf die geometrische Größe der<br />
Haltungslänge selbst hat: Die nachgewiesene Länge<br />
wird mit 61,30 m geführt, aus der Vermessung ergibt<br />
sich eine rechnerische Länge der Haltung von 57,07 m.<br />
In diesem Fall beträgt die Differenz in der Haltungslänge<br />
etwa 7 %. Gerade bei Sanierungsmaßnahmen, aber auch<br />
bei Netzerweiterungen oder anderen Baumaßnahmen<br />
in unmittelbarer Nähe führen diese großen<br />
Unsicherheiten in Länge und Lage rasch zu unerwarteten<br />
Kostensteigerungen.<br />
ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG<br />
Als Fazit dieser drei umfassenden Tests zur geometrischen<br />
Lagebestimmung von gebogenen Haltungen mit dem<br />
neuen Messsystem hakASYS lässt sich feststellen:<br />
»»<br />
Die bewährte <strong>Inspektion</strong>stechnik (Fahrwagen mit<br />
Kamerasystem) von JT-elektronik in Zusammenhang<br />
mit einer neuen Sensorik und Steuersoftware zur<br />
Positionsbestimmung von PPMsys eignet sich sehr gut<br />
für die dreidimensionale Vermessung von gekrümmten<br />
Haltungen. Die eingesetzte inertiale Sensorik in<br />
Kombination mit der Steuersoftware arbeitete bei den<br />
Tests bereits problemlos und liefert zuverlässige Ergebnisse.<br />
Bild 11:<br />
Stützpunkte<br />
aller drei<br />
Befahrungen<br />
in der Mitte<br />
der Haltung<br />
03 / 2013 45
FACHBERICHT SPECIAL: INSPEKTION & GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNG<br />
arbeitet nahezu driftfrei. Dies bedeutet, dass Übergänge<br />
zwischen Krümmungen und Geraden gut identifiziert<br />
werden können.<br />
»»<br />
Die Auflösung der vermessenen Stützpunkte beträgt<br />
ca. 1 cm. Durch Ausdünnen der Stützpunkte können<br />
die extrahierten Linienobjekte deutlich vereinfacht<br />
werden.<br />
Bild 12: Ergebnisse im Schacht Nr. 2<br />
Bild 13: Bogenförmiger<br />
Haltungsverlauf zwischen<br />
Schacht 2 und 3<br />
Danksagung<br />
Unser Dank für die Durchführung aller Testmessungen<br />
geht vor allem an Herrn Stangl, der als Vertreter der<br />
Stadt Regensburg die Vermessung freundlich begleitete<br />
und unkompliziert unterstützte. Durch die Auswahl der<br />
Haltungen und die Bereitstellung von Daten konnte das<br />
neue Messsystem in realistische Szenarien erprobt werden.<br />
Die gewonnenen Erfahrungen tragen wesentlich dazu<br />
bei, hakASYS möglichst schnell zur Marktreife zu führen.<br />
Weitere Tests mit komplexeren Aufgabenstellungen,<br />
die dann auch die Höhenkomponente mit einschließen<br />
werden, sind in naher Zukunft geplant. So sollen u.a.<br />
während eines weiteren Tests die Entlüftungs- und<br />
Entwässerungsleitungen einer Deponie mit modifizierter<br />
Messtechnik in Lage und Höhe erfasst und mit den<br />
vorhandenen Leitungsdokumentationen verglichen<br />
werden.<br />
Bild 14: Planunterlagen der Haltung FM-228 (blau) und<br />
Ergebnis der Vermessung mit hakASYS (grün)<br />
AUTOREN<br />
»»<br />
Die Genauigkeit der Ergebnisse entspricht den gesetzten<br />
Zielen. Die festgestellte Messunsicherheit betrug bei<br />
allen durchgeführten Tests mit Haltungslängen bis 120 m<br />
weniger als 10 cm. Damit wurde die Forderung innerhalb<br />
einer Fahrrinnenbreite zuverlässige Ergebnisse zu liefern<br />
erfüllt.<br />
»»<br />
Das System zeigte bei Mehrfachbefahrungen eine sehr<br />
gute Reproduzierbarkeit der einzelnen Vermessungen.<br />
Dies bedeutet, dass eine einzige Befahrung, bestehend<br />
aus Hin- und Rückmessung, genügt, um gute Ergebnisse<br />
zu liefern.<br />
»»<br />
Pro Minute können durchschnittlich 10 m<br />
Haltungslänge erfasst werden. Diese Angabe bezieht<br />
sich auf die reine Fahrzeit für Hin- und Rückmessung<br />
ohne Rüstzeiten für die Positionierung des Fahrwagens<br />
in der Haltung.<br />
»»<br />
Geradlinige und wenig gekrümmte Haltungsverläufe<br />
können ebenfalls gut erfasst werden. Das System<br />
Dipl.-Ing.FRANK HÜMMER<br />
PPMsys (UG), Oberhaching<br />
Tel. +49 89 45545534<br />
E-Mail: info@ppmsys.de<br />
Dr.-Ing. ADMIRE KANDAWASVIKA<br />
PPMsys (UG), Oberhaching<br />
Tel. +49 89 45545534<br />
E-Mail: info@ppmsys.de<br />
Prof. Dr.-Ing. habil. HANS HEISTER<br />
PPMsys (UG), Oberhaching<br />
Tel. +49 89 45545534<br />
E-Mail: info@ppmsys.de<br />
46 03 / 2013
FORSCHUNGSPROJEKT SPECIAL: INSPEKTION & GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNG<br />
Abwasserinhaltsstoffe perkolieren<br />
in den Untergrund<br />
Schwer abbaubare Stoffe, die durch undichte Hausanschlüsse in den Boden und Untergrund austreten, verbleiben zunächst<br />
in der Nähe der Leckage. Die Stoffe werden, teilweise im Wasser gelöst, durch Kapillarkräfte im Boden gehalten. Bei<br />
Spülstößen wie einem Starkregenereignis werden diese Kräfte überwunden und das eingespülte Wasser wird mittels<br />
Schwerkraft in tiefer gelegene Schichten transportiert. So können mit dem Wasser die temporär fixierten Stoffe ins<br />
Grundwasser gelangen. Dieses wurde bei dem vom VuSD unterstützten Forschungsprojekt in belegbaren Untersuchungen<br />
gemessen.<br />
Leitfähigkeit<br />
Dest.<br />
0<br />
50<br />
100<br />
Die Versickerungsgeschwindigkeit des Bodens stieg nach<br />
einem Spülstoß (Regen) wieder auf den Wert zu Beginn der<br />
Versuche an. Für reale Böden kann das Ergebnis so interpretiert<br />
werden, dass die Versickerungsraten in dem Wechselspiel<br />
von Regen und Trockenperiode schwanken. Das weiß<br />
der Pflanzenproduzent. Abwasser und seine Inhaltsstoffe<br />
können immer in tiefer gelegene Zonen perkolieren.<br />
Biologisch abbaubare Reststoffe und nicht oder kaum<br />
abbaubaren Stoffe verblieben zunächst im Porenraum des<br />
Bodens. Bei der Beschickung der Lysimeter mit destilliertem<br />
Wasser (simulierte Starkregenereignisse) wurden die<br />
im Boden akkumulierten Stoffe ausgewaschen. In einer<br />
Bilanzierung wurden mehr als 90 % der Stoffe, gemessen<br />
an Leitfähigkeit, Calcium und Magnesium, im Perkolat<br />
wiedergefunden.<br />
Lf [µS/cm]<br />
0 200 400 600 800 1000 1200<br />
20,26<br />
260<br />
296<br />
329<br />
383<br />
391<br />
483<br />
681<br />
880<br />
1. Spülung<br />
2. Spülung<br />
3. Spülung<br />
4. Spülung<br />
statt, sie steigt im Ablauf von Lysimeter 1 (50 cm) auf 681<br />
µS/cm, im Ablauf von Lysimeter 2 (100 cm) auf 880 µS/cm<br />
und im Ablauf von Lysimeter 3 auf 986 µS/cm. Die Zunahme<br />
der Leitfähigkeit ist auch nach der zweiten Spülung gut<br />
messbar, sie steigt nach den ersten 50 cm Sickerstrecke auf<br />
329 µS/cm und weiter auf 483 µS/cm nach 100 cm. Am<br />
Ende der Sickerstrecke, nach 150 cm Bodenmatrix, erhöht<br />
sich die Leitfähigkeit auf 576 µS/cm. Die dritte und vierte<br />
Spülung ergeben ein ähnliches Bild, die Leitfähigkeit steigt<br />
zunächst auf 260 µS/cm bis 296 µS/cm an, im Ablauf nach<br />
100 cm Sickerstrecke beträgt sie zwischen 383 µS/cm und<br />
391 µS/cm nach 150 cm Sickerstrecke schließlich zwischen<br />
402 µS/cm und 436 µS/cm.<br />
Mit den Messungen für Calcium und Magnesium bestätigte<br />
sich, dass sorbierte Bestandteile im sandigen Kies auch<br />
durch ein simuliertes Starkregenereignis ausgespült werden.<br />
Übertragen auf reale Bodenverhältnisse zeigt dieses Ergebnis,<br />
dass im Boden sorbierte oder im Korngefüge akkumulierte<br />
Salze – nicht abbaubare Stoffe – durch Regenereignisse<br />
aus dem Boden herausgespült werden. Gut abbaubare<br />
organische Stoffe werden teilweise degrediert. Das war<br />
auch zu erwarten. Im Boden sorbierte und im Korngefüge<br />
akkumulierte Stoffe, insbesondere kaum oder nicht abbaubare<br />
Stoffe, werden durch Regenereignisse aus dem Boden<br />
herausgespült und in tiefer gelegene Schichten transportiert<br />
– bis hin zu grundwasserführenden Schichten.<br />
150<br />
402<br />
436<br />
576<br />
Lysimeterversuche Leitfähigkeit – Übersicht – [µS/cm]<br />
Bild 1: Leitfähigkeit in µS/cm über die Sickerstrecke von 150 cm, sandiger<br />
Kies, mit destilliertem Wasser, vier aufeinanderfolgende Spülungen<br />
In Bild 1 ist die Veränderung der Leitfähigkeit im Lysimeter<br />
mit sandigem Kies dargestellt. Die Leitfähigkeit im demineralisierten<br />
Wasser beträgt 20,26 µS/cm. Die größte Veränderung<br />
der Leitfähigkeit findet durch die erste Spülung<br />
986<br />
Prof. Dr. -Ing. JOHANNES WEINIG<br />
FH Bielefeld, Campus Minden<br />
FB Architektur und Bauingenieurwesen<br />
Tel. +49 571 8385-195<br />
E-Mail: johannes.weinig@fh-bielefeld.de<br />
AUTOR<br />
47 03 / 2013
FACHBERICHT SPECIAL: INSPEKTION & GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNG<br />
Sind private Grundstücksanschlussleitungen<br />
im öffentlichen Straßenraum<br />
eine tickende Zeitbombe?<br />
Überzeugt von der Alternativlosigkeit einer flächendeckenden Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserleitungen wurde<br />
von den Technischen Betrieben Solingen (TBS) das „Modell Solingen“ entwickelt. Dieses Modell soll als erstes Ziel die<br />
Bürger optional begleiten und dabei die öffentliche Infrastruktur vor Schäden schützen.<br />
Die Zuständigkeit für private Grundstücksanschlussleitungen<br />
(GAL) im öffentlichen Straßenraum ist in Nordrhein-<br />
Westfalen sehr unterschiedlich geregelt. In Abhängigkeit<br />
der jeweiligen Ortssatzungen gibt es eine Vielzahl von<br />
Regelungen. Aggregiert man die verschiedenen Satzungsauslegungen<br />
der 396 NRW-Gemeinden, ergibt sich, dass<br />
ca. 50 % der privaten GAL in der Zuständigkeit der Kommunen<br />
liegen (siehe Bild 1). Die andere Hälfte gehört nicht<br />
nur dem Grund- und Hausbesitzer, er ist außerdem für<br />
den ordnungsgemäßen Betrieb und die Unterhaltung im<br />
öffentlichen Straßenraum verantwortlich. Es kann unterstellt<br />
werden, dass dies den wenigsten Hausbesitzern bekannt ist.<br />
Am 14.12.2011 wurde im NRW-Landtag mit den Stimmen<br />
von CDU, FDP und Linken ein Antrag der FDP angenommen,<br />
der die Landesregierung aufforderte, den Vollzug der<br />
Dichtheitsprüfung privater Abwasserleitungen (§ 61a LWG<br />
NRW) auszusetzen. Ab diesem Zeitpunkt wurden innerhalb<br />
einer logischen Sekunde sämtliche Bemühungen der Städte<br />
und Gemeinden in NRW, ein konstruktives Vorgehen mit<br />
der Dichtheitsprüfung zu etablieren, zunichte gemacht.<br />
HANDLUNGSGRUNDLAGE<br />
Seit der Einführung der Selbstüberwachungsverordnung<br />
Kanal (SüwVKan - 1996) sind in NRW alle kommunalen<br />
Kanalnetzbetreiber verpflichtet, sich intensiv mit ihren<br />
öffentlichen Abwasseranlagen auseinanderzusetzen und<br />
hierüber der jeweilig zuständigen Bezirksregierung jährlich<br />
zu berichten. Eine wesentliche Erkenntnis bei den Untersuchungen<br />
war, dass nicht nur die Exfiltration, sondern auch<br />
die Infiltration von Fremdwasser ein ebenso großes Problem<br />
darstellt. Bei einem entsprechenden Fremdwasseranteil<br />
und einem historisch gewachsenen Kanalisationsnetz ist in<br />
der Regel mit einer Erschwernis bei der Abwasserbehandlung<br />
zu rechnen. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass<br />
besonders durch defekte private Abwasserleitungen im<br />
öffentlichen Straßenraum mit immer häufiger auftretenden<br />
Tagebrüchen zu rechnen ist.<br />
SANIERUNGSSTRATEGIE HAUPTKANAL<br />
1997 wurde im öffentlichen Entwässerungsnetz der Stadt<br />
Solingen bei ca. 500 Rohrverbindungen die Dichtheit überprüft.<br />
Das Alter der Untersuchungsbereiche lag i. M. bei<br />
50 Jahren. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass ca. 85 %<br />
der betrachteten Rohrverbindungen undicht waren. Vor<br />
diesem Hintergrund wurde in Solingen 1998 die Sanierungsstrategie<br />
Hauptkanal entwickelt. Auf der Grundlage der<br />
SüwVKan wurde in Abstimmung mit der Bezirksregierung<br />
Düsseldorf ein Konzept aufgebaut, das bis Ende 2015 das<br />
öffentliche Entwässerungsnetz der Stadt Solingen in den<br />
Stand der Technik versetzen sollte. Der Zeithorizont 2015<br />
wurde gewählt, weil im § 45 der Landesbauordnung NRW<br />
damals festgelegt war, dass alle privaten Abwasserleitungen<br />
von den Haus- und Grundbesitzern bis zum 31.12.2015 auf<br />
ihre Dichtigkeit zu überprüfen sind.<br />
Im Einzugsbereich der Kläranlage Solingen-Gräfrath wurde<br />
durch Aufforderung und in Abstimmung mit dem Bergisch-<br />
Rheinischen-Wasserverband und der Bezirksregierung Düsseldorf<br />
das öffentliche Kanalisationsnetz auf Infiltration<br />
von Fremdwasser untersucht und im Nachgang umfänglich<br />
saniert (Renovation durch Schlauchrelining). Innerhalb von<br />
drei Jahren konnte hierdurch der Fremdwasseranteil im<br />
Zulauf der Kläranlage halbiert werden, was einen großen<br />
Erfolg darstellte. Spätestens ab Ende 2006 wurde jedoch<br />
deutlich, dass der Schutz einer Kläranlage vor infiltrierendem<br />
Fremdwasser nicht alleine durch Überprüfung und ggf.<br />
notwendig werdenden Sanierung des Hauptkanals erreicht<br />
werden kann. Die Fremdwasserzulaufwerte im KA-Gräfrath<br />
zeigten eindeutig, dass nach der Sanierung des Hauptkanals<br />
das Fremdwasser über die undichten Anschlusskanäle<br />
auf den privaten Grundstücken in den sanierten dichten<br />
öffentlichen Kanal gelangt und von dort zum Klärwerk<br />
geleitet wird.<br />
Zur selben Zeit (2006) wurden in Köln, gefördert vom Ministerium<br />
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Naturund<br />
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen<br />
(MUNLV), durch die Stadtentwässerungsbetriebe Köln<br />
und der RWTH-Aachen das Pilotprojekt Köln-Höhenhaus<br />
betrieben. Ziel dieses Projektes war, nach der Durchführung<br />
einer Zustandserfassung und einer erforderlichen Sanierung<br />
der privaten Anschlussleitungen Empfehlungen für ein flächendeckendes<br />
Vorgehen zu erarbeiten, um die Akzeptanz<br />
bei den Haus- und Grundbesitzern zu steigern. In Köln-<br />
Höhenhaus wurden 435 <strong>Grundstücksentwässerung</strong>sanlagen<br />
optisch untersucht und auf ihre Dichtigkeit geprüft. Über<br />
48 03 / 2013
SPECIAL: INSPEKTION & GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNG FACHBERICHT<br />
70 % der Gebäude im Untersuchungsgebiet wurden vor<br />
1965 errichtet. 98 % der untersuchten Leitungen wurden<br />
als undicht identifiziert.<br />
Die Ursache für die Undichtigkeit der Rohrverbindungen<br />
bei Kanalhaltungen, die vor 1970 verlegt wurden haben<br />
relativ schlichte Gründe. Zur Abdichtung der Rohrverbindungen<br />
wurden in Teer getränkte Hanfstricke verwendet<br />
(siehe Bild 2). Die Rohrmuffe wurde danach mit einer<br />
Lage plastischem Ton oder Kalk- bzw. Zementmörtel<br />
umhüllt. Später wurde alternativ zum Teerstrick Asphaltkitt<br />
geschmolzen und dünnflüssig über Gießringe zur Abdichtung<br />
der Rohrmuffen verwendet. Ende der 1950er Jahre<br />
wurde eine Vergussmasse aus Asphalt durch Verspachteln<br />
der Rohrverbindungen zur Abdichtung verwendet. Erst<br />
ab Anfang der 1970er Jahre wurden Lippendichtringe aus<br />
Kautschuk-Elastomer bei der Kanalrohrabdichtung verwendet<br />
(siehe Bild 3).<br />
Diese alten Dichtungssysteme wurden häufig mit mangelhafter<br />
Sorgfalt ausgeführt, so dass der Teerstrick und<br />
die Ummörtelung entweder nicht sachgerecht angebracht<br />
wurden oder ganz fehlten. In fast allen Kommunen fand<br />
genau in dem Zeitfenster (1960-1975) eine enorme städtebauliche<br />
Entwicklung statt. Während dieser Zeit wurden<br />
entweder Kriegsschäden beseitigt oder eine städtebauliche<br />
Neuorientierung generierte einen Bauboom. Zu diesem Zeitpunkt<br />
konnte die Industrie allerdings noch kein werkseitig<br />
eingebautes Dichtungselement in Kanalrohren herstellen.<br />
Somit war die Abdichtung der öffentlichen und privaten<br />
Entwässerungsanlagen einzig von der Sorgfalt und Akribie<br />
der Baufirmen abhängig.<br />
Bei beiden Untersuchungen in Solingen-Gräfrath (2001-<br />
2005) und dem Pilotprojekt in Köln-Höhenhaus (2005-2007)<br />
wurde unabhängig voneinander festgestellt, dass Abwasserrohre<br />
aus dem Verlegezeitraum um 1970 mit allergrößter<br />
Wahrscheinlichkeit zum heutigen Zeitpunkt undicht sind<br />
(siehe Bild 4).<br />
KONSEQUENZEN AUS FALSCHEM HANDELN<br />
Bei der Überleitung des 1995 geschaffenen § 45 BauO NRW<br />
in den § 61a LWG lag das primäre Ziel in dem Schutz von<br />
Wasser und Boden vor der Verunreinigung durch klärpflichtige<br />
Abwässer, die durch Exfiltration über undichte Abwasserleitungen<br />
in den Untergrund gelangen. Relativ schnell<br />
wurde jedoch deutlich, dass die Infiltration in Abhängigkeit<br />
vom Fremdwasseraufkommen eine noch viel größere<br />
Bedeutung haben kann. In Verbindung mit einem hohen<br />
Fremdwasseranteil zeigte sich bei den mit Millionen von<br />
Euros in den Stand der Technik gebrachten Kläranlagen,<br />
dass mit erheblichen Erschwernissen bei der Abwasserbehandlung<br />
zu rechnen ist. Diese Erschwernisse würden sich<br />
mittelfristig spürbar auf die Abwassergebühr auswirken.<br />
Langsam, aber unaufhörlich macht sich ein weiterer Bereich<br />
bemerkbar, der durch den Zustand der Ab-wasseranlagen<br />
maßgeblich beeinflusst wird. Es handelt sich um die öffentliche<br />
Infrastruktur. Die öffentlichen Kanalnetze mit einem<br />
Bild 1: Grenze öffentliche und private Abwasseranlage<br />
Bild 2: Abdichtung mit Hanfstrick<br />
Bild 3: Abdichtung mit Lippendichtringen (Steckmuffe)<br />
03 / 2013 49
FACHBERICHT SPECIAL: INSPEKTION & GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNG<br />
mittleren Alter von ca. 50 Jahren werden seit der verbindlichen<br />
Einführung der SüwVKan NRW (1996) regelmäßig<br />
untersucht und bei Bedarf saniert. Dies gilt allerdings nicht<br />
für die privaten Abwasserleitungen im öffentlichen Straßenraum.<br />
Mit einer fast vierfachen Länge gegenüber dem<br />
öffentlichen Hauptkanal und einer baulichen Schädigung<br />
bis zu 75 % stellen diese Abwasseranlagen eine tickende<br />
Zeitbombe dar. Besonders deutlich wurde dieser Sachverhalt<br />
bei zwei spektakulären Schadensereignissen in Solingen<br />
innerhalb der vergangenen zwei Jahre (siehe Bild 5 und Bild<br />
6). In beiden Fällen konnten durch defekte private Anschlusskanäle<br />
unbemerkt die Straßenkörper unterhöhlt werden. Die<br />
Hohlräume traten erst zu Tage, als die Löcher eine extrem<br />
gefährliche Dimension erreicht hatten. Solche Schäden sind<br />
in der Vergangenheit in fast allen Städten in NRW festgestellt<br />
worden und werden zu immer größeren Problemen.<br />
Nur durch viel Glück ist bislang kein Mensch zu Schaden<br />
gekommen. Die Kosten für die Reparatur belaufen sich auf<br />
mehrere hunderttausend Euro. Vor dem Hintergrund solcher<br />
Schreckensszenarien wirken die Argumente sowohl der Bürgerinitiativen<br />
als auch der Politiker nicht nachvollziehbar. Bald<br />
wird die Diskussion nicht mehr um die Sanierungskosten von<br />
privaten Abwasserleitungen behandeln, sondern die notwendigen<br />
Investitionen zur Instandhaltung der öffentlichen<br />
Infrastruktur, auf Grund der desolaten baulichen Situation<br />
der privaten Abwasseranlagen. Dramatisch kann es werden,<br />
wenn neben einem materiellen Schaden zum ersten Mal<br />
ein Mensch betroffen ist und zu Schaden kommt. In einem<br />
solchen Moment wird zwangsläufig ein Staatsanwalt aktiv<br />
und wird die Zuständigkeit prüfen. Geschieht der Unfall im<br />
öffentlichen Straßenraum ist automatisch der Straßenbaulastträger<br />
im Visier. Ein Bauingenieur erlangt durch seine<br />
Tätigkeit ein besonderes Maß an Verantwortung für die<br />
Menschen und die Umwelt. Die von ihm geplanten, gebauten<br />
und betreuten Bauwerke müssen sowohl hinsichtlich der<br />
Standsicherheit als auch der Gebrauchstüchtigkeit gewissen<br />
Anforderungen genügen. Werden diese nicht erfüllt und<br />
durch Mangelhaftigkeit des Bauwerkes sogar Menschen<br />
verletzt oder sogar getötet, haftet der Bauingenieur für<br />
diesen Fehler. Es besteht die Möglichkeit, dass entweder eine<br />
empfindliche Geldbuße oder eine Freiheitsstrafe angesetzt<br />
wird. Dies erfolgt, wenn nachgewiesen werden kann, dass<br />
der Ingenieur fahrlässig gehandelt oder die anerkannten<br />
Regeln der Technik missachtet hat.<br />
Sollte es im öffentlichen Straßenraum zu einer solchen Situation<br />
kommen, muss in jedem Fall geklärt sein, wie die<br />
Verantwortlichkeit verteilt ist. Momentan haben in NRW<br />
alle Kommunen den gesetzlichen Auftrag, die Dichtigkeit<br />
und Funktionsfähigkeit von privaten Anschlusskanälen (siehe<br />
Bild 7) zu organisieren und die Haus- und Grundbesitzer hinsichtlich<br />
ihrer Aufgabe und Verantwortung zu beraten (§ 61a<br />
LWG). Hier gilt es, bei einer Neuregelung die Zuständigkeiten<br />
eindeutig zu regeln. Der Gesetzgeber muss klar definieren,<br />
wer die Verantwortung zu übernehmen hat, wenn den<br />
Tiefbauingenieuren der Kommunen die Zuständigkeit und<br />
Möglichkeit genommen wird, den Stand der Technik bei den<br />
ca. 100.000 km privaten Anschlussleitungen im öffentlichen<br />
Straßenraum zu überprüfen und sanieren zu lassen.<br />
DENKMODELLE<br />
Unabhängig von den politischen Geschehnissen wurde von<br />
den Technischen Betrieben Solingen das „Modell Solingen“<br />
entwickelt. Ein Modell, bei dem der Bürger im Vordergrund<br />
steht, indem er nicht nur beraten wird, sondern durch ver-<br />
8,00%<br />
7,50%<br />
7,00%<br />
Städtebauliche Entwicklung in Solingen<br />
Kanalisation<br />
Gebäude<br />
ca. 60 % der<br />
Gebäude<br />
6,50%<br />
6,00%<br />
5,50%<br />
5,00%<br />
4,50%<br />
4,00%<br />
Teerstrick zur Rohrabdichtung<br />
1960<br />
1975<br />
!"#$% 3,50%<br />
ca. 75 % der Gebäude<br />
3,00%<br />
2,50%<br />
2,00%<br />
1,50%<br />
1,00%<br />
Bild 4:<br />
Städtebauliche<br />
Entwicklung<br />
0,50%<br />
0,00%<br />
1890<br />
1900<br />
1903<br />
1905<br />
1908<br />
1910<br />
1912<br />
1914<br />
1916<br />
1920<br />
1922<br />
1924<br />
1926<br />
1928<br />
1930<br />
1932<br />
1934<br />
1936<br />
1938<br />
1940<br />
1942<br />
1944<br />
1948<br />
1950<br />
1952<br />
1954<br />
1956<br />
1958<br />
1960<br />
1962<br />
1964<br />
1966<br />
1968<br />
1970<br />
1972<br />
1974<br />
1976<br />
1978<br />
1980<br />
1982<br />
1984<br />
1986<br />
1988<br />
1990<br />
1992<br />
1994<br />
1996<br />
1998<br />
2000<br />
2002<br />
2004<br />
2006<br />
2008<br />
2010<br />
2012<br />
50 03 / 2013
SPECIAL: INSPEKTION & GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNG FACHBERICHT<br />
Bild 5: Artikel Schaden Gasstraße<br />
Bild 6: Artikel Schaden Viehbachtalstraße<br />
schiedene Modellschritte selber entscheiden kann, ob und<br />
wenn ja wie weit er von Fachleuten begleitet werden möchte.<br />
Hierzu wurde von den Technischen Betrieben Solingen<br />
gemeinsam mit verschiedenen Partnern ein Netzwerk zur<br />
Umsetzung des § 61a LWG gegründet.<br />
In diesem Netzwerk arbeiten sowohl Ingenieurbüros, Handwerksbetriebe<br />
der Kreishandwerkerschaft Solingen (KWH)<br />
als auch der Verband zertifizierter Sanierungs-Berater (VSB)<br />
und die Kommunal-Agentur NRW eng zusammen. Ziel dieser<br />
Zusammenarbeit ist zum einen eine seriöse und vertrauensvolle<br />
Dienstleistung zu entwickeln und zum anderen<br />
eine nachhaltige Herangehensweise zu generieren. Die<br />
Umsetzung der Beratung zur Dichtheitsprüfung sollte durch<br />
die Verabschiedung einer Fristensatzung verbindlich durch<br />
den Rat der Stadt eingeführt werden. Der Beratungsaufwand<br />
wird über die Abwassergebühr finanziert und würde<br />
eine Steigerung um ca. 0,04 Euro je m³ Schmutzwasser<br />
erzeugen.<br />
Dieses Modell basiert auf der Auswertung von Grundlagen,<br />
die jede Kommune in NRW zur Verfügung stellen könnte. Es<br />
handelt sich sowohl um den Zustand des Hauptkanals, dem<br />
Alter der Gebäude und der Anschlussleitungen als auch dem<br />
Fremdwasseraufkommen. Nach der Aus- und Bewertung<br />
dieser „Sowieso-Daten“ werden die betrachteten Grundstücke<br />
in Prioritätsstufen gegliedert. In einem geodatenbasierten<br />
Kartenwerk (siehe Bild 8) wird jedes Grundstück mit<br />
seiner Priorität farbig dargestellt, um Betrachtungsgebiete<br />
mit Einheiten von 50-100 Grundstücken festlegen zu können,<br />
die wiederum durch Mittelbindung mit einer Gebietspriorität<br />
belegt werden. Die Abarbeitung dieser Bereiche<br />
wird zeitlich so gestaffelt, dass bei einer kontinuierlichen<br />
Beratung der Haus- und Grundbesitzer gewährleistet ist,<br />
dass in einem realistischen Zeitfenster (≤ 20 Jahre) alle Prüfungen<br />
durchgeführt werden können.<br />
Bild 7: Darstellung private <strong>Grundstücksentwässerung</strong>sanlage<br />
03 / 2013 51
FACHBERICHT SPECIAL: INSPEKTION & GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNG<br />
Bild 8:<br />
Sanierungszeiträume<br />
Um der in NRW gesetzlich vorgeschriebenen Beratungspflicht<br />
nachzukommen, gehen die Technischen Betriebe<br />
Solingen bei ca. 34.000 Grundstücken in Solingen, auf<br />
Grund der Erfahrungen der bislang über 1.000 durchgeführten<br />
Beratungsleistungen, von ca. 2,5 Std. pro Grundstück<br />
aus. Dieser zusätzliche Aufwand wäre nur mit vier neuen<br />
Stellen zu schaffen. Vor diesem Hintergrund haben die Technischen<br />
Betriebe Solingen beschlossen, die Beratung durch<br />
die Einbindung von externen Ingenieurbüros umzusetzen.<br />
KONSTRUKTIVE, FACHLICHE AUSEINANDER-<br />
SETZUNG NICHT GEWOLLT?<br />
Wie immer im Leben steht und fällt alles mit dem Willen und<br />
dem Engagement des Einzelnen bzw. des Interessenvertreters.<br />
Am 09.01.2013 fand im NRW-Landtag eine Sitzung<br />
des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz,<br />
Landwirtschaft und Verbraucherschutz eine öffentliche<br />
Anhörung zur Änderung des § 61a LWG statt. Im Rahmen<br />
dieser Anhörung sollten von Sachverständigen die Zusammenhänge,<br />
Konsequenzen und Gefahren bei einem Für oder<br />
Wider der Dichtheitsprüfung von privaten <strong>Grundstücksentwässerung</strong>sleitungen<br />
diskutiert werden. Aufgrund der fast<br />
zehnjährigen Erfahrungswerte in der Organisation, Beratung<br />
und Krisenbewältigung im Umgang mit dem § 45 LBauO/§<br />
61a LWG waren auch die Technischen Betriebe Solingen als<br />
Sachverständige eingeladen. In Erwartung einer auf Sachund<br />
Fachfragen bezogenen Diskussion bin ich als Vertreter<br />
eines betroffenen kommunalen Kanalnetzbetreibers nach<br />
Düsseldorf gefahren, um mich konstruktiv in die Debatte<br />
einzubringen. Mit Erstaunen und einer gehörigen Portion<br />
Unverständnis musste ich zur Kenntnis nehmen, dass nicht<br />
Sachlichkeit das Maß der Dinge war, sondern Polemik und<br />
der ständige Versuch, absolut falsche Zusammenhänge<br />
durch ständiges und beharrliches Wiederholen richtig zu<br />
machen. Nach vier Stunden wurde die Anhörung beendet,<br />
ohne dass es zu einer inhaltlichen Annäherung zwischen<br />
den unterschiedlichen Standpunkten gekommen ist. Vor<br />
diesem Hintergrund muss man davon ausgehen, dass es<br />
aus NRW keinen sinnvollen Impuls für einen vernünftigen<br />
Umgang mit privaten <strong>Grundstücksentwässerung</strong>sanlagen<br />
geben wird. Wollen die kommunalen Netzbetreiber verhindern,<br />
dass private Grundstücksanschlussleitungen im<br />
öffentlichen Straßenraum zu einer tickenden Zeitbombe<br />
werden müssen sie sich selber organisieren, um Vernünftiges<br />
auf den Weg zu bringen.<br />
Dipl.-Ing. MANFRED MÜLLER<br />
Technische Betriebe Solingen, Solingen<br />
Tel. +49 212 290-4311<br />
E-Mail: m.mueller@solingen.de<br />
www.tbs.solingen.de<br />
AUTOR<br />
52 03 / 2013
SPECIAL: INSPEKTION & GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNG FACHBERICHT<br />
Umgang mit Dränagewasser<br />
von privaten Grundstücken<br />
Die Einleitung von Grund- und Dränagewasser in die öffentliche Abwasseranlage ist in den meisten Entwässerungssatzungen<br />
NRWs ausdrücklich verboten. Und dennoch finden sich in vielen Kommunen zahlreiche Dränageanschlüsse. Das können<br />
Dränagen sein, die eigentlich nur für die Bauphase geplant waren und dann „sicherheitshalber“ angeschlossen blieben.<br />
Das können auch zur dauerhaften Dränierung ausgelegte Dränagen sein oder auch undichte Hausanschluss- und<br />
Grundstücksanschlussleitungen, die wie Dränagen wirken. Wieso verbieten die Kommunen die Einleitung von Grundund<br />
Dränagewasser und warum wird Dränagewasser trotz eines Verbotes eingeleitet? Hier bestehen ganz offensichtlich<br />
unterschiedliche Interessenslagen. Eine Orientierungshilfe, wie ein Netzbetreiber seine Leitentscheidung für den Umgang<br />
mit dem Dränagewasser treffen und gegenüber den Bürgern, Politikern und Aufsichtbehörden fundiert begründen kann,<br />
wurde in dem Leitfaden „Umgang mit Dränagewasser von privaten Grundstücken - pragmatische Lösungsansätze und<br />
Argumentationshilfen“ zusammengestellt. Erarbeitet wurde diese Arbeitshilfe durch das IKT - Institut für Unterirdische<br />
Infrastruktur und die KommunalAgenturNRW auf Initiative und in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung Detmold.<br />
DIE MÖGLICHEN PROBLEME DURCH<br />
DRÄNAGEWASSER<br />
Hang-, Schichten- oder Sickerwasser, bei hohem Grundwasserstand<br />
auch Grundwasser kann als Dränagewasser<br />
von privaten Grundstücken in eine Abwasseranlage<br />
gelangen. Die angeschlossenen Dränageleitungen können<br />
zur dauerhaften Dränierung ausgelegte Dränagen sein,<br />
aber auch Dränagen, die eigentlich nur für die Bauphase<br />
geplant waren und dann „sicherheitshalber“ angeschlossen<br />
blieben. Dränierende Wirkung können auch undichte<br />
Hausanschluss- und Grundstücksanschlussleitungen haben<br />
(Bild 1).<br />
Die Einleitung von Dränagewasser in die öffentliche<br />
Schmutz- oder Mischwasserkanalisation wurde in der<br />
Vergangenheit häufig toleriert, obwohl dieses gemäß<br />
kommunaler Entwässerungssatzungen in der Regel<br />
nicht zulässig ist. Sobald Grund- und Dränagewasser<br />
in eine Abwasseranlage gelangt, wird es zum Fremdwasser.<br />
Ein Grenzwert, bei dessen Überschreitung<br />
Bild 1: Unerlaubter Dränageanschluss am öffentlichen Kanal<br />
Quelle: Gemeinde Möhnesee<br />
derFremdwasserabfluss für ein bestimmtes Gebiet<br />
zum Problem wird, kann nicht pauschal festgelegt<br />
werden. Dies hängt von unterschiedlichen Faktoren<br />
ab, wie z.B. den hydraulischen Kapazitäten im Netz<br />
und in der Kläranlage sowie der Leistungsfähigkeit der<br />
Abwasserbehandlungsanlagen.<br />
Insbesondere in Bereichen mit einem hohen Grundwasserstand<br />
kann sich der Fremdwasseranteil in der öffentlichen<br />
Kanalisation durch eingeleitetes Dränagewasser erhöhen<br />
und zu Problemen führen:<br />
»»<br />
Es kann häufiger zu Überlastungen der Kanäle und der<br />
Pumpstationen kommen.<br />
»»<br />
Durch die Einleitung von Dränagewasser wird das<br />
Abwasser verdünnt und abgekühlt. Dadurch kann die<br />
Reinigungsleistung der Abwasserbehandlungsanlagen<br />
beeinträchtigt und das Gewässer durch Überlastung<br />
von Kläranlagen und Regenbecken gefährdet werden.<br />
Werden keine Gegenmaßnahmen ergriffen, sind erhöhte<br />
Schadstoffeinträge in Gewässer zu erwarten.<br />
»»<br />
Die Betriebskosten für die Abwasserableitung und -reinigung<br />
können hierdurch ebenfalls deutlich steigen. In<br />
einigen Fällen kann sich außerdem die Abwasserabgabe<br />
erhöhen bzw. eine Abwasserabgabebefreiung verloren<br />
gehen.<br />
Die in Folge des Klimawandels zu erwartende Zunahme von<br />
Starkregenereignissen mit weiterer Belastung der Netze wird<br />
zu einer Verschärfung die Situation führen.<br />
Dem steht jedoch die Dränung zum Schutz baulicher Anlagen<br />
(DIN 4095) gegenüber. Dränagen sollen temporär vorhandenes<br />
Hang-, Schichten- oder Sickerwasser unterhalb<br />
der Geländeoberkante abführen, um in Kombination mit der<br />
Bauwerksabdichtung Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden<br />
zu vermeiden. Während der Planung und Bemessung der<br />
Dränage sollte in baulicher und wasserrechtlicher Hinsicht<br />
geprüft werden, wohin das Wasser abgeleitet werden kann.<br />
Beim Umgang mit Dränagen bestehen häufig im Einzelfall<br />
abzuwägende Interessenskonflikte zwischen<br />
03 / 2013 53
FACHBERICHT SPECIAL: INSPEKTION & GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNG<br />
Bild 2: Spannungsfeld Dränagen<br />
»»<br />
Gebäudeschutz (Dränagen gegen Kellervernässungen),<br />
»»<br />
Versorgungssicherheit (Schutz der Ressource Trinkwasser<br />
aus Grund- und Flusswasser),<br />
»»<br />
Entsorgungssicherheit (Funktionsfähigkeit des<br />
Gesamt entwässerungssystems),<br />
»»<br />
Gewässerschutz (Vermeidung von hohen Abschlagshäufigkeiten<br />
an den Regenentlastungsbauwerken, Einhaltung<br />
der zulässigen Frachten bei Einleitungen aus<br />
Kläranlage und Entlastungsbauwerken) und<br />
»»<br />
Bodenschutz (Vermeidung von Rückstau aus der Mischoder<br />
Schmutzwasserkanalisation in die Dränagen).<br />
DER LEITFADEN ALS ORIENTIERUNGSHILFE ZUM<br />
UMGANG MIT DRÄNAGEN<br />
Die Fragestellung, wie eine Kommune mit Dränagen in<br />
einem bestimmten Gebiet umgehen sollte, rückt zunehmend<br />
in den Fokus. Die Gründe hierfür können die vorab<br />
beschriebenen Probleme sein. Aber auch im Maßnahmenprogramm<br />
zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie ist<br />
die Reduzierung von Fremdwasser in Abwasseranlagen und<br />
damit letztlich indirekt auch der Umgang mit Dränagen<br />
verankert. Im Vordergrund stehen dabei insbesondere die<br />
Anlagensicherheit und die Verringerung der Gewässerbelastung<br />
aus Abwassereinleitung. Darüber hinaus wird<br />
das Thema im Zusammenhang mit der Dichtheitsprüfung<br />
privater Abwasseranlagen gem. § 61a LWG NRW diskutiert.<br />
In der Vergangenheit war es durchaus gängige Praxis,<br />
Dränagen an die öffentliche Kanalisation anzuschließen,<br />
auch wenn die Dränagewasser-Einleitung in der Regel per<br />
Abwassersatzung untersagt war. Aus diesem Grund ist<br />
davon auszugehen, dass im Zuge der sukzessiven Untersuchungen<br />
der öffentlichen Grundstücksanschlussleitungen<br />
und der privaten Abwasserleitungen eine Vielzahl von Dränageanschlüssen<br />
entdeckt wird.<br />
Allgemein gültige Vorgehensweisen im Umgang mit Dränagen<br />
kann es nicht geben, da pragmatische Lösungsansätze<br />
die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen vor dem<br />
Hintergrund der örtlichen Randbedingungen berücksichtigen<br />
sollten.<br />
Um den Kommunen und Netzbetreibern eine Orientierungshilfe<br />
zu geben, wurde der Leitfaden „Umgang mit<br />
Dränagewasser von privaten Grundstücken - pragmatische<br />
Lösungsansätze und Argumentationshilfen“ durch das IKT –<br />
Institut für Unterirdische Infrastruktur und die Kommunal<br />
AgenturNRW auf Initiative und in Zusammenarbeit mit der<br />
Bezirksregierung Detmold erarbeitet.<br />
Der Leitfaden soll ein Instrument sein, das die kommunalen<br />
Netzbetreiber in ihrer praktischen Arbeit unterstützt. Die<br />
Mitarbeit einer Gruppe kommunaler Netzbetreiber stellt<br />
den Praxisbezug des Leitfadens sicher. Über einen Expertenworkshop<br />
sind weitere Argumente und Lösungsansätze<br />
eingeflossen. Darüber hinaus wurden alle NRW-Bezirksregierungen<br />
in die Diskussion einbezogen.<br />
Das Projekt wurde vom MKULNV NRW gefördert. Der Leitfaden<br />
soll in Kürze als Download auf der Homepage des<br />
LANUV NRW zur Verfügung gestellt werden.<br />
DIE INHALTE DES LEITFADENS<br />
Der Leitfaden enthält Hinweise, Anregungen und Beispiele<br />
zur Beurteilung der Dränagewassersituation. Er zeigt<br />
Lösungsideen auf sowie Möglichkeiten zur Beurteilung und<br />
Auswahl geeigneter pragmatischer Maßnahmen. Er liefert<br />
Argumentationshilfen zur Unterstützung bei der Umsetzung<br />
einer getroffenen Leitentscheidung. Der Leitfaden<br />
gibt auch Hinweise zu Art und Umfang der Kommunikation<br />
gegenüber den unterschiedlichen Zielgruppen. Dadurch soll<br />
eine höhere Akzeptanz der geplanten Maßnahmen sowohl<br />
bei den Bürgern als auch in der kommunalen Politik erzielt<br />
und der Dialog, der im Vorfeld mit den Aufsichtsbehörden<br />
geführt wird, erleichtert werden.<br />
Im Vordergrund steht der praktische Nutzen des Leitfadens<br />
für den Anwender. Daher enthält er „Werkzeuge“ (z.B.<br />
Checklisten zur Beurteilung der Dränagewassersituation<br />
in der eigenen Kommune, ausführliche Darstellung und<br />
Bewertung von Beispielszenarien, Frage-Antwort-Fundus<br />
zur Unterstützung bei der Argumentation, Checkliste mit<br />
Kommunikationsinstrumenten), die den Netzbetreiber bei<br />
der Orientierung im Umgang mit Dränagewasser unterstützen,<br />
ihm aber die erforderlichen Freiräume lassen für<br />
die Berücksichtigung der individuellen Situation im betroffenen<br />
Gebiet (z.B. Hydrogeologie, Demographie, Satzung,<br />
Entwässerungssystem).<br />
Der Leitfaden orientiert sich an den Bearbeitungsschritten:<br />
»»<br />
Beurteilung der Dränagewassersituation und des<br />
Handlungsbedarfs,<br />
»»<br />
Zielfestlegung und Fällen einer Leitenscheidung,<br />
»»<br />
Erkennen und Bewerten von Lösungsideen,<br />
»»<br />
Aufstellen eines kommunenspezifischen Argumentationskatalogs<br />
und<br />
»»<br />
Aufbau einer Kommunikationsstrategie für den<br />
Gesamtprozess.<br />
Je nach Anwendungsfall und Bearbeitungsphase kann der<br />
Nutzer bei dem entsprechenden Bearbeitungsschritt in den<br />
Leitfaden einsteigen.<br />
Darüber hinaus wurden die wichtigsten „Leitsätze für den<br />
Umgang mit Dränagen“ zusammengestellt, die sich aus<br />
der Diskussion und dem Austausch mit den projektbeteiligten<br />
Kommunen, den Experten und den beteiligten<br />
NRW-Bezirksregierungen ergeben haben.<br />
54 03 / 2013
SPECIAL: INSPEKTION & GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNG FACHBERICHT<br />
DIE „WERKZEUGE“ IM LEITFADEN<br />
Der Handlungsleitfaden und die Werkzeuge lassen eine<br />
individuelle Berücksichtigung der jeweiligen Situation und<br />
Zielsetzungen in den Kommunen zu. Der Leitfaden soll den<br />
Netzbetreibern die Auseinandersetzung mit dem Thema<br />
„Umgang mit Dränagewasser von privaten Grundstücken“<br />
erleichtern. Er gibt ihnen eine Systematik an die Hand,<br />
bestehende Probleme ganzheitlich zu erfassen, zu bewerten<br />
und eine pragmatische Lösung zu finden, die eingebettet ist<br />
in die erforderliche eigene (kommunale) Leitentscheidung.<br />
Der Leitfaden beinhaltet folgende Arbeitshilfen:<br />
Dränagewassersituation<br />
Zur Abschätzung, inwieweit Handlungsbedarf hinsichtlich<br />
der Reduzierung von Dränagewasser im Stadtgebiet oder<br />
einem Teilgebiet besteht und welche Lösungsoptionen<br />
aufgrund bestimmter Randbedingungen ausgeschlossen<br />
werden können, dient ein Fragenkatalog mit Hinweisen<br />
für die Beantwortung. Die abschließende Beurteilung kann<br />
nur von der Kommune selbst und vor dem Hintergrund der<br />
derzeitigen Situation und zu erwartenden Entwicklungen<br />
erfolgen.<br />
Zielfestlegung<br />
Nachdem sich die Kommune einen Überblick über die Dränagewassersituation<br />
und den resultierenden Handlungsbedarf<br />
verschafft hat, kann sie übergeordnete Ziele und<br />
Strategien für ihr gesamtes Stadtgebiet oder einzelne Ortsteile<br />
festlegen. Die Schwerpunkte (wasserwirtschaftliche<br />
Ziele, Umweltschutzaspekte, behördliche Auflagen) können<br />
hierbei sehr unterschiedlich sein. Im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung<br />
sind die Kosten, die unterschiedlichen<br />
Interessen und die Akzeptanz der Entscheidungen zum<br />
Umgang mit Dränagen sowie die Einbindung des Vorgehens<br />
in ein wasserwirtschaftliches Gesamtkonzept zu beachten.<br />
Entsprechende Empfehlungen sind im Leitfaden zusammengestellt.<br />
Der Arbeitsschritt der Zielfestlegung schließt mit<br />
der Leitentscheidung für den Umgang mit Dränagen ab.<br />
Konzepte<br />
Ganzheitlich betrachtet, ist der Einfluss des Dränagewassers<br />
auf das Gesamtentwässerungssystem von Bedeutung – vom<br />
Ort des Anfalls bis zur Einleitung ins Gewässer.<br />
Durch die Wechselwirkungen der einzelnen Elemente können<br />
Lösungskonzepte für Dränagewasser an unterschiedlichen<br />
Stellen des Gesamtsystems ansetzen: am Gebäude,<br />
im Bereich der Abwasser-/ Dränagewasseranlagen und bei<br />
den Sonderbauwerken wie Pumpwerken, Regenbecken<br />
und Kläranlage. Je nach örtlichen Randbedingungen und<br />
Zielsetzungen können die Maßnahmen im Planungsgebiet<br />
sehr unterschiedlich ausfallen: von (1.) der Duldung und<br />
Beibehaltung des Ist-Zustandes über (2.) Maßnahmen zur<br />
Unterbindung von bestehenden Dränagewassereinleitungen<br />
in die Abwasseranlage (z.B. Abklemmen von Dränagen und<br />
nachträgliche Abdichtung der Häuser im Bestand, einer<br />
(3.) Vermeidung von neuen Dränagewassereinleitungen<br />
(z.B. durch den Bau Weißer Wannen in Neubaugebieten),<br />
Bild 3: Mögliche Folgeprobleme: Gebäudevernässung<br />
einer (4.) Bereitstellung einer alternativen Vorflut für das<br />
Dränagewasser (z.B. durch den Neubau eines Dränagewassersammlers)<br />
bis hin zu (5.) einer Erweiterung oder/<br />
und Ertüchtigung von Sonderbauwerken als flankierende<br />
Maßnahme oder im absoluten Ausnahmefall auch als<br />
End-of-Pipe-Lösung.<br />
Der Leitfaden bietet abhängig von der Anschlusssituation<br />
im Bestand eine Auswahlmatrix, die das Spektrum der<br />
Möglichkeiten aufzeigt und im Hinblick auf unterschiedliche<br />
Kriterien wie Ökologie, Ökonomie, technische Machbarkeit,<br />
Akzeptanz, rechtliche Aspekte und Erfolgssicherheit bewertet.<br />
In Beispielszenarien werden ausgewählte, in der Praxis<br />
realisierte Lösungen detailliert beschrieben und gewichtet.<br />
KANAL- INSPEKTIONS- DICHTHEITSPRÜF-<br />
REPARATUR- UND SANIERUNGSANLAGEN<br />
03 / 2013 55
FACHBERICHT SPECIAL: INSPEKTION & GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNG<br />
3. End-of-pipe-/anlagentechnische Lösungen (Maßnahmen<br />
an Regenwasserbehandlungsanlagen, Pumpwerken oder<br />
der Kläranlage) sollten die absolute Ausnahme bleiben,<br />
da das gesamte Fremdwasser weiterhin mit abgeleitet,<br />
ggf. gepumpt und behandelt werden muss.<br />
Bild 4: Inhalt und Werkzeuge des Leitfadens<br />
Argumentation<br />
Die Umsetzung und die Akzeptanz des gewählten Konzeptes<br />
werden durch sachgerechte, breitgefächerte Argumente<br />
erleichtert. Daher enthält der Leitfaden einen Fundus mit<br />
Fragen/Antworten und Hinweisen, die für die Kommune bei<br />
der Kommunikation ihres Handlungsbedarfs, ihres Konzeptes<br />
und ihrer Leitentscheidung insbesondere gegenüber der<br />
örtlichen Politik und dem Bürger eine Orientierung geben.<br />
Aus diesem Fundus kann von den Kommunen ein individueller<br />
Argumentationskatalog mit den Aspekten Ökologie/<br />
Umweltschutz, Betrieb, Gebäudeschutz/Gesundheit, Ökonomie/Finanzierung,<br />
Durchsetzbarkeit/Akzeptanz und Recht/<br />
Auflagen der Aufsichtsbehörden zusammengestellt werden.<br />
Kommunikation<br />
Eine wesentliche Voraussetzung für den Projekterfolg ist,<br />
dass Politiker, Aufsichtsbehörden und Bürger die Leitentscheidung<br />
der Kommune mittragen. Hierzu ist eine frühzeitige<br />
Einbindung aller Beteiligten notwendig.<br />
Weiterhin muss die Kontinuität des Informationsflusses<br />
über den gesamten Prozess hinweg sichergestellt werden.<br />
Eine Hilfestellung über Art und Umfang der Kommunikation<br />
mit der jeweiligen Zielgruppe geben die im Leitfaden<br />
aufgeführten Kommunikationsstrategien.<br />
LEITSÄTZE FÜR DEN UMGANG MIT DRÄNAGEN<br />
Ein Ergebnis des Projektes sind folgende (hier verkürzt wiedergegebene)<br />
Leitsätze für den Umgang mit Dränagen,<br />
die sich aus den Diskussionen ableiten lassen. Sie geben<br />
den Kommunen in NRW eine Orientierung, wie geltende<br />
rechtliche Vorgaben mit pragmatischen Lösungsansätzen<br />
umgesetzt werden können.<br />
Ökologie/Umweltschutz<br />
1. Eingriffe in den Grundwasserleiter sind nach Möglichkeit<br />
zu vermeiden. Ausnahmen sind möglich, wenn ansonsten<br />
Nutzungskonflikte drohen.<br />
2. Dränagewasser von privaten Grundstücken sollte zur<br />
Vermeidung der o.g. Probleme grundsätzlich nicht in<br />
öffentliche und private Abwasseranlagen eingeleitet<br />
werden.<br />
Betrieb<br />
4. Der Umgang mit Dränagen sollte beim Neubau und im<br />
Bestand (Anschluss an RW-, MW-, SW-Systeme) differenziert<br />
betrachtet werden. Im Bestand können in<br />
Einzelfällen Ausnahmeregelungen zur Beibehaltung von<br />
Dränageanschlüssen (z.B. bei drohender Gebäudevernässung)<br />
sinnvoll sein.<br />
5. Sofern die Abwasseranlage im Übrigen nach den<br />
a.a.R.d.T. betrieben wird und kein sonstiger Handlungsbedarf<br />
(z.B. erhöhter Fremdwasseranfall) besteht, kann<br />
die Kommune eigenverantwortlich entscheiden, wie sie<br />
mit DW-Einleitungen umgehen möchte.<br />
6. Wenn Fremdwasserprobleme bestehen und/oder die<br />
Abwasseranlage nicht den a.a.R.d.T entspricht, besteht<br />
aus Sicht der Aufsichtbehörden Handlungsbedarf.<br />
7. In Fremdwasserschwerpunktgebieten sollten Dränagen<br />
umgeklemmt und Alternativen geschaffen werden,<br />
wenn ansonsten Gebäudevernässungen drohen oder<br />
sich das Problem nur auf andere Anlagenbestandteile<br />
verlagern könnte.<br />
8. Außerhalb von Fremdwassergebieten sollte die Kommune<br />
die Entscheidung über den Umgang mit bestehenden<br />
Dränagen im Rahmen ihrer Leitentscheidung für das<br />
jeweilige Gebiet treffen. Entsprechende Regelungen sollten<br />
in die Kommunale Abwassersatzung aufgenommen<br />
werden (§ 7 Abs. 2 Nr. 11 der Mustersatzung).<br />
9. Der Umgang mit Dränagen erfordert in vielen Fällen<br />
unterschiedliche Leitentscheidungen für einzelne Stadtgebiete<br />
abhängig von den örtlichen Randbedingungen<br />
wie z.B. Hydrogeologie, Demographie, Satzung,<br />
Entwässerungssystem.<br />
Gebäudeschutz/Gesundheit<br />
10. Zur Berücksichtigung der Auswirkungen geplanter<br />
Maßnahmen z.B. auf den Grundwasserspiegel und<br />
den Gebäudebestand sind ganzheitliche Konzepte auch<br />
unter Einbeziehung der zu erwartenden zukünftigen<br />
Entwicklungen zu empfehlen.<br />
11. Wenn möglich, ist der Status quo des Grundwasserstandes<br />
mit Blick auf Gebäudeschutz/Gesundheit<br />
beizubehalten.<br />
Ökonomie/Finanzierung<br />
12. Dränagewasser als Bestandteil des Fremdwassers verursacht<br />
Kosten. Jede Kommune sollte prüfen und im<br />
politischen Raum abstimmen, wie diese zukünftig (ggfs.<br />
nach dem Verursacherprinzip) umgelegt werden sollen.<br />
Durchsetzbarkeit/Akzeptanz<br />
13. Zur Beurteilung der Fremd-/Dränagewassersituation<br />
werden Frachtbetrachtungen grundsätzlich immer<br />
56 03 / 2013
empfohlen. Zeigen diese, dass als Konzentrationswerte<br />
festgelegte Anforderungen entgegen dem Stand der<br />
Technik durch Verdünnung erreicht wurden, besteht<br />
schon aus diesem Grund Handlungsbedarf. Die Untersuchungsergebnisse<br />
liefern dann eine solide Basis für die<br />
Argumentation gegenüber der Politik, dass die Kommune<br />
tätig werden muss.<br />
14. Der Umgang mit Dränagen stellt ein Konfliktthema im<br />
Spannungsfeld Gebäudeschutz / Ver- und Entsorgungssicherheit<br />
/ Gewässer- und Bodenschutz dar, bei dem<br />
die monetäre und faktische Verhältnismäßigkeit von<br />
Lösungsalternativen zu prüfen ist.<br />
Recht<br />
15. Das Thema „Dränagen“ ist, wenn Handlungsbedarf<br />
besteht (z.B. Nicht-Einhaltung behördlicher Auflagen,<br />
hydraulische Probleme, Vernässungsprobleme), auch<br />
unabhängig von der Dichtheitsprüfung privater Abwasseranlagen<br />
gemäß § 61a LWG anzugehen.<br />
Leitentscheidung/Übergeordnete Zielsetzung für<br />
Lösungsoptionen<br />
16. Eine Leitentscheidung, die für die Sanierung kleinerer<br />
Teilgebiete einen ganzheitlichen Ansatz beinhaltet, ist<br />
einem Lösungskonzept vorzuziehen, das großräumig<br />
angelegt ist, die Probleme aber nicht nachhaltig löst.<br />
Die im Rahmen des Projektes stattgefundenen Diskussionsrunden<br />
und Erfahrungsaustausche mit den projektbeteiligten<br />
Kommunen, den Experten und den Vertretern der<br />
Bezirksregierungen in NRW haben verdeutlicht, dass grundsätzlich<br />
eine einheitliche Umsetzungspraxis anzustreben<br />
ist, ohne dabei jedoch in die im pflichtgemäßen Ermessen<br />
der Aufsichtsbehörde liegenden Einzelentscheidungen einzugreifen.<br />
Außerdem bleibt der Entscheidungsspielraum<br />
unter Berücksichtigung der örtlichen Bedingungen in der<br />
betroffenen Kommune bestehen.<br />
LITERATUR:<br />
[1] EU-Wasserrahmen-RL: Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen<br />
Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung<br />
eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im<br />
Bereich der Wasserpolitik<br />
[2] WHG (März 2010): Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts<br />
[3] DIN 1986-100 „Entwässerungsanlagen für Gebäude und<br />
Grundstücke - Teil 100: Bestimmungen in Verbindung mit DIN<br />
EN 752 und DIN EN 12056“ (2008-05)<br />
[4] DIN 4095 Baugrund „Dränung zum Schutz baulicher Anlagen;<br />
Planung, Bemessung und Ausführung“ (1990-06)<br />
[5] DWA-M 182 „Fremdwasser in Entwässerungssystemen“ (2012-04)<br />
[6] IKT; Ing.-Büro Beck; Hydro-Ingenieure GmbH; ahu AG; KuA-<br />
NRW, (2006): Pilotprojekt der Stadt Billerbeck - Dränagewasser<br />
von Privatgrundstücken - Umweltgerecht Sammeln und Ableiten,<br />
gefördert vom MUNLV NRW<br />
[7] IKT; Ing.-Büro Beck; Hydro-Ingenieure GmbH; ahu AG; KuA-NRW;<br />
(2009): Pilotprojekt der Stadt Billerbeck - Fremdwassersanierung -<br />
Konzepte und Umsetzung im Mischsystem, gefördert vom MUNLV<br />
NRW<br />
[8] Lange, M. (2006): Dränagewasserkonzepte - Konflikt zwischen<br />
technischen Möglichkeiten, rechtlicher Machbarkeit und<br />
Finanzierung; KuA-NRW<br />
AUTOREN<br />
Dipl.-Ing. AMELY DYRBUSCH<br />
Institut für Unterirdische Infrastruktur,<br />
Gelsenkirchen<br />
Tel. +49 209 17806-38<br />
E-Mail: dyrbusch@ikt.de<br />
Dipl.-Biol. DAGMAR CARINA SCHAAF<br />
KommunalAgenturNRW, Düsseldorf<br />
Tel. +49 211 430-7719<br />
E-Mail: schaaf@KommunalAgenturNRW.de<br />
RBD Dipl.-Ing. BERT SCHUMACHER<br />
Bezirksregierung Detmold<br />
Tel. +49 5231 71-5408<br />
E-Mail: bert.schumacher@brdt.nrw.de<br />
03 / 2013 57
SYMPOSIUM 25. und 26. April 2013<br />
Regenwasserbewirtschaftung:<br />
Stormwater Management<br />
auf der WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2013<br />
TOP-THEMA<br />
IN BERLIN:<br />
Nachhaltiger<br />
Umgang mit<br />
Regenwasser<br />
In Kooperation mit dem Beuth-Verlag und dem Bund<br />
der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft<br />
und Kulturbau e.V. (BWK) veranstaltet die technischwissenschaftliche<br />
Fachzeitschrift gwf-<br />
Wasser|Abwasser am 25. und 26. April<br />
2013 ein Symposium zum nachhaltigen<br />
Umgang mit Regenwasser im Rahmen der<br />
WASSER BERLIN INTERNATIONAL. Hochkarätige<br />
Referenten werden zum Stand der<br />
Forschung, über die aktuelle Gesetzeslage<br />
sowie über Projekte im In- und Ausland<br />
berichten. Auf einer Fachexkursion zur<br />
Rummelsburger Bucht im Osten Berlins<br />
lassen sich Grundlagen und Ausführung<br />
dezentraler Regenwasserbewirtschaftung<br />
aus der Nähe in Augenschein<br />
nehmen.<br />
Anmeldung bei:<br />
WASSER BERLIN INTERNATIONAL<br />
Sandra Jerat<br />
jerat@messe-berlin.de<br />
Tel.: +49 (0)30 / 3038-2341<br />
Fax: +49 (0)30 / 3038-2079<br />
Anmeldung für die Exkursion/<br />
Abendveranstaltung bei:<br />
DIN-Akademie<br />
Sarah Mareike Sternheim<br />
sarah_mareike.sternheim@beuth.de<br />
Tel.: +49 (0)30 / 2601-2868<br />
Fax: +49 (0)30 / 2601-42868<br />
Die Kosten für die Exkursion betragen<br />
25,00 EUR inkl. Bus-Shuttle zur Rummelsburger<br />
Bucht.<br />
58 03 / 2013
Eine Veranstaltung von<br />
Unsere Themen und Referenten:<br />
Donnerstag, 25. April 2013, Vormittags Exkursion<br />
13:00 Uhr Begrüßung, Dr.-Ing. Heiko Sieker,<br />
Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH, Berlin<br />
13:35 Uhr Bestandsaufnahme und Ausblick für<br />
die Regenwasserbewirtschaftung<br />
Prof. Dr. Friedhelm Sieker,<br />
Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH, Berlin<br />
14:05 Uhr Regenwasserbewirtschaftung in den<br />
Niederlanden<br />
Dr. Govert Geldof, Ingenieurbüro Geldof, Niederlande<br />
14:35 Uhr Stromwater Management in Scotland<br />
Brian D‘Arcy, Environmental Consultant, Scotland<br />
15:05 Uhr Regenwassermanagement in Berlin<br />
Matthias Rehfeld-Klein, Senatsverwaltung für<br />
Stadtentwicklung und Umwelt, Berlin<br />
15:30 Uhr Pause<br />
16:00 Uhr Regenwassermanagement bei<br />
großflächigen Gewerbe- und<br />
Logistikansiedlungen<br />
Dr. Mathias Kaiser, KaiserIngenieure, Dortmund<br />
16:30 Uhr Regenwassermanagement –<br />
Erfahrungen aus der Emscherregion<br />
Michael Becker, Abt.-Ltr. Wasserwirtschaft,<br />
Emschergenossenschaft/Lippeverband<br />
17:00 Uhr Zusammenfassung der Vorträge<br />
Dr.-Ing. Heiko Sieker,<br />
Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH, Berlin<br />
17:15 Uhr Firmenpräsentationen<br />
17:45 Uhr Übergang zum Get-Together/Messehalle<br />
Ca. 21:00 Uhr Ende Get-Together<br />
Freitag, 26. April 2013<br />
9:00 Uhr Begrüßung, Dr.-Ing. Heiko Sieker,<br />
Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH, Berlin<br />
09:15 Uhr Aktuelle Entwicklungen im technischen<br />
Regelwerk für Regenwetterabflüsse<br />
Prof. Dr. Theo Schmitt, TU Kaiserslautern, DWA<br />
09:45 Uhr Immissionsorientierte Misch- und Niederschlagswasserbehandlung<br />
nach BWK-<br />
M3/M7: Erfahrungen und Perspektiven<br />
aus einem Jahrzehnt Anwendungspraxis<br />
Prof. Dr. Dietrich Borchardt, TU Dresden, Department<br />
Aquatische Ökosystemanalyse und Management,<br />
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ<br />
10:15 Uhr Regenwassernutzung – nationale und<br />
internationale Normung<br />
Prof. Dr.-Ing. Martin Oldenburg, Hochschule Ostwestfalen-Lippe,<br />
FB Umweltingenieurwesen und<br />
Angewandte Informatik<br />
10:45 Uhr Pause<br />
11:15 Uhr Bauaufsichtliche Zulassungen von<br />
dezentralen Niederschlagswasserbehandlungsanlagen<br />
Prof. Dr.-Ing. habil. Antje Welker,<br />
FH Frankfurt, FG Siedlungswasserwirtschaft<br />
11:45 Uhr Zukunftsaufgabe Multicodierung: urbane<br />
Stadträume und Flächen für die Regenwasserbewirtschaftung<br />
– Herausforderungen,<br />
Stolpersteine und Strategien<br />
Prof. Dr. Carlo W. Becker, bgmr Landschaftsarchitekten<br />
Berlin/Leipzig / BTU Cottbus<br />
12:15 Uhr Podiumsdiskussion<br />
12:45 Uhr Ende des Symposiums<br />
WEITERE PROGRAMMPUNKTE Unternehmenspräsentationen, Podiumsdiskussionen,<br />
Abendveranstaltung und Exkursion „Dezentrale Regenwasserbewirtschaftung im<br />
Wohngebiet Rummelsburger Bucht in Berlin“<br />
03 / 2013 59
FACHBERICHT ABWASSERENTSORGUNG<br />
RECHT & REGELWERK<br />
Anbindung von Schlauchlinern<br />
an Schächte<br />
Erste Erfahrungen mit Manschetten<br />
Lange Jahre stellte die Anbindung der Schlauchliner an Schächte einen Systemschwachpunkt dar. Mit der Bereitstellung<br />
von Manschetten verschiedener Bauarten hat die Industrie hierauf reagiert. Für viele Fälle stehen für den kreisrunden<br />
Rohrbereich auch in kleinen Nennweiten ausgereifte und teilweise umfänglich auf Gebrauchstauglichkeit geprüfte Produkte<br />
zur Verfügung. Die Kosten für den Einsatz der Manschetten stehen in einem langfristig guten Verhältnis zu deren Nutzen.<br />
Eine Standardmanschette für alle geometrischen Fälle am Übergang zu den Schächten ist auch für diese Anwendung<br />
nicht verfügbar. Der Planer muss in Kenntnis der jeweiligen örtlichen Situation die geeignete Manschette ermitteln, um<br />
eine sachgerechte Ausschreibung vornehmen zu können. Die ausführenden Firmen werden aus Haftungsgründen mit<br />
dafür sorgen, dass die neuen Manschettentechniken genutzt werden.<br />
AUSGEREIFTE RENOVIERUNGSTECHNIK MIT<br />
SCHWÄCHEN AN DER PERIPHERIE<br />
Mit der zunehmenden Standardisierung der Schlauchliningtechnik<br />
[1] zur Sanierung von Entwässerungskanälen hat<br />
sich diese zum meistgenutzten Renovierungsverfahren [2]<br />
in Deutschland entwickelt. Die Herstellungs- und Anwendungssicherheit<br />
konnte kontinuierlich gesteigert werden,<br />
obgleich auch heute jede Linerinstallation aufs Neue ein Unikat<br />
zur Folge hat, dessen Eigenschaften von der konkreten<br />
Einbausituation beeinflusst werden. Um die zugedachten<br />
Eigenschaften und Vorteile zu erreichen, bedarf es von der<br />
Produktion der Einzelbestandteile über die Planung bis zur<br />
Installation vor Ort dauerhaft großer Sorgfalt, um ein mangelfreies<br />
Werk sicherstellen zu können. Allerdings stößt auch<br />
ein Regelbauverfahren wie das Schlauchlining-Verfahren im<br />
Sinne des Wortes an seine „Grenzen“.<br />
Als Achillesferse des Verfahrens gilt bis heute die Anbindung<br />
an Schächte und an Zuläufe. Dies hängt primär damit<br />
zusammen, dass die Schlauchliner als „Rohr-im-Rohr-System“<br />
regelmäßig ohne Verklebung mit dem Altrohr auskommen<br />
müssen und somit eine gewisse „Beweglichkeit“ der<br />
Liner nicht ausgeschlossen werden kann. Dem gegenüber<br />
waren die Zulauf- und Schachtanbindungen bislang als<br />
starre Verbindungen durch Verkleben konzipiert:<br />
1. Abdichtung des Ringspalts (Wasserdichtheit)<br />
2. Mechanischer Schutz der Linerenden vor betrieblichen<br />
Einflüssen (z.B. Hochdruckreinigung)<br />
Als verbreitete Anbindungsarten an Schächte wurden – in<br />
Abhängigkeit der Planung und der verfolgten Sicherheitsphilosophie<br />
– die Verspachtelung mit kunststoff modifiziertem<br />
Zementmörtel oder Epoxidharz und im besten Falle das Laminieren<br />
vorgesehen. Bei anstehendem Grundwasser wurden<br />
zum Grundwasserstopp diese von einer Harzinjektion oder<br />
dem Einbau von Quellbändern jeweils im Ringspalt flankiert.<br />
Alle bislang gängigen Anbindungsverfahren von Linern an<br />
Schächte weisen den grundsätzlich gleichen Schwachpunkt<br />
einer starren, unflexiblen Verbindung auf, die sich letztlich in<br />
einer mehr oder weniger hohen Mängelquote ausdrücken.<br />
Bei fachgerechter Ausführung kann sich die Laminattechnik<br />
positiv von der Verspachtelung mit Epoxidharz abheben.<br />
Bild 1: Lineranbindung durch Verspachtelung mit Epoxidharz<br />
Bild 2: Lineranbindung durch Laminieren<br />
60 03 / 2013
ABWASSERENTSORGUNG RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
Bild 3: AMEX-Linerendmanschette vom Schacht aus<br />
Dies hat ihre Ursache in der vergleichsweise großen Klebefläche.<br />
Diese ermöglicht es, entstehende Spannungen<br />
besser aufzunehmen. Überwiegend rein kosmetischer Natur<br />
ist daneben die noch immer weit verbreitete Verspachtelung<br />
mit kunststoffmodifiziertem Zementmörtel. Sofern<br />
Bewegungen im Liner selbst stattfinden und/oder Grundwasserdruck<br />
entsteht, sind solche Anbindungen regelmäßig<br />
nicht in der Lage, den anfänglich ggf. vorhandenen<br />
Kraftschluss aufrechtzuerhalten. Ursächlich hierfür ist die<br />
Tatsache, dass eine Klebeverbindung zwischen PCC-Mörtel<br />
und dem Schlauchliner nicht zu erreichen ist und somit<br />
nennenswerte Haftzugfestigkeiten (Widerstand gegen den<br />
Abriss) nicht gegeben sind.<br />
Gleichzeitig sind die Anforderungen an die Ausführung der<br />
Anbindungen nicht trivial und durch die örtlichen Randbedingungen<br />
individuell erschwert:<br />
»»<br />
Schaffung klebefähiger Untergrund am Rohr/im Schacht<br />
»»<br />
Herstellung einer Ringnut zum definierten Materialauftrag<br />
am Rohr/im Schacht zur Linerrückseite hin (bei<br />
Verwendung von Spachtelmaterialien)<br />
»»<br />
Beseitigung von Folien an Linern (außen/innen) zur<br />
Schaffung von klebefähigen Flächen<br />
»»<br />
Säuberung der vorbereiteten Klebeflächen<br />
»»<br />
Freihaltung der vorbereiteten Stellen von Abwasser und<br />
Schmutz bis zum Abschluss der Reaktion der verarbeiteten<br />
Materialien<br />
Lange Jahre musste insbesondere in nichtbegehbaren Querschnitten<br />
mit diesen Möglichkeiten vorliebgenommen werden.<br />
Die grundsätzlich bessere Lösung des Laminierens<br />
wurde hierbei aus Kostengründen oft nicht gefordert.<br />
Die Lösung des Laminierens wird als flexibelste aller Anbindemöglichkeiten<br />
auch neben den nachfolgend beschriebenen<br />
mechanischen Linerendmanschetten ihre Berechtigung und<br />
Erfordernis grundsätzlich weiter behalten. Dies insbesondere<br />
dann, wenn auch die Schachtunterteile mit gleichartigen<br />
Materialien (GFK-Schalen/-laminaten) ausgekleidet werden.<br />
LÖSUNGSANSATZ: MANSCHETTEN ZUR FLEXIBLEN<br />
ANBINDUNG VON LINERN AN SCHÄCHTE<br />
Entwicklungen entstehen oft auf Druck des Marktes. So<br />
auch im Falle der Linerendmanschetten. Auf Grund einer<br />
Bild 4: AMEX-Linerendmanschette vom Kanal aus<br />
besonderen Aufgabenstellung der Gemeinde Schwanau<br />
in Baden-Württemberg musste in 2009 nach Mitteln und<br />
Wegen gesucht werden, um die Abdichtung von Ringspalten<br />
bei Schlauchlinern unter Grundwasserdruck und ohne<br />
den Einsatz von Reaktionsharzen - quasi rein mechanisch<br />
- bewerkstelligen zu können.<br />
Zwei Unternehmen wurden hierzu auf deren Möglichkeiten<br />
hin angesprochen. Sowohl die Amex GmbH, Nöbdenitz, als<br />
auch die Uhrig Kanaltechnik GmbH, Geisingen, letztere im<br />
Verbund mit einem namhaften Linerhersteller, haben sich<br />
der Aufgabe angenommen und in relativ kurzer Zeit Lösungen<br />
entwickelt. Die Erfahrungswerte des Autors beschränken<br />
sich inhaltlich auf diese beiden Systeme.<br />
Grundprinzip und Voraussetzungen<br />
Der Vorteil der mechanischen Manschettensysteme gegenüber<br />
den herkömmlichen Lineranbindungen besteht im<br />
Wesentlichen darin, dass vor Ort keine Kunststoffe zur<br />
Aushärtung gebracht werden müssen (Ausführungsrisiken<br />
sind dadurch extrem minimiert) und keine starren Verbindungen<br />
entstehen.<br />
Das Grundprinzip dieser mechanischen Linerendmanschetten-Systeme<br />
besteht darin, den wasserdichten Lineranschluss<br />
noch im Kanal sicherzustellen. Hierzu wird der<br />
Liner ca. 15 cm vor dem Schacht gekürzt und über dem<br />
Linerende eine elastisch abdichtende Manschette gesetzt.<br />
Diese dichtet den Ringspalt über die EPDM-Gummi-Lage<br />
durch Kompression ab und ermöglicht es dem Liner, sich<br />
dauerhaft zu bewegen (z.B. bei Relaxation infolge innerer<br />
Spannungen, Temperaturänderungen), ohne die Endabdichtung<br />
in Frage zu stellen.<br />
Voraussetzung ist, dass der Manschettensetzbereich zwischen<br />
zurückgeschnittenem Linerende und Schacht schadensfrei<br />
ist. Sofern in diesem Rohrabschnitt bauliche Defizite<br />
vorliegen, müssen diese vor Linereinbau vorsaniert werden,<br />
um ein möglichst vollständiges, flächiges Anliegen der<br />
Manschettendichtungen erreichen zu können. Weiterhin<br />
dürfen im Linerendbereich keine Falten oder Verwerfungen<br />
im Liner selbst vorliegen. Bei dünnwandigen Linern und<br />
einer gleichzeitig stark aufgelösten Rohroberfläche z.B.<br />
Korrosion in Betonrohren können die Unebenheiten in der<br />
03 / 2013 61
FACHBERICHT ABWASSERENTSORGUNG<br />
RECHT & REGELWERK<br />
Lineroberfläche sowie Linerfalten den erfolgreichen Einsatz<br />
von Manschetten verhindern.<br />
Durch den Einbau von Manschetten kommt es zu einer<br />
punktuellen Querschnittsreduzierung über den Liner hinaus.<br />
Hydraulisch entstehen hierdurch regelmäßig keine<br />
Probleme. Im Kanalbetrieb können diese jedoch gerade<br />
bei kleinen Rohrnennweiten < DN 300 dazu führen, dass<br />
Arbeitsgeräte (z.B. Roboter) hierdurch behindert sind. Zur<br />
Sanierung erforderliche Arbeiten in den Haltungen sollten<br />
somit vor dem Einbau von Linerendmanschetten erfolgreich<br />
abgeschlossen werden.<br />
AMEX-Linerendmanschette<br />
Die Amex GmbH setzt seit über zehn Jahren die AMEX ® -10-<br />
Mono-Manschetten zur Abdichtung von Leckagen auch in<br />
Druckrohrleitungen der Gas- und Wasserversorgung erfolgreich<br />
ein. Die Amex-Manschette fand in der Vergangenheit<br />
auch Anwendung in Verbindung mit Linern im begehbaren<br />
Kanalbereich. Die Ursprungsmanschette für die Reparatur<br />
von undichten Rohrverbindungen verfügt zwischenzeitlich<br />
über eine DIBt-Zulassung [3] für den Nennweitenbereich<br />
DN 800 bis DN 2000. Insofern stellte sich die Frage, ob das<br />
System auch „miniaturisiert“ im nichtbegehbaren Kanal ab<br />
DN 200 zum Einsatz als Manschette zur Lineranbindung<br />
gelangen kann?<br />
Das Unternehmen zeigte sich innovativ und so konnten<br />
bereits im Jahresverlauf 2010 erste Tests in Kanälen DN 250<br />
und DN 300 erfolgreich durchgeführt werden. Nach mehreren<br />
Optimierungen zur Reduzierung der Materialdicken<br />
und somit der Minimierung der Einschränkung des verbleibenden<br />
Querschnitts steht heute ein flexibel einsetzbares<br />
Manschettensystem zur Verfügung.<br />
Das Manschettensystem besteht aus<br />
»»<br />
einer EPDM-Elastomermanschette, abgestimmt auf die<br />
Nennweite und die zu überbrückende Wanddicke des<br />
Liners,<br />
»»<br />
i. d. R. drei Spannbändern, zur Fixierung der EPDM-<br />
Manschette gegen Liner bzw. Altrohr.<br />
Vorteile:<br />
»»<br />
Flexibel einsetzbar auch bei deutlichen Auswinkelungen<br />
oder Lageversätzen von im Setzbereich vorhandenen<br />
Rohrverbindungen oder Radialrissen<br />
»»<br />
Die Manschette kann bei Bedarf aus- und wieder eingebaut<br />
werden, ohne dass ein Materialersatz erforderlich<br />
wird oder Beschädigungen am Liner entstehen<br />
Nachteile:<br />
»»<br />
die EPDM-Elastomermanschette ist dem Kanalbetrieb<br />
ungeschützt ausgesetzt<br />
»»<br />
die drei Spannbänder bieten neben der Manschette<br />
selbst jede für sich einen potenziellen Angriffspunkt<br />
im Kanalbetrieb<br />
QUICK-LOCK-Linerendmanschette<br />
Die Uhrig Kanaltechnik GmbH bietet die QUICK-LOCK-Edelstahlmanschette<br />
seit vielen Jahren als Reparaturverfahren<br />
im nichtbegehbaren Kanal erfolgreich an. Die Manschette<br />
verfügt über eine DIBt-Zulassung [4]. Insofern stellte sich die<br />
Frage, ob das System modifiziert auch über Linerenden zum<br />
Einsatz gelangen kann?<br />
Auch die Uhrig Kanaltechnik GmbH griff die Fragestellung<br />
auf und entwickelte in Kooperation mit der RELINEEUROPE<br />
AG, Rohrbach, die QUICK-LOCK Linderendmanschette. Im<br />
Rahmen umfangreicher Eignungstests wurde die Manschette<br />
optimiert und deren Hochdruckspülbeständigkeit [5]<br />
eindrucksvoll nachgewiesen. Aktuell stehen Manschetten<br />
für den Nennweitenbereich DN 150 bis DN 600 zur Verfügung.<br />
Die bestehende DIBt-Zulassung [4] wurde um die<br />
Anbindung von Linern in 2012 erweitert.<br />
Neben der Optimierung der eigentlichen Manschette<br />
wurde auch die Gerätetechnik zur Installation der<br />
Manschette auf die Baustellenbedürfnisse und die<br />
Arbeitssicherheit hin angepasst. Besonders eindrucksvoll<br />
ist hierbei die der Medizintechnik entlehnte Technik<br />
zum Kürzen der Liner im Kanal, ohne das Altrohr<br />
beschädigen zu können. Neben der Schnitttiefeneinstellung<br />
verfügt das Trenngerät über eine oszillierende<br />
Trennscheibe (nur Schwingung, keine Drehbewegung).<br />
Dies reduziert neben der Verletzungsgefahr auch die<br />
Staubentwicklung.<br />
Das Manschettensystem besteht aus<br />
»»<br />
einem EPDM-Flächenelastomer, abgestimmt auf die<br />
Nennweite und die zu überbrückende Wanddicke des<br />
Liners,<br />
»»<br />
einer vollständig überdeckenden Edelstahlmanschette,<br />
zur Fixierung der EPDM-Flächenelastomer gegen Liner<br />
bzw. Altrohr.<br />
Vorteile:<br />
»»<br />
Optimierte Geometrie zum Schutz gegen betriebliche<br />
Einflüsse<br />
»»<br />
Wasserdicht auch bei hohen Grundwasseraußendrücken<br />
»»<br />
durch Einbau mit leichten Überstand in den Schacht<br />
kann die Manschette als mechanischer Schutz der Rohrkante<br />
bei Einsatz von Spüldüsen (Umlenkrollen) genutzt<br />
werden<br />
Nachteile:<br />
»»<br />
Als starres System sind nur minimale Auswinkelungen<br />
(≤ 1°) und praktisch keine Versätze von Rohrverbindungen<br />
oder Radialrissen im Manschettensetzbereich<br />
hinnehmbar<br />
»»<br />
Die Manschette kann bei Bedarf nur mit vollständigem<br />
Materialersatz aus- und wieder eingebaut werden,<br />
Beschädigungen am Liner entstehen nicht<br />
ANSPRUCH AN DIE EINSATZPLANUNG VON<br />
MANSCHETTEN ZUR LINERANBINDUNG<br />
Die Wahl der Art zur Lineranbindung an Schächte erfordert<br />
die genaue Inaugenscheinnahme der Mündungssituation<br />
der Kanäle vor/nach den Schächten. Vielfältige geometrische<br />
Gegebenheiten und Erfordernisse nehmen Einfluss auf die<br />
mögliche Art der Lineranbindung und ggf. erforderliche<br />
Vorarbeiten.<br />
Auch die herkömmlichen Anbindungsarten sind - zumindest<br />
was die Laminattechnik betrifft - weiterhin eine nicht außer<br />
Betracht zu lassende Alternative. Gleichwohl empfiehlt sich<br />
62 03 / 2013
ABWASSERENTSORGUNG RECHT & REGELWERK FACHBERICHT<br />
Bild 5: QUICK-LOCK-Linerendmanschette vom Schacht aus<br />
die Nutzung mechanischer Manschetten in vielen Fällen,<br />
um die bisherigen Systemschwäche beseitigen zu können.<br />
Die vorgesehene Nutzung von Linerendmanschetten bedeutet<br />
für den Planer, dass er sich einen vollständigen Eindruck über die<br />
unmittelbare Rohrmündungssituation verschaffen muss. Sind<br />
die Videoaufzeichnungen hierzu unzureichend, ist eine Schachtbegehung<br />
die probate Möglichkeit sich Klarheit zu schaffen.<br />
Gemäß Kap. 0.2.7, DIN 18326, VOB/C [6] muss der Planer<br />
die Art der Schachtanbindung vorgeben. Da es sich in dieser<br />
Frage um ein entscheidendes Merkmal zur Dauerhaftigkeit<br />
der Systemdichtheit handelt, kann es nicht den Unternehmen<br />
überlassen werden, wie die Art der Lineranbindung<br />
vorgenommen werden soll. Die Kosten einer Manschette<br />
(ca. 400 €/Manschette bei DN 300) sind signifikant, so<br />
dass es immer billigere Lösung für ein Unternehmen gibt.<br />
Im Preiswettbewerb wird sich ein Unternehmen an dieser<br />
Stelle eher Wettbewerbsvorteile zu verschaffen versuchen.<br />
Scheuen in Zukunft die Netzbetreiber die scheinbar hohen<br />
Kosten für eine solche dauerhafte Lineranbindung, dürfte<br />
ihnen künftig neues Ungemach entstehen. Dem latenten<br />
Mängel- und somit Haftungsrisiko bei den Spachteltechniken,<br />
werden die Firmen ihrerseits durch berechtigte Bedenkenanmeldung<br />
im Zuge der Ausführung begegnen, wenn<br />
diese in der Leistungsbeschreibung gefordert sind. Die meisten<br />
Netzbetreiber werden dann aller Erwartung nach nicht<br />
die Firmen aus der Verantwortung entlassen wollen. Sie<br />
werden dann vermutlich im Nachgang der besseren Lösung<br />
– im Rahmen einer Nachtragsvereinbarung – zustimmen.<br />
Bild 6: QUICK-LOCK-Linerendmanschette vom Kanal aus<br />
FAZIT UND AUSBLICK<br />
Die Anbindung von Schlauchlinern an Schächte auch im nichtbegehbaren<br />
Kreisprofil mit flexiblen, mechanischen Manschettensystemen<br />
stellt einen Quantensprung in der Systemtechnik<br />
des Schlauchlinings dar. Hierdurch werden regelmäßig dauerhaft<br />
dichte und gleichzeitig flexible Anbindungen möglich,<br />
die der Nutzungsdauer der Liner selbst entsprechen oder<br />
zumindest aber nahekommen dürften. Gleichwohl sind auch<br />
diese Systeme nicht in jedem Fall und uneingeschränkt nutzbar.<br />
Die bisherige Erfahrung mit den Endmanschettensystemen<br />
zeigen eindrucksvoll, dass die Techniken systemabhängig<br />
mehr oder weniger weitgehend ausgereift sind und eine signifikante<br />
Nutzensteigerung in Verbindung mit den Schlauchlinern<br />
darstellen. Fehlerpotenzial besteht gleichwohl auch<br />
hier, wenn der Planer die örtlichen Gegebenheiten ignoriert<br />
oder das ausführende Personal beispielsweise die Herstellervorgaben<br />
zum Einbau (z.B. Lage der Schlösser) nicht<br />
berücksichtigt.<br />
Bis wann diese Systeme auch für Sonderprofile weiterentwickelt<br />
werden ist eine Frage der Zeit und letztlich der<br />
Marktnachfrage. Ein zunehmender Markt wird auch in dieser<br />
Produktsparte weitere Produktalternativen zur Auswahl<br />
hervorbringen.<br />
LITERATUR<br />
[1] DIN EN ISO 11296-4:2011 „Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die<br />
Renovierung von erdverlegten drucklosen Entwässerungsnetzen<br />
(Freispiegelleitungen) - Teil 4: Vor Ort härtendes Schlauch-Lining“<br />
[2] DIN EN 15885:2011 „Klassifizierung und Eigenschaften<br />
von Techniken für die Renovierung und Reparatur von<br />
Abwasserkanälen und -leitungen“<br />
[3] Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr. Z-42.3-<br />
474; Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Berlin<br />
[4] Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr. Z-42.3-374;<br />
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Berlin<br />
[5] DIN 19523:2008 „Anforderungen und Prüfverfahren zur<br />
Ermittlung der Hochdruckstrahlbeständigkeit und -spülfestigkeit<br />
von Rohrleitungsteilen für Abwasserleitungen und -kanäle“<br />
[6] VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen -<br />
Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für<br />
Bauleistungen ATV) | DIN 18326:2012 „Renovierungsarbeiten<br />
an Entwässerungskanälen“<br />
Dipl.-Ing. (FH) MARKUS VOGEL<br />
VOGEL Ingenieure, Kappelrodeck<br />
Tel. +49 7842 99449-0<br />
E-Mail: m.vogel@vogel-ingenieure.de<br />
AUTOR<br />
03 / 2013 63
PROJEKT KURZ BELEUCHTET ABWASSERENTSORGUNG<br />
Gemeinde Ense stellt große<br />
Anforderungen an Synthesefaserliner<br />
Die Gemeinde Ense, mit ihren 12.800 Einwohnern, liegt auf dem Haarstrang am nördlichen Rand des Sauerlandes und<br />
grenzt an die Soester Börde an. Das rund 119 km lange Kanalnetz der 14 Ortsteile umfasst 67 km Mischwasser-, 20<br />
km Schmutzwasser- und 28 km Regenwasserkanäle sowie 4 km Druckrohrleitungen. 185 m des 1961 aus Stahlbeton<br />
erstellten Mischwasserkanals in der Mitte des Ortsteils Bremen standen zur Sanierung an.<br />
Bevor die Ausschreibung erfolgte, wurden im Vorfeld verschiedene<br />
Lösungsmöglichkeiten geprüft. Dazu gehörte die<br />
Erstellung eines Sachverständigengutachtens sowie eine<br />
Niederschlags- und Abflussmessung. Diese aufwändigen<br />
Untersuchungen waren auf Grund der Spezifika des Altkanals<br />
bzw. der Randbedingungen notwendig geworden.<br />
Die Teilstrecke bestand aus drei verschiedenen Kanalprofilen:<br />
DN 1000/825 Kastenprofil, DN 1200 Kreisprofil und<br />
DN 1100/1650 Eiprofil, wobei der Übergang vom Kreisauf<br />
das Kastenprofil innerhalb einer Haltung lag. Im bzw.<br />
am Kreisprofil DN 1200 verlief noch eine weitere Versorgungsleitung.<br />
Außerdem waren in mehreren Haltungen<br />
eine Vielzahl von Bögen zwischen 15° und 45° zu berücksichtigen.<br />
Die größtenteils sehr geringe Überdeckung des<br />
Kanals von nur 50 cm war ebenfalls in die Betrachtung mit<br />
einzubeziehen.<br />
Nach Befahrung der Sammler wurden die festgestellten<br />
Mängel nach ATV-M 143-2 beurteilt. Hierbei handelte<br />
es sich hauptsächlich um Verschleißerscheinungen des<br />
Betons in der Sohle, am Kämpfer und im Scheitel sowie um<br />
Aufgeständerte Abwasserüberleitung<br />
DN 600; lichte Durchfahrtshöhe ≥ 4,5m<br />
Inversion Kastenprofil 1000/825 mit<br />
Konus auf DN 1200<br />
Undichtigkeiten an Muffen durch größere Ringspalte, Lage-<br />
Abweichungen und nicht fachgerecht angeschlossene Stutzen.<br />
Zudem existierten an partiellen Stellen Abplatzungen,<br />
Scherbenbildungen und Wurzeleinwüchse. Darüber hinaus<br />
zeigte sich mechanischer Verschleiß und die Bewehrung<br />
war an einigen Stellen im Kastenprofil sichtbar korrodiert.<br />
Dieses Schadensbild galt es bei der Auswahl des technisch<br />
und wirtschaftlich optimierten Verfahrens mit ins Kalkül<br />
zu ziehen. Aber auch Emissionsbelastungen durch Abgase,<br />
Feinstaub und Lärm sollten ebenso gering gehalten werden,<br />
wie die Beeinträchtigung von Boden, Grundwasser,<br />
Gebäuden usw. Schließlich war die Minimierung der Auswirkungen<br />
auf Anwohner und Geschäftsleute ein wichtiges<br />
Thema: Staus, Umleitungen, Störung von Betriebsabläufen,<br />
Anliegerbelastungen.<br />
WAHL DES VERFAHRENS<br />
Betrachtet wurden offene und geschlossene Verfahren, speziell<br />
das Schlauchlining-Verfahren mit den Trägermaterialien<br />
Synthese- und Glasfaser sowie das GFK-Einzelrohr-Lining.<br />
Die Prüfung ergab, dass keine wirtschaftliche<br />
Sanierung in offener Bauweise zu<br />
empfehlen war. Begründet wurde diese<br />
Entscheidung u. a. mit der Dauer der Maßnahme,<br />
der Belastung der Anwohner, den<br />
zu erwartenden Kosten, der Standsicherheit<br />
angrenzender Gebäude sowie der Problematik<br />
der Doppelkanäle. Auch die Sanierung<br />
mittels GFK-Einzelrohr-Lining musste<br />
verworfen werden, da sich der Leitungsquerschnitt<br />
der bestehenden Haltungen zu<br />
sehr reduziert und somit die hydraulische<br />
Leistungsfähigkeit nicht ausgereicht hätte.<br />
Die Bögen innerhalb des Kastenprofiles DN<br />
1000/825 und der Dimensionswechsel auf<br />
das Kreisprofil DN 1200 ließen auch nicht<br />
den Einbau eines Glasfaserliners zu. Das<br />
Ausmaß der Faltenbildung war nicht kalkulierbar.<br />
Daher fiel letztlich die Entscheidung<br />
der Gemeinde, unter Beachtung des Sachverständigengutachtens,<br />
auf den Einbau<br />
von Synthesefaserlinern für alle zu sanierenden<br />
Profile.<br />
Vor der eigentlichen Ausschreibung erfolgte<br />
die Bestimmung der Durchflussmengen bei<br />
64 1-2 | 2013
ABWASSERENTSORGUNG PROJEKT KURZ BELEUCHTET<br />
Trockenwetter und Regenereignissen, um verlässliche Angaben<br />
für die Wasserhaltung während der Ausführung der<br />
Baumaßnahme sowie für die Tiefbauarbeiten zu erhalten.<br />
Die für einen vierwöchigen Messzeitraum eingerichteten<br />
drei Messstellen ergaben einen Regenwetterabfluss von<br />
max. 760 l/s sowie bei Trockenwetter 20 l/s.<br />
Als wirtschaftlichster Anbieter erhielt die Niederlassung<br />
Münster der Insituform Rohrsanierungstechniken GmbH<br />
den Auftrag.<br />
Im ersten Schritt führten Bauherr und Insituform gemeinsame<br />
Gespräche mit den betroffenen Anliegern. Inhaltliche<br />
Schwerpunkte waren zum einem die Aufklärung über die<br />
Baumaßnahme mit dem Hinweis auf die Durchführung<br />
von Dichtheitsprüfungen der <strong>Grundstücksentwässerung</strong>en<br />
sowie der gegebenenfalls notwendigen Sanierung. Zum<br />
anderen dienten die Gespräche der engen Abstimmung,<br />
um sowohl für die Privatpersonen als auch Geschäftsinhaber<br />
und öffentliche Institutionen, wie Bank oder Kirche,<br />
die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.<br />
Aus diesem Grund war das Zeitfenster von vornherein<br />
sehr eng gesteckt. In nur zwei Wochen sollten die Liner<br />
eingebaut sein.<br />
ORTSKERN MIT ENGER INFRASTRUKTUR<br />
Doch bis dahin mussten erst einmal eine ganze Reihe vorbereitender<br />
Arbeiten durchgeführt werden. Los ging es mit der<br />
Sanierung der kreuzenden Wasserleitung im Kreisprofil DN<br />
1200. Es folgten die Herstellung des Pumpensumpfs zum<br />
Ansaugen des Mischwassers und der Aufbau der Wasserhaltung<br />
für 1065 l/s. Die 200 m Stahlrohrleitungen DN 600<br />
wurden auf Grund der örtlichen Verhältnisse - Ortskern mit<br />
enger Infrastruktur - auf der gesamten Länge der Sanierungsstrecke<br />
auf 4,50 m lichte Durchfahrtshöhe aufgeständert.<br />
Dazu war es notwendig, alle 12 m Fundamente<br />
für jeweils zwei Ständer mit Betonfüßen von insgesamt<br />
1,20 m x 2,40 m herzustellen. Ca. 30 % der beauftragten<br />
Summe entfielen daher alleine auf den Auf- und Abbau<br />
sowie das Betreiben der Wasserhaltung.<br />
Parallel dazu wurden mit dem Schachtabbruch und der<br />
Sanierung der Straßenabläufe sowie dem Austausch<br />
einzelner Teilbereiche der Anschlussleitungen in offener<br />
Bauweise begonnen. Es folgten das Fräsen von Wurzeleinwüchsen,<br />
Ablagerungen, Stutzen und einragenden<br />
Dichtungen, das Ausbessern von Abplatzungen und<br />
Verschließen von Einläufen, verdeckten Schächten und<br />
Anschlüssen sowie die Überprüfung der Anschlussleitungen,<br />
ob noch in Betrieb befindlich oder nicht. Im Kreisprofil<br />
kam außerdem das Aufarbeiten der bis zu 30 cm breiten<br />
klaffenden Muffen dazu.<br />
Die Bewehrung, die an mehreren Stellen frei lag, war im<br />
Kastenprofil mit Rostschutz zu versehen und anschließend<br />
mittels kunststoff-modifiziertem Kanalsanierungsmörtel<br />
wieder zu verspachteln. Des Weiteren mussten hier die<br />
Eckbereiche mit Kanalsanierungsmörtel vorprofiliert werden<br />
- sogenannte Hohlkehlen - um Hohlräume zwischen<br />
Liner und Altrohr zu vermeiden. Zu guter Letzt galt es noch<br />
einen Übergang für den Dimensionswechsel von Kreis auf<br />
Kasten in der Haltung herzustellen.<br />
a)<br />
b)<br />
Übergang Kastenprofil DN 825/1000 auf<br />
Kreisprofil DN 1200 a) vor der Sanierung<br />
und b) nach der Sanierung<br />
MEHRERE DIMENSIONSWECHSEL<br />
Vor der Produktion der Synthesefaser-Liner im Insituformeigenen<br />
Werk im thüringischen Geschwenda mussten<br />
die Kanalprofile noch kalibriert werden: Überprüfung der<br />
Profilabmessung der zu sanierenden Haltungen über die<br />
kompletten Leitungslängen. Die Planung sah den Einbau<br />
in zwei Abschnitten vor. Bei beiden galt es Dimensionswechsel<br />
von mehreren Dimensionssprüngen zu berücksichtigen:<br />
DN 1200 auf DN 970 sowie DN 1200 auf DN 1365.<br />
Entsprechend dieser Parameter konnten nun die Liner als<br />
Spezialanfertigung aus korrosionsbeständiger Synthesefaser<br />
mit einseitiger Kunststoffbeschichtung gefertigt und<br />
anschließend mit abwasserbeständigem, warmhärtendem<br />
Polyester-Harz imprägniert werden:<br />
»»<br />
70 m DN 1200 in der Einbauwandstärke von 18 mm<br />
mit Konus auf 65 m Kastenprofil DN 1000/825 in der<br />
Einbauwandstärke 24 mm<br />
»»<br />
20 m DN 1200 in der Einbauwandstärke 18 mm mit<br />
Konus auf 30 m Eiprofil DN 1100/1650 in der Einbauwandstärke<br />
27 mm<br />
Der erste Einbauabschnitt sah die Inversion gegen, der<br />
zweite in Fließrichtung vor. Die Herausforderung bestand<br />
neben den Dimensionswechseln und der Durchfahrung<br />
der vielen Bögen mit bis zu 45° insbesondere auch in der<br />
Festlegung der Höhe der Wassersäule. Hier waren die<br />
Insituform-internen Vorgaben gemäß dem Qualitätsmanagement<br />
und gleichzeitig die geringe Überdeckung des<br />
Altkanals von teilweise nur 50 cm zu beachten. Ein zu hoher<br />
Innendruck könnte schnell zur unerwünschten Aufweitung<br />
1-2 | 2013 65
PROJEKT KURZ BELEUCHTET ABWASSERENTSORGUNG<br />
Wiederherstellung des Schachtbauwerkes nach Inlinersanierung<br />
des Altrohres und folglich der Straßenoberfläche führen, da<br />
die Auflast zu gering wäre: Die Höhe des Gerüstturms (mit<br />
ausgeklapptem Förderband) betrug daher 7,70 m.<br />
DURCHFÜHRUNG DER INLINERSANIERUNG<br />
Die eigentliche Inlinersanierung startete mit dem Einbau im<br />
ersten Bauabschnitt „just in time“. 135 m Synthesefaserliner<br />
trafen - für den Transport eisgekühlt - pünktlich in Ense<br />
ein. Nachdem der dünne Folienschlauch (Preliner) in die<br />
Sanierungshaltung eingebracht war, begann die Inversion.<br />
Der Einbau solch spezieller Liner, unter den genannten<br />
Bedingungen, erfordert ein perfektes Zusammenspiel des<br />
Einbauteams, Fingerspitzengefühl bei der Inversionswasserzufuhr<br />
sowie der Einstellung der Wassersäule und damit der<br />
Erzeugung des hydrostatischen Drucks und der Festlegung<br />
der optimalen Inversionsgeschwindigkeit, um die formschlüssige<br />
und eng anliegende Auskleidung des Rohres zu<br />
gewährleisten.<br />
Nachdem der Schlauch am Zielschacht angekommen war,<br />
begann die für den Betrachter weniger spektakuläre Härtephase<br />
des Schlauches zum eigentlichen Endprodukt, dem<br />
muffenlosen, formschlüssigen „Rohr im Rohr“. Mobile<br />
und stationäre Anlagen mit einer Gesamtkapazität von<br />
rund 2.800 KW Heizleistung sorgten für die kontrollierte<br />
Erhitzung des Wassers mit einer Vorlauftemperatur von<br />
ca. 90 °C und die Umwälzung über mehrere Stunden. Die<br />
Temperaturentwicklung wurde selbstverständlich stetig über<br />
Thermofühler an unterschiedlichen kritischen Punkten des<br />
Rohrverlaufes kontrolliert und protokolliert.<br />
Nach der Härtung wurde das Wasser kontinuierlich wieder<br />
auf die Umgebungstemperatur heruntergekühlt, um die<br />
durch die Polymerisation entstandenen Spannungen im<br />
neuen Rohr abzubauen. Erst danach erfolgte die Öffnung<br />
des Rohres am Inversionsende sowie der verfahrensbedingt<br />
überfahrenen Zuläufe und Schächte.<br />
Die folgende Probenentnahme fand durch ein akkreditiertes<br />
Prüfinstitut statt: Untersuchungen der entnommenen<br />
Proben auf Wasserdichtheit, Wanddicke, E-Modul und Biegespannung<br />
gemäß DIBT-Zulassung des Inliners. Alle erforderlichen<br />
Kennwerte wurden erreicht und so der Nachweis<br />
erbracht, dass die Liner den zu erwartenden Belastungen<br />
über die gesamte Lebensdauer von mindestens 50 Jahren<br />
standhalten werden und einem neu verlegten Rohr<br />
hinsichtlich der Qualitätsanforderungen in keiner Weise<br />
nachstanden.<br />
Auch der nur wenige Tage später durchgeführte Einbau im<br />
zweiten Bauabschnitt lief für alle Beteiligten sehr zufriedenstellend<br />
und ohne Komplikationen ab. Eine gemeinsame<br />
Begehung der sanierten Kanäle durch Bauherr und<br />
Auftragnehmer bestätigte, dass die Sanierungsergebnisse<br />
auch optisch voll und ganz überzeugten. Gerade bei nicht<br />
alltäglichen Projekten mit komplexen und anspruchsvollen<br />
Randbedingungen zahlen sich jahrzehntelange Produktkenntnis<br />
und Einbauerfahrungen aus. Der bewährte<br />
Insituform-Synthesefaserliner wurde weltweit bereits in<br />
über 30.500 km Kanälen der Dimensionen DN 150 - 2000<br />
eingebaut.<br />
Aber ebenso unabdingbar für die reibungslose Abwicklung<br />
dieser Maßnahme waren neben dem Qualitätsprodukt<br />
und der erfahrenen Crew der langfristige, vorausschauende<br />
und mit allen Beteiligten abgestimmte Zeitplan, die<br />
gewissenhafte Vorbereitung durch Auftraggeber und -nehmer,<br />
die disziplinierte Umsetzung und die jederzeit offene<br />
Kommunikation.<br />
Das Ergebnis der bisher umfangreichsten Kanalsanierungsmaßnahme<br />
in Ense ist ein renovierter Kanal, der bei deutlich<br />
geringeren Herstellkosten und wesentlich kürzerer Bauzeit<br />
gegenüber dem Neubau, allen Anforderungen, die an einen<br />
neuen Kanal gestellt werden, gerecht wird.<br />
KONTAKT: Gemeindeverwaltung Ense, Frank Sörries,<br />
E-Mail: f.soerries@gemeinde-ense.de<br />
Insituform Rohrsanierungstechniken GmbH, NL Münster,<br />
E-Mail: muenster@insituform.de<br />
Besuchen Sie uns im Internet:<br />
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
66 1-2 | 2013
ABWASSERENTSORGUNG RECHT & PROJEKT REGELWERK KURZ FACHBERICHT<br />
BELEUCHTET<br />
105 t-Stahlbetonschachtbauwerk<br />
für Industrie- und Gewerbegebiet<br />
in Münster<br />
Per Sondertransport und unter Polizeibegleitung lieferte Betonwerk Bieren ein 105 t schweres, aus zwei Teilen bestehendes<br />
Stahlbetonbauwerk an die Firma Dallmann GmbH & Co.KG, die ihrerseits mit dem Bau eines Regenwasserkanals im<br />
südlichen Bereich des Gewerbegebietes „Hansa-Business-Park“, Münster-Amelsbüren, beauftragt worden war.<br />
Bereits den ersten Bauabschnitt, der von der Fa. MBN<br />
AG aus Georgsmarienhütte ausgeführt wurde, belieferte<br />
die Betonwerk Bieren GmbH aus ihren drei Werken mit<br />
insgesamt 2,8 km Beton- und Stahlbetonrohren mit Fuß<br />
von DN 300 bis DN 1600 und einer Baulänge von 2,50 m<br />
bzw. 3 m pro Rohr. Für die Baumaßnahme erhielt MBN<br />
ferner ca. 140 Schächte DN 1000 bis DN 2000 sowie etliche<br />
Sonderschächte.<br />
Laut Wirtschaftsförderung Münster, Eigentümerin des Baugebiets,<br />
war die rasche entwässerungstechnische Erschließung<br />
von großer Bedeutung, um weitere Ansiedlungen von<br />
Betrieben im Hansa-Business Park voran zu treiben.<br />
So lieferte das Betonwerk Bieren im zweiten Bauabschnitt<br />
an die Fa. Dallmann GmbH & Co.KG aus Bramsche neben<br />
Betonrohren mit Fuß DN 300 bis DN 1200 in FBS-Qualität,<br />
Schachtunterteile DN 2000, schalungserhärtet in PERFEKT<br />
Form sowie Sonderschächte, Fertigschächte in Elementbauweise<br />
und ein rund 105 t schweres Stahlbetonbauwerk<br />
bestehend aus zwei Einzelteilen. Das im Werk in Bad<br />
Oeynhausen hergestellte Bauwerk entsprach den erhöhten<br />
Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie Teil 2.2 Schachtbauwerke<br />
aus Stahlbetonfertigteilen.<br />
Die Komplettleistung von Bieren umfasste auch den Einbau<br />
vor Ort durch eine werkseigene Montagekolonne. Unter<br />
„Polizeischutz“ wurden die beiden Teile des Bauwerkes<br />
per Sondertransport zur Baustelle begleitet, wo sie Oberbauleiter<br />
Jörn von Ohlen (Dallmann GmbH & Co.KG) in<br />
Empfang nahm. Dieser kommentierte: „Da die Produkte sich<br />
im Verbundsystem passgenau und reibungslos ineinander<br />
fügen, verlief auch dieses Projekt beim Setzen des Mega-<br />
Schachtbauwerks einwandfrei“.<br />
KONTAKT: FBS e.V., Bonn, Tel. +49 228 95456-54, E-Mail: info@fbsrohre.de,<br />
www.fbsrohre.de<br />
Fotos: BIEREN BETON GmbH<br />
Einbau vor Ort – erster Teil des Schachtbauwerkes<br />
Das zweite Teil des Schachtbauwerkes wird aufgesetzt<br />
03 / 2013 67
FACHBERICHT PROJEKT KURZ RECHT BELEUCHTET & REGELWERK ABWASSERENTSORGUNG<br />
Stauraumkanal aus GFK-Rohren für<br />
das Technische Zentrum Heiterblick<br />
370 m lang ist der Stauraumkanal DN 3000, der im Auftrag der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH auf dem<br />
Gelände der bisherigen LVB-Hauptwerkstatt im Stadtteil Heiterblick verlegt worden ist. Die Tiefbaumaßnahme ist<br />
Bestandteil eines umfangreichen Projektes, bei dem das alte Industriegelände im Nordosten von Leipzig, wo seit über<br />
80 Jahren Straßenbahnen instandgesetzt werden, grundlegend umgebaut wird. In einem ersten Bauabschnitt wird die<br />
neue Hauptwerkstatt für die gesamte LVB-Straßenbahnflotte und im Folgeabschnitt eine Betriebswerkstatt sowie eine<br />
Abstellhalle für 180 Betriebseinheiten errichtet. In dem neuen Stauraumkanal soll das anfallende Regenwasser zukünftig<br />
gesammelt und kontrolliert in das öffentliche Kanalnetz eingeleitet werden.<br />
Im April 2012 begannen mit der Grundsteinlegung die<br />
Bauarbeiten auf dem LVB-Gelände in Leipzig-Heiterblick.<br />
„Die Umsetzung des anspruchsvollen Projektes soll dazu<br />
beitragen, die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Personennahverkehrs<br />
zu steigern“, wirft Projektmanager Frank-Uwe<br />
Neubert von den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) GmbH<br />
einen Blick in die Zukunft. „In erster Linie wird das Technische<br />
Zentrum als Standort für den technischen Service<br />
die Wartung und Instandhaltung sowie die Reparatur und<br />
Generaluntersuchung der modernen Niederflur-Straßenbahnen<br />
übernehmen.“ Im ersten Bauabschnitt entsteht auf<br />
dem ca. 16,5 ha großen Gelände die neue Hauptwerkstatt.<br />
Gleichzeitig werden nach den Vorgaben der Lindschulte<br />
+ Kloppe Ingenieurgesellschaft mbH – zuständig für die<br />
Planung Verkehr und Infrastruktur – 3.800 m Gleise und<br />
Fahrleitungen verlegt und Leitungen für Strom, Wasser,<br />
Abwasser und Gas gebaut. „Die neuen Werkstätten und<br />
Anlagen wurden unter besonderer Berücksichtigung von<br />
energieeffizienten Gesichtspunkten geplant und entsprechen<br />
modernen Umweltstandards“, betont Neubert und<br />
verweist dabei auf die umwelt- und ressourcenschonende<br />
Realisierung eines Konzeptes, das ganz gezielt auf Nachhaltigkeit<br />
setzt.<br />
Geordnet gesammelt und zwischengelagert<br />
Das gilt auch für den Umgang mit dem auf dem Gelände<br />
anfallenden Niederschlagswasser. Aufgrund der eingeschränkten<br />
Versickerungs- und Ableitungsmöglichkei-<br />
Fotos: AMITECH Germany GmbH<br />
Vorteile an der Einbaustelle: Das vergleichsweise geringe Gewicht der<br />
Wickelrohre trägt entscheidend dazu bei, dass die Transportkosten<br />
überschaubar bleiben und die Rohre an der Einbaustelle einfach und<br />
flexibel zu handhaben sind<br />
Zukunftsweisendes Konzept: In dem neuen Stauraumkanal<br />
soll das anfallende Regenwasser gesammelt und kontrolliert<br />
in das öffentliche Kanalnetz eingeleitet werden<br />
68 03 / 2013
ten muss das Oberflächenwasser geordnet gesammelt<br />
und zwischengespeichert werden, um dann kontrolliert<br />
in das öffentliche Kanalnetz eingespeist zu werden. Zur<br />
Ausführung kam eine Anlage, bei der das gesammelte<br />
Regenwasser über ein Absatzbecken geleitet wird, in dem<br />
sich die mitgeführten Feststoffe absetzen. Danach gelangt<br />
das Wasser in einen Stauraumkanal, wo es mittels einer<br />
Pumpe gedrosselt dem öffentlichen Kanal zugeführt wird.<br />
Der Stauraumkanal DN 3000, der von der EUROVIA Verkehrsbau<br />
Union GmbH eingebaut wurde, ist rund 370 m<br />
lang und verfügt über ein Fassungsvermögen von rund<br />
2.700 m 3 . „Seine Länge und Dimensionierung wurden im<br />
Wesentlichen von zwei Faktoren bestimmt“, so Neubert<br />
weiter. „Das war auf der einen Seite die Größe der künftig<br />
versiegelten Flächen und die daraus abzuleitende Menge<br />
an Oberflächenwasser. Auf der anderen Seite stand für den<br />
Bau des Stauraumkanals nur ein begrenzter Platz innerhalb<br />
des Baufeldes zur Verfügung.“<br />
Wartungsaufwand minimiert<br />
Bei der Auswahl eines geeigneten Werkstoffes hat sich<br />
der Auftraggeber für glasfaserverstärkte Kunststoffrohre<br />
entschieden. Zum Einsatz kamen FLOWTITE GFK-<br />
Wickelrohre, deren Produktion in (fast) jeder beliebigen<br />
Länge und in Nennweiten von bis zu 3000 mm möglich<br />
ist. Sie verfügen über vielfältige materialtechnische und<br />
verlegetechnische Vorteile. „Das geringe Gewicht der<br />
Wickelrohre – sie wiegen lediglich ein Viertel bzw. ein<br />
Zehntel von vergleichbaren Rohren aus Grauguss oder<br />
Beton – trägt entscheidend dazu bei, dass die Transportkosten<br />
überschaubar bleiben und dass die Rohre an der<br />
Einbaustelle einfach und flexibel zu handhaben sind“,<br />
erklärt Helmut Jersch, als Vertreter der AMITECH Germany<br />
GmbH verantwortlich für den Vertrieb in Sachsen. Dies<br />
sorgt zudem für eine Minimierung der Verlegekosten,<br />
und auf den Einsatz eines Krans kann meist verzichtet<br />
werden. Auch mit weiteren Werkstoffeigenschaften können<br />
die FLOWTITE-Wickelrohre überzeugen. Der Einsatz<br />
der REKA-Kupplung stellt die Dichtigkeit des gesamten<br />
Systems sicher und die glatten porenfreien Innenoberflächen<br />
der Rohre sorgen für eine hervorragende Hydraulik,<br />
unterstützen die angestrebte Selbstreinigung und minimieren<br />
den Wartungsaufwand.<br />
Der Neubau des Stauraumkanals konnte zur Zufriedenheit<br />
aller Baupartner abgeschlossen werden. Der Umstand, dass<br />
die erforderlichen Bauteile in kürzester Zeit produziert und<br />
geliefert werden konnten, trug dabei ebenso zu einem<br />
reibungslosen und erfolgreichen Abschluss der Tiefbaumaßnahme<br />
bei wie die Qualität der gelieferten Produkte.<br />
Die Arbeiten am ersten Bauabschnitt beim Neubau des<br />
Technischen Zentrums Heiterblick sollen im ersten Quartal<br />
2014 abgeschlossen sein.<br />
KONTAKT: Amitech Germany GmbH, Mochau, Tel. +49 3431 7182-0,<br />
E-Mail: presse@amitech-germany.de, www.amitech-germany.de<br />
03 / 2013 69
FACHBERICHT PROJEKT KURZ RECHT BELEUCHTET & REGELWERK ABWASSERENTSORGUNG<br />
Entflechtung der Leerer<br />
Mischwasserkanalisation<br />
Seit rund zehn Jahren stellen die Stadtwerke Leer - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) das innerstädtische Kanalnetz<br />
sukzessive von einer Mischwasserkanalisation auf ein Trennsystem um. Zum einen werden damit die Vorgaben des<br />
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) erfüllt. Zum anderen führt die Entflechtung der Mischwasserkanalisation zu einer<br />
Verringerung der Kosten, da das anfallende Regenwasser zunehmend aus der Kläranlage ferngehalten wird.<br />
In Leer werden Abschnitte des städtischen Kanalnetzes überall<br />
dort, wo die baulichen Rahmenbedingungen es zulassen,<br />
konsequent erneuert. Etwa dann, wenn entsprechende<br />
Schadensbilder vorliegen oder hydraulische Mindestvoraussetzungen<br />
nicht mehr erfüllt werden. So auch bei einer<br />
Tiefbaumaßnahme im Helmsweg und im Esklumer Fährweg,<br />
wo die H. Schmidt GmbH im Auftrag der Stadtwerke eine<br />
neue Regenwasser- und Schmutzwasserkanalisation hergestellt<br />
hat. Auftraggeber und Planer haben sich dabei für das<br />
HS ® -Kanalrohrsystem der Funke Kunststoffe GmbH entschieden.<br />
Neben Kanalrohren in blau (Regenwasser) und braun<br />
(Schmutzwasser), die für die Erstellung der Sammler und Hausanschlussleitungen<br />
genutzt wurden, kamen weitere Bauteile<br />
wie die HS ® -Abwasserkontrolle oder die VPC ® -Rohrkupplung<br />
zum Einsatz. Der Systemcharakter der aufeinander abgestimmten<br />
Komponenten des modernen Kanalrohrsystems konnte<br />
dabei ebenso überzeugen, wie die einfache und flexible Handhabung<br />
der Rohre und Formteile an der Einbaustelle.<br />
Das Wasserhaushaltsgesetz gibt die Richtung ganz klar vor:<br />
Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder<br />
direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit<br />
Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit<br />
dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlichrechtliche<br />
Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange<br />
entgegenstehen, heißt es in § 55, Abs. 2, des Wasserhaushaltsgesetzes.<br />
„Dementsprechend findet bei uns eine Entflechtung<br />
des Mischwassersystems statt“, erläutert Dipl.-<br />
Ing. Jörg Kuhls, Projektleiter bei den Stadtwerken Leer. Die<br />
Sammlung und der Transport des Abwassers erfolgt über<br />
ein Kanalsystem, das aus Gefälle- und Druckrohrleitungen<br />
sowie Pumpwerken besteht. Ein Hauptpumpwerk fördert<br />
das Abwasser zur Kläranlage Leer, wo eine Behandlung<br />
durch mechanische und biologische Reinigungsverfahren<br />
erfolgt. „Vor allem unter dem Gesichtspunkt der Kostenund<br />
Energieoptimierung gewinnt das Trennsystem dabei<br />
immer mehr an Bedeutung, da sich der Energieaufwand<br />
und die Betriebskosten für die Abwasserbeseitigung reduzieren<br />
lassen“, so Kuhls. Überall dort, wo die Straßendecke<br />
aufgemacht wird, sind deshalb die Kanalbauer zur Stelle,<br />
um die alte Mischwasserkanalisation durch einen entsprechenden<br />
Abwasser- und Regenwassersammler zu erneuern.<br />
Zumindest da, wo es Sinn macht. Ausgenommen sind in<br />
der Regel die Altstadtbereiche, in denen es aus Platz- und<br />
Kostengründen einfach nicht zu realisieren ist.<br />
„Erste Baumaßnahmen mit der entsprechenden Systemumstellung<br />
fanden vor etwa sechs bis sieben Jahren statt“,<br />
erinnert sich Kuhls, der als weiteres Beispiel die Umsetzung<br />
des Projektes „Soziale Stadt“ nennt. Im Jahr 2001 wurde<br />
die beiderseits der Bahnlinie gelegene Leerer Oststadt als<br />
städtebauliches Sanierungsgebiet ausgewiesen und in das<br />
bundesweite Förderprogramm „Soziale Stadt“ aufgenommen.<br />
Seitdem wurden die Lebens- und Arbeitsbedingungen<br />
ebenso wie die Wohnqualität in diesem Quartier nach und<br />
nach gesteigert. Im Zuge der geförderten Baumaßnahmen<br />
wurden mehrere Straßenzüge auf das Trennsystem umgestellt.<br />
Gleiches erfolgte auch in diesem Jahr, etwa bei der<br />
Entflechtung der Mischwasserkanalisation und Herstellung<br />
einer Regenwasser- und Schmutzwasserkanalisation im<br />
Helmsweg und im Esklumer Fährweg.<br />
ÜBERSCHWEMMUNGEN NACH STARKREGEN<br />
Nach Aussage des verantwortlichen Planers Dipl.-Ing. Steffen<br />
Seidel vom Ingenieurbüro Börjes GmbH & Co KG war<br />
neben den für die Dauer der Nutzung des alten Mischwasserkanals<br />
typischen Schadensbilder vor allem eine nicht<br />
mehr zeitgemäße hydraulische Dimensionierung der Haltungen<br />
ausschlaggebend für die Erneuerung der Kanalisation<br />
in den beiden Straßenzügen. „So kam es besonders<br />
nach Starkregenereignissen am Tiefpunkt des Helmsweg<br />
regelmäßig zu Überschwemmungen“, erklärt Seidel, „und<br />
die Anwohner mussten sich öfters mit gefluteten Kellern<br />
auseinandersetzen. Abhilfe schafft das neue Trennsystem. In<br />
Zukunft werden Regen- und Schmutzwasser getrennt abgeleitet.<br />
Während das Abwasser zu den Pumpstationen und<br />
über das Hauptpumpwerk in die Kläranlage geführt wird,<br />
kann das Regenwasser dem Vorfluter zugeführt werden.<br />
Beim Neubau der Sammler setzte die H. Schmidt GmbH<br />
Rohre und Formteile aus dem HS ® -Kanalrohrsystem von<br />
Funke ein. Für die Regenwasser- und Mischwassersammler<br />
kamen blaue und braune Rohre in Nennweiten von DN/OD<br />
200 bis DN/OD 400 zur Ausführung. Hierbei handelt es sich<br />
um Vollwandrohre aus PVC-U, hergestellt in Anlehnung<br />
an die DIN EN 1401-1, jedoch mit erhöhter Wanddicke.<br />
„Das HS ® -Kanalrohr zeichnet sich durch hohe Stabilität,<br />
hohe Sicherheit und gute Verlegbarkeit aus“, erklärt Ewald<br />
Michels-Lübben, Fachberater Funke Kunststoffe GmbH.<br />
Die Rohre verfügen über eine Mindestringsteifigkeit von<br />
12 kN/m 2 und die Formteile sind wandverstärkt (SDR 34).<br />
70 03 / 2013
ABWASSERENTSORGUNG RECHT & PROJEKT REGELWERK KURZ FACHBERICHT<br />
BELEUCHTET<br />
Die Bauteile halten starke Druckbelastungen aus und sind<br />
bereits bei Überdeckungen von 0,5 m für Verkehrslasten bis<br />
SLW 60 einsetzbar. Neben der Farbgebung, die eine Zuordnung<br />
der Leitungen auch viele Jahre nach der Verlegung<br />
möglich macht, ist auch die Innengravur erwähnenswert.<br />
Axial fortlaufend in einem Winkel von 120° tragen die Rohre<br />
einen Schriftzug, der neben dem Namen des Herstellers<br />
Angaben zur Ringsteifigkeit und zum Produktionsdatum<br />
macht. „Die dauerhafte Prägung ist im Gegensatz zu einer<br />
drucktechnisch hergestellten Beschriftung auch noch nach<br />
jahrelangem Einsatz gut lesbar“, so Michels-Lübben, der mit<br />
der fest eingelegten FE ® -Dichtung ein weiteres wichtiges<br />
bautechnisches Merkmal dieses Kanalrohrsystems nennt. Die<br />
Konstruktion sorgt dafür, dass die Dichtung bei der Montage<br />
weder herausgedrückt noch verschoben werden kann.<br />
EINFACHER ZUGANG<br />
„Mit blauen und braunen Rohren DN/OD 160 wurden auch<br />
die Hausanschlussleitungen bis zur Grundstücksgrenze verlegt“,<br />
erläutert Projektleiter Kuhls mit Verweis auf die Satzung,<br />
nach der der öffentliche Bereich an der Grundstücksgrenze<br />
endet. Hier wurde dann eine HS ® -Abwasserkontrolle<br />
eingebaut. Sie erlaubt einen schnellen und einfachen<br />
Zugang zur Kanalisation im öffentlichen Bereich und auf<br />
dem Privatgrundstück, ohne dieses zu betreten. Revisionen,<br />
Spülungen, Dichtigkeitskontrollen oder wenn nötig<br />
Absperrungen sind jederzeit möglich. Geliefert werden die<br />
Abwasserkontrollen im anwender- und einbaufreundlichen<br />
Set. Ihr Einbau verläuft schnell und ist denkbar einfach,<br />
wie Georg Klinkenborg, Geschäftsführer des ausführenden<br />
Unternehmens H. Schmidt GmbH und Polier Matthias<br />
Jürgens berichten. Einig sind sie sich auch bei der Beurteilung<br />
des mit umfangreichen Zubehörteilen ausgestatteten<br />
HS ® -Kanalrohrsystems. „Da ist vom Haus bis zum Sammler<br />
praktisch alles vorhanden, was der Tiefbauer vor Ort im Leitungsgraben<br />
benötigt“, findet Klinkenborg. „Das sorgt für<br />
einen schnellen Baufortschritt, denn Stillstände, etwa weil<br />
bestimmte Teile fehlen und erst herbei geschafft werden<br />
müssen oder über alternative Baulösungen nachgedacht<br />
werden muss, kommen im Grunde genommen nicht vor.“<br />
„Und wenn mal etwas fehlt, kann Funke die gewünschten<br />
Bauteile schnell liefern“, ergänzt Polier Jürgens.<br />
Neben den Rohren und Formteilen machen unter anderem<br />
Bauteile wie die VARIOmuffe oder die VPC ® -Rohrkupplung<br />
die Leistungsstärke und Einsatzvielfalt des modernen Kanalrohrsystems<br />
aus. So wurden beispielsweise Hausanschlussleitungen<br />
mit dem HS ® -Abzweig DN/OD 250/160 45° eingebunden.<br />
Er wird ab Werk mit der HS ® -VARIOmuffe geliefert.<br />
Das Besondere: Das Bauteil verfügt über eine integrierte<br />
Kugel, die die Rohrverbindungen in einem Bereich von 0° bis<br />
11° schwenkbar macht. „Für uns bedeutet das schon beim<br />
Einbau mehr Flexibilität, aber die Konstruktion ermöglicht es<br />
auch, nachträgliche Hausanschlüsse leichter zu realisieren“,<br />
so Jürgens. Gleiches gilt für die VPC ® -Rohrkupplung, die die<br />
Tiefbauer bei der Verbindung der neuen Hausanschlussleitungen<br />
aus PVC-U mit bereits vorhanden Rohren in gleichen<br />
Nennweiten aber aus anderen Werkstoffen verwendet<br />
haben. Genau für diesen Verwendungszweck ist das Bauteil<br />
konstruiert. Die Rohrkupplung besteht aus einer Dichtmanschette<br />
aus Elastomergummi, einem Fixierkorb aus Kunststoff<br />
sowie zwei Edelstahlbändern, die den Verschluss bilden.<br />
Werden die Schrauben der Edelstahlbänder bei der Montage<br />
entsprechend der Herstellerangaben angezogen, passt sich<br />
die Manschette den unterschiedlichen Außendurchmessern<br />
der verschiedenen Rohrwerkstoffe stufenlos an.<br />
Nach Fertigstellung der neuen Kanalisation sollten Überschwemmungen<br />
nach Starkregenereignissen weitestgehend<br />
der Vergangenheit angehören – hierin sind sich die beteiligten<br />
Baupartner einig. Ebenso wie in ihrem Urteil über das<br />
eingesetzte Kanalrohrsystem, das aufgrund seiner Vielfältigkeit<br />
und seiner bautechnischen Eigenschaften zu einem<br />
flexiblen und wirtschaftlichen Bauablauf beigetragen hat.<br />
KONTAKT: Funke Kunststoffe GmbH, Hamm-Uentrop, Tel. +49 2388 3071-0,<br />
E-Mail: info@funkegruppe.de, www.funkegruppe.de<br />
Zug um Zug<br />
wird in Leer<br />
das alte Mischwasser<br />
system<br />
durch ein<br />
modernes<br />
Trennsystem<br />
abgelöst<br />
Formteile<br />
wie die HS ® -<br />
VARIOmuffe<br />
erleichtern das<br />
Einbinden der<br />
Haus an schlussleitungen<br />
in<br />
den Sammler<br />
Die HS ® -Abwasser<br />
kontrolle<br />
erlaubt einen<br />
schnellen und<br />
einfachen<br />
Zugang zur<br />
Kanalisation<br />
im öffentlichen<br />
Bereich und<br />
auf dem<br />
Privatgrundstück<br />
03 / 2013 71
FACHBERICHT PROJEKT KURZ RECHT BELEUCHTET & REGELWERK ABWASSERENTSORGUNG<br />
PP-Vollwandwandrohre sichern<br />
Entwässerung im Simplontunnel<br />
Eine der ältesten und wichtigsten Eisenbahn-Alpenquerungen, der Simplontunnel, wird derzeit erneuert. Weil er den<br />
heutigen Sicherheitsanforderungen nicht mehr entspricht, passt der Betreiber, die Schweizerische Bundesbahnen (SBB),<br />
mit einem Aufwand von 170 Millionen Franken bauliche und technischen Anlagen den aktuellen Anforderungen in Bezug<br />
auf Sicherheit und Technik an: Die Stromversorgung wird erneuert und die Spannung erhöht. In beiden Röhren werden<br />
Gehwege, Handläufe, Notbeleuchtung und Fluchtwegbeschilderungen eingebaut. Zwischen den beiden Tunnelröhren<br />
werden in regelmäßigen Abständen Verbindungen als Fluchtwege ausgebaut. In der Mitte des Tunnels wird die Sohle<br />
abgesenkt und Weichen werden ausgetauscht. Gleisoberbau und die teilweise nicht mehr funktionstüchtige Entwässerung<br />
werden ersetzt. Bei den Baumaßnahmen, die 2012 begonnen haben, kommen auch Rehau-Lösungen zum Einsatz.<br />
Bis Anfang der 1980er Jahre war der Simplontunnel der<br />
längste Tunnel der Erde. Er kam sogar im zweiten James<br />
Bond Film „Liebesgrüße aus Moskau“ 1963 zu Filmehren<br />
und wurde weltberühmt. Mehr als zwei Millionen Fahrgäste<br />
passieren den Tunnel pro Jahr. Der Fahrbetrieb von<br />
Personen- und Güterzügen bewegt sich bei ca. 100 Zügen<br />
pro Tag, die mögliche Kapazität liegt bei bis zu 300 Zügen.<br />
Der Bau des fast 20 km langen Tunnels begann bereits<br />
1898. Im Jahr 1906 wurde schließlich zwischen Brig in der<br />
Schweiz und Iselle in Italien der Betrieb aufgenommen. Der<br />
Simplontunnel ist ein Meisterwerk europäischer Ingenieurbaukunst<br />
und war von Anfang an elektrifiziert – damals eine<br />
absolute Besonderheit. Er besteht aus zwei Einspurröhren<br />
mit einer Querverbindung in Tunnelmitte.<br />
VOLLWANDROHRE AUS PP FÜR DIE<br />
TUNNELENTWÄSSERUNG<br />
Bislang waren PE-Rohre in SN2 für die Tunnelentwässerung<br />
im Einsatz. Diese sind durch harte Spülungen geschwächt<br />
worden. Dazu kommt, dass im Tunnelinnern durchschnittliche<br />
Temperaturen von 30 °C herrschen. Der Auftraggeber<br />
entschied sich daher, bei der Erneuerung auf Vollwandrohre<br />
aus PP nach SN EN 1852 zu setzen. Dabei muss es sich zu<br />
100 % um Neumaterial, also ohne Recyclatbeimischung,<br />
sowie Rohrmaterial ohne Füllstoffe handeln. Diese Anforderungen<br />
erfüllt RAUDRIL Rail PP von Rehau.<br />
Aufgrund der baulichen Gegebenheiten wurde ein Schlitzwinkel<br />
von 150° statt der üblichen 120° gefordert. Rehau<br />
änderte das Schlitzbild entsprechend den Anforderungen<br />
Bei der Sanierung des Simplon-Tunnels werden RAUDRIL Rail PP<br />
Rohre zur Tunnelentwässerung eingesetzt<br />
Zwischen 2012 und 2015 wird der Simplontunnel von der SBB auf<br />
aktuellen Stand gebracht<br />
72 03 / 2013
ABWASSERENTSORGUNG RECHT & PROJEKT REGELWERK KURZ FACHBERICHT<br />
BELEUCHTET<br />
des Auftraggebers. Entsprechend den Ausführungs- und<br />
Qualitätsvorschriften für Tunnelentwässerung der Schweizer<br />
Bahn (SBB) weisen die Rohre eine Schlitzbreite von 10 mm<br />
auf. Hierdurch wird auch eine Reinigung der Wassereintrittsöffnungen<br />
erleichtert.<br />
REINIGUNGSARBEITEN MIT DER<br />
KETTENSCHLEUDER<br />
Da abschnittsweise starke Versinterungen auftreten, sind<br />
Reinigungsarbeiten mit der Kettenschleuder unausweichlich.<br />
Kein Problem, denn RAUDRIL Rail PP kann mit der Kettenschleuder<br />
nach Herstellerangaben gereinigt werden, da es<br />
sich durch hohe Schlagfestigkeit und Widerstandsfähigkeit<br />
auszeichnet und zudem hochdruckspülbar bis 340 bar ist.<br />
RAUDRIL Rail PP entspricht aber nicht nur den Ausführungs-<br />
und Qualitätsvorschriften für Tunnelentwässerung<br />
der Schweizerischen Bahn (SBB), sondern auch der Richtlinie<br />
„Ausbildung und Instandhaltung von Tunnelentwässerungen“<br />
der Österreichischen Vereinigung für Beton- und Bautechnik.<br />
Das vom deutschen Eisenbahn-Bundesamt (EBA)<br />
zugelassene Rohrsystem RAUDRIL Rail PP SN 16 kann ohne<br />
Zustimmung im Einzelfall (ZiE) sogar im Einflussbereich von<br />
Eisenbahnverkehrslasten und speziell im durch das EBA<br />
festgelegten inneren Druckbereich eingesetzt werden.<br />
Zusätzlich zu den Produktvorteilen zeigte sich eine der<br />
besonderen Stärken von Rehau aber auch in der Ländergrenzen<br />
übergreifenden engen Zusammenarbeit von<br />
Verkaufsbüro vor Ort in Bern, Rohrwerk Neulengbach in<br />
Österreich und der Verfahrenstechnik in Erlangen mit dem<br />
Auftraggeber. Denn für das Objekt waren mehrere Anpassungen<br />
an die Anforderungen und Gegebenheiten der<br />
Baustelle notwendig. Während der Bauzeit wird abwechslungsweise<br />
eine Hälfte der beiden Tunnelröhren gesperrt<br />
und der Betrieb einspurig geführt. Nach Abschluss der<br />
Bauarbeiten 2015 kann der Fuhrbetrieb im Simplontunnel<br />
wieder im vollen Umfang aufgenommen werden und der<br />
Verkehr dann wieder nach Norden und Süden sicher fließen.<br />
KONTAKT: REHAU AG + Co, ERLANGEN; Jan-Carl Mehles,<br />
Tel. +49 9131 92-5810, E-Mail: jan-carl.mehles@rehau.com<br />
8th Pipeline Technology<br />
Conference<br />
Pipeline Technology<br />
Conference 18.-20. März 2013, Hannover 2010<br />
Europa’s führende Konferenz<br />
für neue Pipelinetechnologien<br />
Mehr Informationen unter www.pipeline-conference.com<br />
Euro Institute for Information<br />
and Technology Transfer<br />
2013 02 <strong>3R</strong> ptc de.indd 1 11.02.2013 10:36:04<br />
03 / 2013 73
8.<br />
16. Mai 2013, Essen, Hotel Bredeney<br />
www.forum-industriearmaturen.de<br />
Programm<br />
Moderation: Ralph-Harry Klaer,<br />
Bayer Technology Services<br />
• Tendenzen bei Industriearmaturen aus Anwendersicht<br />
R.-H. Klaer, Bayer Technology Services<br />
• Electric meets hydraulics – intelligente elektrische Antriebe<br />
mit fluidischem Getriebe in der Prozessautomation<br />
Marcus Groedl, Gotthard Gawens, Babak Farrokhzad,<br />
HOERBIGER Automatisierungstechnik<br />
• Armaturendiagnose mittels Wirkleistungsmessung –<br />
Leistung, Kräfte, Momente<br />
P. Borsum, TÜV Süd Industrie Service GmbH; M. Beetz, AREVA NP GmbH<br />
• Erste Erfahrungen mit der Lebensdauervorhersage<br />
von Ventilen mit einem Reliability-Index<br />
A. Vogt, F.I.R.S.T. GmbH<br />
• Anforderungen an Armaturen in der Zukunft – eine<br />
Abschätzung aus Sicht eines Armaturenanwenders<br />
G. Spiegel, BASF SE<br />
• Risikoreduzierung durch funktionale Sicherheit<br />
bei Aktoren<br />
S. Peeg, AUMA Riester GmbH<br />
• Herausforderung Elastomerdichtungen: Schadensanalyse<br />
von O-Ringen in Industriearmaturen<br />
M. Krüger, C. Otto Gehrckens GmbH & Co.<br />
• Innovative Armaturensysteme – Schnittstelle<br />
zwischen Brennstoff und Sicherheit<br />
S. Simon, Kühme Armaturen GmbH<br />
Wann und Wo?<br />
Termin:<br />
Donnerstag, 16. Mai 2013<br />
Veranstaltung 09:30 - 17:00 Uhr<br />
Ort:<br />
Essen, Hotel Bredeney, www.hotel-bredeney.de<br />
Zielgruppe:<br />
Das Forum Industriearmaturen wendet sich an alle<br />
Fachleute aus dem Bereich Industriearmaturen:<br />
Anwender, Anlagenplaner und -bauer sowie<br />
Anbieter von Armaturen und Armaturenantrieben.<br />
Teilnahmegebühr:<br />
Abonnenten von Industriearmaturen/<br />
Mitglieder des VDMA FB Armaturen: 330,00 €<br />
regulärer Preis: 360,00 €<br />
Vortragende sind von den Tagungsgebühren<br />
befreit.<br />
Im Preis enthalten sind die Tagungsunterlagen,<br />
das Catering (2 x Kaffee/Snacks, 1 x Mittagessen)<br />
sowie die Parkgebühren am Hotel.<br />
Veranstalter<br />
Mehr Information und Online-Anmeldung unter<br />
www.forum-industriearmaturen.de<br />
Fax-Anmeldung: 0201 82002-40 oder Online-Anmeldung: www.forum-industriearmaturen.de<br />
Ich bin Abonnent von Industriearmaturen / Mitglied des VDMA FB Armaturen<br />
Ich zahle den regulären Preis<br />
Vorname, Name des Empfängers<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Firma/Institution<br />
E-Mail<br />
Straße/Postfach<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Nummer<br />
?<br />
Ort, Datum, Unterschrift
RECHT & REGELWERK PRODUKTE & FACHBERICHT VERFAHREN<br />
Tracto-Technik GmbH & Co. KG<br />
Neueste Bohrtechnik auf der Bauma<br />
Die Tracto-Technik GmbH präsentiert zum 16. Mal auf der<br />
Bauma, der internationalen Fachmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen,<br />
Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte,<br />
vom 15.-21. April in München das gesamte Spektrum ihrer<br />
Bohrtechnik. Dazu gehören seit 1970 die GRUNDOMAT-Erdraketen,<br />
die verstärkt für den FTTH-Hausanschluss eingesetzt<br />
werden. Ein markantes Merkmal der siebten Grundomat-N-<br />
Generation ist die außergewöhnliche Kopfform, die als Kronenkopf<br />
bezeichnet wird (Bild 1). Dieser Kopf ist einzigartig und<br />
steht für eine hohe Durchschlagskraft und Zielgenauigkeit in<br />
steinigen Böden. Der GRUNDOMAT N wird optional auch mit<br />
dem bewährten Stufenkopf der Vorgängergeneration angeboten.<br />
Eine weitere Verbesserung ist die Dreigangsteuerung. Um<br />
in wechselnden Böden besser reagieren zu können, lässt sich<br />
die Erdrakete neben dem Rückwärtsgang auf zwei Vorlaufpositionen<br />
mit unterschiedlichen Schlagfrequenzen umschalten.<br />
Der GRUNDODRILL18 ACS, auch Black Mole genannt<br />
(Bild 2), wurde bereits im vergangenen Jahr einem potentiellen<br />
Anwenderkreis vorgestellt und findet breite Zustimmung.<br />
Die Bohranlage ist mit dem Doppelrohrgestänge für<br />
Felsbohrungen bis 20 Zoll Durchmesser und 300 m Bohrlänge<br />
oder mit dem Twin Drive-Bohrgestänge für reguläre<br />
Spülbohrungen bis 600 mm Durchmesser und 400 m Bohrlänge<br />
flexibel einsetzbar. Der bisherige Längenrekord einer<br />
Felsbohrung liegt bei 270 m. Der GRUNDODRILL 18 ACS<br />
mit seinem hohen technischem Niveau ist mit allem ausgestattet,<br />
was für einen effizienten Bohrbetrieb notwendig<br />
ist. Der Nachfolger des GRUNDODRILL 15 XP ist der<br />
GRUNDODRILL 15 XPT. Damit können Rohre bis 450 mm<br />
Durchmesser eingezogen werden. Neben der Leistungssteigerung<br />
und -optimierung lag der Entwicklungsfokus<br />
auf Verbesserungen der Arbeits- und Betriebssicherheit.<br />
Neben den HDD-Spülbohranlagen von Tracto-Technik stellt<br />
auf dem über 1.500 m 2 großen Messestand auch die Partnerfirma<br />
Prime Drilling ihre HDD-Großbohrtechnik aus.<br />
Netzbetreiber und Anwender im In- und Ausland sind sich<br />
einig: Die GRUNDOPIT K-Keyholetechnik ist der Schlüssel<br />
zum wirtschaftlichen Hausanschluss. Das Keyhole ist<br />
sowohl für die Neuverlegung mit einer Erdrakete oder mit<br />
der gesteuerten Mini-Bohranlage GRUNDOPIT K als auch<br />
für die Erneuerung mit dem Seilzuggerät GRUNDOTUGGER<br />
nutzbar. Ein erfreulicher Begleiteffekt des Keyholes ist, dass<br />
durch die kreisrunde Form Risse und Frostschäden in der<br />
Straßenoberfläche nachhaltig vermieden werden.<br />
Ergänzend zu den bisherigen GRUNDOBURST-Anlagen ist<br />
ein neuer GRUNDOBURST-Typ mit 1900 kN Zugkraft für den<br />
Neurohreinzug bis DA 900 hinzugekommen. Er schließt die<br />
Lücke zwischen dem 1250 G sowie dem 2500 G und hat<br />
bereits auf mehreren Baustellen erfolgreich seine Bewährungsprobe<br />
bestanden.<br />
Das neue Geothermiebohrgerät Geodrill 8R ist das Nachfolgemodell<br />
des Geodrill 4R und wird auf der Bauma als<br />
Prototyp ausgestellt. Die Lafette ist nun von 30° bis auf 95°<br />
schwenkbar und somit nicht nur für schräge, sondern auch<br />
für vertikale Erdwärmebohrungen geeignet. Des Weiteren<br />
erschließen sich dadurch für den Geodrill 8R zusätzliche<br />
Aufgaben im Brunnen-, Grund- und Ankerbau. Die Motorleistung<br />
liegt bei 55 kW; gleichzeitig wurde das Drehmoment<br />
von 3.500 Nm auf 8.000 Nm erhöht.<br />
Hinweis: Da das Messegelände weiter vergrößert und<br />
umstrukturiert wurde, musste auch die Tracto-Technik<br />
„umziehen“ und hat ihren neuen Standort direkt am Eingang<br />
und Parkplatz Nord/West.<br />
KONTAKT: TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG, Lennestadt, E-Mail: karin.<br />
schulte@tracto-technik.de, www.tracto-technik.de<br />
FGN.N521/1<br />
Bild 1 Charakteristisch für die neue Erdrakete ist der neue Kronenkopf,<br />
der eine Pilotbohrung vorschlägt, Hindernisse zertrümmert, das Erdreich<br />
abfördert und mit dem Gehäuse verdrängt<br />
Bild 2 Der neue GRUNDODRILL 18 ACS, auch Black Mole, genannt<br />
03 / 2013 75
FACHBERICHT PRODUKTE & VERFAHREN RECHT & REGELWERK<br />
Radiodetection CE<br />
Flexibles Schiebeinspektionssystem<br />
Das GatorCam 4 <strong>Inspektion</strong>ssystem von Radiodetection<br />
bietet eine hohe Leistung durch ein robustes und einfach zu<br />
bedienendes Schiebeinspektionssystem. Auf der Grundlage<br />
von 15 Jahren kontinuierlicher Entwicklung bietet das neue<br />
GatorCam-Sortiment robuste, hochauflösende 25-mm- und<br />
50-mm-Kameras sowie ein umfangreiches Sortiment von<br />
Trommeln und Schubelementen für die meisten <strong>Inspektion</strong>sbedürfnisse.<br />
Die moderne Steuerung unterstützt digitale<br />
Features und kann auf verschiedenen Speichermedien<br />
aufzeichnen. Sie kann ebenfalls dazu verwendet werden,<br />
detaillierte <strong>Inspektion</strong>sberichte vor Ort zu erstellen, um die<br />
Produktivität zu maximieren.<br />
Kernstück des GatorCam4-Systems ist die robuste und<br />
witterungsbeständige GatorCam4USB-Steuerung, die digitale<br />
Videos oder Bilder in hoher Qualität auf Knopfdruck<br />
aufnimmt und diese auf einem ultrahellen 8“-TFT-Bildschirm<br />
(200 mm) anzeigt. Dank fortgeschrittener Digitalfunktionen<br />
kann der Anwender während der Aufzeichnung und Wiedergabe<br />
in Bilder zoomen,<br />
schwenken und drehen,<br />
um Problembereiche besser<br />
erkennen zu können.<br />
Es können auch jederzeit<br />
Standbilder aufgenommen<br />
werden.<br />
Die GatorCam4USB-<br />
Steuerung unterstützt<br />
die gängigen USB-Flash-<br />
Drives vollständig. Ein<br />
Memory Stick kann einfach<br />
in die Steuerung<br />
gesteckt werden, um<br />
die <strong>Inspektion</strong>svideos, -fotos<br />
und -beobachtungen aufzuzeichnen,<br />
zu speichern<br />
oder zu kopieren. Das System<br />
ist auch mit Compact-<br />
Flash-Speicherkarten kompatibel<br />
und kann direkt an<br />
einen PC zur Datenübertragung<br />
ohne zwischengeschalteten<br />
Kartenleser angeschlossen<br />
werden.<br />
Zudem organisiert<br />
die Steuerung<br />
automatisch Arbeiten nach<br />
Kunde, Standort und Gutachten,<br />
wodurch das Berichten und Auswerten<br />
der Videos, Fotos und Beobachtungen<br />
unkompliziert wird. Das vorinstallierte,<br />
umfassende Berichtssystem<br />
kann zum schnellen Ausfüllen von Beobachtungsberichten<br />
vor Ort verwendet werden. Es kann auch Berichtsdateien im<br />
HTML- oder SEWER.DAT-Format erstellen, ohne an einen<br />
Computer angeschlossen sein zu müssen.<br />
Die Flexisight Manager-Software ist der leistungsstarke<br />
PC-Begleiter für die Steuerung, ermöglicht sie doch dem<br />
Bediener alle seine digitalen <strong>Inspektion</strong>sdaten zu importieren,<br />
zu speichern und zu verwalten. Kundenspezifische<br />
und umfangreiche <strong>Inspektion</strong>sberichte können ebenfalls<br />
mit dem Firmennamen des Bedieners erstellt werden, bei<br />
denen Rohrleitungsgrafiken, Beschreibungen und farbcodierten<br />
Mängelbewertungen des Unternehmens mit<br />
integriert werden.<br />
Das GatorCam4-System bietet die Wahl zwischen zwei<br />
robusten, hochauflösenden Kameras aus Edelstahl,<br />
die einem Druck von 11 bar widerstehen können, was<br />
einer Unterwasserarbeitstiefe von 100 m entspricht. Die<br />
25-mm- und 50-mm-Modelle sind mit fokussierbaren<br />
Objektiven, die eine verbesserte Videoauflösung bieten,<br />
sowie der neuesten Generation von ultrahellen, weißen<br />
LEDs erhältlich, die ein perfektes Bild unter den meisten<br />
Rohrleitungsbedingungen liefern. Die 50-mm-Kamera<br />
ist selbstnivellierend, wodurch das Videobild aufrecht<br />
bleibt, während die Kamera durch das Rohr fährt. Dort,<br />
wo besondere Flexibilität erforderlich ist, bietet die neue<br />
Kabeltrommel für Installateure hervorragende Leistung bei<br />
engen Stellen in den Rohrleitungen von Wohn- und Gewerbegebieten.<br />
Das System kann die meisten Geruchsverschlüsse<br />
(ab 2“/50 mm) und Rohrbiegungen (ab 1 1/4“/32mm)<br />
überwinden. Für Installateure ist es das ideale Werkzeug<br />
für Rohrleitungen mit kleinem Durchmesser. Die eingebaute<br />
Sonde kann verwendet werden, um die Lage mit einem<br />
geeigneten Kabel- und Leitungssuchgerät festzustellen.<br />
Die GatorCam4 kann an die meisten <strong>Inspektion</strong>sanforderungen<br />
angepasst werden. Eine Reihe von verschiedenen<br />
Kabeln sind erhältlich von der Kabeltrommel für Installateure<br />
mit 30 m Länge bis hin zur Trommel mit besonders<br />
steifem 150 m Schubkabel für größere Entfernungen. Eine<br />
langlebige 25-mm- oder 50-mm-Kamera kann an jedem<br />
Schubkabel angebracht werden. Verschiedene kompatible<br />
Sonden, Schlitten, Bürsten und Zubehör runden das Paket<br />
ab, mit dem Rohrleitungen bis 9“ (230 mm) Durchmesser<br />
inspiziert werden können. Dank kompakter Kabeltrommelausführungen<br />
sind die Systeme vollständig transportabel<br />
und während des Transports geschützt.<br />
KONTAKT: Radiodetection CE, Continental Europe, Emmerich,<br />
Marion Giesbers, Tel. +49 2851 9237-20,<br />
E-Mail: marion.giesbers@spx.com<br />
FGN.N930/1<br />
76 03 / 2013
RECHT & REGELWERK PRODUKTE & FACHBERICHT VERFAHREN<br />
IBAK Helmut Hunger GmbH & Co. KG<br />
Kanalrohrinspektionsanlage mit Full-HD-Technologie<br />
Bild 1: Kamera PEGASUS HD mit<br />
elektrischem Lift und Traktor<br />
Hochauflösendes digitales Fernsehen hat Einzug in das<br />
Produktprogramm von IBAK gehalten. Bisher wendete der<br />
Kieler Hersteller von Kanalinspektionsanlagen die Technik<br />
einer vollständig digitalen Bilderzeugung und -übertragung<br />
in seinen auf Fototechnik basierenden PANORAMO-Scannersystemen<br />
an. Diese erzeugen u. a. eine reale 3D-Darstellung<br />
befahrener Leitungen oder Schächte. Über 300<br />
verkaufte Einheiten sprechen für den nachhaltigen Erfolg<br />
dieser Scanner. Bisher wurden in der Palette der Dreh-/<br />
Schwenkkopfkameras die marktüblichen analogen PAL-<br />
Fernsehelektroniken eingesetzt. Allerdings wurde hier mit<br />
der Einführung des Bediensystems BS7 das analoge Videosignal<br />
durch LWL-Technik digital übertragen, was zu einer<br />
enormen Bildverbesserung führte.<br />
Nun folgt der letzte Schritt zur kompletten digitalen Videotechnik:<br />
Erzeugung, Übertragung, Darstellung, Verarbeitung<br />
und Archivierung in Full-HD Qualität.<br />
IBAK nutzt seine in der PANORAMO-Technik gewonnenen<br />
Erfahrungen im Kanal-TV sowie neueste Elektronikkomponenten<br />
aus der digitalen Fernsehtechnik und präsentiert das<br />
weltweit erste HDTV-Dreh-/Schwenkkopf-<strong>Inspektion</strong>ssystem:<br />
PEGASUS HD.<br />
Die PEGASUS HD-Kamera besitzt einen Bildsensor im Full-<br />
HD-Format (1.920 x 1.080 = 208 Millionen Pixel), der ca.<br />
fünfmal so viele Bildelemente aufweist wie ein herkömmlicher<br />
PAL-Sensor. Die Bildübertragung ist von der Bildentstehung<br />
im Kamerakopf bis zur Darstellung und Speicherung<br />
im Bedienstand durchgehend digital. Verlustbehaftete<br />
Analog-/Digital-Wandlungen können dadurch entfallen. Das<br />
Ergebnis ist eine beim Kanalfernsehen bisher nicht mögliche<br />
Güte der Bilder in Auflösung und Farbtreue (Bild 2).<br />
Bereits seit einiger Zeit verwendet IBAK auch bei den analogen<br />
Kamerasystemen eine digitale Übertragung über eine<br />
Glasfaserleitung im Kamerakabel. Diese Glasfaserleitung<br />
kann nun ebenfalls genutzt werden, um die Full-HD-Auflösung<br />
der PEGASUS HD-Kamera zu übertragen. Dadurch und<br />
dank des modularen Aufbaus der IBAK-Kamerasysteme lässt<br />
sich die PEGASUS HD auch mit überschaubarem Aufwand<br />
an neuere <strong>Inspektion</strong>sanlagen adaptieren.<br />
Mit ihrer vertikalen Bildauflösung von 1.080 Pixel erfüllt die<br />
PEGASUS HD nun erstmalig die Anforderungen des DWA-<br />
Merkblatts M149-5 (Dezember 2010) für die <strong>Inspektion</strong><br />
von Großprofilen. Dieses Merkblatt fordert z. B. für die<br />
<strong>Inspektion</strong> einer Leitung DN 1000 in rohraxialer Sicht eine<br />
Bildauflösung von mindestens 1.000 Pixel. Zwar gilt diese<br />
Forderung nicht, wenn die Rohrwand durch eine Dreh-/<br />
Schwenkkopfkamera mit Zoomobjektiv abgeschwenkt wird.<br />
Jedoch bedarf es bei schwer auszumachenden Schadensbildern<br />
natürlich einer ausreichenden Auflösung in axialer<br />
Sicht, um sie überhaupt anschwenken zu können. Bei Bedarf<br />
lässt sich durch den Bediener auch eine geringere Bildauflösung<br />
(HD-Standard 720 x 1.280) einstellen. Dies könnte u.a.<br />
der Reduzierung des abzuspeichernden Datenvolumens bei<br />
der <strong>Inspektion</strong> kleinerer Rohrnennweiten dienen.<br />
Neben der hochauflösenden digitalen Bilderzeugung besitzt<br />
die PEGASUS HD sämtliche Funktionen einer „konventionellen“<br />
Dreh-/Schwenkkopfkamera zur professionellen<br />
Sammlerinspektion, wie 10-fach optischen (sowie 4-fach<br />
digitalen) Zoom, automatisierte Bedienroutinen und Messfunktionen<br />
für Schadensgrößen oder Leitungsverlauf. Die<br />
explosionsgeschützte Ausführung der Anlage für Einsatz in<br />
Zone 1 ist bei IBAK selbstverständlich.<br />
Auf der IFAT 2012 stellte IBAK eine „volldigitale“ Kanalrohr-<br />
Fernsehanlage als Prototyp vor. Nun steht sie als PEGASUS<br />
HD serienmäßig zur Verfügung und wurde im Dezember<br />
2012 an den ersten Kunden, die Stadtentwässerung Koblenz,<br />
ausgeliefert.<br />
KONTAKT: IBAK Helmut Hunger GmbH & Co. KG, Kiel, www.ibak.de<br />
H2/D07 + H2/E08<br />
Bild 2: Anschluss im Betonrohr DN 1000. Foto aufgenommen mit der<br />
PEGASUS HD aus einem unkomprimierten Videodatenstrom mit Full-HD<br />
Auflösung, dargestellt im jpg-Format<br />
03 / 2013 77
FACHBERICHT PRODUKTE & VERFAHREN RECHT & REGELWERK<br />
resinnovation GmbH<br />
Harz8 bindet Schachtdeckelrahmen dauerelastisch ein<br />
Die Rundum-Sanierung von Schachtbauwerken mit modernen<br />
Kunstharzsystemen ist das Schwerpunktthema der resinnovation<br />
GmbH auf der RO-KA-TECH in Kassel. Hier stehen u. a.<br />
die Themen „Abdichtung gegen Grundwasser“ und „korrosionsbeständige<br />
Oberflächenbeschichtung“ im Brennpunkt.<br />
Als chronische „Achillesferse“ von Kanal-Schachtbauwerken<br />
gelten die Einbindung der Schachtdeckelrahmen und ihre<br />
Abdichtung zum Schachtkonus hin. Dieses mechanisch<br />
höchstbelastete Bauelement mit mineralischen Mörteln<br />
einzubinden, ist im Sinne nachhaltiger Problemlösung ein<br />
aussichtsloses Unterfangen, da diese Schwachstelle erfahrungsgemäß<br />
immer wieder aufs Neue saniert werden muss.<br />
Schächte mit dem markant roten „Harz8-Ring“ stehen für kompromisslose<br />
Dichtheit im Bereich der Schachtdeckel-Auflage. Dem<br />
dauerelastischen Werkstoff kann auch jahrelange Verkehrsbelastung<br />
nichts anhaben<br />
Damit könnte bald Schluss sein. Das Epoxidharz-basierte<br />
Abdichtungssystem Harz8, das die resinnovation GmbH<br />
vorstellt, löst dieses Problem schnell und dauerhaft.<br />
Undichte Schachtdeckelrahmen sind ein lästiges Dauerproblem<br />
an einem erheblichen Teil der 13,75 Millionen Revisionsschächte<br />
in deutschen Abwasser-Kanalisationsnetzen. Stete<br />
Dauerbelastung durch die mechanischen Stöße des rollenden<br />
Verkehrs setzt den Schachtrahmen von allen Elementen<br />
des Schachtbauwerks am heftigsten zu. Nur zu bald lösen<br />
sich die Rahmen aus dem Verbund zur Fahrbahnoberfläche;<br />
auch die Dichtheit der Schnittstelle zum darunterliegenden<br />
Schachthals ist schnell dahin.<br />
Harz 8 ist ein von der resinnovation GmbH entwickelter<br />
Zweikomponenten-Epoxidharzmörtel, der momentan als<br />
ultimative Lösung zur Einbindung von Schauchlinern in<br />
Schachtbauwerke Furore macht. Nun hat man das Potential<br />
dieses hoch elastischen Dauerklebers zur „Ein-für<br />
allemal-Sanierung“ des Schachtdeckelrahmen-Problems<br />
entdeckt. Denn im Prinzip steht man hier vor der gleichen<br />
Herausforderung wie bei der Liner-Einbindung – nur ist<br />
sie in ihrem Ausmaß ungleich stärker. In beiden Fällen<br />
hat man relativ zueinander bewegliche Bauelemente,<br />
von denen eines ununterbrochen dynamischen Lasten<br />
ausgesetzt ist. An solchen Schnittstellen können spröde,<br />
mineralische Werkstoffe keine überzeugende Lösung<br />
sein, wie die Praxis auch immer wieder eindrucksvoll<br />
belegt.<br />
Der Schachtring ist jedoch – im Gegensatz zur Liner-Einbindung<br />
tief an der Basis des Bauwerks – den Achslasten<br />
des Straßenverkehrs unmittelbar und aus nächster Distanz<br />
ausgesetzt. Daher kann hier nur ein zuverlässig rissfreier<br />
und dauerelastischer Werkstoff Abhilfe schaffen, der<br />
zugleich eine extreme Haftwirkung zur Fahrbahn und zum<br />
Schachtbauwerk hin bietet und auch unter thermischen<br />
Extrembedingungen nicht versprödet. Die Applikation von<br />
Harz 8 ist einfach und dauert samt vorbereitenden Arbeiten<br />
nur minimal länger als Mörteleinbindung. Der sanierte<br />
Schacht ist binnen 120 Minuten wieder voll belastbar. Der<br />
letztlich entscheidende Unterschied zu klassischen Lösungen<br />
ist, dass mit Harz 8 das Thema Schachtring endgültig<br />
„vom Tisch“ ist. Die DWA hat in ihrer Umfrage 2009 zum<br />
Zustand der Kanalisationssysteme recht plastisch vorgerechnet,<br />
was die turnusmäßige Wiederholung der Sanierung<br />
von Schachtrahmen und Abdeckungen die Volkswirtschaft<br />
und die Gebührenzahler kostet: „Wenn auch nur zwei<br />
Drittel der Schächte im Straßenraum liegen (genaue Zahlen<br />
liegen nicht vor) und diese alle zehn Jahre saniert werden<br />
müssten, so ergibt dies, bei einem durchschnittlichen Sanierungsaufwand<br />
von 500 bis 1.000 € pro Schachtrahmen/<br />
Deckel, einen Sanierungsaufwand von 250 bis 500 Millionen<br />
€ pro Jahr.“ Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.<br />
Es lohnt sich also, in aufwändigere Sanierungssysteme<br />
zu investieren, wenn diese dafür erheblich länger halten<br />
als die bisherigen Lösungen.<br />
Dipl.-Ing. Mirko Heuser und Dipl.-Ing. Dino Heuser,<br />
Geschäftsführer der resinnovation GmbH, ziehen den Rahmen<br />
für die konsequente Lösung des Problems gedanklich<br />
noch einen Schritt weiter: „Eigentlich sollte man gar nicht<br />
erst bis zur Sanierung warten, sondern Harz 8 gleich beim<br />
Schacht-Neubau einsetzen – dann kann man sich von vorn<br />
herein (mindestens) einen Arbeitsgang sparen.“<br />
KONTAKT: resinnovation GmbH, Rülzheim, Tel. +49 7272 702502,<br />
E-Mail: ulrich.winkler@resinnovation.de<br />
H2/E12<br />
78 03 / 2013
RECHT & REGELWERK PRODUKTE & FACHBERICHT VERFAHREN<br />
Trelleborg Pipe Seals Duisburg GmbH<br />
Sanierung vom Hauptkanal zum Gebäude<br />
Praktikabilität, Zuverlässigkeit und Zeitersparnis bei Sanierungsmaßnahmen<br />
von Rohrleitungen: Diese Aspekte stehen<br />
im Mittelpunkt bei den Systemlösungen von Trelleborg Pipe<br />
Seals aus Duisburg. Mit dem neuen MtH-System präsentiert<br />
das Unternehmen auf der RO-KA-TECH ein Verfahren,<br />
das genau diesen Ansprüchen gerecht wird. Der Name MtH<br />
leitet sich dabei vom englischen „Main-to-House“ ab und<br />
bezieht sich auf die Möglichkeit der Sanierung von Stutzen<br />
und Abzweigen sowie der Anschlussleitungen vom Hauptrohr<br />
zum Haus. Bislang benötigte man bei der Instandsetzung<br />
des Hausanschlusssystems obligatorisch einen Zugangspunkt<br />
im Gebäude, um dann in Richtung Hauptkanal zu sanieren.<br />
Das neue System hingegen erlaubt eine aufgrabungsfreie<br />
Wiederherstellung der Leitungen und Abzweige aus entgegengesetzter<br />
Richtung. Ein Zutritt im Hausbereich über<br />
einen Schacht oder eine Revisionsöffnung ist damit nicht<br />
mehr erforderlich. „Die Entfernung zwischen Startschacht im<br />
Hauptrohr zum Anschlusspunkt kann bei der Instandsetzung<br />
sogar bis zu 150 m betragen. Und wir können bis zu 30 m an<br />
einem Stück sanieren“, erklärt Stephan Raab, Leiter Vertrieb<br />
und Marketing bei Trelleborg Pipe Seals Duisburg. Das beim<br />
MtH-System verarbeitete, sehr flexible Hutmanschetten- und<br />
Liner-Material gewährleistet höchste Stabilität und verfügt<br />
in Verbindung mit dem Epoxidharzsystem EPROPOX HC120<br />
über hervorragende mechanische Kennwerte. Insbesondere<br />
Kommunen und Gemeinden eröffnet das innovative Verfahren<br />
neue Möglichkeiten: Sie können künftig die Instandsetzung<br />
ihrer <strong>Grundstücksentwässerung</strong>sleitungen – sogar ohne<br />
Genehmigung des Eigentümers – selbst in die Hand nehmen<br />
und so „problemlos“ für<br />
intakte Leitungen sorgen.<br />
Die Praxistauglichkeit des<br />
Systems wurden im November<br />
2012 bei einem ersten<br />
Pilotprojekt für die Stadt<br />
Rheinberg unter Beweis<br />
gestellt. Hier kam das MtH-<br />
System zum Einsatz, um einige<br />
Hausanschlussleitungen<br />
(DN 150) zu sanieren, bei<br />
denen sowohl im und vorm<br />
Haus keine Zugänglichkeit<br />
vorhanden war, um den<br />
erforderlichen Schlauchliner<br />
einzubauen.<br />
KONTAKT: Trelleborg Pipe SealDuisburg GmbH,<br />
E-Mail: info.epros@trelleborg.com<br />
H5/09<br />
Das patentierte Hightech-MtH-System erlaubt die<br />
Sanierung vom Hauptkanal bis zum Gebäude<br />
Grafik: Trelleborg<br />
Pipe Seals Duisburg<br />
MC Bauchemie<br />
DIBt erteilt Zulassung für Konudur Robopox 10<br />
Risse und Ausbrüche sowie Undichtigkeiten an Rohrmuffen<br />
und Hausanschlusseinbindungen stellen typische Schadensbilder<br />
in der Kanalisation dar, die es sowohl aus Gründen<br />
der Dichtigkeit als auch der Standsicherheit dauerhaft zu<br />
sanieren gilt. Besonders nicht begehbare Kanäle bringen bei<br />
derartigen Schäden Probleme mit sich, da diese nur schwer<br />
zu erfassen und instand zu setzen sind. Konudur Robopox 10<br />
sorgt hier für Abhilfe und bietet eine zuverlässige Lösung: Das<br />
Hightech-Produktsystem der MC, dem das Deutsche Institut<br />
für Bautechnik (DIBt) im Dezember 2012 die allgemeine bauaufsichtliche<br />
Zulassung unter der Zulassungsnummer Z-42.3-<br />
496 erteilt hat, verfügt über hervorragende Eigenschaften<br />
bei der robotergestützten Instandsetzung nicht begehbarer<br />
Kanäle. Das pastöse Zweikomponenten-Epoxidharzsystem<br />
ist manuell und vor allem maschinell verarbeitbar und zeichnet<br />
sich durch eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien<br />
sowie eine gute Haftung auf trockenen, mattfeuchten und<br />
feuchten mineralischen Untergründen sowie GFK-Laminaten<br />
aus. Konudur Robopox 10 härtet auch unter Wasser aus und<br />
verfügt über gute mechanische Eigenschaften nach Erhärtung.<br />
Es ist zudem gut sichtbar bei der Kameraüberwachung<br />
robotergestützter Sanierungssysteme. Konudur Robopox<br />
10 wird zum Instandsetzen örtlich begrenzter Schäden in<br />
Abwasser-, Mischwasser- oder Regenwasserkanälen und<br />
-Ieitungen mit Kreis- oder Eiprofilen eingesetzt. Es dient der<br />
Reparatur von Rissen, Fehlstellen wie Scherben und Ausbrüchen,<br />
defekten Muffen oder Muffenversätzen in Kanälen und<br />
Sammelleitungen aus Steinzeug, Kanalklinker, Beton oder<br />
PVC in den Nennweiten DN 100 bis DN 800. Ein weiteres<br />
Anwendungsgebiet ist die Sanierung defekter Anbindungen<br />
von Hausanschlüssen und Seitenzuläufen. Dabei können problemlos<br />
auch solche Anschlüsse dauerhaft dicht eingebunden<br />
werden, die zuvor mit einem Schlauchliningverfahren auf<br />
Epoxid-, Polyester-, Silikat- oder Vinylesterharzbasis saniert<br />
wurden.<br />
KONTAKT: MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG, Bottrop,<br />
www.mc-bauchemie.de<br />
H10/C04<br />
03 / 2013 79
FACHBERICHT PRODUKTE & VERFAHREN RECHT & REGELWERK<br />
Friatec AG<br />
Erstellung von Hausanschlüssen und Straßenabläufen<br />
Für die wirtschaftliche Erstellung von Hausanschlüssen<br />
und Straßenabläufen steht das FRIAFIT-Abwassersystem<br />
von Friatec.<br />
Große Anschlüsse in d 225 werden bisher mit Spitzend-<br />
Formteilen hergestellt, die mit Hilfe von Heizwendel-<br />
Schweißmuffen in den Kanal eingebunden werden. Ein<br />
nachträgliches Erstellen von Anschlussleitungen ist nur zeitaufwändig<br />
durch Sperren und Trennen des Hauptkanals<br />
möglich. Mit dem neuen FRIAFIT-Abwassersattel ASA-VL<br />
können auch großvolumige Abzweige an Sammlern mit<br />
geringem Aufwand, minimalem Tiefbau und vor allem<br />
ohne Unterbrechung des Betriebs kostengünstig hergestellt<br />
werden.<br />
Die Fixierung des Sattels kann an jeder beliebigen Position<br />
auf dem Rohr erfolgen. Durch die speziell entwickelte Aufspanntechnik<br />
wird nur der Zugang zur überdeckten Sattelfläche<br />
benötigt. Gerade bei Anbindungen an bestehende<br />
Leitungen wird die Bettung der Leitungszone dadurch nur<br />
im unbedingt notwendigen Ausmaß gestört.<br />
Durch die Montage mittels Unterdruck wird automatisch<br />
und in Sekundenschnelle eine optimale Aufspannung des<br />
Sattels auf dem Rohr erzeugt. Baustellenübliche Ovalitäten<br />
und Formabweichungen des Rohres werden dabei durch<br />
die Vakuumspanntechnik ausgeglichen. Hierzu sind nur<br />
ein baustellenüblicher Kompressor und das VACUSET von<br />
Kanalrohr<br />
Steinzeug DN250 N<br />
Steinzeug DN250 H<br />
Steinzeug DN300 N<br />
Steinzeug DN300 H<br />
Steinzeug DN350 N<br />
Steinzeug DN350 H<br />
Beton DN250<br />
Beton DN300<br />
Anschluss-Stutzen d2 = 160 mm<br />
ASA-MULTI DN250<br />
ASA-MULTI<br />
DN300/350-STZ<br />
DN250/300-B<br />
Friatec erforderlich. Der korrekte Sitz des Fittings wird am<br />
Manometer angezeigt: Vakuum steht – Schweißung starten.<br />
Eine absatzfreie Anbohrung mit dem Anbohrset FWAB<br />
ASA ermöglicht eine optimale hydraulische Leistung und<br />
die Fertigstellung eines Abzweiges in kürzester Zeit. Der<br />
FRIAFIT-Abwassersattel ASA-VL mit Abgang d 225 ist für<br />
Anschlüsse an PE-HD-Hauptleitungen in den Dimensionen<br />
d 355, d 450, d 560 und d 630 verfügbar.<br />
Der FRIAFIT-Anschluss-Stutzen ASA-MULTI ermöglicht<br />
jetzt eine Verbindung von geschweißten PE-HD Hausanschlussleitungen<br />
oder Seitenzuläufen an Steinzeug- oder<br />
Betonrohre und damit einen wirtschaftlichen Anschluss. Bei<br />
Neuverlegung wie auch Sanierung muss keine<br />
Trennung des Hauptkanals oder komplette<br />
Freilegung erfolgen. Die Anbohrung des<br />
Steinzeug- bzw. Betonrohres erfolgt mit üblichen<br />
Kernbohrgeräten mittels Bohrkrone. Der<br />
Anschluss-Stutzen ASA-MULTI wird mittels<br />
mechanischer Aufspannung mit elastomerer<br />
Abdichtung für die Schnittstelle Hauptkanal/<br />
Anschluss auf dem Hauptkanal fixiert. Der<br />
Stutzen kann jetzt mit einer FRIAFIT-Muffe<br />
AM oder einem FRIAFIT-Bogen ABM direkt<br />
mit der PE-HD-Anschlussleitung dicht, längskraftschlüssig<br />
und wurzelfest geschweißt<br />
werden.<br />
Der Anschluss erfolgt ohne Einragen in den<br />
Hauptkanal und ermöglicht somit eine ungehinderte<br />
Kamerabefahrung. Die helle Innenfläche<br />
des Stutzens unterstützt die optimale<br />
Sicht bei TV-<strong>Inspektion</strong>. Ein wesentlicher Vorteil<br />
besteht auch im dimensionsübergreifenden<br />
Einsatz, siehe Tabelle.<br />
FRIAFIT-Anschluss-Stutzen ASA-MULTI<br />
KONTAKT: FRIATEC AG, Division Technische Kunststoffe,<br />
Mannheim, Karin Kionka,<br />
Tel. +49 621 486-1708,<br />
E-Mail: karin.kionka@friatec.de,<br />
www.friatec.de<br />
80 03 / 2013
Marktübersicht<br />
2013<br />
Rohre + Komponenten<br />
Maschinen + Geräte<br />
Korrosionsschutz<br />
Dienstleistungen<br />
Sanierung<br />
Institute + Verbände<br />
Fordern Sie weitere Informationen an unter<br />
Tel. 0201/82002-35 oder E-Mail: h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
www.3r-marktuebersicht.de<br />
03 / 2013 81
2013<br />
RohRe + Komponenten<br />
Marktübersicht<br />
Armaturen<br />
Armaturen + Zubehör<br />
Anbohrarmaturen<br />
Rohre<br />
Formstücke<br />
Schutzmantelrohre<br />
Kunststoff<br />
82 03 / 2013
RohRe + Komponenten<br />
2013<br />
Rohrdurchführungen<br />
Marktübersicht<br />
Dichtungen<br />
Ihr „Draht“ zur Anzeigenabteilung von<br />
Helga Pelzer<br />
Tel. 0201 82002-35<br />
Fax 0201 82002-40<br />
h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
03 / 2013 83
2013<br />
mAschInen + GeRäte<br />
Marktübersicht<br />
Kunststoffschweißmaschinen<br />
horizontalbohrtechnik<br />
Leckageortung<br />
Ihr „Draht“ zur Anzeigenabteilung von<br />
Helga Pelzer<br />
Tel. 0201 82002-35<br />
Fax 0201 82002-40<br />
h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
84 03 / 2013
KoRRosIonsschutZ<br />
2013<br />
Kathodischer Korrosionsschutz<br />
Marktübersicht<br />
03 / 2013 85
2013<br />
KoRRosIonsschutZ<br />
Marktübersicht<br />
Kathodischer Korrosionsschutz<br />
86 03 / 2013
KoRRosIonsschutZ<br />
2013<br />
Korrosionsschutz<br />
Marktübersicht<br />
Ihr „Draht“ zur Anzeigenabteilung von<br />
Helga Pelzer<br />
Tel. 0201 82002-35<br />
Fax 0201 82002-40<br />
h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
03 / 2013 87
2013<br />
DIenstLeIstunGen / sAnIeRunG<br />
Marktübersicht<br />
Sanierung<br />
sanierung<br />
InstItute + VeRbänDe<br />
Institute<br />
88 03 / 2013
InstItute + VeRbänDe<br />
2013<br />
Verbände<br />
Marktübersicht<br />
03 / 2013 89
2013<br />
InstItute + VeRbänDe<br />
Marktübersicht<br />
Verbände<br />
INSERENTENVERZEICHNIS<br />
Firma<br />
8th Pipeline Technology Conference 2013, Hannover 73<br />
Amitech Germany GmbH, Mochau 13<br />
Güteschutz Kanalbau e.V., Bad Honnef 03<br />
IE expo 2013, Shanghai, Volksrepublik China 69<br />
JT-elektronik GmbH, Lindau 55<br />
Radiodetection CE, Continental Europe, Emmerich am Rhein 57<br />
RELINEEUROPE AG, Rohrbach<br />
Titelseite<br />
REW Istanbul 2013, Istanbul, Türkei 41<br />
SebaKMT, Baunach 07<br />
TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG, Lennestadt 11<br />
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hannover 15<br />
VDRK Verband der Rohr-und Kanal-Technik-Unternehmen e.V., Kassel<br />
Beilage<br />
Wiesbadener Kunststoffrohrtage 2013, Wiesbaden 17<br />
Marktübersicht 81-90<br />
90 03 / 2013
RsV-Regelwerke<br />
RSV Merkblatt 1<br />
renovierung von entwässerungskanälen und -leitungen<br />
mit vor Ort härtendem Schlauchlining<br />
2011, 48 Seiten, DIN A4, broschiert, € 35,-<br />
RSV Merkblatt 2<br />
renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit<br />
rohren aus thermoplastischen Kunststoffen durch<br />
Liningverfahren ohne ringraum<br />
2009, 38 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RsV Merkblatt 2.2<br />
renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit<br />
vorgefertigten rohren durch TIP-Verfahren<br />
2011, 32 Seiten DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RsV Merkblatt 3<br />
renovierung von Abwasserleitungen und -kanälen durch<br />
Liningverfahren mit ringraum<br />
2008, 40 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RsV Merkblatt 4<br />
reparatur von drucklosen Abwässerkanälen und<br />
rohrleitungen durch vor Ort härtende Kurzliner (partielle Inliner)<br />
2009, 20 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RsV Merkblatt 5<br />
reparatur von entwässerungsleitungen und Kanälen<br />
durch roboterverfahren<br />
2007, 22 Seiten, DIN A4, broschiert, € 27,-<br />
RsV Merkblatt 6<br />
Sanierung von begehbaren entwässerungsleitungen und<br />
-kanälen sowie Schachtbauwerken - Montageverfahren<br />
2007, 23 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RECHT & REGELWERK www.vulkan-verlag.de FACHBERICHT<br />
RsV Merkblatt 6.2<br />
Sanierung von Bauwerken und Schächten<br />
in entwässerungssystemen<br />
2012, 41 Seiten, DIN A4, broschiert, € 35,-<br />
RsV Merkblatt 7.1<br />
renovierung von drucklosen Leitungen /<br />
Anschlussleitungen mit vor Ort härtendem Schlauchlining<br />
2009, 30 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RsV Merkblatt 7.2<br />
Hutprofiltechnik zur einbindung von Anschlussleitungen –<br />
reparatur / renovierung<br />
2009, 31 Seiten, DIN A4, broschiert, € 30,-<br />
RsV Merkblatt 8<br />
erneuerung von entwässerungskanälen und -anschlussleitungen<br />
mit dem Berstliningverfahren<br />
2006, 27 Seiten, DIN A4, broschiert, € 29,-<br />
RsV Merkblatt 10,<br />
Kunststoffrohre für grabenlose Bauweisen<br />
2008, 55 Seiten, DIN A4, broschiert, € 37,-<br />
RsV information 11<br />
Vorteile grabenloser Bauverfahren für die erhaltung und<br />
erneuerung von Wasser-, Gas- und Abwasserleitungen<br />
2012, 42 Seiten DIN A4, broschiert, € 9,-<br />
Auch als<br />
eBook<br />
erhältlich!<br />
Jetzt bestellen!<br />
Wissen für DIe<br />
Zukunft<br />
faxbestellschein an: +49 201 / 82002-34 Deutscher Industrieverlag oder GmbH abtrennen | Arnulfstr. und 124 im | fensterumschlag 80636 München einsenden<br />
Ja, ich / wir bestelle(n) gegen rechnung:<br />
___ ex. rSV-M 1 € 35,-<br />
___ ex. rSV-M 2 € 29,-<br />
___ ex. rSV-M 2.2 € 29,-<br />
___ ex. rSV-M 3 € 29,-<br />
___ ex. rSV-M 4 € 29,-<br />
___ ex. rSV-M 5 € 27,-<br />
___ ex. rSV-M 6 € 29,-<br />
Ich bin rSV-Mitglied und erhalte 20 % rabatt<br />
auf die gedruckte Version (Nachweis erforderlich!)<br />
___ ex. rSV-M 6.2 € 35,-<br />
___ ex. rSV-M 7.1 € 29,-<br />
___ ex. rSV-M 7.2 € 30,-<br />
___ ex. rSV-M 8 € 29,-<br />
___ ex. rSV-M 10 € 37,-<br />
___ ex. rSV-I 11 € 9,-<br />
zzgl. Versandkosten<br />
firma/Institution<br />
Vorname, Name des empfängers<br />
Straße / Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Antwort<br />
Vulkan-Verlag GmbH<br />
Versandbuchhandlung<br />
Postfach 10 39 62<br />
45039 Essen<br />
e-Mail<br />
Branche / Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise Bankabbuchung rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B.<br />
Brief, fax, e-Mail) oder durch rücksendung der Sache widerrufen. Die frist beginnt nach erhalt dieser Belehrung in Textform.<br />
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an die Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Versandbuchhandlung, Huyssenallee 52-56, 45128 essen.<br />
Bankleitzahl<br />
Ort, Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer<br />
nutzung personenbezogener Daten: für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich<br />
von DIV Deutscher 03 / 2013 Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per e-Mail, nicht über interessante, fachspezifische Medien und Informationsangebote informiert und beworben werde.<br />
91<br />
Diese erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.<br />
✘<br />
XfrSVM1212
www.dwa.de/KA<br />
Neues DWA-Büro<br />
in Berlin<br />
Demografischer<br />
Wandel in der<br />
Wasserwirtschaft<br />
Niederschlagswasser<br />
in<br />
Trennsystemen<br />
DWA-Politikmemorandum<br />
KA-Titel_07_2008.indd 1 19.06.2008 10:02:59<br />
SERVICES BUCHBESPRECHUNG<br />
NORMGERECHTE ABSCHEIDERANLAGEN FÜR LEICHTFLÜSSIGKEITEN<br />
Funktion - Betrieb - Wartung - <strong>Inspektion</strong><br />
INFOS:<br />
Autor: Dr. Jürgen Hinrichsen; Beuth Praxis, 1. Auflage<br />
2012, 254 Seiten, DIN A5, Broschur, 42,00 EUR,<br />
ISBN 978-3-410-21270-6, eBook: 42,00 EUR,<br />
ISBN 978-3-410-21271-3, Kombi (Buch & eBook): 54,60 EUR<br />
In Deutschland werden schätzungsweise 100.000<br />
nach dem Schwerkraftprinzip arbeitende Abscheideranlagen<br />
für Leichtflüssigkeiten in Kfz-Werkstätten,<br />
Waschanlagen und Waschstraßen betrieben.<br />
Die technischen Anforderungen an Bau, Betrieb<br />
und Wartung von Norm-gerechten Abscheideranlagen<br />
für Leichtflüssigkeiten sind in den Normen<br />
DIN EN 858-1 und -2 sowie DIN 1999-100 festgelegt.<br />
CE-Kennzeichnung und bauaufsichtliche<br />
Zulassungen regeln außerdem das Inverkehrbringen<br />
auf europäischer und nationaler Ebene. Dieser<br />
Beuth Praxis-Titel geht detailliert auf die Inhalte<br />
der geltenden Verordnungen und Normen ein.<br />
Weitere behandelte Themen sind die verwendeten<br />
Werkstoffe (etwa unter dem Einfluss von Biodiesel)<br />
sowie Betrieb, Wartung und <strong>Inspektion</strong>. Zu diesem<br />
Zweck enthält das Kompendium ein Muster-<br />
Betriebstagebuch. Außerdem präsentiert der Band<br />
eine Darstellung der Generalinspektion sowie der<br />
erforderlichen Qualifikation (Fachkundiger, VAwS-<br />
Sachverständiger) und sachgerechten Ausrüstung.<br />
Der Autor beschreibt die typischen Mängel von<br />
Abscheideranlagen und zeigt konkrete Lösungen<br />
zur Behebung auf. Ein Überblick über aktuell verfügbare<br />
Maschinentypen rundet den Inhalt ab.<br />
DWA-BRANCHENFÜHRER 2013<br />
DWA-BRANCHENFÜHRER 2013<br />
Deutsch<br />
English<br />
Français<br />
■ DWA-BRANCHENFÜHRER<br />
WASSERWIRTSCHAFT<br />
ABWASSER-ABFALL 2013<br />
INDUSTRY GUIDE 2013<br />
WATERMANAGEMENT - WASTEWATER - WASTE<br />
GUIDE SECTORIEL 2013<br />
GESTION DES EAUX - EAUX USÉES-DÉCHETS<br />
Korrespondenz Abwasser, Abfall 55. Jahrgang · Nr. 7 · Juli<br />
Korrespondenz<br />
Abwasser · Abfall<br />
INFOS:<br />
GFA, Rita Theus, Hennef, Tel. +49 22 42/872-153,<br />
Fax +49 22 42/872-151, E-Mail: branchenfuehrer@dwa.de<br />
Eine einzigartige Datenquelle für Dienstleistungen<br />
und Produkte zu den Themen Wasserwirtschaft,<br />
Abwasser und Abfall ist der jährlich erscheinende<br />
Branchenführer der DWA – Deutsche Vereinigung<br />
für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall<br />
e. V. Das aktuelle Adressbuch mit Angaben zu<br />
Herstellern und Dienstleistern aus den Arbeitsbereichen<br />
der Vereinigung ist für 2013 neu erschienen<br />
und in Buchform kostenlos erhältlich. Zudem<br />
wurde die digitale Fassung im Internet aktualisiert:<br />
www.gfa-news.de, dort „Branchenführer“.<br />
Der Branchenführer umfasst die Bereiche: Planung,<br />
Ausschreibung, Bauüberwachung, Bau, Anlagenbau,<br />
Haus- und <strong>Grundstücksentwässerung</strong>,<br />
Kanalisation, Pumpwerke, Hebeanlagen, Abwasserbehandlung,<br />
Schlammbehandlung, -entsorgung,<br />
Wasseraufbereitung, Mess-, Regel-, Steuerungsund<br />
Prüfgeräte, Antriebe, Motoren, Behandlung<br />
besonderer Abwässer aus Industrie und Gewerbe,<br />
Abfallwirtschaft/Entsorgungstechnik, Betrieb,<br />
Wartung, Reparatur, Dienstleistungsunternehmen,<br />
Werbeagenturen, Fachliteratur, Software, Bildung,<br />
Wasserbau, Wasserkraft, Gewässerunterhaltung,<br />
Hydrologie und Boden.<br />
HIDDEN CHAMPIONS – AUFBRUCH NACH GLOBALIA<br />
Die Erfolgsstrategien unbekannter Weltmarktführer<br />
INFOS:<br />
Autor: Hermann Simon; Campus Verlag, 1. Auflage 2012,<br />
447 Seiten, 67 Abb., gebunden, 42,00 EUR,<br />
ISBN: 978-3-593-39714-6<br />
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Hermann Simon setzt die<br />
Serie seiner Hidden Champions-Bestseller mit<br />
seinem neuen Buch „Hidden Champions – Aufbruch<br />
nach Globalia“ fort. Er liefert die bisher<br />
umfassendste Erklärung für den bewunderten<br />
Erfolg deutscher Unternehmen in der Welt von<br />
heute und morgen, die er „Globalia“ nennt.<br />
Immer wieder erfindet Simon solche pointierten<br />
Begriffe. Auch „Hidden Champions“, mittlerweile<br />
mit mehr als 300.000 Google-Einträgen<br />
nicht nur in der deutschen Sprache, sondern<br />
weltweit ein Standard-Terminus, ist seine<br />
Wortschöpfung.<br />
Das neue Buch zeigt anhand von hunderten neuer<br />
Fallbeispiele, dass die unglaubliche Erfolgsgeschichte<br />
der mittelständischen Weltmarktführer<br />
weitergeht. Die Postkrisenzeit, die Probleme der<br />
Eurozone und der Aufstieg Chinas eröffnen völlig<br />
neue Chancen und Herausforderungen, denen<br />
sich die Hidden Champions bravourös gewachsen<br />
zeigen. „Ihre Überlegenheit haben die Hidden<br />
Champions bis dato vielfach unter Beweis gestellt.<br />
Die deutschen Mittelständler sind für Globalia, die<br />
globalisierte Welt der Zukunft, bestens aufgestellt.<br />
Ich bin sehr optimistisch“, so Simon.<br />
92 1-2 | 2013
AKTUELLE TERMINE SERVICES<br />
BAU-Akademie Nord<br />
SEMINARE<br />
GW 15 – Grundkurs Nachumhüllen von<br />
Rohren, Armaturen und Formteilen nach<br />
DVGW-Merkblatt GW 15<br />
08.-12.04.2012 Bad Zwischenahn<br />
GW 15 – Nachschulung Nachumhüllen von<br />
Rohren, Armaturen und Formteilen nach<br />
DVGW-Merkblatt GW 15<br />
04.04.2013 Bad Zwischenahn<br />
11.04.2013 Bad Zwischenahn<br />
GW 330 – Grundkurs PE-Schweißer gemäß<br />
DVGW-Arbeitsblatt GW 330<br />
08.04.-12.04.2013 Bad Zwischenahn<br />
GW 330 – Nachschulung PE-Schweißer<br />
gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 330<br />
18.03.2013 Bad Zwischenahn<br />
19.03.2013 Bad Zwischenahn<br />
15.04.2013 Bad Zwischenahn<br />
16.04.2013 Bad Zwischenahn<br />
17.04.2013 Bad Zwischenahn<br />
18.04.2013 Bad Zwischenahn<br />
W 339 - Fachkraft für Muffentechnik<br />
metallischer Rohrsysteme –<br />
DVGW-Arbeitsblatt W 339<br />
18.-20.03.2013 Bad Zwischenahn<br />
brbv<br />
SPARTENÜBERGREIFEND<br />
GRUNDLAGENSCHULUNGEN<br />
GFK-Rohrleger nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
W 324 – Grundkurs<br />
08./09.04.2013 Gera<br />
GFK-Rohrleger nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
W 324 – Nachschulung<br />
22.03.2013 Gera<br />
INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN<br />
Praxis der Tiefbauarbeiten bei<br />
Leitungsverlegungen –<br />
DIN 4124/ZTV A-StB, 2012<br />
24./25.04.2013 Berlin<br />
Bauausführung<br />
19.03.2013 Münster<br />
Abnahme und Gewährleistung<br />
20.03.2013 Münster<br />
GAS/WASSER<br />
GRUNDLAGENSCHULUNGEN<br />
GW 128 Grundkurs „Vermessung“<br />
12 Termine ab 04.03.2013 bundesweit<br />
GW 128 Nachschulung „Vermessung“<br />
9 Termine ab 19.03.2013 bundesweit<br />
Sicherheit bei Arbeiten im Bereich von<br />
Versorgungsleitungen – Schulung nach<br />
Hinweis GW 129<br />
9 Termine ab 19.03.2013 bundesweit<br />
Schweißaufsicht nach DVGW-Merkblatt<br />
GW 331<br />
12.-26.04.2013 Leipzig<br />
PE-HD Schweißer nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
GW 330 – Grundkurs<br />
27 Termine ab 04.03.2013 bundesweit<br />
PE-HD Schweißer nach DVGW-Arbeitsblatt<br />
GW 330 – Verlängerung<br />
43 Termine ab 05.03.2013 bundesweit<br />
Nachumhüllen von Rohren, Armaturen,<br />
und Formteilen nach DVGW-Merkblatt<br />
GW 15 – Grundkurs<br />
15 Termine ab 04.03.2013 bundesweit<br />
Nachumhüllen von Rohren, Armaturen,<br />
und Formteilen nach DVGW-Merkblatt<br />
GW 15 – Nachschulung<br />
21 Termine ab 01.03.2013 bundesweit<br />
Fachkraft für Muffentechnik metallischer<br />
Rohrsysteme – DVGW-Arbeitsblatt W 339<br />
6 Termine ab 11.03.2013 bundesweit<br />
Kunststoffrohrleger Schwerpunkt PVC<br />
15.-17.04.2013 Gera<br />
INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN<br />
Aufbaulehrgänge Gas/Wasser<br />
6 Termine ab 12.03.2013 bundesweit<br />
Netzmeister/Rohrnetzmeister –<br />
Erfahrungsaustausch<br />
19./20.03.2013 Köln<br />
Sachkundiger Gas bis 4 bar<br />
09.04.2013 Stuttgart<br />
Sachkundiger Wasser<br />
10.04.2013 Stuttgart<br />
Reinigung und Desinfektion von<br />
Wasserverteilungsanlagen<br />
21.03.2013 Stockdorf bei München<br />
PRAXISSEMINARE<br />
Arbeiten an Gasleitungen – BGR 500,<br />
Kap. 2.31 – Fachaufsicht<br />
22.-26.04.2013 Gera<br />
Fachwissen für Schweißaufsichten nach<br />
DVGW-Merkblatt GW 331<br />
inkl. DVS-Abschluss 2212-1<br />
21./22.03.2013 Dortmund<br />
FERNWÄRME<br />
GRUNDLAGENSCHULUNGEN<br />
Fernwärmemeister – Erfahrungsaustausch<br />
19./20.03.2013 Köln<br />
Techniklehrgang für Vorarbeiter Fernwärme<br />
15.-19.04.2013 Kerpen<br />
DVGW<br />
INTENSIVSCHULUNGEN<br />
Wasserchemie<br />
19.-21.03.2013 Bamberg<br />
GWI Essen<br />
SEMINARE<br />
Sicherheitstraining bei Bauarbeiten im<br />
Bereich von Versorgungsleitungen -<br />
BALSibau - DVGW GW 129<br />
19.04.2013 Essen<br />
12.07.2013 Essen<br />
27.09.2013 Essen<br />
22.11.2013 Essen<br />
Sachkundigenschulung Gas-Druckregelund<br />
-Messanlagen im Netzbetrieb und in<br />
der Industrie<br />
24.-26.06.2013 Essen<br />
16.-18.09.2013 Essen<br />
09.-11.12.2013 Essen<br />
Arbeiten an freiverlegten<br />
Gasrohrleitungen auf Werksgelände und<br />
im Bereich betrieblicher Gasverwendung<br />
gemäß DVGW G 614<br />
06.09.2013 Essen<br />
Gasspüren und Gaskonzentrationsmessungen<br />
18./19.06.2013 Essen<br />
07./08.10.2013 Essen<br />
1-2 | 2013 93
SERVICES AKTUELLE TERMINE<br />
Grundlagen, Praxis und Fachkunde von<br />
Gas-Druckregelanlagen nach DVGW G 491,<br />
G 495 und G459-2<br />
10.-11.07.2013 Essen<br />
20.-21.11.2013 Essen<br />
Die DVGW-TRGI 2008 - Technische Regeln<br />
für Gasinstallationen<br />
18.03.2013 Essen<br />
18.07.2013 Essen<br />
Praxis des Bereitschaftsdienstes für Biogas<br />
20.03.2013 Essen<br />
Wirtschaftliche Instandhaltung von<br />
Gasnetzen und –anlagen<br />
21.03.2013 Essen<br />
18.12.2013 Essen<br />
Gas-Hausanschlüsse – Planung, Betrieb,<br />
Instandhaltung<br />
10./11.04.2013 Essen<br />
12./13.12.2013 Essen<br />
Auslegung und Dimensionierung von Gas-<br />
Druckregelanlagen<br />
10./11.04.2013 Essen<br />
09./10.10.2013 Essen<br />
Sicheres Arbeiten und Sicherheitstechnik<br />
in der Gas-Hausinstallation<br />
17./18.04.2013 Essen<br />
25./26.09.2013 Essen<br />
Sachkundige für Odorieranlagen - DVGW<br />
G 280<br />
24./25.04.2013 Essen<br />
12./13.11.2013 Essen<br />
Prüfungen, Dokumentationen und<br />
Abnahmen von Gas-Druckregelanlagen bis<br />
5 bar durch Sachkundige<br />
14./15.05.2013 Essen<br />
05./06.11.2013 Essen<br />
Weiterbildung von Sachkundigen und<br />
technischen Führungskräften im Bereich<br />
von Gas-Druckregel- und -Messanlagen<br />
03./04.06.2013 Essen<br />
16./17.09.2013 Essen<br />
18./19.06.2013 Organisation und Logistik<br />
der Gasrohrnetzüberprüfung<br />
17.06.2013 Essen<br />
Weiterbildung von Sachkundigen und<br />
technischem Personal für<br />
Klärgas- und Biogasanlagen in der<br />
Abwasserbehandlung<br />
26./27.09.2013 Essen<br />
Grundlagen der Gas-Druckregelung<br />
15./16.10.2013 Essen<br />
HDT<br />
SEMINARE<br />
Druckstöße, Dampfschläge und<br />
Pulsationen in Rohrleitungen<br />
18./19.03.2013 Berlin<br />
22./23.04.2013 München<br />
23./24.09.2013 Kochel<br />
Festigkeitsmäßige Auslegung von<br />
Druckbehältern<br />
18./19.03.2013 Essen<br />
02./03.12.2013 Essen<br />
Prüfungen von Druckbehälteranlagen<br />
und Rohrleitungen nach der<br />
Betriebssicherheitsverordnung<br />
15.04.2013 Berlin<br />
Dichtverbindungen an Rohrleitungen<br />
25.09.2013 Berlin<br />
Flanschverbindungen<br />
26.06.2013 Essen<br />
26.09.2013 Berlin<br />
Prüfungen von Druckbehälteranlagen<br />
und Rohrleitungen nach der<br />
Betriebssicherheitsverordnung<br />
15.04.2013 Essen<br />
ASME-Kenntnisse für die Anfrage<br />
zu Druckgeräten, Rohrleitungen mit<br />
Zubehör und Schweißkonstruktionen im<br />
Maschinenbau<br />
03.06.2013 Essen<br />
Schweißen von Rohrleitungen im Energieund<br />
Chemieanlagenbau<br />
05./06.06.2013 Essen<br />
Rohrleitungen nach EN 13480 - Allgemeine<br />
Anforderungen, Werkstoffe, Fertigung und<br />
Prüfung<br />
25.06.2013 München<br />
Sicherheitsventile und Berstscheiben<br />
24.10.2013 Essen<br />
RSV<br />
ZKS-BERATER-LEHRGÄNGE<br />
Blockschulung 2013<br />
Modulare Schulung 2013<br />
Dresden<br />
18.03.-23.03.2013<br />
08.04.-13.04.2013<br />
22.04.-26.04.2013<br />
27.05.-01.06.2013<br />
Feuchtwangen<br />
18.03.-23.03.2013<br />
08.04.-12.04.2013<br />
22.04.-27.04.2013<br />
Kerpen<br />
09.09.-14.09.2013<br />
23.09.-28.09.2013<br />
07.10.-11.10.2013<br />
11.11.-16.11.2013<br />
Hamburg/Kiel<br />
16.09.-21.09.2013<br />
21.10.-26.10.2013<br />
18.11.-22.11.2013<br />
02.12.-07.12.2013<br />
Feuchtwangen<br />
23.09.-28.09.2013<br />
14.10.-19.10.2013<br />
04.11.-08.11.2013<br />
25.11.-30.11.2013<br />
SAG<br />
SEMINARE<br />
Grundlagen der Kanalreinigung in Theorie<br />
und Praxis<br />
22.04.2013 Lauingen<br />
13.05.2013 Lünen<br />
21.05.2013 Darmstadt<br />
23.09.2013 Darmstadt<br />
04.11.2013 Kiel<br />
09.12.2013 Lünen<br />
Fahrzeug- und Gerätetechnik im Bereich<br />
Kanalreinigung<br />
15.05.2013 Lünen<br />
23.05.2013 Darmstadt<br />
25.09.2013 Darmstadt<br />
94 1-2 | 2013
AKTUELLE TERMINE SERVICES<br />
06.11.2013 Kiel<br />
11.12.2013 Lünen<br />
Fachgerechte Reinigung von <strong>Grundstücksentwässerung</strong>sanlagen<br />
in Theorie und Praxis<br />
04.04.2013 Lünen<br />
02.05.2013 Darmstadt<br />
27.05.2013 Kiel<br />
16.12.2013 Lünen<br />
Grundlagen der <strong>Inspektion</strong> von Kanälen<br />
und <strong>Grundstücksentwässerung</strong>sleitungen<br />
in Theorie und Praxis<br />
13.05.2013 Darmstadt<br />
Grundlagen der <strong>Inspektion</strong> von Kanälen<br />
und <strong>Grundstücksentwässerung</strong>sleitungen<br />
in Theorie und Praxis auf Grundlage der<br />
Europäischen Norm DIN EN 13508-2, des<br />
nationalen Regelwerks DWA-M 149, Teil 2<br />
und 5 sowie ISYBAU 2006<br />
22.04.2013 Darmstadt<br />
03.06.2013 Kiel<br />
10.06.2013 Lauingen<br />
01.07.2013 Darmstadt<br />
15.07.2013 Lünen<br />
14.10.2013 Lünen<br />
04.11.2013 Darmstadt<br />
18.11.2013 Kiel<br />
Grundlagen der <strong>Inspektion</strong> von <strong>Grundstücksentwässerung</strong>sleitungen<br />
nach Europäischer<br />
Norm DIN EN 13508-2 und nationalem<br />
Regelwerk DWA-M 149, Teil 2 und 5<br />
03.06.2013 Kiel<br />
03.07.2013 Darmstadt<br />
14.10.2013 Lünen<br />
Bewertung von Schadensbildern,<br />
Zustandsklassifizierung nach DWA-M 149-<br />
3, ISYBAU sowie DIN 1986-30 (02/2012),<br />
Zustandsbewertung nach DWA-M 149-3<br />
(mit Sanierungskennzahlen) und Auswahl<br />
des geeigneten Sanierungsverfahrens<br />
sowie Übersicht von Sanierungsverfahren<br />
im Bereich <strong>Grundstücksentwässerung</strong> (GEA)<br />
08.04.2013 Lauingen<br />
27.05.2013 Darmstadt<br />
07.10.2013 Darmstadt<br />
25.11.2013 Lünen<br />
Grundlagen der Kanalsanierung<br />
privater Abwasserleitungen,<br />
Bewertung von Schadensbildern mit<br />
Zustandsklassifizierung nach DWA-M<br />
149-3, ISYBAU 2006 und DIN 1986-30<br />
(02/2012)<br />
08.04.2013 Lauingen<br />
27.05.2013 Darmstadt<br />
07.10.2013 Darmstadt<br />
25.11.2013 Lünen<br />
<strong>Inspektion</strong> von sanierten Kanälen und<br />
zur Abnahme von Bauleistungen (VOB/<br />
Gewährleistung)<br />
21.05.2013 Lünen<br />
07.08.2013 Kiel<br />
21.08.2013 Darmstadt<br />
Abschlusslehrgang „Zertifizierter<br />
Fachkundiger <strong>Grundstücksentwässerung</strong>“<br />
04.04.2013 Kiel<br />
Sachkundelehrgang Muffendruckprüfung<br />
und Dichtheitsprüfung<br />
von Druckrohrleitungen,<br />
Abwassersammelgruben, Pumpenschächte<br />
und Kleinkläranlagen (Luft/Wasser)<br />
25.04.2013 Lünen<br />
13.06.2013 Darmstadt<br />
10.10.2013 Lünen<br />
Planung und Bau von<br />
<strong>Grundstücksentwässerung</strong>sanlagen<br />
01.07.2013 Lünen<br />
Grundlagen und Anwendung der<br />
Sanierung mittels Berstliningverfahren<br />
17./18.06.2013 Darmstadt<br />
SKZ<br />
SEMINARE<br />
Muffenmontage an<br />
Kunststoffmantelrohren<br />
21./22.03.2013 Halle<br />
TAE<br />
SEMINARE<br />
Messtechnik beim kathodischen<br />
Korrosionsschutz (KKS)<br />
13.-15.05.2013 Ostfildern<br />
TAH<br />
SEMINARE<br />
Zertifizierter Kanalsanierungs-Berater 2013<br />
11.03.-15.06.2013 Hannover<br />
16.-21.09.2013 Heidelberg<br />
14.-19.10.2013 Weimar<br />
TAW<br />
SEMINARE<br />
Verfahrenstechnische Erfahrungsregeln bei<br />
der Auslegung von Apparaten und Anlagen<br />
03./04.06.2013 Wuppertal<br />
Rohrleitungen in verfahrenstechnischen<br />
Anlagen planen und auslegen<br />
16./17.04.2013 Wuppertal<br />
Veranstaltungen zum<br />
Korrosionsschutz<br />
SEMINARE<br />
Prüfung nach DIN EN 15257 A1, A2<br />
erdverlegte Anlagen<br />
21./22.03.2013 Esslingen (angeboten<br />
durch die TAW in Wuppertal)<br />
Zertifikatsprüfung Grad 1, Grad 2 DIN EN<br />
15257 A1, A2 erdverlegte Anlagen<br />
22.03.2013<br />
(angeboten durch die fkks cert gmbh)<br />
Kathodischer Korrosionsschutz<br />
25.04.2013 Aalen<br />
(angeboten durch den DVGW)<br />
Messtechnik beim kathodischen<br />
Korrosionsschutz<br />
13.-15.05.2013 Esslingen<br />
(angeboten von der TAE Technischen Akademie<br />
Esslingen)<br />
ZfW<br />
WORKSHOP<br />
Kathodischer Korrosionsschutz für<br />
Wasserrohrleitungen aus Stahl<br />
16./17.04.2013 Würzburg<br />
SEMINAR<br />
Qualitätsprodukt Kanalsanierung mit<br />
Schlauchlining<br />
28./29.05.2013 Hamburg<br />
1-2 | 2013 95
SERVICES AKTUELLE TERMINE<br />
KONTAKTADRESSEN<br />
BAU-Akademie Nord<br />
Claudia Mack, Tel. 0421/20349-119,<br />
Fax 0421/20349-6119,<br />
E-Mail: Mack@bauindustrie-nord.de,<br />
www.bauakademie-nord.de<br />
brbv<br />
Kurt Rhode, Tel. 0221/37668-44,<br />
Fax 0221/37668-62, E-Mail: rhode@brbv.de,<br />
www.brbv.de<br />
DVGW<br />
Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches<br />
e.V.,<br />
Tel. 0228/9188-607, Fax 0228/9188-997,<br />
E-Mail: splittgerber@dvgw.de, www.dvgw.de<br />
GWI Gas- und Wärmeinstitut Essen e.V.,<br />
Frau B. Hohnhorst, Tel. 0201/3618-143,<br />
Fax 0201/3618-146,<br />
E-Mail: hohnhorst@gwi-essen.de,<br />
www.gwi-essen.de<br />
HdT<br />
Haus der Technik Essen,<br />
Tel. 0201/1803-1,<br />
E-Mail: hdt@hdt-essen.de,<br />
www.hdt-essen.de<br />
SAG-Akademie<br />
Anja Kratt, Tel. 06151/10155-111,<br />
Fax 06151/10155-155,<br />
E-Mail: Kratt@SAG-Akademie.de,<br />
www.SAG-Akademie.de<br />
SKZ<br />
SKZ - ToP gGmbH, Astrid Pratsch,<br />
Tel. 0345/53045-11, Fax 0345/53045-22,<br />
E-Mail: halle@skz.de, www.skz.de<br />
TAE<br />
Technische Akademie Esslingen,<br />
Manfred Schuster, Tel. 0711/3400829,<br />
Fax 0711/3400830,<br />
E-Mail: manfred.schuster@tae.de, www.tae.de<br />
TAH<br />
Technische Akademie Hannover e.V.,<br />
Dr. Igor Borovsky, Tel. 0511/39433-30,<br />
Fax 0511/39433-40,<br />
E-Mail: borovsky@ta-hannover.de,<br />
www.ta-hannover.de<br />
TAW<br />
Technische Akademie Wuppertal e.V.,<br />
Tel. 0202/7495-207, Fax 0202/7495-228,<br />
E-Mail: taw@taw.de, www.taw.de<br />
ZfW<br />
Zentrum für Weiterbildung, Dipl.-Päd. Anke<br />
Lüken, Tel. 0441/361039-20,<br />
Fax 0441/361039-30, E-Mail: anke.lueken@<br />
jade-hs.de, www.jade-hs.de/zfw/<br />
ZKS<br />
RSV - Rohrleitungssanierungsverband e.V.,<br />
Tel.: 05963/9810877, Fax 05963/9810878,<br />
E-Mail: rsv-ev@t-online.de, www.rsv-ev.de<br />
Fachzeitschrift für sichere und<br />
effiziente Rohrleitungssysteme<br />
Ganz RohR<br />
Heute schon Know-how geshoppt?<br />
Der neue Internetauftritt der <strong>3R</strong><br />
www.<strong>3R</strong>-Rohre.de<br />
96 1-2 | 2013
Clever kombiniert und<br />
doppelt clever informiert<br />
Auch als<br />
ePaper<br />
erhältlich!<br />
3r + gwf Wasser/Abwasser im Kombi-Angebot.<br />
Wählen Sie einfach das Bezugsangebot, das Ihnen zusagt: als Heft, ePaper oder Heft + ePaper!<br />
+<br />
<strong>3R</strong> erscheint in der Vulkan-Verlag GmbH, Huyssenallee 52-56, 45128 Essen<br />
gwf Wasser/Abwasser erscheint in der DIV Deutscher Industrieverlag GmbH, Arnulfstr. 124, 80636 München<br />
Wissen für DIe<br />
Zukunft<br />
Vorteilsanforderung per fax: +49 Deutscher 931 Industrieverlag / 4170-494 GmbH | Arnulfstr. oder 124 abtrennen | 80636 München und im fensterumschlag einsenden<br />
Ja, ich möchte clever kombinieren und bestelle für ein Jahr die Fachmagazine <strong>3R</strong> (8 Ausgaben)<br />
und gwf Wasser/Abwasser (11 Ausgaben) im attraktiven Kombi-Bezug.<br />
als Heft für € 556,25 zzgl. Versand (Deutschland: € 54,- / Ausland: € 63,-) pro Jahr.<br />
als ePaper (Einzellizenz) für € 556,25 pro Jahr.<br />
Für Schüler und Studenten (gegen Nachweis) zum Vorzugspreis<br />
als Heft für € 278,13 zzgl. Versand (Deutschland: € 54,- / Ausland: € 63,-) pro Jahr.<br />
als ePaper (Einzellizenz) für € 278,13 pro Jahr.<br />
firma/Institution<br />
Vorname, Name des empfängers<br />
Straße / Postfach, Nr.<br />
Land, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Telefax<br />
Antwort<br />
Leserservice gwf<br />
Postfach 91 61<br />
97091 Würzburg<br />
e-Mail<br />
Branche / Wirtschaftszweig<br />
Bevorzugte Zahlungsweise Bankabbuchung rechnung<br />
Bank, Ort<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B.<br />
Brief, fax, e-Mail) oder durch rücksendung der Sache widerrufen. Die frist beginnt nach erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur<br />
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache an den Leserservice gwf, Postfach<br />
9161, 97091 Würzburg.<br />
Bankleitzahl<br />
Ort, Datum, Unterschrift<br />
Kontonummer<br />
PA3rIN0213<br />
nutzung personenbezogener Daten: für die Auftragsabwicklung und zur Pflege der laufenden Kommunikation werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Mit dieser Anforderung erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich<br />
vom DIV Deutscher Industrieverlag oder vom Vulkan-Verlag per Post, per Telefon, per Telefax, per e-Mail, nicht über interessante, fachspezifische Medien und Informationsangebote informiert und beworben werde.<br />
Diese erklärung kann ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
IMPRESSUM<br />
IMPRESSUM<br />
Verlag<br />
© 1974 Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Postfach 10 39 62, 45039 Essen,<br />
Telefon +49 201-82002-0, Fax -40<br />
Geschäftsführer: Carsten Augsburger, Jürgen Franke<br />
Redaktion<br />
Dipl.-Ing. N. Hülsdau, Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Huyssenallee 52-56, 45128 Essen,<br />
Telefon +49 201-82002-33, Fax +49 201-82002-40,<br />
E-Mail: n.huelsdau@vulkan-verlag.de<br />
Kathrin Lange, Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Telefon +49 201-82002-32, Fax +49 201-82002-40,<br />
E-Mail: k.lange@vulkan-verlag.de<br />
Barbara Pflamm, Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Telefon +49 201-82002-28, Fax +49 201-82002-40,<br />
E-Mail: b.pflamm@vulkan-verlag.de<br />
Anzeigenverkauf<br />
Helga Pelzer, Vulkan-Verlag GmbH,<br />
Telefon +49 201-82002-66, Fax +49 201-82002-40,<br />
E-Mail: h.pelzer@vulkan-verlag.de<br />
Anzeigenverwaltung<br />
Martina Mittermayer,<br />
Vulkan-Verlag/DIV Deutscher Industrieverlag GmbH,<br />
Telefon +49 89-203 53 66-16, Fax +49 89-203 53 66-66,<br />
E-Mail: mittermayer@di-verlag.de<br />
Abonnements/Einzelheftbestellungen<br />
Leserservice <strong>3R</strong> INTERNATIONAL,<br />
Postfach 91 61, 97091 Würzburg,<br />
Telefon +49 931-4170-1616, Fax +49 931-4170-492,<br />
E-Mail: leserservice@vulkan-verlag.de<br />
Layout und Satz<br />
Dipl. Des. Nilofar Mokhtarzada, Vulkan-Verlag GmbH<br />
E-Mail: n.mokhtarzada@vulkan-verlag.de<br />
Druck<br />
Druckerei Chmielorz, Ostring 13,<br />
65205 Wiesbaden-Nordenstadt<br />
Bezugsbedingungen<br />
<strong>3R</strong> erscheint monatlich mit Doppelausgaben im Januar/Februar,<br />
März/April und August/September · Bezugspreise: Abonnement<br />
(Deutschland): € 275,- + € 24,- Versand; Abonnement (Ausland):<br />
€ 275,- + € 28 Versand; Einzelheft (Deutschland): € 39,- + € 3,-<br />
Versand; Einzelheft (Ausland): € 39,- + € 3,50 Versand; Einzelheft<br />
als ePaper (PDF): € 39,-; Studenten: 50 % Ermäßigung auf<br />
den Heftbezugspreis gegen Nachweis · Die Preise enthalten bei<br />
Lieferung in EU-Staaten die Mehrwertsteuer, für alle übrigen<br />
Länder sind es Nettopreise.<br />
Bestellungen sind jederzeit über den Leserservice oder jede<br />
Buchhandlung möglich. Die Kündigungsfrist für Abonnementaufträge<br />
beträgt 8 Wochen zum Bezugsjahresende.<br />
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen<br />
sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb<br />
der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung<br />
des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere<br />
für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen<br />
und die Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen.<br />
Auch die Rechte der Wiedergabe durch Vortrag, Funkund<br />
Fernsehsendung, im Magnettonverfahren oder ähnlichem<br />
Wege bleiben vorbehalten.<br />
Jede im Bereich eines gewerblichen Unternehmens hergestellte<br />
oder benutzte Kopie dient gewerblichen Zwecken gem. § 54 (2)<br />
UrhG und verpflichtet zur Gebührenzahlung an die VG WORT,<br />
Abteilung Wissenschaft, Goethestraße 49, 80336 München, von<br />
der die einzelnen Zahlungsmodalitäten zu erfragen sind.<br />
ISSN 2191-9798<br />
Informationsgemeinschaft zur Feststellung<br />
der Verbreitung von Werbeträgern<br />
Organschaften<br />
Fachbereich Rohrleitungen im Fachverband Dampfkessel-, Behälterund<br />
Rohrleitungsbau e.V. (FDBR), Düsseldorf · Fachverband Kathodischer<br />
Korrosionsschutz e.V., Esslingen · Kunststoffrohrverband e.V.,<br />
Köln · Rohrleitungsbauverband e.V., Köln · Rohrleitungssanierungsverband<br />
e.V., Essen · Verband der Deutschen Hersteller von Gasdruck-Regelgeräten,<br />
Gasmeß- und Gasregelanlagen e.V., Köln<br />
Herausgeber<br />
H. Fastje, EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg (Federführender Herausgeber)<br />
· Dr.-Ing. M. K. Gräf, Vorsitzender der Geschäftsführung<br />
der Europipe GmbH, Mülheim · Dipl.-Ing. R.-H. Klaer, Bayer AG, Krefeld,<br />
Vorsitzender des Fachausschusses „Rohrleitungstechnik“ der VDI-<br />
Gesellschaft Verfahrenstechnik und Chemie-Ingenieurwesen (GVC) ·<br />
Dipl.-Volksw. H. Zech, Geschäftsführer des Rohrleitungssanierungsverbandes<br />
e.V., Lingen (Ems)<br />
Schriftleiter<br />
Dipl.-Ing. M. Buschmann, Rohrleitungsbauverband e.V. (rbv), Köln ·<br />
Rechtsanwalt C. Fürst, Erdgas Münster GmbH, Münster · Dipl.‐Ing.<br />
Th. Grage, Institutsleiter des Fernwärme-Forschungsinstituts, Hemmingen<br />
· Dr.-Ing. A. Hilgenstock, E.ON New Build & Technology<br />
GmbH, Gelsenkirchen (Gastechnologie und Handelsunterstützung) ·<br />
Dipl.-Ing. D. Homann, IKT Institut für Unterirdische Infrastruktur, Gelsenkirchen<br />
· Dipl.‐Ing. N. Hülsdau, Vulkan-Verlag, Essen · Dipl.-Ing.<br />
T. Laier, RWE – Westfalen-Weser-Ems – Netzservice GmbH, Dortmund<br />
· Dipl.-Ing. J. W. Mußmann, FDBR e.V., Düsseldorf · Dr.-Ing. O. Reepmeyer,<br />
Europipe GmbH, Mülheim Dr. H.-C. Sorge, IWW Rheinisch-<br />
Westfälisches Institut für Wasser, Biebesheim · Dr. J. Wüst, SKZ - TeConA<br />
GmbH, Würzburg<br />
Beirat<br />
Dr.-Ing. W. Berger, Direktor des Forschungsinstitutes für Tief-und<br />
Rohrleitungsbau e.V., Weimar · Dr.-Ing. B. Bosseler, Wissenschaftlicher<br />
Leiter des IKT – Institut für Unterirdische Infra struktur, Gelsenkirchen<br />
· Dipl.-Ing. D. Bückemeyer, Vorstand der Stadtwerke Essen AG<br />
· W. Burchard, Geschäftsführer des Fachverbands Armaturen im VD-<br />
MA, Frankfurt · Bauassessor Dipl.‐Ing. K.-H. Flick, Fachverband Steinzeugindustrie<br />
e.V., Köln · Prof. Dr.-Ing. W. Firk, Vorstand des Wasserverbandes<br />
Eifel-Rur, Düren · Dipl.-Wirt. D. Hesselmann, Geschäftsführer<br />
des Rohrleitungsbauverbandes e.V., Köln · Dipl.-Ing. H.-J. Huhn,<br />
BASF AG, Ludwigshafen · Dipl.-Ing. B. Lässer, ILF Beratende Ingenieure<br />
GmbH, München · Dr.-Ing. W. Lindner, Vorstand des Erftverbandes,<br />
Bergheim · Dr. rer. pol. E. Löckenhoff, Geschäftsführer des Kunststoffrohrverbands<br />
e.V., Bonn · Dr.-Ing. R. Maaß, Mitglied des Vorstandes,<br />
FDBR Fachverband Dampfkessel-, Behälter- und Rohrleitungsbau<br />
e.V., Düsseldorf · Dipl.-Ing. R. Middelhauve, TÜV NORD Systems<br />
GmbH & Co. KG, Essen · Dipl.-Ing. R. Moisa, Geschäftsführer der Fachgemeinschaft<br />
Guss-Rohrsysteme e.V., Griesheim · Dipl.‐Berging.<br />
H. W. Richter, GAWACON, Essen · Dipl.-Ing. T. Schamer, Geschäftsführer<br />
der ARKIL INPIPE GmbH, Bottrop · Prof. Dipl.-Ing. Th. Wegener,<br />
Institut für Rohrleitungsbau an der Fachhochschule Oldenburg ·<br />
Prof. Dr.-Ing. B. Wielage, Lehrstuhl für Verbundwerkstoffe, Technische<br />
Universität Chemnitz-Zwickau · Dipl.-Ing. J. Winkels, Technischer<br />
Geschäftsführer der Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH, Siegen<br />
und<br />
sind Unternehmen der