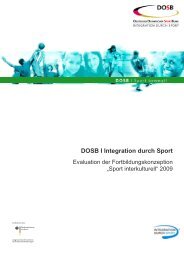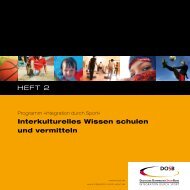Dokumentation Fachtagung Wissen schaf(f)t Teilhabe - Integration ...
Dokumentation Fachtagung Wissen schaf(f)t Teilhabe - Integration ...
Dokumentation Fachtagung Wissen schaf(f)t Teilhabe - Integration ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Grußwort von Herrn Walter Schneeloch,<br />
Präsident des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen und<br />
Vizepräsident des Deutschen Olympischen Sportbundes<br />
Mit der heutigen Tagung<br />
wollen wir uns vor allem mit<br />
der Frage auseinandersetzen,<br />
wie Prozesse der „<strong>Integration</strong><br />
durch Sport“ konzipiert und<br />
ausgestaltet werden können bzw. müssen. In der Verbindung<br />
von fachwissen<strong>schaf</strong>tlichen Erkenntnissen aktueller<br />
Untersuchungen mit praxisbezogenen Erfahrungen<br />
wollen wir mit dieser Veranstaltung im Kern auch eine<br />
strategische Weiterentwicklung des Handlungsfeldes<br />
„<strong>Integration</strong> in und durch den Sport“ beraten und<br />
voranbringen.<br />
Ich freue mich über die große Resonanz auf diese<br />
Tagung und dass es uns gelungen ist, diese Fachveranstaltung<br />
in einer Gemein<strong>schaf</strong>tsaktion von Sportorganisation,<br />
Politik, Stiftungen und <strong>Wissen</strong><strong>schaf</strong>t zu planen<br />
und durchzuführen. Ein ganz besonderer Dank gilt dabei<br />
dem BAMF als Koordinator und Hauptförderer.<br />
Wir alle wissen, dass <strong>Integration</strong> eine permanente<br />
Aufgabe ist. Dabei geht es darum, Prozesse, die zu<br />
einer erfolgreichen <strong>Integration</strong> führen, immer besser zu<br />
verstehen, sie weiter zu entwickeln und sie vor allem<br />
an die sich ständig ändernden Rahmenbedingungen<br />
anzupassen.<br />
Es gibt in Deutschland inzwischen mehr Menschen, die<br />
über 65 Jahre alt sind, als Menschen, die unter 20 Jahre<br />
alt sind. Dieser Trend wird sich von Jahr zu Jahr verstärken.<br />
Von Kindern, die jünger sind als sechs Jahre, haben<br />
38 % eine Zuwanderungsgeschichte, das heißt ihre<br />
Eltern oder Großeltern wurden außerhalb Deutschlands<br />
geboren. In Ballungsräumen an Rhein und Ruhr und in<br />
einigen bevorzugten Zuzugsgebieten beträgt der Anteil<br />
an Menschen mit Zuwanderungsgeschichte über 50<br />
%. Bei den Neugeborenen beträgt der Anteil zum Teil<br />
bereits 60 %. Dies ist die Realität eines Einwanderungslandes!<br />
Diese erfordert eine gezielte und systematische<br />
<strong>Integration</strong>spolitik.<br />
Diese Entwicklung nehmen wir als Sportorganisation zur<br />
Kenntnis und ernst. Wir richten unsere Arbeit entsprechend<br />
aus. Im Kern geht es uns darum, <strong>Integration</strong><br />
auf der Grundlage eines neuen Verständnisses von<br />
Willkommenskultur als zentrale Querschnittsaufgabe<br />
für die weitere Vereinsentwicklung in Deutschland zu<br />
begreifen und zu verankern. Dabei gilt es, die vielfältigen<br />
vorhandenen Stärken und Potenziale der Menschen<br />
mit Zuwanderungsgeschichte zu erkennen, zu fördern<br />
und für die Weiterentwicklung des organisierten Sports<br />
zu nutzen – sei es als aktive Sportlerinnen und Sportler<br />
oder als Führungskräfte in den Sportorganisationen.<br />
Die Debatte um „Interkulturelle Öffnung“ in den Sportorganisationen<br />
wie auch in der Gesell<strong>schaf</strong>t allgemein<br />
ist immer noch stark geprägt von dem Denkansatz des<br />
„wir“ und „die anderen“. Vielmehr muss es künftig<br />
darum gehen, ein „neues gesell<strong>schaf</strong>tliches Wir“ zu<br />
suchen. Mit Blick auf den Vereinssport heißt das, den<br />
Umgang mit sozialer Vielfalt als einen ganzheitlichen<br />
und längerfristigen Lernprozess als Organisation zu<br />
verstehen. Ein „sozialraumbezogener Sportverein“<br />
muss lernen mit Vielfalt umzugehen, muss „sich neu<br />
orientieren“ und mit „größerer Selbstverständlichkeit“<br />
und „weniger Sozialarbeitergestus“ ein „neues Wir“<br />
definieren, statt in das alte „wir und ihr“ zu separieren.<br />
Dieses Verständnis und dieser Prozess brauchen den<br />
gemeinsamen Dialog und das Grundverständnis der<br />
gleichberechtigten <strong>Teilhabe</strong>.<br />
Für den Sport ist dafür jedoch ein nutzenorientierter<br />
Umgang mit Vielfalt von Bedeutung, z.B. für die Entwicklung<br />
von Sportteams oder für neue Impulse und<br />
Ansätze in der Führung des Sports. Letztendlich geht<br />
es auch um die Sicherung der Zukunftsfähigkeit des<br />
Sportvereines. Die interkulturelle Öffnung im Sport muss<br />
daher sowohl bei den Strukturen in Verbänden und Vereinen<br />
als auch bei den zentralen Akteuren ansetzen.<br />
Dabei geht es einerseits z. B. um die Verankerung des<br />
Themas in den entsprechenden Leitbildern, in den<br />
Aus- und Fortbildungen und um die Kooperation und<br />
12 l Grußworte