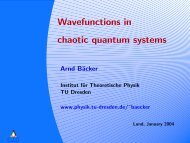Heft 30 - Technische Universität Dresden
Heft 30 - Technische Universität Dresden
Heft 30 - Technische Universität Dresden
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
GRUNDLAGEN DER<br />
EINKRISTALLSTRUKTURBESTIMMUNG<br />
3. Intensivkurs des AK Chemische Kristallographie der GDCh-Fachgruppe Analytische<br />
Chemie und des AK Molekülverbindungen der DGK vom 13. bis 17. September 2004 im<br />
Zistersienserkloster Hardehausen<br />
Mittlerweile bereits zum dritten Mal fand der Intensivkurs – Grundlagen der Einkristallstrukturbestimmung<br />
in der Zeit vom 13. bis 17. September 2004 statt. Im Jahre 2000 erstmals veranstaltet,<br />
wendet sich der - in Form einer Sommerschule abgehaltene - Intensivkurs vor allem<br />
an den wissenschaftlichen Nachwuchs, um in Zeiten zunehmender „black-box-Automatisierung“<br />
der Einkristallstrukturanalyse essentielle Grundlagen zu vermitteln.<br />
Das wissenschaftliche Programm umfasst alle Abschnitte einer Kristallstrukturanalyse, beginnend<br />
bei der Messung bis hin zur Interpretation der Daten. Diese Inhalte wurden in bewährter<br />
Weise durch einzelne Vorträge erläutert, immer wieder unterbrochen von längeren Übungen<br />
in kleinen Gruppen, in denen das eben Erlernte vertieft wurde. Bewusst wurde dabei auf den<br />
Einsatz von Computern verzichtet, sondern mit Papier und Bleistift gearbeitet. Dennoch geht<br />
auch dieser Intensivkurs mit der Zeit. Wurde noch vor vier Jahren bedarfsgemäß ausführlich<br />
auf die Besonderheiten der Datensammlung und der anschließenden Datenreduktion mit konventionellen<br />
Punktzählerdiffraktometern eingegangen, ergab eine ad-hoc Umfrage unter den<br />
33 Teilnehmern, dass diese ausschließlich moderne Flächenzählerdiffraktometer im Einsatz<br />
haben. Entsprechend hat sich auch der Schwerpunkt bei der Messung von Einkristalldaten und<br />
insbesondere der anschließenden Auswertung verlagert.<br />
Von besonderer Bedeutung für das Verständnis der kristallographischen Grundlagen ist die<br />
Symmetrielehre. Nach den Erfahrungen der Vorjahre wurde diesem Teil noch größeres Gewicht<br />
beigemessen. Unter anderem auch durch eine Einführung zur Symmetrie von Punktgruppen,<br />
in lockerer Atmosphäre am ersten Abend. Darüber hinaus erscheint es aber angebracht,<br />
auf eine intensivere Beschäftigung mit Symmetrie im Chemiestudium, vor allem hinsichtlich<br />
der Symmetrie im Festkörper, hinzuwirken. Im weiteren Verlauf des Programms<br />
konnte die Funktionsweise der Fouriertransformation am eindimensionalen Beispiel anschaulich<br />
nachvollzogen werden und wurde anschließend in Form zweidimensionaler Projektionen<br />
an einer realen Kristallstrukur demonstriert. Hierbei konnte die Bedeutung der Auflösung und<br />
der Einfluß starker Beugungsintensitäten gezeigt werden. Die Lösung des zentralen Problems<br />
der Kristallstrukturanalyse, die Phasenbestimmung, wurde getrennt für die Patterson und die<br />
Direkten Methoden diskutiert. An zahlreichen Beispielen konnte die korrekte Interpretation<br />
der Pattersonfunktion geübt werden, einschließlich einiger „Kopfnüsse“, wie der simultanen<br />
Bestimmung von zwei Schweratomlagen. Wenig Begeisterung lässt sich im allgemeinen für<br />
die komplexe Mathematik der direkten Methoden erzielen. Trotzdem bietet die längst als<br />
historisch einzustufende symbolische Addition eine Methode, auf deren Basis auch mit Papier<br />
und Bleistift eine direkte Phasenbestimmung möglich ist und die statistische Abhängigkeit<br />
von Amplitude und Phase der Strukturfaktoren begreifbar wird.<br />
Einer kurzen Einführung in die Grundlagen der least-squares-Verfeinerung folgte eine ausführliche<br />
Behandlung der typischen Programm Ein- und Ausgabe unter besonderer Berücksichtigung<br />
von a priori Randbedingungen (Constraints und Restraints), dem Problem von<br />
Fehlordnung sowie der speziellen Behandlung der Wasserstoffatome. Ergänzt wurde dieser<br />
Teil des Kurses von einer Betrachtung der häufigsten Zwillingsprobleme, die zunehmend an<br />
Bedeutung gewinnen.<br />
32