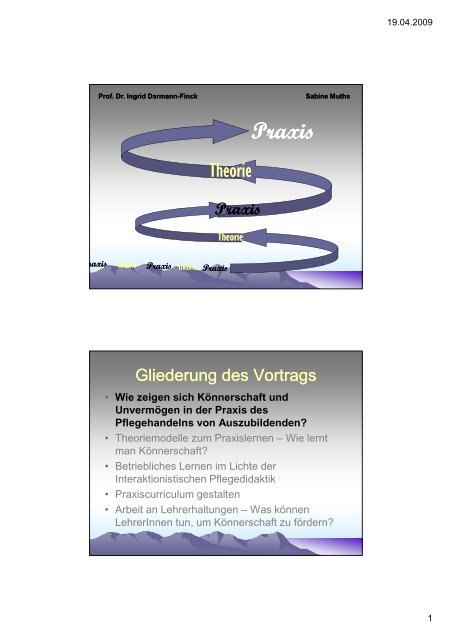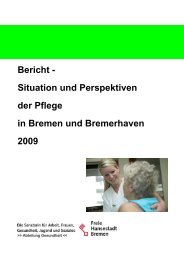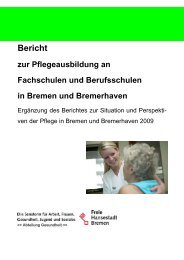Praxis-Theorie-Praxis-Transfer - Universität Bremen
Praxis-Theorie-Praxis-Transfer - Universität Bremen
Praxis-Theorie-Praxis-Transfer - Universität Bremen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
19.04.2009<br />
Prof. Dr. Ingrid Darmann-Finck<br />
Sabine Muths<br />
<strong>Praxis</strong><br />
<strong>Theorie</strong><br />
<strong>Praxis</strong><br />
<strong>Theorie</strong><br />
<strong>Praxis</strong><br />
<strong>Theorie</strong><br />
<strong>Praxis</strong><br />
<strong>Theorie</strong><br />
<strong>Praxis</strong><br />
Gliederung des Vortrags<br />
• Wie zeigen sich Könnerschaft und<br />
Unvermögen in der <strong>Praxis</strong> des<br />
Pflegehandelns von Auszubildenden?<br />
• <strong>Theorie</strong>modelle zum <strong>Praxis</strong>lernen – Wie lernt<br />
man Könnerschaft?<br />
• Betriebliches Lernen im Lichte der<br />
Interaktionistischen Pflegedidaktik<br />
• <strong>Praxis</strong>curriculum gestalten<br />
• Arbeit an Lehrerhaltungen – Was können<br />
LehrerInnen tun, um Könnerschaft zu fördern?<br />
1
19.04.2009<br />
Könnerschaft und Unvermögen<br />
Bitte lesen Sie die beiden Fallsituationen zu<br />
<strong>Praxis</strong>begleitungen in der Pflegeausbildung<br />
und überlegen Sie dabei:<br />
– an welchen Stellen zeigt die Schülerin jeweils<br />
ihre Könnerschaft im Pflegehandeln<br />
– an welchen Stellen ist eher Unvermögen<br />
dokumentiert<br />
FALLSITUATIONEN ZUR<br />
PRAXISBEGLEITUNG IN DER<br />
ALTENPFLEGEAUSBILDUNG<br />
Im Folgenden sind zwei Beobachtungen zur praktischen<br />
Ausbildung in Einrichtungen der Altenpflege, durchgeführt von<br />
Lehrkräften einer Berufsbildenden Schule, dokumentiert. Die<br />
Auszüge sind Teil einer Studienarbeit von Anne Marach zum<br />
Berufspädagogischen Praktikum im Wintersemester 2008/09 an<br />
der Universität <strong>Bremen</strong>.<br />
2
19.04.2009<br />
Anleitungssituation A<br />
„Die Schülerin aus dem zweiten Ausbildungsjahr war sichtlich nervös. Während<br />
der Vorstellung der von ihr erarbeiteten Bewohner-Biographie und der Pflegeplanung<br />
erlitt sie einen „Blackout“ und konnte sich kaum noch an ihr selbst Geschriebenes<br />
erinnern, woraufhin sie anfing zu weinen. Der Lehrer beruhigte sie,<br />
in dem er die Vorbesprechung abbrach und sie aufforderte, uns die Pflegeplanung<br />
anhand der Durchführung der Grundpflege zu verdeutlichen. Daraufhin<br />
entspannte sich die Schülerin ein Wenig. Sie ordnete ihr vorbereitetes Material<br />
zur Grundpflege und betrat mit uns das Zimmer des Bewohners. Sie begrüßte<br />
ihn und wir stellten uns ebenfalls vor. Der Bewohner, der unter Morbus Parkinson<br />
leidet, benötigte Unterstützung bei der Grund-pflege am Waschbecken,<br />
beim Kleidungswechsel und bei der Mobilisation in den Rollstuhl. Im Bereich<br />
Kommunikation traten Schwierigkeiten insofern auf, dass der Bewohner aufgrund<br />
einer durch die Erkrankung sehr verwaschenen Sprache nur noch sehr<br />
wenig verbal kommuniziert. Die Schülerin mobilisierte den Bewohner in den<br />
Rollstuhl, wobei sie nicht verbal mit ihm kommunizierte, sondern offensichtlich<br />
eine für den Bewohner und das Pflegepersonal routinierte Mobilisationsbewegung<br />
vollführte. Die Grundpflege vollzog sich ebenfalls sehr routiniert und ohne<br />
wirkliche Kommunikation (- nur kurze Aufforderungen an den Bewohner). Dabei<br />
zeigten sich deutliche Hygienefehler. Der Lehrer intervenierte nur, indem er versuchte,<br />
ein Gespräch mit dem Bewohner über dessen frühere berufliche Tätigkeit aufzubauen.<br />
Nach der Körperpflege wurde der Bewohner beim Ankleiden unterstützt und von der Auszubildenden<br />
dazu angeregt, sich selbst zu rasieren. Als er dies verweigerte, führte sie die<br />
Rasur selbst durch. Dabei legte sie ihm kein Handtuch vor, so dass nachher der ganze<br />
Pullover voller Bartstoppeln war, die auch nicht entfernt wurden, als der Bewohner das<br />
Zimmer verließ. Zum Ende der Anleitung sammelte die Schülerin ihr Material ein und verabschiedete<br />
sich vom Bewohner.<br />
Im anschließenden Reflexionsgespräch sollte die Auszubildende zuerst eine Selbsteinschätzung<br />
der Situation geben. Da ihr dies frei nicht gelang, orientierte sie sich am<br />
Bewertungsbogen. Der Lehrer fragte nach, ob sie direkt zu jedem einzelnen Punkt von<br />
ihm eine Stellungnahme möchte, oder ob sie zuerst die Punkte alleine durchgehen wolle.<br />
Die Schülerin gab zurück, dass sie gerne eine direkte Stellungnahme nach jedem einzelnen<br />
Unterpunkt hätte. So gingen sie gemeinsam den Bogen durch und besprachen<br />
schließlich die Benotung der gezeigten Leistung. Dabei wurden vom Lehrer immer zuerst<br />
ein positiver und dann ein negativer Aspekt angesprochen. Der Lehrer betonte noch einmal,<br />
dass sie gezielter an ihrer Pflegeplanung arbeiten sollte und bot ihr an, auch außerhalb<br />
der vorgegebenen Termine Pflegeplanungen bei ihm einzureichen. Die Auszubildende<br />
wirkte jetzt sichtlich entspannter und versicherte der Lehrkraft, dass sie dies tun werde<br />
und sich bemühen wolle, die angesprochenen Kritikpunkte auszubessern.“<br />
3
19.04.2009<br />
Anleitungssituation B<br />
„Die Anleitungssituation fand in einer Kurzzeitpflege-Einrichtung statt, die zusätzlich über<br />
drei Hospiz-Zimmer verfügt. Vor der offiziellen Vorbesprechung wurde zunächst geklärt,<br />
ob sich der von der Schülerin (zweites Ausbildungsjahr) ausgewählte Bewohner noch für<br />
die Anleitungssituation eignet. Sein Zustand hatte sich über Nacht so stark verschlechtert,<br />
dass er als präfinal eingestuft und in eines der Hospiz- Zimmer verlegt worden war.<br />
Es wurde gemeinsam besprochen, ob die Auszubildende sich zutraut, den Herrn zu versorgen<br />
oder ob sie lieber einen anderen Bewohner versorgen wolle und die Vorbesprechung<br />
und die Abgabe der Biographie und Pflegeplanung später nachholen. Die Auszubildende<br />
meinte, da sie schon eine Beziehung zu dem Bewohner entwickelt habe, würde<br />
sie ihn trotz der erschwerten Bedingungen gerne versorgen. In der folgenden offiziellen<br />
Vorbesprechung änderte sie ihre Pflegeplanung dann mündlich soweit ab, dass sie zum<br />
aktuellen Zustand des Bewohners passte. Die Schülerin zeigte sich dabei sehr gut vorbereitet<br />
und gleichzeitig flexibel im Bezug auf die Situationsänderung. Wie mir im Nachhinein<br />
durch die Schülerin mitgeteilt wurde, ist der Bewohner in der folgenden Nacht verstorben.<br />
Die Pflegehandlung an sich führte sie sehr ruhig und mit viel Empathie für den Bewohner<br />
und seinen Zustand durch. Dabei nahm sie wenig Rücksicht auf bestehende Routinen,<br />
sondern nahm sich viel Zeit, um in Ruhe und unter Beachtung der non-verbalen Kommunikation<br />
des Bewohners auf diesen individuell einzugehen. Die Lehrkraft zeigte sich in<br />
der Situation unterstützend, griff aktiv in die Ganzkörperwaschung und Lagerung mit ein.<br />
Er gab der Schülerin immer wieder Unterstützung im Bereich Mobilisation und basaler<br />
Stimulation, die sie auch direkt umsetzte. Während dieser Anleitung versuchte die Auszubildende<br />
ihr individuelles, flexibles Handeln vor der Lehrkraft zu rechtfertigen, indem sie<br />
sagte, sie würde im Interesse des Bewohners von den gängigen Grundpflege- Standards<br />
abweichen.<br />
Im Reflexionsgespräch wurde dann zuerst seitens der Lehrkraft nachgefragt, wie die<br />
Schülerin mit der Situation zurechtgekommen sei und wie es ihr gehen würde. Anschließend<br />
sollte die Schülerin wieder eine Selbstreflexion der Situation abgeben, die von der<br />
Lehrkraft im Anschluss durch viel positive und wenig negative Kritik ergänzt wurde. Der<br />
Reflexionsbogen wurde der Reihe nach ausgefüllt und die Note besprochen.“<br />
4
19.04.2009<br />
Situation B: Könnerschaft<br />
zeigt sich hier durch<br />
• Stabile Beziehung zum<br />
Bewohner<br />
• Bereitschaft, Verantwortung zu<br />
übernehmen<br />
• Fähigkeit, geplante Pflege<br />
situativ flexibel anzupassen<br />
• Hoher Informationsstand bzgl.<br />
der individuellen Situation des<br />
Bewohners<br />
• ruhige, gelassene und sichere<br />
Handlungsdurchführung<br />
• Eingehen auf nonverbale<br />
Signale der Kommunikation<br />
• empathische Kontaktaufnahme<br />
• Annehmen von Unterstützung<br />
Situation A: Unvermögen<br />
zeigt sich hier durch<br />
• Informationen zum Bewohner<br />
können nicht formuliert werden<br />
• keine Kontaktaufnahme durch<br />
Kommunikation - nur kurze<br />
Aufforderungen , um<br />
Bewohnerhandeln an eigene<br />
Handlungen anzupassen<br />
• Abarbeiten von<br />
Routinehandlungen<br />
• deutliche Hygienefehler<br />
• Handlungen werden nicht an<br />
die krankheitsbedingten<br />
Einschränkungen angepasst<br />
• Selbsteinschätzung gelingt<br />
nicht<br />
Gliederung des Vortrags<br />
• Wie zeigen sich Könnerschaft und Unvermögen<br />
in der <strong>Praxis</strong> des Pflegehandelns von<br />
Auszubildenden?<br />
• <strong>Theorie</strong>modelle zum <strong>Praxis</strong>lernen – Wie lernt<br />
man Könnerschaft?<br />
• Betriebliches Lernen im Lichte der<br />
Interaktionistischen Pflegedidaktik<br />
• <strong>Praxis</strong>curriculum gestalten<br />
• Arbeit an Lehrerhaltungen – Was können<br />
LehrerInnen tun, um Könnerschaft zu fördern?<br />
5
19.04.2009<br />
Positionen<br />
<strong>Praxis</strong> bildet theoretisches Wissen ab –<br />
<strong>Praxis</strong> folgt den theoretischen Denkmodellen;<br />
oder<br />
<strong>Theorie</strong> und <strong>Praxis</strong> sind zwei<br />
verschiedene Formen des Denkens -<br />
sie nähern sich demselben<br />
Phänomen von verschiedenen Seiten<br />
– gehen nicht ineinander auf;<br />
Position 1:<br />
Modell<br />
technischer<br />
Rationalität<br />
6
19.04.2009<br />
<strong>Theorie</strong> – <strong>Praxis</strong> -<strong>Transfer</strong><br />
• <strong>Praxis</strong> ist Anwendung wissenschaftlicher <strong>Theorie</strong>n /<br />
wissenschaftlich entwickelter Technologien<br />
• Standards definieren den Lösungsweg –<br />
Handlungsregeln lassen sich ableiten<br />
----------------------------<br />
• Ziele, Standards, Lösungswege sind explizit über<br />
<strong>Theorie</strong> rational vermittelbar Lernort Schule<br />
• Die Umsetzung der theoretisch gelernten<br />
Lösungswege erfolgt im Anschluss Lernort <strong>Praxis</strong><br />
Position 2:<br />
Könnerschaft und<br />
professionalisiertes<br />
Handeln<br />
7
19.04.2009<br />
Position 2:<br />
Experten werden – Qualifizierung nach<br />
dem Stufen-Modell von P. Benner<br />
Lernen durch implizite und explizite<br />
Integration (M. Polanyi; G. Neuweg)<br />
Professionalisierung und<br />
Hermeneutisches Fallverstehen<br />
(U. Oevermann)<br />
Lernen durch<br />
implizite und<br />
explizite<br />
Integration<br />
(G. Neuweg / M. Polanyi)<br />
<strong>Theorie</strong><br />
8
19.04.2009<br />
Wissensformen<br />
• Explizites Wissen (Inhalte, <strong>Theorie</strong>n,<br />
Konzepte) – kann bewusst verbalisiert<br />
werden.<br />
• Implizites Wissen – in Handeln<br />
eingebrachtes Wissen / Fähigkeiten –<br />
kann auch unbewusst sein.<br />
Menschliches Denken und<br />
Bewusstsein<br />
• ist keine computer-analoge Informationsverarbeitung<br />
• sondern eher ganzheitlich, dynamisch, prozesshaft<br />
Unterscheidung:<br />
Bewusste Denktätigkeit<br />
Fokalbewusstsein – konzentriert z.B. auf<br />
Handlungsschritte oder Lösungswege<br />
denkendes Handeln - auch unbewusst möglich<br />
Hintergrundbewusstsein<br />
9
19.04.2009<br />
Handeln<br />
• Handeln erfolgt (wie Wahrnehmen)<br />
ganzheitlich;<br />
• Planvoll handeln = zielgerichtet handeln,<br />
nicht einen Plan schrittweise abarbeiten<br />
erfolgreiche, gelungene Handlungen<br />
Aufmerksamkeit (Fokalbewusstsein) ist auf das<br />
Ziel in der Außenwelt gerichtet (distaler Term) –<br />
implizites Wissen ist im Hintergrund aktiv<br />
Handlungsbrüche:<br />
Handlungsbrüche:<br />
Erklärung von Handlungsfolgen, d.h. Handlungen in<br />
einzelne Schritte zerlegen dadurch verändern<br />
sich Handlungen; (Tausendfüßlersyndrom)<br />
Aufmerksamkeit (Fokalbewusstsein) richtet sich<br />
auf sich selbst (proximaler Term), verliert das Ziel<br />
(distalen Term) aus den Augen (dieses rückt ins<br />
Hintergrundbewusstsein)<br />
10
19.04.2009<br />
Aufbau impliziten Wissens<br />
Prozess der impliziten Integration<br />
• Erfahrungen aus Handlungen, auf die ich meine<br />
Aufmerksamkeit gerichtet habe, werden als<br />
Ganzheit integriert und (ggf.) abgespeichert.<br />
Sie stehen dann als implizites Wissen zur<br />
Verfügung.<br />
• Integration kann nicht bewusst erzeugt werden –<br />
sie widerfährt dem Subjekt.<br />
• Integration kann als sehr anstrengend<br />
empfunden werden.<br />
Der Prozess der impliziten<br />
Integration<br />
Z. B. Vorwissen, Vorerfahrungen,<br />
Vorurteile,<br />
Halbwissen, Sinneswahrnehmungen<br />
Implizites<br />
Integrieren<br />
Gestalthaftes<br />
Urteil<br />
11
19.04.2009<br />
Bedingungen für Lernen<br />
Implizites Lernen<br />
• ist eher passiv;<br />
• kann nur in einer entspannten<br />
Lernatmosphäre erfolgen – sonst kommt<br />
es zur einer zu starken Fokussierung auf<br />
sich selbst.<br />
• setzt eine vertrauensvolle Beziehung und<br />
gegenseitige Einfühlung voraus.<br />
Lernen<br />
– im Sinne von<br />
Professionalisierung<br />
und Hermeneutischem<br />
Fallverstehen<br />
(U. Oevermann)<br />
<strong>Theorie</strong><br />
12
19.04.2009<br />
Professionelles Handeln<br />
• Kompetentes Handeln:<br />
eine begründete fallbezogene Auswahl aus den<br />
vorhandenen Standardlösung treffen;<br />
• Professionelles Handeln:<br />
in deutungsoffenen (krisenhaften) Situationen<br />
eine Entscheidung treffen, diese in einem<br />
anschließenden Reflexionsprozess auf einer<br />
fundierten Wissensbasis reflektieren und so die<br />
Verantwortung für Handeln übernehmen.<br />
Hermeneutisches Fallverstehen<br />
• Erst durch die reflexive<br />
Auseinandersetzung mit implizitem<br />
Handeln vor dem Hintergrund expliziten<br />
Wissens wird professionelles Handeln als<br />
autonome <strong>Praxis</strong> möglich.<br />
13
19.04.2009<br />
Situation B: Könnerschaft<br />
zeigt sich hier durch<br />
• Stabile Beziehung zum<br />
Bewohner<br />
• Bereitschaft, Verantwortung zu<br />
übernehmen<br />
• Fähigkeit, geplante Pflege<br />
situativ flexibel anzupassen<br />
• Hoher Informationsstand bzgl.<br />
der individuellen Situation des<br />
Bewohners<br />
• ruhige, gelassene und sichere<br />
Handlungsdurchführung<br />
• Eingehen auf nonverbale<br />
Signale der Kommunikation<br />
• empathische Kontaktaufnahme<br />
• Annehmen von Unterstützung<br />
Situation A: Unvermögen<br />
zeigt sich hier durch<br />
• Informationen zum Bewohner<br />
können nicht formuliert werden<br />
• keine Kontaktaufnahme durch<br />
Kommunikation - nur kurze<br />
Aufforderungen , um<br />
Bewohnerhandeln an eigene<br />
Handlungen anzupassen<br />
• Abarbeiten von<br />
Routinehandlungen<br />
• deutliche Hygienefehler<br />
• Handlungen werden nicht an<br />
die krankheitsbedingten<br />
Einschränkungen angepasst<br />
• Selbsteinschätzung gelingt<br />
nicht<br />
Gliederung des Vortrags<br />
• Wie zeigen sich Könnerschaft und Unvermögen<br />
in der <strong>Praxis</strong> des Pflegehandelns von<br />
Auszubildenden?<br />
• <strong>Theorie</strong>modelle zum <strong>Praxis</strong>lernen – Wie lernt<br />
man Könnerschaft?<br />
• Betriebliches Lernen im Lichte der<br />
Interaktionistischen Pflegedidaktik<br />
• <strong>Praxis</strong>curriculum gestalten<br />
• Arbeit an Lehrerhaltungen – Was können<br />
LehrerInnen tun um Könnerschaft zu fördern?<br />
14
19.04.2009<br />
Ausbildungsbedingungen<br />
Bitte „überfliegen“ Sie die beiden<br />
Fallsituationen zu <strong>Praxis</strong>begleitungen<br />
nochmals und überlegen Sie:<br />
– Wie müssten Ausbildungsbedingungen im<br />
<strong>Praxis</strong>feld gestaltet werden, um Könnerschaft<br />
der Lernenden zu fördern?<br />
Pflegedidaktische Heuristik (Darmann 2005)<br />
Technisches<br />
Erkenntnisinteresse<br />
Pflegende<br />
Erklären von und<br />
instrumentelle<br />
Problemlösung für<br />
die<br />
Probleme/“Krisen“<br />
der Pflegenden<br />
Patienten/<br />
Angehörige<br />
Erklären und<br />
instrumentelle<br />
Problemlösung für<br />
die (Selbst-) Pflegeprobleme<br />
des Patienten<br />
(und die<br />
Fremdpflegeprobleme<br />
d. Angehörigen)<br />
Institution/ Gesundheitssystem<br />
Erklären und<br />
instrumentelle<br />
Problemlösung für<br />
die Probleme der<br />
Institution und des<br />
Systems<br />
Pflegerisches<br />
Handeln<br />
Erklären und Ableiten<br />
von instrumentellen<br />
Lösungen im Hinblick<br />
auf die Unterstützung<br />
des Patienten (d.<br />
Angehörigen) bei der<br />
Lösung seines<br />
Problems<br />
Verstehen der und<br />
Verständigung über<br />
die Interessen und<br />
Motive der Institution<br />
/ des Gesundheitswesens<br />
Praktisches<br />
Erkenntnisinteresse<br />
Verstehen der<br />
und<br />
Verständigung<br />
über die eigenen<br />
Interessen und<br />
Motive<br />
Verstehen der<br />
und<br />
Verständigung<br />
über die Motive<br />
und Werte des<br />
Patienten<br />
Fallverstehen,<br />
Urteilsbildung<br />
und<br />
Verständigung im<br />
konkreten Fall<br />
Emanzi<br />
patorisches<br />
Erkenntnisinteresse<br />
Aufdecken von<br />
gesellschaftlic<br />
h geprägten<br />
inneren<br />
Widersprüchen<br />
Aufdecken von<br />
gesellschaftlich<br />
geprägten<br />
inneren<br />
Widersprüchen<br />
Aufdecken von<br />
gesellschaftlich<br />
geprägten<br />
institutionellen<br />
Widersprüchen<br />
Aufdecken von<br />
widersprüchlichen<br />
Strukturgesetzlichkeiten<br />
der<br />
pflegerischen<br />
Beziehung<br />
15
19.04.2009<br />
Pflegedidaktische Heuristik (Darmann 2005)<br />
Technisches<br />
Erkenntnisinteresse<br />
Pflegende<br />
Erklären von und<br />
instrumentelle<br />
Problemlösung für<br />
die<br />
Probleme/“Krisen“<br />
der Pflegenden<br />
Patienten/<br />
Angehörige<br />
Erklären und<br />
instrumentelle<br />
Problemlösung für<br />
die (Selbst-) Pflegeprobleme<br />
des Patienten<br />
(und die<br />
Fremdpflegeprobleme<br />
d. Angehörigen)<br />
Institution/ Gesundheitssystem<br />
Erklären und<br />
instrumentelle<br />
Problemlösung für<br />
die Probleme der<br />
Institution und des<br />
Systems<br />
Pflegerisches<br />
Handeln<br />
Erklären und Ableiten<br />
von instrumentellen<br />
Lösungen im Hinblick<br />
auf die Unterstützung<br />
des Patienten (d.<br />
Angehörigen) bei der<br />
Lösung seines<br />
Problems<br />
Verstehen der und<br />
Verständigung über<br />
die Interessen und<br />
Motive der Institution<br />
/ des Gesundheitswesens<br />
Praktisches<br />
Erkenntnisinteresse<br />
Verstehen der<br />
und<br />
Verständigung<br />
über die eigenen<br />
Interessen und<br />
Motive<br />
Verstehen der<br />
und<br />
Verständigung<br />
über die Motive<br />
und Werte des<br />
Patienten<br />
Fallverstehen,<br />
Urteilsbildung<br />
und<br />
Verständigung im<br />
konkreten Fall<br />
Emanzi<br />
patorisches<br />
Erkenntnisinteresse<br />
Aufdecken von<br />
gesellschaftlic<br />
h geprägten<br />
inneren<br />
Widersprüchen<br />
Aufdecken von<br />
gesellschaftlich<br />
geprägten<br />
inneren<br />
Widersprüchen<br />
Aufdecken von<br />
gesellschaftlich<br />
geprägten<br />
institutionellen<br />
Widersprüchen<br />
Aufdecken von<br />
widersprüchlichen<br />
Strukturgesetzlichkeiten<br />
der<br />
pflegerischen<br />
Beziehung<br />
Handlungskompetenz im Spiegel der<br />
pflegedidaktischen Heuristik<br />
Technisches<br />
Erkenntnisinteresse<br />
Ziele, die sich auf die Entwicklung von Fähigkeiten und<br />
Fertigkeiten instrumentellen Handelns beziehen – auf<br />
begründetes, explizierbares Regelhandeln<br />
⇒regelgeleitetes Handeln<br />
Praktisches<br />
Erkenntnisinteresse<br />
Emanzipatorisches<br />
Erkenntnisinteresse<br />
Ziele, die sich auf das Finden von angemessenen<br />
Handlungsoptionen in komplexen und einzigartigen<br />
Pflegesituationen beziehen<br />
⇒Situatives Handeln (Könnerschaft)<br />
Ziele, die sich darauf beziehen, dass Handlungsspielräume vor<br />
dem Hintergrund der vorhandenen gesellschaftlichen Machtund<br />
Abhängigkeitsverhältnisse so genutzt werden, dass<br />
letztere eher abgeschwächt werden<br />
⇒verantwortliches Handeln<br />
16
19.04.2009<br />
Lernen im Wechselspiel<br />
von Aktion und Reflexion<br />
Pflegepraxis<br />
Aktion<br />
Schule &<br />
Pflegepraxis<br />
Reflexion<br />
Lernen im Wechselspiel<br />
von Aktion und Reflexion<br />
Pflegepraxis<br />
Aktion<br />
Schule, Skillslab<br />
Schule &<br />
Pflegepraxis<br />
Reflexion<br />
17
19.04.2009<br />
Berufliche Handlungskompetenz im<br />
Spiegel der pflegedidaktischen Heuristik<br />
Pflegerisches<br />
Handeln (Aktion)<br />
Reflexion<br />
Technisches<br />
Erkenntnisinteresse<br />
Praktisches<br />
Erkenntnisinteresse<br />
Emanzipatorisches<br />
Erkenntnisinteresse<br />
Regelgeleitetes<br />
Handeln<br />
Situatives Handeln<br />
(Könnerschaft)<br />
Verantwortliches<br />
Handeln<br />
Reflexion anhand von<br />
Regeln<br />
Reflexion hinsichtlich<br />
der Angemessenheit<br />
im Lichte des Falls<br />
Reflexion hinsichtlich<br />
gesellschaftlicher<br />
Widersprüche<br />
Gliederung des Vortrags<br />
• Wie zeigen sich Könnerschaft und Unvermögen<br />
in der <strong>Praxis</strong> des Pflegehandelns von<br />
Auszubildenden?<br />
• <strong>Theorie</strong>modelle zum <strong>Praxis</strong>lernen – Wie lernt<br />
man Könnerschaft?<br />
• Betriebliches Lernen im Lichte der<br />
Interaktionistischen Pflegedidaktik<br />
• <strong>Praxis</strong>curriculum gestalten<br />
• Arbeit an Lehrerhaltungen – Was können<br />
LehrerInnen tun, um Könnerschaft zu fördern?<br />
18
19.04.2009<br />
Arten von Pflegehandlungen<br />
Systemisch lassen sich 3 Arten von<br />
Pflegehandlungen unterscheiden:<br />
• Einfache Pfelgehandlungen – basieren auf linearen<br />
„Ursache-Wirkungs“-Schemata; das Ergebnis ist<br />
vorhersagbar.<br />
• Komplizierte Pflegehandlungen – das Zusammenwirken<br />
verschiedener Faktoren muss entworfen und berechnet<br />
werden; das Ergebnis bleibt vorhersagbar.<br />
• Komplexe Pflegehandlungen – basieren auf nicht linearer<br />
Dynamik, können nicht entworfen und berechnet werden;<br />
das Ergebnis ist deshalb nur in engen Grenzen (bis gar<br />
nicht) vorhersagbar und damit planbar.<br />
Arten von Pflegehandlungen<br />
und pflegerische Kompetenzen<br />
Einfache<br />
Handlungen<br />
Komplizierte<br />
Handlungen<br />
Komplexe<br />
Handlungen<br />
Komplexe<br />
Handlungen<br />
Regelgeleitetes Handeln:<br />
Handlings (techn. Erkenntnisinteresse)<br />
Regelgeleitetes Handeln: Skills<br />
und Kombination mehrerer Skills<br />
(techn. Erkenntnisinteresse)<br />
Situatives Pflegehandeln<br />
(prakt. Erkenntnisinteresse)<br />
Verantwortliches Pflegehandeln<br />
(emanzipatorisches Erkenntnisinteresse)<br />
19
19.04.2009<br />
Handlings<br />
• sind linear planbar,<br />
• weisen klar strukturierte Abläufe auf,<br />
• basieren auf psychomotorischem Lernen,<br />
• Körperbewusstsein und die Beherrschung der eigenen<br />
Motorik spielen eine zentrale Rolle,<br />
• Handlings sind z. B. Verbände anlegen,<br />
Antithrombosestrümpfe anziehen, Injektionen geben,<br />
Patienten <strong>Transfer</strong>, Mobilisation von Patienten,<br />
• Bearbeitung erfolgt regelgeleitet,<br />
• Handlings können anhand von vorab festgelegten<br />
Handlungsregeln und Kriterien evaluiert werden.<br />
Skills - linear planbare <strong>Praxis</strong>aufgaben<br />
• Skills (engl.: Fähigkeiten, Fertigkeiten) erweitert einfache<br />
Handlungen (Handlings) in Richtung auf die Bewältigung<br />
umfassenderer Pflegesituationen (= vollständige Handlung);<br />
• Auch so genannte Soft Skills, die Fähigkeit zu Kommunikation<br />
und Interaktion mit anderen, kommen zur Anwendung;<br />
• Schritte: Assessment, Planung, Durchführung und Evaluation<br />
(= Pflegeprozess);<br />
• Grundannahme: Lineare Dynamik des Prozesses Genaue<br />
Kenntnis aller Variablen ermöglicht Zielbestimmung und damit<br />
die Bewertung des Erfolgs;<br />
• Bearbeitung erfolgt regelgeleitet,<br />
• Skills können anhand von vorab festgelegten Handlungsregeln<br />
und Kriterien evaluiert werden.<br />
20
19.04.2009<br />
Beispiel-Aufgaben<br />
für Skills im <strong>Praxis</strong>feld<br />
Weniger komplizierte Aufgabe:<br />
• „Bitte unterstützen Sie einen alten Menschen, der nicht<br />
mehr selbständig essen kann, unter Aktivierung<br />
möglichst vieler Ressourcen beim Abendessen:<br />
– Informieren Sie sich vorab über seine Gewohnheiten und<br />
Fähigkeiten; führen Sie ein Gespräch mit ihm über seine<br />
Wünsche und Bedürfnisse;<br />
– Formulieren Sie auf dieser Grundlage die Ziele Ihrer Handlung;<br />
– Führen Sie die Maßnahme durch;<br />
– Überprüfen Sie, inwieweit Sie die Ziele erreicht haben und<br />
dokumentieren Sie entsprechend.“<br />
Komplizierte Aufgabe:<br />
• „Reichen Sie bei einem alten Menschen mit<br />
Schluckstörungen das Essen an.<br />
– Informieren Sie sich zunächst über die Ursache der Schluckstörung<br />
und das zugrunde liegende Krankheitsbild aufgrund der vorliegenden<br />
Dokumentationsunterlagen. Ermitteln Sie ggf. mögliche Gründe,<br />
die zu Nahrungsverweigerung führen können. Beobachten Sie<br />
eine erfahrene Pflegekraft, wie sie die Nahrung anreicht und welche<br />
Möglichkeiten zur Stimulation des Schluckreflexes Sie einsetzt.<br />
Informieren Sie sich weiterhin, wie Sie im konkreten Fall handeln<br />
sollen, wenn der Bewohner / die Bewohnerin aspiriert. Beziehen Sie<br />
hierbei den entsprechende Pflegestandard der Einrichtung ein.<br />
– Formulieren Sie aufgrund dieser Vorarbeiten die konkreten Pflegeziele<br />
für Ihrer Maßnahme.<br />
– Führen Sie die Maßnahme durch.<br />
– Überprüfen Sie, inwieweit Sie die Ziele erreicht haben und dokumentieren<br />
Sie entsprechend.<br />
– Vergleichen Sie Ihre Erfahrungen bei der Planung und Durchführung<br />
der Maßnahme mit den im Unterricht erworbenen Kenntnissen<br />
zum Thema ‚Schluckstörungen.“<br />
21
19.04.2009<br />
Lernen im Wechselspiel<br />
von Aktion und Reflexion<br />
Pflegepraxis<br />
Aktion<br />
Schule, Skillslab<br />
Schule &<br />
Pflegepraxis<br />
Reflexion<br />
Reflexion von Handlings und Skills<br />
Technisches<br />
Erkennt-<br />
nis-<br />
Interesse<br />
Pflegende<br />
Erklären und<br />
instrumentelle<br />
Problemlösung<br />
der Probleme/<br />
“Krisen“ der<br />
Pflegenden<br />
Patienten/<br />
Angehörige<br />
Erklären und<br />
instrumentelle<br />
Problemlösung<br />
der (Selbst-)<br />
Pflegeprobleme<br />
des Patienten<br />
(und der<br />
Fremdpflegeprobleme<br />
der<br />
Angehörigen)<br />
Institution/<br />
Gesundheitssystem<br />
Erklären und<br />
instrumentelle<br />
Problemlösung<br />
der<br />
Probleme der<br />
Institution und<br />
des Systems<br />
Pflegerisches<br />
Handeln<br />
Erklären und<br />
Ableiten von<br />
instrumentellen<br />
Lösungen im<br />
Hinblick auf die<br />
Unterstützung<br />
des Patienten<br />
(d. Angehörigen)<br />
bei der Lösung<br />
seines<br />
Problems,<br />
22
19.04.2009<br />
Reflexion von Handlings und Skills<br />
Technisches<br />
Erkennt-<br />
nis-<br />
Interesse<br />
Pflegende<br />
Erklären und<br />
instrumentelle<br />
Problemlösung<br />
der Probleme/<br />
“Krisen“ der<br />
Pflegenden<br />
Patienten/<br />
Angehörige<br />
Erklären und<br />
instrumentelle<br />
Problemlösung<br />
der (Selbst-)<br />
Pflegeprobleme<br />
des Patienten<br />
(und der<br />
Fremdpflegeprobleme<br />
der<br />
Angehörigen)<br />
Institution/<br />
Gesundheitssystem<br />
Erklären und<br />
instrumentelle<br />
Problemlösung<br />
der<br />
Probleme der<br />
Institution und<br />
des Systems<br />
Pflegerisches<br />
Handeln<br />
Erklären und<br />
Ableiten von<br />
instrumentellen<br />
Lösungen im<br />
Hinblick auf die<br />
Unterstützung<br />
des Patienten<br />
Abgleich des<br />
(d. Angehörigen)<br />
bei<br />
gezeigten<br />
der Lösung<br />
seines Handelns mit<br />
Problems, der Realität<br />
Z. B. Fallmethode<br />
nach<br />
Kaiser/Künzel<br />
• Handlings und Skills - auch als umfassende,<br />
am Pflegeprozess orientierte Pflegehandlungen<br />
- verbleiben so lange auf der Ebene<br />
des „Technischen Erkenntnisinteresses“, so<br />
lange sie die individuelle Sicht der Beteiligten<br />
und den Kontext und die damit verbundene<br />
Komplexität ignorieren.<br />
Erst bei Berücksichtigung der Perspektive<br />
der Subjekte und der Organisation entsteht<br />
<strong>Praxis</strong> im Sinne des „Praktischen<br />
Erkenntnisinteresses“.<br />
23
19.04.2009<br />
Situatives Pflegehandeln<br />
• Grundannahme: Chaotische Dynamik des Prozesses das<br />
Ganze ist mehr als die Teile;<br />
• die richtige Lösung lässt sich nicht linear ableiten, wird kreativ<br />
gefunden;<br />
• Bearbeitung erfolgt intuitiv und implizit;<br />
• Maßstab ist die Angemessenheit der Pflege im Lichte des<br />
Falls;<br />
• <strong>Praxis</strong>auftrag z. B. umfassende und individuelle Versorgung<br />
eines Patienten oder einer Gruppe von Patienten alleine oder<br />
gemeinsam mit einer Pflegeexpertin (<strong>Praxis</strong>anleiterin oder<br />
Lehrerin) oder Beobachtung entsprechender Pflege;<br />
• Mögliche Orte: Schulstation oder Einsatzorte, die für „gute“<br />
Pflege bekannt sind.<br />
Anforderungen an <strong>Praxis</strong> für die<br />
Ausbildung von Könnerschaft<br />
• Angemessene Rahmenbedingungen (materielle und<br />
personelle Ressourcen);<br />
• Gestaltungsspielräume, d. h. kein Messen anhand von<br />
Regeln;<br />
• Gute Vorbilder: praktisch Pflegende, die über reflexive<br />
Könnerschaft verfügen und diese auch praktizieren;<br />
• Vorhandensein von Reflexionsgelegenheiten (z. B.<br />
Pflegevisite, Fallbesprechungen o.ä.);<br />
• Aufgabenstellung angemessen, weder über-, noch<br />
unterfordernd;<br />
• Vertrauensverhältnis zu den anleitenden Pflegenden<br />
• ....<br />
24
19.04.2009<br />
Lernen im Wechselspiel<br />
von Aktion und Reflexion<br />
Pflegepraxis<br />
Aktion<br />
Schule, Skillslab<br />
Schule &<br />
Pflegepraxis<br />
Reflexion<br />
Situatives Pflegehandeln<br />
+ Reflexion<br />
• Reflexion mit dem Ziel, das routineförmige Handeln der<br />
Pflegepraxis bewusst zu machen und aufzubrechen;<br />
• Reflexion in der Handlungspause soll Reflexion in der<br />
Handlung begünstigen;<br />
• Methoden der Reflexion müssen der Komplexität pflegerischen<br />
Handelns gerecht werden (also keine Beurteilung anhand von<br />
Handlungsregeln).<br />
25
19.04.2009<br />
Reflexion situativen Pflegehandelns<br />
Pflegende<br />
Patienten/<br />
Angehörige<br />
Institution/<br />
Gesundheitssystem<br />
Pflegerisches<br />
Handeln<br />
Verstehen der und<br />
Verständigung über<br />
die Interessen und<br />
Motive der<br />
Institution / des<br />
Gesundheitswesens<br />
Praktisches<br />
Erkennt-<br />
nis-<br />
Interesse<br />
Bewusstmachen<br />
und Verstehen<br />
der eigenen<br />
Gefühle,<br />
Interessen,<br />
Motive<br />
Verstehen der<br />
Gefühle,<br />
Interessen und<br />
Motive des<br />
Patienten (bzw.<br />
seiner<br />
Angehörigen)<br />
Reflexion der<br />
Reflexion der<br />
Angemessenheit<br />
der Angemessenheit<br />
der gefun-<br />
gefundenen<br />
Handlungsoption<br />
denen Handlungsoption<br />
Reflexion situativen Pflegehandelns<br />
Pflegende<br />
Patienten/<br />
Angehörige<br />
Institution/<br />
Gesundheitssystem<br />
Pflegerisches<br />
Handeln<br />
Verstehen der und<br />
Verständigung über<br />
die Interessen und<br />
Motive der<br />
Institution / des<br />
Gesundheitswesens<br />
Praktisches<br />
Erkennt-<br />
nis-<br />
Interesse<br />
Bewusstmachen<br />
und Verstehen<br />
der eigenen<br />
Gefühle,<br />
Interessen,<br />
Motive<br />
Verstehen der<br />
Gefühle,<br />
Interessen und<br />
Motive des<br />
Patienten (bzw.<br />
seiner<br />
Angehörigen)<br />
Reflexion der<br />
Reflexion der<br />
Angemessenheit<br />
der Angemessenheit<br />
der gefun-<br />
gefundenen<br />
Handlungsoption<br />
denen Handlungsoption<br />
Z. B. Tagebuchschreiben,<br />
szen.<br />
Übungen...<br />
Z. B. Fallbesprechungen,<br />
Pflegevisite...<br />
26
19.04.2009<br />
Verantwortliches Pflegehandeln<br />
• Verantwortung erlernen Schüler, indem sie für etwas<br />
verantwortlich sind;<br />
• <strong>Praxis</strong>auftrag z. B. individuelle Versorgung eines Patienten<br />
oder einer Gruppe von Patienten alleine oder gemeinsam mit<br />
einer Pflegeexpertin (<strong>Praxis</strong>anleiterin oder Lehrerin); Selbstoder<br />
Fremdbeobachtung von moralisch relevantem Verhalten;<br />
• Günstige Sozialisationsbedingungen: offene Konfrontation mit<br />
sozialen Problemen und Konflikten, zuverlässige<br />
Wertschätzung, zwanglose Kommunikation und<br />
Mitbestimmung, fähigkeitsangemessene Verantwortung (vgl.<br />
Lempert 1998);<br />
Reflexion verantwortlichen<br />
Pflegehandelns<br />
Pflegende<br />
Patienten/<br />
Angehörige<br />
Institution/<br />
Gesundheitssystem<br />
Pflegerisches<br />
Handeln<br />
Emanzipa<br />
torisches<br />
Erkennt-<br />
nis-<br />
Interesse<br />
Reflexion von<br />
gesellschaftlich<br />
geprägten<br />
inneren<br />
Widersprüchen<br />
Reflexion<br />
gesellschaftlich<br />
geprägten<br />
inneren<br />
Widersprüchen<br />
Reflexion von<br />
gesellschaftlich<br />
geprägten<br />
institutionellen<br />
Widersprüchen<br />
Reflexion<br />
pflegerischen<br />
Handelns in<br />
seiner Widersprüchlichkeit<br />
hhhh<br />
27
19.04.2009<br />
Reflexion verantwortlichen<br />
Pflegehandelns<br />
Pflegende<br />
Patienten/<br />
Angehörige<br />
Institution/<br />
Gesundheitssystem<br />
Pflegerisches<br />
Handeln<br />
Emanzipa<br />
torisches<br />
Erkennt-<br />
nis-<br />
Interesse<br />
Reflexion von<br />
gesellschaftlich<br />
geprägten<br />
inneren<br />
Widersprüchen<br />
Reflexion<br />
gesellschaftlich<br />
geprägten<br />
inneren<br />
Widersprüchen<br />
Reflexion von<br />
gesellschaftlich<br />
geprägten<br />
institutionellen<br />
Widersprüchen<br />
Reflexion<br />
pflegerischen<br />
Handelns in<br />
seiner Widersprüchlichkeit<br />
hhhh<br />
Z. B. szen. Darstellung,<br />
Fallbesprechungen<br />
Z. B. ethische<br />
Fallbesprechungen,<br />
Gliederung des Vortrags<br />
• Wie zeigen sich Könnerschaft und Unvermögen in<br />
der <strong>Praxis</strong> des Pflegehandelns von<br />
Auszubildenden?<br />
• <strong>Theorie</strong>modelle zum <strong>Praxis</strong>lernen – Wie lernt man<br />
Könnerschaft?<br />
• Betriebliches Lernen im Lichte der<br />
Interaktionistischen Pflegedidaktik<br />
• <strong>Praxis</strong>curriculum gestalten<br />
• Arbeit an Lehrerhaltungen – Was können<br />
LehrerInnen tun, um Könnerschaft zu fördern?<br />
28
19.04.2009<br />
Ausbildungsbedingungen<br />
Bitte lesen Sie die Fallsituation A nochmals<br />
und achten Sie dabei besonders auf das<br />
Lehrerhandeln. Überlegen Sie:<br />
– Wie stellen Sie sich die Situation insgesamt<br />
vor?<br />
– Welche Haltung nimmt dabei der Lehrer ein?<br />
– Welche Möglichkeiten zur Veränderung der<br />
Situation hat er?<br />
29
19.04.2009<br />
Kontrovers!<br />
„Die Schüler sagten mir, dass fast alle es angenehmer finden, wenn die<br />
Lehrkraft nur passiv an den Anleitungen teilnimmt, (…). Sie<br />
begründeten das wie folgt: sie empfinden es als störend, wenn der<br />
Lehrer aktiv in die Anleitung eingreift, da sie dann fürchten, aus<br />
ihrem Konzept zu geraten und Sorge haben, dass sie nicht wieder<br />
zurück in ihren eigenen Rhythmus finden, sobald die Intervention<br />
durch die Lehrkraft beendet ist. Besonders noch unsichere Schüler<br />
in den ersten Ausbildungsjahren geben an, dass das aktive<br />
Eingreifen der Lehrkraft für sie eine Form der Kritik sei und ihnen<br />
dies vor den Bewohnern peinlich ist, da sie befürchten dadurch an<br />
Autorität zu verlieren. Ihnen sind anschließende Kritik und<br />
Anregungen der Lehrkräfte im Reflexionsgespräch lieber.“ (a.d.<br />
Studienarbeit v. A. Marach)<br />
30
19.04.2009<br />
VORTRAGSIMPRESSIONEN<br />
31
19.04.2009<br />
32
19.04.2009<br />
33
19.04.2009<br />
34
19.04.2009<br />
35