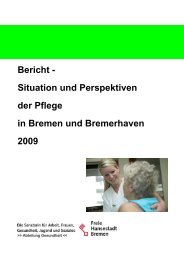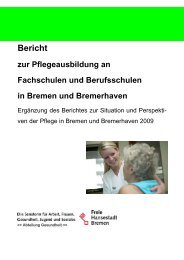Ergebnisse Workshop A_13.03.09 - Universität Bremen
Ergebnisse Workshop A_13.03.09 - Universität Bremen
Ergebnisse Workshop A_13.03.09 - Universität Bremen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Arbeitsergebnisse <strong>Workshop</strong> A: Ambulante Pflege „Bis dann alles an einem Wochenende eskalierte“ Universität <strong>Bremen</strong><br />
1<br />
<strong>Workshop</strong> A<br />
„Bis dann an einem Wochenende alles eskalierte…“<br />
– ein Narrativ aus der ambulanten Pflege<br />
Christine Steiner, Universität <strong>Bremen</strong>
Arbeitsergebnisse <strong>Workshop</strong> A: Ambulante Pflege „Bis dann alles an einem Wochenende eskalierte“ Universität <strong>Bremen</strong><br />
2<br />
Gruppenergebnisse Didaktische Reflexion:<br />
(Die Situation basiert auf dem Narrativ einer Pflegenden)<br />
„Bis dann alles an einem Wochenende eskalierte“<br />
„Ich kam 3xtgl. als Pflegerin der Sozialstation zu Familie W.. Betreut wurde Frau W., sie litt an Morbus Prakinson, der so weit fortgeschritten war, dass sie<br />
bettlägerig war. Außerdem hatte sie einen insulinpflichtigen Diabetes mellitus.<br />
Herr W. litt an beginnender Alzheimer Demenz und versorgte den Haushalt und seine Frau mehr schlecht als recht.<br />
Morgens wurde Frau W. immer gewaschen und das Insulin nach BZ-Kontrolle und Plan gespritzt. Essen gab immer der Ehemann ein. Mittags und abends<br />
wurde die Inkontinenzhose gewechselt und die Patientin frisch gemacht. Abends wurde außerdem noch nach Plan Insulin gespritzt.<br />
Ich versorgte Frau W. über längere Zeit. Der Sommer war sehr heiß und ich bemerkte, dass Frau W. kaum etwas zu trinken bekam, der Urin war stark konzentriert<br />
und roch unangenehm. Da die BZ-Werte hoch waren, fragte ich den Ehemann, was sie zum Essen bekommt. Er sagte: Sahnetorte zum Frühstück,<br />
zum Mittagessen etwas vom Altersheim und außerdem, das würde mich nichts angehen, er wüsste selbst, was er zu geben hat. Auch versuchte ich ihr öfters<br />
was zu Trinken zu geben, was er kategorisch ablehnte: seine Frau würde genügend bekommen, was aber nicht stimmte. Ich stand oft der Situation hilflos<br />
gegenüber. Der uneheliche Sohn hatte auch nichts zu sagen. Beim Ehemann merkte man seinen Beruf als Leutnant noch immer, er duldete keinen Widerspruch.<br />
Ich sah, dass sie zu wenig zu trinken bekam, konnte aber nichts machen.<br />
Bis dann alles an einem Wochenende eskalierte. Ich habe Frau W. wie üblich gespritzt. Ihr Mann war am Vortag beim Gartenfest des Nachbarn und war wohl<br />
recht angeheitert zurückgekommen. Am Morgen war er dann nicht mehr fit genug und hatte vergessen, seiner Frau das Frühstück zu geben. Mittags war sie<br />
nicht mehr ansprechbar, kaltschweißig und zittrig. Ich holte den Hausarzt. Er wies Frau W. ins Krankenhaus ein. Frau W. war im Unterzucker, was ich im ersten<br />
Moment nicht erkannt habe. Ich fühlte mich überfordert und hilflos und fragte mich, ob ich überhaupt für diese Aufgabe geeignet bin. Was hätte ich von<br />
meiner Seite noch tun sollen? Können? Müssen?<br />
Die Fallsituation entstammt einer Lerninsel, die mit folgenden Kooperationspartnern entwickelt wurde:<br />
Einrichtung(en): Netzwerk Curriculumentwicklung an Pflegeschulen Region München<br />
Seminar Fachdidaktik Universität <strong>Bremen</strong> / Osnabrück SoSe 2006<br />
Personen: Petra Iris Kaltenbach-Schmökel, Angelika Müller, Sabine Muths, Christine Steiner, Silke Streuff<br />
Ermittlung von Bildungsinhalte/-ziele anhand der Pflegedidaktischen Heuristik nach Darmann-Finck<br />
(Die fettgedruckten Schlagworte, die so von den Teilnehmern während des <strong>Workshop</strong>s auf Metaplankarten dokumentiert wurden, wurden vertiefend in Anlehnung an<br />
einer bereits entwickelten und erprobten didaktischen Refexion 1 durch C.S. ergänzt)<br />
1 Die didaktische Reflexion entstand unter der Federführung von Sabine Muths, Universität <strong>Bremen</strong>, und unter der Beteiligung von Petra Iris Kaltenbach-Schmökel, Angelika<br />
Müller, Christine Steiner und Silke Streuff.
Arbeitsergebnisse <strong>Workshop</strong> A: Ambulante Pflege „Bis dann alles an einem Wochenende eskalierte“ Universität <strong>Bremen</strong><br />
3<br />
Zielebene: Pflegende Patient /Angehörige Institution/Gesell. pfleger. Handeln<br />
Technisches<br />
Erkenntnisinteresse<br />
= Wissenschaftsorientierung<br />
/<br />
technischinstrumentell<br />
/<br />
Wissen u. Fertigkeiten<br />
(SchülerInnen<br />
nennen / erklären<br />
z.B.…)<br />
• Aspekte von Arbeitsorganisation /<br />
Zeitmanagement<br />
• Rollenkonflikte (intra-, inter-)<br />
Rollendefinition für Pflegende in<br />
der Ambulanten Pflege – Auswirkungen<br />
auf das Professionsverständnis<br />
• Burnout, Copingstrategien:<br />
− theoretische Begründung für die<br />
Notwendigkeit, im Rahmen professioneller<br />
Pflege eigene Grenzen<br />
zu erkennen und akzeptieren<br />
zu müssen<br />
− Theorien zur Entstehung von<br />
Überlastungsgefühlen, Enttäuschungen,<br />
Niederlagen in beruflichen<br />
Situationen<br />
− Theorien und Modelle der<br />
Stressentstehung und –<br />
bewältigung<br />
− Einschätzung/Beurteilung beruflicher<br />
Handlungskompetenzen<br />
(Selbsteinschätzung, Fremdwahrnehmung)<br />
• Diabetes mellitus<br />
Physiologie, Pathophysiologie,<br />
Krankheitslehre, allgemeine pflegerische<br />
Maßnahmen bei Diabetes Mellitus<br />
(BZ-Werte, Insulingabe, Regeln<br />
angemessener Ernährung usw.), Sofortmaßnahmen<br />
bei Hypo-<br />
/Hyperglykämie<br />
• M. Parkinson<br />
Physiologie, Pathophysiologie,<br />
Krankheitslehre, Unterstützungsbedarf<br />
und Pflegeunterstützung<br />
• M. Alzheimer<br />
Physiologie, Pathophysiologie,<br />
Krankheitslehre<br />
• Phänomen Dehydration und Malnutrition<br />
im Alter – Risiken, Gefahren/Auswirkungen,<br />
Maßnahmen –<br />
auch im Zusammenhang mit Diabetes<br />
mellitus und M. Parkinson<br />
• Phänomen Multimorbidität<br />
• Kompensierendes Hilfesystem<br />
Versorgungsmöglichkeiten für<br />
chronisch Kranke in der BRD<br />
• Abrechnungssystem, Pflegeversicherung,<br />
Krankenversicherung<br />
• Aufbau und Struktur ambulanter<br />
Pflege<br />
− Struktur der gesetzlich geregelten<br />
Haus- und Familienpflege,<br />
Zuständigkeiten der Institutionen<br />
− Pflegearrangement - Angebotsvarianten,<br />
alternative Möglichkeiten<br />
institutionalisierter Wohnund<br />
Lebensformen<br />
− Organisationsstruktur ambulanter<br />
Pflege<br />
− Institutionalisierte Kommunikationsstrukturen<br />
im Gesundheitswesen,<br />
spez. in der ambulanten<br />
Pflege (Teambesprechungen,<br />
Pflegevisite, Kontaktaufnahme)<br />
• Schnittstellenmanagement<br />
(Hausarzt, …)<br />
• Wissen über adäquate Pflegeinterventionen/Pflegeprozess:<br />
Planung<br />
und Steuerung pflegerischer Maßnahmen<br />
unter Berücksichtigung unterschiedlicher<br />
Pflegearrangements<br />
bei<br />
− Diabetes mellitus, spez. Bedeutung<br />
der Nahrungsaufnahme,<br />
Flüssigkeitsaufnahme – Maßnahmen<br />
bei Hyper- und Hypoglykämie,<br />
Dehydrierung, Insulintherapie<br />
− M. Parkinson, spez. Nahrungsaufnahme,<br />
Inkontinenzversorgung,<br />
Bewegungskonzepte<br />
− M. Alzheimer; spez. Kommunikationskonzepte,<br />
wie Validation, Alltagsgestaltung,<br />
Erhalt/Förderung<br />
von Selbstständigkeit<br />
• Kenntnis über Versorgung von Bettlägrigen<br />
bei der Nahrungseingabe<br />
• Informations- und Beratungsgespräch/Förderung<br />
von Compliance<br />
bzw. Empowerment (Schulung bzw.<br />
Beratung)<br />
• Ethik/Fürsorge:<br />
Umgang mit Dilemmasituationen,<br />
Wege/Konzepte der Entscheidungsfindung<br />
(ethische Richtlinien,<br />
Kodizes)<br />
• Bedeutung und Bewältigung chronischer<br />
Erkrankungen, Verlaufskurvenmodell<br />
(Corbin/Strauss) – Auswirkungen<br />
in Partnerschaften<br />
• Rechte, Information des Sohnes<br />
• Schutz der Privatrechte und der ehelichen<br />
Gemeinschaft<br />
• Regelungen zum Schutz abhängiger<br />
pflegebedürftiger Personen vor Gewalt<br />
und Vernachlässigung<br />
• Regelung zur Einschränkung bürgerlicher<br />
Rechte im Folge einer Demenzerkrankung/Schutz<br />
der Persönlichkeitsrechte<br />
• Notfallmanagement<br />
• Rechtliche Aspekte (Rechtsbeziehungen,<br />
Betreuungsrecht)<br />
− Gesetzeslage zur ambulanten<br />
Pflege (SBG XI), Definition und<br />
Bedeutung der Pflegebedürftigkeit<br />
nach SBG XI, vertraglich<br />
vereinbarte Pflegeleistungen –<br />
Pflegestufen<br />
− Betreuungsrecht<br />
− Schutz hilfebedürftiger, abhängiger<br />
Personen - Regelungen<br />
staatlicher Interventionen im Bereich<br />
der ambulanten Versorgung<br />
alter Menschen<br />
• Prinzipien einer ethischen Fallbesprechung
Arbeitsergebnisse <strong>Workshop</strong> A: Ambulante Pflege „Bis dann alles an einem Wochenende eskalierte“ Universität <strong>Bremen</strong><br />
4<br />
Praktisches<br />
Erkenntnisinteresse<br />
= Verständigungsorientierung<br />
(SchülerInnen<br />
nehmen wahr<br />
/verstehen / verständigen<br />
sich<br />
z.B. über …)<br />
Das Erleben der Situation und mögliche<br />
(bewusste/unbewusste) Gefühle<br />
und Motive auf Seiten der erzählenden<br />
Pflegekraft, z.B.: Gedanken und<br />
unbewusste Norm/Anspruch in jeglicher<br />
beruflichen Situation Experte zu<br />
sein (persönliches Rollenverständnis)<br />
• Hilflosigkeit<br />
• Überforderung<br />
• Ablehnung (durch den Ehemann)<br />
• Aggression<br />
• Wut<br />
• Gefühle mit der Situation alleine<br />
zu sein<br />
• Gefühl in der beruflichen Fachkompetenz<br />
in Frage gestellt und<br />
beschnitten zu werden<br />
• Mitleid, Ärger, Ablehnung<br />
• Selbstzweifel<br />
• Vorurteile (z.B. gegenüber einem<br />
„Leutnant“/einem Demenzkranken)<br />
• Anspruch einer umfassenden<br />
Verantwortungsübernahme<br />
• Gefühle der Ehepartner:<br />
Hilflosigkeit, Unsicherheit, Überforderung,<br />
Wut/Ärger, Angst, Abhängigkeit,<br />
Selbstaufgabe, Macht,<br />
Kontrolle, Wunsch nach Autonomie,<br />
Todeswunsch/Überlebenswillen<br />
• Frau W.:<br />
− Abhängigkeit und Hilflosigkeit – Erleben<br />
von mangelhafter Versorgung<br />
− generationentypisches Verständnis<br />
sich als Frau unterordnen/fügen zu<br />
müssen – gegenüber ihrem Mann,<br />
der Institution der ambulanten Pflege,<br />
dem Hausarzt, dem Schicksal und der<br />
Krankheit<br />
− Loyalität gegenüber dem Ehepartner<br />
• Herrn W.:<br />
− männlicher Anspruch, stark und autonom<br />
agieren zu müssen, leistungsfähig<br />
und unabhängig zu sein – als Familienvorstand<br />
und Patriarch (generationentypisch)<br />
− fremdes Eingreifen in die eigene Welt<br />
erleben und nicht zulassen können/wollen<br />
→ Gefühle der Fremdbestimmung<br />
und Hilflosigkeit<br />
− wachsender Kontrollverlust und daraus<br />
resultierend z.B. Wut und Aggression<br />
− wachsende Selbstzweifel<br />
• Krankheitsverständnis Familie –<br />
Pflegedienst<br />
• Entscheidungsmacht: Familie<br />
vs. Pflegedienst<br />
• Rollenverhalten Kunde/Dienstleister<br />
• mögliche Interesse des ambulanten<br />
Pflegedienstes durch ressourcenschonende,<br />
ökonomische und<br />
effiziente Versorgung der Kunden<br />
eine Stabilisierung der Institution<br />
und eine Gewinnoptimierung zu<br />
erreichen<br />
• gesellschaftlicher Auftrag, die<br />
begrenzten ökonomischen Ressourcen<br />
im Gesundheitswesen effizient<br />
und gerecht zu verteilen<br />
• gesellschaftlicher Auftrag, schwache<br />
und hilfsbedürftige Mitglieder<br />
sorgend aufzufangen<br />
• gesellschaftlicher Auftrag alle<br />
Bürger zunächst und in erster Linie<br />
in ihrer Eigenverantwortung<br />
anzuerkennen<br />
• fallbezogenes Teamgespräch/Supervision<br />
• Austausch im Pflegeteam<br />
• Handlungsentscheidung zwischen<br />
unmittelbar notwendigen Pflegeerfordernissen,<br />
dem Anspruch an eine<br />
umfassende Pflege, der Wahrung<br />
der Interessen der Patientin und ihres<br />
Partners<br />
• Gestaltung eines Fallmanagements<br />
und die Koordinierung aller an der<br />
Situation der Patientin beteiligte<br />
Personen und Institutionen (Frau<br />
und Herr W., Sohn, Arzt, Sozialdienst,<br />
KH-Betreuung,….)<br />
• Gesprächsführung und Anbahnung<br />
einer (ethischen) Fallbesprechung)<br />
• Antiaggressionstraining<br />
• Einschätzung der akuten Situation<br />
der Patientin (incl. der komplexen<br />
medizinischen Problematik) und ihres<br />
häuslichen Umfeldes (Deutungen<br />
von Krankheitserleben und der<br />
Interaktion im Partnersystem)<br />
• mögliches Einverständnis des Ehepaares<br />
über das Erleben des zunehmenden<br />
Verlustes der Privatsphäre<br />
und Einmischung Fremder in nichtöffentliche<br />
Familienangelegenheiten<br />
• Gefühle des Sohnes:<br />
Hilflosigkeit, Ratlosigkeit
Arbeitsergebnisse <strong>Workshop</strong> A: Ambulante Pflege „Bis dann alles an einem Wochenende eskalierte“ Universität <strong>Bremen</strong><br />
5<br />
Emanzipatorisches<br />
Erkenntnisinteresse<br />
= Reflexions und<br />
Kritikorientierung<br />
(SchülerInnen<br />
reflektieren z.B.<br />
den Widerspruch<br />
zwischen…)<br />
• Wut, Aggression vs. professionelles<br />
Selbstverständnis<br />
Anspruch umfassender professioneller<br />
Kompetenz (pflegerischer<br />
Experte) vs. Erleben der Grenzen<br />
persönlicher Handlungsspielräume<br />
• Pflegerische Norm vs. Hilflosigkeit<br />
Professionelle Rollennorm (Wahrung<br />
der Distanz, souveräner<br />
Überblick) vs. Erleben unprofessioneller<br />
Gefühle von Mitleid, Hilflosigkeit,<br />
Abwehr<br />
• Hilflosigkeit vs. Kontrolle<br />
• Verletzlichkeit vs. Bedrohung<br />
Situation Frau W.:<br />
• Erfahrung von Hilfsbedürftigkeit und<br />
Abhängigkeit (sich fügen müssen) vs.<br />
(möglicherweise verdrängtem) Bedürfnis<br />
nach Selbstständigkeit<br />
• Anspruch eine „gute Patientin“ sein zu<br />
wollen (gegenüber Arzt und Pflegekraft)<br />
vs. eine „gute Ehefrau“<br />
Situation Herr W.:<br />
• Anspruch als Ehemann das Schiff<br />
steuern zu müssen vs. Erleben, dieser<br />
Rolle nicht gerecht zu werden/gewachsen<br />
zu sein<br />
• gesellschaftliche Erwartungen<br />
vs. Machbarkeit (Anspruch und<br />
Wirklichkeit) in der Familie,<br />
beim Pflegedienst<br />
• ökonomisches Interesse vs.<br />
ethische Verantwortlichkeit<br />
• Pflegeauftrag eines ambulanten<br />
Dienstes vs. Handlungsbegrenzung<br />
durch knappe finanzielle Mittel<br />
→ wahrgenommener Pflegeund<br />
Unterstützungsbedarf vs. Einhaltung<br />
des finanziell abgesicherten<br />
Pflegeauftrags (auch: Zeitbedarf<br />
für eine optimale Lösung vs.<br />
Begrenzung der Pflegezeit)<br />
• Thematisierung der pflegerischen<br />
Rolle<br />
Professionelle Ausführung der gesetzlich/vertraglich<br />
definierten pflegerischen<br />
Leistung vs. Diffuse pflegerische<br />
Erfordernisse der Situation<br />
• Autonomie vs. Pflegeverantwortlichkeit<br />
Fürsorge vs. Anerkennung von Autonomie<br />
• Institutionell formulierter Auftrag<br />
einer begrenzten Aufgabe vs. persönlicher<br />
Anspruch von umfassender<br />
Fürsorge<br />
Partnersystem:<br />
• Wunsch nach Schutz der Privatsphäre<br />
vs. Erleben der Notwendigkeit öffentlicher<br />
Hilfe bzw. dem Wunsch<br />
nach Unterstützung<br />
• öffentliches Interesse an einer<br />
umfassenden Versorgungssicherung<br />
für alle Bürger vs. dem Auftrag<br />
der Verteilungsgerechtigkeit<br />
und der effizienten Mittelzuweisung<br />
im Gesundheitswesen<br />
• Verantwortung für des Schutz des<br />
individuellen Lebens vs. dem<br />
Schutz der Privatsphäre → staatliche<br />
Fürsorge vs. Anerkennung<br />
persönlicher Autonomie
Arbeitsergebnisse <strong>Workshop</strong> A: Ambulante Pflege „Bis dann alles an einem Wochenende eskalierte“ Universität <strong>Bremen</strong><br />
6<br />
Mögliche Sequenzbildung, Einordnung in den Verlauf der Ausbildung und Konzeption der Lerninsel 2<br />
Auf der Grundlage der didaktischen Analyse mit Hilfe der heuristischen Matrix ist die folgende mögliche Ordnung der ermittelten Bildungsinhalte vorstellbar:<br />
Wissensgrundlagen – Überwiegend zum Technischen Erkenntnisinteresse:<br />
• Krankheitslehre, Aspekte der Gesundheitsförderung/Prävention und die zugehörigen Pflegeinterventionen<br />
• Juristische, ökonomische und institutionelle/arbeitsorganisatorische Aspekte einer ambulanten Versorgung<br />
• Definition der Berufsrolle und Arbeitsorganisation in der Ambulanten Pflege<br />
Deutung der Fallsituation und Entwicklung von Perspektiven: Überwiegend zum Praktischen Erkenntnisinteresse<br />
• Umfassende Deutung der Situation des Ehepaares<br />
• Fallmanagement und Handlungsentscheidung<br />
Diskussion der komplexen Problematik: Überwiegend zum praktischen und emanzipatorischen Erkenntnisinteresse:<br />
• Umgang mit belastenden beruflichen Herausforderungen und Dilemmasituationen<br />
• Aufgaben und Schwierigkeiten einer professionellen ambulanten Versorgung älterer Menschen<br />
• Diskussion der gesellschaftlichen Dimension des Falls<br />
Da für die Bearbeitung des Falls erforderlichen Wissensgrundlagen, insgesamt sehr komplex sind, eignet sich diese Lernsituation eher für das Ende der Ausbildung,<br />
wenn die Krankheitsbilder, Pflegekonzepte und die Aufgaben der ambulanten Versorgung aus vorangegangenen Unterrichten und aus der Begegnung mit der Praxis<br />
bereits vertraut sind.<br />
Hier ist geplant, dass die SchülerInnen die Bearbeitung zunächst für ein selbstorganisierte Wiederholung und Überprüfung ihrer Kenntnisse nutzen (→ Lernsequenz 1).<br />
Zu einer Deutung der komplexen Fallsituation (Praktisches Erkenntnisinteresse) werden die SchülerInnen durch methodische Interventionen der Perspektivenübernahme<br />
bzw. des szenischen Spiels vertiefend angeregt (→ Lernsequenz 2). Von den möglichen thematischen Aspekten für eine Diskussion im Sinne des Emanzipatorischen<br />
Erkenntnisinteresses wurde der Aspekt der eigenen Berufsrolle und der Professionalisierung ausgewählt. Damit die Lerninsel auch auf die Vorbereitung der Examensprüfung<br />
und dabei besonders auf die mündliche Prüfung in der Krankenpflegeausbildung ausgerichtet (→ Lernsequenz 3). Ergänzend oder fakultativ werden in einer weiteren<br />
Lernsequenz die gesellschaftspolitischen und/oder gesundheitsökonomischen Dimensionen des Falls diskutiert (→ Lernsequenz 4).<br />
2 Die Konzeption wurde einer bereits entwickelten Lerninsel entnommen. Vgl. dazu Hinweis im Anschluss an das Narrativ und Fußnote 1.
Arbeitsergebnisse <strong>Workshop</strong> A: Ambulante Pflege „Bis dann alles an einem Wochenende eskalierte“ Universität <strong>Bremen</strong><br />
7<br />
Einstieg:<br />
Aneignung der Problemsituation und Formulierung von Lernzielen. Verabredung von Lernfragen für<br />
eine selbständige Repitition und Recherche. Verständigung darauf, welcher konflikthaltige Aspekt im<br />
anschließenden Unterricht bearbeitet werden soll.<br />
Methodische Anregungen: POL Schritte 1 – 5 mit Moderation im Unterrichtsgespräch → Formulierung<br />
von fallbezogenen Lernfragen für Lernsequenz 1 und Lernzielen für die Lernsequenzen 2 – 4<br />
2 h<br />
8 h<br />
Lernsequenz 1<br />
Lernsequenz 2<br />
4 h<br />
Lernsequenz 3<br />
3 h 4 h<br />
Lernsequenz 4<br />
„Selbständiges Repititorium“<br />
1. Die SchülerInnen repitieren ihr<br />
Wissen zur medizinischpflegerischen<br />
und rechtlicharbeitsorganisatorischen<br />
Fragen<br />
fallbezogen, arbeitsteilig in kleinen<br />
Gruppen<br />
2. Die <strong>Ergebnisse</strong> der Selbstlernphase<br />
werden in freien Kurzvorträgen<br />
bezogen auf die in der<br />
Einstiegssequenz formulierten<br />
Lernfragen fallbezogen referiert<br />
– und in möglichst knapper Form<br />
zusammengefasst.<br />
Methodische Anregungen:<br />
Selbstorganisiertes Lernen - Ergebnispräsentation<br />
und Sicherung<br />
„Deutung der Fallsituation und<br />
Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten“<br />
Perspektivische Aneignung der Fallsituation<br />
aus Sicht von<br />
− Frau W.<br />
− Herrn W.<br />
− dem Sohn der Familie<br />
− der Pflegekraft<br />
− des hausarztes<br />
→ jeweils Entwicklung des Ist-<br />
Zustandes und einer Wunschlösung<br />
aus den Perspektiven.<br />
Diskussion der verschiedenen Deutungen<br />
und Wunschvorstellungen<br />
und Aushandlung gemeinsamer<br />
Lösungsmöglichkeiten.<br />
Methodische Anregungen:<br />
Erarbeitung von Standbildern aus<br />
den genannten Perspektiven (Gruppenarbeit<br />
– Präsentation im Plenum)<br />
„Widersprüche pflegerischen<br />
Handelns - Professionstheoretische<br />
Überlegungen“<br />
1. Die SchülerInnen lesen einen pflegewissenschaftlichen<br />
Text zu den<br />
Antinomien des Pflegehandelns<br />
(z.B. Auszug/Zusammenfassung v.<br />
Stemmer 2003). Sie identifizieren<br />
im Text die Aussagen, die sich auf<br />
die Situation der Pflegekraft im dargestellten<br />
Fallbeispiel übertragen<br />
lassen.<br />
2. Thesenartige Zusammenfassung<br />
der <strong>Ergebnisse</strong><br />
3. Diskussion: Welche Empfehlungen<br />
lassen sich für die Pflegekraft aus<br />
der Position der Pflegewissenschaftlerin<br />
ableiten? Wie hilfreich<br />
sind diese Empfehlungen?<br />
Methodische Anregungen:<br />
Textarbeit – Einzelarbeit<br />
Unterrichtsgespräch<br />
„Ehemann vernachlässigt Ehefrau – ist<br />
gesellschaftliche Einmischung erforderlich?...“<br />
1. Die SchülerInnen überlegen in Arbeitsgruppen, wie<br />
die geschilderte Situation möglicherweise noch weiter<br />
eskalieren könnte und formulieren eine entsprechende<br />
Titelmeldung für eine Boulevardzeitung.<br />
2. Im Plenum wird das jeweils entwickelte Kerndilemma<br />
benannt und daraufhin die brisanteste Titelgeschichte<br />
ausgewählt, zu der eine Fernsehdiskussion<br />
stattfinden soll. Mögliche Diskussionsteilnehmer (=<br />
Interessengruppen/Positionen) werden ausgewählt<br />
und dies als Rollen auf Arbeitsgruppen verteilt, die<br />
zunächst ihre Rolle/Interessen präzisieren und Argumente<br />
sammeln. Eine Gruppe bereitet die Moderation<br />
vor.<br />
3. Durchführung der Diskussion mit Vertretern a.d.<br />
Arbeitsgruppen. Die Beobachter protokollieren jeweils<br />
die Argumente der anderen Gruppen.<br />
4. Die Argumente werden hierarchisiert in Hinblick auf<br />
Moralstufen (Kohlberg) und Überzeugungskraft.<br />
Methodische Anregungen:<br />
Gruppenarbeit mit Schreibauftrag<br />
Rollenspiel, Unterrichtsgespräche<br />
Ergebnissicherung:<br />
Feedback zur gesamten Lernsituation – „Welchen Wissenszuwachs habe ich gewonnen? / Inwiefern haben<br />
sich meine Vorstellungen/Einstellungen verändert oder auch gefestigt? / Welche Konsequenzen ziehe ich für<br />
mein zukünftiges pflegerisches Handeln?<br />
Methodische Anregung: Blitzlicht<br />
1 h