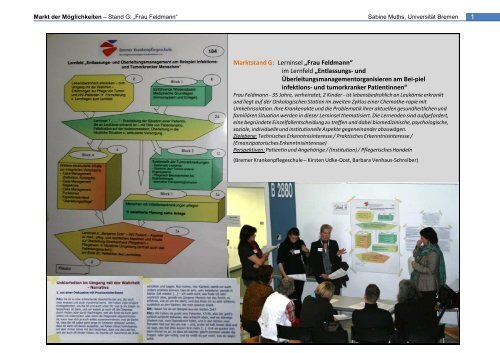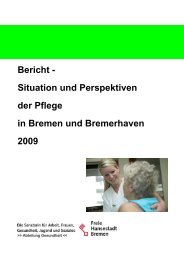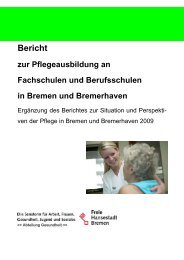Stand H - Frau Feldmann - Universität Bremen
Stand H - Frau Feldmann - Universität Bremen
Stand H - Frau Feldmann - Universität Bremen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Markt der Möglichkeiten – <strong>Stand</strong> G: „<strong>Frau</strong> <strong>Feldmann</strong>“ Sabine Muths, Universität <strong>Bremen</strong><br />
1<br />
Marktstand G: Lerninsel „<strong>Frau</strong> <strong>Feldmann</strong>“<br />
im Lernfeld „Entlassungs- und<br />
Überleitungsmanagementorganisieren am Bei-piel<br />
infektions- und tumorkranker Patientinnen“<br />
<strong>Frau</strong> <strong>Feldmann</strong> - 35 Jahre, verheiratet, 2 Kinder - ist lebensbedrohlich an Leukämie erkrankt<br />
und liegt auf der Onkologischen Station im zweiten Zyklus einer Chemothe-rapie mit<br />
Umkehrisolation. Ihre Krankenakte und die Problematik ihrer aktuellen gesundheitlichen und<br />
familiären Situation werden in dieser Lerninsel thematisiert. Die Lernenden sind aufgefordert,<br />
eine begründete Einzelfallentscheidung zu treffen und dabei biomedizinische, psychologische,<br />
soziale, individuelle und institutionelle Aspekte gegeneinander abzuwägen.<br />
Zielebene: Technisches Erkenntnisinteresse / Praktisches Erkenntnisinteresse /<br />
(Emanzipatorisches Erkenntnisinteresse)<br />
Perspektiven: Patientin und Angehörige / (Institution) / Pflegerisches Handeln<br />
(Bremer Krankenpflegeschule – Kirsten Udke-Dost, Barbara Venhaus-Schreiber)
Markt der Möglichkeiten – <strong>Stand</strong> G: „<strong>Frau</strong> <strong>Feldmann</strong>“ Sabine Muths, Universität <strong>Bremen</strong><br />
2<br />
Kooperationspartner – an der Entwicklung und Erprobung beteiligt:<br />
Einrichtung(en): Bremer Krankenpflegeschule der freigemeinnützigen Krankenhäuser e.V.<br />
Personen:<br />
Insa Casjens, Dieter Guhlke, Jens Oestreich, Kirsten Udke-Dost, Barbara<br />
Venhaus-Schreiber, Ilka Wicha<br />
Inhaltsdimensionen der Lerninsel:<br />
bearbeitete Schlüsselprobleme:<br />
• Urteilsbildung zwischen regelgeleiteten Erkenntnissen und individuellem Fallverstehen<br />
zentrale bearbeitbare technische Erkenntnisse / instrumentelle Fertigkeiten:<br />
• Pflege tumorkranker PatientInnen am Beispiel einer Leukämieerkrankung (Krankheitsbild,<br />
therapeutische Möglichkeiten, Umgang mit Zytostatika, Umkehrisolation,<br />
Patienteninformation …)<br />
• Gestaltung von Überleitungspflege und Einführung in Case-Management<br />
**************<br />
Mögliche curriculare Bezugspunkte in den gesetzlichen Lehrplanvorgaben:<br />
integrierte Wissensgebiete (KrPflAPrV §1.1 – Anl.1):<br />
• Kenntnisse der Gesundheits- und Krankenpflege, der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege<br />
sowie der Pflege- und Gesundheitswissenschaften<br />
• Pflegerelevante Kenntnisse der Naturwissenschaften und der Medizin<br />
• Pflegerelevante Kenntnisse der Geistes- und Sozialwissenschaften<br />
• Pflegerelevante Kenntnisse aus Recht, Politik und Wirtschaft<br />
**************<br />
angesprochene Themenbereiche (KrPflAPrV §1.1 – Anl.1) / Lernfelder Rahmenrichtlinien<br />
Niedersachsen:<br />
• Pflegesituationen bei Menschen aller Altersgruppen erkennen, erfassen und bewerten<br />
(Tb 1 u. 5)<br />
• Pflegemaßnahmen auswählen, durchführen und dokumentieren (Tb 2)<br />
• Pflegebedürftige und Angehörige beraten, anleiten und unterstützen / Bei Maßnahmen<br />
der Gesundheitsförderung und Prävention mitwirken (Tb 3)<br />
• Pflegequalität sichern (Tb 6 u. 7)<br />
• Pflegerisches Handeln bei medizinischer Diagnostik und Therapie (Tb 8)<br />
• Pflege als Beruf ausüben (Tb 10 u. 11)<br />
• In Gruppen und Teams zusammenarbeiten (Tb 12)<br />
<strong>Frau</strong> <strong>Feldmann</strong><br />
(Die folgende Fallsituation basiert auf einem transkribierten Interview mit einer Gesundheits-<br />
und Krankenpflegerin mit langjähriger Erfahrung auf einer onkologischen<br />
Station Zu der Fallbeschreibung wurde eine Patientenakte erstellt. Für diese Akte<br />
wurden die anonymisierten Daten eines vergleichbaren Falls übernommen.)<br />
Teil 1 – Fallsituation mit Patientenakte:<br />
Seit dem 5. September 2006 liegt Claudia <strong>Feldmann</strong> auf der hämatologischen/onkologischen<br />
Station im Diako-Krankenhaus. Sie ist 35 Jahre alt, verheiratet<br />
und hat einen fünfjährigen Sohn und eine zwölfjährige Tochter.<br />
<strong>Frau</strong> <strong>Feldmann</strong> hat seit ca. 5 Wochen das Gefühl, dass „etwas nicht stimmt“, wie sie<br />
im Anamnesegespräch mit dem Arzt berichtet. Sie habe immer wieder Fieberschübe<br />
bis 39°C mit Schüttelfrost ohne jegliche anderen Sy mptome gehabt. Außerdem habe<br />
sie bemerkt, dass ihr häufiger das Zahnfleisch angeschwollen sei.<br />
Anfang 2005 war bereits einmal bei <strong>Frau</strong> <strong>Feldmann</strong> eine akute myeloische Leukämie<br />
diagnostiziert und sofort mit Chemotherapie sowie später mit einer Stammzelltransplantation<br />
erfolgreich behandelt worden. Die Diagnose lautet nun „Rezidiv einer akuten<br />
myeloischen Leukämie“ und es wurde bereits mit der Therapie (Zytostatikagabe)<br />
begonnen.<br />
Aktuell wird <strong>Frau</strong> <strong>Feldmann</strong> isoliert und leidet sehr unter den Nebenwirkungen der<br />
Chemotherapie, insbesondere unter den Schleimhautdefekten im Mund- und Nasenbereich.<br />
Teil 2 – Interviewauszug (wurde leicht modifiziert):<br />
„PA: … Und es war, das muss ich dazu sagen, eine Patientin, die sehr in sich gekehrt<br />
war, und bei der wir das Problem hatten, dass sie selber von sich aus ganz wenig<br />
erzählt hat, überhaupt sehr wenig gesprochen hat und wir kamen gar nicht<br />
so an sie ran. Über ein Buch, das sie gelesen hat, und das ich selber auch<br />
kannte, habe ich dann versucht, sie ein bisschen aus der Reserve zu locken.<br />
I: Was hat sie gelesen?<br />
PA: Den Titel, habe ich gerade überlegt, weiß ich nicht mehr genau, es ging um eine<br />
Mutter-Kind-Beziehung und ich habe gesagt, dass das ein sehr schöne Buch ist<br />
und da hat sie „Ja“ gesagt und fing an zu weinen. Sie hat dann noch gesagt, da<br />
würde sie sich wieder finden. Und darauf bin ich eingestiegen und habe gefragt:<br />
„In wiefern denn“. Sie hat mir erzählt, dass sie ja zwei Kinder zu Hause hätte,<br />
und so etwa: ‚Ich muss doch für meine Kinder noch da sein, was soll mit meinen<br />
Kindern passieren, wenn ich sterbe?‘. Da hatte sie sich also schon mit auseinander<br />
gesetzt. Das war der eine Punkt, über den sie sich geäußert hat, und<br />
wo wir dann auch wussten, warum sie so introvertiert war.<br />
Ein zweiter Punkt war, dass sie so entstellt war im Gesicht, und sie wollte keinerlei<br />
Besuch haben. Aber auf der anderen Seite wollte sie schon ihre Kinder<br />
sehen, weil sie Angst hatte, sie könnte sterben, deshalb wollte sie ihre Kind<br />
auch sehen, aber sie wollte den Kindern ihr Aussehen nicht zumuten. Und da<br />
die Nase defekt war, es lief da auch alles raus, haben wir uns überlegt, was wir<br />
da machen können…“
Markt der Möglichkeiten – <strong>Stand</strong> G: „<strong>Frau</strong> <strong>Feldmann</strong>“ Sabine Muths, Universität <strong>Bremen</strong><br />
3<br />
Bildungsinhalte / -ziele:<br />
Zielebene: Pflegende Pat./Angehörige Institution/Gesell. pfleger. Handeln<br />
Technisches<br />
Erkenntnisinteresse<br />
= Wissenschaftsorientierung<br />
/<br />
technischinstrumentell<br />
/<br />
Wissen u. Fertigkeiten<br />
(SchülerInnen<br />
nennen / erklären<br />
z.B.…)<br />
• Auswirkungen beruflicher<br />
Belastungen<br />
auf die Gesundheit<br />
(physisch<br />
und psychisch)<br />
• Risiken berufliche<br />
Belastung in helfenden<br />
Berufen -<br />
Statistische Aussagen<br />
zu den beruflichen<br />
Belastungen<br />
in verschiedenen<br />
Arbeitsfeldern der<br />
Pflege und ihren<br />
Aussagen auf die<br />
Gesundheit der<br />
Pflegenden<br />
• Möglichkeiten der<br />
Entlastung in belastenden<br />
beruflichen<br />
Handlungsfeldern<br />
• Einflussmöglichkeiten<br />
von Pflegenden<br />
auf die Gestaltung<br />
eines entlastenden<br />
Arbeitsklimas<br />
• Krankheitsbild Leukämie<br />
o Entstehung (incl. Anatomie/Physiologie/Pathophysiologie des<br />
Blutes und des Immunsystems),<br />
o Krankheitsgeschehen/Diagnostik/Typisierung d. Angehörigen<br />
(Laboruntersuchungen)<br />
o Verläufe, Prognosen<br />
• Therapeutische Möglichkeiten – Knochenmarkstransplantation /<br />
Stammzellentransplantation – Verfahren, Vorteile / Risiken<br />
o Mechanismus d. Zytostase / Chemotherapie– erwünschte Wirkungen<br />
und Nebenwirkungen<br />
o die Vorbeugung von Nebenwirkungen<br />
o den Umgang mit Nebenwirkungen Müdigkeit und Erschöpfung<br />
("Fatigue") , Schmerzen, Ernährungs- und Ausscheidungsprobleme<br />
(Inappetenz, Übelkeit, Erbrechen, Obstipation),<br />
Haar-, Haut- und Schleimhautprobleme (Veränderungen<br />
der Mundschleimhaut, Haarausfall, Juckreiz, Ikterus)<br />
• Weitere/ergänzende medikamentöse Behandlungen (Antibiose /<br />
Morphine / …) – Nebenwirkungen und Wechselwirkungen mit<br />
anderen Medikamenten, mit der Erkrankung<br />
• Isolierverfahren – Beachtung der Hygieneregeln als Selbstschutz<br />
(Mundpflege, Kontrolle der Ausscheidungen, Beachten von Einblutungen)<br />
• Prophylaxe und Therapie von Blutungen, Lymphödemen, Infektionen<br />
• Verhaltensmaßnahmen nach dem Krankenhausaufenthalt /<br />
Leben mit stark eingeschränkten Abwehrkräften<br />
• Leben mit existentiellen Krisen – theoretische Erklärungsmodelle<br />
(z.B. Verlaufskurvenmodell v. Corbin/Strauss)<br />
• Unterstützungsmöglichkeiten bei der häuslichen Versorgung der<br />
Familie / Finanzierung<br />
• Beratungsstellen für Krebskranke und ihre Angehörigen<br />
• Umgang mit Belastungsgrenzen im häuslichen Umfeld<br />
• Umgang mit Schutzmaßnahmen während des Besuches<br />
• Studien über den Einfluss des individuellen Wohlbefindens/sozialer<br />
Kontakte auf die Stärkung des Immunsystems und<br />
den Gesundungsprozess bei schweren Krankheitsverläufen<br />
• Gestaltung und Organisation<br />
einer Umkehrisolation<br />
• Case-Management mit Beginn<br />
der Diagnosestellung (medizinisch<br />
/ pflegerisch) – Zusammenarbeit<br />
der Abteilungen<br />
Medizin – Pflege – Sozialberatung<br />
o Case Management Regelkreis:<br />
Identifikation, Assessment,<br />
Entwicklung des Versorgungsplans,<br />
Implementation<br />
des Versorgungsplans,<br />
Monitoring und Re-<br />
Assessment, Evaluation und<br />
Abschluss<br />
o Case Management Funktionen<br />
(anwaltschaftliche, vermittelnde<br />
und selektierende<br />
Funktion)<br />
o Clincal-Pathway im Fallbeispiel<br />
• Organisation von Möglichkeiten<br />
der Sozialberatung für die<br />
Patientin (Aufgaben für Sozialberatung,<br />
Seelsorge, Psychologen<br />
…- Zusammenarbeit<br />
der Berufsgruppen)<br />
• Finanzierung – Abrechnung<br />
über DRG’s – Kosten des<br />
Drehtüreffekts<br />
• Institutionelle Sorge für Entlastungsmöglichkeiten<br />
der Mitarbeiter<br />
/ Gestaltung eines entlastenden<br />
Arbeitsklimas<br />
• Vorbereitung der Laboruntersuchung<br />
• Assistenz bei Punktionen-<br />
Assistenz bei der Knochenmarkpunktion<br />
(Vorbereitung,<br />
Lagerung und Nachsorge des<br />
Patienten, Sofortmaßnahmen<br />
bei Komplikationen)<br />
• Pflegemaßnahmen beim Auftreten<br />
von Nebenwirkungen<br />
der Zytostase<br />
• Pflegehandeln unter den Bedingungen<br />
des Isolationsverfahrens<br />
– Maßnahmen extremer<br />
Keimreduzierung – Anleitung<br />
zur Selbstpflege in der<br />
häuslichen Versorgung (z.B.<br />
am Beispiel Mundpflege, Beachtung<br />
der Thrombopenie …)<br />
• Umgang mit Zytostatika<br />
• Umgang mit Antibiose<br />
• Umgang mit speziellen venösen<br />
Zugängen (Sheldon-<br />
Katheter, Groshong-, Hohn-,<br />
Port-…) – Versorgung, Umgang<br />
mit Nahrung, Medikation<br />
/ Wechsel der Nadel<br />
• Organisation der pflegerischen<br />
Anteile des Case-Management<br />
o Abläufe während des Krankenhausaufenthaltes<br />
o Überleitung in die häusliche<br />
Versorgung<br />
• Zusammenarbeit mit Sozialarbeitern<br />
/ Psychologen / Seelsorgern<br />
in der Institution
Markt der Möglichkeiten – <strong>Stand</strong> G: „<strong>Frau</strong> <strong>Feldmann</strong>“ Sabine Muths, Universität <strong>Bremen</strong><br />
4<br />
Praktisches<br />
Erkenntnisinteresse<br />
= Verständigungsorientierung<br />
(SchülerInnen<br />
nehmen wahr<br />
/verstehen / verständigen<br />
sich<br />
z.B. über …)<br />
• Enttäuschen darüber,<br />
das gut gemeinte<br />
Hilfs- und<br />
Unterstützungsangebote<br />
abgelehnt<br />
werden<br />
• Angst vor der Begegnung<br />
mit schwerer,<br />
tödlicher Erkrankung<br />
und mit<br />
Trauer<br />
• Belastung durch<br />
Leid und Todesnähe<br />
• Angst durch Übertragungsphantasien<br />
der lebensbedrohlichen,<br />
leidvollen Situation<br />
der Patientin<br />
auf sich selbst oder<br />
auf nahe stehende<br />
Personen<br />
Unterricht zum<br />
Thema „Begegnung<br />
mit Tod, Trauer und<br />
Leid in der Pflege“<br />
sollte vorausgegangen<br />
sein<br />
Bezogen auf mögliche Gedanken, Gefühle und Gründe für das<br />
Verhalten von <strong>Frau</strong> <strong>Feldmann</strong>:<br />
• den Rückzug der Patientin<br />
• Sorge um das Kind „Dasein müssen“<br />
• Wunsch, das Kind zu sehen<br />
• Sterben / loslassen wollen<br />
• Angst vor dem Sterben, vor Leid und Schmerz<br />
• Scham über die Entstellung im Gesicht, den äußeren Verfall<br />
Bezogen auf mögliche Gedanken, Gefühle und Gründe für das<br />
Verhalten von Angehörigen:<br />
• dass Ehemann ihr Leid nicht ertragen kann<br />
• Ehemann will Patientin besuchen (- fühlt sich verpflichtet?)<br />
• Kind möchte seine Mutter sehen<br />
• Pflege und medizinische Versorgung<br />
kostengünstig und effektiv<br />
gestalten, d.h. Verweildauer<br />
kurz halten und gleichzeitig<br />
Drehtüreffekte vermeiden<br />
• Isolierung der Patientin und<br />
Rahmung für eine individuelle<br />
Gestaltung der Umkehrisolation<br />
• Umgang mit „zurückgezogenen“<br />
Patienten / Gespräche<br />
mit Patienten und Angehörigen<br />
unter existentiell belastenden<br />
Bedingungen Gespräche<br />
mit der Patientin und ihren Angehörigen<br />
führen unter den<br />
besonderen Bedingungen der<br />
belastenden Situation<br />
• Bewältigungsstrategien mit der<br />
Patientin herausfinden<br />
• Abwägen zwischen hygienischen<br />
Vorschriften und psychischer<br />
Stärkung der Patientin<br />
durch soziale Kontakte<br />
• Einbeziehung von Partnern /<br />
Kindern und Angehörigen<br />
• Mit der Patientin den Besuch<br />
der Angehörigen vorbereiten<br />
• Mit Patientin und Ehemann die<br />
häusliche Versorgung planen<br />
Beratung/Information zum<br />
Umgang mit Belastungsgrenzen<br />
– Gestaltung von Unterstützungssystemen<br />
• Verlaufskurvenarbeit Anwendung<br />
theoretischer Erklärungsmodelle<br />
(z.B. Verlaufenkurvenmodell<br />
– Corbin/Strauss)<br />
auf die Situation<br />
der Patientin Vordenken<br />
von Perspektiven und möglichen<br />
Verläufen
Markt der Möglichkeiten – <strong>Stand</strong> G: „<strong>Frau</strong> <strong>Feldmann</strong>“ Sabine Muths, Universität <strong>Bremen</strong><br />
5<br />
Emanzipatorisches<br />
Erkenntnisinteresse<br />
= Reflexions und<br />
Kritikorientierung<br />
(SchülerInnen<br />
reflektieren z.B.<br />
den Widerspruch<br />
zwischen…)<br />
• individuelle Enttäuschung<br />
über mangelnde<br />
Kommunikationsbereitschaft<br />
einerseits<br />
und dem<br />
Anspruch verständnisvoll<br />
und professionell<br />
zu handeln<br />
(und dabei eigene<br />
Gefühle zurückzustellen)<br />
• der Arbeit in belastenden,<br />
traurigen Situationen<br />
und dem<br />
Bedürfnis nach<br />
Fröhlichkeit / Abwehr<br />
von Leid<br />
• der Abwehr eigenen<br />
Leids, eigener Traurigkeit<br />
durch Konzentration<br />
auf das<br />
Leid von anderen<br />
• der Ablehnung von Besuch und dem Bedürfnis, sich zurückziehen<br />
wollen (= Bedürfnis nach Ich-Bezogenheit und Abgrenzung)<br />
und dem Wunsch Kinder und Ehemann sehen zu wollen (= Bedürfnis<br />
nach sozialen Kontakten und Nähe)<br />
• dem Anspruch für die Kinder da zu sein, da sein zu müssen und<br />
dem Bedürfnis, loslassen zu wollen, bzw. dem Gefühl, nicht für<br />
die Kinder da sein zu können, bzw. dem Gefühl der Trauer, sie<br />
verlassen zu müssen<br />
• der Erfahrung und dem bewussten Erleben einer belastenden,<br />
traurigen Situation einerseits und dem Bedürfnis nach Fröhlichkeit<br />
/ und nach Abwehr von Leid andererseits<br />
• der regelgeleiteten Strukturierung<br />
von Abläufen (hier Umkehrisolierung)<br />
im Interesse<br />
der Sicherheit der Patientin einerseits<br />
und dem Leitbild, Entscheidungs-<br />
und Gestaltungsspielräumen<br />
für das individuelle<br />
Wohl der Patientin schaffen<br />
zu wollen, anderseits<br />
• der klaren Strukturierung und<br />
Abgrenzung von Arbeitsabläufen<br />
durch (hierarchische) Gliederung<br />
der Zusammenarbeit<br />
zwischen den Berufsgruppen<br />
innerhalb des Case-<br />
Managements einerseits und<br />
dem Anspruch eine möglichst<br />
gleichberechtigte Zusammenarbeit<br />
auf Augenhöhe in den<br />
Team zu ermöglichen andererseits<br />
(= entspricht dem Widerspruch<br />
zwischen unterschiedlichen<br />
Führungsstilen<br />
• einer biomedizinisch begründeten<br />
und einer als psychosozial<br />
stabilisierend begründeten<br />
Maßnahme: Schutz der Patientin<br />
vor Infektionen (Isolierung<br />
– v.a. auch vor dem Besuch<br />
von Kindern) – vs. Erhöhung<br />
der Heilungschancen<br />
durch soziale Kontakte (Mutterbindung)<br />
• der Sicherung der<br />
Interessen der eigenen<br />
Berufsgruppe<br />
/ omnipotente<br />
Übernahme möglichst<br />
vieler Aufgaben<br />
bei der Betreuung<br />
der Patientin<br />
und dem Anspruch/<br />
Wunsch nach Zusammenarbeit<br />
im<br />
therapeutischen<br />
Team
Markt der Möglichkeiten – <strong>Stand</strong> G: „<strong>Frau</strong> <strong>Feldmann</strong>“ Sabine Muths, Universität <strong>Bremen</strong><br />
6<br />
14 h<br />
Einstieg: Teil 1<br />
SchülerInnen erarbeiten Lernfragen<br />
aus Fallbeschreibung u. Akte<br />
Methodische Anregungen: Partnerarbeit<br />
- Klassengespräch mit Moderationskarten<br />
Lernsequenz 1<br />
Medizinische und pflegerische<br />
Versorgung der Patientin<br />
Die SchülerInnen<br />
1. entnehmen der Patientenakte und den<br />
Krankenblättern fallbezogene Informationen<br />
2. nennen und erklären die medizinischen<br />
Hintergründe des Krankheitsgeschehens<br />
3. erläutern therapeutische Möglichkeiten<br />
und deren Durchführung<br />
4. leiten Handlungsregeln für die Versorgung<br />
der Patientin ab<br />
5. versorgen die Patientin regelgeleitet<br />
• beachten dabei die Notwendigkeit<br />
des Selbstschutzes<br />
• erläutern ihr Handeln der Patientin<br />
und leiten sie zur Selbstpflege an<br />
• beachten Aspekte von Ökonomie<br />
und Ökologie<br />
Methodische Anregungen:<br />
‚Arbeit mit der Patientenakte<br />
- Lehrer-Schüler-Gespräch zu den medizinischen<br />
Hintergründen des Fallbeispiels<br />
- Entwicklung einer Pflegeplanung für die<br />
Patientin<br />
- Selbstevaluation der Pflegeplanung anhand<br />
der <strong>Stand</strong>ards/Pflegeleitlinien des<br />
Krankenhauses<br />
- kritische Reflexion der eigenen Pflegeplanung<br />
anhand der Unterschiede, die bei<br />
dieser Evaluation deutlich werden<br />
Anbindung im Lernfeld zum<br />
Thema: „Pflege und medizinische<br />
Versorgung tumorkranker<br />
Menschen“<br />
Einstieg: Teil 2<br />
SchülerInnen eignen sich die Situation im<br />
Fall aus der Perspektive der Pflegenden an<br />
– benennen Gefühle und Assoziationen.<br />
Methodische Anregungen: Brainstorming,<br />
Sammlung auf Flip-Chart<br />
4 h<br />
Lernsequenz 2<br />
Die psychische Belastung der Patientin <br />
Konsequenzen für das Pflegehandeln<br />
Die SchülerInnen.<br />
1. verstehen und deuten die verschiedenen Motive der<br />
Patientin.<br />
2. verstehen und deuten Motive der Kinder und des<br />
Ehepartners<br />
3. verstehen und deuten mögliche Motive von MitarbeiterInnen<br />
in der Institution<br />
4. treffen fallbezogene Handlungsentscheidungen in<br />
Bezug auf die Besuchsregelung für die Patientin in<br />
Abwägung von Regelwissen und Fallverstehen<br />
Methodische Anregungen:<br />
Variante 1:<br />
Planspiel: 4 – 5 Gruppen, die die Position von Pflegekräften<br />
mit unterschiedlichen Informationen erarbeiten<br />
z.B.:<br />
A – hat Gespräch mit Ehemann geführt<br />
B – zweites Gespräch mit der Patientin<br />
C – Gespräch mit Hygienefachkraft<br />
D - Gespräch mit Psychologe<br />
E – Gespräch mit Stationsärztin<br />
F – Begegnung mit den Kindern<br />
G – Gespräch mit Hausseelsorger<br />
anschließend Teamdiskussion nach dem Prinzip<br />
Gruppenpuzzle – Entscheidungsfindung zum Besuch<br />
der Kinder<br />
Vorstellung und Auswertung der Ergebnisse – Begründung<br />
und Analyse der Diskussionsprozesse<br />
Variante 2:<br />
Erarbeitung und Deutung der Perspektiven und Gefühle<br />
mit Hilfe von <strong>Stand</strong>bildern /inneren Dialogen /<br />
Rollenspiel / szenische Diskussion bzw. auch perspektivisches<br />
Schreiben<br />
Teamdiskussion: Erstellung einer Leitlinie – Besuchsregelung<br />
für Kinder unter 5 Jahre im Rahmen<br />
der Cytostatikatherapie<br />
4 h<br />
Lernsequenz 3<br />
Entlassung und Überleitung der Patientin in das<br />
häusliche Umfeld<br />
Die SchülerInnen<br />
1. planen fallbezogen die Entlassung der Patientin in das häusliche<br />
Umfeld, wobei der Schwerpunkt auf einem idealtypischen, regelgeleiteten<br />
Entlassungsmanagement liegt. Sie erarbeiten sich fallbezogen<br />
Wissen zum Entlassungsmanagement (Expertenstandard)<br />
und wenden dieses an.<br />
2. vollziehen den Ablauf des Clincal-Pathway im Fallbeispiel nach /<br />
Vernetzung innerhalb der Abteilungen des Krankenhauses (Sozialdienst,<br />
Seelsorge...)<br />
3. informieren sich über die Finanzierung der Pflege der Patientin –<br />
Abrechnung über DRG’s und Senkung der Kosten eines Drehtüreffekts<br />
durch gut geplantes Entlassungsmanagement<br />
4. formulieren Anforderungen an die ambulante Versorgung der<br />
Patientin und kennen Möglichkeiten der Inanspruchnahme weiterer<br />
Hilfssysteme – Sozialdienste, Familienhilfe ...<br />
5. planen Information/Beratung der Patientin / ihrer Angehörgen<br />
• empfehlen begründet Verhaltensmaßnahmen nach dem Krankenhausaufenthalt<br />
in Bezug auf das Leben mit stark eingeschränkten<br />
Abwehrkräften<br />
• planen Beratung zum Umgang mit Belastungsgrenzen und zur<br />
Gestaltung von Unterstützungssystemen<br />
Methodische Anregungen:<br />
Variante 1:<br />
Die Schüler entwickeln ohne theoretische Voraussetzung zum<br />
Überleitungsmanagement die Planung der Überleitung der Patientin<br />
Sie überprüfen ihre Planung anhand eines anschließenden theoretischen<br />
Inputs, der Auseinandersetzung m.d. Expertenstandard<br />
Methodenvariante 2:<br />
Vermittlung der theoretischen Grundlagen zu Überleitungs-<br />
/Entlassungsmanagement (incl. Expertenstandard)<br />
Sie wenden die unterschiedlichen Konzepte auf das Fallbeispiel<br />
an<br />
Methodenvariante 3:<br />
Teilung der Klasse<br />
die eine Gruppe erarbeitet den Expertenstandard<br />
die andere Gruppe erarbeitet Überleitung ohne Vorwissen<br />
Reflexion des Ergebnisses der „Praktiker“ durch die „Theoretiker“<br />
Anbindung im Lernfeld zum Thema:<br />
„Überleitungspflege u. Case-Management“