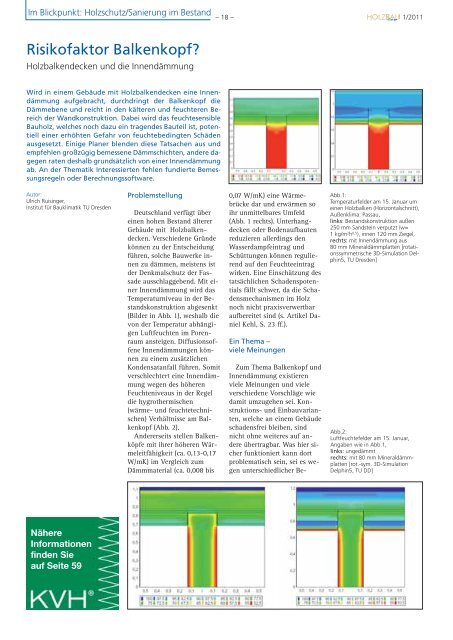Risikofaktor Balkenkopf? - Quadriga
Risikofaktor Balkenkopf? - Quadriga
Risikofaktor Balkenkopf? - Quadriga
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Im Blickpunkt: Holzschutz/Sanierung im Bestand<br />
–18–<br />
1/2011<br />
<strong>Risikofaktor</strong> <strong>Balkenkopf</strong>?<br />
Holzbalkendecken und die Innendämmung<br />
Wird in einem Gebäude mit Holzbalkendecken eine Innendämmung<br />
aufgebracht, durchdringt der <strong>Balkenkopf</strong> die<br />
Dämmebene und reicht in den kälteren und feuchteren Bereich<br />
der Wandkonstruktion. Dabei wird das feuchtesensible<br />
Bauholz, welches noch dazu ein tragendes Bauteil ist, potentiell<br />
einer erhöhten Gefahr von feuchtebedingten Schäden<br />
ausgesetzt. Einige Planer blenden diese Tatsachen aus und<br />
empfehlen großzügig bemessene Dämmschichten, andere dagegen<br />
raten deshalb grundsätzlich von einer Innendämmung<br />
ab. An der Thematik Interessierten fehlen fundierte Bemessungsregeln<br />
oder Berechnungssoftware.<br />
Autor:<br />
Ulrich Ruisinger,<br />
Institut für Bauklimatik TU Dresden<br />
Problemstellung<br />
Deutschland verfügt über<br />
einen hohen Bestand älterer<br />
Gebäude mit Holzbalken -<br />
decken. Verschiedene Gründe<br />
können zu der Entscheidung<br />
führen, solche Bauwerke innen<br />
zu dämmen, meistens ist<br />
der Denkmalschutz der Fassade<br />
ausschlaggebend. Mit einer<br />
Innendämmung wird das<br />
Temperaturniveau in der Bestandskonstruktion<br />
abgesenkt<br />
(Bilder in Abb. 1), weshalb die<br />
von der Temperatur abhängigen<br />
Luftfeuchten im Porenraum<br />
ansteigen. Diffusionsoffene<br />
Innendämmungen können<br />
zu einem zusätzlichen<br />
Kondensatanfall führen. Somit<br />
verschlechtert eine Innendämmung<br />
wegen des höheren<br />
Feuchteniveaus in der Regel<br />
die hygrothermischen<br />
(wärme- und feuchtetechnischen)<br />
Verhältnisse am <strong>Balkenkopf</strong><br />
(Abb. 2).<br />
Andererseits stellen Balkenköpfe<br />
mit ihrer höheren Wärmeleitfähigkeit<br />
(ca. 0,13-0,17<br />
W/mK) im Vergleich zum<br />
Dämmmaterial (ca. 0,008 bis<br />
0,07 W/mK) eine Wärmebrücke<br />
dar und erwärmen so<br />
ihr unmittelbares Umfeld<br />
(Abb. 1 rechts). Unterhangdecken<br />
oder Bodenaufbauten<br />
reduzieren allerdings den<br />
Wasserdampfeintrag und<br />
Schüttungen können regulierend<br />
auf den Feuchteeintrag<br />
wirken. Eine Einschätzung des<br />
tatsächlichen Schadenspotentials<br />
fällt schwer, da die Schadensmechanismen<br />
im Holz<br />
noch nicht praxisverwertbar<br />
aufbereitet sind (s. Artikel Daniel<br />
Kehl, S. 23 ff.).<br />
Ein Thema –<br />
viele Meinungen<br />
Zum Thema <strong>Balkenkopf</strong> und<br />
Innendämmung existieren<br />
viele Meinungen und viele<br />
verschiedene Vorschläge wie<br />
damit umzugehen sei. Konstruktions-<br />
und Einbauvarianten,<br />
welche an einem Gebäude<br />
schadensfrei bleiben, sind<br />
nicht ohne weiteres auf andere<br />
übertragbar. Was hier sicher<br />
funktioniert kann dort<br />
problematisch sein, sei es wegen<br />
unterschiedlicher Be-<br />
Abb.1:<br />
Temperaturfelder am 15. Januar um<br />
einen Holzbalken (Horizontalschnitt),<br />
Außenklima: Passau,<br />
links: Bestandskonstruktion außen<br />
250 mm Sandstein verputzt (w=<br />
1 kg/m 2 h 0,5 ), innen 120 mm Ziegel,<br />
rechts: mit Innendämmung aus<br />
80 mm Mineraldämmplatten [rotationssymmetrische<br />
3D-Simulation Delphin5,<br />
TU Dresden]<br />
Abb.2:<br />
Luftfeuchtefelder am 15. Januar,<br />
Angaben wie in Abb.1,<br />
links: ungedämmt<br />
rechts: mit 80 mm Mineraldämmplatten<br />
[rot.-sym. 3D-Simulation<br />
Delphin5, TU DD]<br />
Nähere<br />
Informationen<br />
finden Sie<br />
auf Seite 59
1/2011<br />
–19–<br />
Im Blickpunkt: Holzschutz/Sanierung im Bestand<br />
standsmaterialien oder anderer<br />
klimatischer Randbedingungen.<br />
Beispielsweise kann eine<br />
sorgfältig verarbeitete Innendämmung<br />
mit Mineralwolle<br />
und Dampfbremse/-sperre in<br />
dem einem Gebäude durchaus<br />
funktionieren. In einem anderen,<br />
exponierten Gebäude<br />
ohne ausreichenden Schlag<br />
regenschutz dagegen sind<br />
Schädigungen zu befürchten.<br />
Warum? Durch dampfbremsende/-sperrende<br />
Schichten<br />
auf der Innenseite wird das<br />
Austrocknungspotential nach<br />
innen stark reduziert: Die<br />
Wand bleibt länger feucht<br />
(Abb. 3).<br />
Auch in historischen Gebäuden<br />
wurde oft darauf geachtet,<br />
Mauerwerksfeuchte<br />
vom <strong>Balkenkopf</strong> fernzuhalten:<br />
mit einem Luftspalt um den<br />
<strong>Balkenkopf</strong> und durch ein<br />
Auflager aus feuchteresistentem<br />
Holz (z.B. Lärche) oder<br />
Teerpappe wurde die kapillare<br />
Trennung realisiert (Abb. 4).<br />
Wird der Luftspalt mit kapillar<br />
leitfähigem Material, z.B. Bauschutt,<br />
aufgefüllt, besteht die<br />
Gefahr, dass hohe Luftfeuchten<br />
im Mauerwerk auch mittels<br />
Kapillartransport den <strong>Balkenkopf</strong><br />
befeuchten.<br />
Der „luftumspülte“<br />
<strong>Balkenkopf</strong><br />
Ein Arbeitskreis der WTA<br />
e.V. (www.wta.de) im Referat 8<br />
(Fachwerk/Holzkonstruktionen)<br />
setzt sich derzeit mit Balkenköpfen<br />
in einem eigenen<br />
Merkblatt auseinander. Darin<br />
wird auch der Begriff „luftumspült“<br />
behandelt, welcher<br />
im Zusammenhang mit Balkenköpfen<br />
häufig Erwähnung<br />
findet. „Luftumspült“ ist nicht<br />
eindeutig definiert und wird<br />
entweder dahingehend interpretiert,<br />
dass damit der bloße<br />
Luftspalt um den <strong>Balkenkopf</strong><br />
gemeint sei. Andere verstehen<br />
darunter, dass dieser Luftspalt<br />
zusätzlich über eine (umlaufende)<br />
Fuge mit dem Innen-<br />
Abb. 3:<br />
Schlechte Kombination: Nicht ausreichender<br />
Schutz vor eindringendem<br />
Schlagregen in Verbindung mit einem<br />
stark diffusionsbremsenden/-sperrendem<br />
Innendämmsystem<br />
Abb. 4:<br />
Kapillare Entkopplung des Holzbalkenkopfes<br />
von angrenzenden Bauteilen<br />
durch einen Luftraum und eine<br />
kapillar sperrende Bahn auf dem Auflager<br />
(Anforderungen lt. DIN 68800-<br />
Anzeige<br />
Fortschritt ist Programm<br />
Energieeffizienz<br />
und Design –<br />
jetzt auch auf<br />
Maß!<br />
Roto Designo R8/R6 MR<br />
Austausch unabhängig von<br />
Baujahr, Hersteller und Größe<br />
Einfacher Einbau von innen; keine<br />
Brech-, Putz- und Folgearbeiten<br />
Lieferung in 8 Arbeitstagen<br />
Roto – Premiumqualität „made<br />
in Germany“*. Mehr Infos zu Roto<br />
Designo unter www.roto-frank.com<br />
* Über 90 % unserer Produkte
Im Blickpunkt: Holzschutz/Sanierung im Bestand<br />
–20–<br />
1/2011<br />
Abb. 5:<br />
Luftfeuchtefelder von aero-hygrothermischen<br />
2D-Simulationen mit Delphin4<br />
bei unterschiedlichen Lufteintrittsgeschwindigkeiten:<br />
250 mm di -<br />
ckes Ziegelmauerwerk mit 30 mm<br />
Calciumsilikatinnendämmung, Innenklima:<br />
20°C/50%, Außenklima<br />
0°C/60% [Gnoth 2007], Vertikalschnitt<br />
Abb. 6:<br />
Konvektionshemmender Anschluss<br />
der Innendämmung an den Holzbalken<br />
durch vorkomprimierte Dichtungsbänder<br />
oder Mörtelverstrich<br />
Anzeige<br />
Typ TL/FG<br />
Innovation<br />
im Standard<br />
Tele-Anhänger als Wechselsystem<br />
Teleskop-Chassis, um 3 m ausziehbar<br />
Teleskop-Wechselpritsche<br />
Ladehöhe durchgängig 780 mm<br />
Ladelängen bis 13 m<br />
Zul. Ges. Gew. 16.000 kg - 24.000 kg<br />
Informationen unter +49 9234 9914-0 oder www.auwaerter.com.<br />
raum verbunden ist. Durch die<br />
Fuge soll warme Innenluft<br />
strömen und im Winter die<br />
kalte Außenseite des <strong>Balkenkopf</strong>s<br />
erwärmen. Andererseits<br />
nimmt diese Luftzufuhr immer<br />
auch Raumluftfeuchte mit.<br />
Dass letztere Auslegungsvariante<br />
in historischen Gebäuden<br />
nicht zu Schäden geführt<br />
hat, ist durchaus möglich.<br />
Allerdings war in früheren<br />
Zeiten der Wasserdampfgehalt<br />
der Raumluft z.B. wegen<br />
undichter Fenster oder<br />
geringerer Feuchteproduktion<br />
niedriger als heute.<br />
Der vorrangige Zweck des<br />
Luftspalts um den <strong>Balkenkopf</strong><br />
ist jedoch in der Funktion als<br />
„kapillar brechende Schicht“<br />
zu sehen. Strömt eine kritische<br />
Menge feuchtwarme<br />
Raumluft in den Luftspalt um<br />
den <strong>Balkenkopf</strong>, kühlt diese<br />
ab und verursacht eine Erhöhung<br />
der Feuchte (Abb. 5). Ist<br />
die eingebrachte Luftmenge<br />
bzw. Einlassgeschwindigkeit<br />
wiederum groß genug, wird<br />
der Luftspalt laut [Gnoth<br />
2007] ausreichend erwärmt.<br />
Unter baupraktischen Gegebenheiten<br />
sind letztere Geschwindigkeiten<br />
> 0,1 m/s<br />
über einen längeren Zeitraum<br />
hinweg allerdings nicht realis -<br />
tisch.<br />
Im WTA-Merkblatt wird<br />
deshalb ein konvektionshemmender<br />
Anschluss empfohlen,<br />
nicht zuletzt auch wegen<br />
schallschutz- und brandschutztechnischer<br />
Anforderungen.<br />
Konvektionshemmend<br />
meint, dass z.B. durch Kompressionsbänder<br />
oder Mörtelverstrich<br />
der Eintritt von<br />
Raumluft in den Bereich um<br />
den <strong>Balkenkopf</strong> weitgehend<br />
unterbunden wird (Abb. 6).<br />
Mörtel ist zwar weniger elastisch,<br />
damit lassen sich jedoch<br />
auch Risse im Holz verschließen.<br />
Hygrothermische Simulation<br />
von Balkenköpfen<br />
Eine exakte Untersuchung<br />
von Balkenköpfen mittels hygrothermischer<br />
Simulationsprogramme<br />
ist derzeit mit<br />
Schwierigkeiten verbunden:<br />
Die erforderlichen 3D-Simulationen<br />
lassen sich mit hygrothermischen<br />
Programmen derzeit<br />
nur in der Forschung und<br />
nur rotationssymmetrisch, d.h.<br />
für runde Balken modellieren.<br />
Ebenso bereitet die Berücksichtigung<br />
von Luftströmungen<br />
und der anisotropen Eigenschaften<br />
des Holzes – unterschiedliche<br />
Wärme- und<br />
Feuchte-Leitfähigkeiten in Abhängigkeit<br />
von der Faserrichtung<br />
– Probleme. Gleichwohl<br />
können aus dem Vergleich solcher<br />
Varianten mit der gleichartig<br />
modellierten Bestandkonstruktion<br />
sinnvolle Schlüsse<br />
gezogen werden.<br />
Die eingangs (Abb. 1 und 2)<br />
angeführten 3D Beispiele eines<br />
runden Balkens, der in<br />
eine westorientierte Außenwand<br />
einbindet, erweisen sich<br />
als unkritisch (Abb. 7, Rechnung<br />
mit Delphin5).<br />
Neben den Mineraldämmplatten<br />
(l= 0,045W/mK) wird<br />
in Abbildung 7 auch eine<br />
Variante mit speziellen 80mm<br />
dicken Holzweichfaserdämmplatten<br />
(l= 0,045W/mK) abgebildet.<br />
Die Holzfeuchte der<br />
gedämmten Aufbauten verläuft<br />
vor allem im Winter ca.<br />
4 M-% oberhalb der ungedämmten<br />
Bestandskonstruktion,<br />
jedoch noch mit deutlichem<br />
Abstand zum Grenzwert<br />
der DIN 68800-3 von<br />
20 M-%.<br />
Dämmung im Deckenhohlraum:<br />
Tun oder lassen?<br />
Ob durchgehend zwischen<br />
den Deckenbalken gedämmt<br />
werden soll oder nicht, ist diskussionswürdig.<br />
Laut den<br />
Messergebnissen in einem<br />
Gründerzeitgebäude in Wiesbaden<br />
[Loga 2005] verläuft
1/2011<br />
–21–<br />
Im Blickpunkt: Holzschutz/Sanierung im Bestand<br />
der Wassergehalt im <strong>Balkenkopf</strong><br />
mit vollständiger Dämmung<br />
etwas höher als mit einer<br />
unterbrochenen. Zu bedenken<br />
sind hierbei allerdings<br />
die Feuchteverhältnisse auf<br />
den ungedämmten Wandoberflächen<br />
im Deckenhohlraum<br />
(Schimmel), vgl. S. 17.<br />
Austausch von Balken bei<br />
der Sanierung<br />
Werden im Zuge einer Sanierung<br />
geschädigte Balken<br />
ausgetauscht, so stellt sich die<br />
Frage, wie eine optimale Einbindung<br />
des neuen Balkens<br />
ausgeführt werden soll. Eine<br />
vor dem Hirnholz angebrachte<br />
Dämmschicht ist zwar durchaus<br />
sinnvoll, eine Wärmebrücke<br />
bleibt dennoch erhalten.<br />
In der Arbeitsfassung des<br />
erwähnten WTA-Merkblattes<br />
wird deshalb ein allseitig, d.h.<br />
fünfseitig, gedämmter <strong>Balkenkopf</strong><br />
befürwortet. Einschränkend<br />
wird gleichzeitig auf den<br />
sehr hohen Aufwand verwiesen<br />
(Aufstemmen der Mauerwerkstaschen,<br />
zeitaufwändige<br />
Dämmung). Nach Meinung<br />
des Verfassers erfüllen andere<br />
Sanierungsvarianten ebenfalls<br />
den erwünschten Zweck:<br />
• eine Innendämmung mit<br />
Schaumglas; die Holzbalken<br />
werden raumseitig ab der<br />
Dämmebene auf bis zu<br />
50cm Länge mit einer bituminösen<br />
Beschichtung bestrichen,<br />
die Anschlüsse<br />
werden ebenfalls dampfdicht<br />
ausgeführt [AkkP<br />
2005] oder<br />
• der Einsatz eines thermisch<br />
entkoppelten Stahlschwertes<br />
in [EnSan 2008].<br />
Grundsätzlich ist zu prüfen,<br />
ob solcher Sonderaufwand betrieben<br />
werden muss, wenn die<br />
Ursache der Schädigung des<br />
Balkens im Zuge der Sanierung<br />
beseitigt wurde und eine<br />
wieder tragfähige Decke mit<br />
zimmermannmäßigen Methoden<br />
hergestellt werden kann.<br />
Besonders kritisch:<br />
Sichtmauerwerk<br />
Die meisten Gebäude mit<br />
Holzbalkendecken haben verputze<br />
Fassaden. D.h. der erforderliche<br />
Schlagregenschutz<br />
kann entsprechend der lokalen<br />
Beanspruchung gewährleistet<br />
werden – entweder durch<br />
den Putz selber oder durch<br />
einen wasserabweisenden,<br />
aber diffusionsoffenen Anstrich.<br />
Unter dieser Voraussetzung<br />
gibt das WTA- Merkblatt<br />
6-4 der AG „Innendämmung<br />
im Bestand“ vereinfachte<br />
Nachweisregeln, die einen<br />
großen Teil des Bestandes und<br />
der möglichen Innendämmungssysteme<br />
abdecken<br />
[WTA 2009], s. Abb. 9, S. 16).<br />
Bei denkmalgeschützten<br />
Sichtfassaden ist in der Praxis<br />
zunächst ein fachmännische<br />
Begutachtung des Fugenbildes<br />
und der Saugfähigkeit der<br />
Steine erforderlich. Anderenfalls<br />
ist auf Dauer eine Wiederholung<br />
vorhandener Schadensverläufe<br />
zu erwarten –<br />
ganz unabhängig davon, ob<br />
eine Innendämmung aufgebracht<br />
wird oder nicht. Unter<br />
Umständen kann auf diffusionsoffene,<br />
hydrophobe Imprägnierungen<br />
zur Verminderung<br />
des Schlagregeneintrags oder<br />
chemischen Holzschutz zurückgegriffen<br />
werden.<br />
Balkenköpfe beheizen?<br />
Die Hochschule Lausitz beschäftigt<br />
sich schon seit Längerem<br />
mit aktiven und pas<br />
siven Maßnahmen der Wärmezufuhr<br />
an Balkenköpfen<br />
(Abb. 8). Bisherige Messungen<br />
bestätigen, dass aktive Maß-<br />
Abb. 7:<br />
Verlauf des Wassergehalts an der<br />
Stirnfläche des <strong>Balkenkopf</strong>s mit unterschiedlichen<br />
Dämmvarianten. Innenklima<br />
20°C/50%, Außenklima: Passau<br />
mit kaltem Winter (keine Anisotropie,<br />
minimaler Luftwechsel n = 0,05 1/h<br />
am <strong>Balkenkopf</strong>)<br />
Abb. 8:<br />
Prinzipskizze: Innendämmung wird<br />
unterbrochen, das Heizrohr wärmt die<br />
unmittelbare Umgebung auf<br />
Lohnabbund und Massiv-Holz-Mauer<br />
aus Sachsen<br />
Abbundzentrum Dahlen GmbH & Co. KG<br />
Anzeige<br />
- Massiv<br />
Gewerbestrasse 3 - Ökologisch, ohne Leim<br />
04774 Dahlen - Gesund und behaglich<br />
Tel.: +49 (0) 34361 - 532 52 - Schnell<br />
Fax: +49 (0) 34361 - 532 53 - Direkt vom Hersteller<br />
- Freies Bauen<br />
Internet: www.abbund-dahlen.de; E-Mail: info@abbund-dahlen.de
Im Blickpunkt: Holzschutz/Sanierung im Bestand<br />
–22–<br />
1/2011<br />
Abb. 9:<br />
Testhaus Dresden: Straßenansicht im<br />
Winter [Ulrich Ruisinger, TU Dresden<br />
2010]<br />
Abb. 10:<br />
Testhaus Dresden: mit Messsensoren<br />
versehener Holzbalken [Frank Meissner,<br />
TU Dresden 2010]<br />
Abb. 11:<br />
Testhaus Dresden: Verlauf von Temperatur<br />
(rot) und relativer Luftfeuchte im<br />
Luftspalt vor dem <strong>Balkenkopf</strong>, Innendämmung<br />
50 mm organisch/mineralische<br />
Dämmung WLS 031 [Frank<br />
Meissner, TU DD 2011]<br />
nahmen wie ein Heizungs bypass<br />
oder eine elektrische Begleitheizung<br />
die Situation am<br />
<strong>Balkenkopf</strong> verbessern können<br />
[Stopp et al 2010].<br />
Zu bedenken ist allerdings,<br />
dass derlei Maßnahmen bezüglich<br />
Zeitaufwand und<br />
Sorgfalt hohe Anforderungen<br />
an die Handwerker stellen und<br />
mit zusätzlichen Wärmeenergieverlusten<br />
verbunden sind,<br />
die den Einspareffekt einer<br />
derartigen Innendämmung in<br />
Frage stellen.<br />
Messungen in Testhäusern<br />
Derzeit liegen nur wenige<br />
Messungen an Balkenköpfen<br />
vor. Im Herbst 2009 wurde in<br />
einem Testhaus der TU Dresden<br />
ein 50 mm dickes, kapillar<br />
leicht leitfähiges Dämmsys -<br />
tem (R ≈ 1,75 m 2 K/W, s d ≈ 1,6 m)<br />
auf einer verputzten, 560 mm<br />
dicken Außenwand angebracht<br />
(Abb. 9-11). Ein <strong>Balkenkopf</strong><br />
in einer nach Westen<br />
ausgerichteten Wand wurde<br />
mit mehreren Temperaturund<br />
Luftfeuchtesensoren ausgestattet.<br />
Die bisherigen Aufzeichnungen<br />
zeigen nach der<br />
Austrocknung der Baufeuchte<br />
bei niedrigen Außentemperaturen<br />
Luftfeuchten bis 95%<br />
bei Temperaturen unter ca.<br />
5°C im Luftspalt vor dem <strong>Balkenkopf</strong>.<br />
Eine Situation, die<br />
für die Aktivierung holzzerstörenden<br />
Pilze unkritisch ist<br />
(vgl. Artikel D. Kehl, S. 23 ff.).<br />
Zusammenfassung und<br />
Ausblick<br />
Der Einbau von Innendämm<br />
systemen ruft in der Regel<br />
negative Veränderungen<br />
der wärme- und feuchtetechnischen<br />
Verhältnisse am <strong>Balkenkopf</strong><br />
hervor. Den am Bau Tätigen<br />
stehen verschiedene Maßnahmen<br />
zur Verfügung, mit<br />
denen sie auf diese Veränderungen<br />
reagieren können. Ob<br />
diese, hier beschriebenen,<br />
Maßnahmen jedoch notwendig<br />
sind, oder ob althergebrach te<br />
Methoden der Trocken haltung<br />
ausreichen ist noch nicht geklärt.<br />
Zwei Forschungsvorhaben<br />
an der TU Graz und der<br />
Fachhochschule Bern, Standort<br />
Biel/Bienne, untersuchen derzeit<br />
u.a. das Zusammenspiel<br />
von Balkenköpfen und Innendämmsystemen.<br />
Ein Paketantrag<br />
deutscher Forschungseinrichtungen<br />
befindet sich gegenwärtig<br />
in der Bewilligungsphase.<br />
Demzufolge ist zukünftig<br />
mit neuen Erkenntnissen zu<br />
rechnen, welche etwas mehr<br />
Licht in das Dunkel um die Balkenköpfe<br />
bringen werden. <br />
Literaturverweise<br />
[AkkP 2005] Protokollband Nr. 32:<br />
Faktor 4 auch bei sensiblen Altbauten:<br />
Passivhauskomponenten + Innendämmung,<br />
Passivhaus-Institut 2005.<br />
[DIN 68800-3:1990-04] Holzschutz<br />
– Vorbeugender chemischer Holzschutz<br />
[Ensan 2008] Hamburg, Kleine Freiheit<br />
46-52, EnSan Abschlussbericht,<br />
PTJ-Projektträger Jülich, Förderkennzeichen<br />
0329750S, 2008.<br />
[Gnoth 2007] Steffen Gnoth: Zum<br />
thermischen und hygrischen Verhalten<br />
von Bauteilen mit offenen und geschlossenen<br />
Hohlräumen, Dissertation<br />
TU Dresden, 2007.<br />
[Loga 2005] Tobias Loga: Energetische<br />
Modernisierung eines Gründerzeithauses<br />
in Wiesbaden, Tagungsband<br />
zum 6. Leipziger Bauschadenstag,<br />
27. September 2005, S. 81-91.<br />
[Stopp et al 2010] Horst Stopp,<br />
Peter Strangfeld, Torsten Toepel, Eva<br />
Anlauft: Messergebnisse und bauphysikalische<br />
Lösungsansätze zur Problematik<br />
der Holzbalkenköpfe in Außenwänden<br />
mit Innendämmung, Bauphysik<br />
32 (2010), S.61-72.<br />
[WTA 2009] Wissenschaftlich-Technische<br />
Arbeitsgemeinschaft<br />
für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege<br />
e.V. - WTA - (Hrsg.): WTA-<br />
Merkblatt 6-4-09. Innendämmung im<br />
Bestand – Planungsleitfaden -.<br />
München 2009.