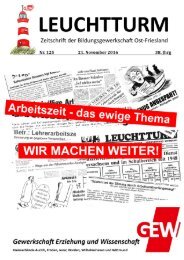LEUCHTTURM
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft<br />
Kreisverbände Aurich, Emden, Jever, Norden, Wilhelmshaven und Wittmund<br />
<strong>LEUCHTTURM</strong><br />
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft in Ost-Friesland<br />
Nr. 119<br />
30. Juni 2014<br />
36. Jhrg.<br />
Es gibt zahlreiche<br />
Untersuchungen,<br />
die belegen, dass<br />
Lehrerinnen und<br />
Lehrer bedeutend<br />
länger arbeiten als<br />
40 Stunden pro Woche,<br />
dass sie durch<br />
die sich verändernde<br />
Schülerschaft heute<br />
immer öfter als SozialarbeiterInnen<br />
gefragt<br />
sind denn als<br />
PädagogInnen, dass<br />
immer neue Lehrpläne<br />
und Verwaltungsvorschriften<br />
sowie<br />
Schulreformen<br />
ein Ausmaß angenommen<br />
haben, das<br />
sich in keiner Arbeitszeitverordnung angemessen niederschlägt, dass nur ein relativ sehr kleiner Prozentsatz<br />
das Pensionsalter bei guter Gesundheit erreicht, aber wie vor 20 Jahren reagieren Landesregierungen<br />
unangemessen. Wenn wir nicht beginnen uns zu wehren, bewerfen die Schülerinnen und Schüler uns mit<br />
Recht mit Spott und anderen Dingen - wie damals.<br />
Rolf Meyer<br />
1993<br />
Eine kleine<br />
Nachlese der<br />
Protest-Aktion<br />
„5 vor 12“ auf den<br />
Seiten 9 bis 20
<strong>LEUCHTTURM</strong><br />
2<br />
Kreisverband Aurich<br />
Annette Weßling- Brandt, Dicke Bült 10, 26624 SBL; Tel. 04934/1562 Südbrookmerland, 27. 5. 2014<br />
Ralf Dittmer<br />
Einladung zur Vertrauensleute- und Personalrätekonferenz<br />
Liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
hiermit laden wir euch herzlich ein zu unserer Vertrauensleute- und Personalrätekonferenz<br />
Donnerstag, 10. 7. 2014, Beginn:10.00 Uhr<br />
im Seminarhotel Aurich, Grüner Weg<br />
Vorschlag zur Tagesordnung:<br />
1. Begrüßung<br />
2. Aktuelle Probleme in der Schule<br />
3. Informationen zum Gutachten zur Schulentwicklung des Landkreises<br />
4. Verschiedenes<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
Ralf Dittmer/ Annette Weßling-Brandt<br />
Die Durchführung der Veranstaltung ist von der Landesschulbehörde, Abteilung Osnabrück, pauschal genehmigt.<br />
Die Mitglieder der Schulpersonalräte beantragen die Beurlaubung nach §40 Nds PersVG bei der Landesschulbehörde.<br />
GEW-Vertrauensleute beantragen Sonderurlaub für gewerkschaftliche Zwecke nach der 2. Unterrichtsstunde bei der<br />
Schulleitung. Es dürfen keine Fahrtkosten bei der Dienststelle/Landes-schulbehörde beantragt werden.<br />
Bitte melde dich bis zum 2.7. 2014 bei uns telefonisch oder per e-mail : annette.gew-aurich@ewe.net an, damit wir<br />
rechtzeitig die Räumlichkeiten und das Mittagessen organisieren können.<br />
Redaktion Leuchtturm Redaktionsschluss: 22.06.2014<br />
KV Wittmund www.GEW-wittmund.de<br />
Ronald Wilts Lüdstede 3 26487 Neuschoo Tel. 04975 - 366 Ronald.Wilts@t-online.de<br />
Jürgen Kramm Wangeroogestr. 8 26409 Wittmund Tel. 04462 - 6102 Juergen.Kramm.WTM@t-online.de<br />
KV Jever www.gewweserems.de/kv-fg/jever/jevindex.htm<br />
Fridolin Haars Fliederweg 16 26434 Wangerland Tel. 04461 - 5123 frimawa@gmx.de<br />
Klaus Blume-Wenten Javenloch 5 26434 Wangerland Tel. 04464 - 8150 k.blume-wenten@t-online.de<br />
KV Aurich www.aurich.gewweseremsde<br />
Ralf Dittmer Oldeborger Str. 81 26624 Südbrookmerland Tel./Fax 04942 - 3938 radidodo@web.de<br />
Franz Kampers Hinter Eschen 16F 26607 Aurich Tel. 04941 - 6988012 fkampers@ewetel.net<br />
KV Norden<br />
Herbert Czekir Reithammer Weg 29 26529 Osteel Tel. 04934 - 6766 herbert.czekir@ewetel.net<br />
Anette Hillen Im Dullert 30 26524 Hage Tel. 04931 - 7 4474 anette-hillen@web.de<br />
KV Emden www.GEW-emd.de<br />
Dr. Josef Kaufhold Herm.-Hesse-Str. 4 26721 Emden Tel. 04921 - 45266 JosefKaufhold@web.de<br />
Gerd de Beer Graf-Edzard-Str. 20 26721 Emden Tel. 04921-29778 hans-gerd-de-beer@t-online.de<br />
KV Wilhelmshaven<br />
Friedrich Fischer Fedderwarder Str. 124 26388 Wilhelmshaven Tel.04421 - 502119 magfish@gmx.de<br />
Wolfgang Niemann-Fuhlbohm Güstrower Str. 3c 26388 Wilhelmshaven Tel.04421 - 87117 wolfgang.nif@gmx.de<br />
Impressum: GEW-<strong>LEUCHTTURM</strong> Nr. 119 / 36. Jahrgang vom 30.06.2014<br />
LehrerInnenzeitung für die Kreisverbände Aurich, Emden, Jever, Norden, Wilhelmshaven, Wittmund<br />
Herausgeber: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im DGB/Kreisverband Wittmund<br />
verantwortl.: Ronald Wilts (1. Vors.), Lüdstede 3, 26487 Neuschoo, 04975/366<br />
Internet: www.gewweserems.de - dort auch Informationen aus den Kreisverbänden<br />
Druck: www.janssendruck.de, Finkenburgstr. 47, 26409 Wittmund
3 <strong>LEUCHTTURM</strong><br />
Käpt’n Blaubär und die Lesenester<br />
ein gele(e)hrter Sketsch über’s Lesenlernen<br />
Käpt’n Blaubär und die drei<br />
Gummibärchen treten auf.<br />
Enkel 1: Mensch Opa, du siehst<br />
aber blass aus! Haben dir<br />
die Klassenfahrten mit den<br />
Gymnasiasten keinen Spaß<br />
gemacht?<br />
Blaubär: Spaß ist vielleicht nicht<br />
das richtige Wort.<br />
Enkel 2: Was war denn los,<br />
Opa?<br />
Blaubär: Nun, ihr müsst ja in<br />
eurem Alter noch nicht<br />
alles wissen, was Jugendliche<br />
in der Nacht so treiben.<br />
Nur so viel: Ich habe<br />
mehrere Wochen lang<br />
kaum ein Auge zu getan.<br />
Enkel 3: Armer Opa! Und was<br />
macht dein Job als Effidingsda-Experte?<br />
Blaubär: Ihr meint als Effizienzexperte<br />
für das niedersächsische<br />
Schulwesen?<br />
Enkel 1: Ja genau.<br />
Blaubär: Ich glaube, dass ich da<br />
ein paar bahnbrechende<br />
Ideen entwickelt habe, um<br />
für die Regierung viel Geld<br />
zu sparen.<br />
Enkel 2: Reicht es denn nicht,<br />
dass die Gymnasiallehrer<br />
mehr arbeiten müssen?<br />
Blaubär: Wo denkt ihr hin?<br />
Niedersachsen ist immer<br />
noch so arm wie eine<br />
Schiffsratte.<br />
Enkel 3: Und was hast du dir da<br />
so ausgedacht, Opa?<br />
Blaubär: Tja, ich habe endlich<br />
einen Weg gefunden, wie<br />
man bei den Grundschulen<br />
sparen kann. Die verschlingen<br />
schließlich das meiste<br />
Geld.<br />
Enkel 1: Aber du hast doch<br />
selbst gesagt, dass die<br />
Grundschullehrer nicht<br />
noch mehr arbeiten können.<br />
Blaubär: Das ist schon richtig.<br />
Aber der Trick ist der: Ich<br />
werde dort ganz viele<br />
Lehrkräfte einsparen.<br />
Enkel 2: Ganz viele Lehrkräfte?<br />
Blaubär: Ja, ganz viele Lehrkräfte<br />
und zwar solche, die man<br />
mit Doppel-E schreiben<br />
sollte.<br />
Enkel 3: Das ist jetzt aber<br />
ziemlich gemein, Opa.<br />
Unsere Lehrer sind alle<br />
wirklich gut.<br />
Blaubär: So meint ihr?<br />
alle: Ja, das meinen wir!<br />
Blaubär: Dann sagt mir mal, ob<br />
ihr wisst, was ein Lesenest<br />
ist.<br />
Enkel 1: Ein Lesenest ist so eine<br />
Stelle, bei der Kinder<br />
nachmittags lesen üben.<br />
Blaubär: Und welche Kinder<br />
gehen dort hin, ihr<br />
kleinen Schlaumeier?<br />
Enkel 2: Die Kinder, die Schwierigkeiten<br />
beim Lesen haben,<br />
natürlich.<br />
Blaubär: Natürlich sagt ihr,<br />
natürlich? Wenn ihr mich<br />
fragt, ich finde das ziemlich<br />
unnatürlich. Wenn die<br />
Grundschullehrer ihr Geld<br />
wert wären, dann bräuchte<br />
man doch auch keine<br />
Lesenester.<br />
Enkel 3: Aber Opa, manche<br />
Kinder lernen nun mal<br />
ganz langsam.<br />
Blaubär: Ihr habt eben einfach<br />
keine Ahnung, ihr kleinen<br />
Döspaddel. Die Grundschullehrer<br />
in Niedersachsen<br />
sind einfach zu schlecht<br />
ausgebildet.<br />
Enkel 1: Woher weißt du das,<br />
Opa?<br />
Blaubär: Na, aus der Zeitung.<br />
Die solltet ihr vielleicht<br />
auch mal lesen, statt immer<br />
nur Fernsehen zu gucken<br />
und zu googeln!<br />
Enkel 2: Aus der Zeitung weißt<br />
du das?<br />
Blaubär: Ja, aus der sogenannten<br />
Lokalpresse. Gott sei Dank<br />
gibt es die noch! Da war<br />
nämlich vor einiger Zeit so<br />
ein Artikel darüber, und da<br />
wurde das Problem genau<br />
benannt. In Niedersachsen<br />
studieren die angehenden<br />
Lehrer nicht vier Fächer<br />
wie in z.B. in Bayern,<br />
sondern nur zwei, und<br />
deshalb haben sie keine<br />
Ahnung vom Leseunterricht.<br />
Enkel 2: Und deshalb brauchen<br />
die in Bayern keine<br />
Lesenester?<br />
Blaubär: Genau so ist es!<br />
Enkel 3: Und wie willst du nun<br />
die vielen Lehrer einsparen?<br />
Die werden doch<br />
trotzdem dringend benötigt.<br />
Blaubär: Eben nicht! Ich werde<br />
den Erstleseunterricht komplett<br />
an die Lesenester<br />
abgeben, die können das<br />
sowieso viel besser und<br />
außerdem machen die das<br />
ehrenamtlich und völlig<br />
kostenlos.<br />
Hein Blöd: Käpt’n, da ist mal<br />
wieder ein Brief für Sie.<br />
Von einer Frau Hantelmann<br />
oder so ähnlich.<br />
Blaubär: Könnte es vielleicht<br />
eine Frau Hannemann<br />
sein?<br />
Hein Blöd: Äh, ja richtig,<br />
Hannemann.<br />
Blaubär: Da bin ich aber<br />
gespannt. Was schreibt die<br />
denn?<br />
Hein Blöd: Sehr geehrter Herr<br />
Blaubär! Ich habe aus der<br />
örtlichen Presse, erfahren, dass<br />
Sie vorhaben, den kompletten<br />
Erstleseunterricht an die sehr<br />
erfolgreich arbeitenden Lesenester<br />
zu delegieren. Da es uns in<br />
Ermangelung ausreichend vorgebildeter<br />
Fachleiter und Fachleiterinnen<br />
in Niedersachsen immer<br />
weniger gelingt, die jungen<br />
Referendare und Referendare auf<br />
diesem Gebiet hinreichend zu<br />
qualifizieren, möchte ich Sie<br />
bitten, zu prüfen, ob nicht die<br />
Lesenester auch die Ausbildung<br />
unseres Lehrernachwuchses auf<br />
ehrenamtlicher Basis übernehmen<br />
könnten. Mit freundlichen<br />
Grüßen, Ihre Elfriede Hannemann,<br />
Leiterin des Studienseminares Aurich<br />
Heinrich<br />
Herlyn
<strong>LEUCHTTURM</strong><br />
4<br />
Prof. Dr. Carsten Müller (Hochschule Emden/Leer)<br />
anlässlich des Arbeitnehmerinnenempfanges der Stadt Emden am 28.04.2014<br />
Es rettet uns kein höh’res Wesen,<br />
kein Gott, kein Kaiser noch Tribun.<br />
Uns aus dem Elend zu erlösen,<br />
können wir nur selber tun!<br />
aus: Die Internationale (E. Luckhardt, 1910)<br />
Sehr geehrte Damen und<br />
Herren,<br />
geschätzte Kolleginnen und<br />
Kollegen.<br />
Aus Anlass des kommenden<br />
„Tages der Arbeit“ besteht in<br />
Emden die Tradition, dass der<br />
Oberbürgermeister der Stadt im<br />
Namen von Rat und Verwaltung<br />
den DGB, die ortsansässigen<br />
Einzelgewerkschaften und ihre<br />
Vertreter_innen zu einem „Gedankenaustausch“<br />
einlädt. Ich<br />
möchte mich herzlich für die<br />
Einladung bedanken, hier im<br />
Namen des DGB sprechen zu<br />
dürfen. Ich habe die Einladung<br />
gerne angenommen und hoffe,<br />
kritische Gedanken beisteuern<br />
zu können.<br />
Zu meiner Person: Ich heiße<br />
Carsten Müller und bin Professor<br />
für „Gesellschafts- und<br />
sozialpolitische Aspekte Sozialer<br />
Arbeit“ an der hiesigen Hochschule<br />
1 , die einst als Fachhochschule<br />
Ostfriesland – ein guter<br />
Name! – gegründet wurde und<br />
heute die Bezeichnung Hochschule<br />
Emden-Leer trägt. Indes<br />
spreche ich hier nur in zweiter<br />
Hinsicht als Wissenschaftler.<br />
Vielmehr möchte ich mich als<br />
Gewerkschaftler zu den aktuellen<br />
Herausforderungen der Gewerkschaftspolitik<br />
positionieren.<br />
Ich bin Mitglied der GEW, als<br />
Hochschulvertreter im erweiterten<br />
Vorstand des GEW-Kreisverbandes<br />
Emden und arbeite auch<br />
auf Landesebene in verschiedenen<br />
Referaten mit. Einige von<br />
Ihnen und Euch werden mich<br />
zudem aus der sozialpolitischen<br />
Arbeit vor Ort, z.B. aus der<br />
„Armutskonferenz Ostfriesland“<br />
oder dem „Bündnis Besser<br />
Wohnen in Emden“ kennen. Ich<br />
bin als Student in die GEW<br />
eingetreten und war – wie<br />
vermutlich viele von uns –<br />
zeitweise mehr oder weniger<br />
aktiv. Als ich 2007 nach Emden<br />
berufen wurde, habe ich überlegt,<br />
welche politische Arbeit ich<br />
wieder aufnehmen will. Ich habe<br />
mich neben der Hochschul- und<br />
Sozialpolitik, die gewissermaßen<br />
zu meinem Professorenjob gehören,<br />
für die Gewerkschaftsarbeit<br />
entschieden.<br />
Diese einleitenden Worte<br />
könnten rein biografisch sein.<br />
Aber: Was ich an meiner<br />
Biografie angedeutet habe, berührt<br />
zentrale Fragen: Warum<br />
wird, ist und bleibt jemand<br />
Mitglied einer Gewerkschaft?<br />
Warum engagiert sich jemand für<br />
eine Gewerkschaft? Und was<br />
macht die Stärke der Gewerkschaften<br />
aus? Die ersten beiden<br />
Fragen kann ich – sicherlich nur<br />
aus meiner persönlichen Sicht –<br />
beantworten: Ich bin relativ früh<br />
eingetreten und wer früh eintritt,<br />
bleibt auch meist länger drin.<br />
Zudem hat mir meine Mitgliedschaft<br />
mehrmals in meiner<br />
Berufskarriere Vorteile gebracht,<br />
z.B. hinsichtlich des Rechtschutzes.<br />
Auch gibt mir die<br />
Gewerkschaft ideellen Rückhalt<br />
in einer Hochschullandschaft,<br />
die sich zusehends ökonomisiert.<br />
Da ist es gut zu wissen, dass<br />
der DGB gegen diesen Trend<br />
eine „demokratische Hochschule“<br />
einfordert. Und schließlich,<br />
denke ich immer noch, dass die<br />
Gewerkschaften zentrale Akteure<br />
sind bzw. sein sollten, um den<br />
Kapitalismus – ich verwende<br />
ganz bewusst diesen Begriff – zu<br />
zähmen.<br />
Die dritte Frage „Was macht<br />
die Stärke der Gewerkschaften<br />
aus?“ ist indes ungleich schwieriger<br />
zu beantworten, denn wir<br />
befinden uns – verharmlosend<br />
gesprochen – in ökonomisch<br />
schwierigen Zeiten. Und diese<br />
ziehen auch die Gewerkschaftsarbeit<br />
in Mitleidenschaft.<br />
Schwierige Zeiten – das<br />
Überleben des<br />
Neoliberalismus 2<br />
Ich spreche jetzt nicht en<br />
Detail über die Finanz-, Wirtschafts-<br />
und Sozialkrise, die<br />
Deutschland angeblich – was ich<br />
nicht glaube – gut meistern soll.<br />
Ich spreche vielmehr von der<br />
ökonomischen Ideologie, dem<br />
sogenannten Neoliberalismus,<br />
der diese Krise nachweislich<br />
mitverursacht hat und befremdlicher<br />
Weise – wie der Politikwissenschaftler<br />
Colin Crouch formuliert<br />
– trotzdem die Krise<br />
überlebt. 3 Anstatt innezuhalten<br />
und bestenfalls umzukehren, hat<br />
der Neoliberalismus wieder<br />
Fahrt aufgenommen. Folgende<br />
Schlagworte aus dem letzten<br />
Bundeswahlkampf mögen als<br />
Hinweise genügen, um zu sehen,<br />
dass nur begingt umgesteuert<br />
wird.<br />
· Der Streit um den Mindestlohn;<br />
dabei wissen wir jetzt<br />
schon, dass 8,50€ samt<br />
Ausnahmen z.B. für Langzeitarbeitslose<br />
nicht ausreichen<br />
werden, um Arbeit gerecht zu<br />
entlohnen.<br />
· Der Streit um eine armutsfeste<br />
Rente; dabei wird die Rentenreform<br />
Benachteiligten mit<br />
brüchigen Erwerbsbiografien<br />
wenig zu Gute kommen.<br />
· Von der Idee einer Bürgerversicherung,<br />
die Privilegien<br />
abbaut, den Wohlfahrtsstaat<br />
reformiert und gleichzeitig<br />
sichert, ist keine Rede mehr.<br />
· Auch die Debatten um<br />
Steuererhöhungen u.a. auf<br />
Spitzenverdienste, auf Kapi-
5 <strong>LEUCHTTURM</strong><br />
talerträge und Erbschaften ist<br />
eingeschlafen.<br />
Ein wenig mag mit der so<br />
genannten „GroKo“ bewegt<br />
worden sein, aber ein neuer<br />
„New Deal“, der den wachsenden<br />
Reichtum umverteilt und<br />
nachhaltig beispielsweise in die<br />
soziale Infrastruktur investiert,<br />
ist auch angesichts der Schuldenbremse<br />
nicht in Sicht – nicht in<br />
Europa, nicht in der Republik,<br />
nicht in Niedersachsen und auch<br />
nicht in den Kommunen.<br />
Deshalb müssen wir, um<br />
Detlef Wetzel, den Vorsitzenden<br />
der IG Metall zu zitieren, die<br />
„Realitäten ins Auge fassen“. 4<br />
Die nivelliert Mittelschichtsgesellschaft<br />
der alten Bundesrepublik<br />
ist weiterhin in Erosion<br />
begriffen: „In den letzten rund<br />
zehn Jahren hat sich der<br />
Arbeitnehmertypus des so genannten<br />
Niedriglohnbeziehers<br />
etabliert und macht mittlerweile<br />
fast 25 Prozent aller Beschäftigungsverhältnisse<br />
aus – das ist<br />
knapp jeder Vierte. Atypische<br />
Beschäftigungsverhältnisse liegen<br />
inzwischen bei etwas mehr<br />
als 25 Prozent und haben in den<br />
letzten zehn Jahren um mehr als<br />
fünf Prozent zugenommen …<br />
Das private Nettovermögen ist<br />
seit 1991 von rund 4,5<br />
Billionen auf mehr als elf<br />
Billionen Euro gestiegen –<br />
allerdings sehr ungleich verteilt.<br />
Die obersten zehn Prozent<br />
besitzen nämlich 53 Prozent der<br />
Vermögenswerte, während die<br />
unteren 50 Prozent es gerade<br />
mal auf ein Prozent bringen.<br />
Tatsächlich ist die untere Hälfte<br />
der Bevölkerung im Vergleich<br />
sogar noch ärmer geworden“. 5<br />
Ich will keinen Sozialneid<br />
schüren, aber diese Ungleichverteilung<br />
wirkt sich auf das<br />
Alltagsbewusstsein der Menschen<br />
aus: In der Bevölkerung<br />
greifen Abstiegsängste um sich,<br />
mithin schwindet das Vertrauen<br />
in Demokratie und Sozialstaat.<br />
Der Anpassungsdruck besonders<br />
auf Kinder und Jugendliche,<br />
etwa hinsichtlich forcierter Bildungsanstrengungen,<br />
steigt. Folgende<br />
Drohung schwebt über<br />
den Köpfen und frisst sich in die<br />
Herzen: Wer nicht mithalten<br />
kann, wer sich und seine<br />
Arbeitskraft nicht optimiert und<br />
verkauft – zu welchem Preis auch<br />
immer –, wird überflüssig und<br />
schließlich exkludiert. 6 Es entsteht<br />
eine neue Klasse der – wie<br />
Michael Hardt und Antonio<br />
Negri meinen – Abgehängten 7 ,<br />
die nicht mehr gebraucht und<br />
von niemand mehr „vertreten“<br />
werden.<br />
Der Erziehungswissenschaftler<br />
Wilhelm Heitmeyer spricht<br />
in diesem Kontext davon, dass<br />
die immer schon brüchige<br />
Solidarität der bürgerlichen<br />
Gesellschaft im Schwinden begriffen<br />
ist. Die Mittelschicht<br />
grenzt sich verstärkt nach unten<br />
ab. Man schaut, angetrieben von<br />
falschen politischen Eliten und<br />
Boulevard-Medien mit verachtendem<br />
Blick auf „die da unten“.<br />
Man dünkt sich moralisch<br />
besser, weil mal – noch! – besser<br />
dran ist. Der forcierte Kapitalismus<br />
zeigt so sein wahres Gesicht.<br />
Er bleibt und war immer schon<br />
ein „autoritärer Kapitalismus“. 8<br />
Gewerkschaften in<br />
schwierigen Zeiten<br />
All dies trifft die Gewerkschaften<br />
in ihren Kern. Die Macht<br />
der Finanzmärkte „korreliert mit<br />
einer schwindenden Arbeitsmarktmacht<br />
der die Szene bis …<br />
[bis zum Ende des kalten<br />
Krieges] beherrschenden Gewerkschaften“<br />
9 , so Michael Kittner,<br />
ebenfalls ein bekannter IG-<br />
Metaller. Ich teile Ihnen und<br />
Euch bestimmt nichts Neues mit,<br />
aber ersparen kann ich es uns<br />
trotzdem nicht: Die Gewerkschaften<br />
durchleben schwere<br />
Zeiten. Nur noch ca. 19% aller<br />
Beschäftigten sind noch Mitglied<br />
einer Gewerkschaft. 10 „Damit<br />
haben die deutschen<br />
Gewerkschaften seit Anfang der<br />
1980er Jahre etwa die Hälfte<br />
ihrer Mitglieder verloren“. 11<br />
Wird zudem die Altersstruktur<br />
betrachtet, wird deutlich, dass<br />
vor allem junge Kolleginnen<br />
und Kollegen fehlen. 12<br />
Ebenfalls hat die Bedeutung<br />
von Tarifverträgen abgenommen.<br />
Im Westen der Bundesrepublik<br />
waren es 2012 noch 60%,<br />
im Osten nur noch 48% der<br />
Beschäftigten, die tarifliche Arbeitsbedingungen<br />
genießen.<br />
Dies sind Rückgänge innerhalb<br />
von fünfzehn Jahren um bis zu<br />
10%. Hinsichtlich der Flächentarifverträge<br />
sieht es noch schlechter<br />
aus. „Faktisch ist es so, dass es<br />
ganze Sektoren gibt, in denen<br />
Gewerkschaften und Mitbestimmung<br />
im Grunde keine Rolle<br />
spielen“. 13<br />
Hinzu kommen weitere Faktoren,<br />
wie u.a.:<br />
· ein interner Konzentrationsprozess,<br />
der aus ehemals 17<br />
heute acht Großgewerkschaften<br />
gemacht hat und<br />
· das Aufkommen berufsspezifischer<br />
Spezialgewerkschaften,<br />
z.B. für Piloten und Lokomotivführer.<br />
14<br />
Alles in allem ist, wie Kittner<br />
meint, die „Gesamttendenz …<br />
eindeutig. Die Macht der alten<br />
Großgewerkschaften schwindet<br />
…“. 15<br />
Auf einen besonderen Aspekt<br />
möchte ich in diesem Kontext<br />
die Aufmerksamkeit lenken.<br />
Dieser schließt an das an, was<br />
oben zur brüchigen Solidarität<br />
gesagt wurde: Kittner analysiert,<br />
dass die Gewerkschaften „der<br />
Rückhalt … im Reich der<br />
Ideen“ 16 verlieren. Damit ist<br />
nicht nur gemeint, dass den<br />
Gewerkschaften ein zunehmend<br />
rauer Ton entgegen schlägt, der<br />
sogar bis zum „union busting“,<br />
also der Verächtlichmachung der<br />
Gewerkschaften, geht. Damit ist<br />
vielmehr gemeint, dass die<br />
„konstitutive Idee der Solidarität<br />
… immer weniger Menschen [in<br />
der individualisierten und pluralisierten<br />
Gesellschaft; d. Verf.]<br />
anspricht“. 17<br />
Mehr noch: Auch innerhalb<br />
der Betriebe und Belegschaften<br />
findet sich das Phänomen –<br />
diese bittere Wahrheit gilt es<br />
auszusprechen – der „exklusiven<br />
Solidarität“, wie Klaus Dörre<br />
dies nennt. 18 Zwar sind „Mitgefühl,<br />
politische Statements gegen<br />
das Gesetz der Arbeitnehmerüberlassung<br />
ebenso wie die<br />
Forderung nach Equal Pay für<br />
Leiharbeite Bestandteil einer
<strong>LEUCHTTURM</strong><br />
auch bei Stammbeschäftigten<br />
verbreiteten solidarischen<br />
Grundhaltung; im konkreten<br />
Fall der Krise war … [ihnen; d.<br />
Verf.] allerding häufig das Hemd<br />
näher als die Jacke“ 19 . Dies zeigt<br />
sich an fehlender konkreter<br />
Solidarität mit prekär und<br />
atypisch Beschäftigten, wenn<br />
diese in Krisenzeiten als Erste<br />
freigesetzt werden, um vermeintlich<br />
die Stammbelegschaften zu<br />
halten.<br />
Was tun?<br />
Wetzel gibt folgenden Kurs<br />
an: „Um im Rahmen der sich<br />
global verschiebenden Marktund<br />
Kräfteverhältnisse bestehen<br />
zu können, müssen wir uns<br />
daher von einem eng gefassten<br />
betriebsverfassungsrechtlichen<br />
Betriebsbegriff lösen und einen<br />
gewerkschaftspolitischen Betriebsbegriff<br />
entwickeln“. 20 Dies<br />
bedeutet zum einen, dass die<br />
Gewerkschaften nicht nur einzelne<br />
Betriebe oder Sparten in den<br />
Blick rücken müssen, sondern<br />
eben die gesamte Kette kapitalistischer<br />
Wertschöpfung. Die<br />
Gewerkschaften müssen die<br />
gesamte Produktion und alle<br />
daran beteiligten Produktivkräfte<br />
in den Blick nehmen – also<br />
nicht nur den Stammbetrieb und<br />
seine Belegschaft, sondern vor<br />
allem auch „den wachsenden<br />
Rand“ u.a. prekär Beschäftigter.<br />
Die Gewerkschaften müssen sich<br />
allen Beschäftigungsgruppen,<br />
eben auch den Unorganisierten<br />
zuwenden – über regionale und<br />
nationale Grenzen hinweg –, um<br />
gestaltungsfähig zu bleiben.<br />
Diese Umorientierung zu<br />
einem politischen Betriebsbegriff,<br />
bedeutet noch mehr:<br />
Letztlich ist damit eine Abkehr<br />
vom „System Nipperdey“ gemeint,<br />
wie dies Kittner in<br />
Anspielung auf den gewerkschaftsabtrünnigen<br />
Juristen<br />
Hans Carl Nipperdey nennt 21 .<br />
Nipperdey hatte mit seiner<br />
neuen Interpretation des Streikrechts<br />
in den 1950er Jahren dazu<br />
beigetragen, dass Arbeitskämpfe<br />
nur auf den Abschluss von<br />
Tarifverträgen ausgerichtet sein<br />
dürfen (was u.a. zum Verbot des<br />
politischen Streiks führte) 22 .<br />
Nicht zuletzt dadurch wurden<br />
die Gewerkschaften in das<br />
System der Bundesrepublik<br />
Deutschland eingebunden und<br />
es entstand der Eindruck eines<br />
abgekarteten Spiels, eines bloß<br />
korporatistischen Verhandlungssystems.<br />
23<br />
Die Gewerkschaften stützen<br />
sich, wie Klaus Dörre formuliert,<br />
dabei vor allem auf ihre<br />
„institutionelle Macht“ 24 , d.h.<br />
sie verstanden sich als Interessenvertretungen<br />
ihrer Mitglieder,<br />
welche die spezifische<br />
Kombination von Tarifautonomie<br />
und betrieblicher Mitbestimmung<br />
möglichst effizient zu<br />
nutzen wussten. Diese Macht<br />
schwindet heute, durch oben<br />
angedeutete ökonomische Veränderungen,<br />
welche Dörre als<br />
„neue kapitalistische Landnahme“<br />
bezeichnet. 25 Auch die Idee<br />
der Gewerkschaft als Serviceleistung<br />
für ihre Mitglieder, z.B.<br />
hinsichtlich forcierter arbeitsrechtlicher<br />
Beratung, kann diesen<br />
Machtverlust nur bedingt<br />
kompensieren.<br />
Deshalb ist es notwendig neue<br />
– eigentlich seit Beginn der<br />
Arbeiter_innenbewegung bekannte<br />
– Machtquellen zu<br />
erschließen. Die Idee lautet in<br />
Anlehnung an Erneuerungsprozesse<br />
in u.a. der amerikanischen<br />
oder australische Gewerkschaftsbewegung<br />
26 : Wir müssen die<br />
institutionelle Macht durch<br />
organisierte bzw. neu zu<br />
organisierende Macht ergänzen!<br />
6<br />
Organizing (Organisieren)<br />
– als eine Antwort<br />
Macht hat, wie der Begründer<br />
des Community Organizing 27 ,<br />
Saul David Alinsky meinte, grob<br />
gesprochen zwei Quellen: einerseits<br />
Kapital und andererseits<br />
organisierte Menschen. 28 Wohl<br />
angemerkt, dass Macht an sich<br />
nicht Verwerfliches darstellt,<br />
sondern – dem englischen<br />
Sprachgebrauch entsprechend –<br />
„Power“ meint. Power wird<br />
gebraucht, um Veränderungen<br />
etwa in Richtung auf mehr<br />
Gerechtigkeit, herbeizuführen.<br />
Die daraus abzuleitende Weisheit<br />
klingt zunächst banal: Die<br />
Gewerkschaften sind nur so<br />
stark, wie die in ihnen<br />
organisierte Macht. Dies zielt<br />
nicht in erster Linie auf die<br />
Gewinnung neuer Mitglieder<br />
(dies kann ein guter Nebeneffekt<br />
sein), sondern vor allem um die<br />
Stärkung solidarischen Beziehungen.<br />
Die Folgen aus einer solchen<br />
gewerkschaftlichen Neuorientierung<br />
sind indes weniger banal.<br />
Eine Gewerkschaft in diesem<br />
Sinn muss, entsprechen einem<br />
berühmten Thesenpapier der IG<br />
Metall, sich neu ausrichten. Die<br />
Gewerkschaften müssen<br />
· „mitgliederorientiert …<br />
· beteiligungsorientiert sein<br />
[und, d. Verf.]<br />
· konfliktorientiert sein“ 29<br />
Was bedeuten Mitglieder-,<br />
Beteiligungs- und<br />
Konfliktorientierung<br />
genauer?<br />
Mit Mitgliederorientierung ist<br />
gemeint, dass sich Gewerkschaften<br />
verstärkt an den Interessen<br />
derjenigen Menschen auszurichten<br />
haben, die sie organisieren<br />
wollen. Die Gewerkschaften<br />
müssen verstärkt auf Menschen –<br />
besonders auf die Unorganisierten<br />
– zugehen, um herauszufinden,<br />
was deren Interessen sind.<br />
War es zuvor eher so: Werde<br />
Mitglied der Gewerkschaft und<br />
wir sehen, was wir für Dich tun<br />
können – muss es jetzt lauten:<br />
Die Gewerkschaft hilft Euch,<br />
eure Interessen zu organisieren<br />
und bestenfalls werdet ihr dann<br />
Mitglied.<br />
Darüber hinaus berühren die<br />
Interessen der Menschen nicht<br />
nur Probleme, die vordergründig<br />
ausschließlich die Arbeitsbedingungen<br />
im Betrieb betreffen. Mit<br />
der oben skizzierten veränderten<br />
Arbeitswelt hängen sehr viele<br />
soziale Probleme in der Lebenswelt<br />
zusammen: brüchiger<br />
Schutz vor sozialem Abstieg,<br />
Armut und Exklusion, nicht<br />
bezahlbarer Wohnraum, fehlende<br />
gute Bildung usw. Auch<br />
diesen Problemen hat sich die<br />
Gewerkschaft zuzuwenden, will<br />
sie den Menschen nicht wie die
7 <strong>LEUCHTTURM</strong><br />
neoliberale Ideologie auf seine<br />
verwertbare Arbeitskraft reduzieren.<br />
Mit Beteiligungsorientierung ist<br />
gemeint, dass die Gewerkschaften<br />
die Mentalität aufzugeben<br />
haben, die Interessen ihrer<br />
Mitglieder besser als jene zu<br />
kennen und deshalb zu vertreten.<br />
Eine stärker beteiligungsorientierte<br />
Gewerkschaft gibt wenigsten<br />
zum Teil die Stellvertretermentalität<br />
auf. Sie nimmt ihre<br />
Mitglieder als Expert_innen in<br />
eigener Sache ernst. Auch dies ist<br />
angesichts der oben skizzierten<br />
alltäglichen Entmächtigung der<br />
Lebensverhältnisse durch die<br />
neue kapitalistische Landnahme<br />
wichtig. Denn Beteiligung setzt<br />
dem Gefühl, in der eigenen<br />
Lebenswelt immer ohnmächtiger<br />
zu werden, etwas entgegen.<br />
Und schließlich zur Konfliktbereitschaft.<br />
Vordergründig steht<br />
Organizing „in einem Spannungsverhältnis<br />
zu<br />
(sozial)partnerschaftlich ausgerichteten<br />
Strategien“. 30 Nicht das<br />
die Sozialpartnerschaft zwischen<br />
z.B. Arbeitsgebern und Arbeitnehmern<br />
per se schlecht wär,<br />
aber in lebendigen Partnerschaften<br />
gehören Konflikte eben<br />
dazu, denn diese führen zu<br />
Veränderungen. In diesem Sinne<br />
sollten Gewerkschaften sich<br />
nicht scheuen, dort wo nötig<br />
Katalysatoren für Konflikte und<br />
damit Initiatoren von Veränderungen<br />
zu sein.<br />
Die hierzu gewählten Formen<br />
sind bestenfalls vielfältig: Neben<br />
traditionellen Mitteln ist es<br />
wünschenswert, wenn sich die<br />
Gewerkschaften neuen Taktiken<br />
zuwenden, z.B. aus dem Bereich<br />
des zivilen Ungehorsams, der<br />
Aktionskunst, der neuen Medien<br />
und der so genannten Kommunikationsguerilla.<br />
Schon Alinsky<br />
wusste, dass Spott eine mächtige<br />
Waffe ist und Widerstand Spaß<br />
machen sollte. Wie so etwas<br />
konkret aussehen kann, davon<br />
überzeugt beispielsweise die<br />
Kampagne „Operation Übernahme“<br />
der IG Metall Jugend. 31<br />
Ein Ausblick – die<br />
Gewerkschaft der Zukunft<br />
Mit diesen Elementen der<br />
Neuorientierung stehen die<br />
Gewerkschaften nicht alleine<br />
dar: „Die Marktlogik …, die<br />
Konkurrenzlogik setzt sich immer<br />
weiter durch. Gleichzeitig<br />
existiert in diesem Land eine<br />
eigene zivilgesellschaftliche Tradition<br />
von Selbstorganisation<br />
…, an die Organizing-Konzepte<br />
anschließen können“, schreibt<br />
Sabine Stövesand, die Brücken<br />
zwischen Gewerkschafts- und<br />
sozialer Arbeit schlägt. 32 Gemeint<br />
sind u.a. Arbeiterselbsthilfe,<br />
Genossenschaften usw.<br />
Schließlich war und ist die<br />
Gewerkschaft selber Teil einer<br />
sozialen Bewegung. 33<br />
Es gibt viele Anlässe „bei<br />
denen sich Themen sozialer und<br />
gewerkschaftlicher Arbeit decken<br />
und eine Zusammenarbeit für<br />
beide Seiten günstig wäre“ 34 ,<br />
z.B. Prekarisierung, Armut,<br />
Wohnungsversorgung, schwindende<br />
Daseinsversorgung, Erhaltung<br />
von Gemeingütern gegenüber<br />
Privatisierung und Deregulierung.<br />
Von daher wäre es klug<br />
und ratsam, dass sich die<br />
Gewerkschaften – nicht nur der<br />
DGB – verstärkt mit sozialen<br />
Bewegungen, vor allem auch im<br />
örtlichen Gemeinwesen 35 vernetzen<br />
und damit Solidarität vor<br />
Ort erlebbar machen.<br />
Fazit<br />
Es gilt das zum Selbstzweck<br />
mutierte Wettbewerbsprinzip,<br />
welches heute alle Lebensbereiche<br />
durchdringt, in Frage zu<br />
stellen. Dabei muss die Gewerkschaft,<br />
müssen wir wissen:<br />
Solidarität als Gegenprinzip<br />
kann nicht gepredigt, Solidarität<br />
muss in Erfahrung gerückt<br />
werden! Und diese Solidarität<br />
zeigt sich vor allem denen<br />
gegenüber, denen es schlechter<br />
geht.<br />
Die Gewerkschaftsarbeit der<br />
Zukunft wird meines Erachtens<br />
damit stehen oder fallen, ob es<br />
uns gelingt, zu einer gesellschaftspolitischen<br />
und nicht nur<br />
betriebsgestaltenden Kraft zu<br />
werden. Die Gewerkschaft sind<br />
auf die Probe gestellt, ob es<br />
gelingt, Alternativen im und<br />
zum Kapitalismus mit sichtbar<br />
werden zu lassen. Dies wird<br />
nicht „von oben“ – top down,<br />
wie es Neudeutsch heißt –<br />
gehen, sondern nur „von<br />
unten“: von den Mitgliedern<br />
her, durch mehr Beteiligung und<br />
mittels katalytischer Konflikten.<br />
Auch in diesem Sinne lässt<br />
sich die zweite Strophe der<br />
Internationalen interpretieren.<br />
Dort heißt es: „Es rettet uns kein<br />
höh’res Wesen, kein Gott, kein<br />
Kaiser noch Tribun. Uns aus<br />
dem Elend zu erlösen, können<br />
wir nur selber tun!“. 36 Die<br />
Befreiung oder zumindest Eindämmung<br />
des neoliberalen<br />
Raubtierkapitalismus kann nur<br />
als Selbstbefreiung – nicht<br />
durch, sondern mit Hilfe der<br />
Gewerkschaft – ins Werk gesetzt<br />
werden!<br />
Ich danke für Ihre und Eure<br />
Aufmerksamkeit und wünsche<br />
uns allen – in diesem Sinn –<br />
einen solidarischen 1. Mai!<br />
Kontakt:<br />
Prof. Dr. Carsten Müller<br />
Fachbereich Soziale Arbeit<br />
und Gesundheit<br />
Hochschule Emden-Leer<br />
(in Ostfriesland)<br />
Constantiaplatz 4<br />
26723 Emden<br />
carsten.mueller@hs-emden-leer.de<br />
(dienst.) 04921 807 1237;<br />
(mobil) 0176 24045102<br />
Die Fußnoten und das<br />
Literaturverzeichnis zu<br />
diesem Artikel sind zu<br />
finden auf der Seite<br />
www.gew-wittmund.de/<br />
leuchtturm Ausgabe 119<br />
auf den Seiten 33 und 34
<strong>LEUCHTTURM</strong><br />
GEW-Kreisverband Jever hat seinen<br />
Vorstand verjüngt<br />
Klaus<br />
Blume-Wenten<br />
Der KV Jever hat einen<br />
neuen Vorstand gewählt. In<br />
einem Team wollen Elke<br />
Kortendieck, Irka Sjuts und<br />
Heiner Wegener die GEW-<br />
Arbeit im Jeverland fortsetzen.<br />
Das Durchschnittsalter ist deutlich<br />
gesunken und damit ein<br />
Generationswechsel vollzogen<br />
worden, auf den die beiden<br />
scheidenden Vorsitzenden Fridolin<br />
Haars und Klaus Blume-<br />
Wenten viel Wert gelegt hatten.<br />
In diesem Zusammenhang sei<br />
hervorgehoben, dass die Landes-<br />
GEW Fortbildungen mit Thorsten<br />
Post und Laura Pooth<br />
anbietet.<br />
Zum Schatzmeister wiedergewählt<br />
wurde Ulrich Schwerdt,<br />
sein Stellvertreter ist nun Andre<br />
Sjuts. Zu den Referaten: A macht<br />
weiterhin Elke Kortendieck und<br />
Referat BCD wird von Sven-<br />
Philipp Glomme vertreten, E hat<br />
Irka Sjuts übernommen und F<br />
Astrid Wenten. Zu den<br />
Fachgruppen: FG RHO (Heiner<br />
Wegener), FG GS ( Irka Sjuts) ,<br />
FG FöS (Jutta Stuhm), FG<br />
Gymnasium (Martin Baurmann),<br />
FG BBS (Frederick<br />
Schnittker), FG IGS (Birgit<br />
Rosendahl), FG Senioren (Klaus<br />
Blume-Wenten), die FG Nichtlehrendes<br />
Schulpersonal konnte<br />
leider nicht besetzt werden. Wir<br />
arbeiten dran. Es ist gut, dass die<br />
Übergabe an jüngere Gewerkschafterinnen<br />
und Gewerkschafter<br />
jetzt gelungen ist, denn wir<br />
wissen alle, wie schwierig es in<br />
vielen Kreisverbänden geworden<br />
ist, die alltägliche Arbeit am<br />
Laufen zuhalten – zumal in den<br />
Fachgruppen pensionierte Kolleginnen<br />
und Kollegen kein<br />
Stimmrecht haben.<br />
Neben der Entlastung des<br />
alten Vorstands und den Wahlen<br />
wurden der verstorbenen Mitglieder<br />
gedacht und langjährige<br />
Mitglieder geehrt. In Abwesenheit<br />
wurden Siegfried Wagner<br />
für 65-jährige und Ilse<br />
Hashagen für 61-jährige Mitgliedschaft<br />
gewürdigt. Einen<br />
persönlichen Dank für ihre<br />
Gewerkschaftszugehörigkeit<br />
konnten Helmut Werner (50<br />
Jahre), Klaus Blume-Wenten (42<br />
Jahre) , Bernhard Schwanzar (41<br />
Jahre) und Heiner Wegener (27<br />
Jahre) in Empfang nehmen.<br />
8<br />
Zu einer angeregten Diskussion<br />
kam es im Zuge des Vortrags<br />
der stellvertretenden Landesvorsitzenden<br />
Laura Pooth, die über<br />
die aktuellen Schwerpunkte der<br />
Arbeit der GEW berichtete.<br />
Themen waren neben der<br />
Inklusion und dem Ganztagsbetrieb<br />
auch die Position der GEW<br />
zur derzeitigen SPD-Regierung:<br />
Darf die GEW mit der<br />
Kultusministerin „kuscheln“?<br />
Auf unserer GEW-Demonstration<br />
anlässlich des Landesparteitags<br />
der SPD am 26. April in der<br />
Weser-Ems-Halle in Oldenburg<br />
hatte es nämlich Unmut über die<br />
Äußerung Eberhard Brandts<br />
gegeben, mit der SPD „kooperieren“<br />
zu „müssen“. Wo fängt das<br />
Aufgeben von gewerkschaftlichen<br />
Zielen an, wann schwächt<br />
man die für den gewerkschaftlichen<br />
Erfolg notwendige Gestaltungsmacht?<br />
Laura Pooth versprach,<br />
die vielen – überwiegend<br />
kritischen - Anregungen der<br />
gewerkschaftlichen Basis in die<br />
Arbeit des GEW-Landesvorstands<br />
und in die Arbeit des<br />
Schulhauptpersonalrats einzubringen!<br />
Der neue Vorstand des GEW-Kreisverbands (von links) Heiner Wegener<br />
(Elisa-Kauffeld-Oberschule), Klaus Blume-Wenten, Elke Kortendieck (Schulleiterin<br />
der Grundschule Jungfernbusch), Fridolin Haars, Irka Sjuts (Grundschule<br />
Cleverns) und Kassenwart Ulrich Schwerdt (Grundschule Harlinger Weg).<br />
Klaus Blume-Wenten und Fridolin Haars
9 <strong>LEUCHTTURM</strong>
<strong>LEUCHTTURM</strong><br />
10<br />
wolfgang bohnsack · lindenstraße 31 · D-26345 bockhorn · telefon +49 4453 7 22 20<br />
· telefax +49 4453 98 8673<br />
e-mail seebode.bohnsack@t-online.de<br />
SPD-Mitglied seit 1972<br />
Schulpersonalrat der Sonnensteinschule Horsten<br />
Horster Hauptstraße 42<br />
26446 Friedeburg-Horsten<br />
An den Abgeordneten des<br />
Niedersächsischen Landtags<br />
Herrn Olaf Lies<br />
Geplante höhere Unterrichtsverpflichtung<br />
Aussetzen der Altersermäßigung<br />
Streichung der Altersermäßigung<br />
24.11.2013<br />
Sehr geehrter Herr Lies,<br />
mit Bedauern haben wir in<br />
unserem Kollegium zur Kenntnis<br />
genommen, dass die niedersächsische<br />
Landesregierung<br />
plant, die Unterrichtsverpflichtung<br />
an Gymnasien um eine<br />
Unterrichtsstunde zu erhöhen<br />
und gleichzeitig die Altersermäßigung<br />
für alle Kolleginnen und<br />
Kollegen an niedersächsischen<br />
Schulen auszusetzen. Gegen<br />
diese Überlegungen verwahren<br />
wir uns vehement und fordern<br />
Sie auf, diesen Beschluss nicht<br />
zu unterstützen.<br />
Ich bin jetzt seit 1978 im<br />
niedersächsischen Schuldienst<br />
und seit mehr als vierzig Jahren<br />
SPD-Mitglied und kann einfach<br />
nicht glauben, was die derzeitige<br />
Landesregierung vorhat. Unter<br />
langjährigen SPD-Mitgliedern<br />
ist es ja üblich, sich zu duzen,<br />
deshalb wechsele ich jetzt auch<br />
zum ‚du‘.<br />
Lieber Olaf,<br />
wie soll ich meinen Kolleginnen<br />
und Kollegen verständlich<br />
machen, dass eine SPD geführte<br />
Regierung ein Versprechen<br />
bricht. Bei Einführung der<br />
Altersteilzeit im Schulbereich<br />
Niedersachsens unter Gerhard<br />
Schröder, machte die damalige<br />
SPD Regierung in Niedersachsen<br />
die feste Zusage gegenüber den<br />
Lehrerverbänden, die Altersermäßigung<br />
ab dem Schuljahr<br />
2014/2015 komplett wieder<br />
einzuführen. Gelten solche<br />
Versprechungen bei euch nicht<br />
mehr? Wie lange wollt ihr die<br />
Altersermäßigung aussetzen? Bis<br />
alle in Frage kommenden<br />
Kolleginnen und Kollegen im<br />
Ruhestand sind oder vorzeitig<br />
wegen Überlastung ausfallen. Ich<br />
beobachte jeden Tag an meiner<br />
Schule, dass viele Kolleginnen<br />
und Kollegen der Schülerinnen<br />
und Schüler wegen erheblich<br />
über das Maß an Unterrichtsverpflichtung<br />
hinaus arbeiten. Würde<br />
jede Kollegin und jeder<br />
Kollege nur den von ihm<br />
geforderten Einsatz im Unterricht<br />
erbringen, würde das<br />
Schulleben an niedersächsischen<br />
Schulen, insbesondere an<br />
Grundschulen, erheblich trister<br />
aussehen. Diese Kolleginnen<br />
und Kollegen bringen sich jeden<br />
Tag mehr in das Schulleben ein,<br />
als von ihnen verlangt werden<br />
kann. Nicht umsonst hat die<br />
Sonnensteinschule Horsten bei<br />
der Überprüfung durch die<br />
Schulinspektion überdurchschnittlich<br />
gut abgeschnitten.<br />
Dies tun sie, obwohl ihnen von<br />
Jahr zu Jahr mehr Aufgaben<br />
aufgebürdet wurden. Mittlerweile<br />
muss jede Kleinigkeit schriftlich<br />
dokumentiert werden. Dies<br />
machen die Kolleginnen und<br />
Kollegen bislang ohne großes<br />
Gemurre, obwohl ihnen dafür<br />
die Unterrichtsverpflichtung<br />
nicht in einem angemessenen<br />
Maß reduziert wurde. Zum<br />
Dank wurde ihnen auch noch<br />
das Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld<br />
gestrichen.<br />
Ab diesem Schuljahr kam<br />
infolge der Inklusion eine<br />
weitere erhebliche Mehrarbeit<br />
auf die Kolleginnen und<br />
Kollegen zu. Auch wieder, ohne<br />
die Unterrichtsverpflichtung zu<br />
reduzieren.<br />
So nicht, lieber Olaf. Dies<br />
kann und will ich auch nicht als<br />
Personalvertreter und SPD-<br />
Mitglied gegenüber meinen<br />
Kolleginnen und Kollegen länger<br />
vertreten.<br />
Du bist herzlich eingeladen,<br />
dir die Arbeit eines engagierten<br />
Kollegiums vor Ort anzusehen.<br />
Einen kleinen Einblick bekommst<br />
du vielleicht auch schon<br />
hier: www.sonnensteinschule.de<br />
.<br />
Zum Abschluss möchte ich<br />
dich noch einmal bitten, darauf<br />
Einfluss zu nehmen, dass nicht<br />
nur die Unterrichtsverpflichtung<br />
an Gymnasien nicht erhöht<br />
wird, sondern an allen Schulen<br />
die Unterrichtsverpflichtung gesenkt<br />
wird. Ebenso muss die<br />
Altersermäßigung, wie versprochen,<br />
zum Schuljahr 2014/2015<br />
wieder in vollem Umfang<br />
eingeführt werden. Auch sollte<br />
ein Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld<br />
für Angestellte und<br />
Beamte des Landes Niedersachsen<br />
umgehend wieder eingeführt<br />
werden. Bei einigen Kolleginnen<br />
und Kollegen ist der Frust<br />
mittlerweile recht hoch. Wenn<br />
nun die Versprechen nicht<br />
eingehalten werden, wird es<br />
sicherlich noch mehr Frust<br />
geben, der sich nicht positiv auf<br />
den Schulalltag auswirkt.<br />
Auf deinen Besuch in der<br />
Sonnensteinschule Horsten<br />
freue ich mich.<br />
Viele Grüße<br />
gez. W. Bohnsack<br />
(Wolfgang Bohnsack, Schulpersonalrat)
11 <strong>LEUCHTTURM</strong><br />
Schulpersonalrat der<br />
Sonnenscheinschule Horsten<br />
Horster Hauptstraße 42<br />
26446 Friedeburg-Horsten<br />
Hannover, 12. Dezember 2013<br />
Sehr geehrter Herr Bohnsack,<br />
vielen Dank für lhren Brief zu<br />
den geänderten Lehrerarbeitszeiten.<br />
Ich nehme lhre Befürchtungen<br />
und lhre Unzufriedenheit<br />
sehr ernst und mir ist bewusst,<br />
dass Sie durch Reformen wie die<br />
Streichung von Urlaubs- und<br />
Weihnachtsgeld in den vergangenen<br />
Jahren negative Einschnitte<br />
hinnehmen mussten.<br />
Gleichwohl bitte ich um<br />
Verständnis dafür, dass die<br />
Landesregierung für,eine umfassende<br />
Reformierung der Bildung<br />
in Niedersachsen neben Vorteilen<br />
für die Lehrer auch<br />
einschneidende Maßnahmen beschließen<br />
musste.<br />
So kann ich Ihr Argument,<br />
die Landesregierung würde keine<br />
weiteren Finanzmittel in die<br />
Bildung investieren, nicht teilen.<br />
Vielmehr werden durch Umschichtungen<br />
und Neufestlegungen<br />
insgesamt 420 Mio. Euro in<br />
die Bildung und damit in die<br />
Zukunft unserer Kinder investiert<br />
werden. Davon sind allein<br />
105 Mio. Euro neu vom<br />
Finanzministerium an das Kultusministerium<br />
zugewiesen worden.<br />
Diese Mittel werden auch<br />
lhnen und lhren Kolleginnen<br />
und Kollegen zugute kommen,<br />
zum einen werden 14,5 Mio.<br />
Euro in die Lehrerfort- und<br />
Weiterbildung investiert. Zum<br />
anderen werden Schulentwicklungsberater<br />
zur Unterstützung<br />
an Schulen eingesetzt werden<br />
und die Zahl der Schulpsychologen<br />
wird erhöht. Des Weiteren<br />
werden auch die Mittel für die<br />
Umsetzung der Inklusion und<br />
für Arbeits- und Gesundheitssicherheit<br />
im Schulwesen aufgestockt.<br />
Wie lhnen bekannt sein wird,<br />
hat der Landesrechnungshof die<br />
Landesregierung ebenfalls dazu<br />
aufgefordert, die Arbeitszeit für<br />
gymnasiale Lehrkräfte anzupassen<br />
und die Regelung der<br />
Altersermäßigung zu überprüfen.<br />
Dem liegt zugrunde, dass<br />
die Lehrerarbeitszeit an Gymnasien<br />
in Niedersachsen bundesweit<br />
am Niedrigsten ist und auch<br />
im Vergleich zu anderen<br />
Schulformen in Niedersachsen<br />
deutlich geringer ist. Allein der<br />
Gleichbehandlungsgrundsatz erfordert<br />
hier eine Anpassung.<br />
Gleiches gilt ebenfalls für die<br />
Regelung der Altersermäßigung .<br />
Da es keine andere Berufsgruppe<br />
mit ähnlichen Privilegien gibt,<br />
lässt hier ebenfalls der Gleichheitsgrundsatz<br />
des Grundgesetzes<br />
eine Reduzierung der<br />
Arbeitszeit im Alter lediglich bei<br />
Lehrerinnen und Lehrern nicht<br />
zu.<br />
Die Rot-Grüne Landesregierung<br />
hat sich eine Zukunftsoffensive<br />
für die Bildungspolitik<br />
vorgenommen, um den Ganztagsschulbetrieb<br />
in Niedersachsen<br />
weiter umzusetzen, die<br />
Olaf Lies Niedersächsischer<br />
Minister<br />
für Wirtschaft, Arbeit<br />
und Verkehr<br />
frühkindliche Bildung verlässlicher<br />
für die Eltern zu gestalten<br />
und die Ausstattung von<br />
Schulen zu verbessern, denn<br />
Bildung hat für die Niedersächsische<br />
Landesregierung oberste<br />
Priorität. Des Weiteren soll mit<br />
diesen Maßnahmen den Auswirkungen<br />
des Demographischen<br />
Wandels begegnet werden. So<br />
plant die Landesregierung keinerlei<br />
Abbau von Lehrerstellen,<br />
obwohl die Anzahl an Schülern<br />
in den kommenden Jahren<br />
deutlich sinken wird.<br />
Ich hoffe mithin, dass wir mit<br />
diesem Bündel an positiven<br />
Maßnahmen, welche zugegebenermaßen<br />
auch gewisse Einschränkungen<br />
enthalten, in eine<br />
positive Zukunft der Bildung in<br />
Niedersachsen blicken und hoffe<br />
auf eine weitere konstruktive<br />
Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen<br />
und Lehrern vor Ort.<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
Lieber Olaf,<br />
am 24.11.2013 habe ich dir<br />
einen Brief geschrieben. Leider<br />
wurde dennoch die Arbeitszeit<br />
der Lehrerinnen und Lehrer an<br />
Gymnasien um eine Stunde<br />
erhöht. Aber nicht nur dies ist<br />
geplant. Mittlerweile ist im<br />
Erlassentwurf zur Arbeitszeitverordnung<br />
für Lehrerinnen und<br />
Lehrer in Niedersachsen die<br />
Altersermäßigung für Lehrerinnen<br />
und Lehrer ab 55 bzw. 60<br />
Jahren komplett gestrichen worden.<br />
Dies ist überhaupt nicht<br />
mehr tolerierbar. Viele Kolleginnen<br />
und Kollegen haben sich<br />
auf die Versprechen unserer<br />
Partei verlassen und werden nun<br />
erneut getäuscht. Nein, es ist<br />
sogar noch schlimmer, sie<br />
werden betrogen. Zusagen werden<br />
nicht eingehalten. Die<br />
Kolleginnen und Kollegen,<br />
denen jetzt die Altersermäßigung<br />
versagt wird, haben mit<br />
ihrer Mehrarbeit in den letzten<br />
Jahren dazu beigetragen, dass in<br />
Niedersachsen trotz fehlender<br />
Lehrerstunden an den Schulen<br />
guter Unterricht gemacht wurde.<br />
Bei diesem Umgang der Landesregierung<br />
mit ihren Bediensteten<br />
bleibt die Motivation auf der<br />
Strecke.<br />
Merkwürdig ist, dass unsere<br />
jetzige Kultusministerin Frauke<br />
Heiligenstadt, bevor sie Kultusministerin<br />
wurde, noch etwas<br />
ganz Anderes gesagt hat:<br />
„Die Lehrer sollen mit<br />
längerer Arbeitszeit für<br />
etwas büßen, das die<br />
Landesregierung in den<br />
vergangenen Jahren verbockt<br />
ha“, sagte die<br />
bildungspolitische Sprecherin<br />
Frauke Heiligenstadt.<br />
„Es ist unverschämt<br />
und dreist, die verfehlte<br />
Bockhorn, den<br />
8. Juni 2014
<strong>LEUCHTTURM</strong><br />
12<br />
Bildungspolitik von Ex-Kultusminister<br />
Busemann auf dem<br />
Rücken der Lehrkräfte auszutragen<br />
und in diesem Zusammenhang<br />
auch noch von<br />
größtmöglichem Vertrauensschutz<br />
zu sprechen, wie es<br />
Kultusministerin Heister-Neumann<br />
getan hat.“<br />
(http://www.spd-fraktionniedersachsen.de/aktuelles/pressemitteilungen/143093.php?y-<br />
=&m=&t=216438&a=216214-<br />
&page=4)<br />
Findest du diesen Umgang mit<br />
uns Lehrerinnen und Lehrern so in<br />
Ordnung? Frauke Heiligenstadt handelt<br />
hier anscheinend nach dem<br />
Spruch: „Was stört mich mein Gerede<br />
von gestern.“<br />
Diese Haltung und diesen Umgang<br />
mit den Landesbediensteten<br />
kann ich nicht länger meinen<br />
Kolleginnen und Kollegen gegenüber<br />
als SPD-Mitglied und Personalrat<br />
vertreten. So kann man ihnen nicht<br />
raten, die SPD erneut zu wählen.<br />
Ich fordere dich hiermit erneut<br />
auf, dich für eine Einhaltung der<br />
gegeben Zusagen der SPD vor ihrem<br />
Regierungsantritt einzusetzen.<br />
Auch bitte ich dich noch einmal,<br />
auf mein Schreiben vom 24.11.2013<br />
zu antworten und inhaltlich darauf<br />
einzugehen und Stellung zu beziehen.<br />
Pardon, aber Karin Evers-Meyer<br />
antwortet immer ausführlich und<br />
kompetent auf gestellte Anfragen.<br />
Von dir habe ich leider nur eine<br />
pauschalisierte Antwort bekommen.<br />
Du schreibst dort von einer<br />
privilegierten Regelung für die<br />
Altersermäßigung. Meinst du damit,<br />
dass Lehrerinnen und Lehrer in<br />
Niedersachsen dadurch privilegiert<br />
sind, keine Altersermäßigung zu<br />
erhalten. In anderen Bundesländern<br />
gibt es die Altersermäßigung sehr<br />
wohl noch, vielfach sogar bis zu drei<br />
Unterrichtsstunden pro Woche.<br />
Du schreibst auch von einer<br />
Erhöhung der Ausgaben im Bildungsbereich.<br />
Dies mag so sein. Deine<br />
Aufzählung klingt auch für jemanden,<br />
der sie in der Presse liest, recht<br />
plausibel und pauschal. Eltern<br />
werden davon begeistert sein und<br />
vielleicht erneut SPD wählen. Diese<br />
Kosten betreffen leider aber nicht<br />
Ausgaben für die Entlastung der<br />
Kolleginnen und Kollegen. Im<br />
Gegenteil, sie werden teilweise zu<br />
Lasten der Lehrerinnen und Lehrer,<br />
der Schulleiterinnen und Schulleiter<br />
erwirtschaftet. Seit vielen Jahren<br />
haben sich deren Aufgaben erhöht<br />
und es gab und gibt keinerlei<br />
Entlastung im Gegenzug. Insofern<br />
halte ich die Inhalte meines unten<br />
angeführten Briefes vom 24.11.2014<br />
weiterhin für richtig und von dir für<br />
unzureichend beantwortet.<br />
Es ist auch interessant, dass<br />
Politiker von Privilegien bei anderen<br />
Berufsgruppen reden, dabei aber<br />
anscheinend vergessen, dass sie bei<br />
der Altersversorgung besonders privilegiert<br />
sind. Eine Lehrerin oder ein<br />
Lehrer muss, wenn er aufgrund der<br />
Belastung vorzeitig in den Ruhestand<br />
geht, mit Einschnitten bei der<br />
Altersversorgung rechnen, auch wenn<br />
er mehr als 35 Jahre im Dienst war.<br />
Ein Politiker muss dies nach 35<br />
Jahren nicht. Er kann bereits nach<br />
weniger Dienstjahren verlustfrei<br />
seinen Ruhestand genießen.<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
Wolfgang Bohnsack<br />
A<br />
uch das Kollegium des Gymnasiums Ulricianum beteiligte sich an der von der GEW initiierten Aktion „5 vor 12“ anlässlich der<br />
Anhörung der Landesregierung zur geplanten Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung für die Gymnasiallehrer und der fortwährenden<br />
Aussetzung der Altersermäßigung. Dazu versammelten sich in der Pause vor der 5. Stunde die Kolleginnen und Kollegen, die keinen<br />
dienstlichen Verpflichtungen nachzugehen hatten, vor dem Hauptportal der Schule, um zu dokumentieren, dass sie nach wie vor die<br />
Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung bei gleichbleibender Arbeitszeit als ungerechtfertigt ansehen.<br />
Erläuternd gibt das Kollegium folgendes zur Kenntnis:<br />
Was uns verloren gehen wird. Ein Blick auf die geplanten Sparmaßnahmen der Landesregierung im Schulwesen.<br />
Nehmen wir an, Sie haben eine gesetzlich festgelegte Arbeitszeit sowie auch bestimmte Aufgaben, die sie<br />
verpflichtend innerhalb dieser Arbeitszeit erfüllen müssten. Wäre das geschehen, blieben Ihnen Spielräume, in denen Sie<br />
zusätzliche, freiwillige Arbeiten durchführen könnten, bevor Sie nach Hause gingen. Schöne Sache.<br />
Würden nun bei gleich bleibender Arbeitszeit die Pflichtaufgaben vermehrt, was würde passieren? Sie könnten weniger<br />
Zusätzliches tun: Verlust an Vielfalt.<br />
Oder Sie müssten schneller, d.h. weniger sorgfältig und damit fehleranfällig arbeiten: Qualitätsverlust. Oder Sie täten<br />
alles wie zuvor, aber in Ihrer Freizeit: Verlust von Privatleben und Regenerierungszeit.<br />
Wie immer Sie sich entscheiden würden, das Ergebnis wäre beklagenswert.<br />
Wir Lehrkräfte müssen uns entscheiden. Wir beklagen die Unterrichtsstundenerhöhung und den Wegfall der<br />
Entlastungsstunden für ältere Kollegen, die das Kabinett der Landesregierung beschlossen hat.<br />
Das Freiwillige, Zusätzliche im Rahmen unserer Arbeitszeit nicht mehr unterbringen zu können, weil die<br />
Pflichtaufgaben, nämlich die Unterrichtsstunden, vermehrt werden, halten wir für eine massive Beschneidung unserer<br />
pädagogischen Möglichkeiten. Wandertage, Projekte, Theaterbesuche, Konzerte, Klassenfahrten u.v.m. sind wichtig.<br />
Nicht nur unsere Schüler mögen sie.<br />
Oberflächlicher zu arbeiten, verträgt unser Bildungsauftrag nicht. Wir sollen Fehler vermeiden helfen und möglichst<br />
wenige selbst machen. Auch Beratungs- und Gesprächszeiten, solide Vor-. und Nachbereitung, Besprechungen und<br />
Konferenzen bedeuten die Qualität unserer Arbeit. Alles dies in der Freizeit machen? Unsere Arbeit ist wunderbar, und<br />
wir tun sie gern, aber Privatleben haben wir auch, und alle Anstrengung bedarf ernstzunehmender Ruhephasen. 40<br />
Wochenstunden sind genug. Nach allen vorliegenden Untersuchungen arbeiten die meisten von uns schon jetzt erheblich<br />
viel mehr.<br />
Wir Lehrkräfte beklagen die Unterrichtsstundenerhöhung und den Wegfall der Entlastungsstunden für ältere Kollegen,<br />
die das Kabinett der Landesregierung beschlossen hat. Wir bedauern, dass durch diese Sparmaßnahmen rund 1700 junge<br />
Lehrkräfte nicht eingestellt werden können und möglicherweise in andere Bundesländer abwandern. Wir fürchten um die<br />
Qualität unserer Arbeit in der Erziehung und Bildung unserer jungen Leute.<br />
Wir finden diese Aufgabe wichtig, für die Gesellschaft, für Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft und für jeden<br />
einzelnen unserer jungen Menschen.
Aktion »5 vor 12«<br />
am 20. März 2014 zur Änderung der Arbeitszeitverordnung<br />
Von Emden bis Varel:<br />
Bild-Dokumentation der<br />
teilnehmenden Schulen<br />
Hinnerk Haidjer Schule<br />
Förderschule Lernen Moordorf<br />
BBS Jever<br />
Grundschule Wallinghausen<br />
Neues Gymnasium Wilhelmshaven WZ Bilderdienst
<strong>LEUCHTTURM</strong><br />
14<br />
Gymnasium Ulricianum Aurich<br />
Oberschule Norden<br />
Paul-Sillus-Grundschule Jever<br />
Hauptschule Bremer Straße Wilhelmshaven<br />
Grundschule Altengroden Wilhelmshaven<br />
Oberschule Obenstrohe
15 <strong>LEUCHTTURM</strong><br />
Pensionäre KGS Großefehn<br />
Oberschule Hohenkirchen<br />
Realschule Aurich<br />
Hafenschule Wilhelmshaven<br />
Grundschule Victorbur<br />
Grundschule Harlinger Weg Jever
<strong>LEUCHTTURM</strong><br />
16<br />
IGS Wilhelmshaven<br />
Pestalozzi-Schule Varel<br />
Gemeinschaftsaktion von<br />
Förderschule, Carl-Gitterm<br />
Johannes-Althusius-Gymnasium Emden
17 <strong>LEUCHTTURM</strong><br />
Mariengymnasium Jever<br />
BBS 1 Wilhelmshaven<br />
on GS Esens-Nord, Christian-Wilhelm-Schneider<br />
rmann Realschule und Internatsgymnasium Esens<br />
Grundschule Sandhorst<br />
BBS Friedenstraße Wilhelmshaven
<strong>LEUCHTTURM</strong><br />
18<br />
KGS Wittmund<br />
BBS Conerus Schule Norden<br />
Grundschule Upstalsboom Aurich<br />
Astrid-Lindgren-Schule Moordorf<br />
IGS Waldschule Egels<br />
BBS1 Emden
Grundschule Bockhorn<br />
19 <strong>LEUCHTTURM</strong><br />
Grundschule Moorhusen<br />
Grundschule Oestringfelde<br />
Grundschule Wiesenhof<br />
Friederikenschule Großheide<br />
Grundschule Riepe
<strong>LEUCHTTURM</strong><br />
20<br />
HRS Moorhusen und Außenstelle<br />
Ulricianum Aurich<br />
Grundschule Grüner Weg Emden<br />
Grundschule Mühlenweg Wilhelmshaven<br />
Elisa-Kauffeld-Oberschule Jever<br />
HRS Moordorf<br />
GS Sonnensteinschule Horsten
21 <strong>LEUCHTTURM</strong><br />
SeniorInnen unterwegs<br />
Auf Spurensuche in Emden<br />
Ende April trafen sich 25<br />
SeniorInnen des Kreisverbandes<br />
Norden, um in Emden in<br />
der a Lasco Bibliothek Spurensuche<br />
zu betreiben.<br />
Die Große Kirche, ehemals<br />
größte Kirche in der Stadt<br />
Emden, wurde im Verlauf des<br />
Zweiten Weltkrieges durch einen<br />
Bombenangriff zerstört. Der<br />
Chor aus dem 15. Jahrhundert<br />
blieb auch lange nach dem Krieg<br />
als Ruine und Mahnmal stehen<br />
und wurde zwischen 1992 und<br />
1995 in einen Bibliotheksneubau<br />
integriert, der Altes und<br />
Neues architektonisch verbindet.<br />
Heute findet man hier eine<br />
Bibliothek, die die älteste und<br />
wertvollste Bibliothek Ostfrieslands<br />
ist, mit über 150 000<br />
Bänden aber auch von überregionaler<br />
Bedeutung.<br />
Benannt wurde die Bibliothek<br />
nach Johannes a Lasco, der 1499<br />
in der Nähe von Warschau, dem<br />
Stammsitz seiner Familie, geboren<br />
wurde. Seine Familie zählte<br />
zum Hochadel. Sein Onkel Jan<br />
wird 1503 königlicher Kanzler.<br />
A Lasco studiert in Bologna<br />
und Padua, kehrt in seine<br />
Heimat zurück, erhält 1521 die<br />
Priesterweihe und beginnt, mit<br />
weiteren geistlichen Einkünften<br />
versehen, eine Laufbahn in der<br />
Kirche und zugleich als königlicher<br />
Sekretär.<br />
In Basel begegnet a Lasco<br />
erstmals Erasmus von Rotterdam.<br />
Er gehört zu Erasmus’<br />
Lieblingsschülern und erwirbt<br />
dessen Bibliothek, die er nach<br />
dessen Tod auch erhält.<br />
Anfang 1540 heiratet a Lasco<br />
Barbara, eine Flämin aus recht<br />
einfachen Verhältnissen. Er wird<br />
so der erste Geistliche Polens,<br />
der offen den Priesterzölibat<br />
bricht. Um der Inquisition zu<br />
entgehen, flüchtet er etwa Mitte<br />
1540 nach Ostfriesland. Graf<br />
Enno II. Cirksena bietet ihm das<br />
Amt eines Superintendenten an.<br />
A Lasco lehnt aber zunächst ab.<br />
In Ostfriesland konkurrieren zu<br />
dieser Zeit Altgläubige mit<br />
lutherischen vor allem auch mit<br />
starken täuferischen Tendenzen.<br />
Erst Mitte 1542 nach dem<br />
endgültigen Bruch mit der<br />
polnischen Kirche nimmt er den<br />
Ruf der Witwe Ennos II., der<br />
Regentin Anna von Oldenburg,<br />
in das Amt eines Superintendenten<br />
an und zieht nach Emden.<br />
Johannes a Lasco schreibt in<br />
dieser Zeit an seinen Freund<br />
Hardenberg in Bremen: „Wir<br />
sind hier alle so aufgenommen, daß<br />
es bei den nächsten Verwandten<br />
nicht liebevoller hätte geschehen<br />
können. Alle angesehenen Männer<br />
des Landes sind so besorgt um die<br />
Kirche, daß ich ihren Eifer, ihre<br />
Freundlichkeit, ja auch ihre Freigebigkeit<br />
nicht genug preisen kann.<br />
Wir sind in ein gemeinsames<br />
Vaterland gekommen.“<br />
1546 erwirbt a Lasco von der<br />
Gräfin das ehemalige Kloster<br />
Abbingwehr bei Loppersum für<br />
4500 Reichstaler und lässt sich<br />
dort mit seiner wachsenden<br />
Familie nieder.<br />
Johannes a Lasco wird<br />
maßgeblich verantwortlich für<br />
die Neugestaltung des ostfriesischen<br />
Kirchenwesens, insbesondere<br />
mit der Herausbildung von<br />
Kirchenrat und Kirchenzucht.<br />
1549 bricht er mit Ostfriesland<br />
und geht nach England, wo<br />
er Glaubensflüchtlionge betreut<br />
und an der Reformation der<br />
englischen Kirche mitwirkt. Als<br />
Maria „die Katholische“ auf den<br />
englischen Thron gelangt, setzt<br />
unter ihrer Herrschaft eine<br />
blutige Rekatholisierung des<br />
Landes ein. Den Flüchtlingsgemeinden<br />
a Lascos werden die bis<br />
dahin gewährten Privilegien<br />
entzogen. Im November 1553<br />
beschließt a Lasco, mit 175<br />
Mitgliedern seiner Gemeinde zu<br />
fliehen. Nach einer Odyssee über<br />
verschiedene Hafenstädte der<br />
Ostseeküste trifft die Flüchtlingsgruppe<br />
schließlich in Emden<br />
ein, wohin a Lasco inzwischen<br />
zurückkehren konnte.<br />
Die Aufnahme der meist aus<br />
den Niederlanden stammenden<br />
Glaubensflüchtlinge markiert<br />
den Anfang eines breiten Stroms<br />
von Exulanten, die in Emden<br />
und Ostfriesland Asyl vor den<br />
Verfolgungen in den habsburgischen<br />
Niederlanden suchen. Sie<br />
legt zugleich den Grund für die<br />
besondere Rolle der Emder<br />
Kirche als „Moederkerk“ des<br />
niederländischen Protestantismus.<br />
Nach dem ausführlichen<br />
Rückblick in die Geschichte<br />
trafen sich die SeniorInnen im<br />
“Cafe´ am Schiefen Turm“ in<br />
Loppersum, wo bei Kaffee und<br />
Kuchen<br />
neben Informationen<br />
aus<br />
der GEW<br />
auch Privates<br />
im Vordergrund<br />
stand. Mit<br />
der Ehrung<br />
von<br />
langjährigen<br />
Mitgliedern<br />
schloss die<br />
Veranstaltung.<br />
Herbert Czekir
<strong>LEUCHTTURM</strong><br />
Fachgruppentag - der erste Schritt zu<br />
einer großen Herausforderung<br />
Herbert Czekir<br />
Rainer Haase<br />
Der Fachgruppentag in Sage<br />
stand diesmal unter dem<br />
Thema „Generationenwechsel“.<br />
Vielleicht war es dem Thema<br />
geschuldet, dass sich nur etwa 75<br />
Kolleginnen und Kollegen eingefunden<br />
hatten.<br />
Fast als sei es geplant, stellte<br />
die Fachgruppe SeniorInnen ein<br />
Drittel der TeilnehmerInnen<br />
und untermauerte so die<br />
Dringlichkeit der Thematik.<br />
Erfreulich ist:<br />
die Mitgliederzahl<br />
der GEW wächst,<br />
bundesweit und<br />
auch in Niedersachsen.<br />
Das stärkt<br />
die Stellung der<br />
Gewerkschaft als<br />
Gesprächs- und<br />
Tarifpartner gegenüber<br />
den Arbeitgebern,<br />
wenn<br />
es z. B. um Arbeitsbedingungen,<br />
Reformen und Löhne geht.<br />
Bedenklich ist: in immer<br />
mehr Kreisverbänden können<br />
die Referate nicht mehr besetzt<br />
werden, schnellt der Altersdurchschnitt<br />
in die Höhe. Häufig sind<br />
die SeniorInnen in der Mehrheit.<br />
Als kompetente Referenten<br />
hatte der Bezirksvorstand Maren<br />
Kaminski, GEW Bezirksverband<br />
Hannover, und Rainer Haase,<br />
Einige Senioren<br />
Coach und Organisationsberater<br />
aus München, eingeladen.<br />
Kollege Haase, ebenfalls<br />
GEW-Mitglied, stellte gleich zu<br />
Anfang klar, dass ein Generationenwechsel<br />
mehr sei als das<br />
„Weiterreichen eines alten Hutes“.<br />
Da die berufliche und<br />
politische Identität der Generationen<br />
unterschiedlich geprägt<br />
seien, könnten die entstandenen<br />
Werte und Normen nicht einfach<br />
„übergeben“ werden.<br />
Vielmehr sei dies ein hochkomplexer<br />
Vorgang mit Lernprozess.<br />
Dabei könne eine<br />
Gewerkschaft sich „neu erfinden“<br />
oder aber auch untergehen.<br />
Auch müsse man beachten, dass<br />
sich die Erziehungsarbeitsplätze,<br />
auf die sich die gewerkschaftliche<br />
Arbeit bezöge, quantitativ und<br />
qualitativ gewandelt hätten.<br />
Auch die technischen Möglichkeiten<br />
des „Politikmachens“<br />
und Organisierens hätten sich<br />
enorm entwickelt.<br />
Generationenwechsel sei deshalb<br />
in erster Linie Generationendialog<br />
und damit eine<br />
gemeinsame Aufgabe der „Alten“<br />
und der „Neuen“.<br />
Dabei läge die Initiativ-<br />
Verantwortung für den Dialog<br />
bei denjenigen, die jetzt Verantwortung<br />
in der GEW tragen und<br />
22<br />
über Ressourcen entscheiden.<br />
Die Initiative müsse bestehen<br />
in<br />
n der Einladung zum Dialog,<br />
n dem Angebot der eigenen<br />
Erfahrungen und Organisationsressourcen,<br />
n dem Schaffen und Unterstützen<br />
von Handlungs- und<br />
Erprobungsräumen,<br />
n dem Zulassen von neuen<br />
Erfahrungen und Veränderungen.<br />
Haase prognostizierte: Gelungener<br />
Generationenwechsel wird<br />
die GEW nicht reproduzieren<br />
wie sie war oder ist, sondern wird<br />
sie weiter entwickeln!<br />
Kritisch äußerte sich Haase<br />
zur Organisationsstruktur der<br />
GEW. Er nannte sie eine<br />
„suboptimal verschränkte Doppelstruktur“.<br />
Dies habe seine Ursache in<br />
den verschiedenen Aufgabenbereichen<br />
der GEW.<br />
Einerseits müsse man die<br />
politischen Aufgaben einer Gewerkschaft<br />
erfüllen, andererseits<br />
aber auch die Ziele einer<br />
Bildungsgewerkschaft verfolgen.<br />
Die Trennung in Regionalprinzip<br />
(z. B. die KV´s) und in<br />
Fachgruppen bilde zwar die Ziele<br />
der GEW ab, verschlänge aber<br />
auch Ressourcen und machen<br />
den Zugang jüngerer Mitglieder<br />
schwieriger, da die Struktur und<br />
ihre Entscheidungsprozesse<br />
kaum überschaubar seien.<br />
„Ich gehe zu keiner Veranstaltung<br />
bei der ich mich dumm und<br />
inkompetent fühle.“<br />
Ein „niederschwelliger“ Zugang<br />
zu Mitarbeit und Gestaltung<br />
für junge Mitglieder ließe<br />
sich eher über die Fachgruppen<br />
organisieren, war sich Haase<br />
sicher. Diese seien aber in der<br />
Regel „entscheidungsferner“.<br />
Deshalb gelte es neue Formen<br />
der Arbeit zu erproben.<br />
„Temporäre Projektorganisation<br />
und Kampagnenorganisation<br />
wird für junge Mitglieder und
23 <strong>LEUCHTTURM</strong><br />
Info-Veranstaltung des Bezirks erfolgreich<br />
Anfang Mai trafen sich fast 40<br />
Kolleginnen und Kollegen<br />
aus dem gesamten Bezirk in<br />
Westerstede zu der jährlichen<br />
Info-Veranstaltung. Diesmal<br />
ging es um das Thema „Rund<br />
um die Pflege“.<br />
Dazu hatte die FG SeniorInnen<br />
eine Fachberaterin der<br />
„Compass-Pflegeberatung“ eingeladen.<br />
Ausführlich stellte die<br />
Beraterin dar, dass die Organisation<br />
eine gesetzlich vorgeschriebene<br />
Leistung der Privaten<br />
Pflegekassen sei und somit von<br />
ihnen finanziert werde, dass<br />
man jedoch eine eigenständige<br />
und unabhängige Einrichtung<br />
sei. Natürlich mag niemand gern<br />
an einen Ernstfall denken,<br />
besonders nicht im jungen Alter.<br />
Doch schnell kann eine<br />
Situation eintreten, die die<br />
Eigenständigkeit einschränkt, in<br />
der man auf fremde Hilfe<br />
angewiesen ist.<br />
Wenn wir selbst oder unser<br />
Partner, die Eltern, Großeltern<br />
oder Freunde plötzlich der Hilfe<br />
und Pflege bedürfen - sei es<br />
altersbedingt, durch Krankheit<br />
oder einen Unfall - tauchen<br />
plötzlich viele Fragen auf.<br />
Um in diesen Fällen zu<br />
informieren und konkrete Hilfestellung<br />
zu geben, sind bundesweit<br />
200 geschulte Fachberater<br />
im Einsatz. Die „Compass-<br />
Pflegeberatung“ bietet unabhän-<br />
sympathisierende KollegInnen<br />
notwendig sein, um ihnen<br />
Mitarbeit zu ermöglichen“, gab<br />
Haase den „Alten“ mit auf den<br />
Weg.<br />
Zum Ende seines Vortrags gab<br />
der Referent praktische Tipps,<br />
wie eine Umsetzung gelingen<br />
könnte.<br />
Er mahnte aber auch:<br />
„Jede Organisationsentwicklung<br />
birgt die Gefahr der<br />
Abwertung des Bestehenden mit<br />
den entsprechenden Folgen der<br />
narzisstischen Kränkung Einzelner<br />
oder der von Gruppen.<br />
Wertschätzung für die Erfahrungen,<br />
Interessen, Ideen, Experimente<br />
und Vorschläge<br />
der „jungen“<br />
wie der „alten“ Generationen<br />
ist der<br />
Schlüssel zur Vermeidung<br />
von „Beschädigungen“.<br />
Im Anschluss an<br />
den Vortrag diskutierte<br />
die Versammlung<br />
lebhaft, bevor<br />
sie den Referenten<br />
mit viel Beifall verabschiedete<br />
- in der<br />
Gewissheit, erst am<br />
Anfang eines langen<br />
und beschwerlichen<br />
Weges zu stehen.<br />
gig und kostenfrei Informationen<br />
und Hilfestellung rund um<br />
das Thema Pflege an.<br />
Der Beratungsservice richtet sich<br />
an<br />
• pflege- und hilfsbedürftige<br />
Menschen,<br />
• deren Angehörige und / oder<br />
Betreuer<br />
• sowie an allgemein Ratsuchende,<br />
die sich bereits im<br />
Vorfeld einer möglichen Pflegesituation<br />
oder nach der<br />
Feststellung eines Pflegebedarfs<br />
informieren wollen.<br />
Dabei reicht das Beratungsangebot<br />
von COMPASS von<br />
einem einfachen Gespräch bis<br />
hin zu einer Begleitung in<br />
schwierigen Situationen. Die<br />
Beratung kann entweder am<br />
Telefon oder im Rahmen eines<br />
Besuches zu Hause bzw. in der<br />
Pflegeeinrichtung erfolgen.<br />
Die Pflegeberatung kann sich<br />
z.B. auf folgende Themen<br />
beziehen:<br />
Entlassung aus dem Krankenhaus<br />
in die häusliche Pflege<br />
• stationäre, teilstationäre sowie<br />
ambulante Betreuung und<br />
Versorgung<br />
• Verfahren zur Feststellung der<br />
Pflegebedürftigkeit<br />
• Leistungen aus der Pflegepflichtversicherung<br />
• Finanzielle Aspekte der Pflegesituation<br />
• weitergehende sozialrechtliche<br />
Ansprüche<br />
Eindringlich schilderte die<br />
Beraterin an Fallbeispielen,<br />
welche Hilfestellungen die<br />
„Compass- Pflegeberatung“ bietet.<br />
Am Ende der Vormittagsveranstaltung<br />
war allen Teilnehmern<br />
klar, dass die Inanspruchnahme<br />
der Pflegeberatung im<br />
Fall des Falles für die Betroffenen<br />
und Angehörigen eine<br />
enorme Hilfe ist.<br />
Schade nur, dass sich fast nur<br />
Pensionäre für die Veranstaltung<br />
interessierten, obwohl jeder in<br />
eine Situation kommen kann,<br />
die aus eigener Kraft kaum oder<br />
nicht mehr zu bewältigen ist.<br />
Für weitere Informationen<br />
bietet sich die Internetseite<br />
www.compass-pflegeberatung.de<br />
an. Kontakt kann auch über die<br />
gebührenfreie Telefonnummer<br />
0800 1018800 aufgenommen<br />
werden.<br />
Der Nachmittag stand dann<br />
im Zeichen gewerkschaftlicher<br />
Themen. Dabei ging es um<br />
vornehmlich um Themen wie<br />
Beihilfe, Versorgung und Vorsorge.<br />
Dabei soll auch an dieser<br />
Stelle noch einmal auf die<br />
Broschüre „Vorsorge ist sicherer“<br />
hingewiesen werden. Sie ist auf<br />
allen Ebenen der GEW anzufordern<br />
und dient nicht nur<br />
Älteren sich auf einen möglichen<br />
Ernstfall vorzubereiten.<br />
Herbert Czekir
<strong>LEUCHTTURM</strong><br />
Die Konsequenz der fehlenden<br />
politischen Jugend<br />
Hasso<br />
Rosenthal<br />
In der Bundesrepublik hat in<br />
den letzten Jahren eine<br />
politisch engagierte Generation<br />
die Gesellschaft gestaltet, geleitet<br />
und durchdacht. In Verbänden,<br />
Gewerkschaften und Parteien,<br />
Medien und Verlagen kommen<br />
die Bürger der 68er Generation<br />
in die Jahre. Und treten ab.<br />
Nachfolger sind wenige in Sicht.<br />
Die Gesellschaft, der Staat erlebt<br />
einen Umbruch, der die Demokratie<br />
schlussendlich gefährden<br />
kann. Das Problem ist der<br />
fehlende Generationswechsel.<br />
Aber warum fehlt er?<br />
Karl Mannheim hat in den<br />
20er Jahren des letzten Jahrhunderts<br />
eine Theorie über das<br />
Zustandekommen politischer<br />
Generationen formuliert. Das<br />
zentrale Kriterium für die<br />
Entwicklung einer „typischen“,<br />
„genuin besonderen“ Generation<br />
ist nicht die Gemeinsamkeit,<br />
sondern der Konflikt der<br />
Generationen. Dazu gehört aber<br />
auch das Gemeinschaftsgefühl<br />
von Heranwachsenden, die sich<br />
ihre Identität an gemeinsamen<br />
Grunderlebnissen bilden, die sie<br />
von der Eltern- bzw. Großelterngeneration<br />
unterscheiden. Das<br />
gefühlte gemeinsame Schicksal<br />
(Kriegserlebnisse, Widerstand<br />
gegen Notstandsgesetze, Empörung<br />
über den Krieg in Vietnam,<br />
Opposition gegen Umweltzerstörungen)<br />
formt eine „Generation<br />
für sich“. Sie muss demnach<br />
ein Bewusstsein ihrer selbst<br />
entwickeln. Verwandte Gefühle<br />
oder Denkweisen stärken jeweils<br />
eine Generation in ihrer<br />
Opposition zum Hergebrachten,<br />
um gemeinschaftlich die Bürgergesellschaft<br />
neu und voranschreitend<br />
gestalten zu wollen.<br />
Polarisierende Ereignisse haben<br />
dabei die Konsequenz der<br />
Ausdifferenzierung des Generationenzusammenhangs<br />
und stärken<br />
ihn. „Was sich aneinander<br />
reibt, bezieht sich aufeinander.“<br />
Zur Frage nach dem Sinn<br />
werden immer wieder Antworten<br />
gesucht. Man muss sich auf das<br />
Leben einlassen. Wer das tut,<br />
und was bleibt einem anderes<br />
übrig, entwickelt Engagement.<br />
Nur die Ausformungen sind<br />
verschieden. Sie gehen von der<br />
Selbstverwirklichung zur<br />
Freundschaft, zur Gemeinschaft,<br />
über die Metaphysik (Religion)<br />
bis hin zum politischen Engagement<br />
oder dem Engagement in<br />
der Community.<br />
Entscheidend bei den 68ern,<br />
dazu gehören auch diametral<br />
entgegengesetzte<br />
Positionen von<br />
Ströbele bis<br />
Schäuble, waren<br />
der eskalierende<br />
Vietnamkrieg<br />
und der Kampf<br />
gegen die Notstandsgesetze.<br />
Die<br />
Spiegelaffaire<br />
oder Strauß Fibag-Skandal<br />
(1961-1962) waren<br />
ebenfalls politische<br />
Großereignisse,<br />
die eine<br />
Generation geprägt<br />
haben. Und<br />
die 68er Kultur-<br />
24<br />
reform vorbereitet haben. Die<br />
Generation der damaligen Jugend<br />
fand ihre Gemeinsamkeiten<br />
auch im Kampf gegen den<br />
Rückfall in alte, autoritäre<br />
Denkmuster („Unter den Talaren<br />
der Muff von tausend Jahren“).<br />
Hannah Ahrends Theorien<br />
waren bewusstseinsprägend. Der<br />
Schock der Erschießung Benno<br />
Ohnesorges positionierte auch<br />
viele bis dahin politisch Indifferente.<br />
Viel Engagement war die<br />
Folge, da gab es die Falken,<br />
große Juso- bzw. JU-Gruppen,<br />
Studentenbewegung, Schülerbewegung,<br />
Lehrlingsbewegung.<br />
Doch welchen Generationskonflikt<br />
soll es heute geben, der<br />
sich mit dem Gutmenschentum<br />
der gesellschaftlich Aktiven<br />
auseinandersetzt? Die vielen<br />
kleinen Skandälchen der Gegenwart<br />
schläfern eher Engagement<br />
ein, da der mediale Grundtenor<br />
doch eher in Richtung des<br />
scheinbar Zwecklosen geht. Interessant,<br />
wie Schelsky 1957 (Die<br />
skeptische Generation) die Nachkriegsgeborenen<br />
beschreibt:<br />
„Diese Generation ist skeptischer,<br />
glaubens- oder wenigstens<br />
illusionsloser als alle Jugendgenerationen<br />
vorher. () Sie meistert<br />
das Leben, indem sie sich dem<br />
Menschsein stellt und ist darauf<br />
stolz. Was sich auch immer<br />
ereignen mag, diese Generation<br />
wird nie revolutionär, in<br />
flammender, kollektiver Leidenschaft<br />
auf die Dinge reagieren.“<br />
Das ändert sich allerdings mit<br />
den 68ern. Die in der Breite von<br />
SDS über Jusos, Junge Union<br />
oder RCDS weniger fanatisch,<br />
aber hochgradig politisch agierten.<br />
In den 80er Jahren konnte<br />
es aus den Nachbeben dieser<br />
Generation heraus passieren,<br />
dass eine 9.Klässlerin mich<br />
morgens mit Tränen in den<br />
Augen begrüßte: „Haben Sie<br />
gehört? Olof Palme ist erschossen<br />
worden!“ Das gibt es heute
25 <strong>LEUCHTTURM</strong><br />
nicht mehr. Wenige reagieren<br />
berührt, wenn jemand wie<br />
Nelson Mandela gestorben ist.<br />
Doch z.B. der bedeutende<br />
Einschnitt wie die friedliche<br />
Revolution in der DDR 1989<br />
hat keine politische Generation<br />
geschaffen. Die Diskussionen<br />
über die ungerechte wirtschaftliche<br />
Einvernahme der „neuen<br />
deutschen Bundesländer“ gingen<br />
über die Köpfe vieler hinweg.<br />
Butterweges Thesen der Armut<br />
in einem reichen Land rühren<br />
keine Massen, die Jugendarbeitslosigkeit<br />
in den Mittelmeerländern<br />
findet hier keine breite<br />
Bewegung für eine gerechtere<br />
EU. Die Flüchtlingsbewegungen<br />
in die Festung Europa ereifern<br />
politische Stammtische bei Facebook<br />
oder Twitter und kulminieren<br />
in den eindrucksvollen<br />
Beweis, dass Volksbefragungen<br />
(wie in der Schweiz zu der Frage)<br />
nicht anstrebenswert sind.<br />
Es gibt Ansätze für eine neue<br />
Jugendbewegung wie Occupy<br />
oder Attac. Doch bei der<br />
Mehrheit der Jugend herrscht<br />
„Schweigen im Walde“. Beobachten<br />
kann man den Rückzug<br />
ins Private und in die berufliche<br />
Karriere. Die Journalistin Meredith<br />
Haan stellt bei ihren<br />
Gleichaltrigen eine erstaunliche<br />
„Flucht in die politische<br />
Unmündigkeit“ fest. Es gehe<br />
nicht um das Erwachsenwerden,<br />
sondern um das Erwachsensein.<br />
() Die heutige Jugend wird sich<br />
weder für sich noch für die<br />
Gesellschaft Verantwortung übernehmen<br />
können. () Meine<br />
Generation ist in ihrer Grundhaltung<br />
gegenüber den großen<br />
Themen des Lebens hilflos<br />
überfordert, in Anspruchsdenken<br />
gefangen. Und resigniert in<br />
einem Maße, das sich durch<br />
keine Erfahrung rechtfertigt. ()<br />
Wenn es eins gibt, was uns quer<br />
über die Grenzen von Wohlstand,<br />
Bildung oder Ethnie<br />
hinweg eint, dann ist es das<br />
hemmungslosen Mitteilungsbedürfnis.“<br />
Da wird gepostet, getwittert,<br />
gesimst, werden Statusmeldungen<br />
bei Facebook aktualisiert,<br />
ohne Scheu vor irgendeiner<br />
abgedroschenen, bedeutungslosen<br />
Wendung oder Formel.<br />
Virtuelle Kommunikation findet<br />
überwiegend mit dem Facebook-<br />
Daumen statt. Ärgerliches, gemeinschaftliches<br />
Engagement<br />
oder Wut finden nicht statt. De<br />
Haaf weiter: „Wir sind nicht<br />
fähig, Kritik zu üben. Das<br />
politische Engagement ist in<br />
meiner Generation fast ausgestorben.<br />
Wenn wir das nicht<br />
ändern, werden wir irgendwann<br />
feststellen, dass eine andere,<br />
jüngere Generation über uns<br />
sagen wird: Sie ließen ihre Welt<br />
veröden, weil sie lieber labern<br />
wollten.“ Es überwiegt tatsächlich<br />
eine weitgehend entpolitisierte<br />
Kommunikation in den<br />
digitalen Netzwerken. Unsozial<br />
deshalb, weil sie Menschen von<br />
der face-to-face-Kommunikation,<br />
dem Dialog, der echten<br />
Begegnung abhalten.<br />
Es bedarf aber der politischen<br />
Leidenschaft, um politisches,<br />
gesellschaftliches Leben wirklich<br />
durchzuhalten. Ohne Streitkultur,<br />
ohne den Willen zu<br />
Begegnung, ohne Konflikttoleranz,<br />
ohne den langen Atem<br />
einer sich weiter entwickelnden<br />
Organisation droht das gesellschaftliche<br />
Leben zu veröden.<br />
Gewerkschaften, Verbände und<br />
Parteien haben ein Erfahrungswissen,<br />
Regeln, soziale Normen,<br />
dialektische Formen der Streitkultur,<br />
die verloren gehen<br />
können. wenn es uns nicht<br />
gelingt, die „Nachgeborenen“ zu<br />
aktivieren. Nachfolger sind wenige<br />
in Sicht. Die Gesellschaft, der<br />
Staat erlebt einen Umbruch, der<br />
die Demokratie schlussendlich<br />
gefährden kann. Das Problem ist<br />
der fehlende Generationswechsel.<br />
Imogen Seeger hat in ihrem<br />
Buch (60er Jahre) das Ergebnis<br />
einer weltweiten Untersuchung<br />
präsentiert, wie viele Bürger sich<br />
politisch oder verbandlich organisieren.<br />
Das waren in einer Zeit<br />
breiter gesellschaftlicher Debatten<br />
4%, davon waren wiederum<br />
10 % bereit, Verantwortung zu<br />
übernehmen. Im Klartext: 0,4%<br />
einer Gesellschaft tragen das<br />
demokratische Gerüst. Heute<br />
droht dies gegen Null zu gehen.<br />
Wir müssen dringend daran<br />
mitwirken, dass sich dieser Trend<br />
umkehrt. Gerade auch in den<br />
Gewerkschaften.<br />
Quellen: Deutschlandfunk; Essay<br />
und Diskurs; Beitrag vom<br />
22.09.2013 von Albrecht von Lucke<br />
„Staat und Politik-Enzyklopädie<br />
des Wissens“; Hrg. Fraenkel, Bracher;<br />
Frankfurt 1967<br />
„Knaurs Buch der modernen<br />
Soziologie“; Imogen Seeger; Zürich<br />
1970<br />
Sommerferien in Niedersachsen<br />
2014 31.07. – 10.09.<br />
2015 23.07. – 02.09.<br />
2016 23.06. – 03.08.<br />
2017 22.06. – 02.08.<br />
2018 28.06. – 08.08.<br />
2019 04.07. – 14.08.<br />
2020 16.07. – 26.08.<br />
2021 22.07. – 01.09.<br />
2022 14.07. – 24.08.<br />
2023 06.07. – 16.08.<br />
2024 24.06. – 02.08.
<strong>LEUCHTTURM</strong><br />
Das August-Gottschalk-Haus in Esens -<br />
erinnern, aufklären, mahnen!<br />
Jens Ritter<br />
Am 28. Juni 2014 eröffnet das<br />
jüdische Museum „August-<br />
Gottschalk-Haus“ in Esens seine<br />
neue Dauerausstellung über die<br />
Verfolgung und Vernichtung der<br />
ostfriesischen Juden sowie die<br />
renovierte Mikwe, das original<br />
erhaltene rituelle Tauchbad der<br />
1940 aufgelösten jüdischen<br />
Gemeinde in Esens.<br />
Damit kann das Team um<br />
Museumsleiterin Frauke Lüken<br />
bereits den dritten Abschnitt bei<br />
Das August-Gottschalk-Haus<br />
STEMPEL_ISRAEL_GEM<br />
der Umsetzung eines neuen<br />
Museumskonzeptes abschließen.<br />
Zuvor wurden 2012 das Schulzimmer<br />
der jüdischen Volksschule<br />
sowie der Seminarraum im<br />
Obergeschoss ihrer Bestimmung<br />
übergeben. Die wichtigste Zielgruppe<br />
des Museums sind<br />
Schülerinnen und Schüler, die<br />
hier einen einzigartigen<br />
außerschulischen<br />
Lernort vorfinden.<br />
Authentischer<br />
Ort der<br />
Geschichte<br />
der Juden in<br />
Ostfriesland<br />
Wie kaum ein<br />
anderer Ort in<br />
der Region steht das August-<br />
Gottschalk-Haus stellvertretend<br />
für die 400jährige jüdische<br />
Kultur in Ostfriesland.<br />
Das<br />
1899 erbaute<br />
Gebäude bildet<br />
mit den Fragmenten<br />
der in<br />
der Pogromnacht<br />
zerstörten<br />
Synagoge von<br />
1828 ein einmaliges<br />
Zeugnis<br />
dieser<br />
Epoche.<br />
In den authentischen<br />
Räumen Blick in die Ausstellung Schulzimmer<br />
des denkmalgeschützten<br />
Hauses wird<br />
erlebbar, dass Juden fester<br />
Bestandteil der ostfriesischen<br />
Gesellschaft in 11<br />
Synagogengemeinden waren:<br />
Bunde, Weener, Leer,<br />
Jemgum, Emden, Norden<br />
(mit Norderney), Aurich,<br />
Dornum, Wittmund,<br />
Neustadtgödens<br />
und<br />
Esens.<br />
Ihr Ende fand diese<br />
Zeit im April 1940,<br />
als mit Ausnahme der<br />
Bewohner des jüdischen<br />
Altenheimes in<br />
Emden die letzten<br />
Juden Ostfriesland<br />
verlassen mussten.<br />
Die Ausstellung<br />
Ein kurzer Film führt<br />
die Volksschulwesen<br />
informieren. Die Mikwe<br />
steht im Zentrum<br />
der Ausstellung über<br />
die jüdische Religion.<br />
Kultische und rituelle<br />
Objekte sowie Gegenstände<br />
des Alltagsglaubens,<br />
die teilweise<br />
noch vor der Auflösung<br />
der ostfriesischen<br />
Gemeinden hier in<br />
26<br />
Gebrauch waren, sind zu sehen.<br />
Komplett neu gestaltet ist der<br />
Ausstellungsbereich mit dem<br />
Titel „Ausgrenzung, Verfolgung,<br />
Vernichtung“. Er dokumentiert<br />
die leidvolle Geschichte der<br />
ostfriesischen Juden während der<br />
NS-Diktatur. Hier erleben die<br />
Besucher, dass der Rassenwahn<br />
der Nazis auch im beschaulichen<br />
Ostfriesland allgegenwärtig war,<br />
In der neu gestalteten Dauerausstellung
27 <strong>LEUCHTTURM</strong><br />
was dazu geführt hat, dass<br />
Ostfriesland 1940 als erste<br />
Region im Reich melden<br />
konnte: „Wir sind judenfrei!“<br />
Einzelne Schicksale werden<br />
exemplarisch für die etwa 1400<br />
Opfer des Holocausts erzählt.<br />
Angebote für Gruppen<br />
und Schulklassen<br />
Neben der Möglichkeit, das<br />
Museum auf eigene Faust zu<br />
erkunden, können sich die<br />
Schüler natürlich auch durch die<br />
Ausstellung führen lassen.<br />
Daneben bietet das August-<br />
Gottschalk-Haus einen Workshop<br />
für Schulklassen an: Unter<br />
dem Motto „Die Juden in Esens<br />
– längst vergessene Mitbürger<br />
Blick in die neue Ausstellung<br />
unserer Stadt“ lernen die<br />
Jugendlichen in Kleingruppenarbeit<br />
jeweils eine jüdische<br />
Familie aus Esens kennen. Sie<br />
gehen auf Spurensuche im<br />
Museum und in der Stadt,<br />
erkunden frühere Wohn- und<br />
Arbeitsstätten der Familie. Aus<br />
Bild- und Quellenmaterial erstellen<br />
sie eine Plakatpräsentation<br />
für ihre Klasse. Dieser<br />
Workshop eignet sich besonders<br />
für Schüler der Sek. 1 ab dem 9.<br />
Schuljahr.<br />
Eine weitere<br />
Möglichkeit,<br />
die jüdische Geschichte<br />
hautnah<br />
zu erleben,<br />
bietet das Projekt<br />
„Mit dem<br />
iPod durch<br />
das jüdische<br />
Esens“. Die<br />
Schüler erhalten<br />
in Kleingruppen<br />
einen<br />
iPod touch und<br />
erkunden auf<br />
einer Zeitreise<br />
Stätten jüdischer<br />
Schüler in der Ausstellung im Schulzimmer<br />
Vergan-<br />
genheit in der Stadt Esens. Sie<br />
werden über einen<br />
schalk-haus.de). Ansonsten ist<br />
das Haus von den Osterferien<br />
interaktiven Stadtplan<br />
bis Anfang November Dienstag,<br />
auf dem Gerät<br />
geleitet. Die entsprechende<br />
Donnerstag und Sonntag von 15<br />
bis 18<br />
App kann<br />
man sich aber auch<br />
kostenfrei aus dem<br />
Apple AppStore herunterladen.<br />
Im Obergeschoss des<br />
August-Gottschalk-<br />
August-Gottschalk-Haus<br />
Burgstraße 8<br />
26427 Esens<br />
Telefon 04971 - 5232<br />
E-Mail: info@august-gottschalkhaus.de<br />
Hauses befinden sich Homepage: www.august-gottschalk-haus.de<br />
ein Gruppenraum,<br />
eine Handbibliothek<br />
rund um das Thema<br />
„Judentum“ und eine<br />
Preise:<br />
Der Eintritt für<br />
Teeküche. Diese Schüler ist frei!<br />
Räumlichkeiten werden<br />
in den Workshop<br />
Gruppenführung<br />
(bis eine<br />
eingebunden, Stunde)<br />
können aber auch 25 Euro<br />
von Lehrern genutzt<br />
werden, um dort den<br />
Besuch der Ausstellung<br />
mit ihren Klassen<br />
Workshop<br />
Stunden<br />
Material)<br />
40 Euro<br />
(4<br />
inkl.<br />
vor- oder nachzu-<br />
bereiten.<br />
iPod-Zeitreise<br />
(1 Stunde Gerätmiete)<br />
Anmeldung und Kurzinfo<br />
Wir freuen uns über den Besuch<br />
3 Euro<br />
Nutzung von<br />
mit euren Schülerinnen und<br />
Schülern. Wer sich individuell<br />
Seminarraum,<br />
Bibliothek und<br />
oder mit dem Fachbereich Teeküche nach<br />
Geschichte oder Religion/Werte Absprache<br />
und Normen informieren oder<br />
eines der Angebote ausprobieren<br />
möchte, meldet sich am besten<br />
auch vorher an. Anmeldungen<br />
Jens Ritter, Museumslehrer,<br />
Carl-Gitter-<br />
nimmt Frauke Lüken telefonisch mann-Realschu-<br />
le Esens<br />
(04971 5232) oder per E-Mail<br />
iPod-Führung durch Esens<br />
entgegen (info@august-gott-
<strong>LEUCHTTURM</strong><br />
28<br />
19.05.2014<br />
DGB-Kongress fordert: TTIP aussetzen<br />
8 Monate<br />
gibt es schon<br />
Ceta,<br />
das Abkommen<br />
zwischen<br />
EU und Kanada.<br />
Nur:<br />
Veröffentlicht<br />
ist<br />
es noch<br />
nicht<br />
TTIP<br />
Mit dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA (TTIP) droht eine neue<br />
Dimension der Privatisierung öffentlicher Güter und Dienstleistungen. In streng geheimen<br />
Verhandlungen soll das und mehr auf den Weg gebracht werden<br />
von Maria<br />
Kniesburges in<br />
verdi-publik 4/<br />
2014<br />
Der<br />
DGB-Bundeskongress<br />
fordert, die TTIP-Verhandlungen<br />
zu einem Freihandelsabkommen<br />
zwischen den USA und<br />
der EU auszusetzen. Die<br />
Aussetzung soll genutzt werden,<br />
einen transparenten Verhandlungsauftrag<br />
der Europäischen<br />
Union neu zu bestimmen, um<br />
damit einen grundsätzlichen<br />
neuen Ansatz in der globalen<br />
Handelspolitik zu etablieren.<br />
Bis Ende 2015 wollen die<br />
beiden weltweit größten Wirtschaftsblöcke<br />
EU und USA, die<br />
gemeinsam fast die Hälfte des<br />
globalen Bruttoinlandsprodukts<br />
erwirtschaften, die derzeit laufenden<br />
Verhandlungen über ein<br />
bilaterales Freihandelsabkommen<br />
TTIP (Transatlantic Trade<br />
and Investment Partnership)<br />
zum Abschluss bringen. Die<br />
Verhandlungen werden von der<br />
Für die demokratische Öffentlichkeit<br />
- selbst für die<br />
Parlamente - sind die Verhandlungen<br />
geheim, Konzern-Lobbyisten<br />
dagegen sitzen quasi mit<br />
am Tisch und können ihre<br />
Vorschläge einbringen. Ende<br />
Mai, in der Woche vor den<br />
Europawahlen, haben die EU-<br />
Kommission und die USA ihre<br />
Verhandlungen über ein transatlantisches<br />
Freihandelsabkommen<br />
fortgesetzt, genannt TTIP<br />
(Transatlantic Trade and Investment<br />
Partnership). Erneut streng<br />
geheim. Dabei stehen für die<br />
meisten Menschen existenzielle<br />
Angelegenheiten auf der Tagesordnung.<br />
Gefährdet sind<br />
Arbeitsrechte und<br />
Schutzstandards<br />
Interesse der Konzerne ist es,<br />
sogenannte Handels- und Inve-<br />
EU-Kommission und der US-<br />
Regierung geführt und finden<br />
unter Ausschluss der Öffentlichkeit<br />
statt. Der DGB-Bundeskongress,<br />
der vom 11. – 16. Mai<br />
2014 in Berlin tagte, fordert in<br />
einem Initiativantrag, die TTIP-<br />
Verhandlungen auszusetzen und<br />
einen neuen Verhandlungsauftrag<br />
transparent zu bestimmen.<br />
Auch der GEW Hauptvorstand<br />
lehnt das TTIP-Abkommen ab<br />
und fordert ein Ende der<br />
laufenden Verhandlungen.<br />
Wirtschaftlicher Nutzen<br />
ist fraglich<br />
Die Befürworter des Abkommens<br />
versprechen wirtschaftliche<br />
Wachstumsimpulse und neue<br />
Arbeitsplätze in Europa und in<br />
den USA. Doch daran bestehen<br />
erhebliche Zweifel. Verschiedene<br />
stitionshemmnisse zu beseitigen.<br />
Dazu zählen mit an erster Stelle<br />
erkämpfte Arbeitsrechte und<br />
andere soziale Schutzstandards,<br />
aber auch Verbraucher- und<br />
Umweltschutzrechte. Drohen<br />
könnte mit dem Abkommen<br />
auch eine neue Dimension der<br />
Privatisierung öffentlicher Güter<br />
und Dienstleistungen. Selbst die<br />
Privatisierung des Wassers, von<br />
den Gewerkschaften für Europa<br />
gerade erfolgreich abgewehrt,<br />
könnte mit dem Freihandelsabkommen<br />
neuerlich drohen. All<br />
das wurde bislang - von denen,<br />
die Bescheid wissen - nicht<br />
dementiert.<br />
Ein zentraler und besonders<br />
brisanter Teil des geplanten<br />
Abkommens betrifft die Einrichtung<br />
privater Schiedsgerichte:<br />
Dort, und nicht etwa vor<br />
ordentlichen Gerichten in öffentlichen<br />
Verhandlungen, sol-<br />
Studien zu den makroökonomischen<br />
Wirkungen des Handelsabkommens<br />
errechnen nur geringe<br />
Wachstums- und Beschäftigungseffekte,<br />
die zudem erst sehr<br />
langfristig wirksam werden sollen.<br />
Zu viele unterschiedliche<br />
Faktoren nehmen Einfluss auf<br />
die wirtschaftliche Entwicklung,<br />
als dass seriöse Voraussagen über<br />
die langfristige Wirkung von<br />
Handelsabkommen möglich wären.<br />
Dies zeigt auch ein Blick auf<br />
die Geschichte des Europäischen<br />
Binnenmarkts und der nordamerikanischen<br />
Freihandelszone<br />
NAFTA vor zwei Jahrzehnten.<br />
Rückblickend betrachtet sind die<br />
optimistischen Voraussagen zu<br />
Wachstum und zusätzlichen<br />
Arbeitsplätzen weder in der<br />
Europäischen Union noch in<br />
den NAFTA-Staaten USA, Kanada<br />
und Mexiko eingetreten.<br />
len US-Konzerne europäische<br />
Staaten auf Schadensersatz verklagen<br />
können, wenn sie der<br />
Ansicht sind, dass staatliche<br />
Regelungen ihre Gewinne<br />
schmälern. Ein Lebensmittelkonzern<br />
etwa könnte Schadenersatz<br />
wegen zu strenger Verbraucherschutz-Bestimmungen<br />
geltend<br />
machen, eine anderer, weil<br />
ein neues Gesetz zum Umweltschutz<br />
seiner Gewinnerwartung<br />
im Wege steht, der dritte wegen<br />
zu hoher Standards im Arbeitsrecht.<br />
Insbesondere gegen diese<br />
Art von Schiedsgerichtsbarkeit,<br />
die die Institutionen des<br />
demokratischen Rechtsstaats aushebeln<br />
würde, erhebt sich seit<br />
Monaten Protest. Und er wird<br />
lauter. Daher hat die EU-<br />
Kommission vor den Europawahlen<br />
erklärt, sie werde die<br />
Verhandlungen über diesen Teil<br />
des Investorenschutzes vorerst<br />
nicht fortsetzen.
29 <strong>LEUCHTTURM</strong><br />
Anhaltende<br />
Geheimniskrämerei<br />
Ein anderes Freihandelsabkommen<br />
scheint aber bereits<br />
unter Dach und Fach zu sein:<br />
der Vertrag zwischen der EU und<br />
Kanada namens Ceta (Comprehensive<br />
Economic and Trade<br />
Agreement). Bereits im Oktober<br />
2013 haben der Präsident der<br />
EU-Kommission, José Manuel<br />
Barroso, und der kanadische<br />
TTIP<br />
Angriff auf die Schutzrechte<br />
Arbeitnehmer/innen nicht zu Verlierern eines Handelsabkommens mit den USA<br />
machen<br />
Mit dem transatlantischen<br />
Handels- und Investitionsabkommen,<br />
kurz TTIP, zwischen<br />
Europa und den USA würde die<br />
größte Freihandelszone der Welt<br />
entstehen. Doch am Verhandlungstisch<br />
geht es keineswegs<br />
nur um Wachstum, Wohlstand<br />
und Zollfreiheit. Auf der Agenda<br />
steht vielmehr der Abbau von<br />
Arbeitnehmerrechten und sozialen<br />
Dienstleistungen. Arbeitnehmer<br />
als die großen Verlierer des<br />
Freihandelsabkommens? Darüber<br />
diskutierten in Hannover<br />
Experten auf Einladung des<br />
ver.di-Landesbezirks Niedersachsen-Bremen<br />
und des Bildungswerks<br />
ver.di.<br />
Seit Juni vergangenen Jahres<br />
verhandelt die EU mit den USA<br />
über ein Freihandelsabkommen -<br />
und zwar im Geheimen, obwohl<br />
fast eine halbe Milliarde<br />
Menschen betroffenen sind.<br />
Inzwischen ist auch die Anfangseuphorie<br />
verflogen, in der in<br />
den Medien noch von der<br />
Hoffnung auf ein Wirtschaftswunder<br />
und rund zwei Millionen<br />
neue Arbeitsplätze die Rede<br />
war. „Neben dem Verbraucherschutz<br />
stehen vor allem die<br />
Rechte der Arbeitnehmer auf<br />
dem Spiel“, warnte die stellvertretende<br />
ver.di-Landesleiterin<br />
Sonja Brüggemeier in Hannover.<br />
Für sie ist klar, was in der<br />
Einladung zur Diskussion noch<br />
Premier Stephen Harper erklärt,<br />
man habe sich in allen Punkten<br />
geeinigt. Das ist nun schon acht<br />
Monate her, veröffentlicht ist das<br />
Abkommen aber immer noch<br />
nicht. Der Text sei noch in<br />
Arbeit, heißt es zu dieser<br />
anhaltenden Geheimniskrämerei,<br />
die es in einer Demokratie<br />
gar nicht geben dürfte.<br />
Wenn sich aber bewahrheitet,<br />
dass zwischen EU und Kanada<br />
die private Schiedsgerichtsbarkeit<br />
bereits vereinbart ist, würde sie<br />
durch die Hintertür auch für US-<br />
Konzerne gelten, die über ihre<br />
kanadischen Niederlassungen<br />
Profitansprüche in Europa einklagen<br />
könnten. Schon ohne das<br />
TTIP-Abkommen. Im Wege<br />
geheimer Verhandlungen, ein<br />
geradezu gespenstischer Vorgang<br />
in der freien westlichen Welt.<br />
als Frage formuliert worden war:<br />
„Das Handelsabkommen zwischen<br />
Europa und USA gefährdet<br />
die Rechte von Arbeitnehmerinnen<br />
und Arbeitnehmern.“<br />
Brüggemeier befürchtet, dass<br />
TTIP einen „massiven Angriff<br />
auf das europäische Versorgungsprinzip“<br />
bringen wird und eine<br />
neue Privatisierungswelle im<br />
Dienstleistungssektor, von der<br />
etwa Bildung, Kultur, Gesundheit,<br />
Wasser- und Energieversorgung<br />
betroffen wären.<br />
Und:? Das geplante Abkommen<br />
verschärfe die Konkurrenz<br />
zwischen europäischen und US-<br />
Unternehmen. Damit droht aus<br />
gewerkschaftlicher Sicht der<br />
Druck vor allem auf die in<br />
Europa höheren Lohnkosten<br />
zuzunehmen. Unter Hinweis auf<br />
das TTIP sei dann die<br />
Entwicklung sozialer Standards<br />
in Deutschland und Europa nur<br />
noch von Kapitalinteressen<br />
abhängig. Durch Freigabe des<br />
Kapitalverkehrs werde außerdem<br />
die Kontrolle über den eigenen<br />
Binnenmarkt ausgehebelt. Brüggemeier:<br />
„Solange man ein<br />
Freihandelsabkommen mit Ländern<br />
schließt, die ein niedrigeres<br />
Schutzniveau haben, erhöht sich<br />
der Druck auf das eigene<br />
Schutzniveau.“<br />
So lehnen die USA die<br />
Mindestarbeitsnormen der Internationalen<br />
Arbeitsorganisation<br />
(ILO) überwiegend ab - etwa das<br />
Recht zur Gründung von<br />
Gewerkschaften und auf Abschluss<br />
von Kollektiverträgen.<br />
Immer wieder werde in den USA<br />
verhindert, dass sich Beschäftigte<br />
in Gewerkschaften organisieren<br />
und Tarifverhandlungen führen.<br />
Nicht ratifiziert wurden auch<br />
Abkommen über Zwangsarbeit,<br />
gleiche Entlohnung, Nichtdiskriminierung<br />
am Arbeitsplatz<br />
und ein Mindestalter für<br />
Beschäftigte. Deutlich schlechtere<br />
Regelungen gebe es im<br />
Arbeitsrecht und bei den<br />
Arbeitszeiten, bei Urlaub, Arbeits-<br />
und Gesundheitsschutz<br />
und bei der Mitbestimmung.<br />
Die Gewerkschaft ver.di fordert,<br />
die Gespräche über das<br />
Freihandelsabkommen unbefristet<br />
auszusetzen, bis aus europäischer<br />
Sicht die Voraussetzungen<br />
für faire Verhandlungen geschaffen<br />
sind. Sodann seien folgende<br />
Bedingungen und Regelungen<br />
mit den USA zu vereinbaren:<br />
Ratifizierung aller wesentlichen<br />
ILO-Mindestarbeitsnormen,<br />
Herausnahme öffentlicher<br />
Dienstleistungen aus den Verhandlungen,<br />
Bereitschaft zur<br />
Unterzeichnung weitergehender<br />
Klimaschutzziele und Vereinbarung<br />
eines No-Spy-Abkommens<br />
mit der EU.<br />
aus verdipublik<br />
4/2014
<strong>LEUCHTTURM</strong><br />
Didaktische Qualität – auch für die<br />
Ausgangsschrift!<br />
Horst Bartnitzky,<br />
Grundschulpädagoge,<br />
Autor<br />
von Schulund<br />
Fachbüchern,<br />
Ehrenmitglied<br />
des<br />
Grundschulverbandes<br />
* Die<br />
Zitate stammen<br />
aus: Neun<br />
Prinzipien zeitgemäßer<br />
Grundschularbeit.<br />
Wieder abgedruckt<br />
in:<br />
Bartnitzky /<br />
Hecker (Hrsg.)<br />
(2010): Allen<br />
Kindern gerecht<br />
werden – Aufgabe<br />
und Wege.<br />
Frankfurt a.<br />
M., Grundschulverband,<br />
S. 202 ff. Horst<br />
Bartnitzky<br />
Es gibt didaktische Entwicklungen,<br />
die notwendige<br />
Konsequenzen haben. Werden<br />
die Konsequenzen nicht gezogen,<br />
dann passt das eine nicht<br />
zum anderen und darunter leidet<br />
das Ganze. Ein Beispiel für<br />
solche didaktische Disparität<br />
wird beim Thema Ausgangsschrift<br />
deutlich.<br />
In den achtziger Jahren<br />
verbreitete sich die Einsicht, dass<br />
Lesen und Schreiben im<br />
Schriftspracherwerb zusammengehören<br />
und dass Kinder sich<br />
aktiv, entdeckend und erprobend,<br />
die Schriftsprache zu eigen<br />
machen. Die in der Lebenswelt<br />
überall anzutreffende Druckschrift<br />
ist dabei die Schriftform,<br />
die Kinder schreibend und<br />
lesend verwenden. Inzwischen<br />
ist dies in den Grundschulen<br />
Allgemeingut und in fast allen<br />
Lehrplänen auch verankert.<br />
Weiterhin wird aber in<br />
Lehrplänen gefordert und in<br />
Grundschulen praktiziert, dass<br />
die Kinder auch eine der drei<br />
genormten Schulausgangsschriften<br />
zu lernen haben: LA, VA<br />
oder SAS. Überkommen ist diese<br />
Vorschrift aus der Zeit, als Lesenund<br />
Schreibenlernen als getrennte<br />
Lehrgänge verstanden<br />
wurden. Galt für das Lesenlernen<br />
die Druckschrift, so für das<br />
Schreibenlernen eine genormte<br />
Schulausgangsschrift.<br />
Damit ergibt sich die widersinnige<br />
Situation, dass die<br />
Kinder zwei Ausgangsschriften<br />
lernen: Von Schulbeginn an die<br />
Druckschrift, wie dies der<br />
neueren<br />
Entwicklung<br />
entspricht,<br />
später eine<br />
genormte<br />
Schulausgangsschrift,<br />
die<br />
aus früherer<br />
didakti-<br />
scher Zeit stammt. Weil dann<br />
aber die Zeit zu knapp ist, diese<br />
zusätzliche Ausgangsschrift auch<br />
didaktisch seriös zu lehren und<br />
zu lernen, arbeiten sich die<br />
Kinder oft in Eigenarbeit durch<br />
irgendeinen Schreiblehrgang<br />
durch. Das Ergebnis sind die<br />
schlechten Schulschriften, die<br />
landauf, landab zu besichtigen<br />
sind: Die Formklarheit der<br />
Buchstaben, die Gleichmäßigkeit<br />
des Schriftzugs und das Wichtigste:<br />
die Lesbarkeit lassen oft sehr<br />
zu wünschen übrig.<br />
Zudem: Die genormten<br />
Schulausgangsschriften passen<br />
nicht in das Konzept eines<br />
zeitgemäßen Unterrichts, weil<br />
grundlegende Qualitätsmerkmale<br />
nicht zum Zuge kommen.<br />
»Lernen als Selbstaneignung<br />
der Welt«*: Viele Kinder<br />
beginnen schon vor der Schule<br />
zu schreiben. Sie orientieren sich<br />
an den Buchstaben, die sie in der<br />
Lebenswelt allerorten finden:<br />
den Druckbuchstaben. Und sie<br />
schreiben sie in Orientierung an<br />
diese Druckbuchstaben in einer<br />
für sie schreibgerechten Weise.<br />
Diese Entwicklung muss von der<br />
Schule aufgenommen und weitergeführt<br />
werden, Kinder ohne<br />
solche vorschulischen Erfahrungen<br />
müssen sie in der Schule<br />
gewinnen können. In der<br />
Weiterentwicklung müssen die<br />
Kinder ausprobieren können,<br />
welche Buchstaben sie miteinander<br />
verbinden können, und sie<br />
erfahren dabei, welche Möglichkeiten<br />
ihnen gut von der Hand<br />
gehen.<br />
Die genormten Schulschriften<br />
aber finden sich<br />
nirgendwo in der Lebenswelt,<br />
nur in der Schule, für<br />
die sie konstruiert wurden.<br />
Sie können eben nur kopiert,<br />
nicht aber von den Kindern<br />
selbst sich angeeignet werden.<br />
»Grundschule als Leistungsschule«*:<br />
Schrift muss<br />
30<br />
für alle Kinder qualitätsvoll<br />
lernbar sein, wenn auch mit<br />
individuellen Bandbreiten. Für<br />
alle Kinder gelten die Kriterien:<br />
Formklarheit und gute Lesbarkeit<br />
sowie zunehmende Geläufigkeit.<br />
Die Schriftform selbst<br />
und die Zeit, in der sie lernbar<br />
ist, muss für alle Kinder eine<br />
individuelle Handschrift ermöglichen,<br />
die diesen Kriterien<br />
entspricht. Eine pädagogische<br />
Leistungskultur erfordert zudem,<br />
dass die Kinder diese Kriterien<br />
kennen, eigene Schreibproben<br />
einschätzen lernen und sich für<br />
die Weiterentwicklung ihrer<br />
Schrift daran orientieren. Statt<br />
die Zeit für eine lebensweltfremde<br />
Schulschrift als zweiter<br />
Ausgangsschrift zu investieren,<br />
sollte sie für die Qualitätssicherung<br />
der individuellen Handschriften<br />
verwendet werden.<br />
Ein Konzept zur Ausgangsschrift,<br />
das diesen Qualitätsmerkmalen<br />
entspricht, legt der<br />
Grundschulverband mit seinem<br />
Projekt Grundschrift vor. Es<br />
bietet mehr als eine »Ausgangsschrift«.<br />
Schriftvorlagen und<br />
Anregungen auf den Karteikarten,<br />
Schriftgespräche und die<br />
Dokumentation in den Heften<br />
»Meine Schrift« machen das<br />
Projekt Grundschrift zu einem<br />
Beispiel qualitätsvollen Unterrichts.<br />
Der Wegfall der überkommenen<br />
genormten Schulschriften<br />
als zweite Ausgangsschrift ist<br />
notwendige Konsequenz. Für die<br />
Schulpolitik hat dies übrigens<br />
den unschätzbaren Vorteil: Diese<br />
Reform kostet nichts.
31 <strong>LEUCHTTURM</strong><br />
Gemeinsam für Bildung<br />
10 Jahre VerA - das Ziel ist verfehlt.<br />
Schulen brauchen Unterstützung statt Testeritis.<br />
Eine gute Schule ist Lern- und Lebensort.<br />
Wie die Menschen in ihr zusammen leben und lernen,<br />
bestimmt ihre Qualität.<br />
Schule lässt sich nicht reduzieren auf messbare<br />
Fachleistungen,<br />
m sie ermöglicht Erfahrungen, die alle Kinder und<br />
Jugendlichen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung<br />
voranbringen;<br />
m sie erhebt selbstbestimmtes Leben und Lernen zum Ziel<br />
und zum Gestaltungsprinzip des schulischen Alltags;<br />
m sie stellt jeder Schülerin und jedem Schüler - bezogen<br />
auf ihr / sein jeweiliges Können - herausfordernde<br />
Aufgaben und fördert damit Leistung;<br />
m sie beschämt nicht, sondern bietet jedem Kind die<br />
Unterstützung, die es für seine Entwicklung benötigt;<br />
m sie fragt nicht, ob Kinder und jugendliche zu ihr passen,<br />
sondern heißt jede und jeden willkommen.<br />
So steht es in Richtlinien und Lehrplänen, so fordern es<br />
Eltern und Pädagoglnnen und so hat es die UN-<br />
Kinderrechtskonvention 1989 rechtsverbindlich zum<br />
Ausdruck gebracht.<br />
Alle Schulen können sich in diesem Sinne entwickeln.<br />
Sie brauchen dafür Impulse, sie brauchen konstruktive Kritik<br />
und alltagstaugliche Hilfen. Diese setzen ein stämmiges<br />
Verhältnis von Pädagogik und Evaluation voraus:<br />
m Respekt für die Sichtweisen des Gegenübers und<br />
Bereitschaft zum Aushandeln unterschiedlicher<br />
Deutungen.<br />
m Verantwortung aller Beteiligten und gegenseitigem<br />
Vertrauen.<br />
Die VerA-Tests helfen weder den Schulen noch den<br />
Kindern.<br />
Die Maßnahmen der Bundesländer reduzieren<br />
Qualitätssicherung auf standardisierte Leistungsmessung und<br />
Inspektion von oben.<br />
Als belastend und wenig hilfreich erleben viele Schulen die<br />
jährlichen Vergleichsarbeiten (VerA), flächendeckend in allen<br />
dritten und achten Klassen:<br />
m VerA beschränkt sich auf leicht messbare Ausschnitte in<br />
den Hauptfächern.<br />
m Die Bewertungen nach falsch/ richtig unterschlagen die<br />
Bedeutung von Zwischenschritten.<br />
m Die Aufgabentypen prägen Unterricht und Lehrwerke<br />
einseitig.<br />
m Die Ausrichtung an »Regelstandards« ist defizitorientiert,<br />
missachtet unterschiedliche Voraussetzungen der<br />
SchülerInnen und ist inklusionsfeindlich.<br />
m VerA erfasst nur, was ist, und bringt kaum lfilfe, um<br />
Schule zu verbessern - vor allein fehlt es an<br />
Unterstützung für Lehrerinnen in schwierigen<br />
Situationen.<br />
m Der Aufwand für VerA ist hoch, verschlingt viel Geld und<br />
bindet Lern- und Arbeitszeit.<br />
m Der Ertrag für Förderung ist gering, Ressourcen für<br />
pädagogische Vorhaben, Schul- und<br />
Unterrichtsentwicklung fehlen.<br />
m Die unterschiedliche Umsetzung von VerA in den<br />
Bundesländern führt auch auf der Systemebene zu<br />
schiefen Vergleichen.<br />
Schulen brauchen Unterstützung.<br />
Schulen sind auf Anstöße von außen angewiesen. Der<br />
Fremdblick ist wichtig, um die Binnensicht zu ergänzen, er ist<br />
ihr nicht überlegen. Schulen sollen als aktive Partner in die<br />
externe Evaluation einbezogen und in ihrer<br />
Evaluationskompetenz gestärkt werden. Dabei können Tests<br />
das persönliche Urteil ergänzen, nicht ersetzen. Wichtiger<br />
als die technische Perfektionierung von Messmethoden ist<br />
ihr Ertrag für Schulentwicklung und individuelle Förderung.<br />
Sinnlos sind immer neue Bestandsaufnahmen bekannter<br />
Schwächen, wenn es an Mitteln zu deren Überwindung fehlt.<br />
Die Aus-, Fort- und Weiterbildung des pädagogischen und des<br />
Leitungspersonals muss als der Schlüssel für die Schul-,<br />
Unterrichts- und Qualitätsentwicklung anerkannt und<br />
entsprechend gefördert werden.<br />
Wir fordern:<br />
m die Evaluation aller Maßnahmen der Bundesländer zur<br />
Quafitätssicherung durch unabhängige Forscherinnen,<br />
m die Beschränkung der Systemevaluation auf Stichproben<br />
und ihre Entzerrung auf einen drei- bis fün@ährigen<br />
Zyklus statt jährlich flächendeckender Erhebungen,<br />
m ein Repertoire an nachhaltig wirkenden<br />
Evaluationsinstrumenten (z. B. alltagstaugliche,<br />
förderdiagnostische Instrumente, Aufgabenpools als<br />
Angebot, Supervisionsangebote), das den Schulen zur<br />
Verfügung stehen muss,<br />
m praxisnahe Fortbildungen für Lehrerinnen in Schul- und<br />
Unterrichtsevaluationsinstrumenten, Lernbeobachtung<br />
und differenzierter Förderung,<br />
m Zeit und Mittel für Maßnahmen, damit Schulen<br />
Konsequenzen aus den Evaluationsergebnissen ziehen<br />
können.<br />
Frankfurt a. M., im Mai 2014
<strong>LEUCHTTURM</strong><br />
„Müssen um Sozialstaat kämpfen“<br />
DGB Kreisverband Wittmund lädt zum Arbeitnehmerempfang ein – Ronald<br />
Wilts geehrt<br />
Thema des Empfangs: „Gerecht verteilen – umverteilen.“<br />
(Quelle:<br />
Anzeiger für<br />
Harlingerland,<br />
28.4.14)<br />
WITTMUND – Sparen allein<br />
helfe nicht, das Problem der<br />
Staatsverschuldung in Deutschland<br />
zu lösen, führte Hartmut<br />
Limbeck beim Arbeitnehmerempfang<br />
des Kreisverbandes des<br />
Deutschen Gewerkschaftsbundes<br />
(DGB) aus, zu dem sich der<br />
Verband rund um den stellvertretenden<br />
Vorsitzenden Berend<br />
Tammen am Sonnabend „Bei<br />
Berend Tammen, Edeltraut Coordes, Ronald Wilts<br />
Manfred Noack<br />
Bodo“ traf. Der ehemalige Verdi-<br />
Landesbezirksleiter in Nordrhein-Westfalen<br />
beeindruckte die<br />
kleine Runde mit seinem<br />
ausführlichen Vortrag, in dem er<br />
ein imposantes Zahlenwerk der<br />
deutschen Wirtschaftssituation<br />
vorstellte. Er plädierte für eine<br />
gerechtere Umverteilung der<br />
finanziellen Ressourcen von<br />
oben nach unten und nicht<br />
umgekehrt. Sparmaßnahmen träfen<br />
den Arbeitnehmer anstatt<br />
ihn zu stärken, so Limbeck. Er<br />
nannte als Alternativen die<br />
Wiedereinführung einer Börsenumsatzsteuer,<br />
die es bereits bis<br />
1991 gegeben habe. Außerdem<br />
sei auch eine Transaktionssteuer<br />
sinnvoll, die die finanzielle<br />
Situation des Staates gut tue.<br />
Insgesamt sei eine aktive<br />
Steuerpolitik notwendig, denn<br />
trotz sprudelnder Einnahmen<br />
der Großunternehmen sei die<br />
finanzielle Situation in Deutschland<br />
schlecht. Ein Problem sei<br />
außerdem, dass dem Staat<br />
Steuern in Milliardenhöhe hinterzogen<br />
würden, die Schattenwirtschaft<br />
sei enorm, das Land<br />
müsse Steuerfahnder einsetzen,<br />
die Steuerquoten sollten offen<br />
gelegt werden. Er kritisierte die<br />
zunehmende Kluft zwischen<br />
armen und reichen Menschen,<br />
die Tatsache, dass es immer mehr<br />
Kinderarmut gebe und dass rund<br />
28 Prozent der Bürger verschuldet<br />
oder ganz ohne Kapital<br />
dastünden. In keinem anderen<br />
Land der Europäischen Union<br />
sei die genannte Kluft zwischen<br />
den wirtschaftlichen Situationen<br />
der Menschen so groß wie in<br />
Deutschland. Mit 3,1 Millionen<br />
Arbeitslosen sei man auf keinem<br />
guten Weg, es gebe unter<br />
anderem zu viel Teilzeitjobs.<br />
„Wir müssen uns den Sozialstaat<br />
stets aufs Neue erkämpfen“,<br />
mahnte der Verdi-<br />
Redner, der kritisierte,<br />
dass große Firmen wie<br />
Enercon und RE-<br />
HAU nach wie vor<br />
eine betriebliche Mitbestimmung<br />
durch<br />
die Arbeitnehmer (Betriebsrat)<br />
verweigerten.<br />
Neben dem inhaltsvollen<br />
Vortrag gab es<br />
zur Unterhaltung der<br />
32<br />
Mitglieder anspruchsvolle Musik<br />
von Manfred Noack, der seinen<br />
Gesang mit der Gitarre untermalte<br />
und Lieder im Gepäck<br />
hatte, die die Liebe zur Heimat<br />
zum Ausdruck brachten, aber<br />
auch alte Volkslieder wie „Die<br />
Gedanken sind frei“, die bis<br />
heute aktuell sind. Dann ehrte<br />
Edeltraut Coordes Ronald Wilts,<br />
der mit seiner Frau Irmgard zum<br />
Empfang kam, für seine Gewerkschaftsarbeit.<br />
Der Lehrer im<br />
Ruhestand, der zuletzt in der<br />
Grundschule Neuschoo unterrichtete,<br />
engagiert sich bis heute<br />
für die Arbeitsbedingungen von<br />
Pädagogen. Bereits zu Beginn<br />
seiner Lehrertätigkeit Ende der<br />
1960er Jahre war er in der<br />
Gewerkschaft für Erziehung und<br />
Wissenschaft (GEW) aktiv. „Er<br />
ist mit Herzblut dabei“, lobte<br />
Edeltraut Coordes den Neuschooer,<br />
Jahrgang 1941. Hans-<br />
Werner Kammer (MdB) überbrachte<br />
Grüße aus dem Bundestag<br />
und dankte der Gewerkschaft<br />
für die Unterstützung der Politik<br />
durch vernünftige Lohn- und<br />
Gehaltsabschlüsse. Heinz Buss<br />
betonte als Vertreter der Stadt,<br />
dass Aufträge für Investitionen<br />
vor Ort möglichst an hiesige<br />
Unternehmer vergeben würden<br />
und man dann darauf achte, dass<br />
gute Tarife an die Arbeitnehmer<br />
gezahlt würden. Gute Arbeit<br />
müsse gut bezahlt werden.<br />
Hartmut Limbeck, Edeltraut Coordes,<br />
Ronald Wilts, Berend Tammen
33 <strong>LEUCHTTURM</strong><br />
1<br />
Mehr zu meiner Person siehe www.dr-carsten-mueller.de<br />
2<br />
Wobei der Begriff des Liberalismus verkürzt wird.<br />
3<br />
siehe (Crouch 2013)<br />
4<br />
(Wetzel 2013, 18)<br />
5<br />
(ebd., 19)<br />
6<br />
Auch so müsste die Inklusionsdebatte gelesen werden.<br />
7<br />
vgl. (Hardt/Negri 2013, 32ff).<br />
8<br />
siehe (Wetzel 2013, 17)<br />
9<br />
(Kittner 2005, 715)<br />
10<br />
siehe (Driebusch/Birke 2012, Deckblatt)<br />
11<br />
(Wetzel 2013, 22).<br />
12<br />
Beispielsweise in der IG Metall sind nur noch ca. 60% der Mitglieder erwerbstätig (vgl. Kittner 2005, 716).<br />
13<br />
(Wetzel 2013, 22)<br />
14<br />
siehe (Kittner 2005, 716ff). Mit anderen Worten: Die “Gladiatorengruppen” brechen den Gewerkschaften weg!<br />
15<br />
(ebd., 718)<br />
16<br />
(ebd., 719)<br />
17<br />
(ebd.)<br />
18<br />
(Dörre 2014, 35)<br />
19<br />
(ebd., 36)<br />
20<br />
(Wetzel 2013, 21); siehe auch (Wetzel/Weigand/Niemann-Findeisen/ Lankau 2013, 52f)<br />
21<br />
siehe (Kittner 2005, 605ff)<br />
22<br />
Auch die Auseinandersetzungen um ein Beamtenstreikrecht bzw. um Streitrecht als individuelles Recht - besonders vor dem<br />
Hintergrund des europäischen Rechtes – gehören hierher.<br />
23<br />
siehe (Kittner 2005, 650)<br />
24<br />
siehe (Dörre 2007, 56-57), auch (Dörre 2008, 3-4)<br />
25<br />
siehe (Dörre 2007, 62)<br />
26<br />
vgl. (Crosby 2009)<br />
27<br />
In der Variante des Community Organizing, welches sich gewerkschaftlicher Methoden bedient, um eine Community, d.h.<br />
eine Nachbarschaft, einen Stadtteil oder eine benachteiligte Bevölkerungsgruppe zu organisieren (vgl. Alinsky 2011); vgl. zum<br />
Zusammenhang von gewerkschaftlichem Organizing und Community Organizing (Stövesand 2007)<br />
28<br />
siehe (Müller/Szynka in FOCO/Stiftung Mitarbeit 2014, 16ff)<br />
29<br />
(Wetzel/Weigand/Niemann-Findeisen/ Lankau 2013, 55)<br />
30<br />
(Dribbusch 2007, 37)<br />
31<br />
siehe (Leiderer 2014, 170ff)<br />
32<br />
(Stövesand 2007, 84)<br />
33<br />
Zur Erinnerung: Genossenschaften, Gewerkschaften und Parteien bilden die drei Säulen der Arbeiter- und<br />
Arbeiterinnenbewegung.<br />
34<br />
(Stövesand 2007, 87)<br />
35<br />
siehe (Bremme/Fürniß/Meinecke 2007, 10)<br />
36<br />
siehe einleitendes Motto<br />
Literaturverzeichnis (auch zum Weiterlesen)<br />
Alinsky, S.D. (2011): Call Me a Radical. Organizing und Empowerment. Göttingen: Lamuv Verlag<br />
(Edition IG Metall Jugend).<br />
Birke, P. (2010): Die große Wut und die kleinen Schritte. Gewerkschaftliches Organizing zwischen<br />
Protest und Projekt. Berlin: Assoziation A.<br />
Bremme, P./Fürniß, U./Meinecke, U. (2007): Organizing als Zukunftsmodell für bundesdeutsche<br />
Gewerkschaften. In: Dies. (Hrsg.): Never work alone. Organizing – ein Zukunftsmodell für<br />
Gewerkschaften. Hamburg: VSA, S.10-23.<br />
Crosby, M. (2009): Power at work. Die Rückgewinnung gewerkschaftlicher Macht am Beispiel<br />
Australiens. Hamburg: VSA.<br />
Crouch, C. (2013): Das befremdliche Überleben des Neoliberalismus. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.<br />
Dörre, K. (2007): Einführung: Gewerkschaften und die kapitalistische Landnahme: Niedergang<br />
oder strategische Wahl? In: Geiselberger, H. (Hrsg.): Und jetzt? Politik, Protest und Propaganda.<br />
Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 53-78.
<strong>LEUCHTTURM</strong><br />
34<br />
Dörre, K. (2008): Die strategische Wahl der Gewerkschaften – Erneuerung durch Organizing? In:<br />
WSI Mitteilungen, 1/2008, S. 3-10.<br />
Dörre, K. (2014): Prekarisierung und Gewerkschaften. Gegenstand einer öffentlichen Strategie. In:<br />
Schröder, L./Urban, H.-J. (Hrsg.): Gute Arbeit. Profile prekärer Arbeit. Arbeitspolitik von unten.<br />
Frankfurt a.M.: Bund-verlag, S. 25-48.<br />
Dribbusch, H. (2007): Das “Organizing-Modell”. Entwicklung, Varianten und Umsetzung. In:<br />
Bremme, P./Fürniß, U./Meinecke, U. (Hrsg.): Never work alone. Organizing – ein Zukunftsmodell<br />
für Gewerkschaften. Hamburg: VSA, S. 24-52.<br />
Dribbusch, H./Birke, P. (2012): Die Gewerkschaften in der Bundesrepublik Deutschland.<br />
Organisation, Rahmenbedingungen, Herausforderungen. Herausgegeben von der Friedrich-<br />
Ebert-Stiftung: Bonn (Text auch im Internet).<br />
Forum Community Organizing (FOCO)/Stiftung Mitarbeit (Hrsg.) (2014): Handbuch Community<br />
Organizing. Theorie und Praxis in Deutschland. Bonn: Verlag Stiftung Mitarbeit.<br />
Geiselberger, H. (2007): Social Movement Unionism. Tomaten des Zorns. In: Ders. (Hrsg.): Und<br />
jetzt? Politik, Protest und Propaganda. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 79-87.<br />
Hardt, M./Negri, A. (2013): Demokratie! Wofür wir kämpfen. Frankfurt/New York: Campus.<br />
IG Metall Vorstand (Hrsg.) (2011): Organisiere die Unorganisierten. Organizing – Beispiele und<br />
Erfahrungen aus der Praxis. Frankfurt a.M.: Eigenverlag.<br />
Kittner, M. (2005): Arbeitskampf. Geschichte, Recht, Gegenwart. München: C.H. Beck.<br />
Leiderer, E. (2014): Die Kampagne “Operation Übernahme” der IG Metall Jugend. In: Forum<br />
Community Organizing (FOCO)/Stiftung Mitarbeit (Hrsg.): Handbuch Community Organizing.<br />
Theorie und Praxis in Deutschland. Bonn: Verlag Stiftung Mitarbeit, S. 170- 175.<br />
Müller, C. (2014): Community Organizing – als Konzept, Methode und Haltung kritischer Sozialer<br />
Arbeit. In: Benz, B. et al. (Hrsg.): Politik Sozialer Arbeit (Bd 2.). Weinheim und Basel: Beltz<br />
Juventa, S. 300-313.<br />
Müller, C./Szynka, P. (2010): Community Organizing. In: Enzyklopädie Erziehungswissenschaft<br />
online (EEO): Juventa. Text im Internet: www.erzwissonline.de<br />
Müller, C./Szynka, P. (2014): Ein starker Gegenpol. Community Organizing. In: Bähr, C. et al. (Hrsg.):<br />
Weltatlas Soziale Arbeit. Jenseits aller Vermessungen. Weinheim und Basel: Beltz Juventa, S. 296-<br />
307.<br />
Stövesand, S. (2007): (Für den) Blick über den Tellerrand. Organizing im lokalen Gemeinwesen. In:<br />
Bremme, P./Fürniß, U./Meinecke, U. (Hrsg.): Never work alone. Organizing – ein Zukunftsmodell<br />
für Gewerkschaften. Hamburg: VSA, S. 79-91.<br />
Wetzel, D. (2005): Gewerkschaftliche Erneuerung ist möglich. In: Crosby, M.: Power at work. Die<br />
Rückgewinnung gewerkschaftlicher Macht am Beispiel Australiens. Hamburg: VSA, S. 349-362.<br />
Wetzel, D. (2013): Für eine neue gewerkschaftliche Agenda. In: Ders. (Hrsg.): Organizing. Die<br />
Veränderung der gewerkschaftlichen Praxis durch das Prinzip Beteiligung. Hamburg: VSA, S.<br />
13-29.<br />
Wetzel, D./Weigand, Jörg/Niemann-Findeisen, S./Lankau, T. (2013): Organizing: Die<br />
mitgliederorientierte Offensivstrategie für die IG Metall. Acht Thesen zur Erneuerung der<br />
Gewerkschaftsarbeit. In: Wetzel, D. (Hrsg.): Organizing. Die Veränderung der gewerkschaftlichen<br />
Praxis durch das Prinzip Beteiligung. Hamburg: VSA, S. 47-63.