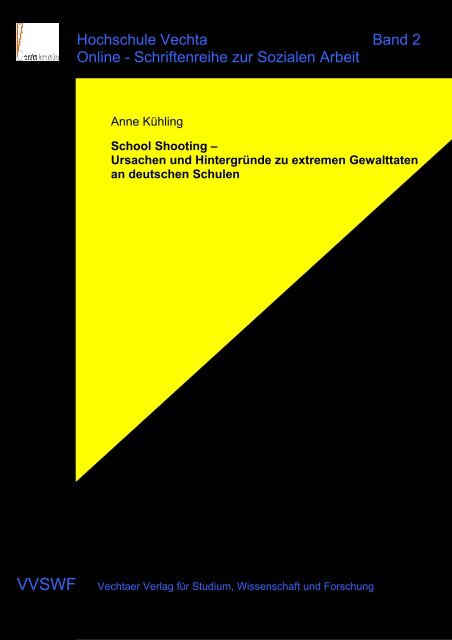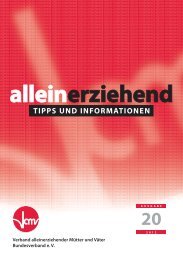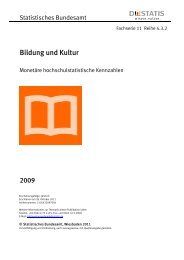School Shooting - Universität Vechta
School Shooting - Universität Vechta
School Shooting - Universität Vechta
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Hochschule <strong>Vechta</strong> Begriffsbestimmung<br />
Band 2<br />
Online - Schriftenreihe zur Sozialen Arbeit<br />
Hochschule Ve<br />
Anne Kühling<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> –<br />
Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten<br />
an deutschen Schulen<br />
VVSWF<br />
<strong>Vechta</strong>er Verlag für Studium, Wissenschaft und Forschung
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Hochschule <strong>Vechta</strong> Begriffsbestimmung<br />
Band 2<br />
Online - Schriftenreihe zur Sozialen Arbeit<br />
Anne Kühling<br />
ist Diplom-Pädagogin und arbeitet seit Ende 2007 im Bereich<br />
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Haus der Jugend<br />
<strong>Vechta</strong> GmbH. Bereits vor und während ihres Studiums an der<br />
Hochschule <strong>Vechta</strong> engagierte sie sich mehrere Jahre in der<br />
Kinder- und Jugendarbeit. Im Sommersemester 2008 gab sie<br />
als Lehrbeauftragte im Diplomstudiengang<br />
Erziehungswissenschaft ein Seminar zum Thema<br />
außerschulische Jugendarbeit an der Hochschule <strong>Vechta</strong>.<br />
VVSWF ISBN 978-3-937870-08-3
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Begriffsbestimmung<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong><br />
Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten<br />
an deutschen Schulen<br />
Anne Kühling<br />
<strong>Vechta</strong> 2009
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Begriffsbestimmung<br />
Die Online - Schriftenreihe zur Sozialen Arbeit wird herausgegeben von:<br />
Prof. Dr. Klaus-Dieter Scheer, <strong>Universität</strong>sprofessor (Pädagogik und Sozialpädagogik)<br />
am Institut für Erziehungswissenschaft der Hochschule <strong>Vechta</strong><br />
Detlev Lindau-Bank, Dipl.-Päd., Dipl.-Sozpäd., wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut<br />
für Erziehungswissenschaft der Hochschule <strong>Vechta</strong><br />
Autorin:<br />
Anne Kühling, Dipl.-Päd., arbeitet seit 2007 im Bereich der Offenen Kinder- und<br />
Jugendarbeit<br />
Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme<br />
Anne Kühling: <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>: Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an<br />
deutschen Schulen<br />
<strong>Vechta</strong>er Verlag für Studium, Wissenschaft und Forschung, 2009<br />
ISBN 978-3-937870-08-3<br />
Alle Rechte vorbehalten.<br />
© 2009 by VVSWF – <strong>Vechta</strong>er Verlag für Studium, Wissenschaft und Forschung<br />
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in<br />
anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der schriftlichen Einwilligung des<br />
Verlages.<br />
Umschlaggestaltung: Lindau-Bank, Scheer, Siemer
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Begriffsbestimmung<br />
Inhaltsverzeichnis:<br />
1.Einleitung ............................................................................................................. 7<br />
2.Begriffsbestimmung ............................................................................................ 9<br />
2.1SCHOOL SHOOTING 9<br />
2.2AMOK 11<br />
2.3ERWEITERTER SUIZID 14<br />
2.4VERWENDUNG DER BEGRIFFE 16<br />
3.Bestehende Forschungsergebnisse ...................................................................19<br />
3.1TÖTUNGSDELIKTE IM BEREICH DES SCHOOL SHOOTING 20<br />
3.1.1STATISTISCHE ERHEBUNG 20<br />
3.1.2 DATENAUSWERTUNG 25<br />
3.2AMERIKANISCHE STUDIEN 32<br />
3.2.1CRITICAL INCIDENT RESPONSE GROUP DES FBI 32<br />
3.2.2JAMES P. MCGEE UND CAREN R. DEBERNADO 33<br />
3.2.3US SECRET SERVICE UND DAS DEPARTMENT OF EDUCATION 35<br />
3.3DEUTSCHE STUDIEN 36<br />
3.3.1LOTHAR ADLER 37<br />
3.3.2FRANK ROBERTZ 38<br />
3.3.3JENS HOFFMANN 39<br />
3.4ERKENNTNISSE AUS DEN FORSCHUNGSERGEBNISSEN 40<br />
4.<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> in Deutschland .......................................................................43<br />
4.1ERFURT 44<br />
4.1.1VORGESCHICHTE UND TATVORBEREITUNG 45<br />
4.1.2TATHERGANG 47<br />
4.1.3ROBERT STEINHÄUSER 49<br />
4.1.4WAFFEN UND KLEIDUNG BEI ROBERT STEINHÄUSER 53<br />
4.2EMSDETTEN 54<br />
4.2.1VORGESCHICHTE UND TATVORBEREITUNG 55<br />
4.2.2TATHERGANG 57<br />
4.2.3BASTIAN BOSSE 58<br />
4.2.4WAFFEN UND KLEIDUNG BEI BASTIAN BOSSE 61<br />
4.3ANALYSE DER TATEN IN ERFURT UND EMSDETTEN 63<br />
4.4ERGEBNISSICHERUNG DER WICHTIGSTEN ASPEKTE 66<br />
5.Erörterung der bedeutenden Teilaspekte ....................................................... 68<br />
5.1NEGATIVE PERSÖNLICHKEITSTENDENZEN DER TÄTER 69<br />
5.1.1BINDUNGSSTIL UND FEHLENDE COPING-STRATEGIEN 69<br />
5.1.2NARZISSTISCHE PERSÖNLICHKEITSTENDENZEN 73
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Begriffsbestimmung<br />
5.1.3PHANTASIEENTWICKLUNG 77<br />
5.2FEHLENDE SICHERHEIT AUF SOZIALER EBENE 81<br />
5.2.1SOZIALE NETZWERKE 82<br />
5.2.2KRITISCHE LEBENSEREIGNISSE 87<br />
5.3EINFLUSS VON COMPUTERSPIELEN AUF SCHOOL SHOOTER 90<br />
5.3.1SPIELMOTIVATION UND SPIELAUSWAHL 91<br />
5.3.2EGO-SHOOTER 92<br />
5.3.3TRANSFER ZWISCHEN VIRTUELLER UND REALER WIRKLICHKEIT 96<br />
5.4ZENTRALE BEDEUTUNG DER SCHUSSWAFFEN 101<br />
5.4.1WAFFENERWERB UND NUTZUNG 101<br />
5.4.2VIRTUELLE WAFFEN UND REALE WAFFENVERWENDUNG 104<br />
5.4.3SYMBOLWERT DER VERWENDETEN WAFFEN 106<br />
5.5VERKNÜPFUNG DER EINFLUSSNEHMENDEN FAKTOREN 108<br />
6.Präventionsansätze ..........................................................................................111<br />
7.Schlussbetrachtung ......................................................................................... 115<br />
8.Literaturverzeichnis ........................................................................................118<br />
9.Anhang ............................................................................................................. 124
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Begriffsbestimmung<br />
1. Einleitung<br />
Extreme Gewalttaten an deutschen Schulen erscheinen bei einer neutralen<br />
Betrachtung als zutiefst grausame Taten von fehlgeleiteten und psychisch kranken<br />
Tätern.<br />
Dieser Eindruck verstärkt sich besonders durch die Medienberichterstattung, die<br />
sich auf solche Ereignisse stürzt.<br />
Im Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit soll eine Annäherung an diese<br />
extremen Gewalttaten auf wissenschaftlich fundierter Basis versucht werden.<br />
Kernpunkt ist der Versuch zu klären, warum Jugendliche diese Gewalttaten<br />
begehen und zu <strong>School</strong> Shootern werden. Ebenso erfolgt eine Untersuchung nach<br />
möglichen Ursachen und Wirkungen, im Hinblick auf mögliche präventive<br />
Ansätze.<br />
In ihrer Ausprägung handelt es sich bei extremen zielgerichteten Gewalttaten an<br />
Schulen um Vorfälle, bei denen ein oder mehrere Jugendliche an einer<br />
Bildungsinstitution mehrere Menschen verletzt oder getötet haben. Ein aktueller<br />
Bezug der Thematik besteht durch Taten wie im November 2006 in Emsdetten,<br />
oder im April 2007 in Blacksburg.<br />
Die nachhaltige Berichterstattung in den Medien nach erfolgten <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s<br />
lässt zunächst vermuten, dass bereits umfangreiche Informationen und Studien<br />
bezüglich dieses Phänomens vorliegen. Eine intensive Recherche zu Beginn der<br />
Arbeit hat jedoch ergeben, dass diese Informationen nur spärlich vorhanden sind.<br />
Ebenso sind explizite Studien zur Thematik, die herangezogen werden können,<br />
nur in sehr geringem Maße vorhanden.<br />
Zu Beginn der Arbeit ist es daher unumgänglich, zunächst die definitorische<br />
Abgrenzung des Begriffs <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> zu den vielfach verwendeten Begriffen<br />
Amok und Amoklauf vorzunehmen. Weiterer Bestandteil dieses Definitionsteils<br />
ist auch die Festlegung des erweiterten Suizids.<br />
Basierend auf diesen Definitionen erfolgt in einem gesonderten Punkt die<br />
Vorstellung und Grobanalyse vorliegender statistischer Werte im Bereich des<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>. Dieser Teil beinhaltet die Vorstellung von insgesamt sechs<br />
nationalen und internationalen Studien sowie deren Verifizierung auf den<br />
Kernbereich der Diplomarbeit.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Begriffsbestimmung<br />
Aus der Ergebnissicherung heraus erfolgt im Hauptteil der Arbeit die<br />
Auseinandersetzung mit zwei stattgefundenen <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s in Deutschland.<br />
Anhand der bestehenden Datenlage sind die Gewalttaten in Erfurt und Emsdetten<br />
als zwei zentral anzusehende <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s in Deutschland ausgewählt<br />
worden.<br />
In beiden Fällen findet zunächst eine Analyse statt, bei der bestehende Dokumente<br />
berücksichtigt und einbezogen werden. Auf Grundlage dieser Dokumente werden<br />
die Hintergründe der Tat, der Tatablauf sowie die Persönlichkeit des Täters<br />
herausgearbeitet. Die zu den Taten vorliegenden Informationen wurden aus<br />
unterschiedlichsten Datenquellen gesammelt, geprüft und analysiert. Die<br />
Dokumentenanalyse erfolgt jeweils im Hinblick auf den Umfang der gegebenen<br />
Bearbeitungszeit und der Recherchemöglichkeiten.<br />
Der zweite Hauptteil der Arbeit greift die vorgestellten Studien, ebenso wie die im<br />
ersten Hauptteil der Arbeit beschriebenen Taten und Tatabläufe auf. Es wird<br />
versucht, zentrale Auffälligkeiten aus den vorgestellten deutschen Fällen<br />
hervorzuheben. Die gefundenen Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden dann<br />
für die anschließende Ursachenforschung herangezogen.<br />
Zielsetzung ist es in diesem Teil, zentrale Einflussfaktoren festzustellen und diese<br />
mit den Ergebnissen und Thesen bestehender wissenschaftlicher Studien<br />
abzugleichen. Darüber erfolgt letztendlich eine Annäherung an das eigentliche<br />
Kernziel dieser Arbeit, der Ableitung und Entwicklung von spezifischen Kriterien<br />
für <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s.<br />
Die Ergebnisse der Erörterung werden im letzten Hauptteil der Arbeit genutzt, die<br />
entwickelten Kenntnisse überleitend für die Bearbeitung präventive Ansätze für<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s zu verwenden. Die Darstellung beinhaltet zudem einen<br />
Überblick über den Aufbau bestehender Ansätze.<br />
Der Schlussteil der vorliegenden Arbeit dient dazu, zusammenfassend die<br />
wichtigsten Ergebnisse darzustellen und auf Schwierigkeiten innerhalb der<br />
Forschung im Bereich von <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> hinzuweisen.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Begriffsbestimmung<br />
2. Begriffsbestimmung<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> oder Amokläufe an Schulen sind als ein relativ neues Phänomen<br />
dieser Zeit anzusehen. Allerdings hat sich gezeigt, dass eine einheitliche<br />
Definition in diesem Bereich nicht besteht. Je nach Ausgangspunkt der<br />
vorliegenden Literatur finden sich verschiedene Erklärungsansätze. Diese gehen<br />
einher mit unterschiedlichen Definitionen aus kriminologischer, psychologischer<br />
oder journalistischer Sicht. Auf Grund dessen ist es notwendig, zunächst die<br />
Kernbegriffe genauer voneinander abzugrenzen, die in diesem Bereich verwendet<br />
werden.<br />
In Bezug auf die bestehende Ausgangslage erfolgt in diesem Kapitel zunächst<br />
eine Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Begriffsbestimmungen. Im<br />
Hinblick auf die Fragestellung der Arbeit, ist das Phänomen von extremen<br />
zielgerichteten Gewalttaten an Schulen zentral. Im Anschluss daran werden die<br />
unterschiedlichen Betrachtungsweisen miteinander verglichen. Wichtig ist es, eine<br />
eigene Verwendung der Begriffe im Vorfeld abzugrenzen und zu begründen, um<br />
eine einheitliche Nutzung der Fachtermini in dieser Arbeit ermöglichen zu<br />
können. Ferner erleichtert eine vertiefte Auseinandersetzung mit den<br />
unterschiedlichen Begrifflichkeiten eine Herangehensweise innerhalb dieses<br />
Themas zu finden und inhaltliche Ziele festzulegen.<br />
2.1 <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong><br />
Im Allgemeinen fällt <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> in den Bereich der Jugendgewalt, wobei es<br />
sich jedoch um eine seltene Form von Gewalt handelt. 1 Auf Grund der zum Teil<br />
hohen Opferzahlen, hat sich jedoch in der Gesellschaft eine erhebliche Angst<br />
gegenüber diesen Taten entwickelt. Gerade weil diese oberflächlich gesehen aus<br />
dem Nichts heraus geschehen, besteht die Furcht, ein solche Tat könnte jederzeit<br />
und überall stattfinden.<br />
In Deutschland hat sich Frank Robertz als einer der ersten mit schweren<br />
zielgerichteten Gewalttaten an Schulen befasst. In Ermangelung einer klar<br />
1<br />
Vgl. Krimpädia (Stand:16.05.2007), www.kriminologie.uni-hamburg.de/wiki/index.php/<strong>School</strong>_<strong>Shooting</strong>,<br />
01.10.2007
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Begriffsbestimmung<br />
definierten Begriffsabgrenzung innerhalb der deutschen Wissenschaft, hat er den<br />
Begriff des <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> eingeführt. 2<br />
Entwickelt hat sich dieser Begriff im angloamerikanischen Bereich. Nach Taten<br />
an Schulen wie Jonesboro in Arkansas oder Littleton in Colorado, setzte er sich<br />
dort sowohl in den Medien, als auch im wissenschaftlichen Bereich als<br />
Fachtermini durch. Das Wort <strong>School</strong> wird ins Deutsche als Schule übersetzt,<br />
<strong>Shooting</strong> kann als schießen oder Schießerei übersetzt werden. Somit umschreibt<br />
die Verwendung des Begriffs <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> den Ort des Geschehens.<br />
Gleichzeitig beinhaltet er die Methodik der Täter und die am häufigsten<br />
verwendete Tatwaffen, den Einsatz von Schusswaffen. Eine sinngemäße<br />
Übersetzung lautet demnach „Schießerei in Schulen“. Eine Herleitung der<br />
Begrifflichkeit kann ebenfalls erfolgen aus:<br />
„[...] <strong>School</strong> abgeleitet vom griechischen Wort schole (Müßiggang, Studium)<br />
und <strong>Shooting</strong> aus den altisländischen Wörtern skutan (hervorspringender<br />
Schiffssteven) und skeud (jagen, treiben, auch „Entlastung des Bogens“)“. 3<br />
Unter einem <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> wird der Spezialfall eines Amoklaufes verstanden,<br />
der vom Täter, einem Schüler, an Schulen ausgeführt wird und dessen Opfer in<br />
den überwiegenden Fällen dem Bildungs-/ Schulsystem angehörig sind. 4 Eine<br />
Definition, die in der Studie des US Secret Service und des United States<br />
Department of Education verwendet wird und das Phänomen zielgerichteter<br />
Gewalttaten an Schulen umschreibt, lautet:<br />
„[...] an incident of targeted school violence was defined as any incident where<br />
(i) a current student or recend former student attacked someone at his or her<br />
school with lethal means (e.g., a gun or knife); and, (ii) where the student<br />
attacker purposefully chose his or her school as the location of the attack.” 5<br />
Nicht einbezogen werden in die Definition zum <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> Handlungen auf<br />
Grund von Banden- und Drogenkriminalität, oder Auseinandersetzungen<br />
zwischen einzelnen Schülern, die an Schulen stattfinden. 6 Weiterhin werden für<br />
den Fall des <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>, notwendige Kriterien angeführt, welche auf die<br />
Besonderheiten dieser Handlungen verweisen.<br />
2<br />
Vgl. Robertz, 2004, S.17.<br />
3<br />
Krimpädia (Stand:16.05.2007), www.kriminologie.uni-hamburg.de/wiki/index.php/<strong>School</strong>_<strong>Shooting</strong>,<br />
01.10.2007<br />
4<br />
Vgl. Robertz, 2004, S.19f.<br />
5<br />
Vossekuil u.a. (2002), www.secretservice.gov/ntac/ssi_final_report.pdf, 20.04.2007, S.7.<br />
6<br />
Vgl. Vossekuil u.a. (2002), www.secretservice.gov/ntac/ssi_final_report.pdf, 20.04.2007, S.7.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Begriffsbestimmung<br />
Diese Kriterien sind: 7<br />
• Es handelt sich bei den Tätern immer um mindestens einen Jugendlichen,<br />
der entweder ein Schüler/ Student, ehemalige Schüler/ Student ist, oder<br />
negative Assoziationen bezüglich Bildungseinrichtungen besitzt.<br />
• Die Handlungen in einem Geschehen zielen alle auf die Tötung anderer<br />
Personen und im Anschluss an die Tat, kann oder muss der Suizid der<br />
eigenen Person das letzte/ eigentliche Ziel sein.<br />
• In der Regel zeichnen sich die Taten besonders durch die Nutzung von<br />
Schusswaffen aus, wobei das Ziel möglichst hohe Opferzahlen sind.<br />
• Es besteht eine direkte Fokussierung auf Opfertypen, die überwiegend im<br />
Bezug zur Schule stehen und es muss sich immer um mehrere Opfer<br />
handeln, die nicht wegen ihrer Person, sondern auf Grund ihrer Funktion<br />
als Lehrer, Schüler oder Schulleiter ausgewählt werden.<br />
Die Begriffe des Amok und des erweiterten Suizids werden in der bestehenden<br />
Literatur ebenfalls bei schweren zielgerichteten Gewalttaten an Schulen als<br />
Definitionsansätze herangezogen. Um einen umfassenden Blick über die<br />
bestehenden Begriffe zu ermöglichen, die im Bereich dieses Phänomens<br />
herangezogen werden, ist es erforderlich, sich weiterführend mit zwei<br />
zusätzlichen Begriffen auseinander zusetzen.<br />
2.2 Amok<br />
Allgemein werden in der heutigen Zeit schwere Tötungsdelikte, die einhergehen<br />
mit wahllosen oder gezielten Tötungsversuchen, in den Medien und der<br />
bestehenden wissenschaftlichen Literatur als Amok, Amoktaten oder Amoklauf<br />
bezeichnet. In einigen Fällen wird der Begriff Amok/ Amoklauf oder der Begriff<br />
Massaker auch für Taten an Schulen verwendet, wobei diese dann unter anderem<br />
7<br />
Vgl. Robertz, 2004, S.20; Vgl. Krimpädia/ IKS (Stand: 16.05.2007), http//:www.kriminologie.uni-hamburg.de/wiki/index.php/<strong>School</strong>_<strong>Shooting</strong>,<br />
01.10.2007
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Begriffsbestimmung<br />
als besondere Beispiele für das allgemeine Phänomen Amok herangezogen<br />
werden. Festzustellen ist, dass es sich bei dem Wort Amok um keinen<br />
definitorisch festgelegten Begriff handelt. So ist er zwar ein weit verbreiteter und<br />
verwendeter Begriff, aber es findet sich hierzu keine einheitlich existierende<br />
Fachlexika, beziehungsweise keine einheitlich geltende Definition in juristischen,<br />
psychologischen oder kriminologischen Wissenschaften. Daher wird an dieser<br />
Stelle zunächst auf den historischen Kontext des Begriffes Amok eingegangen.<br />
Das Wort Amok wird von seinem Ursprung her aus Malaysia und dessen ethnisch<br />
und sprachlich nahestehenden Ländern hergeleitet, wo das Wort „Amuk“ als<br />
wütend oder rasend übersetzt werden kann. 8 Die Wurzeln des Wortstammes selbst<br />
sollen aus Vorderindien stammen. In Vorderindien wurden Amokläufer auch als<br />
„amuco“ bezeichnet. Dort leiteten todgeweihte Krieger mit dem Schlachtruf<br />
„amuco“ ihre kriegerischen Handlungen ein. 9<br />
Erste historische Erwähnungen dieses Phänomens lassen sich bis ins 16.<br />
Jahrhundert zurückverfolgen. In malaiischen Kulturkreisen besaß Amok bereits<br />
eine jahrhundertlange Tradition und war zu Beginn eine besondere Kriegstaktik. 10<br />
Die Krieger wurden ausgebildet gegen Heere zu kämpfen, die ihnen zahlreich<br />
überlegen waren. Die Besonderheit der Kampftechnik lag darin, dass die Krieger<br />
sich ohne Rücksicht auf das eigene Leben mit dem Kampfschrei „Amok“ auf ihre<br />
Gegner stürzten. So wurde dem Gegner die absolute Kampf- und<br />
Siegesbereitschaft signalisiert. Diesen Kriegern wurde in ihren Kulturkreisen ein<br />
besonderer Heldenstatus zugesprochen.<br />
Mit der Einführung des Islams in malaiisch–indonesischen Kulturen im 13./ 14.<br />
Jahrhundert entwickelte sich der Begriff des Amoklaufs weiter zu einer Tat, die<br />
im religiösen Fanatismus begründet lag. 11 Amokläufer mit dem Ziel des eigenen<br />
Todes wurden vor Allah als gottgefällig angepriesen und verherrlicht.<br />
Konträr dazu steht, dass der Selbstmord nach dem islamischen Glauben verboten<br />
ist. Aber im Zentrum stand nicht die eigene Tötung der Krieger, sondern die Frage<br />
nach der Ehre der Täter. Den Amokläufern kam zu dem Zeitpunkt ein besonderer<br />
Heldenstatus zu, wodurch eine Ritualisierung und Mystifizierung der Tat<br />
einsetzte. 12<br />
8<br />
Vgl. Adler,2000, S.9.<br />
9<br />
Vgl. Knecht, 1998, S.681.<br />
10<br />
Vgl. Adler, 2000, S.9f.; Vgl. Knecht, 1998, S.681.<br />
11<br />
Vgl. Knecht, 1998, S.681.<br />
12<br />
Vgl. Adler, 2003, S.11f.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Begriffsbestimmung<br />
Ab dem 14. Jahrhundert entwickelte sich die ursprünglich militärische<br />
Ausprägung zurück. Amokläufe wurden von einer speziellen Form der<br />
Kriegsführung zu einer eher individuell motivierten Handlung. 13 Die Bezeichnung<br />
eines individuellen Amokläufers als „pengamuk“ wurde abgeleitet aus dem<br />
Ursprungswort „Amuk“. 14 Einhergehend mit dem Hervortreten persönlicher<br />
Motive und Interessen verlor der Amoklauf seine spezielle Bedeutung. Die<br />
Verherrlichung der Tat trat in den Hintergrund und der Täter verlor seinen<br />
besonderen Heldenstatus. Ein Rückgang der als impulsiv und unkontrolliert<br />
anzusehenden Handlungen erfolgte erst, als kulturelle Reaktionen verschärft<br />
einsetzten. 15 Mit Beginn der Kolonialisierung wurden Amoktaten immer stärker<br />
als krankhaft deviantes Verhalten angesehen, das von der Gesellschaft als negativ<br />
zu bewerten und zu bestrafen ist. Zudem verloren die Taten über die Zeit ihren<br />
religiösen–kriegerischen und ethnischen Bezug.<br />
Derzeit bestehende Versuche einer näheren Begriffsbestimmung entwickelten sich<br />
aus der Auswertung verschiedener, weltweiter Fälle heraus. 16<br />
Nach einer Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO), handelt es sich<br />
um eine willkürliche Episode mörderischen oder stark zerstörerischen Verhaltens.<br />
Nach der Tat selbst folgt eine Phase des Gedächtnisverlustes und/ oder<br />
Erschöpfung. In vielen Fällen beinhaltet der Amoklauf einen Wechsel in selbst–<br />
zerstörerisches Verhalten. 17 Angelehnt an die Begriffsbestimmung der WHO<br />
definiert Faust Amokläufe als:<br />
„Nicht materiell-kriminell motivierte, tateinheitliche, mindestens in<br />
selbstmörderischer Absicht durchgeführte, auf den unfreiwilligen Tod mehrerer<br />
Menschen zielende plötzliche Angriffe.“ 18<br />
Adler hat auf Grund eigener Studien innerhalb der Amokforschung mehrere<br />
Kriterien operationalisiert, die implizit besondere Merkmale von<br />
Mehrfachtötungen im Rahmen von Amokhandlungen zusammenfassen. Diese<br />
müssen auftreten, um bei einer Handlung von einem Amoklauf sprechen zu<br />
können. Die Merkmale lassen sich wie folgt darstellen: 19<br />
13<br />
Vgl. Knecht, 1998, S.681.<br />
14<br />
Vgl. Ebenda, S681.<br />
15<br />
Vgl. Füllgrabe, 2000, S.225; Vgl. Adler, 2000, S.12f.<br />
16<br />
Vgl. Adler, 2002, S.60.<br />
17<br />
Vgl. WHO, 2001. Nach: Faust (no date), www.psychosoziale-gesundheit.net/seele/amok.html,<br />
25.04.2007, S.5.<br />
18<br />
Faust (no date), www.psychosoziale-gesundheit.net/seele/amok.html, 25.04.2007, S.5.<br />
19<br />
Vgl. Adler, 2000, S.50f.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Begriffsbestimmung<br />
• Ein Amoklauf muss so angelegt sein, dass es sich dabei immer um eine<br />
Tötung von mindestens einer Person handelt, beziehungsweise dass es zu<br />
einer Tötung gekommen wäre, die über die üblichen Täter–Opfer<br />
Konstellationen hinausgeht, wenn äußere Umstände die Tat nicht<br />
verhindert haben.<br />
• Die Tat muss über den gesamten Zeitrahmen oder mindestens zeitweise<br />
ohne Rücksicht auf das eigene Leben angelegt sein, oder den Tod des<br />
Handelnden durch Suizid oder Fremdeinwirkung zum Ziel haben.<br />
• Die Handlung muss, wenn auch nur von außen betrachtet, impulsiv und<br />
raptusartig beginnen, darf allerdings nicht politisch, ethisch, religiös oder<br />
kriminell motiviert sein.<br />
Abschließend kann gesagt werden, dass viele Autoren Amokfälle als<br />
Selbstmordtat sehen und somit als Sonderform innerhalb des Bereichs von<br />
Tötungsdelikten. Es wird davon ausgegangen, dass die Intention des Täters im<br />
Mord und Suizid liegt und gleichzeitig Ziel- und Motivation der Tat beinhaltet. 20<br />
Auf Grund ihrer Form und der besonderen Art der Ausübung des Suizids, kann in<br />
diesem Fall ein Verweis zum Begriff des erweiterten Suizids gezogen werden, der<br />
gerade auf die oben erwähnte Intention eine stärkere Gewichtung legt.<br />
2.3 Erweiterter Suizid<br />
Die Selbsttötung ist eine menschenspezifische Verhaltensweise, die sich zu jeder<br />
Zeit und in jeder Epoche finden lässt. Der Begriff Selbstmord ist bisher die<br />
geläufigste Bezeichnung für die Selbsttötung von eigener Hand. Allerdings<br />
schwingt bei dem Begriff Mord immer mit, dass es sich um eine vorsätzliche Tat<br />
handelt, die in den meisten Fällen aus Mordlust oder anderen niederen<br />
Beweggründen stattfindet. Daher wird zunehmend der aus dem Lateinischen von<br />
sua manu cadere = durch eigene Hand fallen oder sui caedere = sich fällen, töten,<br />
opfern abgeleitete Begriff Suizid verwendet. 21 Bei Amoktaten an Schulen handelt<br />
es sich aber keinesfalls um den einfachen Suizid eines Schüler, denn die Tat<br />
20<br />
Vgl. Adler, 2003, S.23f.<br />
21<br />
Vgl. Faust (no date), www.psychosoziale-gesundheit.net/seele/suizid1.html, 19.05.2006, S.1.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Begriffsbestimmung<br />
zeichnet sich besonders durch den Versuch oder die tatsächliche Tötung weiterer<br />
Menschen aus. In vielen Fällen wird daher der Begriff des erweiterten Suizides<br />
herangezogen.<br />
Unter dem erweiterten Suizid oder auch Mitnahmesuizid werden Tötungen von<br />
einem oder mehreren Menschen unter Einschluss der eigenen Tötung<br />
zusammengefasst. 22 Der Begriff selbst wurde bislang in erster Linie für Frauen<br />
verwendet, die nach der Tötung der eigenen Kinder Suizid versucht oder<br />
begangen haben. Depressionen werden in diesen Fällen als Hauptursache für den<br />
Suizidwunsch herangezogen. 23<br />
Eine weitere Beziehung wird zwischen dem erweiterten Suizid und dem<br />
Tatbestand eines Mordes gesehen. Betrachtet man den erweiterten Suizid unter<br />
dem Mordaspekt werden zwei wesentliche Momente miteinander verbunden. 24<br />
Zum einen die Entlastung der eigenen Tat und Person, indem mehrere Menschen<br />
mit in den Tod gehen. Zum anderen die Unumgänglichkeit des eigenen Todes,<br />
durch die Ermordung weiterer Menschen. Der eigentliche Antrieb einer solchen<br />
Tat liegt damit nicht in der Tötung weiterer Menschen, sondern im eigenen<br />
Suizid. 25 Dieser ist die erste Entscheidung des Täters und damit die treibende<br />
Kraft im gesamten Handlungsablauf. Die Tötung anderer ist damit inhaltlich<br />
streng abhängig von der Entscheidung sein eigenes Leben beenden zu wollen.<br />
Blumenstein sieht bei Amokschützen einen hohen Zusammenhang zwischen dem<br />
Suizid und dem Ziel der Täter, die Menschen zu bestrafen, die aus ihrer Sicht als<br />
Gegner ihrer Person anzusehen sind. 26 Zwar begehen nicht alle Täter Suizid, aber<br />
diejenigen, die dieses tun, entscheiden sich bewusst dazu und nehmen den eigenen<br />
Tod als mögliche Konsequenz in Kauf.<br />
Andere Autoren werten den Suizid nach begangenen Tötungen anderer Menschen,<br />
die auf Grund von speziellen Motiven stattfinden nicht als Suizid. Lange geht<br />
davon aus, Tötungen nicht als erweiterten Suizid anzusehen, bei denen die<br />
Beweggründe an Mordmotiven angelehnt sind, oder bei denen der eigene Tod als<br />
letzte Auswegmöglichkeit mit einkalkuliert wird. 27<br />
22<br />
Vgl. Faust (no date), www.psychosoziale-gesundheit.net/seele/amok.html, 25.04.2007, S.19.<br />
23<br />
Bien, 1984, S.57ff.<br />
24<br />
Vgl. Hansen, 1982, S.26<br />
25<br />
Vgl. Bien, 1984, S.53.<br />
26<br />
Vgl. Blumenstein, 2002, S.836.<br />
27<br />
Vgl. Lange, 1964. Nach: Bien, 1984, S.53.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Begriffsbestimmung<br />
Amoktaten bilden dementsprechend vielmehr eine Sonderform innerhalb des<br />
erweiterten Suizids. Die Taten werden eher als suizidale Handlungen im<br />
Zusammenhang mit Tötungshandlungen gesehen.<br />
Ebenso fordert unter anderem Welder, dass das Tatmotiv in der Mitnahme anderer<br />
Menschen und somit in altruistischen oder pseudoaltruistischen Motiven liegen<br />
muss. 28 Eine altruistische Motivation folgt stets einem höheren Prinzip als der<br />
Ermordung anderer (Staat, Freiheit, Religion, Leben der Freunde). Liegt diese<br />
Motivation bei Amoktätern an Schulen vor, so lässt sich auch von einem<br />
Opfersuizid sprechen, wobei der Täter sein eigenes Leben vorbehaltlos für eine<br />
höhere Idee einsetzt. 29<br />
Wolfersdorf weist darauf hin, dass der Suizidbegriff in Amokfällen um mehrere<br />
Aspekte erweitert werden muss. 30 Zu nennen ist hier die Einbeziehung anderer<br />
gegen deren Willen in den eigenen Suizid, sowie die Motivation des Ziels. Nach<br />
Ansicht von Wolfersdorf liegt hier die Motivation nicht in der eigenen<br />
Selbsttötung, sondern in der Vernichtung anderer, was den eigenen Suizid zur<br />
Mordwaffe werden lässt.<br />
2.4 Verwendung der Begriffe<br />
Der Begriff Amok ist nicht eindeutig auf den Bereich der Tötungsdelikte von<br />
Schülern an Schulen zugeschnitten. Heute wird an vielen Stellen bezweifelt, dass<br />
der Verweis auf den Begriffsursprung und die dazugehörige Kategorisierung/<br />
Definition solcher Taten sich auf heutige Vorfälle oder Bezeichnungen für<br />
Amoktaten übertragen lässt. Es ist fraglich, diese als Modernisierungsfolge zu<br />
sehen, mit einem Verweis auf die Kulturanthropologie des Begriffs. 31 Seine<br />
Übersetzung, die ein Bild von rasenden oder zornigen Tätern zeichnet, passt nicht<br />
auf Jugendliche und deren geplante und zielgerichtete Tötungsdelikte an Schulen.<br />
Weiterhin geht man bei dem Begriff meist davon aus, dass die Opfergruppe zwar<br />
ausgewählt, aber die Opfer selbst zufällig sind. Auch das trifft nicht auf die<br />
28<br />
Vgl. Wedler, 2002, S.<br />
29<br />
Vgl. Wedler. 2002, S.38f.<br />
30<br />
Vgl. Wolfersdorf, 2002, S.14 ff.; Vgl. Gallwitz, 2001, S.170.<br />
31<br />
Vgl. Hermanutz/ Kersten, 2003, S.138f.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Begriffsbestimmung<br />
Jugendlichen zu. 32 Sie kennen viele ihrer Opfer persönlich, da sie Lehrer oder<br />
Klassenkameraden sind, oder sie wissen zumindest, dass es sich um Schüler und<br />
Personal der eigenen Schule handelt. Die Motivation und Ausgestaltung solcher<br />
Fälle bleibt meistens unberücksichtigt, so dass sowohl zwischen<br />
Mehrfachtötungen innerhalb von Familien, als auch politisch/ religiös motivierten,<br />
terroristischen, oder extremen zielgerichteten Mehrfachtötungen an Schulen nicht<br />
direkt unterschieden wird.<br />
Der Begriff des erweiterten Selbstmordes ist ebenso diskussionswürdig. Wie der<br />
empirische Teil in 3. aufzeigt, endet eher die Minderheit der Taten im Suizid des<br />
Täters. Weiterhin ist im Nachhinein auf Grund der bestehenden Daten schwer zu<br />
belegen, ob der Suizid der überlebenden Täter zumindest geplant oder versucht<br />
worden ist. Die Ergebnisse aus deutschen Studien verweisen darauf, dass die<br />
Täter sich klinisch vom Suizidenten, als auch vom Mörder unterscheiden, obwohl<br />
eine eindeutige Trennung trotz allem nicht immer möglich ist. 33 Bei Fällen, in<br />
denen Menschen nur verletzt wurden, ist nicht nachweisbar, ob dieses an anderen<br />
äußeren oder täterrelevanten Variablen liegt, oder das Ziel wirklich nur in einer<br />
einzelnen Person lag. Des weiteren würden Taten, die auf Grund einer<br />
sensibilisierten Umwelt gestoppt werden konnten, nicht mit einbezogen werden.<br />
Beide oben genannten Begriffe sind in ihrer Definition relativ diffus und geben in<br />
ihrer Gesamtheit nicht die Besonderheiten von Tötungsdelikten an Schulen<br />
wieder. Zudem sind sie zu stark mit bestimmten individuellen Interpretationen<br />
belegt, die eine neutrale wissenschaftliche Bearbeitung der Fälle nicht zulassen.<br />
Von Vorteil ist auf Grund dessen der Begriff des <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>. Er verweist auf<br />
die wichtigsten Unterschiede und Besonderheiten, welche diese Taten von<br />
anderen Amokläufen unterscheidet, und sie auf Grund dessen eher zu einer Art<br />
Unterkategorie oder Spezialfall in der Amokforschung werden lässt. Laut<br />
mehrerer vorgestellter Definition, steht aber am Ende einer solchen Tat immer die<br />
Intention zum Suizid des Täters, was bislang als nicht beweisbar gilt. Diese<br />
Hypothese wird zudem im Falle von zielgerichteten Gewalthandlungen an<br />
Schulen bei vielen Studien entweder garnicht oder gegensätzlich behandelt. Die<br />
empirischen Daten sind auf Grund der relativen Seltenheit der Taten nur<br />
32<br />
Vgl. Gallwitz, 2001, S.171.<br />
33<br />
Vgl. Knecht, 1998, S.684.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Begriffsbestimmung<br />
unzureichend und erschweren eine klare Abgrenzung oder Definition schwerer<br />
zielgerichteter Gewalttaten an deutschen Schulen.<br />
Trotzdem wird in dieser Arbeit und der Bearbeitung der einzelnen Bereiche in<br />
erster Linie von dem Phänomen des <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> ausgegangen. Angelehnt an<br />
die Begriffsabgrenzung von Robertz wird der Begriff wie folgt definiert:<br />
• Es handelt sich um jugendliche Täter, die zur Tatzeit entweder Schüler/<br />
Studenten oder ehemalige Schüler/ Studenten der betroffenen<br />
Bildungseinrichtung waren.<br />
• Ziel ist die Tötung oder Verwundung mehrerer Personen aus dem Bereich<br />
der Bildungsinstitution (Personal, Schüler, Studenten), einbezogen werden<br />
aber auch Vorfälle, die nur Verletzte zur Folge hatten, oder gestoppt<br />
werden konnten, bevor es Verletzte gab.<br />
• Nicht einbezogen werden Handlungen, deren Motiv in Bandenkriminalität<br />
oder Streitigkeiten zwischen einzelnen Schülern liegt.<br />
• Die Täter werden abgeleitet aus dem Begriff <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> in der<br />
maskulinen Form als <strong>School</strong> Shooter bezeichnet.<br />
• Eine Berücksichtigung der Suizidintention findet nicht statt, da diese als<br />
Ziel nicht eindeutig belegt werden kann.<br />
Auch wenn eine eigene Begriffsabgrenzung in diesem Punkt getroffen werden<br />
konnte, müssen auf Grund von fehlenden oder unzureichenden<br />
Definitionsmöglichkeiten weitere Begriffe angewendet werden.<br />
Die Wörter <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>, lassen sich auf Grund der Wortbeschaffenheit nicht<br />
immer grammatikalisch einwandfrei anwenden. Ebenso mangelt es bislang an<br />
einer klaren und einheitlichen Definition innerhalb der kriminologischen oder<br />
psychologischen Wissenschaft. Um daher das Verständnis und den Lesefluss zu<br />
erleichtern, wird in dieser Arbeit ebenso auf die Worte Amok/ Amoklauf und der<br />
Umschreibung von <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> als extreme oder auch schwere zielgerichtete<br />
Gewalttat an Schulen zurückgegriffen werden müssen. Diese Begriffe werden im<br />
Verlauf der Arbeit synonym verwandt
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Bestehende Forschungsergebnisse<br />
3. Bestehende Forschungsergebnisse<br />
Weltweit werden bezüglich <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> keinerlei offizielle Statistiken<br />
geführt, auf deren Informationsdaten zurückgegriffen werden kann. 34 Dennoch ist<br />
es für diese Arbeit sinnvoll, einen Überblick über die Häufigkeit solcher Vorfälle<br />
und ihrer Besonderheiten zu geben. Eine statistische Einschätzung kann<br />
Aufschluss über Täter und Taten geben, die für eine eigene Herangehensweise in<br />
dieser Arbeit nutzbar gemacht werden können.<br />
Weiterhin ist es unabdingbar, ebenso den Blick auf den bestehenden<br />
Forschungsstand zu werfen. Die Ergebnisse bestehender Studien können sich bei<br />
der eigenen Bearbeitung als hilfreich erweisen.<br />
Aufgrund der Mehrzahl an Fällen in den USA ist gerade im nordamerikanischen<br />
Bereich der Bestand an Studien und Forschungen höher als in allen anderen<br />
Ländern. 35 Daher werden zunächst Resultate aus amerikanischen Studien<br />
gesondert vorgestellt, die sich mit der Thematik <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> befassen.<br />
Da für diese Arbeit extreme zielgerichtete Gewalthandlungen an deutschen<br />
Schulen das zentralste Moment darstellen, werden nach der Ergebnissicherung der<br />
amerikanischen Forschung bestehende Resultate aus Deutschland vorgestellt.<br />
Der Aufbau des folgenden Überblicks zu den drei amerikanischen, als auch zu<br />
den drei deutschen Studien umfasst zum einen die Autoren, das verwendete<br />
Material und die Art der Studie, sowie deren Ergebnissicherung.<br />
Ziel dieses Kapitel ist es, einen umfassenden Blick über bestehende Ergebnisse<br />
innerhalb Ausprägung und der Forschung im Bereich von <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> zu<br />
ermöglichen.<br />
Anhand der Ergebnisse soll ein eigener Einstieg in die Thematik verbessert<br />
werden. Da es sich bei extremen zielgerichteten Gewalthandlungen an Schulen<br />
um ein relativ neues Phänomen handelt, können mit der Vorstellung bestehender<br />
Thesen Grundlagen hervorgehoben werden, auf denen innerhalb der eigenen<br />
Bearbeitung aufgebaut werden kann.<br />
34<br />
Vgl. Robertz, 2005, S.59.<br />
35<br />
Vgl. Robertz, 2004, S.89ff.; Vgl. Hoffmann, 2007, S.25.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Bestehende Forschungsergebnisse<br />
3.1 Tötungsdelikte im Bereich des <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong><br />
Ausgangsmaterial der statistischen Erhebung in 3.1.1 bilden die Daten aus der<br />
Studie von Frank Robertz aus dem Jahr 2004. 36 Die Daten aus der Studie wurden<br />
ausgewählt, da vergleichbare Studien oder Erhebungen, die eine statistische<br />
Bearbeitung der Daten ermöglichen kaum vorhanden sind, beziehungsweise zum<br />
Bearbeitungszeitpunkt nicht vorlagen. Zusätzlich wird die Tabelle bis zum Jahr<br />
2007 erweitert und ergänzt. Die Quellen der weiteren <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s basieren<br />
auf einer Onlinerecherche im Internet. 37<br />
Obwohl diese Arbeit sich in erster Linie mit den Vorfällen aus Deutschland<br />
beschäftigt, soll zunächst eine weltweite Übersicht gegeben werden, die eine<br />
Datenauswertung aufgrund ihrer Mehrheit an Fällen eher zulässt. Dann werden im<br />
Hinblick auf den Schwerpunkt der Arbeit die deutschen Vorfälle gesondert<br />
aufgelistet.<br />
Alle zusammengetragenen Fälle können sicherlich nicht als statistisch valide<br />
Datenerhebung gewertet werden, sondern sollen vielmehr einen Überblick über<br />
das Phänomen des <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> bieten.<br />
3.1.1 Statistische Erhebung<br />
In die statistische Erhebung wurden Vorfälle aufgenommen, die nach der<br />
getroffenen Begriffsbestimmung in den Bereich des <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s fallen.<br />
Ausgewählt wurden Ereignisse anhand der im vorherigen Punkt festgelegten<br />
Kriterien für <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s. Daher kann die erhobene Statistik in einigen<br />
Ergebnissen von neueren Angaben in diesem Bereich abweichen.<br />
Problematisch bei der Abgrenzung der aufgenommenen Fälle hat sich erwiesen,<br />
dass die Einteilung der Lebensphase Jugend kontextuell von der jeweiligen<br />
Gesellschaft abhängig ist und selbst innerhalb der deutschen Gesetzgebung<br />
unterschiedliche Altersgrenzen genutzt werden. 38<br />
36<br />
Vgl. Robertz, 2004, S.62-75.<br />
37<br />
Vgl. Infoplease (no date), http//:www.infoplease.com/ipa/A0777958.html, 07.10.2007; Vgl. Spiegel.de<br />
(20.11.2006), www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,449549,00.html, 16.04.2007; Vgl. Sueddeutsche.de<br />
(20.11.2006), www.sueddeutsche.de/panorama/artikel/203/92111/, 16.04.2007.<br />
38<br />
Vgl. Robertz, 2004, S.22ff.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Bestehende Forschungsergebnisse<br />
Eine Einteilung ist aber notwenig, um eine Entscheidung zu treffen, welche<br />
Vorfälle in den Bereich des <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> fallen.<br />
In einem deutschen Standardwerk der Entwicklungspsychologie wird innerhalb<br />
der Jugendphase zwischen der frühen Adoleszenz von 11-14 Jahren, der mittleren<br />
Adoleszenz von 15-17 Jahren und der späten Adoleszenz im Alter von 18 bis 21<br />
Jahren unterschieden. 39 Zusätzlich wird mit einer Überschneidung zur<br />
Lebensphase Jugend, der Bereich des frühen Erwachsenenalters von 18-29 Jahren<br />
abgegrenzt, wobei Altersübergänge in dieser Phase als fließend bezeichnet<br />
werden. 40 Aus soziologischer Sicht heraus unterscheidet dagegen Hurrelmann<br />
innerhalb der Lebensphase Jugend zwischen der frühen Jugendphase im Alter von<br />
12-17 Jahren, der mittleren Jugendphase im Alter von 18 bis 21 Jahren und der<br />
späten Jugendphase im Alter von 22 bis 27 Jahren, welche als Übergangsphase<br />
zum Erwachsenenstatus gesehen wird. 41 Er geht demnach von einer Alterspanne<br />
der Lebensphase Jugend zwischen 12-27 Jahren aus.<br />
Wichtig ist, dass eine Einteilung sowohl unter Einbezug von Statusübergängen in<br />
dieser Phase, als auch durch bestimmte Entwicklungsverläufe und spezifischen<br />
Entwicklungsaufgaben erfolgt. Ebenso werden Fälle von Schülern, und Studenten<br />
mit in die Statistik einbezogen. Daher wird in Anlehnung an<br />
entwicklungspsychologische und soziologische Annahmen, als Ausgangspunkt<br />
für die erhobene Statistik, von dem Eintritt in das Jugendalter mit 11 Jahren<br />
ausgegangen, als Höchstgrenze wird das Alter von 25 Jahren gesetzt. Die<br />
Höchstgrenze wird aus pragmatischen Gründen gesetzt, weil darüber hinaus keine<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s von älteren Tätern ermittelt werden konnten, die in den<br />
abgegrenzten Bereich von <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s fallen oder die Täter sich nicht mehr<br />
eindeutig innerhalb der Lebensphase Jugend befanden.<br />
In der Statistik werden weltweite Vorfälle schwerer zielgerichteter Gewalttaten an<br />
Schulen in den Jahren 1975 bis Mitte 2007 aufgelistet. Einbezogen werden<br />
insgesamt 87 <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s. Davon haben die überwiegende Mehrheit der<br />
Taten mit 69 Fällen in den USA stattgefunden. Andere Länder, die bis 2007<br />
aufgeführt werden, sind Kanada mit 6 Taten, Deutschland mit 6 Taten und<br />
Brasilien, Saudi Arabien, Bosnien-Herzegowina, Argentinien, Schweden und<br />
Holland mit jeweils einer Tat.<br />
39<br />
Vgl. Oerter/ Dreher, 2002, 258ff.;<br />
40<br />
Vgl. Krampen/ Reichle, 2002, S.319ff.<br />
41<br />
Vgl. Hurrelmann, 2005, S.40f.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Bestehende Forschungsergebnisse<br />
Die Einteilung innerhalb der folgenden Tabelle erfolgt nach dem Jahr der Tat. Des<br />
weiteren ist eine Unterteilung nach dem jeweilige Datum, an dem das <strong>School</strong><br />
<strong>Shooting</strong> stattfand, vorgenommen worden.<br />
Die Orte werden nach dem Staat und dem genauen Ort gegliedert. Bei Fällen, die<br />
in den USA stattgefunden haben, wird eine zusätzliche Angabe zu dem jeweiligen<br />
Bundesstaat gemacht.<br />
In der Spalte Täter finden sich Angaben über das Alter, sowie das Geschlecht der<br />
<strong>School</strong> Shooter. Auf Angaben zu Namen der Täter wurde verzichtet, da diese für<br />
diese Arbeit keinerlei Relevanz besitzen.<br />
In der Spalte der Waffen werden nur weitere Angaben gemacht, wenn es sich bei<br />
den Tatwaffen nicht um Schusswaffen handelt, oder wenn noch zusätzliche<br />
Waffen verwendet worden sind. Bei den Fällen, in denen keine Angaben zu den<br />
verwendeten Waffen stehen, sind nur Schusswaffen benutzt worden. Ob bei dem<br />
Amoklauf mehrere Schusswaffen verwendet worden sind, konnte nicht in allen<br />
dargestellten Fällen ausfindig gemacht werden. Daher werden keine Angaben<br />
über die Anzahl der jeweiligen Waffen gemacht.<br />
Die weitere Spalte gibt Auskunft über die Opferzahlen der <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s.<br />
Wobei die erste Zahl die Anzahl der Toten bedeutet und die zweite Zahl die<br />
Anzahl der Verletzten.<br />
In der letzten Spalte steht ein Ja hinter den Vorfällen, in denen der Täter nach<br />
seinem Amoklauf Suizid begangen hat. Werden keine Angaben gemacht, so liegt<br />
kein Suizid des Täters vor.<br />
Dazu wurden auch Vorfälle mit aufgenommen, in denen in einzelnen<br />
Teilbereichen keine Angaben ermittelt werden konnten. Diese sind mit einem<br />
Fragezeichen innerhalb der Tabelle gekennzeichnet worden.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Bestehende Forschungsergebnisse<br />
Tabelle 1: 87 <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s weltweit vom 30.12.1974 bis zum 16.04.2007<br />
Jahr Datum Staat Stadt/ Land Täter Waffen Opfer Suizid<br />
1974 30.12. USA Orlean/ New York 18J./m. Schussw./Bomben 0/0 Ja<br />
1975 28.05. Kanada Brampton/ Ontario 16J./m. 1/13 Ja<br />
27.10 Kanada Ottawa/ Ontario 16J./m. 1/5 Ja<br />
1978 22.02. USA Lansing/ Michigan 15J./m. 1/1<br />
18.05. USA Austin/ Texas 13J./m. 1/0<br />
15.10. USA Lanetta/ Alabama 13J./m. 0/1<br />
1979 29.01. USA San Diego/ Kalifornien 16J./w. 1/10<br />
1982 19.03. USA Las Vegas/ Nevada 18J./m. 1/2<br />
1983 20.01. USA St.Louis/ Missouri 15J./m. 1/2 Ja<br />
1985 21.01. USA Goddard/ Kansas 14J./m. 1/3<br />
1986 04.12. USA Lewiston/ Montana 14J./m. 1/3<br />
1987 02.03. USA DeKalb/ Missouri 12J./m. 1/0 Ja<br />
1988 11.02. USA Pinellas Park/ Florida 16J./m. 1/2<br />
26.09. USA Greenwood/South Carolina 19J./m. 1/15<br />
14.12. USA Virgina Beach/ Virgina 15J./m. 1/1<br />
1989 05.10. USA Anaheim/ Orange County 15J./m. 0/1<br />
15.11. USA Arlington/ Texas 13J./m. 0/1<br />
06.12. Kanada Montreal 25J./m. 13/14 Ja<br />
1992 01.05. USA Olivehurst/ Kalifornien 20J./m. 2/12<br />
14.05. USA Napa/ Kalifornien 14J./m. 0/2<br />
11.09. USA Amarillo/ Texas 17J./m. 0/6<br />
14.12. USA Great Barrington/Massa.s 18J./m. 2/4<br />
1993 18.01. USA Grayson/ Kentucky 17J./m. 2/0<br />
01.12. USA Wauwatosa/ Wisconsin 21J./m. 1/0<br />
1994 26.05. USA Union/ Kentucky 17J./m. 4/0<br />
12.10. USA Greensboro/North Carolina 16J./m. 0/1 Ja<br />
08.11. USA Manchester/ Iowa 16J./m. 0/1<br />
1995 23.01. USA Redlands/ Kalifornien 13J./m. 0/1 Ja<br />
12.10. USA Blackville/ South Carolina 16J./m. 1/1 Ja<br />
15.11. USA Lynnville/ Tenessee 17J./m. 2/1<br />
1996 02.02. USA Moses Lake/ Washington 14J./m. 3/1<br />
08.02. USA Paolo Alto/ Kalifonien 16J./m. 0/3 Ja<br />
17.09. USA State College/Pennsylvania 19 J./w. Schuss./Stichw. 1/1<br />
25.12. USA Scottsdale/ Georgia 16J./m. 1/0<br />
1997 19.02. USA Bethel/ Alaska 16J./m. 2/2<br />
01.10. USA Pearl/ Mississippi 16J./m. Schuss./Stichw. 3/7<br />
01.12. USA West Paducah/ Kentucky 14J./m. 3/5<br />
15.12. USA Stamps/ Arkansas 14J./m. 0/2<br />
1998 24.03 USA Jonesbobo/ Arkansas 11+13J./m. 5/10<br />
26.03. USA New York/ New York 14J./m. 0/0<br />
07.04. USA Yonkers/ New York ?w. Schlagwaffe 0/1<br />
24.04. USA Edinboro/ Pennsylvania 14J./m. 0/3<br />
21.05. USA Springfield/ Oregon 15J./m. 3/21<br />
15.06. USA Richmond/ Virgina 14J./m. 0/2<br />
1999 16.04. USA Notus/ Idaho 16J./m. 0/0<br />
20.04. USA Littleton/ Colorado 17+18J./m. Schussw/Bomben 13/23 Ja<br />
28.04. Kanada Taber/ Alberta 14J./m. 1/1<br />
20.05. Saudi Arab. ? ?m. 0/0<br />
20.05. USA Conyers/ Georgia 15J./m. 0/6<br />
09.11. Deutschl. Meißen 15J./m. Stichwaffe 1/0<br />
19.11. USA Deming/ New Mexico 12J./m. 1/0<br />
06.12. USA Fort Gibson/ Oklahoma 13J./m. 0/4<br />
07.12. Niederl. Veghel 17J./m. 0/4<br />
2000 10.03. USA Savannah/ Georgia 19J./m. 2/1<br />
16.03. Deutschl. Brannenburg 16J./m. 1/0 Ja<br />
20.04. Kanada Ottawa/ Ontario 15J./m. Stichwaffe 0/5
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Bestehende Forschungsergebnisse<br />
11.05. USA Prairie Grove/ Arkansas 12J./m. 0/1<br />
26.05. USA Lake Worth/ Florida 13J./m. 1/0<br />
17.07. USA Renton/ Washington 13J./m. 0/0<br />
01.11. USA Carollton/ Texas 15J./m. 0/0<br />
2001 23.02. USA Portland/ Oregon 14J./m. Stichwaffe 0/3<br />
05.03. USA Santee/ Kalifornien 15J./m. 2/13<br />
06.03. Brasilien Limeira 15J./m. 1/2<br />
07.03. USA Williamsport/Pennsylvania 14 J./w. 0/1<br />
22.03. USA El Cajon/ Kalifornien 18J./m. 0/8 Ja<br />
30.03. USA Gary/ Indiana 17J./m. 1/0<br />
20.04. USA Monroe/ Louisiana 14J./m. 0/0<br />
25.10. Schweden Sundvall 19J./m. Stichwaffe 1/1<br />
12.11. USA Caro/ Michigan 17J./m. 0/0 Ja<br />
05.12. USA Springfield/ Massachusetts 17J./m. Stichwaffe 1/0<br />
2002 15.01. USA Manhatten/ New York ?m. 0/2<br />
19.02. Deutschl. Freising 22J./m. Schussw./Bomben 3/3 Ja<br />
20.03. USA Carmichael/ Kalifornien 13J./m. 0/0<br />
26.04. Deutschl. Erfurt 19J./m. Schussw./Stichw. 16/6 Ja<br />
29.04. Bosn.Herzeg. Vlasenica 17J./m. 1/1 Ja<br />
15.11. USA Scurry, Texas 18J./m. Schussw./Benzin 0/0<br />
2003 24.04. USA Red Lion 14J/.m. 1/0 Ja<br />
02.07. Deutschl. Coburg 16J./m. 0/1 Ja<br />
24.09. USA Col Spring/ Minnesota 15J./m. 0/2<br />
2004 28.09. Argentinien Carmen de Patagones 15J./m. 3/6<br />
2005 21.03. USA Red Lake/ Minnesota 16J./m. 9/0 Ja<br />
08.11. USA Jacksboro/ Tennessee 15J./m. 1/2<br />
2006 30.08. USA Hillsborough/North Carol. 19J./m. 1/2<br />
13.09. Kanada Montreal 25J./m. 19/1 Ja<br />
29.09. USA Cazanovia/ Wisconsin 15J./m. 1/0<br />
20.11. Deutschl. Emsdetten 18J./m. 0/37 Ja<br />
2007 16.04. USA Blacksburg/ Virgina 23J./m. 32/0 Ja<br />
Quellen: 42<br />
Nach der Erhebung der Fälle von <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s weltweit erfolgt nun, im<br />
Hinblick auf den Schwerpunkt dieser Arbeit, eine gesonderte Darstellung von<br />
sechs Fällen, die sich in Deutschland ereignet haben..<br />
In der Übersicht werden Angaben zum Jahr, mit genauem Datum, dem Ort, dem<br />
Alter der Täter gemacht.<br />
Der Aufbau der Tabelle ist an die weltweite Tabelle angelehnt. Zusätzlich<br />
erfolgen für die Fälle in Deutschland noch Angaben zur jeweilige Schulform, die<br />
der Täter besucht hat, genauere Angaben über die verwendeten Waffen und<br />
insbesondere über die Opfer der einzelnen <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s.<br />
Als Besonderheit der deutschen Fälle sei zuletzt noch angemerkt, dass bis auf den<br />
Fall in Meißen alle Täter nach ihrem Amoklauf Suizid begangen haben, so dass<br />
auf Angaben dazu in dieser Tabelle verzichtet wurde.<br />
42<br />
Vgl. Robertz, 2004, S.62-75.; Vgl. Infoplease (no date), http//:www.infoplease.com/ipa/A0777958.html,<br />
07.10.2007; Vgl. Spiegel online (20.11.2006), www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,449549,00.html,<br />
16.04.2007; Vgl. Sueddeutsche.de (20.11.2006), www.sueddeutsche.de/panorama/artikel/203/92111/,<br />
16.04.2007.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Bestehende Forschungsergebnisse<br />
Die Übersicht über die deutschen Vorfälle erfolgt im Hinblick auf die<br />
Themenstellung dieser Arbeit. Sie gibt einen komprimierten und genaueren<br />
Überblick über ereignete <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s in Deutschland.<br />
Tabelle 2: 6 <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s in Deutschland vom 09.11.1999 bis zum<br />
20.11.2006<br />
Jahr Datum Ort Alter Schule Waffen Opfer<br />
1999 09.11. Meißen 15 J. Gymnasium 2 Stichwaffen Tötet eine Lehrerin<br />
2000 16.03. Brannenburg<br />
16 J. Schule/ Internat 2 Schusswaffen Verletzt den Heimleiter<br />
des Internats<br />
2002 19.02. Freisingen 22 J. Arbeitsstelle/<br />
Wirtschaftsschule<br />
1 Schusswaffe/<br />
Rohrbomben<br />
Tötet den ehem. Chef<br />
und den Direktor<br />
der Schule/ Verletzt<br />
einen Mitarbeiter<br />
und zwei<br />
Lehrer<br />
26.04. Erfurt 19 J. Gymnasium 2 Schusswaffen Tötet 12 Lehrer, 2<br />
Schüler, 1 Sekretärin,<br />
1 Polizisten/<br />
Verletzt 6 Personen<br />
2003 02.07. Coburg 16 J Realschule 1 Schusswaffe Tötet 1 Lehrerin<br />
2006 20.11. Emsdetten 18 J. Realschule 3 Schusswaffen/<br />
Sprengsätze<br />
37 Verletzte<br />
Quellen 43<br />
3.1.2 Datenauswertung<br />
Die Datenauswertung bezieht sich in erster Linie auf die erhobene weltweite<br />
Statistik in Punkt 3.1.1. Der Einbezug der internationalen Fälle ist notwendig, da<br />
eine alleinige Auswertung der deutschen Daten nicht genügend verwertbare<br />
Ergebnisse liefert. Um dennoch den Schwerpunkt dieser Arbeit nicht aus den<br />
Augen zu verlieren, wird bei der Auswertung einzelner Aspekte jeweils auch auf<br />
die ereigneten <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s in Deutschland eingegangen. Dabei ist es von<br />
Vorteil, dass die Daten der nationalen und internationalen Fälle in einigen<br />
Aspekten jeweils als Vergleichszahlen herangezogen werden können.<br />
Wie bereits im vorherigen Punkt angebracht wurde, kann auch die Auswertung<br />
der Statistiken nicht als wissenschaftlich valide angesehen werden, sondern nur<br />
den Blick auf mögliche Tendenzen im Phänomen <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> richten. Die<br />
43<br />
Vgl. Robertz, 2004, S.62-75.; Vgl. Spiegel online (20.11.2006),<br />
www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,449549,00.html, 16.04.2007; Vgl. Sueddeutsche.de (20.11.2006),<br />
www.sueddeutsche.de/panorama/artikel/203/92111/, 16.04.2007.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Bestehende Forschungsergebnisse<br />
Quellen der Daten in den jeweiligen Abbildungen, wurden aus der vorher<br />
erstellten Tabelle entnommen.<br />
Die Abbildung 1 listet die Anzahl der weltweiten Fälle aus der Statistik in 3.1<br />
nach ihren Jahresdaten auf.<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
Anzahl<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
1974<br />
1977<br />
1980<br />
1983<br />
1986<br />
1989<br />
1992<br />
1995<br />
1998<br />
2001<br />
2004<br />
2007<br />
Jahresdaten<br />
Quelle: Daten basieren auf der statistischen Erhebung<br />
Abbildung 1: Anzahl der <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s weltweit von 1974 bis 2007<br />
Interessanterweise lässt sich eine eindeutige Zunahme an Taten feststellen. Diese<br />
steigt ab den 90-ger Jahren bis 2002 nochmals erheblich an und hat ihren<br />
Höhepunkt zwischen 2000–2002 erreicht, mit insgesamt 23 Taten. Ab dem Jahr<br />
2002 nimmt die Anzahl der <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s wieder ab. Jedoch kann danach kein<br />
Jahr mehr verzeichnet werden, in dem kein <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> stattgefunden hat.<br />
Um einen Anstieg der Vorfälle in Deutschland nachzuweisen, liegen bislang zu<br />
wenig <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s vor. Der erste dokumentarisch erfasste Vorfall ereignete<br />
sich 1999, und dann in den Jahren 2000, 2002, 2003 und 2006 jeweils ein Vorfall.<br />
Die deutschen erfassten <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s beginnen demnach im gleichen<br />
Zeitrahmen, in dem im internationalen Vergleich ein starker Anstieg zu<br />
verzeichnen ist.<br />
Die Abbildung 2, 3 und 4 geben einen Überblick über die Anzahl der Opfer bei<br />
den einzelnen <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s aus der Statistik. Jahre, in denen kein <strong>School</strong><br />
<strong>Shooting</strong> stattfanden, wurden zu Gunsten der Übersichtlichkeit der Abbildung<br />
nicht mit aufgenommen. Ebenso wurde der Suizid der Täter in ihnen nicht mit<br />
einberechnet, da auf diesen in diesem Punkt gesondert eingegangen werden wird.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Bestehende Forschungsergebnisse<br />
Die Abbildung 2 gibt einen Überblick über die Anzahl der einzelnen Verletzten<br />
bei den jeweiligen <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s.<br />
Anzahl der<br />
Verletzten<br />
36<br />
32<br />
28<br />
24<br />
20<br />
16<br />
12<br />
8<br />
4<br />
0<br />
1974<br />
1975<br />
1978<br />
1979<br />
1982<br />
1983<br />
1985<br />
1986<br />
1987<br />
1988<br />
1989<br />
1992<br />
1993<br />
1994<br />
1995<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
Jahreszahle n<br />
der Vorfälle<br />
Quelle: Daten basieren auf der statistischen Erhebung<br />
Abbildung 2: Anzahl der verletzten Opfer bei den <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s weltweit von 1974 bis<br />
2007<br />
Jahre, wie zwischen 1988-1992 und 1997-2002, in denen mehrere <strong>School</strong><br />
<strong>Shooting</strong>s stattfanden, haben auch mehr Verletzte. Ausnahme bildet dabei das<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> in Emsdetten, dass mit 37 Verletzten, mit Abstand zu allen<br />
anderen <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s die meiste Anzahl an Verletzten mit sich brachte.<br />
Die Abbildung 3 beinhaltet die Anzahl der Toten bei den einzelnen <strong>School</strong><br />
<strong>Shooting</strong>s.<br />
32<br />
28<br />
24<br />
Anzahl<br />
der Toten<br />
20<br />
16<br />
12<br />
8<br />
4<br />
0<br />
1974<br />
1975<br />
1978<br />
1979<br />
1982<br />
1983<br />
1985<br />
1986<br />
1987<br />
1988<br />
1989<br />
1992<br />
1993<br />
1994<br />
1995<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
Jahreszahlen<br />
der Vorfälle<br />
Quelle: Daten basieren auf der statistischen Erhebung<br />
Abbildung 3: Anzahl der getöteten Opfer bei den <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s weltweit von 1974-2007
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Bestehende Forschungsergebnisse<br />
Die Abbildungen 3 zeigt auf, dass keine Verbindung zwischen der Anzahl an<br />
Toten oder Verletzten bestehen muss. Vergleicht man die einzelnen Daten der<br />
erfolgten <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s miteinander, so sind in den meisten Fällen relativ<br />
geringe Opferzahlen ersichtlich. Auffällig ist, dass in der überwiegenden Anzahl<br />
der Fälle mit sehr hohen Opferzahlen, entweder getötete Opfer oder Verletzte<br />
eindeutig überwiegen. Ausnahmen bilden dabei nur die Fälle in Montreal 1989<br />
und Littleton im Jahr 1999. Bei diesen beiden <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s sind sowohl die<br />
Anzahl der Verletzten, als auch die Anzahl der Toten wesentlich höher als bei<br />
allen anderen <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s weltweit. Ebenso fällt der Amoklauf von<br />
Blacksburg 2007 mit besonders vielen Toten, aber keinen Verletzten auf.<br />
Basierend auf den beiden vorherigen Abbildungen, wird nun auf die Verteilung<br />
der Opferzahlen in Relation zu den in den einzelnen Jahren erfolgten <strong>School</strong><br />
<strong>Shooting</strong>s eingegangen. Die Abbildung 4 gibt Übersicht über den Schwere-Index<br />
und berechnet sich aus der Anzahl der gesamten Opfer bei den ereigneten <strong>School</strong><br />
<strong>Shooting</strong>s.<br />
Anzahl<br />
der Opfer<br />
36<br />
32<br />
28<br />
24<br />
20<br />
16<br />
12<br />
8<br />
4<br />
0<br />
1974<br />
1975<br />
1978<br />
1979<br />
1982<br />
1983<br />
1985<br />
1986<br />
1987<br />
1988<br />
1989<br />
1992<br />
1993<br />
1994<br />
1995<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
Jahreszahlen<br />
der Vorfälle<br />
Quelle: Daten basieren auf der statistischen Erhebung<br />
Abbildung 4: Die Opferzahlen bei <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s weltweit von 1974 bis 2007<br />
Angegeben wurden alle aufgelisteten Vorfälle bei denen es mindestens ein Opfer<br />
gab. Die Anzahl der Toten und der Verletzten wurde in den Angaben zu den<br />
Opferzahlen zusammengefasst. Verdeutlicht wird hier nochmals der Anstieg an<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s seit den 90-ger Jahren. In Verbindung dazu zeigt sich, dass auch<br />
die Opferzahlen seitdem zugenommen haben. Gerade besonders schwere Fälle
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Bestehende Forschungsergebnisse<br />
von <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> mit mindestens 8 Opfern, kommen in dem kürzeren<br />
Zeitraum von 1997–2007 (13 Fälle) häufiger vor als in den Jahren 1974–1997 (5<br />
Fälle). Besonders zu beachten ist, dass in den Jahren 2003-2005 mit einem<br />
Rückgange der Vorfälle auch ein leichter Rückgang in den Opferzahlen zu<br />
verzeichnen ist. Dafür überwiegen dann aber von 2006 bis Mitte 2007 besonders<br />
folgenreiche <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s mit hohen Opferzahlen.<br />
Aus der statistischen Erhebung lässt sich berechnen, dass weltweit bis 2007<br />
insgesamt 471 Menschen Opfer bei einem <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> waren, davon wurden<br />
174 Menschen getötet und 297 Menschen verletzt. Errechnet man daraus<br />
Durchschnittszahlen, so sind es 2 Tote und 3,4 Verletzte pro ereignetem <strong>School</strong><br />
<strong>Shooting</strong>. Nur 7 Taten in liegen mit ihren Opferzahlen weit über dem<br />
Durchschnitt und forderten jeweils mehr als 5 Tote. Die Tat aus Emsdetten liegt<br />
dagegen besonders hoch in der Anzahl der Verletzten.<br />
Vergleicht man die Daten aus der Grafik mit der Schwere der einzelnen Taten,<br />
also mit den Opferzahlen, so zeigt sich ebenfalls ein Anstieg des Schweregrades<br />
bei den <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s weltweit. Dieses Phänomen spiegelt sich auch in der<br />
deutschlandweiten Tabelle in Punkt 3.3.1 wider. Gerade die Vorfälle in Emsdetten<br />
und in besonders Erfurt gehören mit zu den schwersten Amokläufen weltweit mit<br />
besonders hohen Opferzahlen.<br />
Opfer waren in fast allen Fällen Schüler oder die Opfer gehörten zum<br />
Schulpersonal. Betrachtet man die Suizidrate der einzelnen Täter, begingen bei<br />
den 89 aufgeführten Taten nur 24 Jugendliche Selbstmord, wobei es in Littleton 2<br />
Täter gab, die sich beide das Leben nahmen. In Deutschland gestaltet sich das<br />
Bild der Suizidenten anders, denn bis auf den Fall im Jahr 1999, haben alle<br />
anderen Täter Selbstmord begangen. Des weiteren ist innerhalb des Zeitverlaufes<br />
ebenfalls eine Zunahme des Suizids zu erkennen. Gerade ab dem Jahr 2002<br />
begingen wesentlich mehr Täter nach ihrem Amoklauf Suizid als vorher.<br />
Die folgende Abbildung 5 gibt einen genauen Überblick über die<br />
unterschiedlichen Alterstufen der Täter weltweit. Sie schließt bei 89 Taten<br />
allerdings nur 88 Täter ein. Diese Zahl errechnet sich daraus, dass von den<br />
insgesamt 89 Taten bei zwei <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s zwei Täter beteiligt waren. Diese<br />
Täter wurden alle als Einzeltäter gewertet und in die Auswertung mit einbezogen.<br />
Des weiteren konnten aber drei Fälle nicht miteinbezogen werden, da keine<br />
Altersangaben über die Täter ermittelt werden konnte.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Bestehende Forschungsergebnisse<br />
Anzahl<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25<br />
Alter in Jahren<br />
Quelle: Daten basieren auf der statistischen Erhebung<br />
Abbildung 5 Alterstufen der Täter bei <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s weltweit von 1974 bis 2007<br />
Die Abbildung 5 verdeutlicht, dass Taten von 11–12 Jährigen und von 20–23<br />
Jährigen in der Statistik einen nur geringen Teil aus machen. Das Hauptalter der<br />
Täter liegt somit zwischen 13 und 19 Jahren. Nach der daraus errechneten<br />
Durchschnittszahl, liegt das Alter der Täter weltweit durchschnittlich bei 15,9<br />
Jahren.<br />
Schaut man die Tabelle der deutschen Vorfälle in an, liegt hier das<br />
Durchschnittsalter höher als in der internationalen Statistik. Der jüngste Täter war<br />
15 und der älteste Täter 22 Jahre alt, voraus sich bei den insgesamt 6 <strong>School</strong><br />
<strong>Shooting</strong>s ein Durchschnittsalter von 17,7 Jahren ergibt.<br />
Zur Geschlechtsspezifität von Amoktaten an Schulen zeigt sich deutschlandweit<br />
und international eindeutig, dass es sich in erster Linie um ein männlich<br />
dominiertes Verhalten handelt. Mit einer eindeutigen Minderheit wurden nur 4 der<br />
angeführten Taten von Mädchen begangen.<br />
Alle anderen mit aufgeführten <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s wurden von männlichen<br />
Jugendlichen ausgeführt. In Deutschland liegt die Geschlechterverteilung noch<br />
eindeutiger. Gerade hier wurde keine der Tat von einem Mädchen begangen.<br />
Die Abbildung 6 listet die verwendeten Waffenarten der <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s von<br />
1974 bis 2007 auf:
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Bestehende Forschungsergebnisse<br />
Waffenart<br />
Schlagw affen<br />
Klingenenw affen<br />
Schuss-/ Klingenw affen<br />
Schussw affen, Sprengsätze<br />
Schussw affen<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80<br />
Anzahl<br />
Quelle: Daten basieren auf der statistischen Erhebung<br />
Abbildung 6: Waffenverwendung bei <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s weltweit von 1974 bis 2002<br />
Zum Einsatz kamen in 78 Fällen Schusswaffen wie Gewehre, Revolver oder<br />
andere (halb-) automatische Handfeuerwaffen. In drei Fällen wurden Sprengsätze,<br />
Bomben oder Benzin angewendet und in zwei Fällen wurden zusätzlich<br />
Klingenwaffen verwendet. In vier Fällen kamen nur Stich- oder Klingenwaffen<br />
zum Einsatz und in einem Fall eine stumpfe Schlagwaffe.<br />
Die Waffenart bei <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s zeichnet sich demnach in erster Linie durch<br />
die Verwendung von Schusswaffen aus. Betrachtet man die Taten in Deutschland<br />
gesondert, ist die Tatwaffenverwendung ähnlich der Tendenz in den<br />
internationalen Fällen.<br />
Von den insgesamt 6 betrachteten Fällen bis 2006, wurde bei der Mehrzahl (5<br />
Vorfälle) Schusswaffen verwendet, wobei drei jeweils nur mit Schusswaffen<br />
stattfanden und bei den zwei anderen zusätzlich noch Sprengsätze zum Einsatz<br />
kamen. In einem deutschen Fall benutzte der Täter nur Stichwaffen.<br />
Während die statistische Übersicht einen Einblick über die Häufigkeit und<br />
Ausprägung von schweren zielgerichteten Vorfällen ermöglicht, muss zusätzlich<br />
noch auf den bestehenden Forschungsstand eingegangen werden. Erst ein<br />
übergeordneter Blick auf Umfang und bestehende Wissensstände ermöglicht es,<br />
sich dem Phänomen des <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s mit einer eigenen Bearbeitungsweise<br />
zu nähern.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Bestehende Forschungsergebnisse<br />
3.2 Amerikanische Studien<br />
In den USA gibt es für den Bereich des <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> die meisten Studien. Alle<br />
dort durchgeführten Studien beziehen sich ausschließlich auf Vorfälle in den USA<br />
und beinhalten unterschiedliche Zentrierungen in ihrer Ergebnissicherung.<br />
An dieser Stelle soll nun ein Überblick zu drei bestehenden Studien aus den<br />
Jahren 1999–2002 geliefert werden.<br />
Diese wurden ausgewählt, da sie sich in ihrem Gegenstand, in der Akzentsetzung<br />
und den Ergebnissen voneinander unterscheiden, aber eher ergänzend als im<br />
Widerspruch zueinander stehen. Die Darstellung erfolgt chronologisch, nach dem<br />
Erscheinen der einzelnen Ergebnisse.<br />
3.2.1 Critical Incident Response Group des FBI<br />
Im Jahre 1999 wurde von Mary Ellen O’Toole in Zusammenarbeit mit der Critical<br />
Incident Response Group (CIRG) des FBI eine Studie veröffentlicht, die sich mit<br />
dem Realitätsgehalt von Drohungen befasst hat. Ziel war es, aus den Ergebnissen<br />
der Studie heraus präventiv wirksam werden zu können, dass heißt im Vorfeld bei<br />
ersten Anzeichen eines möglichen <strong>School</strong> Schootings Interventionsprozesse<br />
einleiten zu können. 44<br />
Es wurden 18 öffentliche Schulen in den USA zu dieser Studie herangezogen. 45 In<br />
14 von ihnen hatte ein <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> stattgefunden, in den restlichen 4 Schulen<br />
gab es Hinweise auf mögliche Taten, die jedoch im Vorfeld aufgedeckt und somit<br />
verhindert werden konnten. Zusätzlich wurden Ergebnisse aus einer Evaluation<br />
und einem Symposium der CIRG mit 160 Fachleuten herangezogen.<br />
Diese Fachgruppe des FBI begann im Jahre 1998 mit ihrer ersten Arbeit im<br />
Bereich des Phänomens von <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>. 46 Aus der behavioralen Perspektive<br />
heraus lag der Fokus der Arbeit darin, aus der Auswertung verschiedener Fälle ein<br />
besseres Verständnis für die unterschiedlichen Hintergründe solcher Taten<br />
entwickeln zu können. Nach dem schweren Vorfall in Littleton 1999 wurde eine<br />
44<br />
Vgl. O’Toole (1999), www.fbi.gov/publications/school/school2.pdf, 15.05.2007, S.2f.<br />
45<br />
Vgl. ebenda, S.34.<br />
46<br />
Vgl. ebenda, S.2.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Bestehende Forschungsergebnisse<br />
Fachtagung in Leedsburg, Virgina einberufen, an der unter anderem Mitarbeiter<br />
der 18 betroffenen Schulen teilnahmen.<br />
Die Fälle wurden hinsichtlich Ort, Handlungen, Täter und möglichen<br />
Einflussfaktoren untersucht. Aus den Ergebnissen der Studie wurde ein Modell<br />
erstellt, anhand dessen eine Einschätzung zum Realitätsgehalt von Drohungen<br />
gemacht werden kann. O’Toole verweist allerdings darauf, dass dieses Modell<br />
nicht als absolutes Täterprofil oder Checkliste gesehen werden soll, sondern nur<br />
die Einschätzung eines Schweregrades von Drohungen erleichtern soll. 47<br />
Innerhalb der Studie wird zwischen drei unterschiedlichen Bedrohungspotenzialen<br />
unterschieden: einer Low–Level Bedrohung, der Medium–Level Bedrohung und<br />
der High–Level Bedrohung. Gleichzeitig werden noch vier unterschiedliche<br />
Betrachtungsebenen der Drohungen geboten. 48 Die Zunahme des Schweregrades<br />
und der Spezifität einer Bedrohung bedeutet eine Zunahme des Realitätsgehaltes.<br />
Aus dieser Einteilung heraus steigt je nach Bedrohungsgrad die Notwendigkeit<br />
einer Intervention. Gerade High-Level Bedrohungen müssen demnach als<br />
besonders realistisches und wichtiges Indiz für die Planung eines Amoklaufes<br />
gesehen werden.<br />
3.2.2 James P. McGee und Caren R. DeBernado<br />
Im Jahre 1999 haben James P. McGee und Caren R. DeBernado eine erste<br />
Analyse von zwölf Fällen in den Jahren 1993–1998 herausgegeben. Die Studie<br />
wurde 2001 aktualisiert und um vier weitere Fälle erweitert. 49 Diese Fassung dient<br />
an dieser Stelle als Grundlage der Vorstellung.<br />
Aus den Daten der verwendeten Fälle versuchten beide Autoren, ein Täterprofil<br />
zu erstellen. Die verwendeten Daten wurden aus Medienberichten und offiziellen<br />
Polizeiberichten entnommen und in narrativer Form in chronologischer<br />
Reihenfolge aufgelistet, beschrieben und ausgewertet. Anschließend wurde aus<br />
den Ergebnissen ein Profil entwickelt. 50 Dabei unterschieden sie zwischen<br />
Schießerei an Schulen in Bezug auf Bandenkriminalität (gangs) und Schießereien<br />
47<br />
Vgl. ebenda, S.1.<br />
48<br />
Vgl. ebenda, S.27ff.<br />
49<br />
Vgl. Robertz, 2004, S.92.<br />
50<br />
Vgl. McGee/ DeBernado (2001), www.sheppardpratt.org/Documents/classavenger.pdf, 30.06.2007, S.2ff.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Bestehende Forschungsergebnisse<br />
eines „classroom avengers“. McGee und DeBernado zogen den Begriff eines<br />
„classroom avengers“ für die Bezeichnung eines Amokläufers an Schulen heran.<br />
Verifiziert wurden die Ergebnisse durch ein Interview. Befragt wurde ein Schüler,<br />
der von seiner Schule als möglicher Risikoschüler eingestuft wurde. 51<br />
Das Ergebnis dieser Studie beschreibt ein umfangreiches Täterprofil mit<br />
demografischen, historischen, klinischen bis hin zu kontextbezogenen Faktoren.<br />
Allerdings weisen McGee und DeBernado in ihrer Studie mehrmals darauf hin,<br />
dass dieses Profil nicht als generalisierbar gilt. 52<br />
Nach der Ansicht von McGee und DeBernado, handelt sich bei dem Täter um<br />
einen psychisch gesunden und unauffälligen männlichen Jugendlichen, der<br />
allerdings an depressiv suizidalen Stimmungen leidet. Er stammt aus einer eher<br />
mittelständischen ländlichen Gegend und seine Beziehungen in seinem sozialen<br />
Netzwerk sind auf den ersten Blick eher unauffällig, bei genauerer Betrachtung<br />
jedoch als schädigend und dysfunktional zu beschreiben. Er gilt als introvertiert<br />
und vorhandene Freunde sind meist ebenso soziale Außenseiter. Die<br />
Schulleistungen sind normal und in den meisten Fällen durchschnittlich . Als<br />
Hauptgrund ist Rache zu sehen, sekundäre Motive sind Status und<br />
Aufmerksamkeit und/oder Berühmtheit. Schon lange vor der eigentlichen Tat<br />
setzt sich der Täter gedanklich mit der Umsetzung auseinander und spielt für sich<br />
dieses Szenario durch. Auf Grund dessen erfolgt die Tatausführung<br />
wohldurchdacht und vorbereitet, der Umgang mit Waffen ist aus eigenen<br />
Erfahrungen vertraut und die benutzten Waffen stammen in den meisten Fällen<br />
aus dem Elternhaus. Bedeutend ist weiterhin die letzte Phase vor der Tat. 53<br />
„Within two weeks to 24 hours prior to the shooting rampage, the Classroom<br />
Avenger has been exposed to multiple psycho – social stressors, precipitants or<br />
triggering events.” 54<br />
Diese Stressoren können zudem real, aber auch fiktiv sein und werden in der<br />
Regel sogar Dritten mitgeteilt. Schwerwiegende psychische Erkrankungen oder<br />
andere gewalttätige oder deviante Verhaltensweisen im Vorfeld waren in keinem<br />
der von McGee und DeBernado untersuchten Fälle vorzufinden.<br />
51<br />
Vgl. ebenda, S.13ff.<br />
52<br />
Vgl. ebenda, S.1.<br />
53<br />
Vgl. ebenda, S.7ff.<br />
54<br />
Ebenda, S.9.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Bestehende Forschungsergebnisse<br />
3.2.3 US Secret Service und das Department of Education<br />
Unmittelbar nach dem schweren <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> in Littleton im April 1999<br />
wurde vom US Department of Education und dem US Secret Service eine Studie<br />
in Auftrag gegeben. Es sollte der Frage nachgegangen werden, was man tun kann,<br />
um solch schwere Gewalttaten in der Zukunft verhindern zu können. 55 Die<br />
Ergebnisse wurden in einer Zwischenbilanz im Jahr 2000 und in einem<br />
abschließenden Bericht aus dem Jahr 2002 festgehalten.<br />
Ausgangsmaterial der Studie waren 37 Vorfällen an Schulen in den Vereinigten<br />
Staaten in den Jahren 1974 bis 2000. Evaluiert und analysiert wurden<br />
Polizeiprotokolle, Schul- und Gerichtsunterlagen der Täter sowie psychiatrische<br />
Gutachten über deren Persönlichkeit. Zudem lagen Interviews der Täter vor, die<br />
nach ihren Handlungen inhaftiert werden konnten. 56 Allerdings wurden die<br />
einzelnen verwendeten Vorfälle und das Material dieser Studie nicht gesondert<br />
ausgewiesen.<br />
Das Ziel der Studie lag darin, Prävention zu ermöglichen, Vorzeichen von Fällen<br />
schwerer gezielter Gewalttaten schon früh zu erkennen und rechtzeitig<br />
intervenieren zu können. Mit dieser Vorgehensweise, auch als „Threat<br />
Assessment“ bezeichnet, sollten Leitlinien für Schulen und Schulbehörden<br />
erarbeitet werden, die in notwendigen Fällen eine Bedrohungsanalyse<br />
ermöglichen, um damit in Zukunft eine größere Sicherheit an den Schulen zu<br />
bieten.<br />
Ergebnis der Studie ist, dass ein typisches Täterprofil nicht erstellt werden kann. 57<br />
Es bestehen keine aussagekräftigen Muster in Bezug auf Alter, Hintergründen in<br />
Familie, Peer, Schule, oder dem Konsum von Drogen sowie der Kriminalität in<br />
Zusammenhang mit Drogen oder gewalttätigen Medien. Dennoch können<br />
Gemeinsamkeiten bei den Tätern im Vorfeld der eigentlichen gewalttätigen<br />
Handlungen gefunden werden. So ist <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> nach Ansicht der Autoren<br />
keine impulsive Handlung, sondern schon Monate im Voraus durchplant. In den<br />
meisten Fällen wissen andere Personen von den Ideen des Täters, aber die<br />
eigentlichen Opfer werden nicht direkt vom Täter bedroht. Zudem zeigen die<br />
Täter vorher auffällige Verhaltensweisen oder vermitteln offen das Bedürfnis<br />
55<br />
Vgl. Vossekuil u.a. (2002), www.secretservice.gov/ntac/ssi_final_report.pdf, 20.04.2007, S.3ff.<br />
56<br />
Vgl. ebenda, S.8ff.<br />
57<br />
Vgl. ebenda, S.19ff.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Bestehende Forschungsergebnisse<br />
nach Hilfe. Viele Täter haben Zugang zu Waffen und wissen mit ihnen<br />
umzugehen. Bei der Tat selber sind oft andere Schüler involviert, indem sie bei<br />
Munitionskäufen oder bei den Planungsideen helfen. Unklar bleibt, ob diesen<br />
Schülern die Absicht der Täter wirklich bewusst ist. Beendet wird die Mehrheit<br />
der Vorfälle nicht durch den Einsatz der Polizei, sondern durch Handlungen von<br />
anwesenden Personen wie Lehrern oder Hausmeistern, oder durch den Täter<br />
selbst. 58<br />
Aus diesen Ergebnissen heraus ist von den Autoren ein Leitfaden entwickelt<br />
worden, nachdem die Schule und die Schulleitung bei möglichen Tatverdachten<br />
eine Bedrohungsanalyse durchführen können. 59 Sollte der Verdacht gegenüber<br />
einem Schüler vorliegen, muss man sich zunächst auf Verhaltensweisen und<br />
Äußerungen des Schülers konzentrieren. Bei Verdachtsbestätigung müssen die<br />
Verantwortlichen schnell reagieren und umfassende Erkundigungen über den<br />
möglichen Täter einholen, um die Tat zu verhindern. Zudem sollte dieser Schüler<br />
dann an entsprechende Hilfsinstitutionen oder Fachleute verwiesen werden und es<br />
sollte versucht werden, mögliche Schikanierungen von Schülern untereinander an<br />
den Schulen einzudämmen.<br />
3.3 Deutsche Studien<br />
Wie bereits erwähnt wurde, gestaltet sich in Deutschland die Suche nach Studien<br />
im Bereich des <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> erheblich schwieriger. So gibt es bislang mit der<br />
Studie von Robertz nur eine umfangreiche veröffentlichte Studie, die speziell auf<br />
diesen Sonderbereich eingeht. Die zweite deutsche Studie im Bereich von <strong>School</strong><br />
<strong>Shooting</strong> ist die Studie von Jens Hoffmann. Diese Studie steht in enger<br />
Verbindung zu den Studien aus dem nordamerikanischen Bereich und baut auf<br />
deren Ergebnissen auf. Jedoch lag während des Bearbeitungszeitraumes dieser<br />
Arbeit nur eine Übersicht der Ergebnisse vor.<br />
Auf Grund dessen wird ergänzend zu den Studien im Bereich des <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong><br />
auf eine höhere Abstraktionsebene zurückgegriffen und die deutsche Studien von<br />
58<br />
Vgl. ebenda, S.17ff.<br />
59<br />
Vgl. ebenda, S.39ff.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Bestehende Forschungsergebnisse<br />
Lothar Adler vorgestellt, die sich in erster Linie mit allgemeinen<br />
Amokhandlungen befassen und Amokläufe an Schulen mit beinhalten.<br />
Die Vorstellung der Studien erfolgt ebenso wie bei den Studien aus Amerika in<br />
chronologischer Reihenfolge, in der die Ergebnisse veröffentlicht wurden.<br />
3.3.1 Lothar Adler<br />
Die Studie von Adler wurde angelegt, um eine Übersicht über den Kenntnisstand<br />
zu Amokfällen zu erstellen. Die Ergebnisse der Studie wurden 2000 in einem<br />
Buch veröffentlicht. Ziel war es festzulegen, welche Gemeinsamkeiten oder<br />
besonderen Merkmale von Amokhandlungen zufällig, regelmäßig oder häufig<br />
vorhanden sind. 60<br />
Das zugrunde liegende Datenmaterial wurde aus 234 Pressemitteilungen aus den<br />
Jahren 1980–1989 gewonnen. Diese mussten dann nach vorher festgelegten,<br />
operationalisierten Kriterien einer Amokhandlung entsprechen, so dass 196 Fälle<br />
übrig blieben, die dem Kriterium Amok entsprachen und für die Studie verwendet<br />
wurden. 61 Die verbliebenen Fälle wurden nach bestimmten Merkmalen wie<br />
soziodemografischen Hintergründen, Einschätzung der Delinquenz, auslösenden<br />
Motiven, Täter–Opfer Beziehungen, psychischen Erkrankungen der Täter und<br />
Ausgang der Amokhandlung sortiert und untersucht.<br />
Wie auch die Autoren anderer Studien verweist Adler darauf, dass eine<br />
Generalisierung der Ergebnisse kritisch zu sehen ist, da die bezogenen<br />
Informationen in erster Linie aus Presseberichten bezogen wurden und auf Grund<br />
dessen ein einseitiges Bild zeigen könnten. 62<br />
Ergebnis der Untersuchung ist: „Amok als eine kriminologisch–victimologisch<br />
einheitliche Tat, die von ähnlichen Motiven begangen wird, gibt es nicht.“ 63 Das<br />
bedeutet, dass Ergebnisse aus bestehenden Studien nicht auf alle Fälle anwendbar<br />
sind, sondern höchstens auf eine Subgruppe der Täter. Weiterhin sind die<br />
einzelnen Gruppen nicht eindeutig voneinander zu trennen und Übergänge als<br />
fließend anzusehen.<br />
60<br />
Vgl. Adler, 2000, S.49.<br />
61<br />
Vgl. ebenda, S.50f.<br />
62<br />
Vgl. Ebenda, S.52.<br />
63<br />
Ebenda, S.91.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Bestehende Forschungsergebnisse<br />
Somit ist die Diagnose “Amokläufer“ eher als unspezifisch und sehr vielfältig zu<br />
sehen. Motive und Ursachen für Amokläufe werden in allen Lebensbereichen des<br />
Täters gesehen. 64 Sie liegen in Sorgen, Nöten und Konflikten des alltäglichen<br />
Lebens und zeichnen sich durch eine besondere Schwere aus.<br />
Nach den Ergebnissen kommt Adler zum Schluss, dass psychiatrische<br />
Erkrankungen der Täter weit überrepräsentiert sind, ebenso lassen sich bei vielen<br />
Tätern endogene–depressive Verstimmungen finden.<br />
Somit sind psychische Erkrankungen in der Mehrzahl der Fälle Ursache. Die<br />
Täter handeln meist dann, wenn erhebliche äußere und innerpsychische<br />
Belastungen die eigene Leidensfähigkeit übersteigen und einen anderen Ausweg<br />
nicht mehr zulassen.<br />
Gegen Ende der Studie stellt Adler die Hypothese auf, dass eine gestörte affektive<br />
Impulskontrolle auf Grund von Serotoninmangel die Ursache für homicidale und<br />
suizidale Gewalttaten ist. 65 Serotonin ist ein Neurotransmitter, der die Funktion<br />
eines Neurohormons besitzt und in den Nervenzellen des Gehirns und den<br />
Endungen des symphatischen Nervensystems vorkommt.<br />
3.3.2 Frank Robertz<br />
Die Studie von Frank Robertz aus dem Jahr 2004 ist die erste deutsche Studie die<br />
sich ausschließlich mit dem Phänomen des <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> befasst. Ziel war es,<br />
die Rolle der Phantasieentwicklung bei Jugendlichen als möglichen Indikator für<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s heranzuziehen.<br />
Zunächst wurde von Robertz eine weltweite statistische Erhebung von <strong>School</strong><br />
<strong>Shooting</strong>s mit einem umfassenden Überblick über den bisherigen<br />
Forschungsbestand bei Tötungsdelinquenzen jugendlicher Täter vorgenommen. 66<br />
Hinzugezogen wurden darauf aufbauend zunächst mehrere kriminologische<br />
Kontrolltheorien. Anschließend setzte er sich vertiefend mit verschiedenen<br />
Theorien zur Phantasie in Bezug auf Tötungsdelikte auseinander.<br />
64<br />
Vgl. ebenda, S.99ff.<br />
65<br />
Vgl. ebenda, S.106ff.<br />
66<br />
Vgl. Robertz, 2004, S.31ff.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Bestehende Forschungsergebnisse<br />
Als Ergebnis der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Theorien zur<br />
Phantasie und zur Rolle der Realität bei Jugendlichen, hat Robertz ein eigenes<br />
Modell entwickelt. Zentral wird darin die Relevanz der Phantasie für die<br />
Begehung von Mehrfachtötungen durch Jugendliche gesehen. 67 Dieses Modell<br />
wurde abschließend auf den Amoklauf des Robert Steinhäuser in Erfurt im Jahre<br />
2002 bezogen. Das Ergebnis der Studie kann wie folgt zusammengefasst werden:<br />
„[...] <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s [werden] nur von Jugendlichen begangen, die<br />
gravierende Schädigungen in ihrer bio–psycho–sozialen Integrität, ihrem<br />
sozialen Band und ihrer Selbstkontrolle aufweisen, sowie zudem durch<br />
subjektive Lern- und Kontrolldefizite glauben, auf gesellschaftlich<br />
vorgezeichneten Wegen keine Anerkennung erreichen zu können.“ 68<br />
Gefährdete Jugendliche werden durch Kränkungen und eigenes Versagen<br />
besonders hart getroffen. Dies kann nur durch einen wunscherfüllenden<br />
Kontrollausgleich in ihrer Phantasie abgemildert werden. Daraus entsteht eine<br />
Über–Identifikation mit starken Rollenvorbildern, die im Bereich von<br />
Amokläufern an Schulen eine zusätzliche Brisanz erfährt. Steigernd kommt noch<br />
die Art der Berichterstattung durch die Medien hinzu. Dies lässt den Tätern<br />
Amokhandlungen als ultimativen Weg des Kontrollgewinns erscheinen.<br />
Weitere Faktoren in der Persönlichkeit und dem sozialen Umfeld wirken sich<br />
steigernd auf die dissozialen–destruktiven Tendenzen des Jugendlichen aus. 69 Die<br />
zunächst fiktiven Phantasien orientieren sich im Laufe der Zeit immer weiter an<br />
einer umsetzungsorientierten Vorstellung und die letztendliche Entscheidung<br />
erfolgt dann aus einem auslösenden Moment im Vorfeld der Tat.<br />
3.3.3 Jens Hoffmann<br />
Die Untersuchung von Jens Hoffmann ist relativ neu und die Ergebnisse wurden<br />
aus einer Veröffentlichung im Sommer 2007 entnommen. Als Grundparameter<br />
wurden die Ergebnisse der Studie des US Secret Service und des Department of<br />
Education herangezogen. 70 Zunächst wurden sieben Vorfälle in Deutschland von<br />
1999 bis 2006 mit Hilfe von unterschiedlichen Informationsquellen rekonstruiert<br />
67<br />
Vgl. ebenda, S.151ff.<br />
68<br />
Ebenda, S.245.<br />
69<br />
Vgl. ebenda, S.245f.<br />
70<br />
Vgl. Hoffmann, 2007, S.25ff.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Bestehende Forschungsergebnisse<br />
und dann vergleichend ausgewertet. Die Erkenntnisse sind anhand der Ergebnisse<br />
der Secret Service Studie vorgestellt und mit amerikanischen Vorfällen verglichen<br />
worden.<br />
Unterschieden werden zum einen generelle Ergebnisse im Bereich von <strong>School</strong><br />
<strong>Shooting</strong>s und Ergebnisse, die besonders für Prävention nutzbar gemacht werden<br />
können. Generelle Ergebnisse dabei sind, dass es kein einheitliches Täterprofil<br />
gibt, aber viele Täter sich im Vorfeld der Tat Mobbingerfahrungen innerhalb der<br />
Schule ausgesetzt fühlten. In Einzelfällen wird über positive Reaktionen von<br />
Mitschülern berichtet, die damit die Tatdynamik förderten. Des weiteren konnten<br />
in den ausgewerteten Fällen klare Opferstrukturen aufgedeckt werden und es<br />
wurde angebracht, dass gewalttätige Medien regelmäßig eine Rolle gespielt<br />
haben. 71<br />
Ergebnisse, die bei Hoffmann besonders gut für mögliche Prävention und<br />
Früherkennung nutzbar gemacht werden sollen, sind die Möglichkeit der Täter an<br />
Schusswaffen zu gelangen, das Auftreten starker Verzweiflung im Vorfeld und<br />
dass oftmals Verlusterfahrungen eine besondere Rolle gespielt haben. 72 Ein<br />
Phänomen, dass bei ihm besondere Bedeutung erhält ist, dass viele Täter im<br />
Vorfeld offen oder verdeckt ihre Absichten mitteilen, was auch als „Leaking“ (aus<br />
dem Englischen übersetzt: Leck schlagen) bezeichnet wird. 73 Angelehnt an die<br />
Ergebnisse der amerikanischen Studien unterscheidet er drei verschiedene Formen<br />
frühes, mittleres und spätes „Leaking“. Die Zeitpunkte beziehen sich auch auf den<br />
Entwicklungsweg im Vorfeld von Gewalttaten und können daher präventiv<br />
genutzt werden.<br />
3.4 Erkenntnisse aus den Forschungsergebnissen<br />
Betrachtet man die Ergebnisse der Studien, so zeigt sich, dass diese sich eher<br />
ergänzen als widersprechen. Auch die Ergebnisse der deutschen Studien decken<br />
sich, soweit ein Vergleich möglich ist, in vielen Kernaussagen. Daher werden im<br />
Folgenden die zentralen gemeinsamen Kernelemente der Studien<br />
71<br />
Vgl. ebenda, S.28ff.<br />
72<br />
Vgl. ebenda, S.31f.<br />
73<br />
Vgl. ebenda, 2007, S.32f.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Bestehende Forschungsergebnisse<br />
zusammenfassend dargestellt. Aufgrund der wenig vorhandenen oder zum Teil<br />
nur unzuverlässigen Quellen lehnen alle Autoren es ab, ihre Schlussfolgerungen<br />
als generalisierbar oder verifiziert in Bezug auf Täter und Tat anzusehen. Sie<br />
weisen verstärkt darauf hin, dass weitere und tiefergehende Analysen nötig sind.<br />
Eindeutig wird, dass <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> als ein eigenständiges Phänomen zu<br />
betrachten ist, das sich signifikant zu allgemeinen Amokläufen unterscheidet. Im<br />
Gegensatz zu den eher als raptusartig erscheinenden Amokläufen sind <strong>School</strong><br />
<strong>Shooting</strong> das Ergebnis langer und oftmals gründlicher Vorbereitungsprozesse.<br />
Die Ergebnisse aus den vorgestellten Studien und die Ergebnisse aus der<br />
statistischen Auswertung ermöglichen dennoch einen generellen Eindruck. Es<br />
zeigt sich, dass das allgemeine Bedrohungspotenzial durch <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong><br />
geringer ist als angenommen wird. Obwohl die Anzahl der einzelnen Vorfälle in<br />
Relation gesehen als gering einzustufen ist, ergibt sich eine besondere Brisanz<br />
darin, dass die wenigen Taten zum Teil verheerende Folgen mit sich bringen.<br />
Betrachtet man dazu noch die durchschnittlichen Opferzahlen, so haben <strong>School</strong><br />
<strong>Shooting</strong>s bis auf einige Ausnahmen nur geringe Opferzahlen. Die bestehenden<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s haben überwiegend in den USA stattgefunden, aber die Anzahl<br />
der Vorfälle hat eindeutig zugenommen.<br />
Der Geschlechterverteilung nach handelt es sich in der großen Mehrheit um<br />
jugendliche, männliche Täter, deren Durchschnittsalter international bei 15,9<br />
Jahren, in Deutschland etwas höher liegt. Die Täter nutzten fast ausschließlich<br />
Schusswaffen, sie konnten mit ihnen umgehen und hatten in den meisten Fällen<br />
leichten Zugang zu Waffen. Psychische Erkrankungen der Täter werden in erster<br />
Linie nur bei Adler vermutet. Alle anderen Autoren gehen davon aus, dass die<br />
psychische Verfassung der Täter höchstens depressive Symptome aufweist.<br />
Die Ergebnisse der statistischen Auswertung decken sich in vielen Fällen mit den<br />
Ergebnissen der Studien. Allerdings wurde im Gegensatz zu den amerikanischen<br />
Studien in den vorgestellten deutschen Studien weniger oder gar kein Bezug auf<br />
die soziale Situation der Täter genommen. Kritisch zu sehen ist weiterhin die<br />
Suizidintention bei <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s. Ob das Ziel der Täter im eigenen Suizid<br />
lag, aber der Suizid durch andere Faktoren verhindert wurde, kann keine der<br />
Studien ausreichend beantworten. Ebenso kann auf Grund des Todes der anderen<br />
Täter nicht nachgewiesen werden, ob deren Suizidintention bereits im Vorfeld der
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Bestehende Forschungsergebnisse<br />
Tat gewollt oder einkalkuliert worden ist, oder die Entscheidung zum eigenen Tod<br />
erst während der eigentlichen Handlungen getroffen wurde.<br />
Abschließend kann gesagt werden, dass unterschiedliche, langfristige oder<br />
kurzfristige Einflussfaktoren in den einzelnen Studien erarbeitet wurden, die<br />
jedoch nicht alle die Frage beantworten können, warum ein Schüler zum <strong>School</strong><br />
Shooter wird. Gerade in der deutschen Forschung gibt es zu wenig Studien, die<br />
sich nur mit dem Bereich von schweren gezielten Gewalthandlungen an deutschen<br />
Schulen beschäftigen. Die Studie von Adler erweist sich in der Bearbeitung als<br />
nicht besonders hilfreich. Der Fokus liegt stark auf dem allgemeinen<br />
Amokphänomen, so dass sich ihre Ergebnisse nur bedingt auf den Bereich des<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> übertragen lassen.<br />
Daher zeigt sich eine eigene empirische Herangehensweise unumgänglich.<br />
Ebenso wie in den bestehenden Studien werden in dieser Arbeit daher Vorfälle<br />
schwerer zielgerichteter Gewalttaten an Schulen herangezogen und ausgewertet.<br />
In Anbetracht des Bearbeitungszeitraumes und der Möglichkeit, Materialien zu<br />
recherchieren, sind zwei <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s in Deutschland ausgewählt worden.<br />
Die Vorfälle in Emsdetten und Erfurt wurden ausgewählt, da sie zu zwei der<br />
schwersten Vorfälle weltweit zählen und im Rahmen der eigenen Bearbeitung<br />
genügend Quellen recherchiert werden konnten.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> in Deutschland<br />
4. <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> in Deutschland<br />
Im folgenden Kapitel werden zwei der schwersten Fälle zielgerichteter Gewalt in<br />
Deutschland analysiert. Dies erfolgt anhand einer Dokumentenanalyse der<br />
bestehenden Informationen im Fall des Robert Steinhäuser im Jahr 2002 in Erfurt<br />
und des Bastian Bosse 2006 in Emsdetten.<br />
Ziel der Dokumentenanalyse ist es, zunächst ein möglichst umfangreiches Bild<br />
über zwei der schwersten Amokläufe an deutschen Schulen zu bieten. Zentrale<br />
Fragestellung in der Analyse der dargestellten Daten ist, ob bei den Taten<br />
gemeinsame Ursachen und Hintergründe aufgedeckt werden können. Es sollen<br />
wichtige tatrelevante Ereignisse im Leben von Robert Steinhäuser und Bastian<br />
Bosse beschrieben werden, die im Vorfeld der eigentlichen Handlungen stehen<br />
und für eine Untersuchung der Motivation und der Ursachen schwerer<br />
zielgerichteter Gewalttaten an deutschen Schulen hilfreich sein könnten. Die<br />
Frage nach immer wiederkehrenden Tatmotiven sowie persönlichen und sozialen<br />
Ursachen bietet die Möglichkeit, Amokhandlungen in Schulen als<br />
Problemlöseverhalten oder individuellen Rachefeldzug begreiflicher zu machen.<br />
Desweiteren werden die eigentlichen Tatabläufe anhand des zugänglichen<br />
Materials rekonstruiert. Das Augenmerk liegt darauf, Gemeinsamkeiten und<br />
besondere Unterschiede in der Tat und der Persönlichkeit der Täter<br />
hervorzuheben. Wie in der statistischen Auswertung und der Darstellung des<br />
bisherigen Forschungstandes deutlich geworden ist, liegen in den erwähnten<br />
Merkmalen die wichtigsten und zentralsten Momente im Bereich des <strong>School</strong><br />
<strong>Shooting</strong>.<br />
Alle gesammelten Daten werden im Folgenden in Berichtsform zusammengefasst<br />
dargestellt. Im Anschluss daran werden die besonderen Merkmale und<br />
Auffälligkeiten zur Persönlichkeit der beiden Täter herausgearbeitet. Die<br />
verwendeten Daten können auf Grund des zeitlich vorgegebenen Rahmens der<br />
Materialrecherche, Bearbeitung und Auswertung sicher keine absolut umfassende<br />
Darstellung der Ereignisse in beiden Fällen bieten. Die Analyse beider <strong>School</strong><br />
<strong>Shooting</strong>s und die Ergebnissicherung findet somit unter Berücksichtigung einer<br />
eingeschränkten Repräsentativität der eigenen Daten statt.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> in Deutschland<br />
4.1 Erfurt<br />
In diesem Punkt wird zunächst der Amoklauf von Robert Steinhäuser am<br />
26.04.2002 beschrieben. Ausgangsmaterial der Dokumentenanalyse bildet im Fall<br />
des Robert Steinhäuser in erster Linie der Bericht der Kommission Gutenberg<br />
Gymnasium vom 19.04.2004. Dieser entstand, da der erste Abschlußbericht aus<br />
dem Jahre 2002 aufgrund eines neu eingeleiteten Ermittlungsverfahrens nicht<br />
beendet wurde. Das Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, da zu dem Zeitpunkt<br />
der Verdacht einer Tatbeteiligung einer zweiten Person bestand. Weitere wichtige<br />
Informationsquellen sind die Pressemitteilung der Gutenberg Kommission aus<br />
dem Jahr 2004, die Thüringische Regierungserklärung vom 23.05.2002 und<br />
Artikel aus Presse und der vorliegenden Literatur, die speziell auf das <strong>School</strong><br />
<strong>Shooting</strong> in Erfurt eingehen.<br />
Zur Tat in Erfurt ist zu Beginn anzumerken, dass Zeugenaussagen bestehen, die<br />
auf einen zweiten Täter hinweisen. 74 Der Verdacht von einem weiteren Täter<br />
konnte bis heute nicht bewiesen werden und wurde vom abschließenden<br />
Kommissionsbericht zu dem Vorfall ausgeschlossen. Aber eine Reihe von Zeugen<br />
beschreiben den Täter in Erfurt anders, als Robert tatsächlich am Tattag gekleidet<br />
war. Ebenso bestehen Aussagen, die während der Tat mehr Schüsse,<br />
beziehungsweise Schüsse an Stellen, an denen Robert nicht geschossen hat, gehört<br />
haben. Die Kommission kommt in ihrem Bericht zu dem Ergebnis, dass diese<br />
Aussagen unter anderem auf einer Wahrnehmungsverzerrung der Zeugen<br />
beruhen. Mögliche Ursachen dieser Verzerrung liegen laut Kommission in den<br />
extremen Stressbelastungen der Anwesenden während der Geschehnisse. Stress<br />
kann das Wahrgenommene in erheblicher Weise beeinträchtigen, ebenso werden<br />
Erinnerungen durch wiederholtes Erzählen verändert, beziehungsweise können<br />
verschwimmen. Ebenso kann die Tatsache, dass Robert vorne eine<br />
Handfeuerwaffe trug und hinten auf seinem Rücken eine Pump–Gun befestigt<br />
hatte, den Eindruck verschiedener Täter hervorrufen. Zuletzt kann das entstandene<br />
Echo der eigentlichen Schüsse das Gefühl vermitteln, es habe sich um mehrere<br />
Täter in verschiedenen Teilen der Schule gehandelt.<br />
74<br />
Vgl. Gasser u.a. (2004), www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnasium.pdf,<br />
15.06.2007, 130ff.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> in Deutschland<br />
4.1.1 Vorgeschichte und Tatvorbereitung<br />
Im Februar 1999 meldete sich Robert S. für eine externe Prüfung an, um seinen<br />
Realschulabschluss zu machen. Diese brach er jedoch schon im Juni des Jahres<br />
wieder ab und wurde in das 11. Schuljahr versetzt, ohne einen vorherigen<br />
Schulabschluss gemacht zu haben. 75 Während des gesamten 11. Schuljahres<br />
wurde Robert in seiner Schule mehrmals auffällig. Er drohte auf einer<br />
Klassenfahrt einem Lehrer und bekam dafür einen Verweis der Schule, auch seine<br />
Noten verschlechterten sich in diesem Schuljahr immer weiter. Auf Grund der<br />
Vorkommnisse hatte er mit seiner Mutter ein Beratungsgespräch zu seinen<br />
schlechten Leistungen in der Schule. Dies blieb für ihn zunächst ohne<br />
Konsequenzen und er blieb weiterhin den Unterricht fern. Trotz der<br />
Schwierigkeiten innerhalb des Schuljahres, wurde ein Antrag seiner Eltern<br />
genehmigt und er durfte das 11. Schuljahr nochmals wiederholen.<br />
Im Laufe der späteren Ermittlungen stießen die Beamten bei einer Auswertung<br />
auf Computerdaten, die sich auf dem Computer des Vaters befanden. Diese legten<br />
offen, dass Robert eine Internetrecherche zum Littleton <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> vom<br />
20.04.1999 vorgenommen hatte. Nach Angaben seiner Freunde, war das <strong>School</strong><br />
<strong>Shooting</strong> in Littleton auch bei ihnen Gesprächsthema gewesen, wobei Robert sich<br />
von den Handlungen gleichzeitig fasziniert und abgestoßen gefühlt hatte. 76<br />
Im Oktober 2000 trat Robert mit Erlaubnis seiner Eltern dem Erfurter<br />
Schützenverein Domblick bei und trainierte in der Folgezeit auf verschiedenen<br />
Schießanlagen. Der Thüringer Schützenverein stimmte seinem Antrag auf Erwerb<br />
einer Waffenbesitzkarte im September 2001 zu, da er an Wettkämpfen nach den<br />
Regeln des Schützenbundes ordnungsgemäß teilgenommen hatte. Die Karte<br />
erlaubte ihm den Besitz einer Sportpistole mit 9 mm und einer Flinte 12/70. 77 Am<br />
18.10.2001 stellte das Ordnungsamt in Erfurt Robert S. die Waffenbesitzkarte<br />
offiziell aus.<br />
Auch das von Robert wiederholte Schuljahr verlief nicht besser. Er bekam eine<br />
weitere Mahnung auf Grund vieler Fehlstunden und seine schulischen Leistungen<br />
führten erneut zu einem schlechten Jahreszeugnis. Im September 2001 legte<br />
Robert S. seiner Schule ein offensichtlich gefälschtes Attest als<br />
75<br />
Vgl. Billerbeck/ Schwelien., 2003, S.6.<br />
76<br />
Vgl. Gasser u.a. (2004), www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnasium.pdf,<br />
15.06.2007, S.12f.<br />
77<br />
Vgl. ebenda, S.14ff.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> in Deutschland<br />
Entschuldigungsgrund für Fehlstunden vor. 78 Die Schulleiterin des Gutenberg<br />
Gymnasiums entdeckte dieses und berief eine Anhörung zu dem Vorfall ein,<br />
deren Ergebnis den Schulausschluss von Robert bedeutete. 79 Im Nachhinein<br />
wurde im Kommissionsbericht angeführt, dass beim zuständigen Schulamt kein<br />
offizieller Antrag auf ein Schulausschlussverfahren seitens des Gutenberg<br />
Gymnasiums gestellt wurde. Mit seinem Schulabgangszeugnis des Gutenberg<br />
Gymnasiums wechselte er im Oktober 2001 auf das Königin–Luise–Gymnasium<br />
in Erfurt. Auf Grund eines fehlenden Physik Grundkurses konnte er nach den<br />
Herbstferien nicht am neuen Gymnasium bleiben. Er erhielt allerdings eine<br />
schriftliche Mitteilung des Schulamtes, die ihm den Wechsel an jedes andere<br />
Gymnasium in Erfurt zusicherte. Robert meldete sich nach dem Schreiben nicht<br />
mehr beim staatlichen Schulamt.<br />
Währenddessen hob Robert im Oktober 2001 immer wieder höhere Geldsummen<br />
von seinem Konto ab und kaufte sich bis zum April 2002 mehrere Waffen,<br />
größere Mengen an Munition und Zusatzausrüstungen im Wert von mehreren<br />
Hundert Euro. 80 Der Kauf seiner ersten Waffe wurde allerdings vom Ordnungsamt<br />
nicht genügend abgeklärt, da eine Gegenprüfung der Erwerbsanzeige von Robert<br />
ausblieb. Auch der Erwerb der anderen Waffen und großer Mengen an Munition<br />
wurde von niemandem weiter hinterfragt. Ebenso hätte Robert nach bestehender<br />
deutschen Waffengesetzgebung diese Waffen in einem Waffenschrank sicher<br />
verwahren müssen. Er täuschte in den folgenden sechs Monaten seinen Freunden<br />
und seiner Familie vor, weiter zur Schule zu gehen. Insgesamt brachte Robert bis<br />
zu seinem <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> drei verschiedene Versionen in Umlauf, auf welche<br />
Schulen er in dem halben Jahr gegangen sein soll. Wo sich Robert während der<br />
Schulzeiten aufhielt, kann nicht nachgewiesen werden. Im Dezember 2001 legte<br />
er seinen Eltern ein gefälschtes Halbjahreszeugnis vor. 81 Desweiteren vermutete<br />
ein Freund von Robert, dass seine Eltern nichts von seinem Waffenbesitz wussten.<br />
Im Januar 2002 konnte der Zugriff auf Word-Dokumente zu der Thematik Amok<br />
registriert werden. Diese Daten wurden nach der Tat auf dem Computer von<br />
Roberts Vater sichergestellt. 82 Anfang April strich der Schützenverein Domblick<br />
Robert aus seinem Mitgliedsverzeichnis, da er seine Beiträge nicht gezahlt hatte.<br />
78<br />
Vgl. ebenda, S.17f.<br />
79<br />
Vgl. ebenda, S.20.<br />
80<br />
Vgl. ebenda, S.19ff.<br />
81<br />
Vgl. ebenda, S.25ff.<br />
82<br />
Vgl. ebenda, S.27f.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> in Deutschland<br />
Am 19.04.2002 fiel Roberts Mutter eine große mit einem Schloss versehene<br />
Reisetasche im Zimmer ihres Sohnes auf, sie reagierte aber nicht. Im Nachhinein<br />
wurde festgestellt, dass es sich bei dem Inhalt der Tasche um Munition handelte.<br />
Zwei Tage vor der Tat ging ein mutmaßlicher Drohanruf im Sekretariat des<br />
Gutenberg Gymnasiums ein. 83 Dieser wurde von der Schulsekretärin<br />
entgegengenommen und nur dem Hausmeister der Schule mitgeteilt. Den Abend<br />
vor der Tat verbrachte Robert mit einem Freund. Gegenüber diesem machte er<br />
keinerlei besondere Äußerungen über sein Vorhaben und verhielt sich dem<br />
Anschein nach auch nicht auffällig.<br />
4.1.2 Tathergang<br />
Der Tagesablauf von Robert in der Zeit von 10 Uhr bis 10.45 Uhr kann bis heute<br />
auf Grund von verschiedenen Zeugenaussagen nicht eindeutig nachskizziert<br />
werden. Die vorherige Zeit verbrachte er zu Hause bei seinen Eltern, kehrte aber<br />
wahrscheinlich auf seinem Weg in die Schule zweimal wieder um. Seinen Eltern<br />
erzählte Robert, dass er an diesem Tag seine Englischprüfung habe. 84 Dann betrat<br />
Robert Steinhäuser am 26.04.2002 gegen 10.45 Uhr das Gutenberg Gymnasium in<br />
Erfurt. Es war der Tag der Abiturprüfungen im Gymnasium. 85<br />
Im Flur begegnete er dem Hausmeister des Gymnasiums und fragte diesen nach<br />
der Anwesenheit der Schulleiterin. Als der Mann dies bejahte, begab Robert sich<br />
zunächst auf die Herrentoilette, zog eine schwarze Maske über sein Gesicht und<br />
bewaffnete sich mit einer Pump-Gun und einer Pistole. Die Pump–Gun trug er mit<br />
einem Trageriemen auf seinem Rücken, das Holster für die Pistole befestigte er an<br />
seinem Oberschenkel, nahm die Pistole selbst aber in die Hand. Seine Jacke zog<br />
er aus und ließ sie auf der Herrentoilette. Nach der Tat wurden darin seine<br />
Geldbörse, sowie ein kleines Plastiktütchen mit einer Cannabis–Tabakmischung<br />
gefunden. 86<br />
83<br />
Vgl. ebenda, S.34f.<br />
84<br />
Vgl. Brinkbäumer, u.a., 2002, S.118f.<br />
85<br />
Vgl. Robertz, 2004, S.229.<br />
86<br />
Vgl. Gasser u.a. (2004), www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnasium.pdf,<br />
15.06.2007, S.59f.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> in Deutschland<br />
Nach dem Umkleiden ging Robert zum Schulsekretariat, klingelte dort und<br />
erschoss, nachdem ihm die Tür geöffnet wurde, mit insgesamt drei Schüssen die<br />
stellvertretende Schulleiterin und die Sekretärin im Nebenraum. Dann arbeitete er<br />
sich systematisch durch die anderen Räume und verschiedenen Etagen des<br />
Gutenberg–Gymnasiums, schoss und lud Munition nach. Sein dortiger Gang<br />
wurde im Nachhinein in allen Zeugenaussagen als zügig bis eilig beschrieben.<br />
Während seines Ganges durch die Schule waren immer wieder mehrere Schüler<br />
auf den Fluren und in den Klassenräumen, die er betrat, anwesend. Auf diese<br />
Personen, ebenso wie auf einige Lehrer, die sich in den Gruppen zwischen den<br />
Schülern befanden, schoss Robert während seines Amoklaufes nicht.<br />
Wahrscheinlich wurden die Lehrpersonen von ihm nicht wahrgenommen, da er<br />
die Schülergruppen weitestgehend ignorierte. 87<br />
In der ersten Etage der Schule sah er noch auf der Treppe einen Lehrer, der gerade<br />
einen Vorbereitungsraum aufschließen wollte. Diesen traf er durch drei Schüsse<br />
tötlich in den Rücken. Dann wendete er sich weiteren Klassenräumen auf der<br />
Etage zu und tötete zwei weitere Lehrer mit mehreren Schüssen. 88 Robert ging<br />
über eine Südtreppe ins zweite Obergeschoss der Schule. Dort tötete er zwei<br />
Lehrerinnen mit jeweils 5 Schüssen. Hier, wie auch in der nächsten Etage, sah er<br />
verschiedene Schüler mit Lehrern in Klassenräumen, auf die er nicht schoss. Dies<br />
konnte entweder daran gelegen haben, dass er sie nicht kannte oder das<br />
Lehrpersonal auf Grund ihres Aussehens nicht in der Menge der Schüler auffiel. 89<br />
Im dritten Obergeschoss tötete Robert vier weitere Lehrpersonen durch mehrere<br />
Schüsse. Zeugenaussagen beschrieben sein Verhalten als wenig aufgeregt. Es<br />
zeichnete sich vielmehr durch Ruhe aus, da er weder rannte, noch besonders<br />
hektische Bewegungen gemacht hatte. 90 Er begab sich auf den Weg in die unteren<br />
Etagen des Gebäudes. Wieder in der zweiten Etage traf Robert erstmals auf<br />
verschlossene oder verbarrikadierte Klassenzimmer. Nach mehrmaligem Rütteln<br />
an einer Klinke gab er Schüsse durch die geschlossene Tür ab, verletzte zwei<br />
Schüler tödlich und einen nicht lebensgefährlich. 91 Der Lehrerin, die er in dieser<br />
87<br />
Vgl. Robertz, 2004, S.229.<br />
88<br />
Vgl. Gasser u.a. (2004), www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnasium.pdf,<br />
15.06.2007, S.71f.<br />
89<br />
Vgl. ebenda, S.81f.<br />
90<br />
Vgl. ebenda, S,885ff.<br />
91<br />
Vgl. Robertz, 2004, S.229f.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> in Deutschland<br />
Etage tötete, schoss er zunächst in den Rücken, während sie versuchte zu fliehen,<br />
schoss er weiter auf sie.<br />
Im ersten Obergeschoss feuerte er auf eine geschlossene Toilettentür, traf aber nur<br />
den Rucksack eines Schülers. Dann begab er sich über eine Nordtreppe wieder ins<br />
Erdgeschoss der Schule. Auf dem Schulhof nahm er die Verfolgung einer<br />
Lehrerin auf und verletzte diese durch mehrere Schüsse tötlich. Währenddessen<br />
betrat ein Polizeibeamter den Schulhof. Robert Steinhäuser schoss auf ihn,<br />
verfehlt ihn allerdings. Der Polizist erwiderte die Schüsse, traf aber ebenfalls nicht<br />
und verlor Robert aus den Augen. Während seiner Flucht tötete er einen<br />
Polizeibeamten, der das Gelände des Gutenberg–Gymnasiums betreten hatte.<br />
Robert kehrte wieder in die oberen Etagen des Schulgebäudes zurück. Im ersten<br />
Obergeschoss begegnete er einem in der Schule arbeitenden Lehrling. Er nahm<br />
vor ihm erstmals seine Maske ab und sagte nach einer Frage des Auszubildenden,<br />
dass er von dieser Schule gewiesen worden war. 92 Abschließend begegnete er in<br />
der zweiten Etage der Schule einem Lehrer, dem es gelang Robert in einen Raum<br />
einzuschließen. Der genaue Ablauf des Treffens zwischen dem Lehrer und Robert<br />
und wie es diesem gelang ihn in den Raum zu sperren, konnte nicht eindeutig<br />
geklärt werden. Gesichert ist nur, dass Robert in diesem Raum wieder seine<br />
Maske absetzte und sich selbst tötete. 93<br />
Während seines Amoklaufes tötete Robert einen Schüler und eine Schülerin des<br />
Gutenberg Gymnasiums, die Schulsekretärin und die stellvertretende<br />
Schulleiterin. Ebenso erschoss er zwölf Lehrer und einen Polizisten. Weitere<br />
sechs Menschen wurden verletzt. 94 Sein Amoklauf an der Schule dauerte von ca.<br />
10.45 Uhr, bis zu seinem Einschluss in einem Klassenraum und dem<br />
anschließenden Suizid um ca. 11.20 Uhr.<br />
4.1.3 Robert Steinhäuser<br />
Robert Steinhäuser war der zweite Sohn seiner Eltern. Seine Mutter ist gelernte<br />
Krankenschwester und arbeitete im Schichtdienst einer Erfurter Hautklinik, sein<br />
92<br />
Vgl. Gasser u.a. (2004), www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnasium.pdf,<br />
15.06.2007, S.114ff.<br />
93<br />
Vgl. Robertz, 2004, S.231.<br />
94<br />
Vgl. ebenda, S.74.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> in Deutschland<br />
Vater arbeitete als Elektroingenieur bei Siemens. 95 Sein älterer Bruder Peter<br />
studierte nach seinem Abitur Informatik an einer Fachhochschule. 96 Polizeilich<br />
trat Robert bis zu seinem <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> nicht in Erscheinung.<br />
Seiner Mutter beschrieb ihn als sehr anhängliches Kind, dass oftmals die Nähe zu<br />
seinen Eltern und besonders zu seiner Mutter suchte.<br />
„Der Junge „war ein sehr anhängliches Kind“ [...], „er musste beschützt<br />
werden, damit er seinem Bruder nicht ständig unterlegen war“.“ 97<br />
Während der Pubertät grenzte er sich mehr und mehr von seinen Eltern ab und<br />
teilte und ihnen kaum noch etwas über sein Leben mit. Sein Vater beschrieb ihn<br />
als wenig ehrgeizig, phlegmatisch und antriebslos. 98<br />
Er war nicht in der Lage seinen Eltern und größtenteils auch seinen Freunden von<br />
seinem schulischen Misserfolg zu berichten, sondern baute sich vielmehr ein<br />
Lügennetz auf, um diesen zu verdecken. 99 Zwar wusste ein Grossteil seines<br />
Freundeskreises, dass er vom Gutenberg Gymnasium verwiesen worden war, aber<br />
er verbreitete mehrere Versionen über weitere Schulbesuche. Er verließ weiterhin<br />
jeden Morgen das Haus und kehrte gegen Mittag zurück.<br />
Lehrer und ehemalige Mitschüler beschrieben ihn als stillen, unsicheren Jungen,<br />
der nicht aggressiv war. 100 Es wurde betont, dass er eher unauffällig war und<br />
lediglich öfters durch Störungen im Unterricht auffiel. Seine Leistungen waren<br />
gerade auf dem Gymnasium eher mittelmäßig bis schlecht. Für die Mitschüler<br />
spielte er oft den Klassenclown um Anerkennung zu erlangen, wurde in den<br />
meisten Fällen aber von diesen nicht ernst genommen. Trotzdem war er kein<br />
Einzelgänger.<br />
Er besaß einen Freundeskreis von circa 8–10 Personen, in erster Linie Jungen, mit<br />
denen er sich unter anderem zu Freizeitaktivitäten wie Kino oder Computer<br />
Spielen traf. 101 Nach Aussagen seiner Freunde war er eher ein akzeptierter<br />
Mitläufer, als ein aktives Mitglied der Gruppe. Alle hatten gemeinsam mit ihm,<br />
oder zumindestens zeitweise das Gutenberg Gymnasium besucht. Freunde, die<br />
von seinem Waffenbesitz wussten, machten sich keine Gedanken. Auch seine<br />
95<br />
Vgl. Brinkbäumer, u.a., 2002, S.122.<br />
96<br />
Vgl. Mikos, 2003, S.63.<br />
97<br />
Brinkbäumer, u.a., 2002, S.121.<br />
98<br />
Vgl. ebenda, S.133.<br />
99<br />
Vgl. Gasser u.a. (2004), www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnasium.pdf,<br />
15.06.2007, S.334.<br />
100<br />
Vgl. Mikos, 2003, S.64f.<br />
101<br />
Vgl. Gasser u.a. (2004), www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnasium.pdf,<br />
15.06.2007, S.333ff.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> in Deutschland<br />
Drohung auf einer Klassenfahrt gegenüber einem Lehrer wurde von ihnen nicht<br />
ernst genommen. Einem Freund war aufgefallen, dass Robert bei Äußerungen<br />
über die Tötung von Lehrern einen sehr starren entschlossenen Blick gehabt hatte<br />
und sehr ruhig und leise dabei gesprochen hatte. Dieser Freund wusste allerdings<br />
nichts über Roberts Waffenbesitz.<br />
Bevor Robert auf das Gutenberg–Gymnasium wechselte, besuchte er nach der<br />
Grundschule ein Jahr lang eine thüringische Regelschule, die mit einer Haupt-/<br />
Realschule gleichzusetzen ist. 102 Seine Schulleistungen wurden bereits vor seinem<br />
Schulwechsel als durchschnittlich beschrieben. Auf dem Gymnasium<br />
verschlechterten sich diese, während sein 6 Jahre älterer Bruder das Abitur auf<br />
dem Gutenberg Gymnasium schaffte.<br />
In der 10. Klasse versuchte er einen Schulabschluss zu machen, indem er an der<br />
externen Realschulprüfung teilnehmen wollte, seine Leistungen verhinderten<br />
allerdings einen erfolgreichen Abschluss der Prüfungen. 103 Auch der Versuch das<br />
11. Schuljahr zu wiederholen, oder auf eine andere Schule zu wechseln<br />
scheiterten. Zudem fiel er während seiner Schulzeit auf, da er wiederholt dem<br />
Unterricht fern blieb und Entschuldigungen für Fehlstunden manipulierte.<br />
Die Ansprüche auf dem Gymnasium überforderten Robert, eine adäquate Lösung<br />
auf sein Versagen in der Schule wurde nicht gefunden. Roberts Berufswunsch<br />
Informatik zu studieren gestaltete sich schwierig, da er auf Grund seiner Noten<br />
und eines fehlenden Abschlusses nicht zum Studium zugelassen worden wäre. Er<br />
hat zur Tatzeit nicht einmal einen Hauptschulabschluss vorzuweisen. Auch in<br />
seinen außerschulischen Lebensbereichen gelang es Robert nicht Anerkennung zu<br />
bekommen. Im Handballverein, in dem er einige Zeit spielte, ist er nicht einmal<br />
als Ersatzspieler aufgestellt worden, seinen Führerschein konnte er nicht bestehen,<br />
da er den dazu benötigten Erste Hilfeschein nicht fristgerecht einreichte. 104<br />
Somit scheiterte er in vielen Lebensbereichen und sein Wunsch nach<br />
Anerkennung blieb ihm versagt. Entscheidungen anderer, die sein Leben und<br />
seine Zukunft betrafen, verschlossen ihm mögliche Zukunftsperspektiven. Zudem<br />
wurde berichtet, dass er auf viele der Entscheidungen stark negativ und emotional<br />
reagierte. 105 Trotzdem, oder gerade deswegen, schien Robert den Wunsch gehabt<br />
102<br />
Vgl. Robertz, 2004, S.232.<br />
103<br />
Vgl. Billerbeck/ Schwelien, 2003, S.6.<br />
104<br />
Vgl. Robertz, 2004, S.232f.<br />
105<br />
Vgl. ebenda, S.233.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> in Deutschland<br />
zu haben, berühmt oder bekannt zu werden, und begann sich in dieser Situation<br />
intensiv mit der Thematik <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> auseinander zusetzen. Darauf weisen<br />
unter anderem Videoaufnahmen zu <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s in den USA und weitere<br />
Materialien zu dieser Thematik hin, die bei einer späteren Durchsuchung<br />
gefunden wurden.<br />
Robert besaß eine übersteigerte Selbsteinschätzung. 106 Er entwickelte nur geringe<br />
Kompetenzen im Umgang mit Konflikten und im Problemlöseverhalten. Die<br />
Wahrnehmung, Benennung und Lösung seiner Probleme gelang ihm nicht, aber er<br />
konnte auch nicht Dritte um Unterstützung bitten.<br />
„Stattdessen bildet[e] er eine Art kompensatorischen Größenwahn im Sinne<br />
einer unrealistischen Selbstüberschätzung aus, der die relativ geringe<br />
Ausprägung seines Selbstwertgefühls überspielen sollte.“ 107<br />
Robert begann während der Problematiken in der Schule sich innerhalb seiner<br />
Freizeit für Waffen und den Schützensport zu interessieren. Auch hier<br />
manipulierte er Daten. 108 Er veränderte Eintragungen in seinem Schießbuch, in<br />
dem die Schießleistungen, die er erbrachte, vermerkt wurden. Diese Eintragungen<br />
brauchte er aber, um die Bescheinigung vom Verein zu erhalten, auf Grund derer<br />
er sich eine Waffenbesitzkarte ausstellen lassen konnte.<br />
Außerdem konsumierte er in überdurchschnittlichem Maß zu anderen<br />
Gleichaltrigen Computerspiele, die sich in erster Linie durch<br />
gewaltverherrlichende Inhalte auszeichneten. 109 Unter anderem spielte er nach<br />
Aussage seiner Mutter Ego-Shooter und es wurden nach einer Durchsuchung viele<br />
Gewalt- und Horrorvideofilme gefunden. In einem Presseartikel wurde berichtet,<br />
dass Robert mehrmals starke Auseinandersetzungen mit seinen Eltern über seinen<br />
Fernseh- und Computerkonsum gehabt hatte. 110 Demnach hatten sie versucht,<br />
unter anderem durch Sperrvorrichtungen oder dem Entfernen von Kabeln, ihn an<br />
seinem Konsum zu hindern.<br />
106<br />
Vgl. Gasser u.a. (2004), www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnasium.pdf,<br />
15.06.2007, S.297ff.<br />
107<br />
Thüringer Justizministerium (22/2004), www.thüringen.de/de/homepage/presse/12251/unidex.html,<br />
30.06.2007.<br />
108<br />
Vgl. Gasser u.a. (2004), www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnasium.pdf,<br />
15.06.2007, S.310.ff.<br />
109<br />
Vgl. ebenda, S.335ff.<br />
110<br />
Vgl. Brinkbäumer, u.a., 2002, S.133.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> in Deutschland<br />
4.1.4 Waffen und Kleidung bei Robert Steinhäuser<br />
Am Tattag erschien Robert schwarz gekleidet in seiner ehemaligen Schule. 111 Er<br />
trug ein T–Shirt, ein Kapuzenshirt, eine schwarze Hose und an den Füßen<br />
schwarze Knöchelschuhe. Eine schwarze Wollmaske, schwarze Stoffhandschuhe<br />
und Ohrenstöpsel, zog er sich in der Herrentoilette im Erdgeschoss des<br />
Schulgebäudes an.<br />
Während der Tat selber trug er zwei Schusswaffen bei sich, eine Pistole Glock 14<br />
mit Magazinen und eine Pump-Gun Mossberg 580. Zusätzlich zu den Waffen<br />
führte er zwei große und zwei kleine Reservemagazine mit insgesamt mehr als<br />
110 Schuss, 19 Schrotpatronen der Marke Baschieri&Bellagri 12 und ein<br />
Oberschenkel Pistolenholster mit sich. Die mitgeführte Pump–Gun konnte er nicht<br />
einsetzen, da diese auf Grund unsachgemäßer Handhabung nicht funktionstüchtig<br />
war. Weiterhin versteckte Robert auf der Herrentoilette des Gutenberg<br />
Gymnasiums mehr Munition und Waffen, so dass er ein Reservearsenal an<br />
Waffen besaß, zu dem folgende Waffen und Munition gehörten:<br />
• 142 Schrotpatronen der Marke Baschieri&Bellagri 12<br />
• 338 Patronen für eine 9 mm Luger Waffe<br />
• ein Magazin mit 17 Patronen für eine 9 mm Luger Waffe<br />
• 1 Machete<br />
• 1 Tauchermesser<br />
Nachdem sich Robert in einem Schützenverein angemeldet hatte, stellt er einen<br />
Antrag für eine Waffenbesitzkarte, die ihm vom Ordnungsamt in Erfurt<br />
ausgestellt wurde. Die Waffenbesitzkarte erlaubte Robert offiziell den Besitz einer<br />
Sportpistole mit 9 mm und einer Flinte 12/70. 112 Allerdings erlaubte diese Karte<br />
nach der damaligen Waffengesetzgebung nur den Waffenbesitz selbst. Das<br />
wiederum beinhaltete nicht das Mitführen einer Waffe.<br />
Schon der Kauf seiner ersten Waffe, wurde vom zuständigen Ordnungsamt nur<br />
ungenügend abgeklärt. 113 Während der Verkäufer den Verkauf dem Ordnungsamt<br />
wenige Tage nach Verkaufsdatum meldete, versäumte Robert die nach damaligen<br />
111<br />
Vgl. Gasser u.a. (2004), www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnasium.pdf,<br />
15.06.2007, S.59f.<br />
112<br />
Vgl. Ebenda, S.14ff.<br />
113<br />
Vgl. Thüringer Justizministerium (22/2004), www.thüringen.de/de/homepage/presse/12251/unidex.html,<br />
30.06.2007.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> in Deutschland<br />
Recht geltende Pflicht, seine Waffenbesitzkarte innerhalb von zwei Wochen nach<br />
Waffenerwerb beim Ordnungsamt vorzulegen. Rückfragen auf Grund des<br />
Versäumnisses erfolgten seitens des Ordnungsamtes nicht, obwohl eine<br />
Überprüfung wahrscheinlich Zweifel an der Zulässigkeit der Waffenbesitzkarte<br />
ergeben hätten. Auch der spätere Kauf der Pump–Gun wurde von Robert nicht<br />
dem Ordnungsamt gemeldet.<br />
Fest steht, dass er die Waffen und Munition, trotz unzureichender Absicherung<br />
durch das Ordnungsamt, legal erworben hatte. 114 Er schaffte er es, den Besitz der<br />
Waffen vor vielen geheim zu halten und seinen Eltern war bis zum Tattag nicht<br />
bekannt, das Robert Waffen besaß. Innerhalb seines Freundeskreises war das<br />
etwas anderes, denn ein Teil seiner Freunde wusste entweder direkt von Robert<br />
oder über dritte Personen, dass er mindestens eine Schusswaffe besaß. 115<br />
4.2 Emsdetten<br />
Im Falle des Bastian Bosse gestaltet sich die Recherche schwieriger. Die<br />
verwendeten Informationen bestehen vielmehr aus einer Vielzahl<br />
unterschiedlicher Quellen. Eine der Grundlagen ist die Rede von Innenminister<br />
Dr. Ingo Wolf vom 14.12.2006, zum Polizeieinsatz und Anlass des Amoklaufes<br />
des ehemaligen Schülers der Geschwister-Scholl-Realschule am 20.11.2006 in<br />
Emsdetten. Innerhalb der wissenschaftlichen Literatur wird ein Artikel von Engels<br />
mit einbezogen, der im Sommer 2007 erschienen ist. Des weiteren<br />
Pressemitteilungen der Polizei und verschiedene Artikel aus den deutschen<br />
Printmedien.<br />
Zudem zeigten sich in der eigenen Recherche bereits Schwierigkeiten bei einer<br />
genaueren Namenssuche. So werden in den verschiedenen Quellen entweder der<br />
Name Sebastian, oder der Name Bastian verwendet. In dieser Arbeit findet der<br />
Name Bastian Verwendung, da dieser in der Rede des Innenministeriums sowie<br />
der Polizeidaten verwendet wurde.<br />
114<br />
Vgl. Vogel (71/2002), www.mediengewalt.de/_arc/pre/reg/010.pdf, 07.08.2007.<br />
115<br />
Vgl. Gasser u.a. (2004), www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnasium.pdf,<br />
15.06.2007, S.334f.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> in Deutschland<br />
Die Besonderheit einiger verwendeter Materialien liegt darin, dass es sich um<br />
persönlich verfasste Quellen von Bastian Bosse handelt. Problematisch ist<br />
allerdings, dass ein Großteil der im Internet vorhandenen Materialien nach seinem<br />
Amoklauf sofort aus dem Netz genommen oder gesperrt wurde. Ebenso kritisch<br />
zu sehen ist, dass daher die Originalität der Informationen nicht hundertprozentig<br />
gewährleistet werden kann. Die von Bastian selbst verfassten Materialien basieren<br />
auf gespeicherten Kopien der unterschiedlichen Internetseiten und werden im<br />
Anschluss der Arbeit im Anhang aufgeführt.<br />
4.2.1 Vorgeschichte und Tatvorbereitung<br />
Zur Vorgeschichte von Bastian Bosse wurde von mehreren Gewalterfahrungen<br />
berichtet, denen er während seiner Schulzeit ausgesetzt war. In der 7. Klasse soll<br />
er von anderen Schülern der Geschwister–Scholl–Realschule in Emsdetten als<br />
„Hurensohn“ beschimpft worden sein, woraufhin er sich unter einem<br />
Treppenabsatz der Schule versteckte. 116 Im Juni 2001 sollen mehrere Jungen<br />
Bastian auf dem Schulhof gezwungen haben, einen glühenden Fahrradschlüssel in<br />
die Hand zu nehmen.<br />
Bastian B. begann bereits im Jahr 2004 sich ausführlicher mit Taten und der<br />
Thematik von <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> auseinander zusetzen. 117 Im Juni 2004 meldete er<br />
sich in einem Berliner Forum an. Auf der Seite www.das-beratungsnetz.de, einem<br />
Online-Krisendienst, griff er explizit die Thematik Amoklauf auf. Zwei Jahre<br />
später, im Januar 2006 machte er einen neuen Eintrag im Forum. Darin schrieb er,<br />
dass es ihm besser ginge, er gerade seinen Abschluss mache und er in seinem<br />
vorherigen Eintrag übertrieben habe. 118 Ob die Seite, die sich in erster Linie durch<br />
Beratung und Vermittlung professioneller Hilfe für Jugendliche mit Problemen<br />
aller Art auszeichnet, seine Beiträge ausgewertet, bzw. auf diese reagiert hat, kann<br />
nicht mehr eindeutig festgestellt werden.<br />
116<br />
Vgl. Deggerich u.a., 2006, S.36.<br />
117<br />
Vgl. Wolf (14.12.2006), www.im.nrw.de/pm/141206_1018.html, 20.06.2007.<br />
118<br />
Vgl. Bastians Eintrag ins Beratungsforum, http://blog.dark-born.eu/download/beratungsnetz.php,<br />
04.08.2007.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> in Deutschland<br />
Bis zu seinem Amoklauf trat Bastian B. polizeilich nur einmal in Erscheinung. 119<br />
Er bekam ohne Einwände seitens der Verantwortlichen am 04.07.2006 einen<br />
kleinen Waffenschein. Dieser erlaubte ihm den Besitz von Schreckschuss,<br />
Reizstoff- und Signalwaffen. Neunzehn Tage später fiel er auf einem Open–Air<br />
Festival in Emsdetten auf, da er eine Schreckschusswaffe vorzeigte, um nach<br />
seiner Aussage einen Streit am Rande des Festivals zu schlichten. Weil das<br />
Mitführen einer Waffe bei öffentlichen Veranstaltungen nicht erlaubt ist, stellte<br />
die alarmierte Polizei seinen Waffenschein, die Schreckschusspistole sowie einen<br />
Teleskopschlagstock sicher. Auf Grund der erstatteten Strafanzeige stand Bastian<br />
nun vor einer drohenden Sanktionierung durch die Justiz.<br />
Vor seinem Amoklauf kündigte Bastian diesen im Internet an, hinterließ einen<br />
Abschiedsbrief und ein selbstgedrehtes Video. 120 Als entscheidend gab er dort die<br />
Jahre 2003 und 2004 an. Vorher habe er versucht sich seiner sozialen Umwelt,<br />
sowie dem bestehenden Status in Schule und Peer anzupassen. Er spricht von<br />
Rache. Zunächst von Rache an Schülern, die ihn während der Schulzeit<br />
gedemütigt haben und dann an Rache gegenüber dem Lehrpersonal. Dieses<br />
beschuldigt er, gegen seinen Willen in sein Leben eingegriffen zu haben.<br />
Ermittlungen der Polizei haben festgestellt, dass im Internet eine Personenliste (in<br />
diesem Zusammenhang auch immer wieder als Todesliste bezeichnet)<br />
zusammengestellt wurde. 121 Unter der Überschrift “primäre Todesziele“, hatte er<br />
13 Personennamen aufgelistet, die aus seinem schulischen, aber auch<br />
außerschulischen Bereich stammten. Zusätzlich setzte er Auszüge aus seinem<br />
handschriftlichen Tagebuch ins Internet und ein Video, in dem er auf englisch<br />
seine derzeitigen Emotionen schilderte und ankündigte, die für ihn<br />
verantwortlichen Menschen zu erschießen.<br />
Für den 21.11.2006, einen Tag nach seinem Amoklauf, war die Hauptverhandlung<br />
vor dem Jugendgericht Rheine angesetzt, die sich mit seinem Verstoß gegen das<br />
Waffengesetz befassen sollte.<br />
119<br />
Vgl. Wolf (14.12.2006), www.im.nrw.de/pm/141206_1018.html, 20.06.2007.<br />
120<br />
Vgl. Telepolis (no date), www.heise.de/tp/r4/artikel/24/24032/1.html, 20.06.2007.<br />
121<br />
Vgl. Polizei Steinfurt (23.11.2006),www.presseportal.de/polizeipresse/pm/43526/905473/polizei_steinfurt,<br />
20.06.2007.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> in Deutschland<br />
4.2.2 Tathergang<br />
Am 20.11.2006 fuhr der damals 18jährige Bastian gegen 9.20 Uhr mit einem<br />
PKW zu seiner ehemaligen Schule, der Geschwister–Scholl–Realschule in<br />
Emsdetten, NRW. 122 Während er seinen Wagen verließ wurde beobachtet, wie er<br />
mehrere rohrähnliche Gegenstände unter seiner Kleidung verbarg. Im Nachhinein<br />
stellten sich diese als mehrere Waffen und verschiedene Sprengmittel heraus.<br />
Auf seinem Weg zu einem sogenannten oberen Schulhof, der Empore dieser<br />
Schule, zündete er bereits eine selbstgebastelte Rohrbombe und einen<br />
Rauchkörper, gleichzeitig begann er das Feuer auf Personen zu eröffnen, die sich<br />
zu dem Zeitpunkt auf diesem Schulhofabschnitt befanden. 123 Er betrat den<br />
Schulhof zur ersten großen Unterrichtspause, so dass sich zu diesem Zeitpunkt<br />
besonders viele Schüler und vermehrt Lehrpersonal als Pausenaufsicht auf dem<br />
Gelände waren. Dort verletzte er auch sein erstes Opfer, eine 55jährige<br />
Lehrerin. 124 Diese folgte ihm und wurde von ihm mit einem weiteren Rauchkörper<br />
verletzt, den er nach ihr warf. Danach gab er mehrere ungezielte Schüsse in ihre<br />
Richtung ab und feuerte zudem wahllos auf Schüler, die sich auf dem Schulhof<br />
aufhielten.<br />
Auf seinem weiteren Weg in das Schulgebäude hinein verletzte er drei Schüler<br />
durch abgegebene Schüsse und traf dann auf seinen 16jährigen Bruder, der zu<br />
dem Zeitpunkt noch die Geschwister-Scholl Realschule besuchte. 125 Dieser<br />
versuchte ihn anzuhalten, wurde jedoch von Bastian mit den Worten, er solle nach<br />
Hause gehen, stehen gelassen. Weiterhin verletzte er den 55jährigen Hausmeister<br />
der Schule mit einem Bauchschuss und ging in das Schulgebäude.<br />
Gegen 9.28 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf aus der Schule ein, circa sechs<br />
Minuten später kamen die ersten Beamten an der Realschule an. 126 Als die Polizei<br />
eintraf und mehrere Polizisten versuchten, in die Realschule vorzudringen, zog<br />
sich Bastian immer weiter in die Obergeschosse seiner ehemaligen Schule<br />
zurück. 127<br />
In der Aula im Erdgeschoss der Schule verletzte er einen weiteren Schüler durch<br />
Schüsse schwer und setzt seinen Weg in das 1.OG fort. Dort machte er<br />
122<br />
Vgl. Wolf (14.12.2006), www.im.nrw.de/pm/141206_1018.html, 20.06.2007.<br />
123<br />
Vgl. Engels, 2007, S.36f.<br />
124<br />
Vgl. Deggerich u.a., 2006, S.36.<br />
125<br />
Vgl. Wolf (14.12.2006), www.im.nrw.de/pm/141206_1018.html, 20.06.2007.<br />
126<br />
Vgl. Spiegel online (20.11.2006), www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,449622,00html, 20.06..2007.<br />
127<br />
Vgl. Sueddeutsche.de (20.11.2006), www.sueddeutsche.de/panorama/artikel/203/92111/, 16.04.2007.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> in Deutschland<br />
mindestens einmal Gebrauch von seiner Schusswaffe, verletzte aber niemanden.<br />
Im Treppenhaus auf dem Weg ins 2.OG begegnete er einer entgegenkommenden<br />
Schülergruppe, schoss auf diese und verletzte eine 10- und eine 12-jährige<br />
Schülerin. 128<br />
Er zündete einen Molotowcocktail, der zu einer starken Rauchentwicklung im<br />
oberen Gebäudetrakt führte. Andere Schüler, die auf Grund der<br />
Rauchentwicklung das 2.OG verlassen wollten, konnten unbehelligt über das<br />
Treppenhaus flüchten, so das Bastian im 2.OG niemandem mehr begegnete.<br />
Zudem gab es weitere Explosionen im Schulgebäude, durch deren starke<br />
Rauchentwicklung mehrere Personen in der Schule verletzt wurden. 129 Im 2.OG<br />
beging Bastian dann mit einer Vorderlader–Perkussionswaffe Suizid. Er wurde<br />
gegen 10.30 Uhr durch Einsatzkräfte der Polizei im Flur des 2. OG aufgefunden.<br />
An seinem Körper hatte Bastian mehrere Sprengsätze montiert.<br />
Insgesamt wurden 37 Personen während des <strong>School</strong> Schooting verletzt. 130 Der<br />
gesamte Amoklauf an der Schule in Emsdetten dauerte nicht länger als eine<br />
Stunde bis zum Suizid des Täters. Von den Verletzten erlitten drei Schüler, eine<br />
Schülerin und der Hausmeister Schussverletzungen. Eine Lehrerin erlitt eine<br />
Verletzung im Gesicht auf Grund der geworfenen Rauchgranate. 14 Personen<br />
standen durch Bastians Tat und den Vorfällen innerhalb der Schule unter Schock<br />
und 16 Polizeibeamte bekamen während ihres Einsatzes eine Rauchvergiftung.<br />
4.2.3 Bastian Bosse<br />
Bastian lebte bis zu seiner Tat zusammen mit der Großmutter, zwei jüngeren<br />
Geschwistern und seinen Eltern in einem Einfamilienhaus in Emsdetten. 131 Sein<br />
Großvater, zu dem er ein sehr enges Verhältnis gehabt haben soll, starb 2005 an<br />
Lungenkrebs. Sein Vater war Briefträger in Emsdetten und Mitglied im<br />
Schützenverein, seine Mutter Hausfrau. Sein Bruder ging zu dem Tatzeitpunkt<br />
ebenfalls auf die Geschwister–Scholl–Realschule und seine Schwester besuchte<br />
ein Gymnasium. Seine Mutter gab an, dass ihr bis zur Tat nichts<br />
128<br />
Vgl. Wolf (14.12.2006), www.im.nrw.de/pm/141206_1018.html, 20.06.2007.<br />
129<br />
Vgl. ebenda.<br />
130<br />
Vgl. ebenda.<br />
131<br />
Vgl. Lehmann (24.11.2006), www.tagesspiegel.de/zeitung/Die-Dritte-Seite;art705.2204006, 30.06.2007.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> in Deutschland<br />
Außergewöhnliches an ihrem Sohn aufgefallen war. 132<br />
Lediglich sein<br />
Computerspielekonsum fiel ihr auf, den sie jedoch für Jungen in seinem Alter als<br />
normal einstufte. Er galt als introvertiert, aber eingebunden in das eigene familiäre<br />
System, in dem seine Zurückgezogenheit akzeptiert wurde.<br />
Im Sommer des Jahres 2006 beendete Bastian die Schule mit guten Noten und der<br />
Fachoberschulreife. Anschließend arbeitete er als Aushilfe in einem Baumarkt<br />
und wollte später zur Bundeswehr. 133 Bis zum Jahr 2004 blieb Bastian bereits<br />
zweimal in seiner Schule sitzen. Er wiederholte einmal das 7. Schuljahr und blieb<br />
dann in der achten Klasse noch einmal sitzen. Während seines 9. Schuljahres war<br />
er damit bereits zwei Jahre älter als seine Mitschüler.<br />
Lehrer der Geschwister–Scholl–Realschule beschrieben ihn als einen sehr<br />
verschlossenen Schüler, an dem man nicht mehr herankommen konnte. 134 Auf<br />
Grund seiner schwarzen Kleidung und seinem Habitus, wurde er oftmals von<br />
seinen Mitschülern nicht ernst genommen und mit Spitznamen wie „Matrix–<br />
Mann“, oder „Psycho“ belegt, die Namen wurden jeweils aus den nach dem<br />
gleichnamigen Film abgeleitet. Von ihm wurde berichtet, dass er aus eher<br />
unauffälligen Familienverhältnissen stammte. Weiterhin wurde er in der<br />
Pressemitteilung folgendermaßen beschrieben:<br />
„Er galt als introvertierter Einzelgänger und war als Waffenliebhaber sowie<br />
Anhänger der so genannten Gothic–Szene, einer subkulturellen Jugendszene,<br />
bekannt.“ 135<br />
Freizeitaktivitäten waren Computerspiele (in erster Linie Ego-Shooter),<br />
Videofilme und das Spielen mit Airsoft-Waffen im Freien. 136 Beim Spielen mit<br />
Airsoft-Waffen, treten Jugendliche mit detailgetreuen Waffennachbildungen im<br />
Wald oder auf speziellen Plätzen gegeneinander an. Es gibt dazu Vereine, in<br />
denen die Jugendlichen schwarz gekleidet oder in Kleidung im Armeestil<br />
gegeneinander antreten. Die Munition besteht aus Papier mit einer Farbfüllung.<br />
Bei Treffern hinterlassen sie Farbflecken auf dem Gegner. Ziel ist es, die Gegner<br />
durch Treffer auszuschalten. Bastian war Gründungsmitglied eines Airsoft Teams<br />
in seiner Umgebung. Sein ausgeprägtes Interesse an Waffen wurde von anderen<br />
wahrgenommen, aber nicht als sehr ungewöhnlich eingestuft.<br />
132<br />
Vgl. Deggerich u.a., 2006, S.38.<br />
133<br />
Vgl. Lehmann (24.11.2006), www.tagesspiegel.de/zeitung/Die-Dritte-Seite;art705.2204006, 30.06.2007.<br />
134<br />
Vgl. Deggerich u.a., 2006, S.37.<br />
135<br />
Vgl. Wolf (14.12.2006), www.im.nrw.de/pm/141206_1018.html, 20.06.2007.<br />
136<br />
Vgl. Engels, 2007, S.42.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> in Deutschland<br />
Zur Persönlichkeit von Bastian B. wurde Unterschiedliches berichtet. Während er<br />
nach der Pressemittelung des Ministeriums, als introvertiert galt, zeichnete der<br />
Spiegel in einem seiner Artikel das Bild eines unberechenbaren und zur Gewalt<br />
neigenden Jugendlichen. 137 Dieser habe im Ort Drohungen ausgestoßen und nach<br />
Angaben einiger Eltern insbesondere Mädchen verbal eingeschüchtert. In einem<br />
Presseartikel wurde hervorgehoben, dass sein soziales Umfeld, wie zum Beispiel<br />
Nachbarn und Mitschüler ihn sehr unterschiedlich beschrieben. 138 Die<br />
Beschreibungen reichen demnach von einem sehr unauffälligen netten Jungen bis<br />
zu der Beschreibung einer aggressiven und gewalttätigen Persönlichkeit.<br />
Ein ehemaliger Mitschüler von Bastian gab im Interview mit dem Stern an, dass<br />
ihm im Laufe der Schulzeit Veränderungen an Bastian aufgefallen waren. 139 Zwei<br />
Jahre vor der Tat hatte er begonnen sein Äußeres zu ändern, trug schwarz,<br />
lackierte sich die Nägel schwarz und zog sich immer weiter zurück. Erst ein paar<br />
Monate vor dem 20.11.2006 hätte er sich dann extrem zurückgezogen.<br />
Im Internet hatte Bastian eine eigene Homepage und ein Forum erstellt und setzte,<br />
bis zu seinem Amoklauf, kleine selbstgedrehte Videos auf die entsprechenden<br />
Seiten. Dort gab er sich den Namen „ResistantX“, unter dem auch sein Forum<br />
e.t.c. zu finden war. 140 Während er in seinem realen Leben eher als unauffällig und<br />
zurückhaltend galt, ließ er dort seinem angestauten Frust und seinem Hass freien<br />
Lauf. Er nannte sich „ResistantX“ um zu zeigen, dass er gegen die Gesellschaft, in<br />
der er lebte, rebellierte. Bastian selbst erklärte seinen Namen in einem<br />
Internetforum folgendermaßen:<br />
„Den Namen “ResistantX“ habe ich mir 2003 oder 2004 zugelegt.<br />
“ResistantX“ ist gleichzusetzen mit “Vergänglichkeit“, da alles bis zu einem<br />
bestimmten Punkt (X) standhaft ist, aber irgendwann zusammenbricht.<br />
Vergänglichkeit ist meiner Meinung nach das Beste, was es auf dieser Welt<br />
gibt!“ 141<br />
In einem Onlinetagebuch befanden sich Einträge vom 02.09.2004 bis zum<br />
20.05.2005. 142 Zu Beginn der einzelnen Einträge fand sich ein Gesicht, an dem<br />
man die jeweilige Gefühlslage von Bastian erkennen konnte. Diese pendelte<br />
jeweils zwischen „okay“ bis zu „depressed“, „angry“ und frustrated“. Auch in<br />
137<br />
Vgl. Spiegel online (20.11.2006), www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,449622,00.html, 20.06..2007.<br />
138<br />
Vgl. Stern.de (21.11.2006), www.stern.de/politik/deutschland/576933.html, 30.06.2007.<br />
139<br />
Vgl. Stern.de (23.11.2006), www.stern.de/politik/deutschland/577045.html, 30.06.2007.<br />
140<br />
Vgl. Deggerich u.a., 2006, S.37f.<br />
141<br />
Lehmann (24.11.2006), www.tagesspiegel.de/zeitung/Die-Dritte-Seite;art705.2204006, 30.06.2007.<br />
142<br />
Vgl. Bastians Onlinetagebuch (no date), www.resistantx.livejounal.com/, 18.07.2007.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> in Deutschland<br />
seinem Tagebuch verdeutlichte er seine Enttäuschung. Gerade in Bezug auf seine<br />
Schule schrieb er über Frustrationen, Hass und über die Sinnlosigkeit seines<br />
Lebens. Hier erwähnte er auch Nadine, ein Mädchen, in das er verliebt gewesen<br />
war, die allerdings nach seinen Angaben mit seinem besten Freund zusammen<br />
kam. 143<br />
Sein Abschiedsbrief zeigte das Bild eines verzweifelten Jugendlichen, der für sich<br />
selbst keinen Ausweg sah, und enthielt ähnliche Inhalte wie seine<br />
Tagebuchaufzeichnungen. 144 Er sah sich selbst als einen Verlierer. Sein Hass<br />
fokussierte sich dabei nicht nur auf Lehrer oder Schule, sondern er betraf zunächst<br />
die Menschen allgemein. Dann richtete er seinen Hass gegen die Schule und alles<br />
was für ihn damit zusammengehörte. Die Schuld für seine Situation und seinen<br />
Emotionszustand gab er dem System Schule und als sein Hauptmotiv gab er<br />
Rache an. Seine Abneigung bündelte er in der Abkürzung „S.A.A.R.T.– Schule,<br />
Ausbildung, Arbeit, Rente, Tod“. 145 Dort klagte er den Lebenslauf „normaler“<br />
Menschen an, der für ihn von der Gesellschaft definiert wurde und keinen Platz<br />
für Andersdenkende ließ. In Sozialisationsinstanzen wie der Schule sah er sich<br />
Entwicklungszwängen ausgesetzt denen er nicht entsprechen konnte oder wollte<br />
und in denen er scheiterte. Am Ende fügte er hinzu, dass es ihm auch darum<br />
ginge, die Menschen aufzuwecken. Er wollte sich selbst damit zum Helden<br />
symbolisieren, dessen Tat zum Zeichen werden sollte.<br />
4.2.4 Waffen und Kleidung bei Bastian Bosse<br />
Bastian trug zur Tatzeit schwarze Kleidung und einen langen schwarzen Mantel,<br />
unter dem er einen Teil der Waffen versteckte. Nach seiner Tat wurden weitere<br />
Waffen und Material, um Sprengkörper herzustellen, in dem Auto gefunden, mit<br />
dem Bastian am Tattag zur Schule fuhr. 146 Das Wissen und die Materialen, um die<br />
angefertigten Sprengsätze und Boben herzustellen, hatte er sich unter anderem aus<br />
Chemieforen im Internet besorgt.<br />
143<br />
Vgl. Bastians Tagebuch (no date), www.staydifferent.st.ohost.de/diary/, 04.08.2007.<br />
144<br />
Vgl. Telepolis (no date), www.heise.de/tp/r4/artikel/24/24032/1.html, 20.06.2007.<br />
145<br />
Vgl. ebenda.<br />
146<br />
Vgl. Polizei Steinfurt (23.11.2006), www.presseportal.de/polizeipresse/pm/43526/905473/polizei_steinfurt,<br />
20.06.2007.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> in Deutschland<br />
Er führte drei Schusswaffen mit sich. Es handelte sich um ein verkürztes<br />
Kleinkalibergewehr und zwei Vorderlader–Perkussionswaffen. Für den Erwerb<br />
und Besitz von Kleinkaliberwaffen wurde zu dem Zeitpunkt eine<br />
Waffenbesitzkarte benötigt, für das Führen zusätzlich noch ein Waffenschein. Der<br />
Erwerb und Besitz von Perkussionswaffen war ab dem 18. Lebensjahr erlaubt,<br />
dass Mitführen allerdings nur mit einem dazugehörigen Waffenschein. 147<br />
Bastian besaß weder das eine noch das andere. Er hatte das benutzte<br />
Kleinkalibergewehr illegal von einem ehemaligen Mitglied seines Airsoft–<br />
Spielteams erworben. Die verwendete Munition erwarb Bastian über ein Internet<br />
Handelsportal, ohne dass er einen dazugehörigen Munitionserwerbsschein<br />
besaß. 148 Auch die Perkussionswaffen, die er bei sich führte, kaufte er über ein<br />
Internet-Handelsportal. 149<br />
Der Erwerb der Perkussionswaffen und einiger benötigter Hilfsmittel erfolgte erst<br />
zwischen Oktober/ November 2006, ebenfalls über das Internet. Weitere Waffen<br />
und Bomben, wurden nach seiner Tat von der Polizei in der Schule und dem Auto<br />
sichergestellt. Diese waren: 150<br />
• 17 selbst gefertigte Rohrbomben<br />
• 7 Rauchkörper<br />
• 9 Molotow – Cocktails<br />
• 19 Schrotbecher, die von Bastian selbst hergestellt worden und mit<br />
verschiedenen Füllmaterialien wie Luftgewehrmunition oder<br />
Bleigeschossen gefüllt waren<br />
• 4 Behältnisse, die nach Vermutung der Polizei Pfefferspray enthielten<br />
• 2 Dosen mit Schwarzpulver<br />
• 2 Wurfsterne<br />
• 1 Schlagstock<br />
• 1 Machete<br />
147<br />
Vgl. Ebenda.<br />
148<br />
Vgl. Wolf (14.12.2006), www.im.nrw.de/pm/141206_1018.html, 20.06.2007.<br />
149<br />
Vgl. Engels, 2007, S.44f.<br />
150<br />
Vgl. Wolf (14.12.2006), www.im.nrw.de/pm/141206_1018.html, 20.06.2007.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> in Deutschland<br />
Als er von der Polizei im Raum entdeckt wurde, in dem er Suizid begangen hatte,<br />
wurden weiterhin mehrere Sprengsätze gefunden. Die Sprengsätze hatte er an<br />
seinem Körper befestigt. 151<br />
4.3 Analyse der Taten in Erfurt und Emsdetten<br />
Es zeigt sich in beiden Fällen, dass <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s keine plötzlichen<br />
unvorbereiteten Taten sind, sondern sich vielmehr durch eine gezielte und genaue<br />
Planung des Täters im Vorfeld der eigentliche Tat auszeichnen. Beide Täter<br />
setzten sich Monate und zum Teil auch schon einige Jahre im Voraus mit der<br />
Thematik <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> auseinander, interessierten sich für vorausgegangene<br />
Vorfälle und studierten diese genau.<br />
Zielpersonen waren bei Robert Steinhäuser in erster Linie das Lehrpersonal der<br />
Schule. Alle Opfer starben durch mehrere Schüsse, so gab er auf eine Lehrperson<br />
bis zu acht Schüsse ab. Während seines Amoklaufes waren immer wieder Schüler<br />
auf den Fluren anwesend und er betrat mehrere Klassenräume in denen sich<br />
Schüler befanden, auf die er nicht schoss. Die Schüler und andere Personen, die er<br />
tötete oder verletzte, wurden durch verschlossene Türen getroffen. Im Gegensatz<br />
zu Robert hatte Bastian vor der Tat nachweislich eine Personenliste erstellt, auf<br />
der er mögliche Opfer notiert hatte. Trotzdem zielte Bastian eher wahllos, traf<br />
Schüler und Lehrpersonal gleichermaßen.<br />
Beide Täter unterschieden sich in ihrer individuellen schulischen Laufbahn.<br />
Während Bastian seine Realschule mit einem relativ guten Notendurchschnitt<br />
beendete, gestaltete sich die Schullaufbahn von Robert als uneinheitlich. Er<br />
wechselte zwischen verschiedenen Schulsystemen, seine Leistungen waren als<br />
schwach einzustufen und der Versuch eines vorzeitigen Abschlusses nach der 10.<br />
Klasse scheiterte. Gemeinsam hatten beide, dass sie während ihrer Schulzeit<br />
Klassen wiederholen mussten. Dadurch wurden sie wiederholt aus einem<br />
bestehenden Klassengefüge genommen und mussten sich in ein neues bereits<br />
bestehendes Gefüge einfinden.<br />
151<br />
Vgl. Sueddeutsche.de (20.11.2006), www.sueddeutsche.de/panorama/artikel/203/92111/, 16.04.2007.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> in Deutschland<br />
Ob beide Schüler während ihrer Schulzeit verstärkten Gewalt- oder Mobbing<br />
Erfahrungen ausgesetzt waren, ist im Nachhinein nicht immer eindeutig zu<br />
belegen. Dazu ergaben sich in der Recherche über den Fall in Erfurt keine<br />
Angaben über eigene Gewalterfahrungen während seiner Schulzeit. Bei Bastian<br />
Bosse scheint dieses auf den ersten Blick eindeutiger zuzutreffen. Auszüge seines<br />
Tagebuches und der Auszug aus seinem Eintrag im Beratungsforum lassen darauf<br />
schließen.<br />
Die Eltern der Täter wussten in beiden Fällen nicht viel über die Gefühlslage ihrer<br />
Söhne und schienen auch vom Alltag, den Aktivitäten, Sorgen und Interessen<br />
ihrer Söhne nicht viel gewusst zu haben. Probleme der beiden Jungen wurden zum<br />
Teil wahrgenommen, aber gemeinsame Lösungen wurden nicht erarbeitet. Nur<br />
der starke Computerkonsum war den jeweiligen Eltern aufgefallen. Roberts Eltern<br />
hatten wegen seines intensiven Computerkonsums bereits einmal die Kabel aus<br />
der Wand gezogen. Trotzdem wurde der Konsum von ihnen als normal eingestuft.<br />
Vor der Tat hinterließ Bastian einen Abschiedsbrief in dem er seine Beweggründe<br />
schilderte. Dieses war bei Robert nicht der Fall und es konnte kein Dokument<br />
gefunden werden, dass etwas über seine Beweggründe aussagt.<br />
Die Interessen und Hobbys lagen bei Robert und Bastian sehr ähnlich. Robert und<br />
Bastian waren Waffennarren. Während Bastian dem Hobby in seiner Freizeit auf<br />
spielerische Weise beim Airsoft-Spielen nachging, trainierte Robert in einem<br />
Schützenverein. Sie hatten eine Vorliebe für Gewalt- und Horrorvideos und<br />
Computerspiele, in erster Linie Ego-Shooter. Allerdings unterschieden sie sich<br />
damit sicherlich nicht unbedingt von der Mehrheit der Jungen in ihrem Alter.<br />
Zudem ist kritisch anzumerken, dass die Mehrzahl der Filme, die bei beiden<br />
Tätern gefunden wurden, zwar gewalttätig, aber weder ungewöhnlich noch in<br />
Deutschland verboten sind. Schaut man sich dazu die Hitlisten in allgemein<br />
erhältlichen Computerzeitschriften an, so ist ebenfalls erkennbar, dass Ego-<br />
Shooter bei Jugendlichen allgemein weit verbreitet und beliebt sind.<br />
In ihrer Einbindung in die jeweilige soziale Umwelt lassen sich mehrere<br />
Parallelen bei Robert und Bastian finden. Beide veränderten vor ihrem <strong>School</strong><br />
<strong>Shooting</strong> ihr Verhalten und teilweise auch ihr Äußeres. Es wird berichtet, dass sie<br />
sich im Tatvorfeld immer weiter isolierten und von der Außenwelt zurückgezogen<br />
hatten. Auch wenn Bastian in einigen Berichten als offen aggressiv dargestellt<br />
wurde, so zeigte sich dennoch, dass beide eher als introvertiert und auf den ersten
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> in Deutschland<br />
Blick unauffällig galten. Trotzdem wurden sie von Mitschülern und Lehrern nicht<br />
wirklich ernst genommen und als seltsam beschrieben. Beide waren zwar keine<br />
völligen sozialen Außenseiter, sie besaßen Freunde und waren zum Teil in<br />
Vereinen mehr oder weniger aktiv. Aber die sozialen Kontakte innerhalb der<br />
gleichaltrigen Gruppen sind eher als relativ klein anzusehen. Der Freundeskreis<br />
beschränkte sich vielmehr auf gemeinsame Interessen und Hobbys. Robert schien<br />
eher ein akzeptiertes Mitglied in seiner Peer gewesen zu sein, über Bastian ist<br />
diesbezüglich weniger bekannt. Er nutzte eher anonyme Kontakte aus dem<br />
Internet, um persönliche Konflikte zu besprechen.<br />
In der möglichen Motivlage gibt es Gemeinsamkeiten, aber auch Abweichungen.<br />
Robert sprach in seinem Gespräch mit dem Handwerksauszubildenden von seiner<br />
Wut und seinem Hass auf die Lehrer. Als Motiv gab er Rache über seinen<br />
Schulverweis an. Bastians Motivlage lag zunächst im Hass auf die gesamte<br />
Gesellschaft und fokussierte sich dann stellvertretend auf das System Schule.<br />
Somit sah er letztendlich die gesamte Welt als negativ an. Er hasste aber nicht nur<br />
die Lehrer, die für ihn die Handelnden in dem System Schule darstellten, sondern<br />
auch die Schüler und Gleichaltrigen. Von ihnen fühlte er sich gedemütigt und<br />
physisch sowie besonders psychisch verletzt. Beide Täter konnten als möglichen<br />
Ausweg aus ihrem Teufelskreis nicht die Änderung ihrer eigenen<br />
Verhaltensweisen sehen. Schuldzuschreibungen und Ursachen sahen sie immer<br />
nur bei Anderen.<br />
Beide Täter zeichneten sich dadurch aus, dass sie für ihre Taten schwer bewaffnet<br />
das Schulgebäude betraten. Sie trugen mehrere Schusswaffen, Stichwaffen sowie<br />
große Mengen Munition bei sich. Bastian und Robert erschienen zu ihren<br />
Amokläufen schwarz gekleidet in der Schule. Besonders anzumerken ist, dass<br />
beide zusätzlich mit einer schwarzen Maske ihr Gesicht vermummten. Robert<br />
Steinhäuser trug zur Tat zwei Schusswaffen, eine Pump-Gun und eine Pistole,<br />
Bastian Bosse drei Schusswaffen, ein verkürztes Gewehr und zwei<br />
Vorderladerpistolen. Robert deponierte einen Teil der mitgeführten Waffen und<br />
Munition auf einer Schultoilette. Bastian trug den Großteil der Waffen bei sich<br />
und zudem auch noch mehrere Sprengkörper, die er zum Teil an seinem Körper<br />
befestigt hatte. Während Robert seine Waffen und die Munition zum Teil auf<br />
legalem Wege erworben hatte, erwarb Bastian diese illegal und stellte die<br />
Sprengsätze nach Anleitungen, die er aus dem Internet hatte selbst her. Beide
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> in Deutschland<br />
Täter begannen mit dem Kauf ihrer Waren schon bis zu einem halben Jahr vor<br />
dem <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> und konnten die Materialien vor ihren Eltern und bei<br />
Bastian auch vor seinen Freunden geheim halten. Beide bestellten ihre Munition<br />
und Bastian auch einen Teil der Waffen über Handelsportale im Internet.<br />
4.4 Ergebnissicherung der wichtigsten Aspekte<br />
Die Analyse hat ergeben, dass es sich in beiden Fällen um multifaktorielle<br />
Bedingungen in der Persönlichkeit der Täter und ihrer Motivlage handelte. Sie<br />
galten als Waffennarren, deren Interessen sich in erster Linie in ihren<br />
Freizeitaktivitäten widerspiegelten. Waffennutzung und Gewalt durchzog die<br />
Filme, die sie sahen und die Spiele, die sie spielten.<br />
Bastian zeigte ein stark übertriebenes Machtgehabe bei seinen Internetauftritten.<br />
Die Phantasien, die er dort auslebte, nahmen mit der Zeit zu. Bei Robert war ein<br />
Rückschluss problematisch, aber auch hier lassen sich Indizien für diese<br />
übersteigerte Selbstsicht und die Fokussierung auf gewalthaltige Interessen in der<br />
Freizeit finden.<br />
Beide Täter fühlten sich von ihrer Umwelt unverstanden und isoliert und zogen<br />
sich im Vorfeld der Tat von ihrer Umwelt zurück. Sie entwickelten einen starken<br />
Hass auf die Gesellschaft, in der sie lebten, dieser Hass fixierte sich insbesondere<br />
auf das System Schule. Ebenfalls hatten sie im Vorfeld der Tat immer gegenüber<br />
Dritten Aussagen getroffen, die ihre späteren Handlungen betrafen. Diese<br />
möglichen Warnsignale wurden in keinem der Fälle wahrgenommen oder als<br />
realistisch eingestuft.<br />
Jeder von ihnen hatte im Vorfeld der Tat entscheidende Erlebnisse und sie litten<br />
unter Versagensängsten auf Grund ihrer schulischen Probleme. Unstrittig ist, dass<br />
beiden Vorfällen ein Schlüsselereignis vorherging. War es bei Bastian sicherlich<br />
die drohende Gerichtsverhandlung, so kann bei Robert der Schulverweis als<br />
schwerwiegendes Ereignis gesehen werden. Zudem konnte hervorgehoben<br />
werden, dass sich beide schon lange vor der eigentlichen Tat mit der Thematik<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> auseinandersetzten. Damit einher ging eine Identifikation und<br />
Verherrlichung der Täter und Vorfälle in den USA.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> in Deutschland<br />
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die wichtigsten Aspekte sowohl auf<br />
individueller psychischer Ebene, als auch in dem jeweiligen sozialen<br />
Umfeldgefunden werden konnten. Ableitend aus den Ergebnissen der Analyse,<br />
konnten folgende bedeutende Teilaspekte als besonders relevant eingestuft<br />
werden:<br />
• Auffälligkeiten auf individueller psychischer Ebene der Täter, wie die<br />
Unfähigkeit Probleme zu lösen, eine gestörte Selbst-/ Fremdwahrnehmung<br />
und ein Rückzug aus der Realität.<br />
• Unzureichende Einbindung und Sicherheit innerhalb der einzelnen<br />
sozialen Netzwerke wie Familie, Schule und Peer.<br />
• Ein als besonders schwerwiegend erlebtes Ereignis, kurz vor der<br />
eigentlichen Tat.<br />
• Die intensive Nutzung von Medien mit gewaltverherrlichenden Inhalten.<br />
• Eine gezielte Planung im Vorfeld der Tat, einhergehend mit dem<br />
Vorhandensein von Schusswaffen und der Fähigkeiten mit diesen<br />
umzugehen.<br />
Basierend auf den Ergebnissen der eigenen Bearbeitung findet im nächsten<br />
Kapitel dieser Arbeit eine Auseinandersetzung der herausgearbeiteten Teilaspekte<br />
statt. Diese erfolgt unter Berücksichtigung bestehender wissenschaftlicher Thesen<br />
und mit Bezug auf die beiden ausgewerteten <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
5. Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
Wie sich in der vorhergehenden Analyse gezeigt hat, sind die Handlungen der<br />
Täter von verschiedenen Motiven und Persönlichkeitsmerkmalen abhängig, die<br />
sich sowohl auf soziologischer, als auch auf individueller und psychologischer<br />
Ebene wiederfinden lassen. Monokausale Erklärungsansätze greifen zu kurz und<br />
zeichnen sich durch eine negative und einseitige Betrachtungsweise aus.<br />
In diesem Kapitel der Arbeit sollen nun die gewonnenen Erkenntnisse aus der<br />
vorherigen Dokumentenanalyse überprüft werden. Die Auseinandersetzung mit<br />
dem bestehenden Forschungsstand und die spezielle Untersuchung der Amokläufe<br />
in Erfurt und Emsdetten zeigt die Notwendigkeit, einzelne Aspekte möglicher<br />
Ursachenfaktoren und Bedingungen vertiefend zu betrachten.<br />
Es werden mögliche einflussnehmende Faktoren und Erklärungsansätze für<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> verdeutlicht. Hinsichtlich der Täterpersönlichkeit und der<br />
Tatmotivation kann zwischen Faktoren auf der psychologischen und der<br />
soziologischen Ebene unterschieden werden.<br />
Allerdings ist es oftmals schwierig, diese verschiedenen Ebenen eindeutig<br />
voneinander abzugrenzen. Übergänge sind oftmals als fließend anzusehen oder<br />
stehen ergänzend zueinander. Man kann auf Grund dessen eher von möglichen<br />
Risikokonstellationen mehrerer Faktoren ausgehen, die alleine stehend nicht<br />
unbedingt oder nur eingeschränkte Aussagekraft besitzen. 152 Daher werden in<br />
diesem Punkt auffällige Charakteristika aus der Dokumentenanalyse aufgegriffen<br />
und in Beziehung zu Bastian und Robert gesetzt.<br />
Daraus ergibt sich weiterhin, dass es für die Bearbeitung unumgänglich ist, die<br />
bestehende wissenschaftliche Ursachenforschung und Motivzuschreibung mit<br />
einzubeziehen.<br />
Obwohl sich Risikofaktoren auch bei vielen anderen Jugendlichen finden lassen,<br />
die nicht zu Amoktätern werden, ist es unumgänglich den Blickwinkel mit<br />
bestehenden Ergebnisse zu erweitern, um die eigenen Erkenntnisse auf ihre<br />
Beständigkeit überprüfen oder belegen zu können.<br />
152<br />
Vgl. Lange/ Greve, 2002, S.81ff.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
5.1 Negative Persönlichkeitstendenzen der Täter<br />
Hinsichtlich der Persönlichkeitsstrukturen von Bastian und Robert konnten<br />
mehrere Auffälligkeiten aufgedeckt werden. Dazu gehörten unter anderem<br />
unangemessene Reaktionen auf Krisen und Stresssituationen und besonders bei<br />
Bastian konnte anhand seines selbstgefertigten Materials ein völlig übersteigerter<br />
Selbstbezug deutlich gemacht werden. In den folgenden Punkten dieser Arbeit<br />
werden die einzelnen Aspekte aufgegriffen und in Beziehung zu bestehenden<br />
psychologischen Theorien gesetzt. Das Interesse liegt dabei auf möglichen<br />
Bindungsstörungen und narzisstischen Persönlichkeitstendenzen der Täter.<br />
Aufbauend darauf wird dann die Bedeutung der Phantasie und deren negative<br />
Entwicklung bei Bastian und Robert dargelegt.<br />
5.1.1 Bindungsstil und fehlende Coping-Strategien<br />
Es hat sich gezeigt, dass Robert und Bastian nicht in der Lage waren,<br />
entsprechende Bewältigungsstrategien oder Konfliktlösungsmuster für ihre<br />
Probleme zu entwickeln. Robert zog sich in sich selbst zurück, verheimlichte<br />
monatelang seinen Schulverweis. Auf seinen nicht bestandenen Führerschein<br />
reagierte er wütend mit Beschimpfungen und Tritten gegen Bordsteinkanten.<br />
Bastian äußerte sich im anonymen Medium des Internets oder in seinem<br />
Tagebuch über seine Gewalterfahrungen in der Schule sowie über seinen<br />
Liebeskummer.<br />
Ursache für diese ungenügende Fähigkeit Konflikte zu bearbeiten, wird zum<br />
Beispiel bei Füllgrabe in der Bindungsfähigkeit des jeweiligen Menschen<br />
gesehen. 153 Die fehlende Fähigkeit, eigene Emotionen zu regulieren, eine<br />
steigernde negative Bewertung anderer Menschen, gepaart mit dem Unvermögen<br />
sich in deren Lebenslage hineinzuversetzen, ist typisch für Amokläufe und kann<br />
als ausschlaggebende Ursache angesehen werden. Auch Heitmeyer geht davon<br />
aus, dass bei Fehlen sozialer Bindungen und emotionalen Rückhaltes die<br />
Einsamkeit des Menschen so groß werden kann, dass er den Folgen seines<br />
153<br />
Vgl. Füllgrabe, 2000, S.226f.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
Verhaltens für andere keine Berücksichtigung schenkt. 154 Um die Bedeutung<br />
menschlicher Bindungen herauszuarbeiten, erscheint zunächst eine Übersicht über<br />
die zentralen Ergebnisse aus der Bindungsforschung und dem Bindungsmuster<br />
von Menschen notwendig.<br />
Innerhalb der Bindungsforschung wurden drei unterschiedliche Bindungstypen<br />
entwickelt, die als Resultat der bindungsbezogenen Erfahrungen mit den<br />
Bezugspersonen angesehen werden können. 155 Später wurde den drei bestehenden<br />
Bindungsmustern noch ein viertes hinzugefügt, deren Bindungsverhalten als<br />
desorganisiert oder desorientiert bezeichnet wird. Man unterscheidet nach den<br />
Ergebnissen der Bindungsforschung zwischen dem sicheren Bindungsstil, dem<br />
unsicher–vermeidenden, dem unsicher-ambivalenten und einem desorganisierten,/<br />
desorientiertem Bindungsstil.<br />
Der Bindungstheorie nach bilden Kinder im Laufe ihrer Entwicklung<br />
Erwartungen an zukünftige Interaktionen, die wiederum ihre Einschätzung und ihr<br />
Verhalten beeinflussen. Diese Erwartungen sind weitgehend unbewusster Natur.<br />
Den sogenannten Bindungsrepräsentanzen liegen innere Organisationsstrukturen<br />
von Gefühlen, von Verhalten und mentalen Vorstellungen zu Grunde. Sie werden<br />
weiter ausgearbeitet, mit jeder Interaktion gefestigt, und bilden mit der Zeit das,<br />
was als „Inneres Arbeitsmodell“ bezeichnet werden kann. Dieses bildet die Sicht<br />
vom eigenen Selbst und dem Bild der anderen. Es entwickelt sich demzufolge aus<br />
dem primär vorhandenen Bindungssystem und den Gegebenheiten aus der<br />
Umwelt. Die Bindungsmuster haben während der gesamten Lebensspanne<br />
bestand, prägen die Fähigkeit, Beziehungen zu anderen Menschen einzugehen<br />
sowie die Qualität der Bindungen. Das entwickelte Bindungssystem ist auf der<br />
Verhaltensebene in den zentralen Handlungsmustern (Coping-Stilen) organisiert<br />
und ist als implizites affektives Arbeitsmodell zu sehen. 156 Jugendliche, die über<br />
einen sicheren Bindungsstil verfügen, sind in der Lage, mit Frustrationen oder<br />
Konflikten in ihrer Umwelt umzugehen. Sie können ihren Ärger in adäquater<br />
Weise nach außen mitteilen und diesen mit ihren vorhandenen Coping–Strategien<br />
entsprechend bewältigen.<br />
154<br />
Vgl Heitmeyer, 2003, S. 15.<br />
155<br />
Vgl. Christ, 2002, S.94ff.<br />
156<br />
Vgl. Sprangler, 2001, S.161f.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
Überträgt man die Ergebnisse der Bindungstheorie auf Amokläufer an Schulen, so<br />
kann man bei ihnen entweder von einem unsicher–ambivalenten oder unsicher–<br />
vermeidenden Bindungsstil sprechen. 157<br />
Im Falle eines unsicher–ambivalenten Bindungsstils würde das für Amokläufer<br />
bedeuten, dass primäre Bindungspersonen von Beginn an kein konsistentes<br />
Handlungsmuster im Umgang mit ihnen gezeigt haben. Zuneigung und Sicherheit<br />
sind für sie nur bedingt erfahrbar gewesen. Als Folge davon wird das Verhalten<br />
anderer Menschen oftmals als feindselig eingeschätzt. Ein positiver Umgang mit<br />
Konflikten wird verhindert, der Ärger staut sich im Inneren an und es stehen keine<br />
geeigneten Ressourcen zur Konfliktbewältigung zur Verfügung. 158<br />
Ein unsicher–vermeidendes Bindungsmuster kann bedeuten, dass sie sich<br />
bemühen, besonders unabhängig zu sein. Andere Menschen werden ebenso wie<br />
beim unsicher–ambivalenten Muster eher als negativ eingestuft und Bindungen<br />
werden in der Regel abgewertet. In Problemsituationen, in denen Ärger oder Wut<br />
eine natürliche Reaktion wäre, würden Menschen mit unsicher–vermeidendem<br />
Bindungsmuster ihren Ärger verneinen, aber trotzdem physiologisch eindeutige<br />
Merkmale von Wut oder Aggressivität aufweisen. 159<br />
Bezieht man diese Ergebnisse auf die Handlungsmuster von Robert und Bastian,<br />
scheinen sie nicht über angemessene Handlungsstrategien verfügt zu haben und<br />
auch das Unvermögen sich gegenüber anderen Bindungspersonen mitzuteilen,<br />
verweist auf das Fehlen sicherer Bindungsstrukturen. Das innere Arbeitsmodell,<br />
welches starken Einfluss auf die Wahrnehmung und das Verhalten hat, war bei<br />
Bastian nicht in der Lage, angemessen auf Kränkungen aus der Umwelt,<br />
insbesondere auf Gewalterfahrungen in der Schule, zu regieren. Als Folge stauten<br />
Aggressionen und Wut sich in ihm immer weiter auf. Dies ist aus seinem Hass auf<br />
die Gesellschaft, den er immer wieder erwähnte, zu schließen. Versuche, sich der<br />
Außenwelt mitzuteilen, wie der Eintrag auf der Online-Beratungsseite, scheiterten<br />
oder wurden nicht beachtet. Wie oben bereits erwähnt wurde, konnte auch Robert<br />
mit Frustrationen nicht umgehen. Ihm fehlte es an Handlungsalternativen und die<br />
Beziehungen zu Freunden und Familie nahm er nicht als sicher und vertrauensvoll<br />
genug wahr, um sich ihnen mitzuteilen.<br />
157<br />
Vgl. Füllgrabe, 2000, S.227.<br />
158<br />
Vgl. Eisenberg, 2002, S.90f.<br />
159<br />
Vgl. Christ, 2002, S.94ff.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
Die negative Bewertung ist bei beiden eindeutig festzustellen. Indizien zu einem<br />
unsicheren Bindungsstil lassen sich im Fall von Bastian in seinem umfangreichen<br />
Aufzeichnungen finden, in denen er sich nicht nur über Ausländer (gerade<br />
Türken) oder Lehrer, sondern eigentlich über die gesamte Menschheit negativ<br />
äußerte. Da bei Robert weniger persönliche Daten ermittelt werden konnte, lassen<br />
sich bei ihm auf Grund dessen nur bedingt stichhaltige Aussagen treffen. Auf<br />
Grund des vorliegenden Materials aus der Dokumentenanalyse ist es demnach<br />
nicht möglich eindeutig festzulegen, ob bei Bastian oder Robert ein unsicher–<br />
vermeidender oder unsicher–ambivalenter Bindungsstil vorlag.<br />
Abschließend kann als Ergebnis aus diesem Punkt abgeleitet werden, dass sich bei<br />
den Tätern Indizien auf einen unsicheren Bindungsstil finden lassen. Unsicher<br />
gebundene Menschen besitzen oftmals ein gering ausgeprägtes Selbstbewusstsein,<br />
leiden an Versagensängsten und haben eine nur geringe Frustrationsgrenze,<br />
gepaart mit einem unproduktiven Frustrationsabbau. 160 Die daraus entstehende<br />
Unfähigkeit, adäquat auf Krisen und Probleme zu reagieren, zeigt sich in ihren<br />
mangelhaften Coping–Strategien. Real vorhandene oder potenzielle Bedrohungen<br />
der eigenen Person können von ihnen nicht abgewendet oder im Vorfeld<br />
verhindert werden.<br />
Beide Täter besaßen demnach nur unzureichend ausgebildete Ressourcen zur<br />
Verarbeitung und Bewältigung ihrer Problemlagen. Zu ähnlichen Ergebnissen<br />
bezüglich Charakterzügen und Verhalten kommt auch Mary O`Toole. 161 Unter<br />
dem Begriff „Leakage“, der so viel wie „Leck schlagen bedeutet“, gibt sie im Fall<br />
von jugendlichen Amokläufern mehrere Merkmale an. Zu diesen gehören unter<br />
anderem niedrige Frustrationsgrenzen, unzureichende Coping-Strategien und<br />
Möglichkeiten, mit Ärger und Wut umzugehen, fehlendes Vertrauen in Andere<br />
und fehlende Fähigkeit, Empathie zu empfinden. Weiterhin zu erwähnen ist unter<br />
anderem, dass sie die Ursachen für Fehler nur bei anderen suchen und obwohl sie<br />
eigentlich ein geringes Selbstbewusstsein besitzen, nach außen hin versuchen, ein<br />
gegenteiliges Bild ihrer Persönlichkeit darzustellen. Viele dieser Merkmale, die<br />
auch im Zusammenhang zu narzisstischen Persönlichkeitstendenzen stehen, lassen<br />
sich bei Bastian und Robert finden. Trotz eines nur gering ausgeprägten<br />
Selbstbewusstseins zeigten Robert und Bastian nach außen hin einen<br />
160<br />
Vgl. Landeskriminalamt NRW( 2007), www1.polizeinrw.de/lka/stepone/data/downloads/d3/00/00/amoktaten.pdf,<br />
19.06.2007, S.6.<br />
161<br />
O’Toole (1999), www.fbi.gov/publications/school/school2.pdf, 15.05.2007, S.16ff.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
übersteigerten Selbstbezug und Kränkungen aus der Umwelt wurden als<br />
besonders schwer wahrgenommen. Die Merkmale des übersteigerten Ich–Bezuges<br />
und der leichten Kränkbarkeit beider Amokläufer verweisen auch auf<br />
narzisstische Persönlichkeitsmerkmale, worauf nun im nächsten Punkt dieser<br />
Arbeit genauer eingegangen werden wird.<br />
5.1.2 Narzisstische Persönlichkeitstendenzen<br />
Robert und Bastian wiesen eine gestörte Wahrnehmung der eigenen Person und<br />
damit einhergehend eine gestörte Wahrnehmung in ihren Beziehungen zu anderen<br />
auf. Daher liegt es nahe, zunächst die Persönlichkeit der Täter genauer auf<br />
mögliche narzisstische Tendenzen hin zu diskutieren.<br />
Betrachtet man Bastians Aktivitäten im Internet und sein Tagebuch, so wird bei<br />
ihm klar, dass er sich immer weiter in eine übertriebene Selbstbezogenheit<br />
hineinsteigerte. Seine Aussagen machen deutlich, dass die Welt sich um ihn<br />
herum drehte und er sich selbst im Mittelpunkt dieser sah. Ein Perspektivwechsel<br />
ist für ihn nicht möglich. Für ihn muss die Welt sich ändern und nicht er selbst.<br />
Seine persönlichen Aufzeichnungen zeigen das Bild eines Jugendlichen, der in<br />
einem völligen Selbstbezug lebte und dessen dargestellte Stimmungslagen in<br />
seinem Onlinetagebuch auf mögliche depressive Verstimmungen schließen lassen.<br />
Die meiste Zeit fühlte er sich gelangweilt, frustriert oder aggressiv. Er war nicht<br />
in der Lage, sich in die Emotionsebene anderer einzufühlen und distanzierte sich<br />
immer weiter. Bei Robert ist es auf Grund der vorliegenden Ergebnisse<br />
schwieriger Feststellungen zu treffen, aber auch bei ihm wird deutlich, dass er<br />
sich im Vorfeld der Tat stark zurückzog. Er fokussierte sich auf sich selbst und<br />
war unfähig, seinen Eltern Gefühle und Probleme mitzuteilen.<br />
Aus psychoanalytischer Sicht bedeutet Narzissmus nach Freud eine extreme<br />
Fixierung auf die eigene Libido als Zentrum. 162 Narzissmuss wird zunächst als<br />
Teil der frühkindlichen Entwicklung gesehen, der die Hinwendung zu anderen<br />
Personen als Übergangsstadium zwischen dem Autoerotismus und der sich später<br />
entwickelnden Objektliebe bedeutet. Dieser primäre Narzissmus ist Teil einer<br />
162<br />
Vgl. Stimmer, 1987, S.72ff.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
normalen kindlichen Entwicklung. Bei einer normalen Regulierung verlagert sich<br />
die Libido später auf Objekte aus der Umwelt. Im Falle des sekundären<br />
Narzissmus findet eine Fixierung/ Regression in Bezug auf den primären<br />
Narzissmus statt, die zu unrealistischen Größenphantasien und sozialer<br />
Regression führt. Trotz einer später herausgebildeten Objektliebe, verschwindet<br />
die Selbstbezogenheit mit der Entwicklung der Persönlichkeit nicht. Im Gegensatz<br />
zu einer normalen Entwicklung, zu der auch ein gewisser Grad an<br />
Selbstbezogenheit gehört, nimmt die verminderte Fähigkeit Empathie zu<br />
empfinden und Altruismus bei einem narzisstischen Menschen krankhafte Züge<br />
an. 163<br />
Seit Freud hat sich die Sicht auf den Narzissmus durch verschiedene Vertreter wie<br />
Kernberg oder Kohut weiterentwickelt. Es wird von verschiedenen Abstufungen<br />
ausgegangen, von narzisstischen Zügen einer Persönlichkeit, bis hin zu einer<br />
pathologisch krankhaften Störung. Erst in der absolut stärksten Ausprägung wird<br />
laut Kernberg von einer krankhaft narzisstischen Persönlichkeit ausgegangen. 164<br />
Bei Kernberg rückt der zerstörerische Aspekt der Persönlichkeit in den<br />
Mittelpunkt. Das Hauptproblem narzisstischer Persönlichkeiten in ihrer<br />
pathologischen Ausrichtung liegt demnach in einer Störung des<br />
Selbstwertgefühls, das in Zusammenhang zu einer Störung in der<br />
Objektbeziehung steht. 165 Die Störung äußert sich besonders in zwei Merkmalen.<br />
Zum einen besitzen narzisstische Personen ein hohes Maß an Selbstbezogenheit in<br />
Kontakt mit anderen Menschen, gepaart mit einem starken Bedürfnis von ihnen<br />
beachtet und geliebt zu werden. Zudem ist das eigene Selbstkonzept in Bezug auf<br />
ihre eigene Persönlichkeit völlig überhöht und steht im Widerspruch zu dem<br />
Wunsch nach Anerkennung und Bestätigung durch Andere.<br />
Kohut geht von zwei sich unabhängig voneinander agierenden Entwicklungslinien<br />
aus, welche die Persönlichkeit über das ganze Leben hinweg beeinflussen und die<br />
Basis des individuellen Selbstgefühles bilden. 166 Bei Versagen primärer oder<br />
kompensatorischer Chancen manifestieren sich die Ergebnisse der gestörten<br />
Entwicklung in einer Spiegelung oder idealisierten Übertragung. Narzisstische<br />
Personen suchen nach bestätigenden und bewundernden Selbstobjekten, um<br />
163<br />
Vgl. Stimmer, 1987, S.74f.<br />
164<br />
Vgl. Kernberg, 1983, S.34ff.<br />
165<br />
Vgl. Ebenda, S.261.<br />
166<br />
Vgl. Wahl, 1985, S.72.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
Gefühle von Wertlosigkeit oder fehlender Selbstachtung zu überspielen. Sie<br />
versuchen immer wieder, die eigene innere Leere durch idealisierte Selbstobjekte<br />
zu füllen oder suchen sich ein Alter Ego, um Selbstbestätigung durch völlige<br />
Empathie und Idealisierung zu erlangen. Im Gegensatz zu anderen Autoren legt<br />
Kohut den Fokus allerdings auf gesunde Seiten des Narzissmuss wie Liebe,<br />
Hoffnung und Ideale. 167<br />
Heutzutage unterscheidet man verschiedene Abstufungen einer narzisstischen<br />
Persönlichkeit von einer normalen Persönlichkeitscharakteristika bis hin zu einer<br />
schweren Persönlichkeitsstörung. 168 In seiner stärksten krankhaften Ausprägung<br />
bedeutet das die völlige Selbstüberschätzung der eigenen Persönlichkeit,<br />
einhergehend mit dem Unvermögen, sich in die Emotionen des Gegenüber<br />
hineinzuversetzen. Dazu kommt oftmals eine eher depressive Persönlichkeit mit<br />
Minderwertigkeitskomplexen, die für sich selbst und ihr eigenes Leben eine tiefe<br />
Leere in sich verspürt. Einerseits erleben sie sich als unwiderstehlich, wird ihnen<br />
jedoch die Aufmerksamkeit und Anerkennung verweigert, ziehen sie sich<br />
gekränkt zurück, entwickeln Neid oder Missgunst gegenüber anderen.<br />
Personen mit narzisstischen Tendenzen sind, wie bereits beschrieben, je nach<br />
Stärke der Ausprägung, vermindert oder gar nicht in der Lage Empathie für ihre<br />
Mitmenschen zu empfinden. Eine Beziehung zwischen Empathiefähigkeit von<br />
Tätern und deren Tötungshandlungen lässt sich auch bei Robert und Bastian<br />
feststellen. Die stärksten Defizite sind dabei im Bereich der Wahrnehmung und<br />
Anteilnahme an Emotionen anderer und der verminderten Fähigkeit zur<br />
Perspektivübernahme finden. Außerdem lässt die Kaltblütigkeit und Umsetzung<br />
der Amokläufe in Emsdetten und Erfurt auf eine starke Wut schließen, die hinter<br />
der Tat und dem Täter steckte und sich in den eigentlichen Handlungen scheinbar<br />
entlud. Bezieht man dieses auf die Annahmen narzisstischer<br />
Persönlichkeitsstörungen, so kann die Wut als Reaktion auf Versagungen aus der<br />
Umwelt gesehen werden.<br />
Götz Eisenberg sieht bei Amokläufen an Schulen den Hass und die Wut der Täter<br />
als zentral an. 169 Unter Bezugnahme auf Kernberg geht er davon aus, dass zu<br />
einem niedrigen Selbstwertgefühl der Täter Wut und Hass kommt.<br />
167<br />
Vgl. Wahl, 1985, S.72ff.<br />
168<br />
Vgl. Faust (no date), www.psychosoziale-gesundheit.net/seele/amok.html, 25.04.2007, S.19f.<br />
169<br />
Vgl. Eisenberg, 2002, S.25f.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
„Die Vorstellung, andere Menschen zerstören und in Furcht und Schrecken<br />
versetzen zu können, wird zu einer Quelle von Macht- und<br />
Überlegenheitsgefühlen. Um der eigenen narzißtischen Katastrophe zu<br />
entgehen und unerträgliche Gefühle von Angst, Ohnmacht und Hilflosigkeit<br />
abzuwehren, wird das eigene Innere nach außen gestülpt und mörderischselbstmörderisch<br />
in Szene gesetzt.“ 170<br />
Die innere Spannung des Täters richtet sich nach außen, bevor sie das eigene<br />
Selbst zerstört. Die Täter haben mit der Gesellschaft in der sie leben<br />
abgeschlossen und ihr Ausbruch wird durch die verwendeten Schusswaffen und<br />
Sprengsätze symbolisch unterstützt. Der Täter will demnach sein eigenes<br />
Selbstbild retten und stellt diese Wahrung über das eigene Überleben.<br />
Gewalttätiges Verhalten ist laut Kernberg das Ergebnis eines übermäßigen<br />
Aggressionstriebes, bedingt durch unlustvolle Erlebnisse und Affektdisposition. 171<br />
Sie führen zu einer Fixierung, der auf Spaltung bezogenen Abwehrvorgänge. Eine<br />
Integration der Selbst- und Objektrepräsentanzen scheitert und führt zu einer<br />
Schwächung und pathologischen Entwicklung von „Ich“ und „Über-Ich“<br />
Strukturen. Narzisstische Wutausbrüche erfolgen demnach, wenn die eigenen<br />
Bedürfnisse nicht in Einklang mit den Bedürfnissen anderer Menschen gebracht<br />
werden können oder die Betroffenen merken, dass die von ihnen wahrgenommene<br />
Realität sich nicht nach ihrem Willen ausrichtet. Sie vermitteln der narzisstischen<br />
Persönlichkeit Sicherheit, weil destruktive Ansätze gegen andere gerichtet werden<br />
können. Würden sie gegen das eigene Selbst gerichtet werden, wäre dies<br />
divergent zu dem Bezug auf das eigene, überzogene Ego. Andererseits bedeutet<br />
die nach außen gerichtete Wut einen subjektiv empfundenen Kontrollgewinn der<br />
eigenen Person.<br />
Dieser Wunsch nach Kontrollgewinn lässt sich auch bei Robert und Bastian<br />
finden. Der Einsatz von Schusswaffen beinhaltete gleichzeitig auch Macht. Sie<br />
versuchten mit ihrem Amoklauf in extremster Weise Kontrolle über ihre Situation<br />
und dementsprechend auch über ihre als negativ empfundene Realität zu<br />
gewinnen. Die Emotionen anderer Menschen und in diesem Fall ganz besonders<br />
das Leben anderer Menschen berührte die Täter nicht und zeigt ihr Unvermögen,<br />
sich in Andere hineinzuversetzen.<br />
170<br />
Ebenda, S.25.<br />
171<br />
Vgl. Kernberg, 1983, S. 136.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
Frank Robertz meint dazu, dass im Falle von Tötungsdelikten durch Jugendliche<br />
emotional verursachte Aggressionen sicherlich möglich sind. 172 Kritisch zu sehen<br />
ist diese Hypothese allerdings im Zusammenhang mit gezielt geplanten Tötungen.<br />
Er sieht einen narzisstischen Wutausbruch, der sich nach langer Phase der<br />
Aufstauung gerade in einem <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>, welches sich durch eine lange und<br />
sorgfältige Planung auszeichnet, als unrealistisch an. Kritisch wird der Verweis<br />
auf ein gestörtes Wirklichkeitsbild und ein übersteigertes Selbstbewusstein von<br />
Freerk Huisken gesehen. 173 Dort wird auf eine gesellschaftsbedingte subjektive<br />
Einstellung zu gesundem und krankhaftem Wirklichkeitsbild und<br />
Selbstbewusstseinsideal verwiesen. Sie beeinflusst die Einschätzung zur<br />
Persönlichkeit der Täter nimmt diese aus dem Blickwinkel heraus als gestört<br />
wahr. Doch trotz der Kritik einiger Autoren können narzisstische<br />
Persönlichkeitszüge bei Amokläufern an Schulen festgestellt werden. Jedoch<br />
bleibt die Rolle der narzisstischen Wut als Auslöser für Amokläufe weiterhin<br />
kritisch zu sehen. Die Geplantheit der Tat steht im Widerspruch zu der Annahme,<br />
dass narzisstische Wutausbrüche aus einem Impuls heraus entstehen.<br />
5.1.3 Phantasieentwicklung<br />
Die Analyse und die Bearbeitung psychischer Auffälligkeiten der Täter hat<br />
gezeigt, dass sich Besonderheiten in der Phantasieentwicklung der Täter finden<br />
lassen. Obwohl Phantasie als ein grundsätzlich positives Merkmal bei<br />
Jugendlichen anzusehen ist, zeichnete sie sich bei den Tätern von Emsdetten und<br />
Erfurt durch eine Hinwendung zu besonders gewalttätigen Inhalten aus. Ein<br />
Korrelat zwischen dieser einseitigen Ausrichtung ihrer Phantasie und den<br />
Amokläufen ist offensichtlich, da sie sich auf der Grenze zu einem Realitäts- und<br />
damit einhergehend zu einem Kontrollverlust der Täter bewegt. 174<br />
In der Psychologie wird die Phantasie als Vorstellungskonstrukt gesehen. 175 Das<br />
Konstrukt orientiert sich an der Wahrnehmung abgewandelter Erinnerungen und<br />
172<br />
Vgl. Robertz, 2004, S.208.<br />
173<br />
Vgl. Huisken, 2002, S. 20ff.<br />
174<br />
Vgl. Landeskriminalamt NRW (2007), www1.polizeinrw.de/lka/stepone/data/downloads/d3/00/00/amoktaten.pdf,<br />
19.06.2007, S.7.<br />
175<br />
Vgl. Fröhlich, 2005, S.365.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
beinhaltet einen schöpferischen Anteil, bei dem zu früheren<br />
Wahrnehmungsanteilen neue Gebilde und Inhalte assoziiert werden. Eine gestörte<br />
Phantasieentwicklung liegt vor, wenn die Vorstellungswelt sich ohne eine direkte<br />
Anbindung an vorher gemachte Sinneserfahrungen bildet.<br />
Frank Robertz hat sich eingehend mit der Phantasieentwicklung von Amokläufern<br />
an Schulen auseinandergesetzt. Auf Grund dessen werden zunächst die Ergebnisse<br />
seiner Untersuchung dargestellt, um sie dann auf mögliche Erscheinungsformen<br />
bei Robert und Bastian untersuchen zu können. Er sieht die Phantasie als eine<br />
Bewusstseinsform:<br />
„[...] die mittels der Verknüpfung von Wahrnehmung und Denken kreative<br />
Erfahrungen erlaubt. Dabei ist der Grad der Intensität beziehungsweise der<br />
Kontrolle über diese Fähigkeit veränderlich. Er prägt das Erleben der Realität<br />
und somit auch Handlungen eines Menschen ebenso, wie dies auch durch die<br />
inhaltliche Ausrichtung der Phantasie geschieht. 176<br />
Unter zu Hilfenahme von unterschiedlichen Theorien aus der Psychologie hat er<br />
ein Konzept über den Einfluss von Phantasien bei <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s erstellt. Die<br />
Kernaussage besteht darin, dass durch kritische Lebensereignisse hervorgerufene<br />
Schädigungen auf psychischer Ebene der Täter, mittels Imitation und einer Über–<br />
Identifikation mit dissozialen Vorbildern zu einer gestörten Phantasieentwicklung<br />
führen können. 177 Eigentliches Ziel der Phantasieentwicklung ist es, Kontrolle<br />
wiederzugewinnen. Medien sind in diesem Zusammenspiel dahingehend<br />
einflussnehmend, als dass sie die Phantasierichtung beeinflussen. Auslöser für den<br />
Schritt, die Phantasien in die Tat umzusetzen, können subjektiv besonders kritisch<br />
erlebte Ereignisse im Leben sein. Besondere Bedeutung wird innerhalb dieses<br />
Konzeptes der Über–Identifikation in Zusammenhang mit gewalttätigen<br />
Rollenvorbildern eingeräumt, denn auf Grund von medialer Berichterstattung und<br />
Phantasieanregung erscheint das <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> als ultimativer Weg des<br />
Kontrollgewinns.<br />
Auch Eisenberg verweist auf die Bedeutsamkeit der Phantasie bei jugendlichen<br />
Amokläufern indem er sagt, dass narzisstische Tendenzen in den Tätern Größen-<br />
und Machtphantasien heranreifen lassen. 178 Diese richten sich zunächst nach innen<br />
und dienen dem gestörten Selbst der Täter im Falle von Krisen oder Kränkungen<br />
als Rückzugsort. Im Normalfall relativieren sich diese Phantasien im<br />
176<br />
Robertz, 2004, S.28.<br />
177<br />
Vgl. ebenda, S.245f.<br />
178<br />
Vgl. Eisenberg, 2002, S.41ff.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
Biografieverlauf und weichen realistischeren Einschätzungen. Dieses scheint bei<br />
<strong>School</strong> Shootern nicht der Fall zu sein. Die Emotionen von Wut und<br />
Rachegelüsten und die damit einhergehenden Tötungsphantasien verlagern sich<br />
ins Innere und sorgen dort gewissermaßen für eine symbolische Entlastung. Die<br />
Entlastung scheint aber bei ihnen nicht ausreichend zu sein, um die angestaute<br />
Wut kompensieren zu können, so dass sie sich dann im Akt des Amoklaufes in<br />
der Realität verwirklicht und gebündelt nach außen richtet.<br />
Genau hier könnte eine bedeutende Schnittstelle zwischen den narzisstischen<br />
Persönlichkeitszügen bei <strong>School</strong> Shootern und der fehlgeleiteten<br />
Phantasieentwicklung liegen. Das stark überhöhte Erleben von Kränkungen und<br />
Versagensängsten, gepaart mit der negativen Sicht anderer, steht divergent zu<br />
ihrer überhöhten Selbstsicht. Negative Emotionen wie Wut und Hass wurden<br />
ausgelöst und richteten sich zunächst nach Innen. 179 Auf Grund eines<br />
unproduktiven Aggressionsabbaus sammelten sich die Phantasievorstellungen der<br />
Täter und steigerten sich im Laufe der Zeit in ihrer Intensität. Die Kontrolle<br />
innerhalb der Traumwelt wurde zum Zentrum der Aggressionsverarbeitung und<br />
eine Kompensation durch einen Rückzug in positive Gedankenwelten war nicht<br />
möglich, da ihre Gewalt im Zentrum ihrer Phantasien stand. 180 Sie entwickelten<br />
entsprechende Wunschvorstellungen sich an der Welt zu rächen und setzten diese<br />
dann im Gegensatz zu anderen in ihrem Amoklauf in die Tat um.<br />
Die Phantasien der Täter wurden durch gewalttätige Spiele, Filme und die<br />
Faszination der Täter für bereits geschehene Vorfälle an Amokläufen geprägt.<br />
Merkmale wie die Faszination an gewaltverherrlichenden Medien werden in der<br />
amerikanischen Studien auch von Mary O’Toole angebracht. 181 Sie gibt dazu<br />
weiterhin an, dass <strong>School</strong> Shooter sich oftmals negative Rollenvorbilder suchen.<br />
Bei Robert lässt sich das in seinem Interesse am Massenmörder Charles Manson<br />
finden, wobei er versuchte, sich mit seinem umfangreichen Wissen über dessen<br />
Taten innerhalb seiner Peer hervorzuheben. 182<br />
Bei der Auswertung der Daten auf den Computern der Täter wurde umfangreiches<br />
Material gefunden, das auf ihr Interesse an vorherigen <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s verweist.<br />
179<br />
Vgl. ebenda, S.44.<br />
180<br />
Vgl. Gallwitz, 2001, S.174.<br />
181<br />
Vgl. O’Toole (1999), www.fbi.gov/publications/school/school2.pdf, 15.05.2007, S.20f.<br />
182<br />
Vgl. Gasser u.a. (2004),<br />
www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnasium.pdf,<br />
15.06.2007, S.344ff.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
Robertz gibt dazu an, dass auch die Art und Weise der Medienberichterstattung<br />
hohen Einfluss ausübt. 183 Die überhöhte, zumeist einseitige Berichterstattung und<br />
Darstellung von Amokhandlungen beeinflusst die Sicht auf solche Taten.<br />
Gefährdete Jugendliche können diese als ultimative Möglichkeit sehen, ihren<br />
Wunsch nach Bekanntheit zu erfüllen. In der oftmals einseitigen Suche nach<br />
Motiven der Täter finden sich auf jeden Fall spezifische Problemlagen der<br />
betroffenen Jugendlichen. Der Amoklauf wird als mögliche Lösungsstrategie der<br />
Jugendlichen wahrgenommen, wobei die Medienberichterstattung mit als<br />
Rechtfertigungsmechanismus fungiert. Zusätzlich kann sie, gepaart mit den<br />
gewaltdurchzogenen Hobbys der Täter, die Tötungshemmung herabsetzen.<br />
Schuldgefühle werden vermindert, da andere Jugendliche mit scheinbar ähnlichen<br />
Problemlagen die ausgemalten Phantasien in die Tat umgesetzt haben und somit<br />
subjektiv empfunden scheinbare Kontrolle gewonnen haben.<br />
Der starke Wunsch nach Kontrollgewinn lässt sich jedoch in der Realität des<br />
Amoklaufes nicht umsetzen. 184 Während ihrer Tathandlungen sind beide Täter<br />
immer wieder unvorhergesehenen Situationen ausgesetzt, die ihnen vor Augen<br />
gehalten haben können, dass sie nicht die absolute Kontrolle über ihre Situation<br />
besitzen. Bei Bastian mag dies zum einen das Aufeinandertreffen mit seinem<br />
Bruder sein, bei Robert vielleicht die direkte Anrede durch einen Lehrer der<br />
Schule. Zudem wich Robert nach der Tötung eines Polizisten von seinem<br />
primären Tötungsziel ab und seine Schüsse wurden unkontrollierter. Er schoss<br />
durch geschlossene Türen des Gymnasiums und tötete dabei auch Schüler, ohne<br />
dass er sich dessen bewusst war.<br />
Ein weiterer Beleg für den Einfluss der Phantasieentwicklung lässt sich in der<br />
Verwendung einer Maskierung sehen. 185 Sie verknüpft die Phantasien der Täter<br />
mit der Realität. Die Vermummung als eine Identifikation mit den Protagonisten<br />
aus den Filmen und Spielen, die beide Täter schauten und spielten, bedeutet<br />
gleichzeitig eine Distanz zu den Opfern. Sie schlüpfen in die Rolle eines<br />
Protagonisten und werden zum anonymen Handelnden, der Macht und Kontrolle<br />
besitzt. Dazu kommt die Vorstellung, die sich aus dem Medieninteresse der Täter<br />
gebildet hat, berühmt und im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Die<br />
Abnahme der Maske hebt die Wirkung ihrer damit verknüpften Phantasien auf<br />
183<br />
Vgl. Robertz, 2007, S.14f.<br />
184<br />
Vgl. Robertz, 2004, S.229ff.<br />
185<br />
Vgl. Pfeiffer, 2002, S.3f.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
und konfrontiert sie mit der Realität ihrer Handlungen und realen Menschen, die<br />
ihnen gegenüber stehen.<br />
Die genannten Situationen aber machen den Tätern ihren Kontrollverlust deutlich.<br />
Letztendlich wird der Suizid als einzige Möglichkeit gesehen, wenigstens die<br />
Kontrolle über sich selbst zu bewahren. Die Konfrontation mit unvorhersehbaren<br />
und nicht eingeplanten Situationen, führt zu einem Rollenwechsel vom<br />
Protagonisten ihrer gewalttätigen Phantasien zu einem Schüler, der an der<br />
ehemaligen Schule soeben mehrere Menschen verletzt oder getötet hat. Zu Beginn<br />
bedeutet der Amoklauf für die Täter eine reale Umsetzung ihrer Phantasien. 186<br />
Zusammenfassend sind schwerwiegende psychische Krankheiten rückwirkend<br />
kaum belegbar. Weiterhin kann sicherlich nicht davon ausgegangen werden, dass<br />
die in den vorherigen Punkten dargelegten negativen Persönlichkeitstendenzen als<br />
alleinige auslösende Faktoren gesehen werden können. Aber durch fehlende<br />
Coping–Strategien auf Grund eines unsicheren Bindungsstils und narzisstischen<br />
Persönlichkeitszügen der Täter, erhält die Phantasie des Täters eine Brisanz bei<br />
die Realisierung der Tatvorstellungen.<br />
5.2 Fehlende Sicherheit auf sozialer Ebene<br />
Nach der Erörterung besonderer Aspekte auf psychischer Ebene der Täter<br />
erscheint es an dieser Stelle notwendig, näher auf die soziale Ebene der Täter<br />
einzugehen. Fraglich im Falle von <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> ist, ob und welchen Einfluss<br />
gerade die sozialen Netzwerke besitzen. Innerhalb der sozialen Netzwerke der<br />
Täter wird die Rolle von Familie, Peer und Schule erörtert.<br />
Zunächst werden Teilaspekte erörtert, die sich im Bereich der engen sozialen<br />
Netzwerke wie Familie und Peer finden lassen. Dann wird näher auf die<br />
Bedeutung und der Einfluss der Schule eingegangen. Festgestellt wurde im<br />
vorherigen Kapitel, dass sich bei beiden Tätern Auffälligkeiten dahingehend<br />
finden lassen. Wie bereits herausgearbeitet wurde, ist die Schule ein zentraler<br />
Aspekt innerhalb dieses Phänomens. Beide <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s haben an einer<br />
Schule stattgefunden ebenso ist eine Fokussierung auf Opfer innerhalb der Schule<br />
186<br />
Vgl. Robertz, 2004, S.230f.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
eindeutig. Daher ist es unumgänglich im letzten Unterpunkt zusätzlich auf die<br />
Bedeutung besonders kritisch erlebter Ereignisse im Leben und innerhalb der<br />
sozialen Umwelt der Täter einzugehen.<br />
5.2.1 Soziale Netzwerke<br />
Die Bearbeitung der sozialen Netzwerke und deren Einflüsse auf jugendliche<br />
Amokläufer gestaltet sich innerhalb der bestehenden Literatur als uneinheitlich<br />
und bisweilen divergent. So geht Gallwitz davon aus, dass die Familie ein<br />
Problemfeld bei Amokläufern sein kann. 187 Die Familie kennzeichnet sich<br />
dementsprechend durch ein Umfeld fehlender Kommunikation zwischen den<br />
einzelnen Mitgliedern der Familie. Der Vater oder die Mutter können als<br />
dominant bezeichnet werden und die Beziehungen untereinander sind geprägt<br />
durch Feindseeligkeit und Vernachlässigung.<br />
Problematisch zu sehen sind die Annahme von McGee und DeBernado. Sie sind<br />
der Meinung, dass die Familien von jugendlichen Amokläufern sich zwar<br />
oberflächlich als normal, aber tiefergehend eher als dysfunktional beschreiben<br />
lassen. „Divorce, Seperation and/or frequent episodes of intense friction between<br />
parents, and parents and child, is the norm [...].“ 188 Offene oder verdeckte Gewalt<br />
und Feindseligkeiten bestimmen die familiären Emotionen. Der Vater ist eher als<br />
abwesend zu sehen und Strenge innerhalb der Familie ist entweder besonders<br />
stark vertreten oder sehr inkonsistent. 189<br />
Nach Bannenberg sind bei jugendlichen Amokläufern keine Anzeichen von<br />
sogenannten broken–home–Hintergründen festzustellen. 190 Die Jugendlichen<br />
scheinen innerhalb der Familie keinen Gewalterfahrungen ausgesetzt gewesen zu<br />
sein, sondern entstammen eher einem Kleinbürgerlichen- oder Mittelschicht–<br />
Milieu. Die Jugendlichen besitzen relativ große Freiräume, Konflikte über<br />
problematische Verhaltensweisen werden eher weniger ausgetragen. Das<br />
Zusammenleben der Familienmitglieder besteht aus einem nebeneinander der<br />
einzelnen Mitglieder. Britta Bannenberg verweist zusätzlich dazu in einigen<br />
187<br />
Vgl. Gallwitz, 2001, S.172.<br />
188<br />
McGee/ DeBernado,1999, S.7.<br />
189<br />
Vgl. ebenda, 1999, S.7.<br />
190<br />
Vgl. Bannenberg, 2007, S.39.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
untersuchten Fällen darauf, dass die Beziehung zum Vater besonders über den<br />
Umgang mit Waffen besteht. Auch McGee und DeBernado verweisen auf den<br />
besonderen Umgang mit Waffen innerhalb der Familie von <strong>School</strong> Shootern. 191 In<br />
den beiden untersuchten Fälle konnte dahingehend kein Zusammenhang<br />
festgestellt werden. Roberts Vater war zwar Mitglied in einem Schützenverein<br />
und ist selbst Schützenkönig gewesen, aber eine Definierung der Vater–Sohn<br />
Beziehung über das gemeinsame Interesse lässt sich nicht erschließen. Auch in<br />
Bastians Familie konnten keine Hinweise auf eine wichtige Bedeutung von<br />
Waffen oder dem Schützensport gefunden werden.<br />
Bezüglich der Familien von jugendlichen Amokläufern ist es demnach schwierig<br />
Besonderheiten aufzudecken, da die Täter im allgemeinen aus Familien mit einer<br />
normalen Spannweite von intakten Kernfamilien bis hin zu Stiefelternteilen<br />
kommen. 192 Bestätigend dazu gibt auch Vossekuil an, dass sich bei jugendlichen<br />
Amokläufern keine offensichtlichen Auffälligkeiten bezüglich der familiären<br />
Situation finden lassen. Die Jugendlichen stammten aus einer Vielzahl<br />
unterschiedlicher Familienstrukturen. 193 Aber wie bereits im Punkt über<br />
psychische Auffälligkeiten von Tätern festgestellt wurde, verweisen auch hier<br />
Indizien auf Problemlagen innerhalb familiärer Bindungen.<br />
In Bezug auf die Sozialisation gefährdeter Jugendlicher wird angenommen, dass<br />
ein Mangel an Liebe und Zuwendung sowie das Vorhandensein häuslicher Gewalt<br />
die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die betroffenen Jugendlichen später selber<br />
dazu neigen, Gewalt auszuüben. 194 Zeichen von häuslicher Gewalt konnten in<br />
keinem der beiden Fälle aufgedeckt werden. Eindeutig ist aber, dass die<br />
Unwissenheit der Eltern über den Schulverweis und die Möglichkeit, diesen über<br />
Monate hinweg zu verheimlichen, auf Defizite innerhalb der Beziehungen von<br />
Robert und seinen Eltern verweist. Jugendliche in diesem Alter stehen an einem<br />
Punkt, an dem die Abnabelung vom Elternhaus und die Lockerung der Bindungen<br />
zu den Eltern bedeutende Sozialisationsfaktoren sind. Aber dennoch sollte ein<br />
Interesse an dem Alltag auf beiden Seiten bestehen bleiben. Roberts Eltern fiel der<br />
starke Konsum von gewalttätigen Filmen und Spielen auf. Ebenso wussten die<br />
Eltern von seinen schlechten Schulleistungen. Rückfragen bezüglich des<br />
191<br />
Vgl. McGee/ DeBernado,1999, S.7.<br />
192<br />
Vgl. Hoffmann, 2007, S.28.<br />
193<br />
Vgl. Vossekuil u.a. (2002), www.secretservice.gov/ntac/ssi_final_report.pdf, 20.04.2007, S.19f.<br />
194<br />
Vgl. Pfeiffer, 2002, S.3f.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
Leistungsstandes oder möglicher Problemlagen konnten anhand des vorliegenden<br />
Materials nicht festgestellt werden. In Zusammenhang dazu ist Mary O’Toole der<br />
Meinung, dass die Familien nicht auf pathologische oder negative<br />
Verhaltensweisen reagiert haben. 195 Sie waren nicht in der Lage, diese ausreichend<br />
wahrzunehmen oder haben diese vor anderen heruntergespielt.<br />
Interessant ist der Aspekt, dass Amokläufe an Schulen, trotz allgemeiner<br />
Annahmen in der Regel nicht an Hauptschulen oder sozialen Brennpunkten<br />
stattfinden. Auffälligkeiten innerhalb des Bildungsniveaus der Täter lassen sich<br />
nur dahingehend treffen, dass die Täter in vielen Fällen nicht aus einem<br />
niedrigeren Bildungsstand stammen. Auch die amerikanischen Studien kommen<br />
hinsichtlich des Bildungsgrades jugendlicher Amokläufer zu ähnlichen<br />
Ergebnissen. 196<br />
Der Bildungsgrad der Eltern und der Täter ist in den beiden untersuchten Fällen<br />
eher als mittel bis hoch einzuschätzen. Roberts Amoklauf fand an einem Erfurter<br />
Gymnasium statt, Bastian lief in seiner ehemaligen Realschule Amok. Hoffman<br />
geht davon aus, dass an Schulen mit niedrigem Ausbildungsniveau Konflikte eher<br />
erkennbar sind. 197 Da die Täter in der Regel männlich waren, gibt er an, dass die<br />
Erwartungen von Aufstieg und gesellschaftlichem Erfolg in Mittel- und<br />
Oberschichtseinrichtungen immer noch stark in Zusammenhang zu männlichen<br />
Rollenbildern als Ernährer oder Machtinhaber stehen. Für die Täter würde es in<br />
diesem Fall bedeuten, dass ein subjektiv empfundenes Versagen in dieser Kultur<br />
eine besondere Bedrohung der männlichen Identität darstellt. Jugendliche mit<br />
niedrigem Bildungsniveau stehen oftmals im unteren Bereich der Gesellschaft, so<br />
dass ein Versagen nicht so schlimm erfasst und gedeutet wird, als bei<br />
Jugendlichen mit einem mittleren oder höheren Bildungsabschluss. Denen droht<br />
bei Versagen eine höhere Isolation aus ihrem sozialen Umfeld.<br />
Adolf Gallwitz geht ebenso auf das Bildungsniveau von jugendlichen<br />
Amokläufern ein. Er sieht diese als oftmals überdurchschnittlich intelligent an,<br />
aber sie:<br />
„[...] stellen sich hinsichtlich ihrer Noten, Beziehungen zu Gleichaltrigen und<br />
nachweisbaren Leistungen im Beruf nur als klägliches Mittelmaß heraus und<br />
195<br />
Vgl. O’Toole (1999), www.fbi.gov/publications/school/school2.pdf, 15.05.2007, S.21.<br />
196<br />
Vgl. Vossekuil u.a. (2002), www.secretservice.gov/ntac/ssi_final_report.pdf, 20.04.2007, S.19f.<br />
197<br />
Vgl. Hoffmann, Interview am 12.07.2007, S.3f.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
bleiben in allen Bereichen weit davon entfernt, ihr Leistungspotenzial<br />
auszuschöpfen.“ 198<br />
Innerhalb der Schule fallen die Täter einigen Lehrern durch ihre<br />
Zurückgezogenheit als problematisch auf. 199 Dies wird jedoch nicht weiter<br />
aufgegriffen, da von ihnen oberflächlich gesehen kein Stör- oder Gewaltpotenzial<br />
ausgeht. Durch ein besonders hohes Gewaltpotenzial oder Gewalthandlungen ist<br />
keiner der beiden Täter im Vorfeld aufgefallen. Obwohl Robert mit seinem<br />
Schulverweis einer erheblichen Konfliktsituation in seiner schulischen Laufbahn<br />
ausgesetzt war und auch einigen Lehrern seine persönlichen Veränderungen<br />
aufgefallen waren, wurden seitens der Schule keine Mittel gefunden, um Zugang<br />
zu seinen Problemen zu erreichen. Im Gegensatz dazu zeigten sich bei Bastian<br />
zusätzlich zu schulischen Schwierigkeiten auch Gewalterfahrungen. Im Gegensatz<br />
zu Robert zeigte sich beim ihm besonders deutlich, welche Auswirkungen die<br />
gemachten Erfahrungen auf seine Persönlichkeit gehabt haben. 200 In seinen<br />
Unterlagen wechselte er zwischen Rache- und Wutgefühlen sowie<br />
philosophischen Betrachtungen über seine Sicht der Gesellschaft und<br />
Schuldzuweisungen. Erfahrungen durch Mobbing lagen auch laut der Ergebnisse<br />
der amerikanischen Studien in einigen Fällen vor, die dann ähnlich wie die<br />
Erfahrungen bei Bastian schon an systematische Quälerein grenzten. 201<br />
In Bezug auf Amokläufe scheint sich demnach auch die Schule als mögliches<br />
Einflussfeld herauszukristallisieren. Kränkungen und Akzeptanzprobleme führten<br />
dazu, dass der Hass der Täter sich auf das System Schule fokussierte. Zudem<br />
waren die Zukunftsaussichten beider durch Perspektivlosigkeit gekennzeichnet.<br />
Sie durchlitten während ihrer Schulzeit durch individuelle Versagensgefühle<br />
geprägte Phasen, welche als besonders schwerwiegend empfunden wurden.<br />
Nach der Betrachtung der Familie innerhalb des sozialen Netzwerkes der Täter<br />
soll nun die Sicht auf den Freundeskreis gelenkt werden. Eine besondere Relevanz<br />
für Jugendliche ist die Bedeutung des Freundeskreises, auch als Peer<br />
bezeichnet. 202 Die Peer dient als Schutzraum, der Jugendlichen als Orientierungs-<br />
und Stabilisierungspunkt dient. Sie bietet einen geschützten Raum für individuelle<br />
198<br />
Gallwitz, 2001, S.174.<br />
199<br />
Vgl. Bannenberg, 2007, S.39f.<br />
200<br />
Vgl. Engels, 2007, S.41.<br />
201<br />
Vgl. Vossekuil u.a. (2002), www.secretservice.gov/ntac/ssi_final_report.pdf, 20.04.2007, S.20f.<br />
202<br />
Vgl. Oerter/ Dreher, 2002, S.259ff.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
Selbstdarstellungsmöglichkeiten und fördert damit die Identitätsfindung<br />
Jugendlicher.<br />
Laut Vossekuil zeigt sich innerhalb der Peer jugendlicher Amokläufer ein<br />
ähnliches Bild wie in den Familienverhältnissen. Die Jugendlichen variieren<br />
zwischen isolierten Einzelgängern bis zu anerkannten Mitgliedern innerhalb ihrer<br />
Peer. 203 McGee und DeBernado gehen davon aus, dass die Täter eher introvertierte<br />
Einzelgänger sind, die einen nur geringen Freundeskreis besitzen. 204<br />
Robertz gibt an, dass oberflächlich gesehen, Amokläufer einen Freundeskreis<br />
besitzen, der sich bei genauerer Betrachtung aber eher als dysfunktional<br />
beschreiben lässt. 205 Bei Robert Steinhäuser bestand er größtenteils aus<br />
ehemaligen Schulkameraden. Wie die Analyse weiterhin ergeben hat, zeichneten<br />
sich die bestehenden Freundschaften nicht durch eine besondere Tiefe in den<br />
einzelnen Beziehungen, sondern nur durch eine oberflächliche<br />
Interessensgemeinschaft aus. Robert belog einen Grossteil seiner Freunde nach<br />
dem Schulverweis. Das von ihm aufgebaute Lügennetz hatte bis zu seinem<br />
Amoklauf bestand. Des Weiteren hatte ein Teil seiner Freunde Kenntnis über<br />
seine Mitgliedschaft im Schützenverein. Der Besitz von Waffen war einigen<br />
bekannt, wurde aber nicht als gefährlich eingestuft.<br />
Bastians Peer bestand aus Mitgliedern seines Air-Soft Teams. Trotzdem wird in<br />
verschiedenen Mitteilungen berichtet, dass er eine Außenseiterposition innerhalb<br />
seiner Schule besaß. Diese verstärkte sich gegen Ende seiner Schulzeit und er<br />
wurde in der Schule mit verschiedenen negativen Spitznamen tituliert.<br />
Die Kontakte zu Gleichaltrigen bestanden bei beiden Tätern innerhalb ihrer Peer<br />
demnach auf Grund gemeinsamer Freizeitinteressen. O’Toole gibt an, dass die<br />
Peer von <strong>School</strong> Shootern sich oftmals besonders durch die gemeinsamen<br />
Interessen und die Faszination an Gewalt auszeichnet. 206 Dies kann bei Bastian<br />
sicherlich bestätigt werden, kann aber im Falle von Robert nicht als gesichert<br />
gesehen werden.<br />
Beziehungen zu Mädchen konnten bei keinem festgestellt werden. Bastians<br />
Tagebucheintragungen nach, war er unglücklich in ein gleichaltriges Mädchen<br />
verliebt. Bei Robert wurden keinerlei mögliche Beziehungen festgestellt.<br />
203<br />
Vgl. Vossekuil u.a. (2002), www.secretservice.gov/ntac/ssi_final_report.pdf, 20.04.2007, S.20.<br />
204<br />
Vgl. McGee/ De Bernado, 1999, S.8.<br />
205<br />
Vgl. Robertz, 2007, S.13.<br />
206<br />
Vgl. O’Toole (1999), www.fbi.gov/publications/school/school2.pdf, 15.05.2007, S:24.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
Die Wichtigkeit eines sicheren sozialen Netzes und die Gefährdung durch das<br />
Fehlen sozialer Einbindung in ein Netz von Verwandten, Bekannten und<br />
Freunden ist sicherlich eindeutig. 207 Jugendliche brauchen Anerkennung aus ihrem<br />
Umfeld, um eine stabile Identität bilden zu können. „Fehlende Anerkennung ist<br />
eine Summe mangelnder sozialer Integration und sozialer Unterstützung.“ 208 Ohne<br />
eine positive Selbstwertbilanz kann das eigene Selbstwertgefühl weder aufgebaut<br />
noch stabilisiert werden. Als Folge können soziale Bindungen und emotionaler<br />
Rückhalt verloren gehen, der Wert anderer Menschen und der eigene Selbstwert<br />
verlieren an Bedeutung. Gerade die Annahme, dass fehlende Anerkennung<br />
erheblichen Einfluss auf gefährdete Jugendliche ausübt macht es notwendig, näher<br />
auf die Bedeutung der Sozialisationsinstanz Schule einzugehen.<br />
5.2.2 Kritische Lebensereignisse<br />
Wie bereits ausführlich erläutert wurde, sind <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s keine Handlungen,<br />
die unvorbereitet aus einem Impuls der Täter heraus entstehen. Den Taten gehen<br />
lange Missstände voraus, die bei den Tätern Kränkungen und psychische<br />
Verletzungen hinterlassen. Kurz vor den Tötungshandlungen steht dann ein<br />
Schlüsselereignis, das von den Tätern als subjektiv bedeutend erlebte Niederlage<br />
empfunden wird. Diese Niederlagen gingen für Robert und Bastian mit einem<br />
besonderen Status- oder Beziehungsverlust einher. 209<br />
McGee und DeBernado sehen den Wunsch nach Rache als zentral an. „The<br />
primary motive of the Classroom Avenger’s attack is vengeance, while a<br />
secondary motive is achievment of notoriety.” 210 In ihren Phantasien planen sie<br />
die Tat bis ins kleinste Detail und selektieren schon im Vorfeld ihre Opfer. Wie<br />
im Kapitel 4 dieser Arbeit festgestellt wurde, geben beide Täter Hass und Wut als<br />
Ursache für ihre Amokläufe an. Diese Motive können im Nachhinein als<br />
vordergründig gesehen werden. Sie sind das Produkt einer langen Kette von<br />
negativen Erlebnissen im Leben der <strong>School</strong> Shooter, die auf Grund dessen einer<br />
näheren Erörterung bedürfen.<br />
207<br />
Vgl. Gallwitz, 2001, S.173f.<br />
208<br />
Vgl. Heitmeyer, 2003, S.15.<br />
209<br />
Vgl. Robertz, 2007, S.13<br />
210<br />
McGee/ DeBernado (2001), www.sheppardpratt.org/Documents/classavenger.pdf, 30.06.2007, S.9.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
Robert scheiterte in vielen seiner Lebensbereiche. Er konnte im schulischen<br />
Bereich keine Erfolgserlebnisse verzeichnen. Seinen Eltern schien eine höhere<br />
schulische Bildung so wichtig zu sein, dass er diesen von seinem Versagen nicht<br />
berichten kann. Auch war die Bindung zu ihnen zusätzlich belastet, sie wussten<br />
nichts über die fehlgeleitete Entwicklung ihres Sohnes und den Interessen, denen<br />
er sich immer verstärkter zuwendete. Er verschloss sich emotional und<br />
Auffälligkeiten und Problemfelder wurden nicht ausreichend thematisiert oder<br />
gelöst. Auch in seinen Freizeitinteressen, wie dem Handballsport konnte er, im<br />
Gegensatz zu seinem Bruder, den wahrgenommenen Erwartungen nicht<br />
standhalten.<br />
Bastian schaffte einen Schulabschluss, aber berichtete von prägenden<br />
Gewalterfahrungen in der Schule. Auf Grund von fehlender Sicherheit und<br />
stabilen Bindungen, wussten die Eltern nichts über die starke Bedeutung der<br />
negativen Schulerlebnisse. Seine aufgestauten Frustrationen ließ er in seinen<br />
Hobbies raus. Veränderungen in der Persönlichkeit wurden auch bei ihm nicht<br />
hinreichend wahrgenommen und thematisiert.<br />
Gesellschaftlich anerkannte Werte wie Leistung, Durchsetzungsvermögen und<br />
sozialer Aufstieg setzte beide Jugendliche hohem Druck aus. 211 Diesem konnten<br />
sie scheinbar nicht standhalten. Als besonders tiefgreifendes, negatives Erlebnis<br />
kann bei Robert der letztendliche Schulverweis gesehen werden. Die unmittelbare<br />
schulische Vorgeschichte bei Robert zeigt, dass die Selektion innerhalb der<br />
Schule bei ihm zu einer Perspektivlosigkeit in Bezug auf seine Zukunft führte. Er<br />
versagte in einem Bereich, der von seinen Eltern als wichtig angesehen wurde.<br />
Auf Grund seiner zahlreichen Versuche Anerkennung über die Erfüllung<br />
verinnerlichter wichtiger Statuspositionen zu erreichen, erlebte er den<br />
Schulverweis als besonders schwerwiegend. Bastian stand vor einer drohenden<br />
Gerichtsverhandlung. Seinen Status oder vielmehr den Wert seiner Persönlichkeit<br />
definierte er über seine Freizeitaktivitäten. Waffen fanden dabei eine besondere<br />
Bedeutung, deren Verlust als mögliches Ergebnis der Gerichtsverhandlung, für<br />
ihn einen besonders hohen Schweregrad besaß.<br />
Fehlende Anerkennung im realen Leben verhindert die Entwicklung einer<br />
gesicherten Ich-Identität. 212 Bastian und Robert bündelten ihre Kränkungen in den<br />
211<br />
Vgl. Heitmeyer, 2003, S.16.<br />
212<br />
Vgl. Mikos, 2003, S.67.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
unterschiedlichen Lebensbereichen und transferierten sie auf die Schule. Sie<br />
wurde zum Sinnbild für Kränkungen und negative Situationen im Leben, daher<br />
auch ihre Opferauswahl. Symbolisch für den Lebensbereich, den beide als<br />
besonders negativ interpretierten, wurden die Opfer bewusst gewählt. Sie sind als<br />
Bindeglieder zu sehen, die als ausführende Organe in dem System Schule<br />
arbeiten.<br />
Eisenberg bezeichnet den Einfluss vorhergehender Ereignisse als<br />
Entgesellschaftung. 213 Jugendliche reagieren auf negative Erfahrungen zunächst<br />
nur auf kognitiver Ebene, nicht jedoch aktiv handelnd.<br />
„Gesellschaftliche Konflikte werden reprivatisiert und stauen sich in einem<br />
seelischen Innenraum, der für das Austragen solcher Ereignisse ungeeignet ist.<br />
[...] Hinter den Bildern aktuell erfahrener Kränkungen tauchen Bilder aus der<br />
lebensgeschichtlichen Vergangenheit auf [...]. Wie ein Verstärker schließen<br />
sich uralte Kränkungs- und Zurückweisungserfahrungen an die aktuellen<br />
Demütigungen an und verleihen diesen so erst ihre Wucht.“ 214<br />
Nach einem langen Prozess innerer Aufstauung, ist dann eine aktuell als<br />
besonders schwer empfundene Situation Auslöser für die Tötungshandlungen.<br />
Diese Meinung lässt sich auch in einer amerikanischen Studie wiederfinden. Sie<br />
geht davon aus, dass ein real erlebtes oder ein als solches empfundenes Ereignis<br />
als letztendliche Erlaubnis gesehen wird, ihren Plan in die Tat umzusetzen. 215<br />
Freerk Huisken gibt an, dass bei <strong>School</strong> Shootern falsche Vorstellungen über die<br />
Ursachen von Erfolg und Misserfolg vorliegen. 216 Die negativen Erlebnisse<br />
bündeln sich in dem einschneidenden negativen Erlebnis kurz vor den<br />
eigentlichen Tötungshandlungen. Die lange Reihe von negativ empfundenen<br />
Ereignissen hat bei den Tätern zur Auflösung des eigenen Selbstwertes geführt.<br />
Ausschlaggebend sieht er jedoch nicht das Erlebnis selbst, sondern die damit<br />
verbundenen Interpretationen der Täter an. Sie sehen darin die letztendliche<br />
Auflösung der Geltung ihrer Subjektivität. Der Wunsch, den eigenen Selbstwert<br />
zu retten, wird zum zentralen Lebensinhalt, der sich nur noch durch den Amoklauf<br />
als einzige Möglichkeit korrigieren lässt.<br />
Beeinflusst wird die Wahrnehmung von negativen Erlebnissen dadurch, dass<br />
schützende Faktoren bei jugendlichen Amokläufern nur schwach ausgeprägt<br />
213<br />
Vgl. Eisenberg, 2002, S.23f.<br />
214<br />
Eisenberg, 2002, S.24.<br />
215<br />
Vgl. McGee/ DeBernado (2001), www.sheppardpratt.org/Documents/classavenger.pdf, 30.06.2007, S.9f.<br />
216<br />
Vgl. Huisken, 2002, S.54.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
sind. 217 Fehlende Reaktionen aus dem näheren sozialen Umfeld verhindern den<br />
Jugendlichen zu erkennen, dass die Schädigung anderer Menschen kein<br />
akzeptables Lösungsmuster sein kann. Letztendlich kann gesagt werden, dass die<br />
Realisierung eines <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s nach einem Auslöser erfolgt. Dieser<br />
Auslöser liegt in einem schwerwiegenden Erlebnis kurz vor der eigentlichen Tat.<br />
Die betroffenen Jugendlichen bewerten das Erlebnis subjektiv oftmals als<br />
schweren Verlust oder Niederlage, welches letztendlich als Verlust der letzten<br />
funktionalen sozialen Beziehung gesehen werden kann.<br />
5.3 Einfluss von Computerspielen auf <strong>School</strong> Shooter<br />
Nach den einzelnen Amokläufen zentrierten sich gerade die<br />
Medienberichterstattung und die politischen Diskussionen darauf, Ego-Shooter,<br />
wie das Spiel „Counterstrike“, als Ursache für Amokläufe heranzuziehen. 218<br />
Deterministische Vorstellungen, bei denen Computerspiele als Ursache für <strong>School</strong><br />
<strong>Shooting</strong> herangezogen werden, sind als zu eindimensional zu betrachten. Eine<br />
einfache Ursache–Wirkung Kausalität erweist sich bei der Bearbeitung in allen<br />
einflussnehmenden Aspekten als zu kurzsichtig. Die Debatte, ob Computerspiele<br />
Auslöser für Gewalt sind würde in dieser Arbeit zu weit führen, denn die<br />
Ergebnisse dazu gestalten sich selbst innerhalb der Medienforschung zum Teil<br />
divergent. Eine eindeutige Antwort darauf kann bei dem heutigen<br />
Forschungsstand nicht gegeben werden.<br />
Dennoch ist auffällig, dass sich beide untersuchten <strong>School</strong> Shooter in ihrer<br />
Freizeit mit dem Spielen von Computerspielen beschäftigten, die sich durch<br />
gewalttätige Inhalte auszeichneten. Ein Einflussnahme der Spiele, die sich auf<br />
Grund ihrer Konzipierung durch Macht und Kontrolle auszeichnen, sind gerade in<br />
Bezug auf die bereits erörterten negativen Persönlichkeitstendenzen nicht von der<br />
Hand zu weisen. Daher erfolgt in diesem Punkt eine Betrachtung der<br />
Spielmotivation und der Spielauswahl in Hinblick auf eine Verbindung zwischen<br />
der Wahrnehmung virtueller und realer Wirklichkeiten und deren Auswirkungen<br />
217<br />
Vgl. Robertz, 2007, S.17.<br />
218<br />
Vgl. Brinkbäumer, u.a., 2002, S.131.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
auf die Persönlichkeit und mögliche Einstellungsänderungen bei Robert<br />
Steinhäuser und Bastian Bosse.<br />
5.3.1 Spielmotivation und Spielauswahl<br />
Um sich die Wirkung von Computerspielen bewusst zu machen, muss an dieser<br />
Stelle zunächst einmal auf die Spielmotivation und spezielle Spielauswahl der<br />
Spieler eingegangen werden.<br />
In den Ergebnissen verschiedener Studien wird als Anlass des Spielens zum einen<br />
Langeweile genannt und damit einhergehend der Wunsch nach Unterhaltung.<br />
Weitere Anlässe sind Ärger und Wut, woraus der Wunsch nach Stressabbau<br />
entsteht. 219 Dieses scheint auch bei Bastian und Robert der Fall gewesen zu sein.<br />
Sie instrumentalisierten das Computerspiel und nutzten es, um ihren Stress<br />
abzubauen. Die gesteigerte Flucht in virtuelle Welten verhalf ihnen die realen<br />
Konflikte erst einmal zu verdrängen. Denn innerhalb dieser virtuellen Welt<br />
erlebten sie sich durch die darin enthaltenen Gewalthandlungen als machtvoll.<br />
Beleuchtet man die Erscheinungsform und das Wesen von Computerspielen im<br />
Allgemeinen, so kann das zentrale Motiv der Spiele sicherlich in dem Wunsch<br />
nach Erfolg gesehen werden. 220 Erfolg bedeutet Macht, Herrschaft oder Kontrolle<br />
über eine reduzierte virtuelle Realität. Durch intensive Nutzung kann eine<br />
Verschiebung in Richtung spezieller dynamischer Muster entstehen, welche dann<br />
Auswirkungen auf Handlungen in der realen Welt haben. Die von Robert und<br />
Bastian ausgewählten Spiele beinhalteten in besonderer Weise die Nutzung von<br />
Macht und Kontrolle. Sie bevorzugten in erster Linie Spiele, die ein hohes<br />
Gewaltpotenzial bieten und sich, auf Grund ihrer Konzipierung, durch das Töten<br />
virtueller Personen auszeichnet.<br />
Einige Autoren gehen davon aus, dass die Auswahl der Spieler die Verknüpfung<br />
von Lebenswelt und virtueller Welt bedeutet, die sich beim Spieler schon in der<br />
Auswahl spezifischer Spielgenres zeigt. 221 Wird ein Spiel ausgewählt, so werden<br />
Strukturen der Lebenswelt des Spielers mit den Strukturen des Computerspiels in<br />
219<br />
Vgl. Ladas, 2002, S.93f.<br />
220<br />
Vgl. Fritz, 1997b, S.83.<br />
221<br />
Vgl. Fritz/ Fehr, 2003b, S.21ff./ Ladas, 2002, S.94ff.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
Beziehung gesetzt. Fritz sieht die primäre Motivation Computerspiele zu spielen<br />
in der Kopplung zwischen Computerspiel und sonstiger Lebenswelt. 222<br />
Bei der strukturellen Kopplung werden Spiele anhand von realen<br />
Persönlichkeitsmerkmalen, der Lebenssituation, den Interessen und den Vorlieben<br />
ausgewählt. Es werden demnach Computerspiele bevorzugt, in denen bereits<br />
Bekanntes assoziiert werden kann. Wählt der Spieler Spielstrukturen, dessen<br />
Strukturen sich nicht einfach in der realen Welt umsetzen lassen, aber von ihm<br />
gewünscht werden, wird das kompensatorische Kopplung genannt. 223<br />
Mikos sieht allgemein beim Konsum von Computerspielen keinen direkten<br />
Zusammenhang „[...] zwischen den symbolischen Darstellungen der<br />
verschiedenen Medien und Taten in der sozialen Wirklichkeit [...].“ 224 Aber die<br />
<strong>School</strong> Shooter suchen sich aus den bestehenden Angeboten der Medien die<br />
heraus, die ihnen für ihre Problemsituationen und ihre emotionalen Empfindungen<br />
am dienlichsten erscheinen. Bereits im Vorfeld muss ein Geflecht an<br />
Bedingungen vorhanden sein, damit sich eine Fokussierung auf gewaltvolle Spiele<br />
verstärkend auf die Tatabsicht auswirkt. Die Spielauswahl wird zum Indikator und<br />
Verstärker für kritische Lebensentwürfe und der kognitiven und emotionalen<br />
Befindlichkeit. Die Rolle der Computerspiele kann sicherlich nicht darin gesehen<br />
werden, dass sie selbst neue Einstellungen schaffen, aber sie wirken<br />
einstellungsverstärkend, falls gewisse Grundvoraussetzungen dafür, ähnlich<br />
gerichtete Voreinstellungen oder Dispositionen bereits vorhanden sind. Daher<br />
wird nach den Erläuterungen zur Motivation des Spielens im nächsten Punkt der<br />
Arbeit, der Blick auf die von Robert und Bastian ausgewählten Computerspiele<br />
gerichtet.<br />
5.3.2 Ego-Shooter<br />
Bei den untersuchten Amokläufern wurden nach der Tat eine Vielzahl von<br />
Computerspielen gefunden, die zum Gebiet der sogenannten Ego-Shooter<br />
gehören. Ego-Shooter fallen in den Bereich der Actionspiele. In der heutigen Zeit<br />
222<br />
Vgl. Fritz, 2003b, S.1ff.<br />
223<br />
Vgl. Fritz/ Fehr, 2003a, S.1.<br />
224<br />
Mikos, 2003, S.68.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
wird der Markt an Actionspielen stark durch 3D–Actionspiele, auch 3D–Shooter<br />
genannt, bestimmt. 225 In vielen Computerzeitschriften wird weiterhin noch<br />
zwischen einzelnen Unterkategorien unterschieden. Die Einteilung erfolgt unter<br />
anderem nach der Anzahlmöglichkeit der Spieler (Single- oder Multiplayer) oder<br />
den unterschiedlichen Nuancen in den Aufgaben der einzelnen Spiele, wie ein<br />
stärkerer Fokus auf Militärszenarien, Science Fiction, Fantasy/ Horror oder<br />
Action. Dabei handelt es sich aber ausnahmslos um Spielkonzepte, in denen der<br />
Spieler sich durch unterschiedliche Spielwelten kämpft. Man unterscheidet<br />
zwischen zwei Arten von Shootern. 226 Die Bezeichnung First–Person-Shootern<br />
(FPS) ergibt sich aus der perspektivischen Einstellung des Spielers. Aus der Ich-<br />
Perspektive heraus nimmt der Spieler seine Umwelt wahr und sieht sozusagen<br />
durch die Augen der Spielfigur. Bei Third-Person-Shootern (TPS) verfolgt der<br />
Spieler das Geschehen aus einer dritten Perspektive heraus, mit Ansicht auf die<br />
gespielte Figur. Im Mittelpunkt der Ausführungen stehen an dieser Stelle Ego-<br />
Shooter aus der FPS, die auf Grund der perspektivischen Sicht den Spieler selbst<br />
stärker in die Handlungen einbinden.<br />
Das Spielgenre von Ego-Shootern zeichnet sich durch Gewaltdarstellungen und<br />
aggressive Handlungsmuster aus, die in den einzelnen Spielwelten notwendig<br />
sind, um erfolgreich zu sein. 227 Zentrales Spielelement ist das Erschießen der<br />
Gegner, wobei der Spieler immer auf ein großes Arsenal an Waffen zurückgreifen<br />
kann, die er während des Spielverlaufes findet. Zur Erledigung der Spielaufgaben<br />
müssen in allen Ego-Shootern bis zum Ende des Spieles sehr viele Gegner vom<br />
Spieler eliminiert werden. Das Spielende wird erreicht indem der Spieler das Ende<br />
eines bestimmten Spielabschnitts (Level) erreicht, dessen Logik vom jeweiligen<br />
Spielgeschehen abhängig ist. In den meisten Spielen handelt es sich um die<br />
Erfüllung eines Auftrages, den der Spieler zu Beginn gestellt bekommt.<br />
Ebenso kann zwischen zwei unterschiedlichen Spielmodi, dem Singleplayer<br />
Modus und dem Multiplayer Modus unterschieden werden. 228 Im Singleplayer<br />
Modus wird gegen computergesteuerte Gegner (Bots) gespielt. Der Multiplayer<br />
Modus wird mit anderen realen Spielern gemeinsam in lokalen Netzwerken (LAN<br />
= Local Area Network) oder über das Internet gespielt. Es kann zwischen<br />
225<br />
Vgl. Ladas, 2002, S.48.<br />
226<br />
Vgl. Herberer/ Höhler/ Müller, 2007, S.147.<br />
227<br />
Vgl. Witting/ Esser, 2003b, S.1.<br />
228<br />
Vgl. Herberer/ Höhler/ Müller, 2007, S.149f. ; Vgl. Witting/ Esser, 2003, S.1f.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
mehreren Kampfoptionen gewählt werden. Beim „Deathmatch“ kämpft jeder<br />
Spieler für sich selbst, beim „Clan-War“ oder auch „Team-Deathmatch“ treten<br />
gegnerische Mannschaften gegeneinander an und unter dem Begriff „Capture the<br />
Flag“ muss als Spielziel die Fahne eines gegnerischen Teams erobert werden.<br />
Der Spieler ist auf Grund der Spielgestaltung permanenten Bedrohungen<br />
ausgesetzt und steht somit unter ständigem Handlungsdruck.<br />
„Ego-Shooter ziehen die Spieler durch eine hohe Handlungsdichte, die<br />
permanente Bedrohungssituation und die fingierte subjektive Wahrnehmung<br />
des Spielers in ihren Bann.“ 229<br />
Bei Robert und Bastian wurden unter anderem Ego-Shooter gefunden, die mit zu<br />
den populärsten Spielen dieses Genres gehören, wie „Return to Castle<br />
Wolfenstein“, „Quake“, „Half Life“, „Counterstrike“, „Unreal Tournament“ oder<br />
„Medal of Honor“. Wie der Vorgänger „DOOM“, der als Urvater im Bereich der<br />
Ego-Shooter gilt, spielen auch seine Nachfolger wie „Quake 1“, „Quake 2“, oder<br />
„Quake 3“ im Science Fiction Ambiente. „Medal of Honor“ oder „Return to<br />
Castle Wolfenstein“ orientieren sich in ihrer Aufmachung an Kriegsszenarien. 230<br />
Einige der Spiele, die bei beiden Tätern gefunden wurden, sind in Deutschland<br />
indiziert. Bei einer Indizierung von Spielen dürfen die betroffenen Spiele weder<br />
beworben, noch offen ausgestellt werden und die Abgabe darf nur an Personen<br />
über 18 Jahre erfolgen. Die Indizierung von Computerspielen erfolgt in<br />
Deutschland bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdete Medien (BPjM), die<br />
Anfrage auf Indizierung muss allerdings durch Dritte veranlasst werden. 231<br />
Auch ungekürzte Versionen der oben genannten Spiele „Half-Life“, „Medal of<br />
Honor“, die US Versionen von Quake oder englische und deutsche Fassungen von<br />
„Return to Castle Wolfenstein“ und „Unreal Tournament“ sind in Deutschland<br />
indiziert. Wobei zu erwähnen ist, das Robert und Bastian zur Tatzeit selbst schon<br />
volljährig waren. Angaben, wann sie diese Spiele gekauft haben, konnten nicht<br />
ermittelt werden.<br />
„Half Life“ bindet den Spieler besonders in eine Geschichte ein. Der gespielte<br />
Charakter ist ein normaler Mensch, wobei durch die interaktive Beteiligung der<br />
Identifikationsgrad mit dem Hauptcharakter um ein vielfaches erhöht wird.<br />
229<br />
Vgl. Herberer/ Höhler/ Müller, 2007, S.149.<br />
230<br />
Vgl. Wiemken, 2003, S.2ff.<br />
231<br />
Vgl. Herberer/ Höhler/ Müller, 2007, S.151f.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
„Counterstrike“, ursprünglich eine kostenlose Modifikation von Half Life, ist<br />
einer der erfolgreichsten Online-First-Person-Shooter weltweit. 232<br />
Dieses Spiel rückte nach dem Amoklauf von Robert Steinhäuser stark in den<br />
Blickpunkt der Öffentlichkeit und wurde ebenfalls durch die BPjM geprüft. Eine<br />
Indizierung wurde allerdings nicht vorgenommen, da die Kommunikation der<br />
Spieler untereinander und die strategischen Spielmöglichkeiten als positive<br />
sozialisatorische Aspekte bewertet wurden. Auf Grund des Mehrspielermodus<br />
müssen die Spieler soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit einsetzen um<br />
gemeinsam zum Ziel zu kommen. „Counterstrike“ war das einzige Spiel, dass<br />
nach seinem Amoklauf auf dem Computer von Bastian installiert war. Es ist als<br />
Mannschaftsspiel zu sehen, bei denen eine Gruppe die Rolle von Terroristen<br />
einnimmt und gegen eine andere Gruppe, die eine Spezialeinheit der Polizei<br />
(Counterstriker) darstellt, kämpft. Das Besondere an diesem Spiel ist die<br />
detailgenaue und fast realistische Nachbildung realer Waffen worauf im späteren<br />
Verlauf dieser Arbeit noch näher eingegangen wird.<br />
Hervorzuheben ist, dass er dieses Spiel mehrmals selbst bearbeitet hatte. So hatte<br />
Bastian zwei Level erstellt, bei denen die „Maps“ (Landkarten) der Geschwister-<br />
Scholl-Realschule nachempfunden worden waren. 233 Der Erstellung dieser<br />
Landkarten muss Bastian viel Zeit gewidmet haben, um eine möglichst<br />
detailgetreue Widergabe der Schule zu erstellen.<br />
Die stetige Verbesserung der visuellen Darstellung lässt Ego-Shooter immer<br />
realistischer wirken und zusätzliche „Engines“ (Programmierungscodes) in<br />
einigen Spielen bieten dem Spieler die Möglichkeit, eigene „Maps“ kreativ nach<br />
eigenen Vorstellungen zu gestalten. Durch die Erstellung eigener<br />
Spiellandschaften wird unter anderem eine stärkere persönliche Bindung der<br />
Spieler zu ihrem Spiel erreicht. 234<br />
Robertz und Wickenhäuser weisen in diesem Zusammenhang auf die Gefahr hin,<br />
die von Ego-Shootern ausgeht. 235 Wesentlich ist, dass in Bezug auf die Rolle der<br />
Phantasieentwicklung gefährdeter Jugendlicher es geschehen kann, dass Spiele<br />
den Status einer Ersatzwelt erlangen. Über Macht innerhalb der virtuellen Welt,<br />
erhalten sie eine Scheinbestätigung. Daraus kann das Bedürfnis entstehen, diese<br />
232<br />
Vgl. ebenda, S.153ff.<br />
233<br />
Vgl. Engels, 2007, S.42f.<br />
234<br />
Vgl. Gieselmann, 2002, S.64f.<br />
235<br />
Vgl. Robertz/ Wickenhäuser (09.12.2006), www.heise.de/tp/r4/24/24173/1.html, 19.09.2007.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
Macht und Scheinselbstständigkeit in der realen Welt umsetzen zu wollen. Diese<br />
These verweist auf einen möglichen Transfer zwischen der virtuellen und realen<br />
Welt. Auf die Möglichkeit eines solchen Transfers wird nun anschließend im<br />
nächsten Punkt dieser Arbeit eingegangen.<br />
5.3.3 Transfer zwischen virtueller und realer Wirklichkeit<br />
Innerhalb der wissenschaftlichen Forschung bestehen mehrere Ansätze über<br />
Zusammenhänge zwischen Medien und Realität. Daher wird in diesem Punkt auf<br />
Zusammenhänge zwischen realer und virtueller Wirklichkeit eingegangen. Falls<br />
eine Verbindung und damit eine Transfermöglichkeit besteht, wird diskutiert, ob<br />
sich diese auch in den Amokläufen von Robert und Bastian wiederfinden lassen.<br />
Um eine Herangehensweise in der Bearbeitung der virtuellen und realen<br />
Wirklichkeit festlegen zu können, wird die Sichtweise der Wirklichkeit aus<br />
konstruktivistischer Sicht herangezogen.<br />
Der Konstruktivismus unterscheidet sich von anderen Ansätzen im Wesentlichen<br />
durch die Annahme, dass die Wirklichkeit an sich nicht existiert. Welten werden<br />
demnach als kognitive Systeme betrachtet. Fritz definiert die Wirklichkeit als<br />
begriffliches Konstrukt, dass der Mensch durch seine Wahrnehmung nicht<br />
erfahren kann. 236 Die gesamte Darstellung der ablaufenden Prozesse, die im Falle<br />
der konstruierten Wirklichkeit im Gehirn ablaufen, würde im Rahmen dieser<br />
Arbeit zu weit führen, so dass mit dem folgenden Zitat von Jürgen Fritz an dieser<br />
Stelle ein kleiner Einblick darüber erfolgt.<br />
„Unsere Sinnesempfindungen entstehen nicht in den Sinnesorganen, sondern<br />
im Gehirn und zwar als Ergebnis eines internen Verarbeitungsprozesses. Das<br />
menschliche Gehirn ist nicht offen, sondern ein in sich abgeschlossenes<br />
System. Es deutet und bewertet nach selbst entwickelten Kriterien neuronale<br />
Signale, von deren „wahrer“ Herkunft und Bedeutung es im absoluten Sinne<br />
nichts weiß. Die von uns durch die Wahrnehmung erschlossene sinnliche Welt<br />
ist demnach ein Konstrukt unseres Gehirns. Die uns zugängliche Welt scheint<br />
uns so, weil das Gehirn seine Elemente zu unserer Realität zusammengefügt<br />
hat.“ 237<br />
236<br />
Vgl. Fritz, 1997a, S. 13ff.<br />
237<br />
Fritz, 2003a, S.2.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
Die Lebenswelt wird in sechs unterschiedliche Welten gegliedert, in denen<br />
Menschen integriert sind und in denen sie leben und zwar die reale Welt, die<br />
Traumwelt, die mentale Welt, die Spielwelt, die mediale Welt und die virtuelle<br />
Welt. 238 Die Gesamtheit aller kognitiven Konstrukte ergibt das, was der Mensch<br />
als seine individuelle Lebenswelt empfindet. In welcher Welt man sich befindet<br />
wird durch die Aufmerksamkeit des Individuums gelenkt. Trotzdem werden die<br />
Trennungen zwischen den einzelnen Welten als durchlässig angesehen, da es an<br />
vielen Stellen zu Überschneidungen oder Diffusion kommen kann. Wird die<br />
Aufmerksamkeit des Individuums geteilt, kann es sich demnach gleichzeitig in<br />
verschiedenen Realitäten befinden. Um die Welten mit ihren jeweiligen<br />
Reizeindrücken ordnen und differenzieren zu können, entwickelt der Mensch in<br />
aktiver Auseinandersetzung mit den Welten Handlungskompetenzen. Sie<br />
ermöglichen es individuelle Rahmen für die Welten festzulegen. Mit Hilfe von<br />
individuellen Handlungskompetenzen können Sachverhalte und Schemata<br />
kontrolliert werden. Die Sachverhalte und Schemata besitzen in den einzelnen<br />
Welten ihre Gültigkeit, sind aber nicht immer übertragbar. Ebenso kann ein<br />
möglicher Transfer zwischen den Welten kontrolliert werden. 239<br />
Von hoher Bedeutung ist im Zusammenhang zum Thema dieser Arbeit, die<br />
Verbindung von realer Welt und mentaler Welt, sowie der virtuellen Welt. 240<br />
Zwar ist auch die reale Welt als Konstrukt des Individuums zu betrachten, aber sie<br />
unterscheidet sich in der Bedeutung für das Überleben des Menschen von den<br />
anderen. Reale Gefahren können Individuen in ihrer Existenz bedrohen und<br />
werden dahingehend in ihren Auswirkungen als wesentlich erheblicher angesehen<br />
als Gefahren in den anderen Welten. Innerhalb der mentalen Welt finden geistige<br />
Vorstellungen des Menschen statt, die nicht zur aktuellen Wahrnehmung gehören.<br />
Dazu gehören Vorstellungsbilder, die Planung zukünftiger oder die Analyse<br />
vorheriger Ereignisse. Die mentale Welt ist bewusst und das Individuum<br />
konstruiert in ihr die eigenen Vorstellungen und Phantasiewelten. Fritz geht davon<br />
aus, dass zwischen der mentalen und der realen Welt kein Handlungsbezug<br />
besteht, aber dass die mentale Welt Impulse für eine Umsetzung in der realen<br />
Welt liefern kann. 241 Die virtuelle Welt zeichnet sich besonders durch die aktive<br />
238<br />
Vgl. Fritz, 1997a,S.15ff.<br />
239<br />
Vgl. Fritz, 1997a, S.21f.<br />
240<br />
Vgl. Ladas, 2002, S.76f.<br />
241<br />
Vgl. Fritz, 1997a, S.18f.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
Teilhabe des Individuums aus. Innerhalb der virtuellen Welt handelt der Spieler<br />
und verändert sie gegebenenfalls. Im Vergleich zur realen Welt, haben mentale<br />
und virtuelle Welten gemeinsam, dass der Mensch sie wieder verlassen kann.<br />
Handlungen und deren Auswirkungen auf die reale Welt sind begrenzt. So haben<br />
Tötungsphantasien in der mentalen Welt oder Tötungen in der virtuellen Welt<br />
keine Auswirkungen auf die reale Welt.<br />
An dieser Stelle kann innerhalb von <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s ein Transfer zur Bedeutung<br />
der Phantasieentwicklung gezogen werden. Wenn virtuelle, reale und mentale<br />
Welten ineinander übergreifen können und man die Amokläufe von Bastian und<br />
Robert betrachtet, erscheint der Transfer, oder eine Übertragung von virtueller<br />
Welt in die reale Welt möglich. Beide Täter können in Bezug auf ihre<br />
Persönlichkeit schon im Vorfeld als gefährdet angesehen werden. Durch das<br />
Töten in der virtuellen Welt erhielten sie eine Art Ersatzbestätigung. 242 Der<br />
Wunsch nach Macht und Kontrolle kann dann auf die reale Welt transferiert<br />
werden, um auch hier das Fehlende zu erlangen. Setzen sich die Verletzungen und<br />
Versagungen im realen Leben immer weiter fort, kann in Einzelfällen der Wunsch<br />
nach Realisierung der Spielinhalte auftreten. Bedeutend ist die Aussage, dass ein<br />
Transfer immer auch eine Transformation beinhalten muss. Innerhalb von<br />
Transferprozessen werden nur Reizkonfigurationen übertragen, die auf bestehende<br />
Schemata angeglichen werden.<br />
„Damit sich überhaupt Schemata bilden und diese Schemata Bedeutung für<br />
neue Situationen erlangen können, ist eine „Abstraktionsleistung“ im<br />
menschlichen Gehirn notwendig. Die konkrete Reizsituation mit ihrer Fülle an<br />
Details und Besonderheiten muss „transformiert“ werden auf Muster und<br />
Strukturen, die sich in das neuronale Netz des menschlichen Gehirns<br />
„einweben“ lassen.“ 243<br />
Geschehnisse in der virtuellen Welt müssen demnach erst einmal vom Spieler als<br />
wichtig und interessant angesehen werden. Ist die Aufmerksamkeit des Spielers<br />
groß genug, werden durch das Geschehen auf dem Bildschirm viele Erinnerungen<br />
ausgelöst, die im weiteren Verlauf als immer zusammenhängender und sinnvoller<br />
erlebt werden. Dabei fließen sowohl Kognitionen und Emotionen aus<br />
verschiedenen Zeitebenen des Spielers mit ein. Der Prozess des Erinnerns ist dann<br />
entscheidend, ob der Spieler in der virtuellen Welt bleibt. Ist das der Fall kommt<br />
242<br />
Vgl. Robertz/ Wickenhäuser (09.12.2006), www.heise.de/tp/r4/artikel/24/24173/1.html, 19.09.2007.<br />
243<br />
Fritz, 1997c, S.230.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
es zu einer emotionalen Inanspruchnahme, die sich nach Fritz durch Stress und<br />
Flow ausdrücken kann. 244 Die Aufmerksamkeit des Spielers bleibt konstant und<br />
das Spiel kann Spuren hinterlassen, die in andere Welten transferiert werden<br />
können. Diese Spuren sind Schemata, in denen sich aufgrund von<br />
Gemeinsamkeiten viele einzelne Wahrnehmungen und Erfahrungen verdichtet<br />
haben. Sie strukturieren die Gesamtheit und verringern Komplexität, gleichzeitig<br />
konstruieren sie die Wahrnehmung.<br />
Weiterhin wird zwischen verschiedenen Abstraktionsebenen unterschieden, auf<br />
denen sich die transferierten Schemata anordnen lassen. Die Ebenen haben alle<br />
unterschiedliche Transfermöglichkeiten. 245<br />
Zum Beispiel auf der metaphorischen Ebene lassen sich symbolisch-funktionale<br />
Schemata finden. 246 Sie beinhalten keine konkreten Handlungen sondern<br />
übergeordnete typische Strukturen. Der Transfer auf dieser Ebene erfolgt auf einer<br />
höheren abstrakten Ebene und besitzt eine gute Transfereignung, denn<br />
verschiedene Situationen oder Dinge können sich durchaus als strukturell ähnlich<br />
erweisen und daher metaphorisch verbunden werden. In Bezug auf<br />
Computerspiele bedeutet dies, dass die Präferenz bestimmter Computerspiele auf<br />
metaphorischer Ebene eine Verbindung zu der konkreten Lebenssituation<br />
aufweisen kann. Als weiteres Beispiel besitzt die dynamische Ebene keinen<br />
Handlungs- oder Sachbezug, sie zeichnet sich durch Motivation und<br />
handlungsorientierte Grundmuster aus. 247 Diese sind im Gegensatz zur realen Welt<br />
in der virtuellen Welt begrenzt und erscheinen bei Computerspielen als<br />
grundlegende Botschaften wie Macht, Herrschaft oder Kontrolle. Wie bereits<br />
erwähnt wurde kann Erfolg in Computerspielen mit diesen grundlegenden<br />
Botschaften gleichgesetzt werden. Eine intensive Nutzung kann eine<br />
Verschiebung in Richtung spezieller dynamischer Muster bewirken, die dann<br />
Auswirkungen auf Handlungen in der realen Welt haben. 248<br />
Im Zusammenhang zu Computerspielen unterscheiden Witting und Esser<br />
zusätzlich verschiedene einflussnehmende Transferformen. 249 Diese<br />
berücksichtigen sowohl individuelle Faktoren der Spieler, als auch<br />
244<br />
Vgl. Fritz, 2003c, S.4.<br />
245<br />
Vgl. Fritz, 1997c, S.232ff.; Vgl. Ladas, 2002, S.86f.; Vgl. Witting/ Esser 1997, S247ff.<br />
246<br />
Vgl. Fritz, 1997c, S.235f.<br />
247<br />
Vgl. ebenda, S.236f.<br />
248<br />
Vgl. ebenda, S.231ff.<br />
249<br />
Vgl. Witting/ Esser, 2003a, S.30ff.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
mediumabhängige. Die Ergebnisse wurden auf extreme Gewalthandlungen<br />
bezogen und sie kommen dabei zu einem ähnlichen Ergebnis wie Robertz und<br />
Wickenhäuser. 250 Demnach werden Versagens- und Existenzängste durch Macht-<br />
und Erfolgserlebnisse in der virtuellen Welt kompensiert. Eine Identifizierung mit<br />
den virtuellen Helden zeigt sich durch Ähnlichkeiten in der Kleidung als auch in<br />
den Waffen der Täter.<br />
Zentral ist, dass bei Robert und Bastian ein Transfer auf verschiedenen Ebenen<br />
zwischen virtueller Welt und realer Welt stattgefunden haben muss. Beeinflusst<br />
wurde die Wahrnehmung der realen Welt und individuelle verhaltenskulturelle<br />
Entwicklungen. Sie konnten nicht mehr zwischen Handlungen in der realen und<br />
virtuellen Welt und darauf folgenden Konsequenzen unterscheiden. Das einseitige<br />
Spielinteresse und ihre Spielmotivationen waren Spiegel ihrer bereits bestehenden<br />
gefährdeten Persönlichkeiten. So wurden von ihnen unterbewusst und unkritisch<br />
Einstellungen und Verhaltensweisen auf die reale Welt übertragen, mit tragischen<br />
Konsequenzen innerhalb der realen Welt.<br />
Auch Fritz und Fehr gehen von einer Faszinierung der Spieler aus, da reale<br />
Erlebnisse im Moment des Spielens ausgeblendet werden können und virtuelle<br />
Handlungen in der realen Welt folgenlos bleiben. Allerdings sehen sie einen<br />
direkten Transfer kritisch.<br />
„Die Ausübung virtueller Gewalt kann als Gefühl machtvoller Kompetenz und<br />
Überlegenheit erlebt werden. Ob damit die Gefahr besteht, reale Gewalt wie<br />
virtuelle wahrzunehmen, bleibt hingegen eine offene Forschungsfrage.“ 251<br />
Sie bestätigen damit die Annahme, dass die Ursachen nicht direkt in den Medien<br />
selbst liegen, sondern im realen Leben der Spieler.<br />
Die Computerspiele machen demnach nicht gewalttätiger, sondern ein intensiver<br />
Konsum kann dazu führen, dass kein angemessener Umgang mit Konflikten und<br />
Frustrationen entwickelt werden kann. Brisanz erhält das Spielen von<br />
Computerspielen mit besonders gewalttätigen Inhalten erst dann, wenn eine<br />
destruktive und dissoziale Phantasieentwicklung bei dem gefährdeten<br />
Jugendlichen vorliegt.<br />
Die Flucht aus der Realität in die virtuelle Ebene kann Einfluss auf die mentale<br />
Ebene und somit auf die Einstellung des Jugendlichen haben. Der exzessive<br />
250<br />
Vgl. Robertz/ Wickenhäuser (09.12.2006), www.heise.de/tp/r4/artikel/24/24173/1.html, 19.09.2007.<br />
251<br />
Fritz/Fehr, 2003, S.55.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
Computerspielkonsum und ein Mangel an sozialen Beziehungen kann dann als ein<br />
Symptom dafür gesehen werden, dass im Leben des Jugendlichen Problemfelder<br />
bestehen. Die Computerspiele sind somit aber nicht als Ursache, sondern als<br />
Ausdruck der Problemlage zu sehen.<br />
5.4 Zentrale Bedeutung der Schusswaffen<br />
Beide Täter waren zur Tatzeit schwer bewaffnet. Robert Steinhäuser führte zwei<br />
Schusswaffen und über 450 Patronen für die verschiedenen Waffen bei sich.<br />
Bastian Bosse trug drei Schusswaffen mit Munition und hatte zusätzlich<br />
Sprengkörper dabei, die er zum Teil an seinem Körper befestigt hatte.<br />
Sie verfügten während ihres <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> über eine Art Waffenarsenal.<br />
Zentral war die Verwendung verschiedener Schusswaffen und bei Bastian zudem<br />
der Einsatz von mehreren Sprengkörpern. Zieht man die verwendeten Waffen aus<br />
anderen bekannten <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s weltweit mit ein, so zeigt sich, dass gerade<br />
die Waffenauswahl bei jugendlichen Amokläufern in fast allen Fällen so gut wie<br />
identisch ist.<br />
Die Schusswaffennutzung wird zum zentralen Bestandteil der eigentlichen<br />
Tatausführung und unterstreicht die Gefährlichkeit der Tat im Falle von<br />
Amokläufen an Schulen.<br />
Untersucht werden Merkmale des Waffenerwerbs und der Waffennutzung, der<br />
mögliche Zusammenhang zu den Waffen in Ego-Shootern und im Anschluss<br />
daran die psychologische Bedeutung der Schusswaffen für <strong>School</strong> Shoootings. Es<br />
wird näher herausgearbeitet, was die Schusswaffenverwendung für die Fälle und<br />
für den Täter bedeutet und ob sich darin eine besondere Symbolik finden lässt.<br />
5.4.1 Waffenerwerb und Nutzung<br />
Die Analyse der Fälle in Emsdetten und Erfurt unterstreicht die Ergebnisse aus<br />
den bestehenden Studien. <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> zeichnet sich besonders durch den
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
zentralen Gebrauch von Schusswaffen aus. Zur Waffenverwendung ist es wichtig<br />
zu erwähnen, dass mit Zunahme der Gefährlichkeit der eingesetzten Waffen auch<br />
die Gefährlichkeit der Tat zunimmt. 252 Dabei werden Schusswaffen, Sprengsätze<br />
und insbesondere der Besitz eines Waffenarsenals aus Komponenten<br />
verschiedener Waffenarten, besondere Gefährlichkeit eingeräumt.<br />
Während Roberts Waffenerwerb legal über Händler und Handelsportale im<br />
Internet war, besorgte sich Bastian einen Teil seiner Waffen, die Munition und<br />
Materialien für die Sprengsätze legal über das Internet und eine Waffe illegal über<br />
einen Bekannten. Robert und Bastian begannen mit dem Kauf ihrer Waren schon<br />
bis zu einem halben Jahr vor dem <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>. Dies zeigt, dass sie sich<br />
sorgsam und systematisch schon längere Zeit im Vorfeld auf ihre Handlungen<br />
vorbereiteten und unterstreicht die Geplantheit der Tat. Füllgrabe sieht im<br />
systematischen Sammeln von Waffen eine Besonderheit bei Amokläufern, die sie<br />
von anderen Mördern unterscheidet. 253<br />
In den USA scheint ein Zusammenhang zwischen den steigenden Amokläufen an<br />
Schulen und der zunehmenden Erhältlichkeit von halbautomatischen<br />
Handfeuerwaffen und größeren Munitionsmagazinen zu bestehen. 254 Es wird aber<br />
auch darauf hingewiesen, dass die meisten Schüler zu jung waren, um sich selbst<br />
die Waffen legal zu besorgen. Dort besaßen in den meisten Fällen die Familien<br />
der Täter Waffen und damit hatten die meisten Täter schon im Vorfeld der Tat<br />
Zugang zu Waffen und diese bereits mehrmals benutzt. 255<br />
Grossman sieht jedoch eine leichte Gelegenheiten an Waffen zu gelangen nicht<br />
als mögliche Ursache für Amokläufe.<br />
„Oft wird der leichtere Zugang zu Waffen verantwortlich gemacht. Diese<br />
Zugänglichkeit ist niemals gut, aber sie kann nicht verantwortlich sein, denn<br />
Waffen sind ein konstanter Faktor in der Entwicklung der Gewalt in den USA<br />
gewesen.“ 256<br />
Seiner Meinung nach liegt die zentrale Ursache in den Medien und er gibt an, dass<br />
innerhalb der Medienforschung eine klare Kausalität zwischen Ursache und<br />
Wirkung von medialer und realer Gewalt besteht. 257 Allerdings wurde im<br />
252<br />
Vgl. Faust (no date), www.psychosoziale-gesundheit.net/seele/amok.html, 25.04.2007, S.33.<br />
253<br />
Vgl. Füllgrabe, 2000, S.228.<br />
254<br />
Vgl. Blumenstein, 2002, S.837.<br />
255<br />
Vgl. Vossekuil u.a. (2002), www.secretservice.gov/ntac/ssi_final_report.pdf, 20.04.2007, S.27f.; Vgl.<br />
O’Toole (1999), www.fbi.gov/publications/school/school2.pdf, 15.05.2007, S.21.<br />
256<br />
Grossmann/ DeGaetano, 2003, S.34.<br />
257<br />
Vgl.ebenda, 2003, S.37.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
vorherigen Punkt schon aufgezeigt, dass eine eindeutige Kausalität in Bezug auf<br />
Medien anhand des bisherigen Forschungsstandes nicht möglich ist, so dass seine<br />
Aussage weiterhin kritisch zu sehen ist.<br />
Es ist auffällig, dass in den USA die jugendlichen Amokläufer die Waffen oft von<br />
Verwandten oder Nachbarn stahlen, oder diese illegal/ mit Hilfe eines<br />
Strohmannes oder im Internet besorgten. Obwohl die vorherrschende Meinung<br />
dahin tendiert, dass Jugendliche in Deutschland schwerer an Waffen gelangen, hat<br />
sich ergeben, dass dies nicht unbedingt der Fall ist. 258<br />
Die beiden Vorfälle haben gezeigt, dass es auch in Deutschland nicht unmöglich<br />
ist, legal sowie illegal an Waffen zu gelangen. Sind sie erst einmal in<br />
Waffenbesitz, hat auch das Verbot des Mitführens einer Waffe kaum noch<br />
Einfluss. Ein leichter und schneller Zugang zu Waffen erhöht die<br />
Wahrscheinlichkeit, dass bei Suizidhandlungen Waffen eingesetzt werden. 259<br />
Adler kommt dazu in seiner Studie zu dem Ergebnis, das Handlungen, bei denen<br />
die Waffenbeschaffung im Vorfeld stattfand und im Nachhinein nachzuvollziehen<br />
war, viel gefährlicher verliefen. 260 Die Zahl der Verletzten lag nach seinen<br />
Ergebnissen dann wesentlich höher. Dies mag im Fall des Bastian zutreffen, bei<br />
Robert jedoch nicht. Obwohl die Tatvorbereitung gerade im Bereich der Waffen<br />
wesentlich intensiver verlief, als das bei Bastian der Fall war, sind die<br />
Todeszahlen der Opfer um ein vielfaches höher als die der Verletzten.<br />
Ursachen für die geringeren Zahlen können zum einen sicherlich darin liegen,<br />
dass Bastians negative Einstellungen sich zunächst viel stärker auf die gesamte<br />
Gesellschaft bezogen und sich dieses auch im wahllosen Umherschießen in seiner<br />
ehemaligen Schule widerspiegelte. Vielleicht ging es Bastian aber auch vielmehr<br />
darum Aufmerksamkeit durch sein Tun zu erlangen, als Rache an seiner<br />
ehemaligen Schule.<br />
Bastian begann sein Waffenarsenal gezielt zu kaufen beziehungsweise<br />
herzustellen. Auf Grund dessen wurde seine Phantasie gerade durch das<br />
Herstellen eigener Sprengsätze stark geprägt. Diese hätten im schlimmsten Falle<br />
besonders hohe Opferzahlen im Gegensatz zu einzelnen Waffen bedeutet. Das<br />
keine anderen Menschen bei seinem Amoklauf getötet wurden, kann demnach<br />
auch von einem externen zufälligen Faktor abhängen.<br />
258<br />
Vgl. Hoffmann, 2007, S.31.<br />
259<br />
Vgl. Faust (no date), www.psychosoziale-gesundheit.net/seele/amok.html, 25.04.2007, S.24.<br />
260<br />
Vgl. Adler, 2000, S.61f.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
Robert erwarb, während er sich schon gedanklich mit der Thematik des <strong>School</strong><br />
<strong>Shooting</strong> auseinander setzte, eine Waffenbescheinigung, die den Besitz<br />
bestimmter Waffen für ihn legalisierte. Er trainierte in einem Schützenverein und<br />
konnte mit den verwendeten Schusswaffen gut genug umgehen. 261 Bastian war<br />
kein Mitglied in einem Schützenverein und besaß auch keine Erlaubnis für den<br />
Waffenbesitz, konnte auf Grund seines Hobbys aber mit Waffenimitationen<br />
umgehen.<br />
Die Bedeutung von Computerspielen auf reale Gewalt wurde in dieser Arbeit<br />
bereits diskutiert. Im folgenden Punkt soll aber nun der Blick auf mögliche<br />
Parallelen zwischen den Waffen bei den Ego-Shootern und den Waffen, die<br />
Robert und Bastian verwendeten, gerichtet werden.<br />
5.4.2 Virtuelle Waffen und reale Waffenverwendung<br />
Schaut man sich die Waffenverwendung bei Robert und Bastian an, so fällt auf,<br />
dass diese starke Parallelen zu den verwendeten Waffen in den Ego-Shootern<br />
aufweisen, die beide gespielt haben. In vielen Spielen werden die Waffen sehr<br />
realgetreu simuliert. 262 Dazu können auf den Internetseiten von Spielen wie<br />
„Medal of Honor“, aber auch „Counterstrike“ detaillierte Informationen über die<br />
realen Vorbilder und zum Teil auch Abbildungen der realen Waffen eingesehen<br />
werden. Es gibt Informationen über technische Details, Angaben zu dem<br />
Herstellern und zum Einsatz der unterschiedlichen Waffen in der realen Welt.<br />
Selbst die Treffsicherheit und Schadenswirkung der virtuellen Waffen wird denen<br />
der realen nachempfunden und möglichst realistisch dargestellt.<br />
Einige Spiele unterteilen zudem den Körper der Gegner in verschiedene<br />
Trefferzonen, entsprechend der Schadenswirkung realer Verwundungen. Bei<br />
„Soldier of Fortune 2“, einem Spiel das auch bei Robert gefunden wurde, ist ein<br />
Kopfschuss wesentlich tödlicher, als ein Treffer in Arm oder Bein des Gegner.<br />
Viele der Spielentwickler geben an, dass bei der Entwicklung der Spiele entweder<br />
mit Personen zusammengearbeitet wurde, die das notwendige Wissen über den<br />
261<br />
Vgl. Gasser u.a. (2004),<br />
www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnasium.pdf,<br />
15.06.2007, S.321.<br />
262<br />
Vgl. Witting/ Esser, 2003b, S.3.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
Einsatz der Waffen besitzen oder Spielentwickler setzten sich im Rahmen der<br />
Vorbereitung selbst mit Waffen auseinander. So wurde für das Spiel „Soldier of<br />
Fortune“ mit einem ehemaligen Söldner zusammengearbeitet. Der Hauptcharakter<br />
in dem Spiel, John Mullin, ist der Person des Söldners im Namen und auch in<br />
seinem Aussehen nachempfunden.<br />
Beim Spiel „Counterstrike“ nahm der Programmierer Lee Goosemann in einem<br />
Schießstand selbst Unterricht mit verschiedenen Waffen. 263 Weitere<br />
Realitätsbezüge werden dadurch erreicht, dass zum Beispiel beim Internetauftritt<br />
des Spieles „Soldier of Fortune“ eine Verlinkung zur gleichnamigen<br />
Waffenzeitschrift besteht. 264 Auf der Seite der Waffenzeitschrift sind dann<br />
wiederum Links auf verschiedene Seiten amerikanischer<br />
Waffenrechtsorganisationen oder direkt auf Waffenshops zu finden.<br />
Das fundierte Wissen über Waffen, deren Einsatz und deren Auswirkung scheint<br />
bei Robert und Bastian demnach nicht nur aus ihrer Waffenaffinität, sondern auch<br />
aus ihren Erfahrungen innerhalb der Spiele zu stammen. 265 Auf den Seiten der<br />
Waffenshops können direkt Bestellungen realer Waffen erfolgen, was wiederum<br />
die getroffenen Aussagen aus dem vorherigen Punkt bestätigt. Die Gelegenheiten<br />
und Möglichkeiten an Waffen zu gelangen sind gegeben und trotz der<br />
bestehenden Rechtslage kann nicht gewährleistet werden, dass der Zugang<br />
Jugendlicher zu realen Waffen verwert bleibt. Es zeigt sich, dass der<br />
Realitätsbezug der Waffen eine der Werbestrategien vieler Spiele ist, um sich<br />
gegenüber anderen Konkurrenzprodukten durchzusetzen. Den Spielern wird<br />
suggeriert, dass die Realitätsnähe einen erhöhten Spielspass und gesteigerte<br />
Spannung bedeutet. Die Trennlinie zwischen realer und virtueller Welt wird aus<br />
Sicht der Spieler gesehen verringert. 266 Die virtuellen Waffen besitzen die<br />
gleichen Vor- und Nachteile wie reale Waffen, der Spieler muss diese<br />
gegeneinander abwägen und versuchen, für sich selbst die effektivste Waffe zu<br />
wählen. 267<br />
Die Auseinandersetzung mit den Waffen bedeutet, dass eine emotionale Bindung<br />
hergestellt wird. Trifft der Spieler die richtige Wahl und ist im Spiel erfolgreich,<br />
263<br />
Vgl. Herberer/ Höhler/ Müller, 2007, S.151ff.<br />
264<br />
Vgl. Witting/ Esser, 2003b, S.4.<br />
265<br />
Vgl. Gasser u.a. (2004), www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnasium.pdf,<br />
15.06.2007, S.337.<br />
266<br />
Vgl. Witting/ Esser, S.4f.<br />
267<br />
Vgl. Herberer/ Höhler/ Müller, 2007, S.154f.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
gestaltet sich die Bindung als besonders positiv. Er erlangt Wissen über reale<br />
Waffen und über deren Einsatzmöglichkeiten. Das kann ein verstärktes Interesse<br />
an Waffen in der realen Welt zur Folge haben. Die Verlinkungen auf Seiten der<br />
Spielerhersteller erleichtern einen Zugang zu Informationen und<br />
Beschaffungsmöglichkeiten in der realen Welt. Eine experimentelle Studie hat<br />
ergeben, dass Ego-Shooter Übungseffekte auf die Spieler haben. 268 Das Spielen<br />
von Ego-Shootern fördert die Erhöhung der Treffsicherheit und der<br />
Zielgenauigkeit. Zudem können sich durch die Übungen am Computer auch die<br />
Ergebnisse mit realen Waffen verbessern. Wichtig ist in diesem Punkt vor allem<br />
die Erkenntnis, dass auf Grund der Beschaffenheit der Spiele das Schießen selbst<br />
geübt werden kann, auch wenn es sich um virtuelle Realitäten handelt. Ein<br />
Transfer zwischen der positiven Bewertung der Waffen in der virtuellen Welt in<br />
die reale Welt, kann jedoch auf Grund des derzeitigen Forschungsstandes<br />
sicherlich noch nicht eindeutig bewiesen werden.<br />
5.4.3 Symbolwert der verwendeten Waffen<br />
Das Leben von Bastian und Robert wurde stark durch den Umgang mit Waffen in<br />
der realen Welt und der virtuellen Welt der Spiele bestimmt. Das mögliche<br />
Schlüsselereignis in Bastians Leben zeigt auf, dass er eine besonders enge<br />
Bindung zu Waffen entwickelt hatte, die durch die Gerichtsverhandlung bedroht<br />
wurde. Der niedersächsische Justizminister sieht in der Waffenverwendung der<br />
Täter eine Kompensierung der eigenen Unzulänglichkeiten und Schwächen. 269<br />
Durch Waffennutzung erlangen sie Gefühle wie Macht und Erhabenheit<br />
gegenüber ihren Mitmenschen, was sie automatisch zum Stärkeren macht.<br />
Weiterhin bringt er ein altes militärisches Zitat an der aussagt, dass die<br />
Schusswaffe als Braut des Soldaten zu sehen ist und überträgt ihn auf die<br />
jugendlichen Amokläufer. Er unterstellt ihnen eine geradezu erotische Beziehung<br />
zu ihren eigenen Waffen.<br />
Schusswaffen erhöhen aufgrund der weiteren Reichweite die Distanz zu ihren<br />
Opfern. Sie können den direkten Körperkontakt vermeiden und auch fliehende<br />
268<br />
Vgl. Hermanutz/ Kersten, 2003, S.146f.<br />
269<br />
Vgl. Pfeiffer, 2002, S.3
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
Opfer treffen und töten. Gleichzeitig ist es schwerer, bewaffnete Täter zu<br />
überwinden und zu stoppen. Man kann ihnen nicht so leicht nahe genug kommen,<br />
um sie zu entwaffnen. Gerade wenn man selbst unbewaffnet ist, erscheint es fast<br />
unmöglich, wenn der Täter genug Munition besitzt und Zeit hat nachzuladen,<br />
bevor man ihn überwältigen kann.<br />
Relevant wird dabei von Dobler gesehen, dass der Handfeuerwaffengebrauch in<br />
erster Linie der Festigung des eigenen Selbstwertgefühls dient. 270 Eigene<br />
Minderwertigkeitskomplexe können überwunden werden. Vielleicht oder gerade<br />
dadurch ist der bedeutendste psychologische Symbolcharakter der Waffen in der<br />
Macht zu sehen, welche diese für den Täter bedeuten und ausstrahlen. Sie fühlen<br />
sich unverwundbar, da sie davon ausgehen können, dass ihr Gegenüber<br />
unbewaffnet und damit als unterlegen angesehen werden kann.<br />
Zu der Waffenaffinität kommt oftmals auch eine Militärverherrlichung. 271 Bastian<br />
zeigte sich in seinen selbstgedrehten Filmen oftmals in Kleidung im Militärstil.<br />
Auch die Kleidung zur Tatzeit der beiden Fälle deutet darauf hin, denn ihre<br />
schwarze Kleidung und die Maskierung waren angelehnt an ein militärisches<br />
Outfit. Ihrer subjektiven Wahrnehmung nach machten die verwendeten<br />
Schusswaffen sie machtvoll und unangreifbar. Dazu in Diskrepanz stand ihre<br />
tatsächliche körperliche Erscheinung. Robert war als eher schlechter Sportler<br />
bekannt und Bastian war kein Mitglied in einem Sportverein. Hösle gibt dazu an,<br />
dass die Überlegenheit, die Handfeuerwaffen ausstrahlen zur Kompensation<br />
geringerer physischer Stärke dienen. 272 Der körperlich Unterlegene erhält die<br />
Gelegenheit im Kampf gegen einen vermeintlich Stärkeren eine Chance auf den<br />
Sieg zu erhalten.<br />
Ihre Kleidung und auch die Waffen lassen sie als maskierte Rächer erscheinen,<br />
die eine Identifikation mit vorhergegangenen Amokläufen aufweist. 273 Sie<br />
sprechen sich damit einen eigenen Heldenstatus zu. Sie wollen berühmt und<br />
gehört werden. Da sie dazu alleine nicht in der Lage sind verwenden sie<br />
Schusswaffen, um sich buchstäblich mit einem „großen Knall“ Gehör zu<br />
verschaffen. Dies zeigt sich gerade in den Parallelen zwischen ihrem Aussehen<br />
und ihrer Handlungen während ihres Amoklaufes zu ihren Computerspielen.<br />
270<br />
Vgl. Dobler, 1994, S.164.<br />
271<br />
Vgl. Bannenberg, 2007, S.39.<br />
272<br />
Vgl. Hösle, 1997, S.410.<br />
273<br />
Vgl. Bannenberg, 2007, S.39.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
Gerade der für sie so bedeutende Aspekt von Macht und Überlegenheit ist in<br />
diesen Spielen als zentral anzusehen.<br />
Der Mangel an Lösungsstrategien und eine schwach ausgebildete Persönlichkeit<br />
bedeutete für Bastian und Robert, sich unterlegen oder machtlos zu fühlen. Sie<br />
waren nicht in der Lage Konflikte verbal zu äußern oder zu lösen. Vielmehr zogen<br />
sie sich in sich selbst zurück und waren in ihrem Tun gelähmt. Flucht suchten sie<br />
in ihren Interessen, die durch Gewalt und Waffen geprägt waren und in denen<br />
Gewalt oftmals zur Konfliktlösung eingesetzt wurde.<br />
Das Vorhandensein der Waffen und eine Faszination, die diese auf die Täter<br />
gehabt zu haben scheint, bilden ein zentrales Moment bei Amokläufen an<br />
Schulen. Die Jugendlichen hatten es relativ leicht an Waffen zu gelangen und<br />
besaßen zudem noch die Kenntnisse und Fähigkeiten, diese gezielt einzusetzen.<br />
Der Umgang mit Waffen beim Spielen in virtuellen Welten oder im<br />
Schützenverein führte ebenso zu einer Herabsetzung der Hemmschwelle Waffen<br />
gegen andere Menschen einzusetzen. Ebenso ist das Gefühl von Hilflosigkeit und<br />
Machtlosigkeit zentral. Über den Einsatz der Waffen und der Tat erscheint das<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> als ultimativer Weg Macht wiederzuerlangen.<br />
5.5 Verknüpfung der einflussnehmenden Faktoren<br />
Es lassen sich in Hinblick auf die Persönlichkeit der Täter auffällige Merkmale<br />
herausarbeiten. Jedoch ist es trotz übereinstimmender Gemeinsamkeiten nicht<br />
möglich, ein einheitliches Täterprofil zu erstellen.<br />
Bedingungen finden sich sowohl auf psychischer, als auch auf sozialer Ebene der<br />
gefährdeten Jugendlichen. Wie bei vielen andere Autoren kann das Fazit gezogen<br />
werden, dass die in diesem Kapitel diskutierten unterschiedlichen Faktoren in<br />
Bedingung zueinander stehen. Gallwitz geht im Zuge dessen davon aus, dass es<br />
sich um einen tödlichen Kreislauf handelt. 274 Denn obwohl sich bei vielen<br />
Jugendlichen gleiche Umwelterfahrungen finden lassen, müssen zusätzlich dazu<br />
besondere Störungen in der Persönlichkeit hinzukommen. Ein Konglomerat an<br />
Faktoren der Umwelterfahrungen und Persönlichkeitstendenzen muss vorliegen,<br />
274<br />
Vgl. Gallwitz, 2001, S.174.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
damit gefährdete Jugendliche einen Amoklauf als einzige Möglichkeit zur<br />
Problembewältigung ansehen. Auch Robertz geht von einem Modell aus, bei dem<br />
sowohl kurzfristige Faktoren, wie Auslöser und situative Einflüsse, als auch<br />
langfristige Faktoren, wie defizitäre bio-psycho-soziale Integrität, bedeutend<br />
sind. 275 Der Phantasie räumt er dahingehend eine wichtige Rolle ein, indem er sie<br />
als Bindeglied zwischen den beiden Einflussfaktoren ansieht und als wesentlich in<br />
der Entwicklung der Tatidee.<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s werden demnach von Jugendlichen begangen, die gravierende<br />
Defizite innerhalb ihrer Persönlichkeit aufweisen. Auf Grund von mangelnder<br />
Bindungsfähigkeit, unzureichender Bewältigungsstrategien sowie narzisstischen<br />
Persönlichkeitstendenzen, konnten Faktoren wie fehlende Empathiefähigkeit und<br />
mangelnde Selbstkontrolle herausgearbeitet werden. Mit ihrer subjektiven<br />
Wahrnehmung von Lern- und Kontrolldefiziten glauben sie, dass sie im<br />
gesellschaftlichen Rahmen keine Anerkennung bekommen.<br />
In Hinblick auf die soziale Ebene fallen fehlende sichere Bindungen und<br />
Beziehungen innerhalb ihrer individuellen sozialen Netzwerke auf. Das Fehlen<br />
sicherer sozialer Netzwerke verstärkt ihre Sicht, sozial isoliert zu sein. Daraus<br />
ergibt sich bei ihnen die Annahme, auf gesellschaftlich anerkannten Wegen keine<br />
Bestätigung ihres Selbst zu erlangen. Kränkungen, Verletzungen und Krisen<br />
werden auf Grund ihrer nur gering ausgeprägten Identität als besonders<br />
schwerwiegend erlebt und stehen im Gegensatz zu ihrer übersteigerten<br />
Selbstsicht. Um Ohnmachtgefühle und Kontrollverlust auszugleichen, nimmt an<br />
dieser Stelle die eigene Phantasie einen hohen Stellenwert ein.<br />
Die Beschäftigung mit gewalttätigen Rollenvorbildern im Bereich von <strong>School</strong><br />
<strong>Shooting</strong>, das verstärkte Interesse an Waffen und deren symbolischer Bedeutung<br />
sowie der Rückzug innerhalb der virtuellen gewalthaltigen Medien, erhält gerade<br />
in Bezug auf die Rolle der Phantasie eine starke Brisanz. Die Phantasien steigern<br />
sich über einen längeren Zeitraum in ihrer Intensität und in ihrer dissozialen und<br />
zerstörerischen Ausrichtung. Dazu kommt der Zugang zu Waffen und fehlende<br />
oder unzureichende Reaktionen aus der Umwelt. Der sich steigernde Rückzug aus<br />
der realen Welt in ihre Phantasien, dient zu Beginn nur der Kompensation und<br />
zeichnet sich durch eine fiktive und spielerische Umsetzung aus. Die anfänglich<br />
fiktive Auseinandersetzung wandelt sich in eine umsetzungsorientierte<br />
275<br />
Vgl. Robertz, 2004, S.246.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Erörterung der bedeutenden Teilaspekte<br />
Vorstellung. Die Taten erhalten dadurch für gefährdete Jugendliche die<br />
Bedeutung der einzigen Möglichkeit, um fehlende Anerkennung und den<br />
subjektiv empfundenen Kontrollverlust auszugleichen. Eine Realisierung erfolgt<br />
letztendlich nach einem Auslöser. Das Schlüsselereignis wird von dem<br />
betroffenen Jugendlich als schwerer Verlust oder Niederlage bewertet, der<br />
letztendlich als Verlust der letzten funktionalen sozialen Beziehung zur<br />
Gesellschaft gesehen werden kann.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Präventionsansätze<br />
6. Präventionsansätze<br />
Es hat sich im Kapitel 5 eindeutig gezeigt, dass dem <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> keine<br />
monokausalen Ursachen und Motive zuzuschreiben sind. Eine Neuregulierung der<br />
Waffengesetzgebung nach dem Amoklauf von Robert Steinhäuser hat einen<br />
erneuten Vorfall nicht verhindern können. Auch die Diskussion um ein Verbot<br />
von gewalthaltigen Computerspielen kann als unangemessen eingestuft werden.<br />
Ego-Shooter produzieren keine jugendlichen Amokläufer und eine eindeutige<br />
Kausalität kann bis heute nicht bewiesen werden. Gerade die multifaktoriellen<br />
Bedingungen erschweren die Möglichkeiten, präventive Maßnahmen zu<br />
entwickeln oder bei Verdacht frühzeitig intervenieren zu können. Es lassen sich<br />
Bedingungen sowohl auf individueller psychischer Ebene der Täter, als auch in<br />
der engeren und weiteren sozialen Umwelt feststellen.<br />
Bei Robert und auch bei Bastian ist zu erkennen, dass sich im zeitlichen Verlauf<br />
der individuellen Biografie ihre Handlungsalternativen immer weiter<br />
eingeschränkt haben. Kennzeichnend sind dafür Krisen, mit denen sie konfrontiert<br />
wurden und deren Lösung ihnen nicht möglich war. Am Ende sahen sie in der<br />
Tötung anderer Menschen den einzigen Ausweg, der Krisensituationen zu<br />
entfliehen.<br />
Wichtig wäre demnach, Jugendlichen auf pädagogischer Ebene Hilfestellungen<br />
bei ihrer Identitätsbildung zu bieten. Eine positive und sichere Identitätsbildung<br />
beinhaltet die Einbindung in stabile Beziehungen und die Entwicklung adäquater<br />
Lösungsstrategien im Falle von Krisen. Eine frühe und umfassende Stabilisierung<br />
der bio-psycho-sozialen Integrität und die Möglichkeit des Erlebens einer<br />
emphatischen und prosozialen Gemeinschaft kann individuelle Schutzschilde<br />
Jugendlicher verbessern und destruktive Phantasien auf ein Minimum<br />
reduzieren. 276<br />
Eine so breit angelegte Hilfestellung müsste frühzeitig und in allen wichtigen<br />
Lebensbereichen von Jugendlichen einsetzen. Dies erweist sich jedoch in<br />
Anbetracht der gesellschaftlich begrenzten Leistungsmöglichkeiten sicherlich als<br />
utopisch. Bedeutungsvoll ist es dennoch, dass das soziale Umfeld Jugendlicher<br />
sensibilisiert sein muss, um eingreifen zu können, wenn sich Jugendliche aus<br />
Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht immer weiter zurückziehen. Daher ist es<br />
276<br />
Vgl. Robertz, 2004, S.250.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Präventionsansätze<br />
wichtig zu untersuchen, worauf eine Sensibilisierung stattfinden muss. Nur wenn<br />
bewusst ist, wie Vorzeichen oder Indikatoren im Vorfeld erkennbar sind, können<br />
Interventionen stattfinden.<br />
In den USA kristallisierten sich aus bestehenden Studien drei verschiedene<br />
Reaktionsschemata heraus, um für die Zukunft präventiv wirksam zu werden. 277<br />
In der Strategie der „Zero Tolerance“, bedeutet es eine rigorose und konsequente<br />
Ahndung innerhalb der Strafverfolgung. 278 Im Falle von gefährdeten oder<br />
auffälligen Jugendlichen bedeutet das einen sofortigen Verweis von der Schule.<br />
Zudem wurden für das Schulsystem besondere Vorschriften und<br />
Überwachungssysteme eingesetzt. Gegenstände, die in jeglicher Art und Weise<br />
als Waffe genutzt werden könnten, sind verboten. In vielen Schulen müssen die<br />
Schüler morgens erst durch eine Sicherheitskontrolle, um das Schulgebäude zu<br />
betreten. Allerdings wird dieser neokonservative Ansatz selbst in den USA als<br />
kritisch gesehen, denn das größte Problem liegt in der alleinigen Fokussierung auf<br />
die Tat, Motivlagen werden nicht beachtet. Außerdem werden auch Jugendliche,<br />
die nur leichte Verhaltensauffälligkeiten an den Tag gelegt haben, mit der ganzen<br />
Härte vom Staat bestraft und etikettiert.<br />
Die zweite Strategie in den USA ist der Versuch ein Täterprofil zu erstellen,<br />
welches in Zukunft helfen soll, potenzielle Amokläufer im Vorfeld der Tat zu<br />
erkennen. 279 Wie aber bereits in der Darstellung der amerikanischen<br />
Studienergebnisse in Kapitel 3 gezeigt wurde, ist ein eindeutiges Profil nicht<br />
möglich. Fast alle Autoren weisen explizit darauf hin, dass ein Profil nicht<br />
möglich ist. Problematisch an den Versuchen ein Raster zu erstellen ist in diesem<br />
Fall sicherlich, dass viele der Punkte auf fast alle Jugendlichen in der Pubertät<br />
zutreffen. Aber nicht alle diese Jugendlichen sind potenziell gefährdet. Auch<br />
deutsche Autoren sehen es kritisch mit sogenannten Frühindikatoren im Bereich<br />
jugendlicher Amokläufer zu arbeiten. Nach Lange und Greve gibt es kein sicheres<br />
Frühwarnsystem zur Erkennung von potenziellen Amokläufern. 280 Sie gehen<br />
davon aus, dass es eine Form des typischen Amokläufers nicht gibt und der<br />
Zusammenhang nur in der Tat selber besteht. Auch Bannenberg warnt vor zu<br />
schnellen Schlussfolgerungen und Klassifikationsfehlern. 281 Sie weist darauf hin,<br />
277<br />
Vgl. Robertz, 2006, S.1f.<br />
278<br />
Vgl. Palm, 2003, S.80ff.<br />
279<br />
Vgl. McGee/ DeBernado, 1999, S.1ff.<br />
280<br />
Vgl. Lange/ Greve, 2002, S.93f.<br />
281<br />
Vgl. Bannernberg, 2007, S.37f.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Präventionsansätze<br />
dass Indikatoren auf Grund ihrer geringen Genauigkeit und der Komplexität der<br />
Zusammenhänge nicht als sichere Klassifizierung gelten können.<br />
Am hilfreichsten hat sich der Ansatz des „Threat Assessment“ herausgestellt,<br />
unter anderem zu finden in der Studie der Critical Incident Response Group des<br />
FBI oder der Studie des US Secret Service und des Department of Education. 282<br />
Zentral ist die Annahme, dass Jugendliche im Vorfeld offene oder verdeckte<br />
Signale aussenden. Präventiv wirksam wird man, indem Reaktionen flexibel und<br />
individuell auf die Art der Drohungen erfolgen. Bei richtiger Einschätzung<br />
können Etikettierungsprozesse oder Fehleinschätzungen minimiert werden.<br />
Auch in Deutschland ist man dabei, mögliche Präventionsstrategien im Falle von<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> zu entwickeln. Der zur Zeit populärste Ansatz bezieht sich auf<br />
die dritte Strategie der USA, dem „Threat Assessment“. Es wird als besonders<br />
wichtig erachtet, ein Gespür für Hinweise zu entwickeln, die auf mögliche<br />
Absichten eines <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> hinweisen. Ausgang bildet die Annahme, dass<br />
die Täter im Vorfeld direkt oder verschlüsselt über ihre Absichten<br />
kommunizieren. Als Fachausdruck wird dafür der Begriff des „Leaking“<br />
verwendet. 283 Erweitert werden die Annahmen aus den amerikanischen Studien<br />
dadurch, dass Äußerungen der Täter im Internet, wie Webtagebücher oder ein<br />
intensives Interesse an Waffen, sowie vorherigen <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s zu<br />
verzeichnen ist. 284 Unterschieden werden mehrere Ebenen im Bereich des<br />
„Leaking“.<br />
So geht Hoffmann von drei Ebenen des „Leaking“ aus. 285 Beim frühen Leaking<br />
identifiziert sich der Jugendliche erkennbar mit anderen Gewalttätern oder<br />
beschäftigt sich intensiv mit Gewalthandlungen. Planungselemente werden dann<br />
in der Ebene des mittleren Leaking deutlich, dass kann sich unter anderem in der<br />
Erstellung einer Todesliste äußern. Das späte Leaking bezieht sich bereits auf eine<br />
konkrete Tat, der Jugendliche macht Andeutungen und Ankündigungen, dass an<br />
einem bestimmten Tag oder an einem bestimmten Ort etwas geschehen wird.<br />
Entscheidend ist, dass sich die anfänglichen Ideen und Vorstellungen zunächst<br />
innerhalb der mentalen Welt, oder besser gesagt der Phantasie abspielen. Diese<br />
setzen sich dann immer weiter in die reale Welt durch und äußern sich in direkten<br />
282<br />
Vgl. O`Toole, 1999, 26ff.; Vgl. Vossekuil u.a. (2002), www.secretservice.gov/ntac/ssi_final_report.pdf,<br />
20.04.2007, S.29ff.<br />
283<br />
Vgl. Hoffmann, 2007, 32f.<br />
284<br />
Vgl. Robertz, 2006, S.3.<br />
285<br />
Vgl. Hoffmann, 2007, S.32.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Präventionsansätze<br />
oder indirekte Signalen. Spätestens wenn Jugendliche beginnen, Vorstellungen<br />
oder Phantasien mitzuteilen, müssen negative Rückmeldungen seitens des<br />
sozialen Umfeldes erfolgen. 286 Es muss ihnen deutlich aufgezeigt werden, dass<br />
Schädigungen anderer Menschen nicht akzeptabel sind und auch niemals als<br />
angemessene Lösungsstrategien angesehen werden können.<br />
Kritisch zu erwähnen ist auch hier, dass diese Erkenntnisse Gefahren bergen.<br />
Dieser Ansatz kann, bei einer falschen Einschätzung oder bei Überreaktionen zu<br />
Fehlinterpretationen führen. Die meisten Hinweise treffen auf eine Vielzahl<br />
Jugendlicher zu, die sich gedanklich dennoch nicht mit der Planung eines <strong>School</strong><br />
<strong>Shooting</strong> auseinandersetzen. Die Gefahr besteht darin, dass eine Über-<br />
Interpretation möglicher Hinweise auch eine Stigmatisierung beinhaltet. Werden<br />
vorschnelle Schlüsse gezogen, können Jugendliche als potenzielle Amokläufer<br />
stigmatisiert werden, die eine solche Tat nicht in Erwägung ziehen. Weiterhin<br />
kann die Suche nach möglichen Bedrohungen auch zu dem Gefühl eines ständig<br />
anwesenden Droh-Potenzials führen. 287<br />
Abschließend ist festzustellen, dass immer erst eine Einschätzung erfolgen muss,<br />
ob getroffene Äußerungen als ernsthaft einzustufen sind. 288 Nur dann können dem<br />
betroffenen Jugendlichen Hilfestellungen geboten werden. Mögliche Maßnahmen<br />
können auf individueller Ebene des Jugendlichen ansetzen. Das Ziel liegt in der<br />
Stärkung des Selbstbewusstseins und in der Entwicklung positiver<br />
Bewältigungsstrategien. Aber auch auf Ebene sozialisatorischer Instanzen wie der<br />
Schule selbst sind präventive Möglichkeiten gegeben. Das bedeutet Techniken zu<br />
entwickeln, um Leaking feststellen und richtig einschätzen zu können. Die<br />
Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern, aber auch zu Eltern muss<br />
verbessert werden. Ebenso wichtig erscheint es, Verhaltensregeln zu vermitteln<br />
um vorhandene Hemmungen und Auffälligkeiten mitzuteilen beziehungsweise<br />
abzubauen.<br />
286<br />
Vgl. Robertz, 2007, S.17.<br />
287<br />
Vgl. Faust (no date), www.psychosoziale-gesundheit.net/seele/amok.html, 25.04.2007, S.41.<br />
288<br />
Vgl. Robertz, 2006, S.3.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
7. Schlussbetrachtung<br />
Schlussbetrachtung<br />
Die retrospektive Suche im Falle von Amokläufen an Schulen hat ergeben, dass<br />
eine Vielzahl unterschiedlicher Hypothesen über Bedingungen und Motivlagen<br />
der Täter besteht. Die verschiedenen Autoren stehen dabei nebeneinander,<br />
ergänzend, aber auch divergent zueinander. Welche der Faktoren dabei aber als<br />
besonders ausschlaggebend oder signifikant für <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s angesehen<br />
werden können, kann nicht eindeutig verifiziert werden. Zudem ist festzustellen,<br />
dass die bestehenden Annahmen in der Forschung nicht aus Theorien oder<br />
Hypothesen abgeleitet sind, sondern nur Ergebnisse aus bestehenden<br />
ausgewerteten Fällen sind und auf denen die Argumentationsebene der einzelnen<br />
Studien beruht. Somit können sämtliche Faktoren, die herausgearbeitet wurden,<br />
nur als mögliche Indikatoren im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit gesehen<br />
werden, nicht aber als deterministisch gesicherte Ergebnisse. Die vorliegenden<br />
einflussnehmenden Faktoren können demnach nur als Hypothesen gesehen<br />
werden, deren Auftreten die Wahrscheinlichkeit solcher Taten erhöht. Dieses hat<br />
sich auch in der eigenen Bearbeitung der Thematik bestätigt. All das zeigt, wie<br />
schwierig es ist, sichere Präindikatoren auszumachen, die eine Prävention<br />
ermöglichen. Zudem lassen sich viele der einflussnehmenden Faktoren auch bei<br />
anderen gleichaltrigen Jugendlichen finden, die trotzdem nicht zum Amokläufer<br />
werden.<br />
Ergebnisse aus der allgemeinen Amokforschung, die auf eine Verbindung zum<br />
ursprünglichen malaiischen Amok hinweisen, erweisen sich innerhalb dieses<br />
speziellen Phänomens als weitestgehend unbrauchbar. Gerade die Annahme, dass<br />
es sich dabei um unkontrollierte impulsive und raptusartige Ausbrüche handelt,<br />
konnte innerhalb der eigenen Arbeit widerlegt werden. Ebenso konnte der<br />
Zusammenhang von Suizid und <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> im Rahmen der eignen<br />
Bearbeitung nicht belegt werden. Schon im Bereich der Begriffbestimmungen hat<br />
sich gezeigt, dass eine primäre Ausrichtung der Tötungshandlungen auf den<br />
eigenen Suizid hin nur schwer nachzuweisen ist.<br />
Der Schwerpunkt der Erörterung im 5. Kapitel dieser Arbeit wurde sowohl auf<br />
einzelne individuelle Einflüsse auf persönlicher Ebene, als auch auf Ebene der<br />
sozialen Umwelt der Täter gelegt. Wichtig war, die Einflüsse auf beiden Ebenen<br />
und deren Zusammenhänge genauer zu hinterfragen. Die in dieser Arbeit
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Schlussbetrachtung<br />
herausgearbeiteten Risikofaktoren können rückwirkend als mögliche<br />
Erklärungsansätze für ereignete Fälle gesehen werden. Eine Festlegung auf diese<br />
Schwerpunkte beinhaltet zusätzlich die Reduzierung auf bestimmte Teilaspekte.<br />
So konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht auf alle Aspekte eingegangen werden.<br />
So konnte unter anderem eine Betrachtung von <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s in<br />
Zusammenhang zur Medienberichterstattung nach stattgefundenen <strong>School</strong><br />
<strong>Shooting</strong>s nicht mit einbezogen werden. So dass an dieser Stelle dazu nur gesagt<br />
werden kann, dass die intensive Verarbeitung und Beschäftigung in den Medien<br />
mit tatsächlichen Vorfällen und die Verbreitung verschiedenster Materialien über<br />
die Öffentlichkeit möglicherweise großen Einfluss auf die Wahrnehmung und<br />
Sichtweise von Jugendlichen, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne,<br />
bedeuten kann. Auf Grund dessen könnte eine intensive Medienpräsenz sich<br />
möglicherweise auch begünstigend auf Nachahmungstaten von gefährdeten<br />
Jugendlichen auswirken.<br />
Als Erkenntnis aus dieser Arbeit kann gesagt werden, dass eine Kombination<br />
vieler einflussnehmender Faktoren auftreten muss, damit ein Jugendlicher zum<br />
Amokläufer wird. Die Kombination psychologischer und sozialer Faktoren über<br />
mehrere Jahre hinweg führt dazu, dass er seinen Amoklauf als einzige<br />
Möglichkeit ansieht, sich der zugespitzten Situation zu entziehen.<br />
Faktoren, die sich auf psychischer Ebene als besonders einflussnehmend<br />
herauskristallisiert haben, sind mangelnde Bindungsfähigkeit, unzureichende<br />
Bewältigungsstrategien sowie narzisstischen Persönlichkeitstendenzen, die sich in<br />
fehlender Empathiefähigkeit und mangelnder Selbstkontrolle bemerkbar machen.<br />
Auf sozialer Ebene ist das Fehlen sicherer sozialer Netzwerke als zentral<br />
anzusehen. Kränkungen und Konflikte werden als besonders schwerwiegend<br />
erfahren und stehen divergent zu ihrer Selbstsicht. Über ihre<br />
Phantasieentwicklung versuchen sie Ohnmachtgefühle und Kontrollverluste zu<br />
kompensieren. Gerade in Verbindung mit einer auf Gewalt ausgerichteten<br />
Phantasieentwicklung erhält das Interesse an Waffen sowie der Rückzug<br />
innerhalb der virtuellen gewalthaltigen Medien eine starke Brisanz. Die<br />
Phantasien steigern sich auf Dauer in tatumsetzende Vorstellungen. Dazu kommt<br />
der Zugang zu Waffen und fehlende oder unzureichende Reaktionen aus der<br />
Umwelt.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> - Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Schlussbetrachtung<br />
Die intensive Beschäftigung mit anderen Amokläufen und ein vorrausgehendes<br />
Lebensereignis, dass von ihm selbst als extrem kritisch wahrgenommen wird,<br />
können mit als besonders tatbegünstigend gesehen werden. Dieses kritische<br />
Lebensereignis kann auf Grund dessen sicherlich nur als Anlass, aber nicht als<br />
elementare Ursache des Amoklaufes angesehen werden, da es am Ende einer<br />
Kette vieler wichtiger Faktoren steht.<br />
Wichtig ist es demnach, sich weiterhin vertiefend mit den einzelnen Faktoren<br />
auseinander zusetzen. Die bestehende Forschungslage bei <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s<br />
erweist sich allerdings dahingehend noch als ungenügend. Die Forschung steht<br />
noch am Anfang, denn erst mit den schweren Vorfällen seit Mitte der neunziger<br />
Jahre beschäftigen sich amerikanische Forscher eingehender mit dem Phänomen.<br />
In Deutschland werden <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s erst seit dem Amoklauf von Robert<br />
Steinhäuser stärker thematisiert. Zusätzlich kommt bei der retrospektiven Analyse<br />
hinzu, dass in Deutschland die Mehrzahl der Fälle im Tod des Amokläufers<br />
geendet haben und die Bearbeitung der Fälle daher immer auf Interpretationen der<br />
vorliegenden Informationen beruht.<br />
Ebenso ist eine vertiefte Auseinandersetzung mit <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> zwingend<br />
notwendig, um weiter im Bereich der Prävention oder Früherkennung arbeiten zu<br />
können. Nur die unabdingbare Auseinandersetzung mit den einzelnen<br />
einflussnehmenden Aspekten vor Tateinhergang ermöglicht es, sinnvolle<br />
präventive Maßnahmen zu entwickeln, um diese Fällen von schwerer<br />
zielgerichteten Gewalttaten zu verhindern.<br />
Der derzeitige Stand präventiver Ansätze verweist allerdings darauf, dass alle<br />
Aspekte bislang noch nicht eindeutig herausgearbeitet werden konnten und somit<br />
ein Schutz für jugendlichen Täter und für deren mögliche zukünftige Opfer vor<br />
Tatbeginn noch nicht gegeben sein kann und damit auch weitere zukünftige Taten<br />
noch nicht eindeutig verhindert werden können.
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong><br />
Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
8. Literaturverzeichnis<br />
Literaturverzeichnis<br />
Adler, Lothar: Amok. Eine Studie. München: belleville Verlag, 2000<br />
Adler, Lothar: Amok im Spektrum homizidal-suizidaler Handlungen. In: Wolfersdorf, Manfred/<br />
Wedler, Hans (Hg.): Terroristen–Suizide und Amok. Regensburg: S. Roderer Verlag, 2002,<br />
(S.60–72)<br />
Adler, Lothar : Amok. In: Bergsdorf, Wolfgang/ Herz, Dietmar/ Hoffmeister, Hans (Hg.): Gewalt<br />
und Terror. Ringvorlesung im Wintersemester 2002/ 2003.Weimar: Rhino Verlag, 2003, (S.19-<br />
34)<br />
Bannenberg, Britta: So genannte Amokläufe/ So-called „Amok“ Killings. In: <strong>Universität</strong> Bielefeld,<br />
Informations- und Pressestelle in Zusammenarbeit mit dem Institut für interdisziplinäre<br />
Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) (Hg.): BI.research Forschungsmagazin, Bd.30, 2007,<br />
(S.36-40)<br />
Bien, R.: Häufigkeit, Motivation und Durchführung des erweiterten Suizids bei psychiatrischen<br />
Patienten. In: Pohlmeier, Hermann/ Schmidtke, Armin/ Welz, Rainer (Hg.): Suizidales Verhalten.<br />
Methodenprobleme und Erklärungsansätze. Regensburg: S. Roderer Verlag, 1984, (S.53–<br />
60)<br />
Billerbeck, von, Liane/ Schwelien, Michael: Mal so richtig aufräumen. Der Mörder Robert S. und<br />
seine Welt: Die Website, die Waffen, die Zeugen. In: Zeitdokumente (Hg.): Zehn Minuten<br />
Krieg. Der Massenmord von Erfurt. 2003, Nr.2, (S.5–7)<br />
Blumenstein, Alfred: Schusswaffen und Jugendgewalt. In: Heitmeyer, Wilhelm/ Hagan, John<br />
(Hg.): Internationales Handbuch der Gewaltforschung. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag,<br />
2002, (S.819-845)<br />
Brinkbäumer, Klaus/ Cziesche, Dominik/ Hoppe, Ralf/ Hurz, Felix/ Meyer, Cordula/ Repke, Irina/<br />
Röbel, Sven/ Smoltcyk, Alexander/ Wassermann, Andreas, Winter, Steffen: Das Spiel seines<br />
Lebens. In: Spiegel, 2002, Nr.19, (S.118–144)<br />
Christ, H.: Dissoziative Bindung und familiale Traumatisierung. In: Zenz, W. M./ Bächer, K./<br />
Blum – Maurice, R. (Hg.): Die vergessenen Kinder. Vernachlässigung, Armut und Unterversorgung<br />
in Deutschland. Köln: PapyRossa Verlag, 2002 (S. 88-102)<br />
Deggerich, Markus/ Gaterburg, Angela/ Kaiser, Simone/ Kleinhubbert, Guido/ Röbel, Sven: Virus<br />
im Programm. In Spiegel, 2006, Nr. 48, (S.36-39)<br />
Dobler, Ernst, Ulrich: Schußwaffen und Schußwaffenkriminalität in der Bundesrepublik Deutschland<br />
(ohne Berücksichtigung der neuen Länder): psychosoziologische und kriminologisch-kriminalistische<br />
Aspekte. Frankfurt am Main: Europäischer Verlag der Wissenschaften, 1994<br />
Eisenberg, Götz: Gewalt, die aus der Kälte kommt. Amok–Pogrom–Populismus. Gießen: Psychosozial<br />
Verlag, 2002<br />
Engels, Holger: Das <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong> von Emsdetten – der letzte Ausweg aus dem Tunnel?. In:<br />
Hoffmann, Jens/ Wondrak, Isabel (Hg.): Amok und zielgerichtete Gewalt an Schulen. Frankfurt:<br />
Verlag für Polizeiwissenschaften, 2007 (S.35-56)<br />
Faust, Volker (no date): Seelische Störungen erkennen, verstehen, verhindern, behandeln: Selbsttötungsgefahr1.<br />
URL: http://www.psychosoziale-gesundheit.net/seele/suizid1.html, (Zugriffsdatum:<br />
19.05.2007)<br />
Faust, Volker (no date): Seelische Störungen erkennen, verstehen, verhindern, behandeln: Amok.<br />
URL: http://www.psychosoziale-gesundheit.net/seele/amok.html, (Zugriffsdatum: 25.04.2007)
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong><br />
Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Literaturverzeichnis<br />
Fritz, Jürgen: Lebenswelt und Wirklichkeit. In: Fritz, Jürgen/ Fehr, Wolfgang (Hg.): Handbuch<br />
Medien: Computerspiele - Theorie, Forschung, Praxis. Bonn: Bundeszentrale für politische<br />
Bildung/ bpb, 1997a, (S.13-30)<br />
Fritz, Jürgen: Was sind Computerspiele?. In: Fritz, Jürgen/ Fehr, Wolfgang (Hg.): Handbuch Medien:<br />
Computerspiele – Theorie, Forschung, Praxis. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung,/<br />
bpb, 1997b, (S.81-86)<br />
Fritz, Jürgen: Zwischen Transfer und Transformation. Überlegungen zu einem Wirkungsmodell<br />
der virtuellen Welt. In: Fritz, Jürgen/ Fehr, Wolfgang (Hg.): Handbuch Medien: Computerspiele<br />
– Theorie, Forschung, Praxis. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung,/ bpb, 1997c,<br />
(S.229-246)<br />
Fritz, Jürgen: So wirklich ist die Wirklichkeit. Über die Wahrnehmung und kognitive Verarbeitung<br />
realer und medialer Ereignisse. In: Fritz, Jürgen/ Fehr, Wolfgang (Hg.): Computerspiele.<br />
Virtuelle Spiel- und Lernwelten. Bundeszentrale für politische Bildung/ bpb, 2003a, (nur auf<br />
beiliegender CD-Rom)<br />
Fritz, Jürgen: Warum spielt jemand Computerspiele? Macht, Herrschaft uns Kontrolle faszinieren<br />
und motivieren. In: Fritz, Jürgen/ Fehr, Wolfgang (Hg.): Computerspiele. Virtuelle Spiel- und<br />
Lernwelten. Bundeszentrale für politische Bildung/ bpb, 2003b, (nur auf beiliegender CD-<br />
Rom)<br />
Fritz, Jürgen: Wie virtuelle Welten wirken. Über die Struktur von Transfer aus der medialen in die<br />
reale Welt. In: Fritz, Jürgen/ Fehr, Wolfgang (Hg.): Computerspiele. Virtuelle Spiel- und Lernwelten.<br />
Bundeszentrale für politische Bildung/ bpb, 2003d, (nur auf beiliegender CD-Rom)<br />
Fritz, Jürgen/ Fehr, Wolfgang: Virtuelle Gewalt: Modell oder Spiegel? Computerspiele aus Sicht<br />
der Medienwirkungsforschung. In: Fritz, Jürgen/ Fehr, Wolfgang (Hg.): Computerspiele. Virtuelle<br />
Spiel- und Lernwelten. Bundeszentrale für politische Bildung/ bpb, 2003a, (S.49-60)<br />
Fritz, Jürgen/ Fehr, Wolfgang: Computerspiele als Fortsetzung des Alltags. Wie sich Spielwelten<br />
und Lebenswelten verschränken. In: Fritz, Jürgen/ Fehr, Wolfgang (Hg.): Computerspiele. Virtuelle<br />
Spiel- und Lernwelten. Bundeszentrale für politische Bildung/ bpb, 2003b, (nur auf beiliegender<br />
CD-Rom)<br />
Fröhlich, Werner: Art. Phantasie. In: Wörterbuch der Psychologie. München: dtv Verlag, 25.Auflage,<br />
2005 (S.365)<br />
Füllgrabe, Uwe: Amok–Eine spezielle Art der Mehrfachtötung. In: Kriminalistik, Nr.4, 2000,<br />
(S.225-228)<br />
Gallwitz, Adolf: Amok – Grandios untergehen, ohne selbst Hand anzulegen. In: Polizei heute,<br />
Nr.6, 2001, (S.170-175)<br />
Gasser, Karl Heinz/ Creutzfeld, Malte/ Näher, Markus/ Rainer, Rudolf/ Wickler, Peter (2004): Bericht<br />
der Kommission Gutenberg Gymnasium. Erfurt: Freistaat Thüringen, URL:http://www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnasium.pdf,<br />
(Zugriffsdatum: 15.06.2007)<br />
Gieselmann, Hartmut: Der virtuelle Krieg. Zwischen Schein und Wirklichkeit im Computerspiel.<br />
Hannover: Offizin Verlag, 2002<br />
Grossmann, Dave/ DeGaetano, Gloria: Wer hat unseren Kindern das Töten beigebracht? Ein Aufruf<br />
gegen Gewalt in Fernsehen, Film und Computerspielen. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben,<br />
2003<br />
Hansen, J.: Suizid und Homizid: Ihre Gemeinsamkeiten als Zugang zu einer Antriebsanalyse des<br />
Selbstmordgeschehens. In: Reimer, Christian (Hg.): Suizid: Ergebnisse und Therapie. Berlin,<br />
Heidelberg, New Yoork: Springer Verlag, 1982, (S.24 – 38)
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong><br />
Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Literaturverzeichnis<br />
Heitmeyer, Wilhelm: Süchtig nach Anerkennung – Die prekäre Normalität: Wer nicht auffällt,<br />
wird nicht wahrgenommen – ist ein Nichts. In: Zeitdokumente (Hg.): Zehn Minuten Krieg. Der<br />
Massenmord von Erfurt. 2003, Nr.2, (S.15–16)<br />
Herberer, Claudia/ Höhler, Jennifer/ Müller, Holger: Jugendgefährdung durch gewalthaltige<br />
Computerspiele? Typen und Konzepte aktueller Ego-Shooter und ihre Beurteilung. In: Dolle-<br />
Weinkauff, Bernd/ Ewers, Hans-Heino/ Jaekel, Regina (Hg.): Gewalt in aktuellen Kinder- und<br />
Jugendmedien. Von der Verherrlichung bis zur Ächtung eines gesellschaftlichen Phänomens.<br />
Weinheim und München: Juventa Verlag, 2007<br />
Hermanutz, Max/ Kersten, Joachim: Amoktaten. In: Stein, Frank (Hg.): Grundlagen der Polizeipsychologie.<br />
Band 2. Göttingen: Hogrefe Verlag, 2003 (S.138–152)<br />
Hösle, Vittorio: Moral und Politik – Grundlagen einer politischen Ethik für das 21. Jahrhundert.<br />
München: C. H. Beck Verlag, 1997<br />
Hoffmann, Jens: Tödliche Verzweifelung – der Weg zu zielgerichteten Gewalttaten an Schulen.<br />
In: Hoffmann, Jens/ Wondrak, Isabel (Hg.): Amok und zielgerichtete Gewalt an Schulen.<br />
Frankfurt: Verlag für Polizeiwissenschaften, 2007 (S.25-34)<br />
Hoffmann, Jens (12.07.2007): Interview im Bayrischen Rundfunk. In: Schuster, Klaus –Dieter:<br />
Forschung und Gesellschaft 12.07.2007. Columbine, Erfurt, Blacksburg und kein Ende?<br />
Amokforschung<br />
Huisken, Freerk: z.B. Erfurt – Was das bürgerliche Bildungs- und Einbildungswesen anrichtet.<br />
Hamburg: VSA – Verlag, 2002<br />
Hurrelmann, Klaus: Lebensphase Jugend. Eine Einführung in die sozialwissenschaftliche Jugendforschung.<br />
Weinheim und München: Juventa Verlag, 2005<br />
Infoplease.com (2007): A Time Line of Recent Worldwide <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s. URL:http://www.-<br />
infoplease.com/ipa/A0777958.html, (Zugriffsdatum: 07.10.2007)<br />
Kernberg, F., Otto: Borderline Störungen und pathologischer Narzissmus. Frankfurt am Main:<br />
Suhrkamp Verlag, 1983<br />
Knecht, Thomas: Amok. Transkulturelle Betrachtung über eine Extremform menschlicher Aggressionen.<br />
In: Kriminalistik; 10/98, (S.681-684)<br />
Krampen, Günter/ Reichle, Barbara: Frühes Erwachsenenalter. In: Oerter Rolf/ Montada, Leo<br />
(H): Entwicklungspsychologie. Ein Lehrbuch. Weinheim: Psychologie Verlag, 1995, (S.319-<br />
349)<br />
Krimpädia/ IKS (Institut für Kriminologische Sozialforschung) (letzter Stand: 16.05.2007): Art.:<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>. URL:http://www.kriminologie.uni-hamburg.de/wiki/index.php/<strong>School</strong>_<strong>Shooting</strong>,<br />
(Zugriffsdatum: 01.10.2007)<br />
Ladas, Manuel: Brutale Spiele(r)? Wirkung und Nutzung von Gewalt in Computerspielen. Frankfurt<br />
am Main: Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2002<br />
Landeskriminalamt NRW (2007): Amoktaten– Forschungsübersicht unter besonderer Beachtung<br />
jugendlicher Täter im schulischen Kontext. Düsseldorf: Analysen der Kriminalistisch – Kriminologische<br />
Forschungsstelle Nr.3, URL::http//: www1.polizei-nrw.de/lka/stepone/data/downloads/d3/00/00/amoktaten.pdf,<br />
(Zugriffsdatum: 19.06.2007)<br />
Lange, Tanja/ Greve, Werner: Amoklauf in der Schule – Allgemeine Überlegungen aus speziellem<br />
Anlass. In: Soziale Probleme, 2002, Nr.13, (S.80-101)
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong><br />
Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Literaturverzeichnis<br />
Lehmann, Armin (24.11.2006): Die Gesichter des jungen B. URL:<br />
http://www.tagesspiegel.de/zeitung/Die-Dritte-Seite;art705.2204006, (Zugriffsdatum:<br />
30.06.2007)<br />
McGee, James, P./ DeBernado, Caren, R. (2001): The Classroom Avenger. [Erweiterung der Originalversion:<br />
The forensic Examiner: Band 8, Nr.5, 1999 (S.16–18)] URL:http://www.sheppardpratt.org/Documents/classavanger.pdf,<br />
(30.06.2007)<br />
Mikos, Lothar: Amok in der Mediengesellschaft. In: Archiv der Jugendkulturen (Hg.): Der Amoklauf<br />
von Erfurt. Berlin. Verlag Thomas Tilsner, 2003, (S.46–74)<br />
Oerter, Rolf/ Dreher, Eva: Jugendalter. In: Oerter Rolf/ Montada, Leo (Hg.): Entwicklungspsychologie.<br />
Ein Lehrbuch. Weinheim: Psychologie Verlag, 2002, (S.258-318)<br />
O’Toole, Mary Ellen (1999): The <strong>School</strong> Shooters: A Threat Assessment Perspective. Critical Incident<br />
Response Group. FBI Academy Quantico, Virginia. URL:http://www.fbi.gov/publications/school/school2.pdf,<br />
(Zugriffsdatum: 15.05.2007)<br />
Palm, Goedart: Clockwork Ameroca. Schulmassaker und tödliches Freistilringen in den USA. In:<br />
Rötzer, Florian (Hg.): Virtuelle Welten – reale Gewalt. Hannover: Heinz Heise Verlag, 2003,<br />
(S.80-88)<br />
Pfeiffer, Christian: Warum Männer Amok laufen. In: Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule<br />
e.V.-Gesamtschulverband (Hg.): Gesamtschul –Kontakte. 2002, Nr.2, (S.3-4)<br />
Polizei Steinfurt, Pressestelle (23.11.2006): Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft<br />
Münster und der Polizeibehörden Münster und Steinfurt Nachtrag zur OTS Meldung vom<br />
20.11.2006. Digitale Pressemappe.<br />
URL:http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/43526/905473/polizei_steinfurt, (Zugriffsdatum:<br />
20.06.2007)<br />
Robertz, Frank: <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s. Über die Relevanz der Phantasie für die Begehung von Mehrfachtötungen<br />
durch Jugendliche. Frankfurt am Main: Verlag für Polizeiwissenschaften, 2004<br />
Robertz, Frank: Leaking – Ankündigung schwerer Straftaten an Schulen. In: Stiftung SPI: Sozialpädagogisches<br />
Institut Berlin/ Clearingstelle Jugendhilfe/ Polizei (Hg.): Leaking – Ankündigungen<br />
schwerer Straftaten an Schulen. Loseblatt Sammlung: Infoblatt Nr.40, Dezember 2006<br />
Robertz, Frank: Erfurt – 5 Jahre danach. In: Hoffmann, Jens/ Wondrak, Isabel (Hg.): Amok und<br />
zielgerichtete Gewalt an Schulen. Frankfurt am Main: Verlag für Polizeiwissenschaft, 2007,<br />
(S.9-24)<br />
Robertz, Frank/ Wickenhäuser, Ruben (09.12.2006): Anerkennung für Amokläufer?<br />
URL:http//www.heise.de/tp/r4/artikel/24/24173/1.html, (Zugriffsdatum: 19.09.2007)<br />
Spiegel online (20.11.2006): Amoklauf in der Schule. Der verhinderte Massenmord.<br />
URL:http://www.spielgel.de/panorama/justiz/0,1518,449622,00.html, (Zugriffsdatum:<br />
20.06.2007)<br />
Spiegel online (20.11.2006): Chronik: Massenmorde in der Schule.<br />
URL:http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,449549,00.html, (Zugriffsdatum:<br />
16.04.2007)<br />
Sprangler, G. Die Psychobiologie der Bindung: Ebenen der Bindungsorganisation. In: Suess, G.<br />
J./ Scheurer–Englisch, H./ Pfeifer, W.–K.,P. (Hg): Bindungstheorie und Familiendynamik. Anwendung<br />
der Bindungstheorie in Beratung und Therapie. Gießen: Psychosozial – Verlag, 2001<br />
(S. 157-180)<br />
Stern.de (21.11.2006): Amoklauf in Emsdetten. Wer war Bastian B.?<br />
URL:http://www.stern.de/politik/deutschland/576933.html, (Zugriffsdatum: 30.06.2007)
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong><br />
Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Literaturverzeichnis<br />
Stern.de (23.11.2006): Interview mit einem Mitschüler des Amokläufers “Bastian war kein Außenseiter“.<br />
URL: http://www.stern.de/tv/sterntv/577045.html, (Zugriffdatum: 30.06.2007)<br />
Stimmer, Franz: Narzissmus:. Zur Psychogenese und Soziogenese narzisstischen Verhaltens. Berlin:<br />
Dunckner und Humblot, 1987<br />
Sueddeutsche.de (20.11.2006): Chronik der Gewalt. Von Littleton bis Emsdetten.<br />
URL:http://www.sueddeutsche.de/panorama/artikel/203/92111/, (Zugriffsdatum 16.04.2007)<br />
Thüringer Justizministerium: (22/ 2004): Pressemitteilung: Bericht der Gutenberg Kommission<br />
zu den Vorgängen am Erfurter Gutenberg Gymnasium am 26. April 2002. Freistaat Thüringen,<br />
2004. URL: http://www.thueringen.de/de/homepage/presse/12251/unidex.html, (Zugriffsdatum:<br />
30.06.2007)<br />
Vogel, Dr., Bernhard: Pressemitteilung der Thüringer Regierung (71/2002): Der 26. April 2002<br />
und die Konsequenzen. URL:http://www.mediengewalt.de/_arc/pre/reg/010.pdf, (Zugriffsdatum:<br />
07.08.2007)<br />
Vossekuil, Bryan/ Fein, Robert/ Randazzo, Marisa Reddy/ Borum, Randy/ Modzeleski, Willian/<br />
Poolack, William: The Final Report and Findings of the Safe <strong>School</strong> Initiative: Implications for<br />
the Prevention of <strong>School</strong> Attacks in the United States. US Secret Service and US Department<br />
of Education. Washington D.C., 2002 URL:http://www.secretservice.gov/ntac/ssi_final_report.pdf,<br />
(Zugriffsdatum: 20.04.2007)<br />
Wahl, Heribert: Narzißmus? Von Freuds Narzissmustheorie zur Selbstpsychologie. Stuttgart, Berlin,<br />
Köln, Mainz: Hohlhammer Verlag, 1985<br />
Wedler, Hans: Über den Terroristensuizid. In Wolfersdorf, Manfred/ Wedler, Hans (Hg.): Terroristen<br />
– Suizide und Amok. Regensburg: S. Roderer Verlag, 2002, (S.37-47)<br />
Wiemken, Jens: Attentat verhindert, Bombe entschärft, Geisel tot. Sind Ego-Shooter wirklich so<br />
problematisch wie man gemeinhin glaubt In: Fritz, Jürgen/ Fehr, Wolfgang (Hg.): Computerspiele<br />
Virtuelle Spiel- und Lernwelten. Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung, 2003,<br />
(auf beiliegender CD-Rom)<br />
Witting, Tanja/ Esser, Heike: Transferprozesse beim Computerspiel. Was aus der Welt des Computerspiels<br />
übertragen wird. In: Fritz, Jürgen/ Fehr, Wolfgang (Hg.): Handbuch Medien: Computerspiele<br />
– Theorie, Forschung, Praxis. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung,/ bpb,<br />
1997, (S.247-262)<br />
Witting, Tanja/ Esser, Heike: Nicht nur das Wirkende bestimmt die Wirkung. In: Fritz, Jürgen/<br />
Fehr, Wolfgang (Hg.): Computerspiele Virtuelle Spiel- und Lernwelten. Bonn: Bundeszentrale<br />
für Politische Bildung, 2003a, (S.30-48)<br />
Witting, Tanja/ Esser, Heike: Virtuelle Gewalt zwischen Sport und Krieg. Zum Marketing von<br />
Ego-Shootern. In: Fritz, Jürgen/ Fehr, Wolfgang (Hg.): Computerspiele Virtuelle Spiel- und<br />
Lernwelten. Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung, 2003b, (auf beiliegender CD-Rom)<br />
Wolf, Ingo (14.12.2006): Rede von Innenminister Dr. Ingo Wolf in der Sitzung des Innenausschusses<br />
des Landtags NRW am 14.12.2006 zum Polizeieinsatz und Anlass des Amoklaufes<br />
eines ehemaligen Schülers der Geschwister-Scholl-Realschule am 20.11.2006 in Emsdetten.<br />
URL: http://www.im.nrw.de/pm/141206_1018.html, (Zugriffsdatum: 20.06.2007)<br />
Wolfersdorf, Manfred/ Purucker, Michael/ Franke, Christopf/ Maurer, Christian: Muss unser Verständnis<br />
von Suizidalität erweitert werden? Suizidologische Splitter nach den Terrorsuiziden<br />
vom 11. September 2001 in New York und Washington D.C., USA. In Wolfersdorf, Manfred/<br />
Wedler, Hans (Hg.): Terroristen – Suizide und Amok. Regensburg: S. Roderer Verlag, 2002,<br />
(S.37-47)
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong><br />
Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Literaturverzeichnis<br />
Weblinks mit persönlichen Dateien von Bastian Bosse<br />
Telepolis (no date): ”Ich will Rache”. Bastians Abschiedbrief.<br />
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/24/24032/1.html, (Zugriffdatum: 20.06.2007)<br />
Bastians Eintrag ins Beratungsforum (no date).<br />
URL:http://blog.dark-born.eu/download/beratungsnetz.php, (Zugriffsdatum: 04.08.2007)<br />
Bastians Onlinetagebuch (no date).<br />
URL:http://www.resistantx.livejounal.com/, (Zugriffsdatum: 18.07.2007)<br />
Bastians Tagebuch (no date).<br />
URL:http//staydifferent.st.ohost.de/diary/, (Zugriffsdatum: 04.08.2007)
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong><br />
Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
9. Anhang<br />
Anhang<br />
Innerhalb des Anhangs werden alle Literaturquellen aufgeführt, die im Rahmen<br />
der Onlinerecherche im Internet ermittelt worden sind. Allerdings hat sich die<br />
Gesamtheit der Dateien als zu umfangreich herausgestellt, um sie normal in den<br />
Anhang einzufügen. Auf Grund dessen werden sie gesondert auf einer CD-Rom<br />
dieser Arbeit beigelegt. Um dennoch eine Übersicht zu gewährleisten, werden im<br />
Folgenden die einzelnen Quellen angeführt werden. Die Auflistung erfolgt anhand<br />
von Überschriften, die mit den Titeln der Dateiordner auf der CD-Rom identisch<br />
sind.<br />
Amerikanische Studien<br />
McGee, James, P./ DeBernado, Caren, R. (2001): The Classroom Avenger. URL:http://www.sheppardpratt.org/Documents/classavenger.pdf,<br />
(30.06.2007)<br />
O’Toole, Mary Ellen (1999): The <strong>School</strong> Shooters: A Threat Assessment Perspective.<br />
URL:http://www.fbi.gov/publications/school/school2.pdf, (Zugriffsdatum: 15.05.2007)<br />
Vossekuil, Bryan/ Fein, Robert/ Randazzo, Marisa Reddy/ Borum, Randy/ Modzeleski, Willian/<br />
Poolack, William: The Final Report and Findings of the Safe <strong>School</strong> Initiative: Implications for<br />
the Prevention of <strong>School</strong> Attacks in the United States.<br />
URL:http://www.secretservice.gov/ntac/ssi_final_report.pdf, (Zugriffsdatum: 20.04.2007)<br />
Forschungsberichte und Artikel<br />
Faust, Volker (no date): Seelische Störungen erkennen, verstehen, verhindern, behandeln: Selbsttötungsgefahr1.<br />
URL: http://www.psychosoziale-gesundheit.net/seele/suizid1.html, (Zugriffsdatum: 19.05.2007)<br />
Faust, Volker (no date): Seelische Störungen erkennen, verstehen, verhindern, behandeln: Amok.<br />
URL: http://www.psychosoziale-gesundheit.net/seele/amok.html, (Zugriffsdatum: 25.04.2007)<br />
Gasser, Karl Heinz/ Creutzfeld, Malte/ Näher, Markus/ Rainer, Rudolf/ Wickler, Peter (2004): Bericht<br />
der Kommission Gutenberg Gymnasium.<br />
URL:http://www.thueringen.de/imperia/md/content/text/justiz/bericht_der_kommission_gutenberg_gymnasium.pdf,<br />
(Zugriffsdatum: 15.06.2007)<br />
Krimpädia/ IKS (Institut für Kriminologische Sozialforschung) (letzter Stand: 16.05.2007): Art.:<br />
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>.<br />
URL:http://www.kriminologie.uni-hamburg.de/wiki/index.php/<strong>School</strong>_<strong>Shooting</strong>, (Zugriffsdatum:<br />
01.10.2007)<br />
Landeskriminalamt NRW (2007): Amoktaten– Forschungsübersicht unter besonderer Beachtung<br />
jugendlicher Täter im schulischen Kontext.<br />
URL::http//: www1.polizei-nrw.de/lka/stepone/data/downloads/d3/00/00/amoktaten.pdf, (Zugriffsdatum:<br />
19.06.2007)<br />
Kopien von Bastian Bosses Internetaktivitäten<br />
Telepolis (no date): ”Ich will Rache”. Bastians Abschiedbrief.<br />
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/24/24032/1.html, (Zugriffdatum: 20.06.2007)
<strong>School</strong> <strong>Shooting</strong><br />
Ursachen und Hintergründe zu extremen Gewalttaten an deutschen Schulen<br />
Anhang<br />
Bastians Eintrag ins Beratungsforum:<br />
URL:http://blog.dark-born.eu/download/beratungsnetz.php, (Zugriffsdatum: 04.08.2007)<br />
Bastians Onlinetagebuch:<br />
URL:http://www.resistantx.livejounal.com/, (Zugriffsdatum: 18.07.2007)<br />
Bastians Tagebuch:<br />
URL:http//staydifferent.st.ohost.de/diary/, (Zugriffsdatum: 04.08.2007)<br />
Pressemitteilungen<br />
Polizei Steinfurt, Pressestelle (23.11.2006): Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft<br />
Münster und der Polizeibehörden Münster und Steinfurt Nachtrag zur OTS Meldung vom<br />
20.11.2006.<br />
URL:http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/43526/905473/polizei_steinfurt, (Zugriffsdatum:<br />
20.06.2007)<br />
Thüringer Justizministerium: (22/ 2004): Pressemitteilung: Bericht der Gutenberg Kommission<br />
zu den Vorgängen am Erfurter Gutenberg Gymnasium am 26. April 2002.<br />
URL: http://www.thueringen.de/de/homepage/presse/12251/unidex.html, (Zugriffsdatum:<br />
30.06.2007)<br />
Vogel, Dr., Bernhard: Pressemitteilung der Thüringer Regierung (71/2002):<br />
URL:http://www.mediengewalt.de/_arc/pre/reg/010.pdf, (Zugriffsdatum: 07.08.2007)<br />
Wolf, Ingo (14.12.2006): Rede von Innenminister Dr. Ingo Wolf in der Sitzung des Innenausschusses<br />
des Landtags NRW am 14.12.2006.<br />
URL: http://www.im.nrw.de/pm/141206_1018html, (Zugriffsdatum: 20.06.2007)<br />
Online verfügbare Artikel<br />
Robertz, Frank/ Wickenhäuser, Ruben (09.12.2006): Anerkennung für Amokläufer?<br />
URL:http//www.heise.de/tp/r4/artikel/24/24173/1.html, (Zugriffsdatum: 19.09.2007)<br />
Spiegel online (20.11.2006): Amoklauf in der Schule. Der verhinderte Massenmord.<br />
URL:http://www.spielgel.de/panorama/justiz/0,1518,449622,00.html, (Zugriffsdatum: 20.06.2007)<br />
Stern.de (21.11.2006): Amoklauf in Emsdetten. Wer war Bastian B.?<br />
URL:http://www.stern.de/politik/deutschland/576933.html, (Zugriffsdatum: 30.06.2007)<br />
Stern.de (23.11.2006): Interview mit einem Mitschüler des Amokläufers “Bastian war kein Außenseiter“.<br />
URL: http://www.stern.de/tv/sterntv/577045.html, (Zugriffdatum: 30.06.2007)<br />
Onlinequellen der statistischen Erhebung<br />
Infoplease.com (2007): A Time Line of Recent Worldwide <strong>School</strong> <strong>Shooting</strong>s.<br />
URL:http://www.infoplease.com/ipa/A0777958.html, (Zugriffsdatum: 07.10.2007)<br />
Spiegel online (20.11.2006): Chronik: Massenmorde in der Schule.<br />
URL:http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,449549,00.html, (Zugriffsdatum: 16.04.2007<br />
Sueddeutsche.de (20.11.2006): Chronik der Gewalt. Von Littleton bis Emsdetten.<br />
URL:http://www.sueddeutsche.de/panorama/artikel/203/92111/, (Zugriffsdatum 16.04.2007)
Eidesstattliche Erklärung<br />
Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig<br />
und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe; die<br />
aus fremden Quellen (einschließlich elektronischer Quellen) direkt oder indirekt<br />
übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht.<br />
<strong>Vechta</strong>, den 15.10.2007<br />
____________________