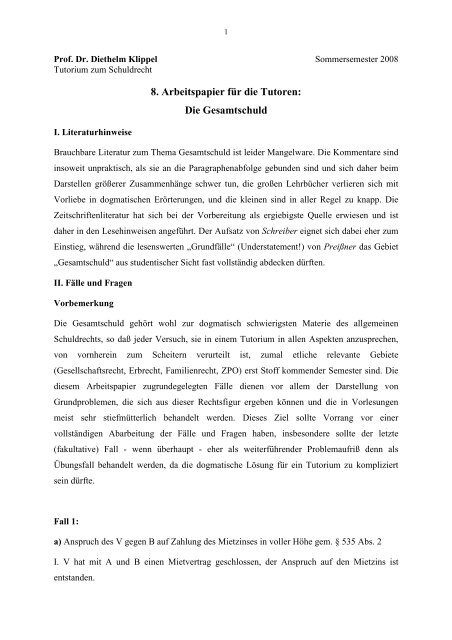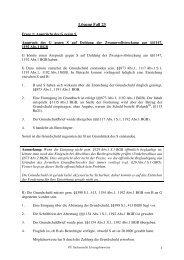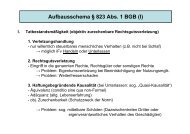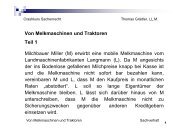Lösung Fall 8 - Zivilrecht VI
Lösung Fall 8 - Zivilrecht VI
Lösung Fall 8 - Zivilrecht VI
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1<br />
Prof. Dr. Diethelm Klippel Sommersemester 2008<br />
Tutorium zum Schuldrecht<br />
I. Literaturhinweise<br />
8. Arbeitspapier für die Tutoren:<br />
Die Gesamtschuld<br />
Brauchbare Literatur zum Thema Gesamtschuld ist leider Mangelware. Die Kommentare sind<br />
insoweit unpraktisch, als sie an die Paragraphenabfolge gebunden sind und sich daher beim<br />
Darstellen größerer Zusammenhänge schwer tun, die großen Lehrbücher verlieren sich mit<br />
Vorliebe in dogmatischen Erörterungen, und die kleinen sind in aller Regel zu knapp. Die<br />
Zeitschriftenliteratur hat sich bei der Vorbereitung als ergiebigste Quelle erwiesen und ist<br />
daher in den Lesehinweisen angeführt. Der Aufsatz von Schreiber eignet sich dabei eher zum<br />
Einstieg, während die lesenswerten „Grundfälle“ (Understatement!) von Preißner das Gebiet<br />
„Gesamtschuld“ aus studentischer Sicht fast vollständig abdecken dürften.<br />
II. Fälle und Fragen<br />
Vorbemerkung<br />
Die Gesamtschuld gehört wohl zur dogmatisch schwierigsten Materie des allgemeinen<br />
Schuldrechts, so daß jeder Versuch, sie in einem Tutorium in allen Aspekten anzusprechen,<br />
von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, zumal etliche relevante Gebiete<br />
(Gesellschaftsrecht, Erbrecht, Familienrecht, ZPO) erst Stoff kommender Semester sind. Die<br />
diesem Arbeitspapier zugrundegelegten Fälle dienen vor allem der Darstellung von<br />
Grundproblemen, die sich aus dieser Rechtsfigur ergeben können und die in Vorlesungen<br />
meist sehr stiefmütterlich behandelt werden. Dieses Ziel sollte Vorrang vor einer<br />
vollständigen Abarbeitung der Fälle und Fragen haben, insbesondere sollte der letzte<br />
(fakultative) <strong>Fall</strong> - wenn überhaupt - eher als weiterführender Problemaufriß denn als<br />
Übungsfall behandelt werden, da die dogmatische Lösung für ein Tutorium zu kompliziert<br />
sein dürfte.<br />
<strong>Fall</strong> 1:<br />
a) Anspruch des V gegen B auf Zahlung des Mietzinses in voller Höhe gem. § 535 Abs. 2<br />
I. V hat mit A und B einen Mietvertrag geschlossen, der Anspruch auf den Mietzins ist<br />
entstanden.
2<br />
II. Fraglich ist jedoch, in welcher Höhe B diesen Anspruch zu erfüllen hat. Die unbefangene<br />
Lektüre von § 420 würde in der Tat eine Aufteilung nach Nutzenanteilen bzw. („im Zweifel“)<br />
nach Köpfen nahelegen. Allerdings ist für vertraglich begründete Schulden § 427 spezieller,<br />
der im Zweifel Gesamtschuldnerschaft anordnet.<br />
Allerdings stellt § 427 BGB keine zwingende Norm, sondern nur eine Auslegungsregel dar.<br />
Im Einzelfall kann sich daher durch ausdrückliche Vereinbarung oder auch aus den<br />
Umständen etwas anderes ergeben. Bsp.: Zwei Familien kaufen bei einem Heizölhändler<br />
gemeinsam Öl ein, um Mengenrabatt zu erhalten; mit dem Händler wird entsprechend<br />
getrennte Lieferung und Rechung unter anteiliger Anrechnung des Mengenrabatts vereinbart:<br />
Keine Gesamtschuld. Oder: Mehrere private Bauherren haben sich aus Kostengründen zur<br />
Errichtung einer Wohneigentumsanlage zusammengefunden und schließen mit dem<br />
Unternehmer einen entsprechenden Bauvertrag - keine Gesamtschuld, da die Interessenlage<br />
stark für eine Teilschuld iSd § 420 BGB spricht (kaum einer kann für alle zahlen).<br />
Im konkreten <strong>Fall</strong> fehlt es jedoch an dererlei konkreten Hinweisen, so daß eine<br />
gesamtschuldnerische Haftung von A und B zu bejahen ist. Jedenfalls deswegen ist § 421<br />
anwendbar, der dem Gläubiger den Zugriff auf jeden Schuldner in voller Höhe eröffnet. V<br />
kann daher von A oder von B den gesamten Betrag fordern. Da er B ausgewählt hat, muß<br />
dieser für sämtliche Schulden aufkommen (zum Regreß später).<br />
b) Philipp von Heck (1858-1943, führender Vertreter der Interessenjurisprudenz) spielt auf<br />
eben diese Möglichkeit des Gläubigers an, sich sein „Opfer“ mehr oder weniger willkürlich<br />
aus dem Kreis der Gesamtschuldner aussuchen zu können, ohne Rücksicht darauf, welche<br />
Stellung dem Betroffenen im Verhältnis der Gesamtschuldner zueinander zukommt.<br />
c) Anspruch des V gegen Tick, Trick oder Track auf Zahlung des Mietzinses in voller Höhe<br />
gem. §§ 535 Abs. 2, 427, 421 S. 1<br />
I. Sämtliche Mieter haben gemeinsam mit V einen Mietvertrag geschlossen, der Anspruch auf<br />
den Mietzins ist entstanden, §§ 535 Abs. 2, 427, 421 S. 1. Da sie als Gesamtschuldner haften,<br />
kann V grundsätzlich jeden in voller Höhe in Anspruch nehmen.<br />
II. Der Anspruch könnte indes durch die Aufrechnung des D erloschen sein. D und V hatten<br />
gegeneinander fällige und einredefreie Geldforderungen in gleicher Höhe (§ 387), und D hat<br />
die Aufrechnung erklärt (§ 389). Einer Aufrechnung steht insbesondere § 393 nicht entgegen,<br />
da D nicht gegen eine Forderung aus unerlaubter Handlung aufrechnet, sondern mit einer. Die<br />
Forderung des V gegen D aus §§ 535 Abs. 2, 427, 421 S. 1 ist damit erloschen (§ 389). Diese
3<br />
Wirkung tritt auch im Verhältnis von V zu den übrigen Mietern ein, § 422 I 1, 2; daß V von D<br />
ablassen wollte, spielt keine Rolle. V hat keine Ansprüche gegen Tick, Trick oder Track.<br />
<strong>Fall</strong> 2:<br />
Dieser <strong>Fall</strong> soll - neben einem Beispiel für eine gesetzlich angeordnete Gesamtschuld - vor<br />
allem die ökonomische Bedeutung dieses Rechtsinstituts verdeutlichen.<br />
I. Ansprüche des U gegen K bestehen aus §§ 823 I (Gesundheit, Eigentum); 823 II i.V.m. 229<br />
StGB sowie straßenverkehrsrechtlichen Normen. Sie sind jedoch wegen der Situation des K<br />
wirtschaftlich wertlos: Die Durchsetzung eines Anspruchs gegen den niederländischen<br />
Pflichtversicherer wird schwierig sein und erfordert im Streitfall eine Prozeßführung im<br />
Ausland.<br />
II. Ansprüche des U gegen H bestehen jedenfalls aus § 823 I (Gesundheit, Eigentum), da<br />
insbesondere das Fehlverhalten des K die Haftung des H nicht ausschließt.<br />
III. H und K haften gem. §§ 840 I, 421 S. 1 als Gesamtschuldner; der Ausgleich im<br />
Innenverhältnis erfolgt entsprechend § 254 I nach der jeweiligen Verantwortung (die<br />
Verteilung nach Köpfen gem. § 426 gilt nur, „soweit nicht ein anderes bestimmt ist“). U kann<br />
daher den wirtschaftlich wertvolleren Anspruch gegen H geltend machen, ohne auf die Höhe<br />
von dessen Verschulden Rücksicht nehmen zu müssen. Ökonomisch gesehen wird damit<br />
durch die Gesamtschuld das Risiko einer Insolvenz des K auf H abgewälzt.<br />
<strong>Fall</strong> 3:<br />
Es kommt eine gesamtschuldnerische Haftung von F, M, und V gem. §§ 840 I, 421 S.1 in<br />
Betracht.<br />
• Gegen F als Fahrerin hat S Ansprüche aus §§ 823 I, 823 II i.V.m. 229 StGB und 823 II<br />
i.V.m. 18 I StVG.<br />
• Gegen V als Halter hat S Ansprüche aus §§ 823 I, 823 II i.V.m. 229 StGB und 823 II<br />
i.V.m. 7 I StVG.<br />
• Gegen M als Halterin hat S einen Anspruch aus §§ 823 II i.V.m. 7 I StVG.<br />
Gem. §§ 840 I, 421 S. 1 haften F, M und V somit gesamtschuldnerisch.<br />
F könnte gegen V einen Anspruch auf hälftige Beteiligung an den ihr entstandenen Kosten<br />
aus § 426 I haben. Demnach sind Gesamtschuldner grundsätzlich zu gleichen Anteilen<br />
verpflichtet, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. Es stellt sich die Frage, nach welchen<br />
Regeln der Innenausgleich zwischen F, M und V stattfindet. Wie in <strong>Fall</strong> 2) gezeigt, ist bei
4<br />
Schadensersatzansprüchen in entsprechender Anwendung des § 254 grundsätzlich der<br />
jeweilige Verschuldensanteil entscheidend. Im Gegensatz zu <strong>Fall</strong> 2) kommt es hier jedoch auf<br />
ein Mitverschulden zunächst nicht an, da § 254 BGB von § 17 I S. 1 StVG als Sonderregel<br />
ausgeschlossen wird (Palandt-Heinrichs, § 426 Rn. 10). Ansatzpunkt für die<br />
Haftungsaufteilung ist hier vielmehr die vom Fahrzeug ausgehende Betriebsgefahr. Dabei<br />
handelt es sich um die Summe der Gefahren, die das Kfz durch seine Eigenart in den Verkehr<br />
trägt. Erhöht wird die Betriebsgefahr durch die besondere Bauart des Fahrzeugs, etwaige<br />
Mängel oder - nach allgemeiner Auffassung - ein Verschulden des Fahrers. Ist neben den<br />
Haltern, deren Haftung sich aus § 17 I S. 1 StVG ergibt, auch ein Fahrer gem. § 18 I StVG für<br />
einen Schaden durch mehrere Kfz verantwortlich, ist er gem. § 18 III StVG an der<br />
Haftungsaufteilung des § 17 StVG zu beteiligen. Dies gilt allerdings nur gegenüber den<br />
"Haltern und Führern der anderen beteiligten Fahrzeuge", nicht gegenüber dem Halter des<br />
von ihm selbst gelenkten Fahrzeugs. Mit diesem bildet er eine Haftungseinheit (Palandt-<br />
Heinrichs, § 426 Rn. 11). Bei der Quotenbildung werden sie also wie eine Person behandelt.<br />
Das Verschulden der F hat die Betriebsgefahr des Fahrzeugs erhöht, so dass sich M dieses<br />
zurechnen lassen muss. Gewichtet man das Verschulden des V und der F gleich hoch, gelangt<br />
man aber nicht zu einer Dreiteilung der Quoten. Das würde nämlich bedeuten, dass das<br />
Verschulden der F doppelt berücksichtigt würde. Dem V darf aber nicht zugute kommen, dass<br />
zufällig nicht die Halterin M selbst gefahren ist.<br />
V ist also im Unrecht. Er muß gem. § 426 I für die Hälfte der Kosten aufkommen.<br />
(Anm.: Nimmt S nicht F, sondern V in Anspruch, kann dieser M und F gesamtschuldnerisch<br />
auf deren gemeinsame Quote in Rückgriff nehmen. Dabei bilden M und F ein "gestuftes"<br />
Gesamtschuldverhältnis. Sie gleichen sich im Innenverhältnis nicht nach §§ 17, 18 StVG,<br />
sondern nach §§ 426 I, 254 BGB analog aus.)<br />
Ein Anspruch der F gegen den V auf Kostenbeteiligung ergibt sich auch aus § 426 II.<br />
(Anm.: An dieser Stelle sollte kurz auf die cessio legis hingewiesen werden, ohne die<br />
Darstellung jedoch zu vertiefen.)<br />
<strong>Fall</strong> 4:<br />
Hier scheidet eine Gesamtschuld der Sänger jedenfalls hinsichtlich des Primäranspruchs<br />
schon deswegen aus, weil keiner von ihnen alleine die gesamte Leistung erbringen kann (vgl.<br />
die Definition in § 421); es wäre unsinnig, eine Einzelperson zum Vortrag eines<br />
vierstimmigen Liedes zu verurteilen. Wenn aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die
5<br />
geschuldete Leistung nur gemeinsam von allen Schuldnern erbracht werden kann, liegt eine<br />
sog. gemeinschaftliche Schuld vor. Jeder schuldet dann seine Mitwirkung an der<br />
Leistungserbringung, eine Gesamtschuld kommt jedoch nicht in Frage. Bei<br />
Sekundäransprüchen kann es allerdings zu einer gesamtschuldnerischen Haftung kommen.<br />
Abzugrenzen ist die Gesamtschuld daher von<br />
- der gemeinschaftlichen Schuld: Der Unterschied liegt darin, daß hier aus rechtlichen oder<br />
tatsächlichen Gründen von den Schuldnern nur gemeinsam geleistet werden kann.<br />
- der Teilschuld gem. § 420: Es besteht ein einheitliches Schuldverhältnis, das aber auf eine<br />
teilbare Leistung gerichtet ist.<br />
- der sog. Leistungskumulation (unproblematisch): Es bestehen zwischen Gläubiger und den<br />
Schuldnern mehrere unabhängige, nicht verbundene Schuldverhältnisse, die u.U. gemeinsam<br />
einem übergeordneten Zweck des Gläubigers dienen. (Bsp.: Der lokale Gemüsehändler<br />
bestellt von zwei Großhändlern je 10 Zentner Spinat, um am Gründonnerstag den Ort mit<br />
mindestens 10 Zentnern versorgen zu können).<br />
Entstehen kann eine Gesamtschuld:<br />
- aus Vertrag bzw. aus „Vertrag und Gesetz“ (§ 427).<br />
- aus Gesetz, z.B. § 769 bei Mitbürgen, § 840 I bei unerlaubten Handlungen mehrerer. Die<br />
weiteren gesetzlich geregelten Fälle knüpfen häufig an delikate Tatbestände an (§§ 2058,<br />
1357 I, 431, ...), die Zweitsemestern im Zweifel nicht bekannt sind, so daß das Tutorium<br />
damit nicht belastet werden sollte.<br />
<strong>Fall</strong> 5:<br />
Hinsichtlich der Frage der Entstehung einer Gesamtschuld ist <strong>Fall</strong> 4 weniger im Ergebnis als<br />
vielmehr in der Begründung ein Problemfall. Letztlich ausschlaggebend ist dafür, wie man §<br />
421 liest: Als konstitutiven Tatbestand für eine Gesamtschuld, oder als Tatbestand, der die<br />
Folgen einer Gesamtschuld regelt („freier Zugriff“), sie aber selbst schon voraussetzt.<br />
Fraglich ist, ob M, G und die P-AG gegenüber V als Gesamtschuldner haften. Dies hängt im<br />
konkreten <strong>Fall</strong> letztlich davon ab, wie man § 421 versteht. Die beiden Meinungen, die im<br />
folgenden dargestellt werden, kommen mit unterschiedlicher Begründung im vorliegenden<br />
<strong>Fall</strong> zum gleichen Ergebnis. Die Studenten sollten also darauf aufmerksam gemacht werden,<br />
daß die ausführliche Darstellung, die die Tutoren nun geben, in einer Klausur oder Hausarbeit<br />
nicht in voller Länge darzustellen wäre.
6<br />
I. Wenn man mit einer Literaturansicht davon ausgeht, daß § 421 selbst einen<br />
Begründungstatbestand enthält, d.h. eine Gesamtschuld vorliegt, wenn mehrere Schuldner in<br />
der in § 421 beschriebenen Weise eine Leistung schulden, dann könnte man im <strong>Fall</strong> 4<br />
durchaus auf eine Gesamtschuld von M, G, und P-AG kommen:<br />
1. V hat Ansprüche auf Ersatz des Brandschadens gegen M aus § 823 I und §§ 823 II i.V.m.<br />
306d StGB.<br />
2. V hat Ansprüche auf Ersatz des Brandschadens gegen G aus § 823 I und §§ 823 II i.V.m.<br />
306d StGB. M und G haften als Gesamtschuldner, §§ 840 I, 421 S. 1.<br />
3. V hat gegen die P-AG Ansprüche auf Ersatz des Brandschadens aus dem<br />
Versicherungsvertrag.<br />
4. V kann ersichtlich nur einmal Erfüllung verlangen, da im <strong>Fall</strong>e einer Zahlung der P-AG<br />
seine Ansprüche gegen M und G auf diese übergehen, § 67 VVG. Zahlen dagegen M<br />
und/oder G, braucht die P-AG nicht einzuspringen.<br />
Damit wären, legt man § 421 als konstitutiven Tatbestand zugrunde, die Voraussetzungen für<br />
das Zustandekommen einer Gesamtschuld erfüllt. Interessengerecht ist dieses Ergebnis jedoch<br />
nicht: Der Regreß wird nämlich dann kompliziert, wenn sich V - wie zu erwarten - an die<br />
zahlungskräftige Versicherung hält. Deren Ausgleichsanspruch hängt dann davon ab,<br />
„wieweit“ sie im Innenverhältnis Ausgleich verlangen kann, vgl. § 426 I, II; umgekehrt<br />
könnten M und/oder G, sofern sie die Schuld tilgen, zumindest grundsätzlich einen Regreß<br />
gegen die Versicherung in Betracht ziehen. Man könnte zwar wohl dadurch zu einem billigen<br />
Ergebnis kommen, daß man die Innenverpflichtung der Versicherung pauschal mit „Null“<br />
ansetzt, aber dogmatisch ist das nicht gerade befriedigend: Die Versicherung, deren Leistung<br />
typischerweise darin liegt, Insolvenzgefahren sowie die Nichtentdeckung von<br />
Verantwortlichen abzusichern, paßt nicht in einen „Haftungsverband“ mit den deliktischen<br />
Schädigern. Daher nehmen auch diejenigen Literaturvertreter, die § 421 als konstitutiven<br />
Tatbestand betrachten, die Fälle aus, in denen ein Schuldner als Alleinverursacher, der andere<br />
als Fürsorgepflichtiger haftet. Somit liegt nach dieser Ansicht keine Gesamtschuld von M, G<br />
und der P-AG vor (wohl aber von M und G).<br />
II. Die mittlerweile wohl dominierende Gegenmeinung setzt direkt bei der Auslegung des §<br />
421 an und betrachten ihn als bloßes Regelungsinstrument für die Rechtsfolge einer bereits<br />
entstandenen Gesamtschuld.
7<br />
1. Nach der inzwischen wohl aufgegebenen älteren Rechtsprechung sollte ein solches<br />
Vorliegen, wenn mehrere Schuldner dasselbe Leistungsinteresse zu befriedigen haben und<br />
zwischen den Gläubigern eine rechtliche Zweckgemeinschaft besteht, d.h. die Ansprüche also<br />
nicht nur zufällig und absichtslos nebeneinanderstehen. Wenn dies doch der <strong>Fall</strong> ist, sollte<br />
eine sog. „unechte Gesamtschuld“ vorliegen, die nicht nach Gesamtschuldregeln zu<br />
behandeln ist.<br />
2. Die nun wohl herrschende Rechtsprechungs- und Literaturmeinung lehnt den Begriff der<br />
„Zweckgemeinschaft“ (zu Recht) als „zu unscharf“ ab und verlangt für die Entstehung der<br />
Gesamtschuld neben der Identität des Leistungsinteresses auch eine Gleichstufigkeit der<br />
konkurrierenden Ansprüche, was davon abhängen soll, ob einer der Verpflichteten letztlich<br />
prinzipiell allein für die Leistung aufkommen muß oder nicht: Stellt die Erfüllung durch einen<br />
anderen nur eine Art „Vorschuß“ dar, der lediglich das Liquiditätsrisiko mindern soll, so liegt<br />
keine Gesamtschuld vor. Daher haftet auch nach dieser Ansicht die P-AG nicht als<br />
Gesamtschuldner mit M und G.<br />
Die Folgen dieser Ausklammerung der P-AG sind im wesentlichen:<br />
- Eine Zahlung der P-AG hat keine wechselseitige Tilgungswirkung (§ 422 I scheidet aus!),<br />
d.h. die Ansprüche des V gegen M und G bleiben bestehen und gehen im Wege der<br />
Legalzession (§ 67 I VVG) auf die P-AG über, die daraus nun gegen M und G vorgehen kann,<br />
ohne sich um Fragen des Schuldausgleichs kümmern zu müssen.<br />
- Sofern V zuerst M oder G in Anspruch nimmt, braucht keiner der beiden einen Gedanken<br />
darauf zu verschwenden, ob nicht bei der P-AG noch etwas im Regreßwege zu holen wäre<br />
(weil § 426 nicht in Betracht kommt).<br />
<strong>Fall</strong> 6:<br />
Das Problem dieses <strong>Fall</strong>es wird am besten sichtbar, wenn man mit Ansprüchen des V beginnt.<br />
A) Anspruch des V gegen H aus §§ 535 Abs. 2, 427, 421<br />
I. Der Anspruch ist aus dem Mietvertrag gegen H als Gesamtschuldner entstanden, §§ 535<br />
Abs. 2, 427, 421.<br />
II. Eine Geltendmachung des Anspruchs gegenüber H ist aber durch den „Erlaß“ -<br />
unbeschadet seiner rechtlichen Qualifizierung - ausgeschlossen.<br />
B) Anspruch des V gegen N und K als Gesamtschuldner, §§ 535 Abs. 2, 427, 421 S.1.<br />
I. Die Ansprüche sind aus dem Mietvertrag gem. §§ 535 Abs. 2, 427, 421 S. 1 entstanden.
8<br />
II. Fraglich ist indes ihre Höhe. Sie hängt davon ab, welche Qualität der „Erlaß“ gegenüber H<br />
hat. Dies ist durch Auslegung des „Erlaßvertrages“ zu ermitteln.<br />
1. Man könnte den „Erlaß“ dahingehend deuten, daß V den H völlig freigestellt haben möchte<br />
und gegen N und K in voller Höhe vorgehen kann; es kommt zu keinem Regreß im<br />
Innenverhältnis gem. § 426.<br />
2. Der Erlaß könnte bedeuten, daß V von H nichts fordern will, von K und N jedoch den Preis<br />
in voller Höhe verlangt, wobei der Ausgleich im Innenverhältnis davon nicht berührt wird.<br />
3. V verzichtet im Ergebnis auf denjenigen Teil der Mieteinnahmen, der dem Anteil des H im<br />
Innenverhältnis entspricht und geht in Höhe des Restes gegen K und N vor und geht davon<br />
aus, daß H im Innenverhältnis nicht ausgleichspflichtig ist (sonst beträgt der „Erlaß“<br />
gegenüber H nur 1/6, und K kommt in den Genuß des gleichen Erlaßbetrages).<br />
4. Bewertung:<br />
Es ist allgemein anerkannt, daß der Gläubiger nicht einseitig in das Innenverhältnis der<br />
Gesamtschuldner eingreifen kann: Damit entfällt Variante 1, die im Ergebnis zu einem mit<br />
der Privatautonomie nicht zu vereinbarenden Vertrag zu Lasten Dritter führt (interne<br />
„Mieterhöhung“ für K und N um jeweils 150,- DM). Variante 2 ist völlig unproblematisch, V<br />
könnte das gleiche Ergebnis auch einfach dadurch erreichen, daß er H - ohne „Erlaß“ - nicht<br />
in Anspruch nimmt. Der einzige Vorteil für H besteht dann allerdings darin, nicht den<br />
gesamten Betrag an V zahlen zu müssen (evtl. Liquiditätsaspekt), da ihn im Innenverhältnis<br />
der Regreß aus §§ 426 I, II ereilt. Das dürfte aber kaum dem Parteiwillen bei Abschluß des<br />
Vertrages entsprochen haben; Absicht war hier vielmehr, dem H einen „echten“<br />
Vermögenswert in Gestalt kostenfreien Wohnens zukommen zu lassen, und den anderen<br />
Parteien, insbesondere K, nicht.<br />
Interessengerecht und in der Zulässigkeit unstreitig ist daher Variante 3, die sich im Ergebnis<br />
als (echter) Erlaß mit beschränkter Gesamtwirkung darstellt. Problematisch ist nur ihre<br />
Begründung, da man ohne einen „Eingriff“ in das Gesamtschuldverhältnis nicht auskommt,<br />
weil ansonsten § 426 I, II sämtliche gewollten Ungleichheiten einebnet. Vertreten werden<br />
folgende Ansätze (Vgl. Preißner, JuS 1987, S. 294 m.w.N.):<br />
a) Erlaß gegenüber dem Erlaßpartner mit Wirkungen eines Vertrages zugunsten Dritter für die<br />
übrigen Schuldner in Höhe ihrer Ausgleichsberechtigung,<br />
b) Teilgesamterlaß für alle Gesamtschuldner, verbunden mit einem Teileinzelerlaß zugunsten<br />
des Erlaßpartners,
9<br />
c) ein Regreßhinderungsverbot analog §§ 776, 1165.<br />
Der Streit kann offenbleiben, da die Ergebnisse übereinstimmen; im Tutorium wird es kaum<br />
ratsam sein, auf die verschiedenen dogmatischen Ansätze (insbesondere c)) einzugehen.<br />
Wenn klar wird, daß die Zulässigkeit eines Eingriffs in das Innenverhältnis einer<br />
Gesamtschuld im Ergebnis zu einem Vertrag zu Lasten Dritter führen kann, ist schon einiges<br />
erreicht.<br />
Extrem problematisch würde dies nämlich in <strong>Fall</strong> 7. Es handelt sich hier um den Standardfall<br />
der „gestörten Gesamtschuld“, der ausführlich bei Medicus, Bürgerliches Recht, 19. Aufl.<br />
2002, Rn. 928-938 erörtert wird; eine kurze Darstellung findet sich bei Köhler, PdW/<br />
Schuldrecht I, 18. Aufl. 2000, <strong>Fall</strong> 136.<br />
Das Kernproblem liegt hier darin, daß der Haftungsausschluß das Entstehen einer<br />
Gesamtschuld hindert (da B nichts schuldet), so daß W an sich - unabhängig von seinem<br />
Verschulden - für den gesamten Schaden aufkommen müßte, während er ohne einen<br />
Haftungsausschluß Gesamtschuldner würde und gem. §§ 426, 254 Regreß in Höhe von 75%<br />
nehmen könnte. Im Ergebnis wird W also durch den Vertrag zwischen B und D benachteiligt;<br />
das ist kaum hinnehmbar. Die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten - fingierte Gesamtschuld<br />
bzw. a priori Anspruchskürzung um den von der Haftung freigestellten Teil über die<br />
Konstruktion des Haftungsausschlußvertrages als „Vertrag zugunsten (zukünftiger)<br />
Zweitschädiger“ (interessengerechter) - sind bei Medicus a.a.O. ausführlich erörtert, so daß<br />
von einer Darstellung an dieser Stelle - zumal die Zeit ohnehin für diesen <strong>Fall</strong> kaum reichen<br />
dürfte - abgesehen wird. Es genügt wohl, das Problem zu zeigen (deswegen auch „zum<br />
Weiterdenken“).