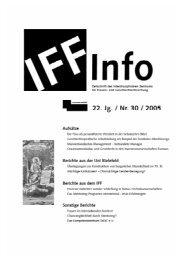IFF-Info Nr. 26, 2003 - IFFOnzeit
IFF-Info Nr. 26, 2003 - IFFOnzeit
IFF-Info Nr. 26, 2003 - IFFOnzeit
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Geschlecht in Behandlungsangeboten sozialpsychiatrischer Versorgungseinrichtungen<br />
Die Daten der Interview-Befragung<br />
zeichnen ein realistisches und nüchternes<br />
Bild von der Lebenssituation<br />
der KlientInnen. Die Art des Kontaktaufbaus<br />
zur Gewinnung der<br />
ProbandInnen schließt nicht aus,<br />
dass wir für unsere Gespräche möglicherweise<br />
überwiegend aufgeschlossene,<br />
verbalisierungsfähige<br />
und weniger „kranke“ ProbandInnen<br />
erreichten. Insgesamt lebten von<br />
den zur Interview-Mitarbeit bereiten<br />
ProbandInnen 15 in den verschiedenen<br />
Heimen (sechs Frauen/<br />
neun Männer) und 14 (je sieben<br />
Frauen und Männer) in einer Wohngemeinschaft<br />
oder auch alleine, letztere<br />
werden jedoch im Betreuten<br />
Wohnen begleitet. In eine vertiefte<br />
Analyse wurden 12 Interviews –<br />
jeweils sechs Frauen und sechs Männer<br />
– einbezogen. Ausgeklammert<br />
wurden jene Interviews, bei denen<br />
sich erkennen ließ, dass eine UntersuchungsteilnehmerIn<br />
sich in einer<br />
Akutphase der psychischen Erkrankung<br />
befand. Die Erstinformation<br />
und der Kontakt erfolgte ausschließlich<br />
über die MitarbeiterInnen.<br />
Interessanterweise waren die<br />
Männer bereitwilliger zu einer Mitarbeit<br />
zu bewegen, die Frauen hielten<br />
sich stärker zurück. Eine eher<br />
überraschende Tatsache, unterstellt<br />
man die übliche Meinung, Frauen<br />
seien aufgrund ihrer Sozialisation<br />
eher zur verbalen Kommunikation<br />
über Emotionen und den Beziehungskontext<br />
konditioniert und<br />
Männer eher für die aktive „Macher-<br />
Ebene“. Unsere rekrutierten männlichen<br />
Untersuchungsteilnehmer<br />
meldeten sich nicht nur bereitwilliger<br />
zur Teilnahme, sondern schienen<br />
auf den ersten Blick auch offener,<br />
über ihren intimen Bereich auszusagen.<br />
Dem traditionellen Geschlechterstereotyp<br />
blieben die befragten<br />
Männer und Frauen dennoch treu,<br />
indem sie die Inhalte ihrer Erzählungen<br />
in eine Fakten-Ebene und<br />
Emotionen-Ebene trennten. Die<br />
Frauen berichteten in allen Zusammenhängen<br />
eher von ihren Gefühlen,<br />
die Männer beschrieben jedoch<br />
auch im Gefühlsbereich die faktischen<br />
Begebenheiten. Die Geschlechter-Trennung<br />
dieser Erzählweisen<br />
korrespondiert mit jener der<br />
MitarbeiterInnen. Nicht überprüfbar<br />
war in diesem Interviewkontext,<br />
inwieweit das Geschlecht der Interviewerin<br />
für das Gespräch geschlechtsspezifisch<br />
bedeutungsvoll<br />
wurde. Mit Sicherheit jedoch war es<br />
wirkungsvoll. In unserer quantitativen<br />
Befragung betonten 38% der<br />
befragten Frauen und Männer, dass<br />
es schwieriger sei, mit einem Mann<br />
über Probleme zu sprechen, d.h. die<br />
überwiegende Mehrheit sprach sich<br />
positiv für eine weibliche Gesprächspartnerin<br />
aus.<br />
Entgegen der Befürchtung einiger<br />
Professioneller, die befragten<br />
NutzerInnen könnten durch die Interviews<br />
dekompensieren, blieben<br />
alle interviewten Personen während<br />
des Interviews ebenso wie nach Abschluss<br />
des Gespräches stabil und<br />
unbefangen. Im Gegensatz zu diesen<br />
Befürchtungen schienen sie<br />
überwiegend die Aufmerksamkeit<br />
zu genießen und die Befragung als<br />
eine Ablenkung und Bereicherung<br />
des Alltages anzusehen.<br />
Beschreibung der<br />
Untersuchungsgruppe<br />
Die sozialen Erfahrungen der ProbandInnen<br />
aus der Interview-<br />
Gruppe unterscheiden sich wesentlich:<br />
Nur ein Mann ist verheiratet,<br />
alle anderen sind ledig, keiner hat eigene<br />
Kinder. Demgegenüber sind<br />
nur zwei Frauen ledig und haben<br />
keine Kinder, die restlichen waren<br />
alle verheiratet und haben ein oder<br />
zwei Kinder. Inzwischen sind diese<br />
Frauen geschieden. Das Alter der<br />
Befragten lag zwischen Anfang 30<br />
bis Ende 40. Was ihre Lebensplanung<br />
anbelangt, haben sich die Interviewten<br />
mit ihrer Lebensform arrangiert<br />
und äußern dementsprechend<br />
bezüglich der Lebensqualität<br />
eine relative Zufriedenheit. Alle TeilnehmerInnen<br />
der Interview-Befragung<br />
beschrieben während ihrer<br />
Biographie-Darstellung die Kriterien<br />
einer chronischen psychotischen<br />
Erkrankung. Da uns die Selbsteinschätzung<br />
der Erkrankung, die in direkter<br />
Abhängigkeit zu einer Krankheitseinsicht<br />
und Compliance steht,<br />
wesentlich war, verknappe ich an<br />
dieser Stelle die Angaben der NutzerInnen.<br />
Fast alle wussten ihre<br />
Krankheit zu definieren, wenn auch<br />
nicht immer differenziert. In der<br />
Gruppe der intensiv ausgewerteten<br />
Interviews wurden als Erkrankung<br />
endogene Psychose angegeben, die<br />
Differenzierungen waren Wahnvorstellungen,<br />
Ängste, Depressionen,<br />
Halluzinationen, Schizophrenie und<br />
„Stimmen-hören“. In der Analyse<br />
der Interviews wurde erkennbar,<br />
dass zwei Klientinnen ihre Erkrankung<br />
nicht einsehen, ein Klient sich<br />
nicht als erkrankt anerkennt und einer<br />
seine Diagnose als „medizinisch<br />
übertrieben“ ablehnte. Beide Männer<br />
berichteten über eine zwangsweise<br />
Einlieferung in die Psychiatrie,<br />
was mit ihrer Einstellung zusammenhängen<br />
mag.<br />
Alle ProbandInnen der Interview-Erhebung<br />
sind langzeiterfahrene<br />
KlientInnen, die sich inzwischen<br />
in der Psychiatrie-Szene eingerichtet<br />
haben, das bedeutet, zwar äußerlich<br />
den Wunsch bzw. das Ziel formulieren,<br />
in die „Normalität“ zurück<br />
zu wollen, aber de facto das<br />
Leben im Betreuten Wohnen oder<br />
im Heim als den eigenen Ort anzuerkennen.<br />
Im Klienten-Interview<br />
fünf wird sogar ausdrücklich erwähnt,<br />
dass sein Lebensraum in diesem<br />
Heim liege. Diese Menschen<br />
<strong>Info</strong> 20.Jg. <strong>Nr</strong>.<strong>26</strong>/<strong>2003</strong><br />
35