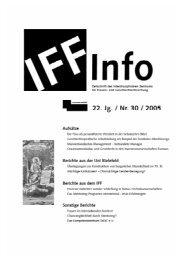IFF-Info Nr. 26, 2003 - IFFOnzeit
IFF-Info Nr. 26, 2003 - IFFOnzeit
IFF-Info Nr. 26, 2003 - IFFOnzeit
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Geschlecht in Behandlungsangeboten sozialpsychiatrischer Versorgungseinrichtungen<br />
terstützungsleistung der psychosozialen<br />
Einrichtungen deutlich machen.<br />
Fazit<br />
Grundsätzlich bestätigen die Befragungsergebnisse<br />
die Notwendigkeit<br />
einer Geschlechterorientierung innerhalb<br />
der post-stationären psychiatrischen<br />
Versorgung. Deutlich wird,<br />
dass die ambulante sozialpsychiatrische<br />
Arbeit mit Frauen und<br />
Männer eine tertiäre Sozialisationsarbeit<br />
ist, die nicht nur die eigene<br />
Identität stützen, sondern vor allem<br />
eine selbstbewusste, selbstbestimmte<br />
Organisation des Alltagslebens ermöglichen<br />
soll. Damit eine solche<br />
Hilfestellung neue Handlungsmöglichkeiten<br />
bezüglich der eigenen<br />
Kompetenzen zu entdecken und<br />
entwickeln hilft, bedarf es einer geschlechtersensiblen<br />
Haltung auf Seiten<br />
der BetreuerInnen, um eine<br />
Kongruenz zwischen der eigenen<br />
geschlechtlichen Rolle und dem ICH<br />
auf Seiten der Betreuten zu fördern.<br />
Unsere Ergebnisse verweisen auf<br />
eine notwendige Reflexion:<br />
• zum einen auf einer gesellschaftliche<br />
Ebene, die latent wirksam<br />
ist,<br />
• zum anderen auf einer individuellen<br />
Ebene, auf der die Betroffenen<br />
ihre Konflikt-Bewältigungs-Strategien<br />
und Handlungsmuster<br />
entwickelt haben.<br />
Eine geschlechtersensible Handlungsebene<br />
verbindet diese beiden<br />
Aspekte, sie versucht auf der intellektuellen<br />
Ebene die gesellschaftliche<br />
Rollenverteilung bewusst zu machen,<br />
die Positionierung der/des<br />
Klientin bzw. Klienten als Frau oder<br />
Mann zu reflektieren und die strukturellen<br />
Bedingungen durchsichtig<br />
zu machen. Über dieses intellektuelle<br />
Begreifen kann auf der individuellen<br />
Ebene eine weitergehende Förderung<br />
und Erarbeitung der brachliegenden<br />
Ressourcen stattfinden.<br />
Eine Ressourcen-betonte Arbeit ist<br />
an dieser Stelle einer Defizit-orientierten<br />
vorzuziehen. Sie folgt dem<br />
Gedanken einer ganzheitlichen Anerkennung<br />
der Person und findet<br />
sich am ehesten im methodischen<br />
Konzept des Empowerments. Die<br />
Umsetzung dieses methodischen<br />
Prinzips im sozialpsychiatrischen<br />
Hilfebereich, verbunden mit der<br />
Verwirklichung der geforderten geschlechterspezifischen<br />
Betreuung<br />
macht die Qualität von Sozialer Arbeit<br />
erst aus und drückt sich letztlich<br />
auch im Selbstwertgefühl und<br />
der Stabilität der betreuten KlientInnen<br />
aus.<br />
Vergleicht man die Gruppe der<br />
befragten Frauen mit jener der befragten<br />
Männer, so lässt sich erkennen,<br />
dass bei den Frauen ein stärkeres<br />
„Geschlechterbewusstsein“ existiert.<br />
Von ihnen werden sehr viel<br />
mehr frauenspezifische Problemlagen,<br />
die sie im Laufe ihres Lebens<br />
belastet haben, aufgeführt als von<br />
den Männern. Diese bleiben „sachlich“,<br />
sie schilderten ihre Probleme<br />
eher beiläufig verpackt, sind sich der<br />
Rollenspezifik weniger bewusst.<br />
Diese rollenspezifische Ausrichtung<br />
findet sich ebenfalls in den Interviews<br />
mit den professionellen Betreuern.<br />
Die tabellarische Zusammenstellung<br />
der vorgefundenen<br />
Sozialisationsmuster der NutzerInnen<br />
macht die Geschlechterdifferenz<br />
der Befragten deutlich. Es sind<br />
Differenzen, die aktuell – wie die<br />
Ergebnisse zeigen – wenig Berücksichtigung<br />
finden, jedoch in einer<br />
Ressourcen-orientierten Betreuungsarbeit<br />
respektiert werden müssen.<br />
Betrachtet man die Verbesserungswünsche<br />
der Befragten, so erklären<br />
Frauen wie Männer, dass eine<br />
intensivere Betreuung, d.h. mehr<br />
Kontakte und Gespräche, von der<br />
Mehrheit gewünscht werden. Die<br />
Anteilnahme der Betreuungspersonen<br />
sollte sich nicht nur auf das Notwendige<br />
reduzieren, sie sollte umfassender<br />
den Menschen in seinem<br />
ganzen sozialen Radius erfassen.<br />
Konsens bestand auch im Wunsch,<br />
eine/n BetreuerIn eigener Wahl bestimmen<br />
zu können; meist wünschten<br />
sich die Betroffenen eine/n BetreuerIn<br />
des eigenen Geschlechtes.<br />
Hilfen zur Unterstützung einer stabilen<br />
eigenen weiblichen oder<br />
männlichen Identität wünschen sich<br />
beide Geschlechter. Darüber hinaus<br />
wünschen sich Frauen Halt und<br />
Unterstützung bei der Entwicklung<br />
ihrer Autonomie; Männer dagegen<br />
wünschen Hilfe und Unterstützung<br />
zum Verhalten im sozialen Raum<br />
und in der Interaktion mit Frauen.<br />
Damit zielen die Wünsche beider<br />
Geschlechter auf eine Überwindung<br />
traditioneller Geschlechterrollen.<br />
Als Fazit beider Untersuchungsteile,<br />
der quantitativen sowie qualitativen<br />
Erhebung, lassen sich folgende<br />
Aussagen festhalten:<br />
• Die Ergebnisse belegen das Fortbestehen<br />
des sogenannten ambulanten<br />
Ghettos, eine soziale und<br />
berufliche Integration psychisch<br />
kranker Frauen und Männer in<br />
die Gesellschaft findet nicht statt.<br />
Dadurch kommt dem Betreuungspersonal<br />
in den gemeindepsychiatrischen<br />
Einrichtungen die<br />
Rolle wichtiger Bezugspersonen<br />
und Sozialisationsagenten zu,<br />
ohne dass sie dafür ausgebildet<br />
wären.<br />
• In vielen Bereichen konnten Defizite<br />
innerhalb der Lebensqualität<br />
unserer Befragten aufgezeigt<br />
werden – so im Hinblick auf die<br />
finanzielle Situation, die sozialen<br />
Kontakte, das Sexualleben, die<br />
Betreuungssituation.<br />
• Aussagen zur Lebenszufriedenheit<br />
stehen im Zusammenhang<br />
mit einer Adaptation an die marginale<br />
Lebensrolle in gemeindepsychiatrischen<br />
Einrichtungen,<br />
weniger mit dem Erwerb einer<br />
autonomen integrierten Position<br />
<strong>Info</strong> 20.Jg. <strong>Nr</strong>.<strong>26</strong>/<strong>2003</strong><br />
43