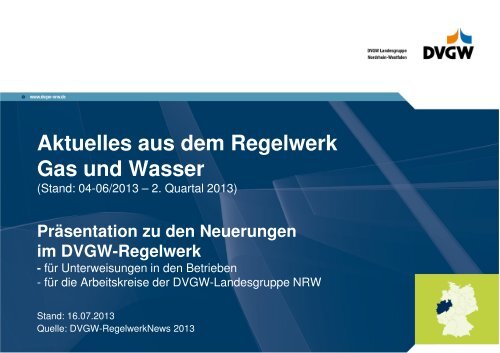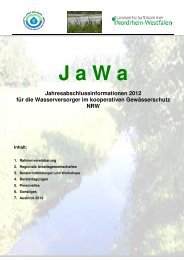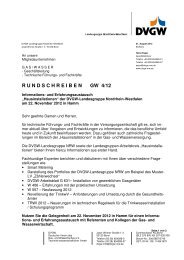Download
Download
Download
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Aktuelles aus dem Regelwerk<br />
Gas und Wasser<br />
(Stand: 04-06/2013 – 2. Quartal 2013)<br />
Präsentation zu den Neuerungen<br />
im DVGW-Regelwerk<br />
- für Unterweisungen in den Betrieben<br />
- für die Arbeitskreise der DVGW-Landesgruppe NRW<br />
Stand: 16.07.2013<br />
Quelle: DVGW-RegelwerkNews 2013
Erläuterungen<br />
Die nachfolgende Präsentation über Neuerungen im DVGW-Regelwerk kann im Rahmen von Unterweisungen<br />
in den Gas- und Wasserversorgungsunternehmen sowie in Fachunternehmen genutzt werden.<br />
Grundlage der Präsentation sind die Inhalte des regelmäßig erscheinenden kostenlosen DVGW-Newsletter<br />
"RegelwerkNews„, der i. d. R. monatlich über Neuerscheinungen des DVGW-Regelwerks informiert.<br />
Newsletter abonnieren<br />
Sie ist gleichzeitig als Information für die Arbeitskreise der DVGW-Landesgruppe NRW zur Behandlung in<br />
den jeweiligen Arbeitskreissitzungen vorgesehen. Mit den Kennzeichnungen im Inhaltsverzeichnis nach der<br />
untenstehenden Legende wird die Zuordnung zu den jeweiligen Arbeitskreisen bzw. zu relevanten<br />
Organisationseinheiten im Unternehmen dargestellt.<br />
2<br />
Abk.<br />
BM<br />
GW<br />
HI<br />
IG<br />
LW/WW<br />
OF<br />
IW<br />
KOK<br />
WW<br />
WWS<br />
Arbeitskreis<br />
Baustellenmanagement<br />
Gas-Wasser-Versorgung<br />
Hausinstallation<br />
Industriegasanlagen<br />
Landwirtschaft / Wasserwirtschaft<br />
Organisationsfragen<br />
Wasserversorgung in Industrie und Gewerbe<br />
DVGW-Koordinierungskreis West<br />
Wasserwerksbetrieb<br />
WWS-Beirat
Inhaltsverzeichnis [1/4]<br />
AK<br />
Regelwerks-Nr. / Thema<br />
GW G 265-1 Entwurf "Anlagen für die Aufbereitung und Einspeisung von Biogas in<br />
Gasversorgungsnetze - Teil 1: Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung und<br />
Inbetriebnahme" - Ausgabe 6/13<br />
GW G 403 „Entscheidungshilfen für die Instandhaltung von Gasverteilungsnetzen“<br />
- Ausgabe 3/13<br />
GW G 686 "Mengenermittlung an Netzkopplungspunkten (NKP) zwischen Netzbetreibern"<br />
- Ausgabe 7/13<br />
3
Inhaltsverzeichnis [2/4]<br />
AK<br />
GW<br />
GW<br />
GW<br />
GW<br />
GW<br />
GW<br />
Regelwerks-Nr. / Thema<br />
GW 20 Entwurf „Kathodischer Korrosionsschutz in Mantelrohren im Kreuzungsbereich<br />
mit Verkehrswegen Produktrohre aus Stahl im Vortriebsverfahren; textgleich mit AfK-<br />
Empfehlung Nr. 1“ - Ausgabe 4/13<br />
GW 21 Entwurf „Beeinflussung von unterirdischen metallischen Anlagen durch Streuströme<br />
von Gleichstromanalgen; textgleich mit AfK-Empfehlung Nr. 2“ - Ausgabe 4/13<br />
GW 22 Entwurf "Maßnahmen beim Bau und Betrieb von Rohrleitungen im<br />
Einflussbereich von Hochspannungs-Drehstromanlagen und Wechselstrom-<br />
Bahnanlagen" - Ausgabe 5/13<br />
GW 24 Entwurf "Kathodischer Korrosionsschutz in Verbindung mit explosionsgefährdeten<br />
Bereichen; textgleich mit AfK-Empfehlung Nr. 5" - Ausgabe 4/13<br />
GW 27 Entwurf "Verfahren zum Nachweis der Wirksamkeit des kathodischen<br />
Korrosionsschutzes an erdverlegten Rohrleitungen; textgleich mit AfK-Empfehlung Nr. 10"<br />
- Ausgabe 4/13<br />
GW 28 Entwurf "Beurteilung der Korrosionsgefährdung durch Wechselstrom bei<br />
kathodisch geschützten Stahlrohrleitungen und Schutzmaßnahmen; textgleich mit AfK-<br />
Empfehlung Nr. 11" - Ausgabe 4/13<br />
4
Inhaltsverzeichnis [3/4]<br />
AK<br />
Regelwerks-Nr. / Thema<br />
GW W 105 Entwurf "Grundsätze und Maßnahmen einer Gewässer schützenden<br />
Waldbewirtschaftung" - Ausgabe 6/13<br />
GW W 408-B1 "Anschluss von Entnahmevorrichtungen an Hydranten in Trinkwasserverteilungsanlagen<br />
- Beiblatt 1: Hinweise zu Standrohren mit Entnahmevorrichtung„<br />
- Ausgabe 5/13<br />
GW W 619 Entwurf "Unterwasserpumpen in der Wasserversorgung"<br />
- Ausgabe 7/13<br />
GW W 651 "Dosieranlagen für Pulveraktivkohle in der Trinkwasseraufbereitung"<br />
- Ausgabe 4/13<br />
5
Inhaltsverzeichnis [4/4]<br />
AK<br />
GW<br />
Regelwerks-Nr. / Thema<br />
VDI/DVGW 6023 "Hygiene in Trinkwasser-Installationen - Anforderungen an Planung,<br />
Ausführung, Betrieb und Instandhaltung„ - Ausgabe 4/13<br />
6
DIN-Normen<br />
AK<br />
GW<br />
GW<br />
GW<br />
Regelwerks-Nr. / Thema<br />
DIN EN 12007-3 Entwurf "Gasinfrastruktur - Rohrleitungen mit einem maximal<br />
zulässigen Betriebsdruck bis einschließlich 16 bar - Teil 3: Besondere funktionale<br />
Anforderungen für Stahl" - Entwurf April 2013<br />
DIN EN 1949 "Festlegung für die Installation von Flüssiggasanlagen in bewohnbaren<br />
Freizeitfahrzeugen und zu Wohnzwecken in anderen Fahrzeugen„ - Ausgabe Mai 2013<br />
DIN EN 12186 Entwurf "Gas-Infrastruktur - Gas-Druckregelanlagen für Transport und<br />
Verteilung - Funktionale Anforderungen" - Ausgabe Mai 2013<br />
GW DIN EN 12732 "Gasinfrastruktur - Schweißen von Rohrleitungen aus Stahl -<br />
Funktionale Anforderungen„ - Ausgabe Juli 2013<br />
7
G 265-1 Entwurf "Anlagen für die Aufbereitung und Einspeisung von Biogas in<br />
Gasversorgungsnetze - Teil 1: Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung und<br />
Inbetriebnahme" - Ausgabe 6/13 [1/3]<br />
Der vorliegende Entwurf Juni 2013 des DVGW-Arbeitsblattes G 265-1 ist als Ersatz<br />
für die DVGW-Prüfgrundlage VP 265-1 vorgesehen. Nachdem die DVGW-Prüfgrundlage<br />
VP 265-1 fast fünf Jahre bei Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung und<br />
Inbetriebnahme von Biogas-Aufbereitungs- und Biogas-Einspeiseanlagen zur<br />
Anwendung gekommen ist, wurde diese Prüfgrundlage grundlegend überarbeitet und<br />
in das nun als Entwurf vorliegende Arbeitsblatt G 265-1 überführt.<br />
Ziel war es, die praktischen Erfahrungen bei der Anwendung der Prüfgrundlage in<br />
das vorliegende Arbeitsblatt einfließen zu lassen. Außerdem wurden Anpassungen<br />
an geänderte Gesetze (EnWG und BImSchG), Verordnungen (z. B. GasNZV,<br />
GasHDrLtgV, 4. BImSchV), berufsgenossenschaftliche Vorschriften und Regeln<br />
sowie Regeln der Technik vorgenommen.<br />
8
G 265-1 Entwurf "Anlagen für die Aufbereitung und Einspeisung von Biogas in<br />
Gasversorgungsnetze - Teil 1: Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung und<br />
Inbetriebnahme" - Ausgabe 6/13 [2/3]<br />
Der Anwendungsbereich des Arbeitsblattes wurde um Rückspeiseanlagen erweitert.<br />
Ebenso wurden Biogase aus nicht fermentativen Quellen, wie z. B. aus Wasserstoff<br />
synthetisch erzeugtes Methan, die hinsichtlich ihrer stofflichen Bestandteile und<br />
gastechnischen Kenndaten den Anforderungen der DVGW-Arbeitsblätter G 260 und<br />
G 262 entsprechen, in den Anwendungsbereich mit aufgenommen.<br />
In diesem DVGW-Arbeitsblatt sind die Mindestanforderungen an die technische<br />
Sicherheit, der zur Nutzbarmachung des Biogases - von der Aufbereitungsanlage<br />
über die Verdichtung, Druckregelung, Konditionierung und Messung bis zur Einspeisung<br />
in das Gasversorgungsnetz als Zusatz- bzw. Austauschgas - erforderlichen<br />
Anlage und deren Komponenten, zusammenfassend dargestellt. Dabei wurde ein<br />
Schwerpunkt auf die notwendigen Abstimmungen zwischen den in der Regel unterschiedlichen<br />
Betreibern der Anlagen gelegt.<br />
9
G 265-1 Entwurf "Anlagen für die Aufbereitung und Einspeisung von Biogas in<br />
Gasversorgungsnetze - Teil 1: Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung und<br />
Inbetriebnahme" - Ausgabe 6/13 [3/3]<br />
Die Anforderungen an Verdichter können sinngemäß auch für die der Biogasaufbereitungsanlage<br />
vorgeschalteten Gebläse angewendet werden. Hinsichtlich der<br />
Anforderungen an die Einspeisung von Biogas in Netze zur Versorgung der Allgemeinheit<br />
mit Gas, sind unter anderem die DVGW-Arbeitsblätter G 260, G 262 und G<br />
2000 zu beachten.<br />
10
G 403 „Entscheidungshilfen für die Instandhaltung von Gasverteilungsnetzen“<br />
- Ausgabe 3/13 [1/2]<br />
Gasverteilungsnetze müssen durch rechtzeitige und kontinuierliche Maßnahmen in<br />
einem Zustand gehalten werden, der die technische Sicherheit und Zuverlässigkeit<br />
gewährleistet. Für die Planung der Instandhaltungsmaßnahmen und die Entwicklung<br />
unternehmensinterner Strategien ist die Erhebung wesentlicher Netzdaten notwendig.<br />
Das DVGW-Arbeitsblatt G 402 "Netz und Schadenstatistik - Erfassung und Auswertung<br />
von Daten zum Aufbau von Instandhaltungsstrategien für Gasverteilungsnetze"<br />
beschreibt die Erfassung und Auswertung von Netzdaten zum Aufbau einer Instandhaltungsstrategie<br />
für Gasverteilungsnetze und die grundsätzliche Vorgehensweise für<br />
die Entwicklung einer Instandhaltungsstrategie.<br />
Das DVGW-Merkblatt G 403 baut inhaltlich auf dem DVGW-Arbeits-blatt G 402 auf<br />
und stellt ergänzend dazu dar, wie diese Netzdaten für den Aufbau einer unternehmensindividuellen<br />
Instandhaltungsstrategie verwendet werden können.<br />
11
G 403 „Entscheidungshilfen für die Instandhaltung von Gasverteilungsnetzen“<br />
- Ausgabe 3/13 [2/2]<br />
Der Hauptteil des DVGW-Merkblatts G 403 vermittelt die wesentlichen Grundlagen<br />
und Arbeitsschritte, die bei einer langfristigen Instandhaltungsstrategie und einer<br />
mittelfristigen Instandhaltungsplanung zu beachten sind. Anhand eines Beispielnetzes<br />
werden in den Anhängen die langfristige Instandhaltungsstrategie, die<br />
mittelfristige Instandhaltungsplanung und die sich daraus er-gebenden kurzfristigen<br />
Instandhaltungsmaßnahmen detaillierter entwickelt. Hierbei wurde darauf geachtet,<br />
dass die einzelnen Berechnungsschritte für den Anwender nachvollziehbar sind. Der<br />
langfristigen Instandhaltungsstrategie liegen statistische Verfahren (z. B. Ausfallfunktionen)<br />
zu Grunde. Die Ableitung dieser Funktionen aus den vorhandenen<br />
Bestands- und Schadensdaten werden im Beispiel ebenfalls erläutert.<br />
12
G 686 "Mengenermittlung an Netzkopplungspunkten (NKP) zwischen Netzbetreibern"<br />
- Ausgabe 7/13 [1/2]<br />
Das Merkblatt wendet sich an benachbarte Netzbetreiber und soll Lösungen anbieten,<br />
die es beiden Parteien erlauben, eine gemeinsame Basis für die Mengenermittlung<br />
am Netzkopplungspunkt zu schaffen, insbesondere für den Prozess der<br />
Datenmeldung an den Marktgebietsverantwortlichen zur Berechnung des Netzkontos.<br />
Die Messanlagen an Netzkopplungspunkte sind Messstellen an Netzübergängen<br />
zwischen zwei Netzbetreibern. Sie sind in der Regel durch höhere Durchflussmengen,<br />
höhere Druckbereiche (potentielle K-Zahl-Korrektur nach G 486), den<br />
Einsatz von Mengenumwertern sowie eine umfangreiche Messdatenregistrierung<br />
gekennzeichnet. Als Abrechnungszeitspanne gilt in der Regel der Monat. Die<br />
Zeitbasis zur Festlegung des Gastages und Monats ist in den Geschäftsprozessen<br />
für das Bilanzkreismanagement Gas definiert. Die Mengenermittlung an den<br />
Netzkopplungspunkten ist in den DVGW-Regelwerken nicht vollständig definiert. Das<br />
DVGW Merkblatt G 686 (M) "Mengenermittlung an Netzkopplungspunkten (NKP)<br />
zwischen Netzbetreibern" soll den vor- und nachgelagerten Netzbetreibern eine<br />
Handlungsempfehlung zur Abstimmung der an den Netzkopplungspunkten<br />
geflossenen Gasmengen sein, um bei der Berechnung der thermischen Energie zum<br />
gleichen 13 Ergebnis zu kommen.
G 686 "Mengenermittlung an Netzkopplungspunkten (NKP) zwischen Netzbetreibern"<br />
- Ausgabe 7/13 [2/2]<br />
Im Rahmen der Geschäftsprozesse für das Bilanzkreismanagement Gas sind<br />
Netzbetreiber verpflichtet, zwischen dem vorgelagerten Netzbetreiber (vgNB) und<br />
dem nachgelagerten Netzbetreiber (ngNB) abgestimmte Zeitreihen auf Stundenbasis<br />
für die Netzkopplungspunkte (NKP) marktgebietsscharf an den Marktgebietsverantwortlichen<br />
(MGV) zu senden. Durch die beschriebene Mengenabstimmung am<br />
Netzkopplungspunkt in der zweiten Auflage des DVGW Merkblatt G 686 (M) wird<br />
bewirkt, dass eine abgestimmte netzkopplungspunktscharfe Energiezeitreihe für<br />
nachgelagerte Prozesse (z. B. Netznutzungsabrechnung, Überwachung der internen<br />
Bestellung, interne und externe Anfragen, Netzkontoprozess) verwendet wird. Dabei<br />
sind die Fristen gemäß der Kooperationsvereinbarung Gas (KoV) und des<br />
BDEW/VKU/GEODE-Leitfadens "Geschäftsprozesse Bilanzkreismanagement Gas"<br />
einzuhalten.<br />
14
GW 20 Entwurf „Kathodischer Korrosionsschutz in Mantelrohren im<br />
Kreuzungsbereich mit Verkehrswegen Produktrohre aus Stahl im Vortriebsverfahren;<br />
textgleich mit AfK-Empfehlung Nr. 1“ - Ausgabe 4/13 [1/2]<br />
Dieses Arbeitsblatt gibt aus korrosionsschutztechnischer Sicht Hinweise für die<br />
Planung, die Inbetriebnahme und die messtechnische Überwachung einer kathodisch<br />
geschützten Produktleitung, die in einem Mantelrohr verlegt ist.<br />
Für die Überarbeitung waren die folgenden Überlegungen ausschlaggebend:<br />
• Neben Mantelrohren aus Stahl werden in der Praxis häufig Mantelrohre aus<br />
Kunststoff oder Beton bzw. Stahlbeton eingesetzt. Diese Materialien werden in der<br />
vorliegenden Überarbeitung bezüglich ihres Einflusses auf den Korrosionsschutz<br />
des Produktrohres berücksichtigt<br />
• Der Einfluss eines Mantelrohres auf die Wechselstrom-Korrosionsgefährdung des<br />
Produktrohres sollte aufgegriffen werden<br />
• Erfahrungen mit zement- und kunststoffartigen Verfüllmaterialien für den Ringraum<br />
sollten in dieses neue Arbeitsblatt einfließen<br />
15
GW 20 Entwurf „Kathodischer Korrosionsschutz in Mantelrohren im<br />
Kreuzungsbereich mit Verkehrswegen Produktrohre aus Stahl im Vortriebsverfahren;<br />
textgleich mit AfK-Empfehlung Nr. 1“ - Ausgabe 4/13 [2/2]<br />
• Es liegen neue Erkenntnisse zur Bewertung des kathodischen Korrosionsschutzes<br />
des Produktrohres vor. Diese werden in dem über-arbeiteten Arbeitsblatt ausführlich<br />
beschrieben<br />
• Vor dem Hintergrund der Ausführungen im DVGW-Arbeitsblatt GW 20 textgleich<br />
mit der der AfK-Empfehlung Nr.10 mussten die Mess-vorschriften für die Prüfung<br />
des kathodischen Schutzes von Rohren, die mit grabenlosen Verlegeverfahren<br />
eingebracht wurden, angepasst werden<br />
• Es sollten die Maßnahmen zusammengestellt werden, die ergriffen werden<br />
können, wenn der kathodische Korrosionsschutz des Produktrohres im Mantelrohr<br />
nicht ausreichend wirksam ist<br />
• Weiterhin wurden in dieses Arbeitsblatt Hinweise eingearbeitet zur Überprüfung<br />
der Umhüllungsqualität eines Produktrohres, das z. B. im Rahmen einer Neubaumaßnahme<br />
in ein Mantelrohr eingezogen wurde. Dies wurde als notwendig erachtet,<br />
weil in der Vergangenheit Fälle bekannt wurden, bei denen es während<br />
des Einzugsvorganges zu Umhüllungsfehlstellen am Produktrohr gekommen war.<br />
16
GW 21 Entwurf „Beeinflussung von unterirdischen mitallischen Anlagen durch<br />
Streuströme von Gleichstromanalgen; textgleich mit AfK-Empfehlung Nr. 2“<br />
- Ausgabe 4/13 [1/4]<br />
Dieses Arbeitsblatt befasst sich mit der Beeinflussung erdverlegter metallischer<br />
Objekte durch Streuströme aus Gleichstromanlagen. Dabei gibt es Hinweise über die<br />
Grundlagen, Kriterien und messtechnische Beurteilung der Streustrombeeinflussung<br />
und beschreibt Maßnahmen zur Verhinderung schädlicher Beeinflussung von erdverlegten<br />
metallischen Objekten. Dabei wird ausschließlich das Thema Außenkorrosion<br />
betrachtet. Das Thema Innenkorrosion im Zusammenhang mit der Beeinflussung<br />
erdverlegter metallischer Objekte durch Streuströme aus Gleichstromanlagen<br />
ist nicht Thema dieses Arbeitsblattes.<br />
Ebenfalls nicht Thema dieses Arbeitsblattes ist die Beeinflussung erdverlegter<br />
metallischer Objekte durch Streuströme aus Wechselstromanlagen.<br />
17
GW 21 Entwurf „Beeinflussung von unterirdischen mitallischen Anlagen durch<br />
Streuströme von Gleichstromanalgen; textgleich mit AfK-Empfehlung Nr. 2“<br />
- Ausgabe 4/13 [2/4]<br />
Für die Überarbeitung des Arbeitsblattes waren die folgenden Überlegungen ausschlaggebend:<br />
• Seit der Ablösung von DIN VDE 0150 durch DIN EN 50162 existieren neue Beeinflussungskriterien.Diese<br />
werden in diesem Arbeitsblatt praxisgerecht dargestellt<br />
• Die von der Technischen Akademie in Wuppertal in den 90er Jahren des letzten<br />
Jahrhunderts entwickelten Mess- und Beurteilungsmethoden hinsichtlich des<br />
Nachweises einer unzulässigen Beeinflussung durch zeitlich veränderliche Streuströme<br />
sind in dieses Arbeitsblatt mit eingeflossen<br />
• Durch die gleichzeitige Überarbeitung von DIN EN 50122-2 konnte sichergestellt<br />
werden, dass zumindest in Deutschland im Falle der Streustrombeeinflussung<br />
durch zeitlich veränderliche Streuströme sowohl die Bahnbetreiber als auch die<br />
Rohrleitungs- und Tankanlagenbetreiber dieselben Mess- und Beurteilungsmethoden<br />
bei der Beurteilung einer möglichen Beeinflussung anwenden<br />
18
GW 21 Entwurf „Beeinflussung von unterirdischen mitallischen Anlagen durch<br />
Streuströme von Gleichstromanalgen; textgleich mit AfK-Empfehlung Nr. 2“<br />
- Ausgabe 4/13 [3/4]<br />
Für die Überarbeitung des Arbeitsblattes waren die folgenden Überlegungen ausschlaggebend:<br />
• Seit der Ablösung von DIN VDE 0150 durch DIN EN 50162 existieren neue Beeinflussungskriterien.<br />
Diese werden in diesem Arbeitsblatt praxisgerecht dargestellt<br />
• Die von der Technischen Akademie in Wuppertal in den 90er Jahren des letzten<br />
Jahrhunderts entwickelten Mess- und Beurteilungsmethoden hinsichtlich des<br />
Nachweises einer unzulässigen Beeinflussung durch zeitlich veränderliche Streuströme<br />
sind in dieses Arbeitsblatt mit eingeflossen<br />
• Durch die gleichzeitige Überarbeitung von DIN EN 50122-2 konnte sichergestellt<br />
werden, dass zumindest in Deutschland im Falle der Streustrombeeinflussung<br />
durch zeitlich veränderliche Streuströme sowohl die Bahnbetreiber als auch die<br />
Rohrleitungs- und Tankanlagenbetreiber dieselben Mess- und Beurteilungsmethoden<br />
bei der Beurteilung einer möglichen Beeinflussung anwenden<br />
19
GW 21 Entwurf „Beeinflussung von unterirdischen mitallischen Anlagen durch<br />
Streuströme von Gleichstromanalgen; textgleich mit AfK-Empfehlung Nr. 2“<br />
- Ausgabe 4/13 [4/4]<br />
• Die Grundlagen der Beeinflussung werden ausführlich dargestellt und die<br />
Schwierigkeiten beim messtechnischen Nachweis einer möglichen unzulässigen<br />
Beeinflussung umfassend beschrieben<br />
• Die früher in der AfK-Empfehlung Nr. 9 beschriebenen Spannungstrichterberechnungen<br />
von Anodenanlagen werden nun in diesem Arbeitsblatt dargestellt<br />
• Es werden Maßnahmen zur Verhinderung schädlicher Beeinflussung von erdverlegten<br />
metallischen Objekten durch Streuströme aus Gleichstromanlagen<br />
beschrieben<br />
20
GW 22 Entwurf "Maßnahmen beim Bau und Betrieb von Rohrleitungen im<br />
Einflussbereich von Hochspannungs-Drehstromanlagen und Wechselstrom-<br />
Bahnanlagen" - Ausgabe 5/13 [1/1]<br />
Als erste Technische Regel zum Themenbereich "Hochspannungsbeeinflussung"<br />
erschien im Januar 1966 die Empfehlung "Maßnahmen beim Bau und Betrieb von<br />
Rohrleitungen im Einflussbereich von Hochspannungsfreileitungen (Richtlinien für<br />
hochspannungsbeeinflusste Rohrleitungen)", welche nach intensiven Beratungen<br />
eines Arbeitskreises erstellt und textgleich als Technische Empfehlung Nr. 7 (TE 7)<br />
der Schiedsstelle für Beeinflussungsfragen (SfB) und als Empfehlung Nr. 3 der<br />
Arbeitsgemeinschaft für Korrosionsfragen (AfK-3) veröffentlicht wurde.<br />
21
GW 24 Entwurf "Kathodischer Korrosionsschutz in Verbindung mit<br />
explosionsgefährdeten Bereichen; textgleich mit AfK-Empfehlung Nr. 5"<br />
Ausgabe 4/13 [1/2]<br />
Dieses Arbeitsblatt behandelt allgemeine Richtlinien und Maßnahmen zur Vermeidung<br />
von Zündgefahren an Isolierstücken und zur Sicherstellung eines kathodischen<br />
Korrosionsschutzes in explosionsgefährdeten Bereichen. Es ist anwendbar<br />
auf Stationen von Erdgas-Leitungssystemen und - unter Beachtung der jeweils<br />
gültigen Vorschriften (z. B. TRbF, TRBS, TRGS, BetrSichV) - sinngemäß auch für<br />
andere Produktleitungen.<br />
Isolierstücke dienen der elektrischen Trennung von Rohrleitungsanlagen - z. B. zur<br />
Sicherstellung des kathodischen Korrosionsschutzes (Trennung KKS-geschützter<br />
Anlagen vom geerdeten Stationssystem), zur elektrischen Aufteilung längerer<br />
Rohrleitungssysteme an Eigentums- bzw. KKS-Schutzbereichsgrenzen oder - in<br />
selteneren Fällen - zur elektrischen Aufteilung hochspannungsbeeinflusster<br />
Rohrleitungsabschnitte. Die elektrische Trennung besteht bis zur Durchschlagfestigkeit<br />
des Isolierstücks.<br />
22
GW 24 Entwurf "Kathodischer Korrosionsschutz in Verbindung mit<br />
explosionsgefährdeten Bereichen; textgleich mit AfK-Empfehlung Nr. 5"<br />
Ausgabe 4/13 [2/2]<br />
Diese Durchschlagfestigkeit kann - z. B. in Abhängigkeit von dem durchströmenden<br />
Medium, der Einbaulage und den äußeren atmosphärischen Einflüssen - unter<br />
Umständen auch mit zunehmender Betriebsdauer abnehmen. Es ist aber davon<br />
auszugehen, dass blitzbedingte Überspannungen infolge eines Einschlages in<br />
exponierte Teile einer Pipelineanlage zu einer Überbeanspruchung der Durchschlagfestigkeit<br />
von Isolierstücken führen können. Bei Isolierstücken kathodisch geschützter<br />
Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen sind zur Vermeidung von Zündgefahren<br />
besondere Vorkehrungen zu treffen. Solche Gefahren können infolge Funkenbildung<br />
durch elektrische Anlagen oder durch Blitzeinwirkungen entstehen. Des Weiteren<br />
sind Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des kathodischen Korrosionsschutzes<br />
erforderlich.<br />
23
GW 27 Entwurf "Verfahren zum Nachweis der Wirksamkeit des kathodischen<br />
Korrosionsschutzes an erdverlegten Rohrleitungen; textgleich mit AfK-Empfehlung<br />
Nr. 10" - Ausgabe 4/13 [1/2]<br />
Nach DIN EN 12954 muss bei vollständigem kathodischen Korrosionsschutz das<br />
Schutzkriterium an jedem Messpunkt des Schutzobjektes, d. h. an jeder Fehlstelle<br />
seiner Umhüllung erfüllt sein.<br />
In dem Bemühen aufzuzeigen, wie dies unter Berücksichtigung der bekannten<br />
physikalischen Grundlagen mit eingeführten und neueren Messverfahren in der<br />
Praxis weitgehend nachgewiesen werden kann, wurde DIN EN 13509 erarbeitet. In<br />
den Fällen, in denen die beschriebenen Messmethoden oder die örtlichen Verhältnisse<br />
die Ermittlung der notwendigen Daten in nicht hinreichendem, aussagefähigem<br />
Maße erlauben, ergeben sich Schwierigkeiten beim Nachweis. Diesbezügliche Problemfälle<br />
stellen die meisten Behälter dar, beispielsweise aber auch Rohrleitungen in<br />
Stadtgebieten, insbesondere bei Vorliegen von zeitlich sich stark ändernder Streustrombeeinflussung<br />
durch z. B. Gleichstrom-Bahnanlagen, Rohrleitungen mit<br />
Schutzmaßnahmen gegen Hochspannungsbeeinflussung und parallel verlaufende<br />
Rohrleitungen.<br />
24
GW 27 Entwurf "Verfahren zum Nachweis der Wirksamkeit des kathodischen<br />
Korrosionsschutzes an erdverlegten Rohrleitungen; textgleich mit AfK-Empfehlung<br />
Nr. 10" - Ausgabe 4/13 [2/2]<br />
Das vorliegende Arbeitsblatt beschreibt weitere Messverfahren, mit denen der<br />
Nachweis des Schutzkriteriums im Sinne von DIN EN 13509 erfolgen kann. Es gibt<br />
darüber hinaus Hinweise über die Zweckmäßigkeit der Anwendung der einzelnen<br />
Verfahren unter verschiedenen Einsatzbedingungen sowie zur Vermeidung von<br />
Fehlmessungen und Fehlinterpretationen der Messergebnisse. Hinsichtlich der<br />
Definition der Begriffe wird auf die beiden zuvor zitierten Normen hingewiesen.<br />
Die beschriebenen Nachweisverfahren sind teils seit langem Stand der Technik (z. B.<br />
Ausschaltpotentialmessungen), teils finden sie zunehmend Anwendung (z. B.<br />
Intensivmessungen), so dass hier Erfahrungen bei der Erarbeitung dieses Arbeitsblattes<br />
berücksichtigt werden konnten. Bei einigen Verfahren (z. B. Potentialgradientenvergleich)<br />
liegen dagegen nur wenige Erfahrungen vor.<br />
25
GW 28 Entwurf "Beurteilung der Korrosionsgefährdung durch Wechselstrom bei<br />
kathodisch geschützten Stahlrohrleitungen und Schutzmaßnahmen; textgleich mit<br />
AfK-Empfehlung Nr. 11" - Ausgabe 4/13 [1/3]<br />
Der Inhalt dieses Entwurfes spiegelt das gemeinsame Verständnis (fachlicher Bearbeitungsstand<br />
2011) unter den für Beeinflussungsfragen und Korrosionsschutz zuständigen<br />
Fachleuten aus den der AfK zugehörigen Verbänden wider. Im Zusammenhang mit der<br />
bevorstehenden europäischen Norm DIN EN 15280 muss erwähnt werden, dass dieses<br />
Arbeitsblatt nicht im Widerspruch zu dieser Norm steht. Das Arbeitsblatt ist in sich als<br />
geschlossenes Dokument zu sehen, welches praxisorientierte Hinweise gibt und die DIN<br />
EN 15280 konkret auf die nationalen Bedürfnisse spezifiziert.<br />
26
GW 28 Entwurf "Beurteilung der Korrosionsgefährdung durch Wechselstrom bei<br />
kathodisch geschützten Stahlrohrleitungen und Schutzmaßnahmen; textgleich mit<br />
AfK-Empfehlung Nr. 11" - Ausgabe 4/13 [2/3]<br />
Ein vertieftes Verständnis der beteiligten Prozesse der Wechselstromkorrosion, unter<br />
Einfluss des kathodischen Korrosionsschutzes, hat aber über längere Zeit gefehlt. Erst<br />
aufgrund jüngerer Labor- und Felduntersuchungen war es möglich ein Modell zu entwickeln,<br />
welches in der Lage ist, alle bisherigen empirischen Beobachtungen zu erklären.<br />
Insbesondere betrifft dies die Befunde zum Einfluss des kathodischen Schutzniveaus<br />
auf die Wechselstrom-Korrosionsgefährdung. Die aktuellen Modellvorstellungen erklären<br />
dann auch die Schutzkriterien, unter deren Einhaltung die Korrosionsgeschwindigkeit auf<br />
ein technisch akzeptierbares Maß verringert werden kann. Mittels umfangreicher Feldversuche<br />
konnten die dem Modell zugrunde liegenden Schutzkriterien in der Praxis<br />
bestätigt bzw. überprüft werden.<br />
27
GW 28 Entwurf "Beurteilung der Korrosionsgefährdung durch Wechselstrom bei<br />
kathodisch geschützten Stahlrohrleitungen und Schutzmaßnahmen; textgleich mit<br />
AfK-Empfehlung Nr. 11" - Ausgabe 4/13 [3/3]<br />
Die Felduntersuchungen zeigten außerdem, dass eine Verringerung der Korrosionsgeschwindigkeit<br />
auf technisch vernachlässigbare Werte < 0,01 mm/a, wie in<br />
DIN EN 12954 als Kriterium für die Anwendung des kathodischen<br />
Korrosionsschutzes angegeben, bei Wechselspannungsbeeinflussung nicht gewährleistet<br />
werden kann. In diesem Arbeitsblatt wird daher bei Einhaltung der genannten<br />
Kriterien bewusst der Begriff "technisch akzeptierbare Korrosionsgeschwindigkeit"<br />
(Korrosionsgeschwindigkeit < 0,03 mm/a) gewählt.<br />
Für die praktische Anwendung einzelner Kriterien werden Mittelwerte empfohlen,<br />
welche mit einer maximal zulässigen Standardabweichung verknüpft sind. Die Werte<br />
wurden aus den Daten der Feldversuche abgeleitet und entsprechen den vorgefundenen<br />
Rahmenbedingungen. Es ist daher möglich, dass sich mit zunehmender<br />
Praxiserfahrung Anpassungsbedarf der statistischen Größen ergibt.<br />
28
W 105 Entwurf "Grundsätze und Maßnahmen einer Gewässer schützenden<br />
Waldbewirtschaftung" - Ausgabe 6/13 [1/2]<br />
Der Entwurf des neuen Arbeitsblattes definiert die Grundsätze einer Gewässer<br />
schützenden Waldbewirtschaftung im Sinne einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft<br />
und benennt Maßnahmen für deren Umsetzung in der Praxis.<br />
Mit den DVGW-Arbeitsblättern W 104 und W 105 enthält das DVGW-Regelwerk nun<br />
zwei vergleichbar strukturierte Regelwerke, welche die Anforderungen des vorsorgenden<br />
Gewässerschutzes an die in den Einzugsgebieten von Wassergewinnungsanlagen<br />
dominierenden Flächennutzungen der Land- und Waldbewirtschaftung<br />
konkretisieren.<br />
Hintergrund dieses Arbeitsblattes ist, dass der Wald laut Bundeswaldgesetz<br />
mehreren Funktionen - Nutz-, Schutz-, und Erholungsfunktion - dient. Die Art und<br />
Weise der Waldbewirtschaftung kann bei der Umsetzung von Maßnahmen zur<br />
Erfüllung dieser Funktionen erhebliche Auswirkungen auf die Qualität und Quantität<br />
von Gewässern, d. h. sowohl Oberflächen- als auch Grundwasser, haben. Daher<br />
kommt der Wasserschutzfunktion eine besondere Bedeutung innerhalb der<br />
ordnungsgemäßen Forstwirtschaft zu.<br />
29
W 105 Entwurf "Grundsätze und Maßnahmen einer Gewässer schützenden<br />
Waldbewirtschaftung" - Ausgabe 6/13 [2/2]<br />
Ziel dieses Arbeitsblattes ist es daher, die Wasserschutzfunktion des Waldes zu<br />
konkretisieren und Notwendigkeiten in der Bewirtschaftung der Wälder zu definieren,<br />
bei deren Einhaltung unter dem Aspekt der Wasserschutzfunktion eine ordnungsgemäße<br />
Forstwirtschaft eingehalten ist.<br />
Das Arbeitsblatt enthält Hinweise und Empfehlungen für Waldbesitzer, Talsperrenbetreiber<br />
und Wasserversorgungsunternehmen sowie wasserwirtschaftliche und forstliche<br />
Fachbehörden für die Planung, Genehmigung, Ausführung und Begleitung<br />
waldbaulicher Aktivitäten.<br />
30
W 408-B1 "Anschluss von Entnahmevorrichtungen an Hydranten in<br />
Trinkwasserverteilungsanlagen - Beiblatt 1: Hinweise zu Standrohren mit<br />
Entnahmevorrichtung" - Ausgabe 5/13 [1/2]<br />
Da das Beiblatt eigentlich "nur" ein "informativer Anhang" des DVGW-Arbeitsblattes<br />
W 408 ist und somit nicht den vergleichsweise verbindlichen Charakter einer<br />
"Technischen Regel" (Arbeitsblatt) aufweist, hätte man diesen Anhang auch einfach<br />
als "Technischen Hinweis" (Merkblatt) und damit ohne Beteiligung der Öffentlichkeit<br />
abschließend veröffentlichen können. Die zuständigen DVGW-Gremien entschieden<br />
sich bewusst für den offenen Weg, um die Akzeptanz, Qualität und Verbreitung des<br />
Beiblatts zu fördern. In der Tat trugen die Stellungnahmen der Fachöffentlichkeit zum<br />
Entwurf des Beiblatts vom Juni 2012 sehr zur Verdeutlichung und Präzisierung bei.<br />
Gleich zu Beginn hebt die endgültige Fassung des DVGW-Arbeitsblattes W 408-B1<br />
"Anschluss von Entnahmevorrichtungen an Hydranten in Trinkwasserverteilungsanlagen<br />
- Beiblatt 1: Hinweise zu Standrohren mit Entnahmevorrichtung" vom Mai<br />
2013 hervor: "Die Relevanz des einzelnen Hinweises richtet sich u.a. nach dem<br />
Verwendungszweck (Trinkwasser, Brauchwasser, Löschwasser etc.) und der damit<br />
verbundenen Beanspruchung, der Verwendungsdauer und Häufigkeit der Wiederverwendung<br />
(Gesamtlebensdauer) sowie der Inspektion, Wartung und ggf. Instandsetzung."<br />
31
W 408-B1 "Anschluss von Entnahmevorrichtungen an Hydranten in<br />
Trinkwasserverteilungsanlagen - Beiblatt 1: Hinweise zu Standrohren mit<br />
Entnahmevorrichtung" - Ausgabe 5/13 [2/2]<br />
Standrohre sind eben keine Bauteile, wie sie etwa in Trinkwasser-Installationen in der<br />
Erwartung eingebaut werden, dass sie mindestens 50 Jahre von der Bildfläche<br />
verschwinden und entsprechend unauffällig ihren Dienst in einer üblicherweise<br />
technisch desinteressierten Laienumgebung verrichten. Vielmehr sind Standrohre<br />
jederzeit sichtbar und man setzt voraus, dass sie nur von unterwiesenen bzw.<br />
fachkundigen Personen gehandhabt werden.<br />
Das Beiblatt deckt alle Aspekte ab, die Standrohre mit Entnahmevorrichtung und ihre<br />
Trinkwassertauglichkeit betreffen, insbesondere:<br />
• Aufbau (Rohr, Sieb, Wasserzähler, Sicherungseinrichtung, Probenahmestelle,<br />
Auslaufventil)<br />
• Werkstoffe (Metalle/Korrosionsbeständigkeit, organische Werkstoffe)<br />
• Handhabung (Instandhaltung, Reinigung/Desinfektion, Lagerung, Transport,<br />
Vorgehensweise bei Beschädigungen)<br />
• Vermietung (vertragliche Aspekte, Unterweisung, Bedienungsanleitung).<br />
32
W 619 Entwurf "Unterwasserpumpen in der Wasserversorgung"<br />
- Ausgabe 7/13 [1/3]<br />
Das Arbeitsblatt W 619 "Unterwasserpumpen in der Wasserversorgung" gilt für den<br />
Einsatz von Pumpen in der Wasserversorgung, die unterhalb der Wasseroberfläche<br />
eingesetzt werden und ergänzt damit die in DVGW W 610 (A) aufgeführten allgemeinen<br />
Grundsätze für Pumpensysteme. Es dient als Grundlage für Auswahl,<br />
Auslegung, Betrieb und Instandhaltung und gibt einen gestrafften Überblick über die<br />
heute verwendeten Unterwasserpumpentypen mit ihren wesentlichen Vor- und<br />
Nachteilen.<br />
33
W 619 Entwurf "Unterwasserpumpen in der Wasserversorgung"<br />
- Ausgabe 7/13 [2/3]<br />
Definiert werden im Arbeitsblatt die Unterwasserpumpen als teilweise oder<br />
vollständig eingetaucht betriebene Kreiselpumpen, mit Antrieb durch<br />
• Unterwassermotor (untergetauchter, wassergefüllter Elektromotor),<br />
vgl. Unterwassermotorpumpe, Polderpumpe, Druckmantelpumpe<br />
• Tauchmotor (untergetauchter, druckwasserdichter, trockenlaufender Motor),<br />
vgl. Tauchmotorpumpe, Rohrschachtpumpe<br />
• trocken aufgestellter Motor (oberhalb der Wasserfläche),<br />
vgl. Bohrlochwellenpumpe, Rohrgehäusepumpe<br />
34
W 619 Entwurf "Unterwasserpumpen in der Wasserversorgung"<br />
Ausgabe 7/13 [3/3]<br />
Wesentliche Inhalte des Arbeitsblattes sind:<br />
• Konstruktive Merkmale und Einsatzgebiete von Unterwasserpumpen<br />
• Planungshinweise<br />
• Montage und Inbetriebnahme<br />
• Betrieb<br />
35
W 651 "Dosieranlagen für Pulveraktivkohle in der Trinkwasseraufbereitung"<br />
Ausgabe 4/13 [1/2]<br />
Das DVGW-Merkblatt W 651 gilt für den Aufbau und die Funktionsweise von<br />
Anlagen zur Herstellung und Dosierung von wässrigen Pulverkohlesuspensionen.<br />
Pulveraktivkohle wird in der Trinkwasseraufbereitung zur Adsorption von störenden<br />
Wasserinhaltsstoffen verwendet. Sie kommt dabei in der Regel als wässrige<br />
Suspension zum Einsatz.<br />
Dem Anwender werden mit dem DVGW-Arbeitsblatt W 651 praxisbezogene<br />
Hinweise zur Auslegung, konstruktiven Gestaltung und zum Betrieb von Anlagen zur<br />
Herstellung und Dosierung wässriger Pulverkohlesuspensionen gegeben.<br />
36
W 651 "Dosieranlagen für Pulveraktivkohle in der Trinkwasseraufbereitung"<br />
Ausgabe 4/13 [2/2]<br />
Das Merkblatt behandelt im Detail den Aufbau und die Funktion der am häufigsten<br />
eingesetzten Anlagen. Wesentliche Inhalte sind hierbei:<br />
• Grundsätzliches zu den Eigenschaften von Pulveraktivkohle<br />
• Transport und Lagerung von Pulveraktivkohle, mit ausführlicher Betrachtung der<br />
Silotechnik<br />
• Herstellprozess von Aktivkohlesuspensionen<br />
• Dosieren von Suspensionen<br />
• Kompaktanlagen zur Dosierung<br />
• Betrieb und Instandhaltung von Anlagen<br />
37
VDI/DVGW 6023 "Hygiene in Trinkwasser-Installationen - Anforderungen an<br />
Planung, Ausführung, Betrieb und Instandhaltung„ - Ausgabe 4/13 [1/2]<br />
Trinkwasserhygiene in Gebäuden hat einen großen Einfluss auf die Gesundheit der<br />
Bewohner. Jedes Jahr erkranken nach Schätzungen des Umweltbundesamts allein<br />
in Deutschland ca. 30.000 Menschen an einer Erkrankung, die durch Legionellen<br />
hervorgerufen wird. Infektionsquellen sind häufig Trinkwasser-Installationen, die<br />
falsch geplant, ausgeführt oder betrieben werden. Wie die Qualität des Trinkwassers<br />
bis hin zur letzten Entnahmestelle gesichert werden kann, zeigt die neue Richtlinie<br />
VDI/DVGW 6023.<br />
Entscheidend ist: Wasser muss fließen und die entsprechende Temperatur haben.<br />
Kaltes Wasser muss kalt, d. h. unter 25 °C bleiben, das Heißwassersystem darf<br />
nirgends kälter als 55 °C sein. Bei Wasser, das länger als 72 Stunden in einer<br />
Trinkwasser-Installation stagniert, kann nicht mehr von einem hygienisch einwandfreien<br />
Zustand ausgegangen werden. Schlimmer noch: Längere und wiederholte<br />
Stagnation in Leitungsteilen kann zu einer Verkeimung der gesamten Trinkwasser-<br />
Installation führen, die aufwendige Sanierungsmaßnahmen erforderlich macht.<br />
38
VDI/DVGW 6023 "Hygiene in Trinkwasser-Installationen - Anforderungen an<br />
Planung, Ausführung, Betrieb und Instandhaltung„ - Ausgabe 4/13 [2/2]<br />
Eine Desinfektion einer einmal verkeimten Trinkwasser-Installation zeigt zumeist<br />
keinen nachhaltigen Erfolg, weil die Ursache der Verkeimung im Layout der Anlage<br />
oder im nicht bestimmungsgemäßen Betrieb zu suchen ist. Die Verantwortung trägt<br />
der Betreiber im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Er muss seine Installation<br />
und deren Schwachstellen kennen und sicherstellen, dass keine Gefahr für die<br />
Nutzer entsteht. Die Bedeutung der Trinkwasser-Installation für gesundes Wohnen<br />
und Arbeiten verlangt eine Verständigung unter allen für Planung, Erstellung, Betrieb<br />
und Instandhaltung verantwortlichen Partnern - vom Hersteller über den Groß- und<br />
Einzelhandel bis hin zum Fachhandwerker und vom Gebäudeeigner oder -vermieter<br />
bis hin zum individuellen Mieter.<br />
Damit alle Beteiligten die nötigen Kenntnisse haben, legt die Richtlinie VDI/DVGW<br />
6023 eine Schulung fest, in der zielgruppengerecht den Planern, Errichtern und<br />
Betreibern das Thema "Trinkwasserhygiene" nahe gebracht wird. Die Richtlinie gilt<br />
für alle Trinkwasser-Installationen auf Grundstücken und in Gebäuden sowie für<br />
ähnliche Anlagen, z.B. auf Schiffen und gibt Hinweise für die Planung, Errichtung,<br />
Inbetriebnahme, Nutzung, Betriebsweise und Instandhaltung aller Trinkwasser-<br />
Installationen.<br />
39