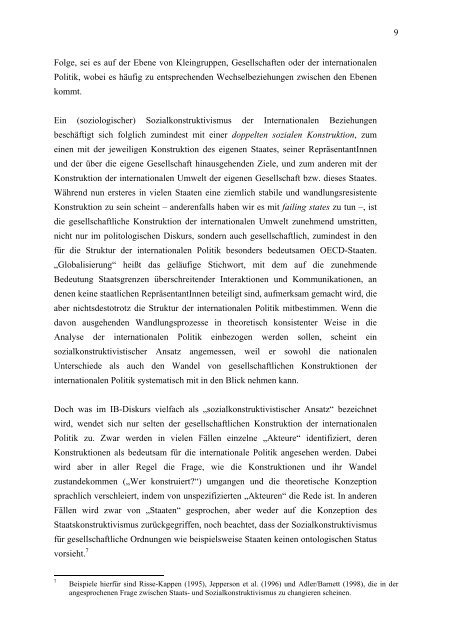Theoretische und erkenntnistheoretische Konsequenzen ...
Theoretische und erkenntnistheoretische Konsequenzen ...
Theoretische und erkenntnistheoretische Konsequenzen ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
9<br />
Folge, sei es auf der Ebene von Kleingruppen, Gesellschaften oder der internationalen<br />
Politik, wobei es häufig zu entsprechenden Wechselbeziehungen zwischen den Ebenen<br />
kommt.<br />
Ein (soziologischer) Sozialkonstruktivismus der Internationalen Beziehungen<br />
beschäftigt sich folglich zumindest mit einer doppelten sozialen Konstruktion, zum<br />
einen mit der jeweiligen Konstruktion des eigenen Staates, seiner RepräsentantInnen<br />
<strong>und</strong> der über die eigene Gesellschaft hinausgehenden Ziele, <strong>und</strong> zum anderen mit der<br />
Konstruktion der internationalen Umwelt der eigenen Gesellschaft bzw. dieses Staates.<br />
Während nun ersteres in vielen Staaten eine ziemlich stabile <strong>und</strong> wandlungsresistente<br />
Konstruktion zu sein scheint – anderenfalls haben wir es mit failing states zu tun –, ist<br />
die gesellschaftliche Konstruktion der internationalen Umwelt zunehmend umstritten,<br />
nicht nur im politologischen Diskurs, sondern auch gesellschaftlich, zumindest in den<br />
für die Struktur der internationalen Politik besonders bedeutsamen OECD-Staaten.<br />
„Globalisierung“ heißt das geläufige Stichwort, mit dem auf die zunehmende<br />
Bedeutung Staatsgrenzen überschreitender Interaktionen <strong>und</strong> Kommunikationen, an<br />
denen keine staatlichen RepräsentantInnen beteiligt sind, aufmerksam gemacht wird, die<br />
aber nichtsdestotrotz die Struktur der internationalen Politik mitbestimmen. Wenn die<br />
davon ausgehenden Wandlungsprozesse in theoretisch konsistenter Weise in die<br />
Analyse der internationalen Politik einbezogen werden sollen, scheint ein<br />
sozialkonstruktivistischer Ansatz angemessen, weil er sowohl die nationalen<br />
Unterschiede als auch den Wandel von gesellschaftlichen Konstruktionen der<br />
internationalen Politik systematisch mit in den Blick nehmen kann.<br />
Doch was im IB-Diskurs vielfach als „sozialkonstruktivistischer Ansatz“ bezeichnet<br />
wird, wendet sich nur selten der gesellschaftlichen Konstruktion der internationalen<br />
Politik zu. Zwar werden in vielen Fällen einzelne „Akteure“ identifiziert, deren<br />
Konstruktionen als bedeutsam für die internationale Politik angesehen werden. Dabei<br />
wird aber in aller Regel die Frage, wie die Konstruktionen <strong>und</strong> ihr Wandel<br />
zustandekommen („Wer konstruiert“) umgangen <strong>und</strong> die theoretische Konzeption<br />
sprachlich verschleiert, indem von unspezifizierten „Akteuren“ die Rede ist. In anderen<br />
Fällen wird zwar von „Staaten“ gesprochen, aber weder auf die Konzeption des<br />
Staatskonstruktivismus zurückgegriffen, noch beachtet, dass der Sozialkonstruktivismus<br />
für gesellschaftliche Ordnungen wie beispielsweise Staaten keinen ontologischen Status<br />
vorsieht. 7<br />
7<br />
Beispiele hierfür sind Risse-Kappen (1995), Jepperson et al. (1996) <strong>und</strong> Adler/Barnett (1998), die in der<br />
angesprochenen Frage zwischen Staats- <strong>und</strong> Sozialkonstruktivismus zu changieren scheinen.